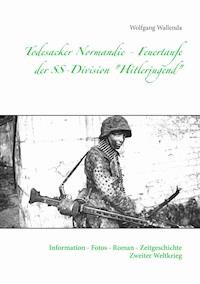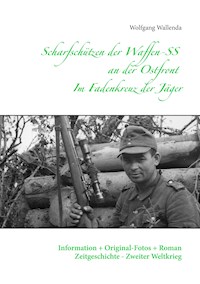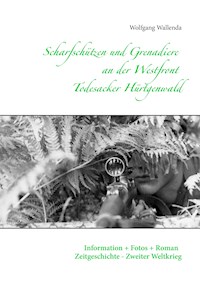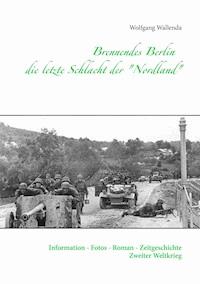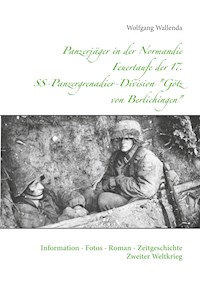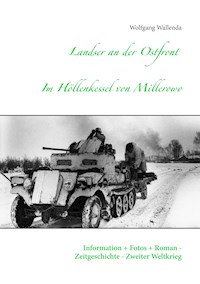Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der eigenwillige Oberkommissar Gschwendtner wird zum bayrischen Landeskriminalamt abgeordnet und dort einer neu aufgestellten Sonderkommission zugeteilt. Gemeinsam mit der aus dem Osten der Republik stammenden Mandy Hammerschmidt und dem homosexuellen türkeistämmigen Emre Gümüs soll er fragwürdige Altfälle aufarbeiten. Vollgepackt mit Vorurteilen, nimmt der urbayrische Grantler die Herausforderung an. "Heimatkrimi - Der Tod kommt aus dem Jenseits" ist ein schräg-lockerer Krimi mit Lokalkolorit, der von der ersten bis zur letzten Seite subtile Spannung bietet und die Leser abwechselnd mit Nervenkitzel und Comedy an sich fesselt. Ein grandioses Lesevergnügen, nicht nur für Krimi-Fans.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Lachen Sie ruhig mal im Büro, wer weiß, ob Sie zu Hause
noch Gelegenheit dazu haben.“
Gschwendtner
Dieses Buch widme ich Gunther „Gschwendtner“ Staub.
Handlung und Personen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkei-ten mit realen Personen wären rein zufällig.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Gschwendtner und der Hundehaufen
Türkische Familienbande
Sonderkommission
Die Spur des Fluches
Dorfgeheimnisse
Familienehre und andere Dinge
Puzzlesuche
Heiße Spuren – kalter Kaffee
Nächtliche Besucher
Jäger und Gejagte
Hexenkessel
Rosa Träume
Buchempfehlungen
Der etwas andere Detektiv
Über den Autor
Ein Bestseller unter den Anti-Kriegs-Romanen
Prolog
Stromausfall. Schlagartig war alles stockduster. Erwin Geier ballte vor Wut die Fäuste so fest zusammen, dass das Weiße an den Knöcheln hervortrat. „Scheißdreck!“, brüllte der Mittfünfziger. Nor-malerweise würde er um diese Uhrzeit schon schlafen, doch heute war im dritten Programm die lange John Wayne-Filmnacht. Es war kurz nach Mitternacht und soeben lief einer seiner Lieblingswestern. Der Teufelshauptmann aus dem Jahr 1949. Geier lag zwei, drei Minuten bei völliger Dunkelheit auf dem Sofa und wartete. Er hoffte, das verdammte Licht würde binnen kürzester Zeit wieder angehen und der Fernseher anspringen. Natürlich passierte nichts. „Ich bringe diese Pfuscher vom Elektrizitätswerk um!“, raunzte Geier mit seiner tiefen Stimme.
Seit geraumer Zeit tobte ein orkanartiges Unwetter. Es goss in Strömen. Von heftigem Wind getrieben, peitschte unaufhörlich Regen gegen die Fensterscheiben des Einsiedlerhofes. Myriaden von Wassertropfen prasselten gegen das Glas. Der Hof lag versteckt hinter sanften Hügeln und einer Waldschonung weit außerhalb des Ortskerns der oberbayrischen Gemeinde Wessobrunn. Einsam anmutende Idylle. Zumindest bei schönem Wetter.
Grollender Donner war zu hören. Laut und bedrohlich entluden sich die Naturgewalten. Sturmböen wirbelten alles umher, was nicht niet- und nagelfest war. Ein gigantischer Blitz zuckte am pechschwarzen Himmel. Sein zackig flimmerndes Licht erhellte für einen kurzen Moment den Raum. Es war bizarres Licht. Schnell, zittrig, unheimlich. Schatten tanzten an der Wand. Geier zog niemals die Vorhänge zu. Wozu auch? Er wohnte hier draußen mutterseelenallein. Der Griff zum Wohnzimmertisch war reinste Routine. Zwischen zwei leeren Bierflaschen lagen seine Zigaretten, daneben das Feuerzeug. Zielsicher fand er es. Ein kurzer Dreh am Zündrad und eine kleine Flamme erhellte das Zimmer. Geier stand auf und stapfte los. Er bewegte sich andächtig, damit die Flamme nicht durch den beim Gehen entstehenden Windzug gelöscht wurde. Zusätzlich schützte er sie mit vorgehaltener Hand. Im Flur war das Heulen des Windes am deutlichsten zu hören. Das Bauernhaus, in dem er lebte, wurde vor über 150 Jahren erbaut und entsprechend zugig war es. Schon den ganzen Tag war das schwere Unwetter in den Nachrichten angekündigt worden.
„… orkanartige Gewitter am Alpenrand ... für die oberbayrischen Seen gilt Sturmwarnung …“, quakte es bis zum Abend stündlich aus dem Radio.
Es war kühl geworden. Richtig unangenehm kalt. Geier fröstelte ein wenig. Der Einsiedler ging schnurstracks zur Kommode, die hin-ten im Eck des langen Flurs stand, zog mit der linken Hand eine Schublade auf und holte eine Kerze heraus. „Wie in guten alten Zei-ten“, sagte er zufrieden.
Seit ein paar Jahren nahmen seine Selbstgespräche merklich zu. Ihm war es egal und es war auch niemand hier, der sich daran stören konnte. Also redete der brummbärige Mann munter drauflos, wann immer er dies mochte. Nur wenn er unter Menschen war, achtete er darauf, nicht durch Selbstgespräche aufzufallen. Er wollte nicht ins Gerede der tratschenden Weiber kommen.
Geier hielt die Flamme des Feuerzeugs an den Kerzendocht. Wackelnd sprang sie über und auch hier zauberte der tanzende Lichtschein bewegliche Schatten an die Wand. Dieses Mal surrten sie jedoch nicht so wild herum, wie vorhin beim Blitzlicht im Wohnzimmer. Die Bewegungen waren eher wellengleich. Die Flamme hielt der Zugluft stand. Das heiß gewordene Feuerzeug verschwand in der Hosentasche.
Bumm
Geier horchte auf. Ein kräftiges Schlagen war zu hören. Das Ge-räusch kam von draußen. Eine Tür war zum Spielball des Windes geworden. Es gab keinen Zweifel.
Bumm Bumm
„Jetzt hat der verfluchte Wind auch noch die Tür zum Holzschup-pen aufgedrückt“, schimpfte der Einsiedler. Seine Wut steigerte sich. Wenn er seine Ruhe haben wollte, musste er raus und diese verfluchte Tür schließen. „Wenn ich jetzt zum Schuppen rübergehe, werde ich pitschnass. Dafür gönne ich mir anschließend zur Belohnung noch ein Bierchen.“
Das war eine gute Idee. Arbeit musste sich lohnen! Und die Be-lohnung einer weiteren Flasche Bier hob seine miese Laune. „Viel-leicht bekommen die das mit dem Strom bis dahin wieder hin“, meinte er als Nächstes und ging in den Keller.
Ordnung war das halbe Leben. Mit der anderen Hälfte, also der Unordnung, lebte es sich zwar besser, aber was Werkzeug betraf, gab es kein Pardon. Das musste aufgeräumt sein und sich stets auf seinem Platz befinden.
Im Werkzeugschrank fand er die gesuchte Taschenlampe. Er knipste sie an und blies die Kerze aus. Der Lichtstrahl war um etliches heller als das Kerzenlicht. Wieder zurück im Flur, zog sich Erwin Geier seinen gelben Regenkittel über, schlüpfte in die Gummistiefel und ging vor die Tür. Kalter Wind drückte noch kälteren Regen gegen sein Gesicht. „Sauwetter, elendiges!“, schimpfte er laut.
Bumm
Er musste diese nervige Tür schließen. Das Schlagen regte ihn jetzt schon irrsinnig auf. Die ganze Nacht würde er das nicht aushalten. Geier dachte an sein Bier und stampfte los. Der Holzschuppen befand sich schräg gegenüber des Wohnhauses. Geier musste quer über den Hof gehen. Es schüttete nach wie vor in Strömen. Er leuchtete zum Schuppen und starrte in die Dunkelheit. Die pechschwarze Nacht fraß den Lichtstrahl der Taschenlampe förmlich auf. Es war so gut wie nichts zu erkennen. Geier beschleunigte sein Tempo und hastete mit schnellen Schritten weiter. Der starke Wind blies permanent Regen ins Gesicht des Mannes. Jeder Tropfen pikste wie ein Nadelstich auf der Haut. Die Kapuze wurde vom Kopf geweht. Binnen Sekunden waren seine immer dünner werdenden Haare tropfnass. Er griff mit der freien Hand nach der Kapuze, zog sie wieder über und senkte den Kopf. Im selben Moment beschloss Geier, dass er seinen Rechtsanwalt aufsuchen würde. Vielleicht gab es einen Weg, diese Elektrizitäts-Heinis zu verklagen. Bei diesen Strompreisen heutzutage sollte die Lieferung zu 100 Prozent gesichert sein. Kein Strom – kein Geld! Eine gute Idee. Die Abschlagszahlung würde er dieses Mal prozentual, natürlich mit einem Wochenendaufschlag und unter Berechnung des Ausfalls der Fernsehgebühren, kürzen. Geier überquerte den Hof in gebückter Haltung. Er stemmte sich gegen den Wind und hielt mit einer Hand die Kapuze des Regenkittels fest. Die andere Hand umklammerte den Griff der Taschenlampe. Jetzt erkannte er endlich etwas. Der Lichtstrahl huschte über die Tür des Holzschuppens, die im Rhythmus der Windböen tanzte.
Auf … ratsch … zu … bumm.
Immer wieder wurde sie hin und her gestoßen, knallte gegen den Türrahmen, federte zurück, wurde an die Wand gewuchtet, um wiederum zur Zarge zu schnalzen.
Warum greift die blöde Verriegelung nicht, schoss ihm durch den Kopf.
Bisher gab es mit dem Schuppen noch nie Probleme. „Alles wird alt und verreckt.“
Vermutlich war das Holz an der Zarge durchgefault und die Schlossfalle herausgebrochen. Er würde es sich morgen genauer ansehen.
Bumm Bumm
Die nächsten Gedanken kamen aus dem Nichts. Das Unwetter ließ plötzlich Erinnerungen aufkeimen. Nur für einen kurzen Moment. Geier verstieß sie sofort, dennoch bekam er Gänsehaut. Ein Gesicht tauchte auf und verblasste wieder. Eine junge Frau lag auf dem Waldboden. Ihr Mund war zum Schrei geöffnet, doch kein Laut kam über ihre Lippen. Ein Auge starrte ihn an, eines war zur Hälfte geschlossen. Der Körper war kalt. Kalt und tot. Damals hatte er mit diesen Bildern im Kopf des Öfteren Albträume. Irgendwann waren sie weg und jahrelang in den Tiefen seiner Seele eingesperrt. Ausgerechnet jetzt kamen sie wieder zum Vorschein. Geier blieb für einen kurzen Augenblick stehen. In seinen früheren Träumen war die Tote aufgestanden, umlaut zu schreien. Geier schüttelte den Kopf.
Schwachsinn, dachte er.
Er ging weiter, plötzlich stockte er. War da etwas? Hatte er tat-sächlich etwas gehört?
Da ist doch was!
War es der ihm bekannte und zum Albtraum gehörende imagi-näre Schrei? Vermischte er sich mit dem Heulen des Windes? Die Hand mit der Taschenlampe schnellte nach oben. Für ein, zwei Sekunden boxte er gegen unsichtbare Schatten. Es war unheimlich. Etwas in ihm trieb ihn zurück zum Haus.
Halt! Gehe nicht weiter! Die Vergangenheit holt dich ein! Da-mals tobte auch ein Gewittersturm, weißt du es noch?
Ein kurzes Zögern. Unsicherheit kam auf.
Bumm Bumm
Das Schlagen der Tür nervte, das Wetter nervte, der Stromausfall nervte. Geier wollte den Film weitersehen. Der Einsiedler verdrängte die warnenden Gedanken. Er hatte sich wieder im Griff. Das befremdende Gefühl verschwand. „Humbug! Alles vorbei!“, stieß er aus. „Die letzten siebenunddreißig Jahre ist nichts passiert und jetzt passiert auch nichts!“
Er erreichte mit schnellen Schritten den Schuppen, betrat ihn und griff instinktiv zum Lichtschalter.
Klick
Nichts passierte. Es blieb dunkel. Der Strom war demnach immer noch weg. „Dann eben nicht“, sagte der Mittfünfziger laut und leuchtete mit der Taschenlampe kurz in den Schuppen hinein. Der Lichtkegel streifte die geschichteten Holzstapel, sowie einen als Holzbock verwendeten Baumstumpf, an dem eine Bogensäge und eine Axt lehnten. Dann wanderte der helle Strahl weiter zu einem angestaubten Fahrrad mit platten Reifen, fuhr über den abgesperrten Stahlschrank, in dem Geier teures Gartenwerkzeug verwahrte und schwenkte schließlich zurück zur Türzarge. Es war nichts Auffälliges zu sehen. Das beklemmende Gefühl, das ihn vorhin übermannte, war allerdings noch nicht gänzlich verschwunden. Er spürte es immer noch leicht. Es war, als ob ihn jemand beobachtete.
Hier ist keine Menschenseele. Ich bin allein. Alles ist gut!
Er würde die Tür abschließen müssen, damit für heute Nacht endgültig Ruhe war. Sollte das nicht klappen, musste er sie aushängen. Danach wollte er sofort zum Haus zurückgehen.
Vielleicht gönne ich mir aufgrund der Umstände noch einen Schnaps zum Bier.
Geier fühlte sich gar nicht wohl. Er, der vor nichts und nieman-den Angst hatte, wurde von etwas Unheimlichen getrieben. „Müdig-keit und Wetter“, grummelte er. Diesmal jedoch sehr leise.
Vielleicht sollte er sich wieder einen Hund anschaffen. Klar, sein Batzi konnte nicht ersetzt werden, doch auch ein anderes Tier war für gute Aufpasser-Dienste geeignet.
Ich kaufe einen Schäferhund oder einen Dobermann.
Gleich morgen würde er sich umhören und in der Zeitung nach entsprechenden Inseraten suchen. Ein lautes Rascheln ließ ihn zusammenzucken. Da war definitiv jemand. Gänsehaut überzog den Körper des Einsiedlers. Das Kribbeln strömte vom Haaransatz über die Wirbelsäule bis zu den Zehen. Mit weit aufgerissenen Augen fuhr Geier herum. Im Lichtkegel der Taschenlampe tauchte etwas auf. „Was zur Hölle ist ...“, weiter kam er nicht.
Ein Stück Hartholz krachte gegen seine Stirn. Blut schoss aus einer weit auseinanderklaffenden Platzwunde. Geier taumelte benommen ein kleines Stück zurück. Eine Hand griff an die Wunde, mit der anderen suchte er Halt am Holzstapel. Die Taschenlampe fiel zwangsläufig zu Boden. Der Einsiedler glaubte im rollenden Lichtkegel eine Gestalt erkannt zu haben. Das Ding trug eine Kapuze. Man sah kein Gesicht.
Der Tod, durchfuhr es ihn.
Der mannshohe Holzstapel, an dem er Halt suchte, wackelte be-drohlich. Geier stemmte sich geistesgegenwärtig dagegen, um ein Einstürzen zu verhindern. Ein heftiger Schlag in seine Kniekehle ließ ihn umknicken. Er stützte sich mit seiner blutverschmierten Hand auf dem kalten Betonboden ab und wollte wieder aufstehen, doch der Holzstapel stürzte ein. Blitzschnell versuchte sich Geier wegzudrehen. Er war chancenlos. Die schweren Buchenscheite begruben ihn unter sich. Das Gewicht war erdrückend. Der Einsiedler rang verzweifelt nach Sauerstoff. Der Drang zu atmen wurde immer größer, doch die Last auf ihm war schwer, zu schwer, als dass sich der Brustkorb beim Atmen mit vollem Volumen heben und senken konnte. Sterne tanzten vor seinen Augen. Plötzlich war diese Gestalt wieder da. Sie saß über ihm. Der Druck auf seinem Oberkörper war stärker geworden. Schwer keuchend versuchte Geier seine Arme zu heben. Es ging nicht. Er konnte nicht mehr atmen. Lautes, bedrohliches Donnern war zu hören. Wieder schickte ein Blitz für wenige Augenblicke flimmerndes, grelles Licht vom Himmel. Das letzte Bild im Leben des schwer verletzten Geier war eine Gestalt, deren Gesicht im Dunkel einer großen Kapuze verschwamm.
Es gibt sie doch. Das ist ein Drude! Er holt mich ins Reich der Toten! Also doch! Der Tod kommt aus dem Jenseits.
In diesem Moment wusste Erwin Geier, dass er sterben würde. Er musste für das büßen, was vor mehr als dreißig Jahren geschehen war. Todesangst überkam ihn. Wie in seinem Traum war wieder ein Mund zum Schrei geöffnet. Doch dieses Mal war es sein eigener. Und ebenso wie in seinen Albträumen kam kein Laut über die Lippen. Alles war haargenau wie bei der Leiche auf dem Waldboden. Der Einsiedler schloss die Augen, flüchtete gedanklich in die Dunkelheit. Sein Körper bäumte sich ein letztes Mal auf. Das Brausen des Sturmes klang schauerlich, der Wind schlug die Schuppentür auf und zu.
Bumm bumm
Doch Geier hörte und spürte nichts mehr. Er war tot. Die Dun-kelheit hatte ihn geholt und gab ihn nicht mehr her.
Erwin Geier wurde erst einige Tage später vom Postboten aufge-funden. Der Unfalltod des Einsiedlers sprach sich im Dorf schnell herum. „Einsiedler von Holzstapel erschlagen“, war als Schlagzeile in den Zeitungen zu lesen.
„Das war kein Unfall, das war der Fluch! Ich werde auch von Druden heimgesucht. Sie schicken mir bald den Todesengel!“, kreischte Ottmar Meier ins Telefon.
„Beruhige dich doch mal“, antwortete sein Gesprächspartner. „Vergiss diesen Schmarrn mit dem Fluch! Außerdem gibt es keine Druden! Todesengel schon zweimal nicht!“
„Wir wurden verflucht! Kannst du dich nicht mehr erinnern?“
„Ottmar! Jetzt werde mal vernünftig. Wir leben im 21. Jahrhun-dert! Vergiss diesen Mittelalter-Scheiß! Das waren damals nichts an-deres als stupide Kindereien!“
„Wir wissen es genau! Du willst es nur nicht wahrhaben!“
„Ottmar!“, zischte er ins Telefon.
Hektisches Atmen war zu hören. Es folgte: „Ich muss meine Fa-milie retten!“
„Spinnst du? Was hast du vor?“
Die Hysterie hatte Meier vollends gepackt. Er plärrte ins Telefon: „Erwin lebte allein. Er hatte keine Familie mehr. Ich muss meine Frau und meine Kinder schützen. Der Todesengel wird sie sonst holen.“
Mit sanfter Stimme wollte er beruhigend auf Ottmar Meier ein-wirken. „Sollen wir uns treffen? Hast du heute Abend Zeit?“
„Du weißt, was damals vorgefallen ist! Jetzt holt er uns! Der Fluch des Druden schlägt zu. Das Jenseits greift nach uns. Du weißt es!“
„Einen Scheißdreck weiß ich!“, wurde der Anrufer jäh unterbro-chen. „Es gibt weder Druden noch Hexen oder sonst einen Zauber. Dieser Fluch existiert nur in deiner Psyche! Jetzt werde vernünftig!“
Die Gemüter waren erhitzt. Angst kontra Wut.
„Du weißt, dass dies eine uralte Macht ist!“
„Ich wiederhole! Bleibt vernünftig, Ottmar! Gar nichts ist zu tun und niemand holt uns! Du weißt ganz genau, was Erwin widerfahren ist. Er wollte im Suff Holz holen und wurde von einem schlecht gestapelten Haufen schwerer Buchenholzscheite erschlagen! Das war ein bedauerlicher Unfall. Die Polizei hat die Sache untersucht und genauso protokolliert. Erwin war nicht nüchtern. Verstehst du? Er war sternhagelblau! Da passieren nun mal Unfälle.“
„Und die Vorzeichen?“
„Welche Vorzeichen?“
„Von denen ich dir erzählt habe. Ein tot geborenes Kalb von mei-ner besten Kuh, das magere Milchjahr ...“
„Alles blöde Zufälle! Wie viele Milchkühe sind denn schon we-gen irgendwelchen Krankheiten eingegangen? Hör auf mit dem Quatsch! Du solltest mal einen Arzt aufsuchen, und damit meine ich keinen Allgemeinarzt.“
Klack.
Ottmar Meier legte auf. Seine Hand zitterte. „Dieses Arschloch will es einfach nicht begreifen“, weinte er. Er hätte damals bei dem ganzen Zeug einfach nicht mitmachen dürfen. So viel Zeit war ver-gangen. Warum erst jetzt? Sie hatten anfangs alle auf die Auswirkungen des Fluches gewartet. Tagelang, wochenlang, monatelang vegetierten sie nur vor sich hin. Dann begannen sie wieder normal zu leben. Jeder auf seine Art. Allmählich geriet es in Vergessenheit. Jetzt aber war er da, der Fluch des Druden!
Diese Wesen haben eben ein anderes Zeitverhältnis.
Der vom Druden gesandte Todesengel würde sie holen. Alle!
Nach und nach pickt er sich die Beteiligten von damals heraus, dessen war sich Ottmar Meier sicher.
Sie hätten es nicht machen sollen. Sie hätten es gestehen sollen oder es zumindest anders machen müssen. Was zum Teufel war nur mit ihnen los? Warum hat keiner das Geheimnis gelüftet? Verzweif-lung machte sich breit.
„Die Tatsachen sprechen für sich“, murmelte der schwer depres-sive und völlig verängstigte Meier.
Wenn man von Ruth absieht, die ihr Schicksal selbst besiegelte, war der erste Tote von ihnen Sepp Ramsler. Herzinfarkt, nachdem er zuvor noch beim traditionellen Perchtengehen im Ortsteil Forst die bösen Geister ausgetrieben hatte. Den anschließenden Heimweg nach Wessobrunn überlebte er nicht.
Der zweite war Rudolf Zickmann, der sich bei Holzarbeiten ei-nen Unterarm abgesägt hatte und jämmerlich verbluten musste, während seine Frau beim Einkaufen war.
Als Nächstes war Erwin Geier an der Reihe. Und nun klopfte der Sensenmann auch an seine Tür. Ottmar spürte es ganz deutlich. Er musste den Fluch aufhalten und dem Todesengel Einhalt gebieten. Er würde noch ein paar letzte Worte an seine Familie schreiben, um anschließend den Fluch mit ins Grab zu nehmen. Es gab nur eine Möglichkeit die Sache zu beenden. Tod durch den Strick. Sein Leichnam sollte dann verbrannt und auf See bestattet werden. Das Geld dafür war da. Ottmar Meier hatte alles schriftlich festgehalten und dafür Adressen und Ansprechpartner für diesen Beisetzungswunsch notiert. Die wenigen Formalitäten würde seine Familie schon hinbekommen. Nein! Sie musste es hinbekommen. Es musste genau so geschehen, sonst war alles umsonst.
Gschwendtner und der Hundehaufen
Das Anbahnungslokal im Münchner Rotlichtmilieu war weniger als spärlich besucht. Eigentlich saß nur ein einziger Gast in dem her-untergekommenen Etablissement, und dieser hatte sich ins dunkelste und hinterste Eck gezwängt. Oberkommissar Gschwendtner ging davon aus, dass der ältere Herr nicht erkannt werden wollte. Eine abgewrackte Animierdame leistete dem Kunden Gesellschaft. Ihm war das laute Kichern der ehemaligen Prostituierten, deren Karrierehöhepunkt gewiss schon etliche Jahre zurücklag, peinlich. Jedenfalls sprachen das schnelle: „Pssst!“, und ein lang gezogenes: „Schsssst!“, welches er so diskret wie möglich herauspresste, dafür.
Im verschmutzten Schaufenster blinkte ein rotes Neonlicht-Herz. Die Glanzzeit des Schuppens lag noch länger zurück als die Tage, in denen die Animierdame in der Woche mehr Geld einnahm, als ein Arbeiter im ganzen Monat. Der Einrichtung nach zu urteilen, war das Etablissement in den Fünfzigern oder Sechzigerjahren eröffnet worden. Damals war hier garantiert die Hölle los. Im Gedanken sah der Oberkommissar ein zum Bersten gefülltes Lokal. Soldaten der US-Armee dürften die besten Kunden der leichten Damen gewesen sein. Rauchschwaden schwängerten die Luft. Aschenbecher waren voller Lucky Strike Kippen, Schlager, Rock 'n’ Roll und Beat liefen die Jukebox rauf und runter. Der US-Dollar lag bei drei oder vier D-Mark und selbst die amerikanischen GI's mit dem niedrigsten Dienstgrad in der US-Army fuhren einen BMW oder Mercedes.
Alles war vergangen, verblasst, lag weit zurück. Jetzt vermittelte das in einer Seitenstraße nächst dem Hauptbahnhof gelegene Nachtlokal eher den Eindruck einer verruchten Spelunke, in der man als Gast besser aus Dosen als aus Gläsern die Getränke zu sich nehmen sollte. Zumindest wenn vermeiden wollte, sich Lippenherpes oder gar Schlimmeres einzufangen. Eines war klar! Wer hier einkehrte, war entweder mit dem Milieu verwoben, hatte sich verlaufen oder war dicht wie eine Haubitze. Alternativ hierzu konnte man noch ein Bulle sein, der im Halbmilieu eine mehr oder weniger wichtige Information suchte. Genau das traf auf Gschwendtner zu. Aus diesem Grund saß er auf einem der hölzernen Barhocker und wartete auf eine Antwort.
Der Atem des Barkeepers stank abscheulich. Angewidert vom fürchterlichen Mief der Mundfäulnis seines Gegenübers, versuchte Gschwendtner nicht mehr durch die Nase zu atmen, sondern schnaufte flach durch den Mund ein und aus. Dabei war er darauf bedacht, die Luft immer seitlich, weit ab vom Geruchsherd, einzusaugen. Schon kurz nach Beginn des Gesprächs hatte der Oberkommissar für sich beschlossen, sofort einen routinemäßigen Kontrolltermin beim Zahnarzt zu vereinbaren. Er wollte definitiv nicht wie dieser Typ enden, der ihm gegenüberstand. Er wollte weder jetzt noch zu einem späteren Zeitpunkt, pure Zahnruinen in seinem Mund herumtragen, die mehr an historische Schlachten und abgebrannte Burgruinen erinnerten, als an einst weiße Kauwerkzeuge. Nun ja. Sofort würde vielleicht nächste Woche heißen. Spätestens nächsten Monat. Aber da ganz bestimmt. Vorausgesetzt, sein Zahnarzt hatte einen Termin frei. Die kleinen schwarzen Stummel im Rachen des bulligen Mannes hinter dem Tresen hatten mit Zähnen nichts mehr gemeinsam. Der verspürte Ekel löste bei dem Polizisten leichte Gänsehautbildung aus. Gschwendtner stellte sich immer wieder eine Frage. Was ist das nur für ein Mensch?
In der Schule gehörte der Dicke garantiert zu den gehänselten Außenseitern. Heute würde man ihn wohl als Mobbingopfer bezeich-nen. Damals war er einfach der fettleibige Trottel, der Klassenclown oder das Mastschwein. Spitzname: Schwarte oder Mister Piggy! Beim Sport hatte er, um sich vor jeglicher Aktivität zu drücken, meistens eine Entschuldigung dabei. Selbstverständlich gefälscht. Wer damals Schwarte genannt wurde, würde heutzutage wohl eher als Opfer, Schnürschinken oder Mann mit Weißbierspoiler betitelt werden.
Ich selbst war zu meiner Schulzeit rank und schlank, fuhr es durch den Kopf des Kripobeamten, der zwar auch über einen kleinen Knödelfriedhof verfügte, sich aber nicht als dick, auf gut bayrisch gwampert oder gar als fettleibig betrachtete. Er war einfach ein gstandenes Mannsbild!
Und er gehörte auch nie den anderen an. Den seltsamen Kreaturen der Spezies Mensch. Gschwendtner war weder bei den Strebern, den sogenannten Mathe-Einser-Gummifingern, noch bei den Aussätzigen angesiedelt, mit denen niemand spielen wollte und bei denen die Mädchen leise tuschelnd und kichernd vorübergingen. Er war bei den Normalen zu Hause. Die Aussätzigen, das waren die Loser, die Pickelfressen, fett- oder magersüchtigen Kerle ohne Chance jemals in eine der angesagten Cliquen zu kommen. Das waren Einzelgänger. MOF-Typen. Menschen ohne Freunde! Außer ihresgleichen hatten sie keine Ansprechpartner. Loser eben!
Gschwendtner wusste genau, wie es dem Typen hinter dem Tre-sen ergangen war. Irgendwann wog der Kerl 70 oder 80 Kilo, während seine Klassenkameraden gerade mal 45 Kilo auf die Waage brachten. Und wiederum irgendwann hatte der geistige Tiefflieger zum ersten Mal mit seiner fleischigen Faust zugeschlagen. Die Karriere war vorprogrammiert. Abgebrochene Metzgerlehre, misslungener Fünf-Finger-Rabatt, also beim Klauen zwecks fehlender Grundschnelligkeit erwischt worden, und nach jahrelangem Abhartzen und Sozialschmarotzen holte er sich eine Kneipenlizenz. Damit hatte er alles erreicht, was für ihn möglich war. Jetzt stand er hinter dem Tresen der abgefuckten Bar und warf Gschwendtner seinen übel riechenden Atem entgegen. Mundgulli, schoss es blitzartig durch Gschwendtners Kopf.
Als die dickwanstige Hand des 130 plus x Kilo-Kolosses sich hob und auf der Schulter des Polizisten landete, mischte sich zusätzlich abstoßender Schweißgeruch zur in der Luft schwelenden Mundfäul-nis. Die freigelegte Achselhöhle hatte seit Tagen weder Duschwasser noch Deo gesehen. Achselterror pur! Gschwendtner rang sich ein Lächeln ab und bugsierte seinen Kopf etwas zurück. Ein Würge-Reflex wurde unterdrückt. Verdammt! Er brauchte unbedingt die noch nicht ausgesprochene Information. Er musste mehr Druck machen. Die Achsel lag immer noch frei. Ein Kuhstall wäre eine Parfümmetropole gegen diesen abstoßenden Geruch.
Duschwasser und Deo, durchströmte es ihn. Doppel-D. Genauso wie die Tittengröße der abgehalfterten Nutte, die hinter seinem Rücken immer noch den einzigen Gast belaberte und inbrünstig hoffte, er würde ihr für ’nen Zwanni nach oben in eines der billigen Zimmer folgen. Der Polizist lachte innerlich über seinen selbst erfundenen Doppel-D-Witz und schnappte gleichzeitig nach Luft. Er fühlte sich wie ein trockengelegter Goldfisch und überlegte, ob diese Situation schlimmer war als der letzte Fauxpas, der nur zwei Tage zurücklag.
Oh Mann, das war eine peinliche Nummer, die auf Anhieb in die Top Ten seiner berühmtesten Fehltritte schoss. Er konnte jetzt noch vor Scham im Boden versinken, wenn er daran dachte. Toll gemacht, Gschwendtner, sagte er im Stillen ironisch zu sich selbst.
Vorgestern sollte er im feinen Zwirn seine Beförderungsurkunde abholen. Natürlich im Präsidium und im Beisein seines obersten Chefs.
„Ganz großer Bahnhof! Irgendein Goldsternträger aus dem Prä-sidium möchte mir gratulieren“, hatte er zu seiner Frau gesagt, als er den Anzug aus dem Schrank nahm und die Schultern des Sakkos abstaubte. In diesem Moment war ihm noch nicht bewusst, welche Konsequenzen es haben würde, wenn die Hose so eng saß, als wäre er Nurejew, der Balletttänzer. Gut, das Sakko konnte er offen tragen. Das war leger und Lockerheit nahm er sich ohnehin heraus. Das lag allein schon daran, dass die Mode der letzten dreißig Jahre vorbehaltlos an ihm vorbeigezogen war. Er trug genau das, was ihm gefiel. Jeans, TShirts und offene Hemden. Nur an diesen einen Tag musste es der Anzug sein. Wann hatte er ihn zuletzt getragen?
War das die Hochzeit von …? Nein, zu lange her.
Jetzt fiel es ihm wieder ein. Er trug ihn bei der Firmung einer seiner Töchter. Danach kleidete er sich bei solchen Anlässen immer in Tracht. „In Bayern kann man das in Lederhosen machen“, sagte er stur.
Jetzt stand er vor dem Spiegel und betrachtete sich abschätzend. Vielleicht habe ich seit der Firmung abgenommen, hoffte er. „Passt!“, kam es zufrieden.
Mit dem Kopfschütteln seiner Frau und ihrem „Du bist und bleibst ein alter Sturschädel“ im Ohr, verließ er das Haus.
Sie fuhren im nagelneuen Dienst-BMW. Dem Flaggschiff des Kommissariats und der von höchster Stelle auserkorene Chef-Wagen. Kriminaldirektor Schmelzer, der Dienststellenleiter, saß auf dem Beifahrersitz und rümpfte die Nase, während Gschwendtner auf die stark befahrene Nymphenburger Straße einbog. Das immer kalkiger werdende Gesicht seines Beifahrers bereitete dem Polizisten Sorgen. Die Ursache dafür ebenfalls. Aus dem Fußraum kroch der jedem wohlbekannte und extrem intensive Geruch von Hundescheiße in die Nasen der beiden Insassen des zivilen Streifenwagens.
Vielleicht hätte ich doch nicht über den Grünstreifen gehen sol-len, durchfuhr es Gschwendtner.
Oder war es sein Chef, der in einen Hundehaufen getreten war? Ein schneller Blick zum Beifahrer. Nein! Vom Chef kommt es nicht. Der Gestank kam von seiner Seite. Unverkennbar!
„Wollen Sie nicht rechts ran fahren und Ihre Schuhe putzen? Das hält ja niemand aus!“
Gschwendtner versuchte sich ahnungslos zu stellen. „Kommt das von mir?“, presste er kurz aus, aber die Situation war zu eindeutig. Rhetorische Fragen schienen unangebracht zu sein. Dennoch schob er ein: „Ob unser Vorgänger vergessen hat, den Wagen zu reinigen und ihn einfach so …“, er sprach den Satz nicht zu Ende, sondern setzte den Blinker und fuhr rechts ran.
Den ausgestreckten Mittelfinger des hinter ihm lautstark fluchen-den Verkehrsteilnehmers ignorierte er ebenso wie das Hubkonzert der folgenden fünf oder sechs Fahrzeuge, gepaart mit Vogelzeigern und Scheibenwischer-Nachmachern. Ein Blick nach unten ließ nichts Gutes verheißen. Schon beim Aussteigen erkannte er die Bescherung.
„Volles Pfund!“, entfuhr es ihm und er streifte mit dem Schuh über das spärlich wachsende Gras des Grünstreifens, der die Nym-phenburger Straße vom parallel verlaufenden Radweg trennte.
Sein Chef war ebenfalls ausgestiegen. Schmelzer rauchte nervös eine Zigarette. Immer wieder fiel sein Blick auf die Armbanduhr. „Die Fußmatte auch“, sagte er trocken und ziemlich humorlos.
„Klar doch“, würgte Gschwendtner aus. Die gute Laune hatte sich längst davongeschlichen. Mangels Werkzeugs zog der Polizist den billigen Kugelschreiber mit Werbeaufdruck einer Polizeigewerk-schaft aus der Innentasche seines Jacketts. Gezielt setzte er ihn ein und fuhr damit durch die Ritzen seiner Schuhsohle. Einbeinig dastehend, geriet Gschwendtner aus dem Gleichgewicht, versuchte sich durch einen ungelenken Balanceakt aufrecht zu halten und kam dadurch erst recht ins Straucheln. Das angehobene Bein schnellte nach unten, der Absatz des gnadenlos nach Hundefäkalien riechenden Schuhs knallte gegen die Kante des Bordsteins. Das laut hinausgeschriene: „Verfluchte Scheiße! Ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken!“, brachte auch keine Hilfe. Der Absatz war ab. Gschwendtner bückte sich. Immer noch laut fluchend ein: „Himmelherrgottkruzifix!“, und „Bluat von ‘ner toten Sau am Säbel!“, brüllend, griff die rechte Hand nach dem abgestoßenen Schuhabsatz. Zeitgleich mit dem Bücken war deutlich das Geräusch von reißendem Stoff zu hören. Synchron hierzu spürte der Polizist frische Luft an seinem Gesäß. In der Hoffnung, der Riss in seiner Hose sei nur klein und unauffällig, entschied sich Gschwendtner spontan dazu, den Absatz liegenzulassen.
Wer trug die Schuld an diesem Schlamassel? Die etlichen Schnitzel und Schweinebraten, oder die paar Hektoliter Weißbier, mit denen die herrliche Tellerpracht stets hinuntergespült wurde?
Nichts von alledem, entschied der Bulle des Volkes, wie er gele-gentlich genannt wurde. Mein Bauch ist meine Sparbüchse! Der Anzug war billig und der dünne Stoff ist daran schuld, dachte er.
„Scheißklumpvareckts!“, schob er nach. Es half alles nichts. Es galt die Ruhe zu bewahren!
Das Jackett ist doch sicherlich lang genug? Ist der Riss abge-deckt? Die positive Beantwortung der beiden Fragen war momentan das Wichtigste im Leben des Polizisten. Jetzt fiel ihm ein, wann er den Anzug zum letzten Mal getragen hatte. Das war nicht bei der Firmung von Tochter Nr. 2, das war bei der Hochzeit eines Kollegen. Das war …, grübelte er, während sein Chef erneut in den Innenraum des Dienstwagens deutete und ein: „Die Fußmatte nicht vergessen“, murmelte.
Abgelenkt vom letzten Malheur schob Gschwendtner den Kugel-schreiber zurück in die Innentasche seines Jacketts, ging, verursacht durch den absatzlosen Schuh, mit leicht humpelndem Gang zur Fah-rerseite des BMWs und zog die Fußmatte heraus. Natürlich hatte sein Chef recht. Sie war ordentlich mit Hundedreck besudelt. Kaum war die Matte draußen, setzte sich der Kriminaldirektor zurück auf den Beifahrersitz. Gschwendtner öffnete den Kofferraum.
Hier ist die Matte hervorragend aufgehoben, überlegte er und war mit seiner Wahl äußerst zufrieden.
Später wollte er sie reinigen. Vielleicht in der Waschstraße ab-sprühen, kam ihm in den Sinn. Genauso würde er es machen. Zufrieden, die peinliche Situation gemeistert zu haben, stieg er wieder ein. Die Fahrt ging weiter, die Fenster blieben einen Spalt geöffnet. Anders konnte der immer noch latent vorhandene Hundekacke-Geruch nicht ertragen werden.
Als sie im Präsidium ankamen, stieg Direktor Schmelzer schnell aus. „Kommen Sie mit, wir sind spät dran!“
Gschwendtner hatte das Gefühl, dass sein Chef die eingangs fröhliche Stimmung irgendwie nicht mehr zeigte.
Während der hohe Polizeibeamte mit langen Schritten zum Ein-gang eilte, humpelte Gschwendtner hinterher. Natürlich immer darauf bedacht, dass das Sakko sein Hinterteil, und damit den Riss in der Hose, verdeckte.
Der menschengefüllte Saal wirkte auf den bodenstämmigen Po-lizisten wie eine pompöse Galaveranstaltung der deutschen Schauspielerelite. Junge Kolleginnen und Kollegen waren als Ordonnanzen eingeteilt. Sie stolzierten in der feinen Garnitur und umher und trugen Tabletts mit Sekt und Orangensaft durch die Gästereihen.
Milchgesichter, die als Bedienungen missbraucht werden, waren Gschwendtners erste Gedanken.
Er entdeckte das Büffet. Auf mindestens fünf Metern Länge wa-ren die feinsten Köstlichkeiten so präsentiert, dass ihm schon jetzt das Wasser im Mund zusammen lief.
„Büffet, echt geil“, stieß er aus. Sein Magen war ohnehin leer und mit einem kleinen Häppchen im Bauch würde sich die langweilige Zeremonie sicherlich wesentlich lockerer angehen lassen. Er warf ein Auge auf Direktor Schmelzer, steuerte aber schnurgerade auf das Büffet zu. Den Kollegen, der mit hochrotem Kopf ein volles Tablett mit billigem Aldi-Prickelwasser und Orangensaft an ihm vorbei jonglierte, sah er zu spät.
Wramm, Schepper
„Scheiße!“
Das Klirren der am Boden zerschmetterten Gläser hörte sich an, als würde ein Glascontainer ausgeleert werden. Gschwendtner schloss die Augen. Im Geiste war er wieder 16 Jahre alt und hatte auf der Jugend-Disco-Party mit schwingenden Armen bei einer ungeschickten Tanzbewegung die Disco-Kugel von der Decke direkt auf die Tanzfläche bugsiert. Damals stand er ziemlich belämmert in der Mitte der Disse und schämte sich in Grund und Boden. Klar, dass er allein nach Hause gegangen war. Ungeküsst und weit weg von seinem Traum an den Busen von Elisabeth Katschinski heranzukommen.
Bevor sich der junge Polizist, dessen Kopf nun kurz vor einer Explosion zu stehen schien, aufrichten und den Verursacher des Malheurs suchen konnte, verdrückte sich Gschwendtner sofort in die Menge. Den ersten zweifelnden Blicken seiner Kollegen und Kolle-ginnen schob er noch ein: „Armer Kerl. Ein solches Missgeschick aber auch“, entgegen. Dann war er in der Masse der Polizisten verschwunden und atmete erleichtert auf. Innerlich schmunzelnd, sich aus dieser Situation gerettet zu haben, bemerkte er, dass ihn einige Blicke verfolgten. Instinktiv griff er an sein Gesäß. Verdammt! Das Sakko ist zu kurz!
Er benötigte ein Häppchen zur Stärkung. Nur ein gefüllter Bauch kann klar denken, war seine Devise.
„Entschuldigung“, sagte Gschwendtner höflich und schob sich zwischen einem Fünf-Sterne-Hauptkommissar und einer aufgetakel-ten Blondine durch, die entweder die Schreibkraft des Chef-Bullen war und sich von ihm vögeln ließ, oder sie war eine Goldsternträgerin der Kripo, in deren Hintern der Hauptkommissar kroch, um etwas für seine Karriere herauszuschinden.
Gschwendtner ging im Gedanken nicht gerade höflich mit seinen Kollegen um. Die meisten von ihnen hatten es seiner Meinung nach auch nicht verdient. Er war am Ziel. Das Büffet war luxuriös. Eingelegte Oliven und Schafskäse in allen Variationen lachten ihn an. Gegrillte Scampi ruhten neben geräuchertem Aal. Daneben wiederum hatte man ein paar Austern auf Eis gebettet. Garantiert echter Parma-Schinken reihte sich zwischen Crevetten und Thunfisch-Salat ein. Frisches Baguette lag scheibchenweise aufgeschnitten zwischen Frischkäse und gefüllten Weinblättern. Weiter hinten sah er kalten Braten, Essiggurken und goldgelbe Kürbisstückchen in Marinade. Er war im Paradies. Gottseidank hatte er zugesagt und … ach was. Seine Beförderung war Gold wert.
Sein Appetit wuchs ins Unendliche. Während die Masse der ge-ladenen Gäste immer noch um den gestürzten Ordonnanz-Kollegen herumstand und bestürzt versuchte, ihre mit Sekt und O-Saft ange-spritzten Klamotten zu reinigen, schnappte sich Gschwendtner einen Teller und trat an den Kopf des Büffets. Er lächelte eine erstaunt dreinblickende Dame an und meinte schlicht: „Guten Appetit! Das Büffet ist eröffnet!“
Ihm fiel nicht auf, dass die Dame sich verwundert umdrehte und dem Redner lauschte, der sich soeben auf der Bühne eingefunden hatte und in ein Mikrofon sprach. Gschwendtner hörte nicht zu. Wozu auch? Noch war das Büffet-Paradies gefüllt. Es fehlte so gut wie nichts. Nein! Eigentlich fehlte gar nichts. Wie auch? Das Büffet war bislang nicht offiziell eröffnet. Ein Glücksfall für Gschwendtner, der gern aus dem Vollem schöpfte. Sein Teller war bereits randvoll, bevor der hungrige Polizist das erste Drittel des Büffets abgeschritten hatte. Genüsslich schluckte er ein Stück Schafskäse mit Oliven-Kräuter-Öl-Dressing hinunter. Ein Bissen Baguette folgte obligatorisch. Der Geruch der gegrillten Scampi war einfach unwiderstehlich. Ein Hauch von Knoblauch kroch in seine Nase. Die Leute klatschten Applaus, dann kehrte Stille ein. Rednerwechsel.
„Danke, meine Damen und Herren“, sagte jemand.
Gschwendtner hatte der Bühne den Rücken zugekehrt. Das fol-gende Blabla interessierte ihn nicht. Eigentlich hörte er die nächsten Worte nur im Unterbewusstsein, doch das, was er hörte, reichte aus, ihn zur Salzsäule erstarren zu lassen.
„… und bevor ich das Büffet eröffne …“
Die Worte hallten wider, als wäre er in einer Felsenwand einge-klemmt, an der das Echo zweimal vorbeizog. Ohne weiter zu kauen, schluckte er die Scampi teilzerkaut hinunter. Der Teller wanderte schlagartig auf den Tisch zurück.
Nur nicht umdrehen, sagte er innerlich zu sich selbst.
„… habe ich die Ehre einen altgedienten Haudegen …“, der Redner lachte, „… ich darf ihn doch so nennen? Kaum jemand kennt seinen Vornamen.“ Kurze Pause. „Aber den braucht er auch nicht, denn im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums München weiß jeder, wer gemeint ist, wenn ich vom personifizierten Fahnder spreche.“
Gemurmel. Heimliches Raten, wer gemeint war.
„Es kann nur einen geben und das ist unser allseits bekannter Gschwendtner!“
Farbe schoss in Gschwendtners Gesicht. Er verstand nur noch Wortfetzen. Der Mob der Oberschleimer suchte ihn bereits. Köpfe drehten sich hin und her.
Der Drecksack liest von einem Zettel ab! Er kennt mich gar nicht, fiel ihm sofort auf, als er erschrocken zur Bühne blickte.
Nur weg vom Büffet, blitzte es als Nächstes durch sein Gehirn.
„… in den vergangenen 25 Jahren ... bla … bla ... bla … nicht immer einfach ... mehr als dreitausend geklärte Delikte gehen auf sein Konto … und deshalb …“
Er meint tatsächlich mich! Verflucht, was ist das für ein Tag?
„Na, wo ist er denn?“
Direktor Schmelzer betrat auf ein Zeichen des Redners hin ebenfalls die kleine Bühne. Er stand jetzt neben dem Mann mit dem Mikrofon. Die Menge begann zu applaudieren. Dann fing einer der Idioten an „Gschwendtner“ zu rufen. Die Meute fiel mit ein. „Gschwendtner! Gschwendtner!“, kam es im Chor.
Es war die Hölle. Er musste nach vorn.
Verfluchter Mist. Ausgerechnet auf die Bühne! Ich bin doch kein Popstar! Schmelzer ist ein Riesenknallkopf mit null Hirn! Warum hat er nicht gesagt, in welchen feierlichen Rahmen mir die Urkunde aus-gehändigt werden sollte?
Plötzlich fiel es ihm wieder ein. Ich Depp, überkam es den Poli-zisten.
„Ganz großer Bahnhof!“, hatte es geheißen. Ich habe es noch selbst zu meiner Frau gesagt. Das war also damit gemeint. Ich bin die Rahmenfüllung der Präsidiumseinweihungsfeier nach dem Umbau.
Beklommene Blicke. Dann erspähte er sie. Fotografen! Es waren sowohl präsidiumseigene Pressevertreter anwesend, als auch ein paar Journalisten der großen Münchner Boulevardzeitungen. Die kleine Bühne hatte sich gefüllt. Erste Blitzlichter waren zu sehen.
„Wenn Peinlichkeit einen Namen bekommt“, murmelte er und kämpfte sich durch den Mob.
Das Humpeln aufgrund des fehlenden Absatzes war noch das geringste Problem. Die strahlend feuerrote Unterhose, die sein Gesäß bis zu den blinkend weiß hervorstechenden Oberschenkeln zierte, war um Längen schlimmer. Er wusste, dass er der Verlierer des Abends werden würde. Sein tiefstes ICH verriet es. Es war dieses Bauchgefühl, das ihn niemals täuschte.
Die Blitzlichter ärgerten ihn, als er über die drei Stufen die Bühne betrat. Nein, ärgern war der falsche Ausdruck. Sie machten ihn wü-tend. Gschwendtner zwang sich ein Lächeln ins Gesicht. Er wurde von Direktor Schmelzer mit Händeschütteln begrüßt und zugleich dem Innenminister vorgestellt, der mit breitem Grinsen neben dem Polizeipräsidenten und anderen ranghohen Polizeibeamten stand und klatschte.
Verdammte Scheiße! Jetzt erst registrierte Gschwendtner, von wem er alles erwartet wurde.
Der Innenminister, der Staatssekretär, der Polizeipräsident, ein Vertreter der Gewerkschaft und Direktor Schmelzer standen auf der Bühne, lachten schleimig in die Kameras der Journalisten und streckten ihm die Hände zur Begrüßung hin.
Aufgrund des fehlenden Absatzes kämpfte Gschwendtner eini-germaßen gelungen gegen das Humpeln an. Das schiefe Dastehen konnte er jedoch nicht gänzlich ausgleichen. Die Körperhaltung war aufgrund des kaputten Schuhs permanent leicht abgeschrägt. Der Versuch durch eine Zehenspitzenstellung, also Abheben der betreffenden Ferse, eine Korrektur zu erreichen, verlieh dem Polizisten für einen Augenblick die Figur eines dicken Fragezeichens und verursachte schnell einen Krampf in der Wade. Das war genau der Moment, als ein Stakkato von Blitzlichtern über ihn hereinfiel.
„Herzlichen Glückwunsch“, sagte der Innenminister ins Mikro-fon. Jemand kam von hinten heran und übergab dem Politiker eine Urkunde.
„Wie fühlt man sich, wenn man einer der erfolgreichsten Fahnder Münchens ist?“, fragte der Staatsvertreter und hielt obligatorisch die Beförderungsurkunde hoch, um sich dabei fotografieren zu lassen.
Gschwendtner streckte die Hand aus, um den Gruß des Innenministers entgegenzunehmen. Das Sakko rutschte nach oben und die rote Unterhose stach im grellen Blitzlichtgewitter für jeden sichtbar heraus.
„Unterzeichnen“, flüsterte eine Stimme von hinten.
Gschwendtner zog seinen Kugelschreiber heraus.
„Ach ja“, meinte der Innenminister schleimig lächelnd und nahm das Schreibgerät entgegen. „Das muss ich auch noch machen.“ Er drückte mit dem Daumen auf das Ende des Kulis, damit die Mine hervortrat, und kritzelte seinen Namen unter die Urkunde. Es lag wieder dieser leicht penetrante Geruch von Hundekacke in der Luft. Der Polizist bemerkte es sofort. Natürlich kroch der Gestank auch in die Nase des Politikers. Angewidert sah der Leiter des Innenministeriums auf den Kugelschreiber, entdeckte ein paar eingetrocknete Reste Hundekot und warf erst Gschwendtner, dann Kriminaldirektor Schmelzer einen bösen, wenn nicht gar tödlichen, Blick zu.
Der Abend war gelaufen. Kommentarlos nahm der frisch geba-ckene Oberkommissar die Beförderungsurkunde entgegen, hob sie in die Kameras der Reporter und lauschte den Worten des Polizeipräsidenten, der sich neben dem Innenminister postiert hatte. Diese Ansprache nutzte Gschwendtner kurz darauf zur Flucht.
Am nächsten Tag war er nicht nur das Gespött im Büro, sondern auch noch mit der feuerroten Unterhose der Lacher der Stadt.
Insgeheim hoffte der Bulle, dass die Sache mit dem Hunde-scheiße-Kugelschreiber kein Nachspiel haben würde, aber dazu kannte er die High Society des Beamtentums nur zu gut. Er machte also das, was er am besten konnte. Arbeiten und die Situation aussitzen.
Ein ähnlich übler Geruch wie der Mief von Hundekacke, holte ihn in die Gegenwart zurück. Die rechte Hand des Polizisten fingerte eine Tüte Fishermans Friend aus der Brusttasche seiner Jacke. Er wartete nicht auf die Antwort seiner ersten Frage. Er musste eine dringlichere Zweite nachschieben. Das war lebensnotwendig, wenn er nicht vom Gestank ohnmächtig werden wollte. „Willst du auch eins?“
Enttäuscht sah er ein Kopfschütteln. Die fetten Wangen schwab-belten nach. Der füllige Körper des Fleischberges bewegte sich nach hinten. Der Barkeeper stand wieder aufrecht hinter dem Tresen. „Die Dinger mog i ned!“
Aufatmen. Wenigstens der penetrante Schweißgeruch war nun nicht mehr so deutlich wahrzunehmen. Gschwendtner musste die erste Frage tatsächlich wiederholen. Vermutlich war sie irgendwo zwischen Kleinhirn, Hirnrinde und Sprachzentrum des Stinkers verloren gegangen. „Jetzt sag schon! Wo versteckt sich diese Ratte? Du willst doch nicht, dass ich …“
„Moment, Gschwendtner! Mia zwoa ham an Deal g`hobt! I va-pfeiff den afghanischen Drogen-Wurschtl und du losst mia künftig mei Ruah!“
„Der Drogen-Wurschtl, wie du ihn nennst, hat zwei seiner Kon-kurrenten jeweils ein Messer zwischen die Rippen gejagt. Der war dir ohnehin egal. Aber jetzt geht es um ein Kind. Der Kerl, dem du ir-gendwo Unterschlupf gewährst, hält ein Kind gefangen.“
„Des is sei Gör. Zumindest hot a des gsogt!“
„Du kannst mich mal, ich werde …“
Wieder wurde der Oberkommissar unterbrochen. Der Kopf des Barkeepers wackelte hin und her. Die fetten Wangen schwabbelten wieder nach und erinnerten an einen Bernhardiner, der sich schüt-telte. „I sog na! Na! Und no amoi na! Des san Voda und Tochta!“
Gschwendtner zog sein Handy aus der Hosentasche. „Bitte! Dann eben auf die harte Tour!“
Die Schweinsaugen des Stinkers verengten sich. „Des wogst du ned!“
„So“, sagte Gschwendtner nicht nur hörbar, sondern leicht pro-vozierend. „Kurzwahl. Da ist sie ja.“
Das Handy wanderte ans Ohr. Warten. Nur Sekunden vergingen, dann sprach der Kriminalpolizist weiter. „Servus. Ich bin es. … Wer ich? Blöde Frage! Ich natürlich, der Gschwendtner.“
Pause. Zwei Augenpaare trafen sich. Die Spannung im Lokal glich einem Duell im Wilden Westen. High Noon! Beide Gunfighter standen sich gegenüber. Gschwendtner zog schneller. Er würde sie-gen.
„Ich brauche eine Gruppe von deinen Leuten für eine Razzia … Ja, sofort! Ich glaube hier werden illegal Zimmer an Nutten vermietet. Ach ja, und bring auch einen Hundeführer mit ‘nem Gift-Wau-Wau mit! Hier könnte unter dem Tresen das eine oder andere Tütchen gefunden werden“, pfefferte Gschwendtner voller Selbstsicherheit hinterher. „Ja! Volles Programm für die Sitte und das Rauschgiftdezernat. Wo ich bin?“
„Hea auf! I sog, wos i woass!“, zischte der Barkeeper plötzlich.
Ein Lächeln huschte über das Gesicht des Polizisten. „Ich melde mich noch einmal. Ich glaube, ich war doch etwas vorschnell. Nichts für ungut! Servus.“
Das Mobiltelefon wanderte zurück in die Hosentasche.
Schweißperlen standen auf der Stirn des Barkeepers. Die nassen Ränder unter den Achseln hatten sich in der letzten Minute auf die doppelte Größe ausgeweitet. Der Kopf war hochrot angelaufen. „Erpressung is des!“
„Wo?“, herrschte der Polizist mit einem einzigen Wort. Er ließ keine Zweifel bezüglich seiner Entschlossenheit zu.
„Des woar des letzte moi!“
„Wo?“
„Oben! Zimmer zwoa! Dös Kind is ned im Zimmer!“
„Wenn ich jetzt dort hinaufgehe, dann bleiben deine Hände auf dem Tresen. Wenn du ihn warnst, kannst du deinen Laden hier dichtmachen!“
„Wan jemand erfoart, dos i eam hi`ghängt hob, is des a scho wuascht! Dann is mei Ruaf im Milieu ruiniert!“
Die letzten Worte hatte der Kripobeamte schon gar nicht mehr gehört. Er war sofort von seinem Barhocker aufgesprungen und durch eine Seitentür ins Treppenhaus verschwunden.
Gschwendtner sah aus wie ein Bilderbuch-Bayer. 90 Kilo plus x, bei 184 Zentimetern Körpergröße. Bierbauch und Haarkranz waren selbstredend inbegriffen. Im Normalfall sprach er sogenanntes bayri-sches Hochdeutsch, konnte aber auch puren Dialekt reden. Überhaupt hatte er die Fähigkeit, fremde Mundarten zu imitieren. Auf Bedarf sprach er unverkennbares fränkisch, schwäbisch, sächsisch und beherrschte sogar die original Wiener Tonart.
Er rannte die Treppe nach oben. Eine Hand wanderte automatisch an die Seite. Wie schon oft zuvor umklammerte er den Griff seiner Pistole. Ziehen und schießen waren kein Problem. In dreißig Dienstjahren tausendmal trainiert, war das in Fleisch und Blut übergegangen. Sein Herz pochte immer schneller. Der Puls begann zu rasen. Der Verstand hingegen arbeitete ruhig und sachlich. Dennoch spürte er es wieder. Es war jedes Mal das gleiche Gefühl. Jagdfieber pur!
Gschwendtner stand im Flur. Es roch muffig. Alles sah entspre-chend billig und alt aus. Diffuses Licht verschleierte den Schmutz auf dem abgelatschten Teppichboden. Die Wände waren tapeziert. Mus-tertapete mit Rosen-Motiv. Genauso alt wie das Etablissement selbst, dachte der Fahnder. Nummer 2 war gleich das erste Zimmer auf der rechten Seite. Es gab keine Nummer 1.
Er lauschte kurz an der Tür. Ein Fernseher lief. Jemand telefo-nierte. Er ist da. Auf Verstärkung warten oder …?
Die Überlegung war noch nicht einmal richtig angedacht, als Gschwendtners linke Hand gegen die Tür pochte. „Zimmerservice! Sie hatten etwas bestellt!“
Schweigen. Schritte, die sich der Tür näherten. „Zimmerservice? Ich habe nichts bestellt!“
Die Schritte entfernten sich wieder, was Gschwendtner zum An-lass nahm, die Tür auf seine eigene Art zu öffnen. Er trat einen Schritt zurück, drehte sich um und holte mit dem rechten Bein aus. Dann hieb die Sohle des Fußes mit Schwung gegen die Tür. Das dünne Holz des Rahmens splitterte sofort, die Tür schwang auf.
„Was soll …?“, prustete die Stimme eines Mannes, die jedoch sofort stockte, als er sich der urbayrischen Figur Gschwendtners ge-genüber sah. Gleichzeitig starrte der südländisch aussehende Kerl in den Lauf einer Pistole der Marke Heckler & Koch. Gschwendtners Dienstwaffe.
„Wo ist die Kleine?“
Die Frage war kompromisslos gestellt. Die Augen des Bullen sprühten Kälte, Verachtung und Hass aus. Es gab keinen Spielraum.
Ängstliche Blicke wurden durch hämisches Grinsen abgelöst. „Ihr werdet sie nie bekommen. Sie ist ...“
Der Kerl hatte noch nicht einmal ausgesprochen, als Gschwend-tner ihn mit der linken Hand am Hals packte. Blitzschnell war die Waffe mit der anderen Hand zurück ins Holster geschoben. „Ich hasse es, wenn man kleine Mädchen entführt!“
Der Mann griff mit beiden Händen an den Unterarm des Polizis-ten. „Sie dürfen mich nicht schlagen. Ich kenne das Gesetz“, würgte er hervor.
„Keine Angst, ich schlage dich nicht, du Arschgeige“, entgegnete Gschwendtner und bugsierte den ihm körperlich um mehrere Kilos unterlegenen Araber zum offen stehenden Fenster. „Zum letzten Mal. Wo ist die Kleine? Du wirst sie nicht zwangsverheiraten, sondern sie wieder ihrer Mutter übergeben!“
„Leck mich am …“
Der Kindesentführer hatte keine Möglichkeit, den Satz zu Ende zu sprechen. Gschwendtner griff mit der freien rechten Hand ebenfalls zu, hob den Kontrahenten hoch und gab ihm einen leichten Schubs. Zeitgleich ließ er ihn los, sodass der Mann rücklings aus dem Fenster kippte. Bevor er ganz hinausfiel, packte Gschwendtner wieder zu und bekam den Araber an den Beinen zu fassen. Der Oberkörper des Mannes hing draußen. Unten herrschte reger Verkehr. Ein gellender Schrei ertönte. Passanten blieben stehen. Hektik brach auf der Straße aus. Der Araber wedelte wild mit den Armen umher, während der Zivilfahnder seine Hände so kraftvoll wie Schraubstöcke um die Knöchel des Mannes geschlungen hatte. „Du bist schwerer als ich dachte“, keuchte der Polizist. „Warum musstest du auch versuchen, durch das Fenster zu springen?“
„Du Mörder! Ahhh! Hilfeeee“, kam es schrill und laut.
Auf der Straße versammelten sich immer mehr Menschen. Sie blickten alle nach oben. Ein paar der schaulustigen Gaffer zogen ihre Smartphones heraus. Ein Teil verständigte den Notruf, während andere die Szene filmten.
„Er ist durchgeknallt und möchte sich umbringen“, rief Gschwendtner geistesgegenwärtig. Das war meine Eigensicherung, grinste er innerlich. „Rufen Sie die Polizei und die Feuerwehr an!“
„Du Schwein“, keuchte der Araber.
„Wo ist das Mädchen?“, schob Gschwendtner etwas leiser nach.
„Hilfe!“
„Ich tippe auf Querschnittslähmung ... also, ich meine, wenn ich loslasse. Mit viel Glück brichst du dir nur alle Knochen. Wahrschein-lich liegst du für ein paar Wochen mit Spreiz-Gips im Krankenhaus. Ich besuche dich dann jeden Tag.“
Gschwendtner ließ ein Bein los. Der markerschütternde Schrei des Arabers wurde nur vom Raunen der Zuschauer übertönt. Blitz-schnell griff die zweite Hand des Bayern wieder zu. Nun hielt er den Entführer mit beiden Händen an einem Bein fest.
„Hoppla …“, schnaufte Gschwendtner, „… das war eng. Na ja, dann sehen wir uns im Krankenhaus. Gute Reise!“
„Sie ist bei meinem Cousin in der Teestube gleich ums Eck“, kreischte der Typ. „Wirklich! Bitte … ziehen Sie mich … rein! Ich wollte sie doch nur zurück in meine Heimat bringen! Ich habe einen guten Ehemann gefunden. Jetzt ist sie bei Ahmed!“
„Wenn das nicht stimmt …“, fauchte Gschwendtner und lockerte den Griff für eine Millisekunde, um gleich wieder zuzupacken.
„Ich … lüge … nicht! Ziehen Sie mich rein!“
Gschwendtner zog den Entführer zurück ins Hotelzimmer. Wei-nend, zitternd und keuchend saß der Araber auf den Fußboden. Martinshörner waren zu hören. „Das ist die Verstärkung!“
Gschwendtner zog sein Handy aus der Tasche und tippte eine Nummer ein. „Ich bin es. Sie ist in der Teestube in der Schwanthaler-straße. Der Typ heißt Ahmed! Holt sie euch!“
Am nächsten Morgen gab es im Büro statt Blumen und Feier-stimmung eher eine Art saure Gurken-Zeit. Als Gschwendtner die Räume betrat, begrüßte ihn die Sekretärin mit einem freundlichen: „Griaß di“, verzog aber das Gesicht zu einer Grimasse und deutete stumm mit einer schnellen Kopfbewegung nach hinten.
„Der Alte?“
Sie nickte kommentarlos, schnappte sich einen Pack Anzeigen und tippte auf ihrer Tastatur herum. Gschwendtner wusste, dass dies das wohl schlechteste Zeichen war, das es gab. Die Schreibkraft war für ihn ein Stimmungsbarometer. Lachte sie, war die Welt in Ordnung. Meistens duftete es dann gleichzeitig nach Kaffee. Sporadisch stand auch ein selbst gebackener Kuchen in der kleinen Teeküche parat. Zog sie ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter, herrschte dicke Luft. Heute war Alarmstufe Rot angesagt, denn die Tippse wirkte leicht depressiv, was auf Endzeitstimmung hinwies. Gschwendtner ahnte, dass Schmelzer geladen und in absoluter Geberlaune war. Soll er nur kommen, dachte der Ermittler. Ich bin vorbereitet.
Nur eine Minute später, Gschwendtner hatte noch nicht einmal sein Büro erreicht, hörte er die Stimme Schmelzers durch den Flur hallen. „Ist Gschwendtner schon da?“
Mist!
Zehn Sekunden später saß er ihm gegenüber. „Das war es, Gschwendtner! Sie sind draußen! Ich freue mich schon, wenn ich Ihnen im Winter beim Verkehr regeln zusehen darf! Ihre Uniform passt doch noch, oder?“, kam als süffisanter Zusatz.
Das Büro war spartanisch eingerichtet. Vermutlich nach Norm. Alles in Schmelzers armseligen Leben lief nach Norm ab. Vermutlich vögelte er auch nach einer Art Dienstvorschrift. „Schatz. Es ist Sonn-tagabend und wir haben zwischen dem Tatort und den Tagesthemen die eheliche Pflicht zu vollziehen. Mach das Licht aus und komm her!“
Gschwendtner musterte seinen Chef. Nein! Dieser Mann vögelt nicht,