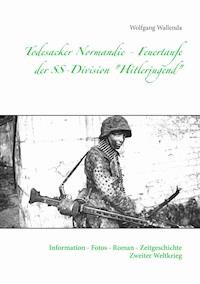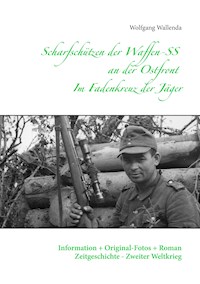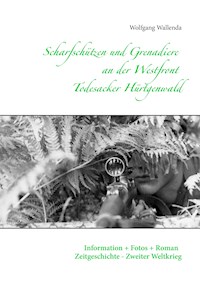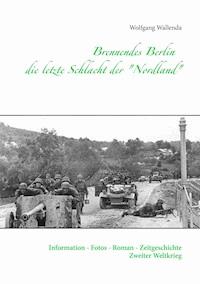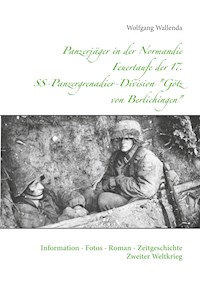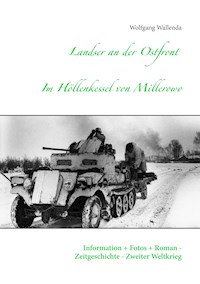Scharfschütze am Monte Cassino: "Manchmal höre ich sie heute noch schreien!" E-Book
Wolfgang Wallenda
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
"Manchmal höre ich sie heute noch schreien!", sagte Josef Altmann mehr als 50 Jahre nach der Schlacht um den Monte Cassino und verlor sich in seinen Gedanken. Instinktiv zuckte er zusammen, duckte sich zur Seite und suchte scheinbar Deckung vor einer imaginär heran rauschenden Granate. Als Angehöriger des Regiments 361 erlebte der ehemalige Fremdenlegionär die erbarmungslosen Kämpfe an der Gustav-Linie und rund um den Monte Cassino. Der Krieg hatte eine unfassbare Grausamkeit erreicht und der Tod schlug täglich gnadenlos zu. Altmann wird im Schnelldurchlauf zum Scharfschützen ausgebildet und sofort an der Front eingesetzt. Durch das Zielfernrohr erkennt er die Gesichter seiner Opfer. Die Hände beginnen zu zittern, das Herz rast. Gänsehaut überzieht seinen Körper. Angst, Elend, der Verlust seiner engsten Kameraden und die Schreie der Sterbenden lassen ihn, entgegen seiner anfänglichen Zweifel, abdrücken. Ohne Pathos, frei von Heldentum und erschreckend realitätsnah erzählt Josef Altmann seine Geschichte. Dieses Buch ist ein schonungsloser Tatsachenbericht und soll als Mahnmal gegen Kriege dienen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der nächste Krieg wird von einer Furchtbarkeit sein wie noch keiner seiner Vorgänger.
Bertha von Suttner
österr. Pazifistin
(* 09.06.1843 – † 21.06.1914)
Bis auf historische Persönlichkeiten sind alle Namen geändert.
Jegliche Ähnlichkeiten mit realen Personen wären rein zufällig.
Der Autor
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Scharfschütze am Monte Cassino: „Manchmal höre ich sie heute noch schreien.“
Vorwort
Ich schätzte Josef Altmann auf ungefähr 90 Jahre. Trotz seines hohen Alters wirkte er immer noch agil und kräftig. Sein Gesicht war wettergegerbt, der Blick freundlich. Es hatte mich sehr beeindruckt, dass er die Zugfahrt von Ludwigshafen bis ins Alpenvorland lediglich aus dem Grund auf sich nahm, um mich kennenzulernen. Natürlich hatte er dabei auch einen Hintergedanken: Sein Ziel war es, seine Lebensgeschichte zu erzählen und mich dazu zu bewegen, sie als weiteres Mahnmal gegen Kriege als Buch zu veröffentlichen.
Herr Altmann hatte damals über meinen Verlag Kontakt zu mir aufgenommen. Nach ein paar Telefonaten war ich neugierig geworden und stimmte schließlich seinem Wunsch auf ein persönliches Treffen zu.
Ich hatte schon mehrere Bücher zum Thema Zweiter Weltkrieg veröffentlicht und mich bei den vorangegangenen Recherchen bereits mit etlichen Kriegsveteranen getroffen. Sie berichteten alle über ihre Erlebnisse. Nicht etwa, um damit alte Zeiten wieder auf- und hochleben zu lassen, sondern, um sie vor dem Vergessen zu bewahren und die nächsten Generationen zu warnen.
Kein einziger Veteran glorifizierte das Dritte Reich oder den Krieg. Sie waren Opfer der Zeit, in die sie hineingeboren wurden, Opfer der Gleichschaltungspolitik des verbrecherischen Nazi-Regimes und letztendlich Opfer des von diesem Regime provozierten und begonnenen Zweiten Weltkriegs.
Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von ihnen während des Krieges auch zum Täter geworden war. Aber eines war mir klar: Ihre für uns unvorstellbaren Erlebnisse hatten sich gnadenlos in die Köpfe und Seelen dieser Veteranen eingebrannt.
Unauslöschlich!
Krieg ist Hölle.
Genau von dieser Hölle berichteten sie mir.
Die Masse der einfachen Soldaten wurde unfreiwillig einberufen. Herausgerissen aus dem normalen Leben, mussten sie ihre Familie zurücklassen und waren dazu verdammt, in einen Krieg zu ziehen, zu kämpfen und zu töten, um nicht selbst getötet zu werden. Die einzige menschliche Nähe, die sie spürten, war die Kameradschaft des Mannes, der neben ihnen im Dreck lag. Des Kameraden, der gemeinsam mit ihnen auf das Sterben wartete.
An den Fronten der Kriegsschauplätze fanden sie keine viel zitierte Landser-Romantik und kein sagenumwobenes Heldentum. Sie fanden Not, Elend, Leid und Unrecht.
Damals waren sie jung und geblendet. Infiltriert von nationalistischem Gedankengut folgten sie teils freiwillig, teils gezwungenermaßen dem Ruf eines Diktators und dessen Henkern. Sie zogen in einen Krieg, der zu dem größten Verbrechen in der Menschheitsgeschichte wurde.
Wie sehr diese Vergangenheit die Veteranen bedrückte und welche unsichtbare Last sie jahrzehntelang mit sich herumschleppten, offenbarten sie mir in ihren Geschichten.
Das hatte zur Folge, dass mir mittlerweile so viele Originalunterlagen und Interviews zur Verfügung standen, um mehrere Bücher schreiben zu können. Entsprechend verhalten reagierte ich zu Beginn der Telefonate mit Herrn Altmann. Doch nach und nach zog mich dieser Veteran in seinen Bann. Anders als seine ehemaligen Kriegskameraden lobte er meinen Debütroman über Monte Cassino nicht, sondern sagte mir sofort, was ich darin alles falsch wiedergegeben hatte. Es war konstruktive Kritik, die ich mir sehr zu Herzen nahm. Erst gegen Ende seiner Ausführungen sagte er: „Viele kleine Formalitäten konnten Sie gar nicht wissen, weil es Detailwissen von uns ehemaligen Wehrmachtsangehörigen ist, aber eines stimmt haargenau.“
Er machte eine Pause.
„Was denn?“, fragte ich neugierig.
„So, wie Sie es dargestellt haben, genau so war es. Haargenau so. Ich kann das beurteilen. Ich war dort. Ich habe es erlebt.“
Nach all der berechtigten Schelte tat dieses wirklich ehrlich gemeinte Lob richtig gut.
Zwei Wochen später stimmte ich einem Treffen zu. Wir fanden einen Termin und nach der Anreise von Herrn Altmann saßen wir zusammen in der Gaststube der Pension, in der er sich eingemietet hatte.
Nach dem üblichen Prozedere des persönlichen Kennenlernens öffnete er eine abgegriffene braune Aktentasche. Seine Hand fuhr hinein und zog einen Packen Papiere heraus. Er legte sie auf den Tisch und schob sie mir zu. „Das sind alles Fotokopien. Ich habe das Originalmaterial zu Hause. Sie belegen zum größten Teil meine Geschichte“, begann er.
Wie üblich legte ich einen Notizblock und einen Kugelschreiber zurecht, dann lehnte ich mich zurück und hörte zu. Mit ruhiger, sonorer Stimme berichtete Josef Altmann über seine Erlebnisse. Bereits nach wenigen Sätzen war ich gefesselt. Der Erzählstil war packend, schonungslos und ohne Pathos. Er verzog kaum eine Miene und unterbrach seinen Wortschwall nur, wenn er einen Schluck Wasser nahm oder merkte, dass ich mit meinen Notizen etwas nachhing. Nur einmal wurde es auf eine andere Art und Weise still um den alten Mann. Das war, als er über die Kämpfe bei Monte Cassino sprach. Plötzlich stockte er, dann hörte er auf zu sprechen. Seine Augen wurden feucht, sein Blick starr. Er sah regelrecht durch mich hindurch. Es war, als ob ich nicht anwesend wäre. In diesem Moment war er gedanklich wieder dort. Er befand sich mitten auf den Schlachtfeldern rund um den Monte Cassino und durchlebte alles noch einmal.
„Manchmal höre ich sie heute noch schreien!“, kam es diesmal mit brüchiger Stimme.
Ich bekam Gänsehaut.
Er schloss kurz die Augen. Als er sie wieder öffnete, war der Tunnelblick weg. Er hatte sich wieder gefangen, nahm einen Schluck Wasser und sagte: „Es gab Tage, da rauchten junge Kameraden eine ganze Schachtel Zigaretten oder tranken eine komplette Flasche Cognac am Tag, um das alles zu überstehen. Es war grausam, als die Granaten heranpfiffen und zwischen uns detonierten. Ich habe die Bilder nie wieder aus meinem Kopf bekommen. Es war ein Schlachtfeld, übersäht von Toten und Verwundeten. Da lagen Männer, die mit Armstümpfen winkten, um auf sich aufmerksam zu machen. Da waren junge Kerle, die aus ihren Deckungen krochen, doch ihnen fehlten die Beine. Wir wateten durch einen Brei aus Blut und Knochensplittern. Und dann immerzu diese gellenden Schreie. Sie können sich das nicht vorstellen, Monte Cassino war die Hölle.“
Mit feuchten Augen stand er auf und ging zur Toilette. Als er zurückkam, setzte er sich und erzählte sofort weiter. Ich ahnte, dass er sich an diesem Abend alles Erlebte von der Seele reden würde. Er räumte mit allem auf, das ihn bedrückte. Er befreite sich nach all den Jahrzehnten von einer zentnerschweren Last und wollte es der Nachwelt als Warnung hinterlassen.
Ich versprach ihm, das Material irgendwann zu verwenden. Er ahnte wohl damals schon, dass er es nicht mehr erleben würde, war mir aber dennoch dankbar. Als wir uns nach einem langen Abend verabschiedeten, sah ich Herrn Altmann die Erleichterung an. Eine Woche später erhielt ich einen handgeschriebenen Brief und sein Original-Afrika-Ärmelband zur Erinnerung an dieses Gespräch. Es war sein Dankeschön für alles.
Heute sitze ich am PC, betrachte die mir überlassenen Dokumente, schlage meine Notizen auf und löse mein gegebenes Versprechen ein.
Der Autor
Scharfschütze am Monte Cassino: „Manchmal höre ich sie heute noch schreien.“
Afrika, Mitte März 1943
Zwischen den Fieberschüben, die mich abwechselnd mit Schüttelfrost und glühender Hitze plagten, lag ich wach, zumindest wenn man diesen Zustand überhaupt als Wachsein bezeichnen konnte. Ich befand mich irgendwo zwischen der Realität und einem dahinsiechenden Delirium. Es roch nach Urin und Kot, nach Karbol, Eiter und Tod. Die Luft war tagsüber stickig und heiß. Nachts hingegen kroch eisige Kälte in die unbeheizten Räume und man fror trotz zweier Wolldecken. Wenn es an der Front rumste, hörte man die Detonationen der Granaten bis hierher. Sie übertönten dann das permanente Stöhnen der Schwerverwundeten.
Eine Krankenschwester tupfte mit einem feuchten Tuch über meine Stirn. Ein Arzt notierte etwas auf ein Blatt Papier und gab es einem hinter ihm stehenden Sanitätssoldaten. Er murmelte dabei etwas, das ich nicht verstand, dann ging er weiter. Der Blick, den mir der Sani zuwarf, verhieß nichts Gutes. Die Krankenschwester versuchte, mir Tee einzuflößen. Vorsichtig half sie mir, den Kopf anzuheben.
„Nur etwas nippen“, hörte ich sie sagen.
Die braune Brühe war lauwarm. Ich benetzte erst die Lippen und wollte dann gierig den Becher leeren. Doch kaum hatte ich zwei kleine Schlucke gemacht, nahm sie den Becher weg und stellte ihn zur Seite.
„Sie müssen langsam trinken“, mahnte sie und stand auf. „Ich komme gleich wieder.“
Sie ging zum nächsten Krankenbett. Ihr Körper wurde augenblicklich zur Silhouette. Ich sackte wieder weg.
Es war nicht das erste Mal, dass ich in Afrika war.
Ich stamme aus einer Artistenfamilie. Meine Eltern besaßen einen kleinen Wanderzirkus, mit dem wir von Mai bis Oktober quer durch Europa reisten. Nach den mehr oder weniger erfolgreichen Tourneen kehrten wir im Spätherbst ins Saarland zurück. Dort lag unser Dorf, das zugleich das Winterquartier war.
Ursprünglich stammen wir aus dem Elsass. Meine Großmutter war Französin, Großvater Deutscher. Gegen Ende des Ersten Weltkrieges zogen sie im Sommer 1918 mehr notgedrungen als freiwillig zu meinem Großonkel ins Saarland im Deutschen Reich. Seither sind wir Deutsche. Ich bin zweisprachig aufgewachsen und lernte auf unseren Reisen als dritte Fremdsprache englisch.
Da wir mit dem Zirkus ständig unterwegs waren, war ich nie in die Hitlerjugend eingetreten, was ich damals als sehr nachteilig empfand. Wenn wir gastierten und auftraten, saßen immer wieder junge Burschen in der HJ-Uniform unter den Zuschauern. Ich beneidete meine Altersgenossen darum und wäre selbst liebend gern in so eine Uniform geschlüpft. Vor allem, wenn wir vor oder nach den Vorstellungen ins Gespräch kamen und sie mir von den Abenteuern erzählten, die sie in der HJ erlebten. Die Älteren durften sogar schießen.
Ich wusste damals nicht, dass sie vom Naziregime bereits in jungen Jahren zu Soldaten erzogen wurden. Es standen sowohl körperliche als auch ideologische Schulungen auf dem Tagesprogramm der Hitlerjugend. Aus den Kindern von heute wurden bereits die Soldaten von morgen geformt. Ein Leitspruch der HJ lautete: „Was sind wir? Pimpfe! Was wollen wir werden? Soldaten!“
Meine Eltern waren sehr liberal eingestellt und vermieden es, über Politik zu sprechen. Großvater hingegen schwärmte für Adolf Hitler und dessen Auftreten, während Großmutter sich verständlicherweise mehr zu Frankreich hingezogen fühlte und das politische Geschehen in Deutschland mit Argwohn betrachtete.
Ich stand stets in der Mitte davon und interessierte mich nicht wirklich für Politik. Es war etwas anderes, das mich anzog. Es war das Militär. Fasziniert von Uniformen aller Herrenländer und mit jeder Menge Abenteuerlust im Bauch hatte ich damals nur ein Ziel: Ich wollte Soldat werden. Ich war durch das Reisen und die Auftritte im Zirkus trotz meines jungen Alters bereits sehr selbstbewusst und weltoffen. Für mich war das Soldatentum gleichgesetzt mit Heldentum, Einsätzen in fernen Ländern und Abenteuer pur.
Seit ich ein Kleinkind war, trainierte ich meinen Körper. Meine beiden älteren Brüder und ich schwangen auf Trapezen herum und halfen beim Auf- und Abbau des großen Zeltes mit. Ich war meinem biologischen Alter weit voraus und man schätzte mich stets zwei, drei Jahre älter als ich tatsächlich war. Diesen Umstand machte ich mir 1938 während einer Tour durch Elsass-Lothringen zunutze.
Für die Wehrmacht war ich eindeutig zu jung. Dort sah ich auch keine Möglichkeit, durch Fälschen meiner Papiere vorzeitig aufgenommen zu werden. Ich konnte mir nicht vorstellen, die deutsche Bürokratie betrügen zu können. Deshalb geisterte mir das Anmustern in einer anderen militärischen Einheit immer mehr im Kopf herum. Eine Truppe, die damals schon sagenumwoben war, hatte es mir angetan.
Die Légion étrangère.
Es hieß, in der Fremdenlegion wird jeder genommen und nicht lange nach seinen Papieren befragt. Sie war der richtige Ort für Abenteurer und das Tor zur großen weiten Welt. Und wenn jemand mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, würde er dort eine neue Identität erhalten. Man musste sich nur für fünf Jahre verpflichten.
Naiv wie ich war, manifestierte sich dieser Gedanke in meinem Kopf und so stur wie ich war, setzte ich mein Vorhaben kurze Zeit später auch in die Tat um.
Als wir in Metz gastierten, stromerte ich tagsüber durch die Stadt. Ich fand ein Werbebüro der Fremdenlegion und wusste, was zu tun war. Ich hatte eine Entscheidung gefällt und mein Entschluss stand fest. Nachdem wir mit dem Zirkus weitergezogen waren und das Zelt aufgebaut war, packte ich meine wenigen Sachen, hinterließ meiner Familie einen Brief, reiste zurück nach Metz und bewarb mich im Büro der Légion étrangère.
Ich fand in der Legion alles, nur nicht das, wonach ich gesucht hatte. Es war eine harte und entbehrungsreiche Männerwelt. Wir saßen in einem Fort mitten in der Wüste Marokkos und der Alltag war stumpf, langweilig und trist. Das Wasser roch nach Blech, war warm und brachte immer wieder den einen oder anderen von uns auf die Krankenstation.
Dort lag man des Öfteren mit Malaria, Durchfall oder wenn man sich in einem der billigen Araber-Bordelle mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt hatte.
Unter den Legionären war Gewalt an der Tagesordnung. Es wurde viel Alkohol getrunken und Homosexualität war, wohl auch aufgrund der Abgeschiedenheit des Kasernenlebens, weit verbreitet. Mitunter kam es untereinander zu Vergewaltigungen.
Wer zu schwach war, zerbrach in der Legion. Wer in einer Gruppe mit falschen Kameraden landete, hatte nichts zu lachen. Die körperlich Starken regierten und die Schwachen fügten sich, außer sie waren eiskalt und schnell mit dem Messer. Dann fürchtete man sie.
Die militärische Hierarchie wurde streng eingehalten und Disziplin großgeschrieben. Es gab bereits für allerkleinste Vergehen drakonische Strafen. Hierzu reichte es unter anderem schon aus, wenn man eine ungepflegte Ausrüstung oder Uniform trug oder beim Küchendienst, zu dem man regelmäßig eingeteilt wurde, schlampig Kartoffeln schälte.
Auch wenn man im alltäglichen Kasernenleben zerstritten und verhasst miteinander umging, im Einsatz war alles anders. Kaum marschierte man aus dem Tor in die Wüste hinaus, hielten alle zusammen. Die Truppe stand wie ein Mann. Jeder gab für den anderen sein Leben. Nationalität oder Religion spielten hier keine Rolle. Der Deutsche stand neben dem Spanier, dem Italiener, dem Russen und dem Schweden. Die Muslime kämpften neben den Juden und diese neben den Christen.
Ohne Ausnahme hielten wir uns an den sieben Punkte umfassenden Ehrenkodex der Fremdenlegion.
1. Legionär, du bist ein Freiwilliger, der Frankreich mit Ehre und Treue dient.
2. Jeder Legionär ist dein Waffenbruder, gleich welcher Nationalität, Rasse oder Religion. Du bezeugst ihm jederzeit engste Verbundenheit, so als wäre er dein leiblicher Bruder.
3. Du respektierst deine Traditionen und bist deinen Vorgesetzten treu ergeben. Disziplin und Kameradschaft sind deine Stärke, Mut und Treue deine Tugenden.
4. Deinen Status als Fremdenlegionär zeigst du durch tadelloses, immer elegantes Äußeres, dein Benehmen ist würdevoll und zurückhaltend. Deine Kaserne und deine Unterkunft sind immer sauber.
5. Als Elitesoldat trainierst du unerbittlich, du behandelst deine Waffe, als wäre sie dein höchstes persönliches Gut, du bist ständig bestrebt, deine körperliche Verfassung zu verbessern.
6. Der erteilte Befehl ist heilig, du führst ihn, unter Respektierung der Gesetze und international geltender Konventionen, bis zu seiner Erfüllung aus - sollte es nötig sein, unter Einsatz deines Lebens.
7. Im Kampf agierst du umsichtig und mit kühlem Kopf sowie ohne Hass, du achtest deine besiegten Feinde. Deine gefallenen und verwundeten Kameraden, sowie deine Waffen lässt du niemals zurück.
Wenn wir durch die Wüste marschierten und ein Lied sangen, zitterten die Bewohner der umliegenden Dörfer vor lauter Angst. Frankreich zeigte Macht durch Härte.
Das Motto der Legionäre lautete damals, wie auch heute noch: Legio Patria Nostra (Die Legion ist unser Vaterland) und Honneur et Fidélité (Ehre und Treue)
Ich hatte in zweifacher Hinsicht Glück. Erstens kam ich in einen Zug, dessen harter Kern aus elf Deutschen bestand, vor denen jeder Respekt hatte und ich deshalb nie Ziel von Attacken gleichgeschlechtlicher Liebe wurde. Zweitens landete ich aufgrund meiner guten Fremdsprachenkenntnisse ziemlich zügig in der Schreibstube, weshalb ich nur an wenigen Exkursionen gegen aufständische Berber teilnehmen musste.
Mit dem Ausbruch des Krieges zwischen Deutschland und Frankreich saßen die deutschen und österreichischen Legionäre zwischen zwei Stühlen. Für die Franzosen waren wir halbe Feinde, für die Deutschen galten wir als Vaterlandsverräter und das, obwohl wir unseren Eid auf die Fahne der Legion und nicht auf die Flagge Frankreichs abgelegt hatten. Entsprechend unserer Position zwischen zwei Stühlen verharrten wir stillschweigend und warteten ab, was passieren würde.
Als das Deutsche Reich 1941 seinem italienischen Waffenbruder in Afrika beiseite stehen musste, erinnerte man sich an uns Legionäre. Man öffnete eine Tür zur Heimat, indem man uns eine Möglichkeit bot, in die Wehrmacht einzutreten.
Die Beweggründe der rund 2000 Legionäre, die das Angebot annahmen, waren unterschiedlich. Manche wollten ihrem Vaterland dienen und für das Deutsche Reich kämpfen, andere wiederum identifizierten sich mit dem nationalistischen Gedankengut des Regimes. Die meisten Kameraden, die ich kannte, sahen darin jedoch, ebenso wie ich, eine schnelle Möglichkeit, die Fremdenlegion zu verlassen. Es war ein Ausweg aus dem Moloch der Einöde, in der wir tagein, tagaus für wenig Sold unseren harten Dienst verrichteten.
Außer mir selbst meldeten sich weitere neun meiner engsten Kameraden freiwillig für den Übertritt von der Legion in die Wehrmacht. Wir durchliefen die damals üblichen Überprüfungen und als feststand, dass sich unter uns kein gesuchter Verbrecher oder politischer Gegner befand, wurden wir schließlich im sogenannten verstärkten Afrika-Regiment 361 zusammengefasst.
So freundlich, wie wir hofften, war der Empfang bei der Heimkehr ins Reich jedoch nicht. Man betrachtete uns argwöhnisch und wir kamen vom Regen in die Traufe.
Ähnlich den Bewährungseinheiten 500 und 999 für militärische Straftäter wurde das Afrika-Regiment 361 ebenfalls vornehmlich an den hart umkämpften Brennpunkten der Front eingesetzt. Wir sollten uns dadurch von dem Makel des vorgehaltenen Vaterlandverrats befreien. Und genau das taten wir, denn wir waren keine einfachen Soldaten. Wir waren hart ausgebildete Wüstenkrieger, die das Land und das entbehrungsreiche Leben in diesem kargen Landstrich der Erde bestens kannten. Wir ernteten nach und nach Respekt und Anerkennung, doch der Preis für diese Art der Rückkehr in die Heimat war für viele Legionäre hoch. Sie zahlten mit ihrem Leben.
Erst ruckelte es heftig, dann folgte starkes Bremsen. Durch die Fliehkraft rutschte ich nach vorn. Mein Kopf stieß gegen etwas Hartes. Ein kurzer, heftiger Schmerz war zu spüren. Ich war schlagartig wach, aber durch das Fieber immer noch ziemlich benommen. Ich registrierte das Brummen von Motoren. Als ich die Augen öffnete, blickte ich in ein bekanntes Gesicht. Es war das runde und feuerrote Mondgesicht des immer gut gelaunten Erwin Müller aus Oberbayern. Ein Kamerad, mit dem man Pferde stehlen konnte. Es tat gut, Erwin zu sehen. Seine Anwesenheit gab mir Sicherheit. Er war ein Kamerad, der nie jemanden im Stich ließ, absolut zuverlässig und komplett verschwiegen war. Der Oberbayer hatte noch nie jemanden verpfiffen, der etwas ausgefressen hatte. Nicht einmal, wenn er selbst dafür die Strafe abbekommen hatte.
Erwin nahm sogar einmal eine Woche Bunker auf sich, obwohl er fälschlicherweise beschuldigt worden war, den Wein eines Kameraden gestohlen und ausgetrunken zu haben. Nachdem Erwin die Woche abgesessen hatte und wieder raus durfte, dauerte es nicht lange und ein Schweizer Kamerad lag mit Gesichtsschwellungen und Rippenbrüchen in der Krankenstation. Der Schweizer behauptete damals felsenfest, dass er gestürzt war. Jeder von uns wusste aber, dass Erwin den wahren Täter unter vier Augen zur Rechenschaft gezogen hatte.
„Bon jour camarade“, begrüßte mich das Mondgesicht mit seinem unverkennbar bayrischen Akzent und lachte dabei. „Na, du alter Zirkusclown, bist du endlich aufgewacht?“
Ich lag auf der Pritsche eines Lastwagens. Das erklärte auch das Ruckeln und Schaukeln.
„Hast du geglaubt, wir lassen dich zurück?“
Ich wollte antworten, doch mein Mund war trocken. Mein Sprechversuch klang wie das Aufklappen einer Munitionskiste mit verrosteten Scharnieren. Erwin schraubte den Deckel einer Feldflasche ab und hielt sie mir an die spröden, aufgerissenen Lippen. Ich öffnete den Mund. Er kippte etwas Wasser hinein. Ein Teil davon rann an den Mundwinkeln wieder heraus und versickerte irgendwo zwischen Kragen und Wolldecke. Das, was im Mund verblieb, war eine Wohltat.
„Der Tommy drückt gewaltig gegen die Mareth-Linie. Unsere Kameraden halten die Stellung zwar immer noch, aber es sieht nicht gut aus. Das Lazarett wurde bereits aufgelöst. Es geht Richtung Tunis“, erzählte er.
Ich bekam nur ein paar Brocken von dem, was Erwin sagte, mit. Das Fieber warf mich schnell zurück ins Delirium.
Als ich das nächste Mal aufwachte, blickte ich auf Wellblech, das auf gebogene Stahlträger geschmiedet war. Propellermotoren dröhnten. Ich befand mich an Bord einer Ju 52, die Richtung Sizilien flog.
Nach einer Zwischenstation in einem Militärhospital auf Sizilien folgten lange Lazarettaufenthalte in Apollonia/Griechenland und Gars am Inn.
In Apollonia erfuhr ich vom Schicksal des Afrika Korps. Die Kapitulation meiner Kameraden hatte mich hart getroffen. Ich wusste nicht, wer von ihnen noch lebte, wer gefallen und wer in Gefangenschaft geraten war. Fest stand, dass das Afrika Korps nicht mehr existierte. Rund 150.000 deutsche und etwa 125.000 italienische Kameraden waren in Gefangenschaft geraten.
Als die Alliierten am 09. September 1943 in Salerno/Italien landeten, war ich auf dem Weg nach Gars am Inn. Ich hatte mehr als 10 Kilo Körpergewicht verloren, fühlte mich noch immer schwach auf den Beinen, war aber insgesamt auf dem Weg der Besserung.
Im Oktober 1943 erreichte mich ein Feldpostbrief meines Legionär-Kameraden Eduard Schwarz. Ede oder Oberlehrer, wie wir ihn nannten, war ziemlich intelligent. In der Legion hatte er den Rang eines Korporals. In der Wehrmacht wurde er zwischenzeitlich zum Unteroffizier befördert. Ede stammte aus einer Kölner Juristenfamilie und hatte bereits ein paar Semester Jura studiert. Liebeskummer hatte ihn dazu getrieben, über Nacht alles abzubrechen und sein Komfortleben zurückzulassen. Ede fand wohl seinen inneren Frieden in der Legion. Der Oberlehrer schrieb, dass außer ihm auch Erwin Müller, Richard Buchecker, Willi Faber und Alfred Kummerer dem Kessel entkommen waren. Drei Kameraden aus unserem alten Zug waren tot, einer galt als vermisst. Alle anderen gerieten vermutlich in Gefangenschaft.
Ede teilte in seinem Brief weiterhin mit, dass man sie nach Sardinien gebracht hatte. Dort war der Rest des Regiments 361, darunter etwa 80 Legionäre aus unserem Bataillon, in die neu aufgestellte 90. Panzergrenadier-Division eingegliedert worden.
„80 von ehemals 850“, murmelte ich, trauerte um die Toten und freute mich, dass es zumindest ein paar meiner engsten Kameraden geschafft hatten. Ich starrte sekundenlang vor mich hin. In diesem Moment wurde mir klar, dass diese Männer mehr als Kameraden für mich waren. Es waren meine Freunde. Die Besten, die man sich wünschen konnte.
Neben dem Oberlehrer und Erwin mit dem ewig feuerroten Mondgesicht waren also noch drei Legionäre aus meinem Zug dem Kessel entkommen.
Alfred Kummerer war Pfälzer und gelernter Metzger. Er hatte uns in Afrika mehr als einmal mit Köstlichkeiten aus frisch geschlachteten Rindern oder Schafen verwöhnt.
Beim Stichwort Schaf fiel mir sofort Richard Buchecker ein. Er war vormals Schäfer irgendwo an der Ostseeküste. Richard war der kräftigste Mann, den ich kannte. Ich hatte ihm oft vorgeschlagen, dass wir nach der Legion zusammen im Zirkus meiner Eltern auftreten könnten. Er würde dort als stärkster Mann der Welt vorgestellt und garantiert für ein ausverkauftes Zelt sorgen. Richard war um die zwei Meter groß und wenn er im Türrahmen stand, wurde es im Raum dunkel. Er hatte ein gutes Gemüt. Und wer in der Legion als sein Freund galt, wurde von niemandem belästigt. Warum Richard zur Legion gegangen war, wusste niemand so genau. Richard war extrem wortkarg. Wenn er zwei Sätze am Tag hervorbrachte, war das viel. Er wurde deshalb von allen nur der Stumme genannt.
Willi Faber war ein Hamburger Junge vom Kiez. Sein Spitzname war Pocke, weil sein Gesicht mit Pockennarben übersät war und einer Kraterlandschaft glich. Willi landete in der Legion, weil er sich mit der Hamburger Unterwelt angelegt hatte. „Ich habe beim Kartenspielen ein paar Zuhälter um ihr Bargeld erleichtert. Da war ich meines Lebens nicht mehr froh“, erzählte er und hatte dabei verschmitzt gegrinst.
Eine Woche, nachdem ich den Brief erhalten hatte, wurde ich als genesen entlassen. Man steckte mich in das Panzergrenadier Ersatz-Bataillon 104 in Landau/Pfalz und dort wurde ich, trotz oder wohl aufgrund meiner langen Krankheit, sofort in Urlaub geschickt. Ich durfte 14 Tage nach Hause fahren.
Viel Grund zur Freude gab es jedoch nicht. Großvater war zwei Monate zuvor gestorben. Meine Großmutter erzählte mir, dass Opa stolz auf mich war, weil ich Soldat geworden bin. Die Legion mochte er zwar nicht, aber dass ich im Afrika-Korps diente, verbreitete er überall. Leider gab es auch weitere schlimme Schicksale zu verdauen. Meine beiden Brüder waren kurz hintereinander von der Wehrmacht eingezogen worden. Beide mussten an die Ostfront. Robert fiel bei den Kämpfen am Dnjepr und wurde irgendwo in Russland begraben. Oskar lag mit einem Lungensteckschuss in einem Lazarett in der Nähe von Kiew. Womöglich war das auch ein Grund, weshalb man mich so unerwartet nach Hause geschickt hatte.
Die Zeit mit meiner Familie tat mir gut. Ich wurde gut bekocht und erholte mich zusehends. Als ich am Ende des Urlaubs zu meiner Einheit nach Landau fuhr, versprach ich meiner Mutter, dass ich ihr immer wieder schreiben und gut auf mich aufpassen würde. Ab diesem Tag versuchte ich, so oft es ging Notizen zu machen.
Meine Zeit beim Ersatz-Bataillon war ziemlich schnell beendet und ich musste mich bei der 3. Kompanie des Ausbildungs-Bataillons in Neustadt an der Weinstraße melden.
Wiederum nur vier Wochen später wurde ich in die Schreibstube gerufen. Ich sollte meine erneute Versetzung entgegennehmen. Mein Herz raste schneller als ein Maschinengewehr feuerte. Mir war klar, dass es diesmal zu einer Fronteinheit gehen würde. Da ich ehemaliger Legionär war, hatte ich größte Hoffnung, wieder zu meinem alten Haufen zu kommen. Entsprechend aufgeregt betrat ich das Backsteingebäude, ging schnellen Schrittes den Flur entlang und atmete vor dem Schreibbüro ein paarmal tief ein und aus. Die Tür war nur angelehnt und ich schob sie auf. Der Spieß hob kurz den Kopf. Ich lächelte, machte einen Schritt nach vorn und sagte salopp mit höflichem Ton: „Guten Tag zusammen. Grenadier Altmann. Ich soll herkommen.“
Ein Schreibstubensoldat wirbelte gekonnt mit den Fingern über die Tastatur einer Schreibmaschine. Noch bevor ich meinen Satz beendet hatte, verebbte augenblicklich das klackernde Anschlagen der Typenhebel auf der Walze. Er hatte aufgehört zu tippen und starrte abwechselnd erst mich, dann den Spieß an. Der Hauptfeldwebel warf mir einen scharfen, schrägen Blick zu, widmete sich wieder dem Dokument, das er gerade las und unterzeichnete es.
Hauptfeldwebel in der Wehrmacht war kein eigenständiger Dienstrang, sondern eine Dienststellung. Er war der Kompaniefeldwebel und kenntlich an den beiden Kolbenringen an den Ärmeln der Feldbluse. Der Spieß war die sog. Mutter der Kompanie. Er entlastete den Kompanieführer und führte die Schreibstube und im Feld sorgte er auch beim Tross für Ordnung. Kurzum, der Spieß war eine besondere Respektsperson.
Mit grimmigem Blick erhob sich der Kompaniefeldwebel und schmetterte mir völlig unerwartet und in einer gewaltigen Lautstärke entgegen: „Ich glaube, ich spinne! Sie gehen augenblicklich wieder raus, kommen nochmal rein und machen anständig Meldung! Wenn das nicht klappt, jage ich sie mit vollem Marschgepäck bis Mitternacht um den Kasernenhof! Verstanden?“
Ich war perplex und stand wie versteinert da.
„Raus hier!“ Er brüllte mit solcher Intensität, dass sein Kopf hochrot anlief und die pulsierende Schlagader am Hals hervortrat. Sein Arm schoss wie beim Hitlergruß nach oben, nur war die Hand nicht flach, sondern sein Zeigefinger wies mir den Weg zur Tür. „Raus!“, wiederholte er.
Ich verließ sofort die Schreibstube, zog die Tür hinter mir zu und holte tief Luft. Diesen Anschiss musste ich ein paar Sekunden lang verdauen. Ich verfluchte den Kommiss, warf dem Kompaniefeldwebel im Stillen etliche Ausdrücke an den Kopf und sammelte mich. Ich schob die Tür wieder auf und betrat die Schreibstube zum zweiten Mal. Unüberhörbar stampfte ich mit den Knobelbechern auf den Boden, schlug die Hacken zusammen, stand stramm und streckte den rechten Arm aus. „Heil Hitler, Herr Hauptfeldwebel. Grenadier Altmann meldet sich zur Stelle. Ich wurde hierher beordert.“
Der Spieß ließ mich ein bis zwei Minuten warten, lehnte sich schließlich zurück und sprach seinen Gehilfen an. „Schneider, haben wir etwas von einem Altmann da? Er kann noch nicht so lange hier sein. Der Name ist mir nicht geläufig.“
Es raschelte. Sekunden später hob der Schreibstubensoldat ein Schriftstück hoch. „Er kam von der Fünften rüber. Ist ein ehemaliger Legionär und wird wieder an die Front versetzt.“ Schneider stand auf und brachte dem Spieß das Schriftstück. Dieser flog kurz darüber und winkte mich zu seinem Schreibtisch. „Na also, geht doch. Viel haben sie euch in der Fremdenlegion wohl nicht beigebracht. Hier bei uns herrscht Zucht und Ordnung“, bekam ich zu hören. „Her mit dem Soldbuch.“
Ich ersparte mir jeglichen Kommentar und überreichte das Soldbuch, um sofort wieder in Hab-Acht-Stellung zu gehen. Der Spieß nahm Notiz davon und murmelte ein: „Stehen Sie bequem.“
Ich schob den rechten Fuß leicht nach vorn.
Ein paar Augenblicke später schob ich mein Soldbuch wieder ein und hielt ein Schreiben in der Hand. Es war mein Marschbefehl. „Als ehemaliger Angehöriger des Afrika-Regiments 361 werden Sie wieder ihrem alten Haufen zugeteilt. Sie gehören ab sofort zur 90. Panzergrenadier-Division. Regiment 361, II. Bataillon, 7. Kompanie. Das Marschbataillon rückt morgen früh um 07.30 Uhr ab.“
„Jawohl, Herr Hauptfeldwebel“, antwortete ich zackig und unterdrückte meine Freude. Das war genau die Einheit, in der meine Kameraden dienten. Ich würde auf den Oberlehrer und die anderen treffen. Und wie ich Ede kannte, hatte er längst beim Spieß oder beim Kompanieführer für so einen Fall vorgesorgt und meinen Namen vormerken lassen.
„Was glotzen Sie so? Dachten Sie, wir schicken Sie auf Weihnachtsurlaub? Raus hier!“
Ich war zufrieden. Das Geplärr drang in ein Ohr ein und flutschte beim anderen sinnbildlich wieder hinaus.
„Jawohl, Herr Hauptfeldwebel“, wiederholte ich, grüßte militärisch, drehte mich um und ging zum Packen auf meine Stube.
Die Wehrmacht war eine sehr moderne Armee mit neuen Strukturen. Während ihres Aufbaus besann man sich u.a. auf die Schriftstücke des französischen Offiziers Ardant du Picq. Du Picq, der 1870 im Krieg gegen Deutschland gefallen war, studierte antike und moderne Schlachten und schrieb in seinem Buch Etudes sur le combat über Kampfkraft und Kampfmoral der Soldaten. Demnach kämpften Männer, die sich kannten, verbissener und standen füreinander ein, während der Zusammenhalt und damit die Kampfkraft und -moral bei Soldaten, die sich fremd waren, nicht so ausgeprägt waren. Mit anderen Worten: Je mehr sich die Soldaten untereinander verbunden fühlten, desto stabiler war ihr Auftreten als geschlossener Verband.
Das Deutsche Reich machte sich diesen Umstand zunutze und baute das neue Heer auf landsmännischer Basis auf. Männer aus gleichen Regionen dienten in den gleichen Einheiten. Sie sprachen den gleichen Dialekt, hatten die gleichen Einstellungen und kannten sich oftmals seit Jahren oder waren sogar miteinander verwandt. Erst als im Lauf des Krieges die Verluste immer größer wurden, konnte man diese Art der Rekrutenzuteilung nicht mehr gezielt durchführen.
Die nächste Säule des militärischen Erfolges der Wehrmacht lag in der Ausbildung. Jeder deutsche Soldat war mit seinen Waffen so vertraut, dass er sie mit verbundenen Augen zerlegen und wieder zusammensetzen konnte. So gerieten sie im Einsatz z. B. bei Ladehemmungen nicht oder weit weniger in Panik, da das Problem oftmals mit einigen Handgriffen gelöst werden konnte.
Eine weitere positive Neuerung war eine kleine, aber wirkungsvolle Veränderung der inneren Struktur. Während im Weltkrieg von 1914 bis 1918 noch eine strikte Trennung von Mannschaften, Unteroffizieren, Offizieren und Generalsstäben herrschte, war das in der Wehrmacht anders.
Jeder Soldat hatte bei Eignung die Möglichkeit, bis an die Spitze aufzusteigen.
Jeder Wehrmachtsangehörige, vom einfachen Soldaten bis zum Feldmarschall, bekam das gleiche Essen.
Befehle wurden bis ins kleinste Glied besprochen. Rückte man ins Feld, wusste auch der einfache Landser, wie der Befehl lautete und welches Ziel man verfolgte. Fielen die Offiziere, führten die Unteroffiziere, fielen diese, führte der nächste Dienstrang. Die Männer konnten agieren und waren nicht hilflos, wenn ein Vorgesetzter ausfiel.
21. Dezember 1943
Marschierend und mit dem Westerwald-Lied auf den Lippen hatten wir die Kaserne verlassen. Wir verströmten nach außen fröhliche Gelassenheit. Die jungen Rekruten, das war ein Großteil unter den Männern, strahlten voller Stolz und Freude. Sie träumten von Heldentum und Orden. Die Älteren unter uns, zumeist Rückkehrer aus Lazaretten oder aufgeriebenen Einheiten, waren eher verhalten. Sie kannten den Krieg, die Front, das Entbehren und die damit verbundene Hölle auf Erden. Sie wussten, was auf sie zukommen würde.
Ich selbst hatte gemischte Gefühle. Ich freute mich einerseits auf das Wiedersehen mit meinen Kameraden, andererseits hatte ich Bedenken, wieder in den Kampf ziehen zu müssen. Das Töten war grausam. Wenn man hinter einem Maschinengewehr lag und in eine auf sich zulaufende, wabernde Masse feuerte, berührte das weniger, als wenn man bei einem Spähtrupp auf den Feind traf und ihn im Kampf, um das eigene nackte Leben zu retten, mit dem Bajonett, dem Spaten, einem Dolch oder mit bloßen Händen tötete. Dieses bittere Soldatenlos musste ich in Afrika kennenlernen. Töte oder stirb. Ich wollte leben, also tötete ich zwangsläufig. Die nächtlichen Spähtrupps in die ohnehin menschenfeindliche Wüste waren gefürchtet und verhasst. Man traf fast jedes Mal auf den Tommy und das bedeutete Nahkampf.
Ich schloss die Augen, als diese Erinnerungsbilder durch meinen Kopf schossen. Wie viele schlaflose Nächte hatte ich deshalb schon verbracht? Wie oft verfolgten mich die Gesichter der Männer, die ich töten musste? Wie Teufelsfratzen tanzten sie um mich herum, bis ich schweißgebadet aufwachte. Mit der Zeit wurde es besser. Aufgehört hat es nie.
Um mich abzulenken, klinkte ich mich in den Gesang ein und schmetterte lautstark die nächste Strophe mit. „… über deine Höhen pfeift der Wind so kalt, jedoch der kleinste Sonnenschein dringt tief ins Herz hinein …“
Wir wussten alle nicht, dass wir direkt in eine Hölle marschierten, deren Ausmaß man sich nicht vorstellen konnte. Der Teufel stieß die Pforte zu seinem Reich weit auf. Das Eingangstor hieß Monte Cassino. Tausende und abertausende Soldaten sollten es durchschreiten. Und wir marschierten geradezu bestens gelaunt und laut singend darauf zu.
Es war gut, dass keiner von den Männern in diesem Augenblick auch nur annähernd ahnte, dass rund dreiviertel von ihnen binnen der nächsten sechs Monate tot waren, als vermisst galten oder teils schwer verwundet in einem Lazarett vor sich hinsiechen würde.
Dem Feldwebel, der uns führte, schien das Lied sehr zu gefallen. Kaum war es zu Ende, rief er laut: „Und noch einmal! Auf geht’s, Kameraden!“
Und so schallte es aus voller Brust erneut: „Heute wollen wir marschieren, einen neuen Marsch probieren, auf den schönen Westerwald, da pfeift der Wind so kalt …“
Vor uns lagen rund 1200 Kilometer, die wir bis zur Front zurücklegen mussten. Zu Fuß, mit dem Lastwagen und hauptsächlich mit der Eisenbahn.