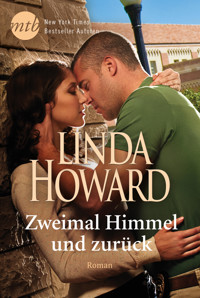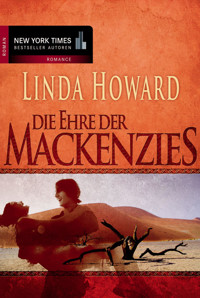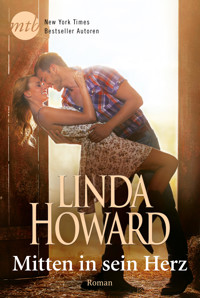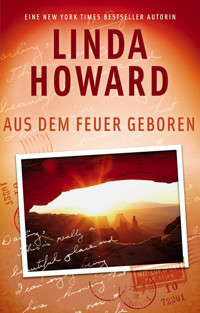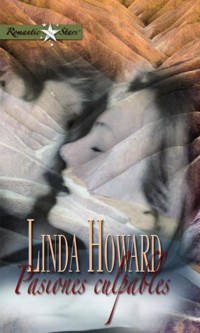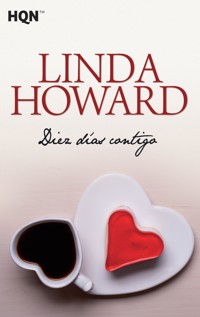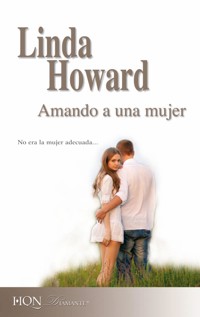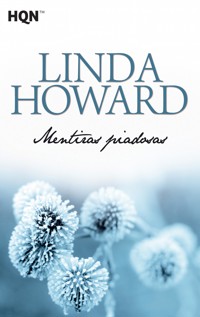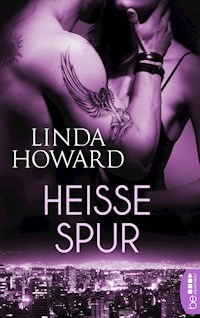
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Er ist der einzige, der ihr helfen kann. Doch kann sie ihm trauen?
Milla Edge spürt vermisste Kinder auf. Ihr Job beginnt, wenn die Polizei längst aufgegeben hat. Millas Vergangenheit hat sie hart gemacht, aber dann trifft sie auf James Diaz - einen ebenso undurchsichtigen wie attraktiven Mann, der sie sofort in seinen Bann zieht. Als sie bei der Verfolgung einer heißen Spur in Mexiko auf einen Kinderhändler-Ring stößt, ist sie auf James angewiesen. Er muss ihr helfen, den Kopf des Verbrechersyndikats aufzuspüren. Doch schnell muss Milla erkennen, dass sie selbst zur Gejagten geworden ist - und sie schwebt in tödlicher Gefahr ...
Nach der Blair-Mallory-Reihe mit "Die Doppelgängerin" und "Mordgeflüster" gibt es jetzt auch "Heiße Spur" von Linda Howard erstmals als eBook.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Weitere Titel der Autorin
Die Doppelgängerin
Mordgeflüster
Über dieses Buch
Milla Edge spürt vermisste Kinder auf. Ihr Job beginnt, wenn die Polizei längst aufgegeben hat. Millas Vergangenheit hat sie hart gemacht, aber dann trifft sie auf James Diaz – einen ebenso undurchsichtigen wie attraktiven Mann, der sie sofort in seinen Bann zieht. Als sie bei der Verfolgung einer heißen Spur in Mexiko auf einen Kinderhändler-Ring stößt, ist sie auf James angewiesen. Er muss ihr helfen, den Kopf des Verbrechersyndikats aufzuspüren. Doch schnell muss Milla erkennen, dass sie selbst zur Gejagten geworden ist – und sie schwebt in tödlicher Gefahr …
Über die Autorin
Linda Howard gehört zu den erfolgreichsten Liebesromanautorinnen weltweit. Sie hat über 25 Romane geschrieben, die sich inzwischen millionenfach verkauft haben. Ihre Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und mit vielen Preisen ausgezeichnet. Sie wohnt mit ihrem Mann und fünf Kindern in Alabama.
Linda Howard
Heiße Spur
Aus dem Amerikanischen von Christoph Göhler
beHEARTBEAT
Digitale Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2003 by Linda Howington
Titel der amerikanischen Originalausgabe: „Cry no more“
Originalverlag: Ballentine Books, New York
This translation published by arrangement with Ballantine Books, an Imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC
Für die deutschsprachige Erstausgabe:
Copyright © der deutschen Übersetzung 2004 by Verlagsgruppe Random House GmbH
Verlag: Wilhelm Goldmann Verlag, München
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Johanna Voetlause
Covergestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de unter Verwendung von Motiven © shutterstock: Gabriel Georgescu; © gettyimages: Phototreat
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar
ISBN 978-3-7325-6972-4
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Widmung
Meinen Freundinnen Beverly Barton, die so gern Porzellan zerschmeißt, und Linda Jones, die beide in Tränen ausbrachen, als ich ihnen erzählte, wovon diese Geschichte handelt.
Meiner Lektorin Kate Collins und ihren Kolleginnen im Verlag, die für dieses Buch wirklich Fantastisches geleistet haben. Ihr seid super.
Robin Rue, meinem Agenten, der es so lange mit mir ausgehalten hat. Ist dir klar, dass wir seit fast zwanzig Jahren zusammen sind? Viele Ehen halten weniger lang. Und für William Gage Wiemann, der nie dann auftaucht, wenn man mit ihm rechnet.
1
Mexiko 1993
Milla war über dem Stillen eingeschlafen. David Boone stand neben seiner Frau und seinem Kind, betrachtete die beiden liebevoll und spürte dabei ein leicht dümmliches Lächeln auf seinem Gesicht und ein stolzes Dehnen in seiner Brust. Seine Frau. Sein Kind.
O Gott, seine Welt.
Die alte Faszination, die Besessenheit von der Medizin war geblieben, nur wurde sie inzwischen von etwas abgemildert, das nicht weniger faszinierend war. Nie im Leben hätte er geglaubt, dass die Prozesse während der Schwangerschaft und Geburt, die rapide Entwicklung eines Säuglings ihn derart in ihren Bann ziehen könnten. Er war Chirurg geworden, weil er auf diesem Gebiet die größten Herausforderungen gesehen hatte; die Geburtshilfe war ihm dagegen immer so vorgekommen, als würde man dem Gras beim Wachsen zuschauen. Natürlich, manchmal lief die Sache schief, dann musste der Gynäkologe auf Draht sein, doch meistens wuchsen die Kinder von ganz allein im Bauch heran, bis sie irgendwann auf die Welt kamen, und fertig.
So hatte er zumindest gedacht, bis er selbst Vater geworden war. Im klinischen Sinn hatte er über jedes Detail der fötalen Entwicklung Bescheid gewusst, doch auf die überschwänglichen Gefühle, mit denen er beobachtet hatte, wie Milla zunehmend fülliger wurde und die kleinen Tritte und flatternden Bewegungen des Babys stärker und fordernder wurden, war er nicht gefasst gewesen. Und wenn schon er von Gefühlsstürmen gebeutelt worden war, wie hatte sich dann wohl Milla gefühlt? Sehr häufig, selbst während des aufreibenden, belastenden letzten Schwangerschaftsmonats, hatte er sie dabei ertappt, wie sie mit verzückter, gedankenverlorener Miene beinahe unbewusst ihren Bauch streichelte, und daraus geschlossen, dass sie sich in eine Welt zurückgezogen hatte, in der nur sie und das Baby existierten.
Und dann war Justin auf die Welt gekommen, gesund und munter, und David war wie betrunken vor Erleichterung und Euphorie gewesen. Seither waren sechs Wochen vergangen, in denen anscheinend jeder Tag, an dem der Säugling größer wurde, eine Veränderung gebracht hatte; der schwarze Flaum auf seinem Kopf war blond geworden, und die Augen wirkten viel blauer und wacher als zu Anfang. Inzwischen nahm Justin immer mehr wahr, er erkannte Stimmen und schwenkte die Arme und Beinchen in einem ruckhaften, unkoordinierten Rhythmus, unter dem seine kleinen Muskeln kräftiger wurden. Er badete für sein Leben gern. Er verfügte über ein zorniges Weinen, ein hungriges Weinen, ein greinendes Weinen und ein schlecht gelauntes Weinen. Milla hatte schon nach wenigen Tagen den Unterschied heraushören können.
Die Veränderungen in seiner Frau waren kaum weniger faszinierend. Milla hatte eine leicht weltfremde Aura gehabt, so als wäre sie lieber Beobachterin als Teilnehmerin. Ihre distanzierte Art hatte ihn schon bei ihrer ersten Begegnung herausgefordert, doch er hatte sie so lange eisern umworben, bis sie ihn schließlich als Menschen und nicht nur als Teil der Kulisse wahrnehmen musste. Noch heute konnte er genau sagen, wann er gewonnen hatte: Sie waren beide auf einer Silvesterparty gewesen, als Milla ihn inmitten des Gelächters, Geplauders und der Albereien angesehen und mit leicht verdatterter Miene geblinzelt hatte, so als wäre er ganz unerwartet in ihrem Blickfeld aufgetaucht. Mehr war nicht passiert; kein heißer Kuss, keine schwülstigen Beteuerungen in nächtlicher Dunkelheit, nur eine unerwartete Klarheit in ihrem Blick, als sie ihn endlich, wirklich wahrgenommen hatte. Dann hatte sie lächelnd seine Hand ergriffen, und mit dieser schlichten Berührung hatten sie sich aneinander gebunden.
Unglaublich.
Na gut, es war fast genauso unglaublich, dass er lang genug aus seinem Studien- und Arbeitszimmer aufgetaucht war, um sie auf einer dieser sterbenslangweiligen Partys, die sein Professor zu geben beliebte, zu entdecken, aber danach war ihm ihr Gesicht nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Sie war keine Schönheit; möglicherweise war sie nicht einmal besonders hübsch. Aber aus ihrem Wesen, aus den klaren, kraftvollen Linien ihres Gesichtes und ihrem Gang – diesem fast schwebenden Schritt, der auf ihn so wirkte, als würden ihre Füße kaum den Boden berühren – strahlte etwas, das ihm so beharrlich zusetzte wie ein unbeirrbarer Moskito.
Wie faszinierend es gewesen war, sie kennen zu lernen. Es beglückte ihn zu erfahren, dass ihre Lieblingsfarbe Grün war, dass sie keine Peperonis auf ihrer Pizza mochte, dass sie gern Actionfilme sah und Gott sei Dank Frauenfilme zum Gähnen fand, was ihn überraschte, da sie ansonsten durch und durch weiblich war. Woraufhin sie erwidert hatte, dass sie sich mit Frauengeschichten zur Genüge auskenne und sie keinesfalls auch noch im Kino anschauen wolle. Wo sie einem noch dazu meist unerträglich trivial serviert wurden. Ihre stille, heitere Art betörte ihn; falls sie jemals cholerische Ausbrüche hatte, dann hatte er bisher nichts davon mitbekommen. Sie war der ausgeglichenste Mensch, der ihm je begegnet war, und auch nachdem er zwei Jahre mit ihr verheiratet war, konnte er sein Glück kaum fassen.
Sie räkelte sich gähnend, wobei ihre Brustwarze aus dem schlaffen Mund des Babys flutschte, das daraufhin ein paar Mal grunzend nuckelte und dann weiterschlief. Fasziniert strich David mit einem Finger über die volle Rundung ihrer nackten Brust. Er musste es zugeben: Die Veränderungen an ihrem Busen gefielen ihm ausgesprochen gut. Vor ihrer Schwangerschaft war Milla mager gewesen wie eine Langstreckenläuferin. Seither war sie runder, weicher, und die sexuelle Zwangspause nach der Geburt trieb ihn allmählich in den Wahnsinn. Er konnte es kaum erwarten, bis sie morgen zu Susanna Kosper, der Gynäkologin in ihrem Team, ging, um die sechs Wochen nach der Geburt fällige Kontrolluntersuchung vornehmen zu lassen. Genau genommen waren inzwischen beinahe sieben Wochen vergangen, weil Susannas Terminplan durch mehrere Notfälle über den Haufen geworfen worden war, und er hielt den Druck fast nicht mehr aus. Durch Onanieren ließ sich die Spannung zwar lindern, aber das war längst nicht so erfüllend wie der Sex mit seiner Frau.
Sie schlug die Augen auf und lächelte ihn verträumt an. »Hey, Doogie«, murmelte sie. »Denkst du an morgen Abend?«
Er lachte sowohl über den Spitznamen, den sie ihm in Anlehnung an den jugendlichen Fernseharzt Doogie Howser verpasst hatte, als auch über ihre Gabe, seine Gedanken zu lesen – wobei seine Gedanken allerdings nicht schwer zu lesen waren. Seit zwei Monaten dachte er praktisch ausschließlich an Sex. »Ich denke an nichts anderes.«
»Vielleicht schläft Doogie Junior morgen mal durch.« Sie strich mit zärtlicher Hand über den flaumigen Kopf des Babys, und der Kleine reagierte mit ein paar Nuckelbewegungen. Beide Erwachsenen seufzten wie aus einem Mund: »Schön wär’s«, und David lachte noch mal. Justin war geradezu unersättlich; spätestens alle zwei Stunden wollte er die Brust haben. Milla hatte sich schon gesorgt, ihre Milch könnte vielleicht zu dünn oder zu knapp sein, doch Justin entwickelte sich prächtig, und Susanna hatte ihr versichert, sie brauche sich keine Sorgen zu machen, das Baby sei schlicht und einfach ein Vielfraß.
Milla gähnte wieder, und David strich ihr fürsorglich über die Wange. »Auch wenn dir Susanna morgen grünes Licht gibt, heißt das nicht, dass wir miteinander schlafen müssen. Wenn du zu erschöpft bist, können wir ebenso gut noch warten.« Susanna hatte ihm in drastischen Farben ausgemalt, wie kräftezehrend das Leben für eine junge Mutter war, vor allem wenn sie ihr Kind stillte.
Milla klappte mitten im Gähnen den Mund zu und sah ihn zornig an. »O doch, das müssen wir«, beteuerte sie entschieden. »Wenn du glaubst, dass ich auch nur eine Minute länger warte – Justin kann von Glück reden, wenn ich ihn nicht bei Susanna lasse und direkt zu dir in die Klinik flitze.«
»Wo du mich mit vorgehaltenem Skalpell zum Strippen zwingst?«, fragte er grinsend.
»Keine schlechte Idee.« Sie nahm seine Hand, legte sie auf ihre Brust zurück und rieb mit der Brustwarze über seine Finger. »Es ist schon über sechs Wochen her. Wir brauchen nicht auf Susannas offizielles Okay zu warten.«
Was für eine verlockende Idee. Tatsächlich war sie ihm auch schon gekommen, aber er hatte bei Milla nicht den Eindruck erwecken wollen, es ginge ihm ausschließlich um Sex. Erleichtert, dass sie die Idee selbst aufgebracht hatte, spürte er, wie die Versuchung an ihm zu zupfen begann. Er warf einen schnellen Blick auf die Uhr und stöhnte gequält auf. »Ich muss in zehn Minuten im Krankenhaus sein.« Schon jetzt würden die Patienten vor der Krankenhaustür Schlange stehen, bereit, stundenlang zu warten, nur um einen Arzt sprechen zu dürfen. Ihm blieb gerade noch Zeit, zur Klinik zu rasen, sich umzuziehen und seine Hände zu bürsten. Nicht dass er länger als zehn Sekunden zum Höhepunkt gebraucht hätte, so geladen wie er war, aber Milla hatte ganz eindeutig mehr Zeit verdient.
»Dann bleibt es eben bei heute Abend.« Milla drehte sich zur Seite und lächelte zu ihm auf. »Ich lasse Justin so wenig wie möglich schlafen, damit er heute Abend müde ist.«
»Guter Plan.« Er stand auf und griff nach seinen Schlüsseln. »Was hast du heute vor?«
»Nicht viel. Ich will am Morgen auf den Markt, bevor es zu heiß wird.«
»Bring Orangen mit.« In letzter Zeit lechzte er ständig nach Orangen, so als verzehrte sich sein Körper nach Vitamin C. Andererseits stand er oft und lang im OP, vielleicht brauchte er also tatsächlich welches. Er beugte sich vor, gab Milla einen Kuss und strich dann mit seinen Lippen über Justins seidigweiche Wangen. »Pass gut auf Mommy auf«, befahl er seinem schlafenden Sohn, dann eilte er aus der Tür.
Milla blieb noch ein paar Minuten im Bett liegen und kostete die Ruhe und den Frieden aus. Endlich einmal wollte ein paar Minuten lang niemand etwas von ihr. Sie hatte geglaubt, auf das Baby vorbereitet zu sein, aber sie hätte sich nicht träumen lassen, dass es sie rund um die Uhr auf Trab halten würde. Wenn Justin gerade nicht gefüttert oder gewickelt werden musste, hetzte sie sich ab, um alle anderen anfallenden Arbeiten zu erledigen, wobei sie ständig so müde war, als würde sie bei jedem Schritt durch knietiefes Wasser waten. Sie fühlte sich, als hätte sie seit Monaten keine Nacht mehr durchgeschlafen. Nein, sie hatte tatsächlich seit Monaten keine Nacht mehr durchgeschlafen; seit vier etwa, als das Baby so groß geworden war, dass es auf ihre Blase gedrückt hatte, und sie mehr oder weniger jede halbe Stunde aufs Klo gerannt war. Justin hatte tief gelegen, was Susanna zufolge das Atmen erleichterte, aber mit ständigem Harndrang bezahlt werden musste. Mutter zu sein war eindeutig kein Traumjob; es war wunderschön, aber garantiert kein Traumjob.
Sie wusste, dass sie vor Glück strahlte, als sie ihren schlafenden Sohn betrachtete. Er war ein Prachtjunge; das sagten alle, und alle bewunderten seine blonden Haare, die blauen Augen und den süßen Mund. Justin sah aus wie das archetypische Reklamebaby, jenes idealisierte, großäugige Kleinkind, dessen Abbild Millionen von Babypflegeartikeln ziert. Milla war von allem an ihm bezaubert, angefangen von den winzigen Fingernägelchen bis zu den Grübchen, die immer tiefer wurden, je mehr Gewicht er zulegte. Den ganzen Tag hätte sie so dasitzen und ihn anschauen können ... wenn sie nicht so viel zu tun gehabt hätte.
Augenblicklich schaltete ihr Gehirn in den Arbeitsmodus um, und sie listete in Gedanken auf, was heute alles zu erledigen war – waschen, putzen, kochen und, sobald sie eine freie Minute hatte, den Papierkram des Krankenhauses abarbeiten. Und irgendwann im Laufe des Tages würde sie Zeit für so frivole Dinge finden müssen wie ihre Haare zu waschen und ihre Beine zu rasieren, denn schließlich hatte sie heute Abend ein heißes Date mit ihrem Ehemann. Sie würde es nie leid werden, Mutter zu sein, aber sie war definitiv bereit, eine zweite Rolle zu übernehmen, wie zum Beispiel die einer sexuell begehrenswerten Frau. Der Sex fehlte ihr; David agierte im Bett mit der gleichen absoluten Konzentration, die er für alles aufbrachte, was ihn interessierte. Und es war ausgesprochen angenehm, das Objekt dieser Konzentration zu sein. Nein, es war entschieden mehr als angenehm. Es war absolut fantastisch.
Zu allererst würde sie jedoch auf den Markt gehen, bevor es zu heiß dafür war.
Nur noch zwei Monate, dachte sie. Mexiko würde ihr fehlen: die Menschen, die Sonne, der gemächliche Lebensrhythmus. Das Arbeitsjahr, das David und seine Kollegen der Armenklinik gestiftet hatten, war so gut wie vorbei; bald ging es zurück in die Tretmühle des amerikanischen Medizinbetriebs. Natürlich freute sie sich auf zu Hause, auf ihre Familie, ihre Freunde und solche Annehmlichkeiten wie einen klimatisierten Supermarkt. Oft malte sie sich aus, wie sie mit Justin im Park spazieren gehen oder mit ihm bei ihrer Mutter vorbeischauen würde. Sie hatte ihre Mutter während der langen Schwangerschaftsmonate vermisst. Die sporadischen Telefonate sowie eine Stippvisite daheim hatten ihre Sehnsucht nicht wirklich stillen können.
Beinahe hätte sie damals beschlossen, David nicht nach Mexiko zu begleiten; denn dass sie schwanger war, hatte sie erst kurz vor ihrem Abreisetermin gemerkt. Aber sie hatte auf gar keinen Fall so lange von ihm getrennt sein wollen, und schon gar nicht, während sie ihr erstes Kind austrug. Darum hatte sie nach der Begegnung mit Susanna, der Gynäkologin in Davids Team, beschlossen, bei ihrem ursprünglichen Plan zu bleiben. Ihre Mutter war entsetzt gewesen – ihr Enkelkind würde im Ausland geboren werden! –, aber die Schwangerschaft war genau nach Plan und ohne medizinische Probleme verlaufen. Justin war pünktlich zur Welt gekommen, nur zwei Tage nach dem errechneten Termin, und seither hatte Milla das Gefühl, in einem ständigen Nebel zu leben, der sich halb aus Liebe und halb aus Übermüdung zusammensetzte.
Das stand in so krassem Gegensatz zu ihrer Vorstellung vom Mutterdasein, dass sie unwillkürlich lächeln musste. Bewehrt mit einem grandiosen Magister der Geisteswissenschaften, war sie ausgezogen, die Welt zu verändern, und zwar Mensch um Mensch. Sie wollte jene Art von Lehrerin sein, an die sich die Menschen noch erinnerten, wenn sie selbst Großeltern waren, jene Art von Lehrerin, die das Leben ihrer Schüler wahrhaft beeinflusste. Sie fühlte sich wohl in der akademischen Welt, nicht einmal die Untiefen der Institutspolitik ließen sie zurückschrecken; sie hatte vorgehabt, ihre Ausbildung mit einem Doktortitel abzuschließen und dann selbst an der Universität zu lehren. Eine Heirat – durchaus, aber nicht gleich. Vielleicht mit dreißig oder fünfunddreißig. Kinder – vielleicht.
Und dann war sie David begegnet, dem medizinischen Überflieger. Er war der Sohn ihres Geschichtsprofessors, weshalb sie, kaum hatte der Professor sie als Assistentin angestellt, alles über ihn erfahren hatte. Davids IQ lag eindeutig im Geniebereich; mit vierzehn hatte er die High School abgeschlossen, mit siebzehn das College, anschließend hatte er im Zeitraffer das Medizinstudium absolviert und praktizierte, als sie ihn im Alter von fünfundzwanzig Jahren kennen lernte, bereits als Chirurg. Sie hatte erwartet, entweder auf einen arroganten Besserwisser zu treffen – auch wenn ihm die Rechthaberei durchaus zustehen mochte – oder auf einen totalen Eierkopf.
Er war nichts von alledem. Stattdessen war er ein gut aussehender junger Mann, dessen Gesicht nach zahllosen Überstunden im Operationssaal oft von Müdigkeit gezeichnet war und der eine unerschöpfliche Wissbegier ausstrahlte, die ihn nächtelang über Fachbüchern brüten ließ und ihm im wahrsten Sinn des Wortes den Schlaf raubte. Sein Lächeln war niedlich und sexy, aus seinen Augen strahlte Humor, und seine blonden Haare waren gewöhnlich struppig und zerzaust. Er war groß, was ihr sehr entgegenkam, da sie selbst einen Meter siebzig war und gern High Heels trug. Eigentlich gefiel ihr alles an ihm, und darum zögerte sie keine Sekunde, als er sie fragte, ob sie mit ihm ausgehen wollte.
Trotzdem hatte es sie überrascht, als sie ihn bei der Silvesterfeier dabei ertappt hatte, wie er sie mit dunklem, machtvollem Verlangen gemustert hatte. Die Erkenntnis hatte sie ins Straucheln gebracht wie ein Schlag in die Magengrube, so als hätte Joshua in seine Posaune geblasen und all ihre Mauern zum Einsturz gebracht. David liebte sie, und sie liebte David. So einfach war das.
Mit einundzwanzig Jahren war sie seine Frau geworden, gleich nachdem sie ihren Abschluss gemacht hatte, und nun war sie mit dreiundzwanzig bereits Mutter. Sie hatte ihren Entschluss noch keine Sekunde bereut. Sie wollte nach wie vor unterrichten, nachdem sie erst in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt waren, und sie wollte auch ihre Ausbildung fortführen. Aber sie hätte nichts von dem rückgängig machen wollen, was zu dem unglaublichen Wunder, einen Sohn zu haben, geführt hatte. Sobald sie gemerkt hatte, dass sie schwanger war, war sie ganz und gar in ihrer neuen Rolle aufgegangen und hatte sich in das Baby in ihrem Bauch verliebt, bis sie glaubte, innerlich von einem mächtigen, heißen Glühen erwärmt zu werden. Das Gefühl hatte sich nach der Geburt noch verstärkt, so sehr, dass sie einen geradezu magnetischen Sog zu spüren meinte, wenn Justin nur im Nebenzimmer schlief. Diese Verbundenheit gab ihr ständig neue Kraft, ganz gleich, wie müde sie war.
Sie kletterte aus dem Bett und errichtete sorgsam eine Kissenmauer rund um ihr Baby, obwohl Justin sich nicht einmal auf den Bauch drehen konnte. Er rührte sich kein einziges Mal, während sie sich schnell wusch, die Bürste durch ihre kurzen Locken zog und dann eines der lockeren Sommerkleider überstreifte, die sie extra für die Zeit nach der Geburt gekauft hatte. Sie war noch sechs Kilo schwerer als vor der Schwangerschaft, aber das zusätzliche Gewicht kümmerte sie nicht ... besonders. Irgendwie gefielen ihr die mütterlichen Rundungen, und David war ganz begeistert, dass ihre Brüste von Körbchengröße B auf D angeschwollen waren.
Bei dem Gedanken an den bevorstehenden Abend spürte sie einen vorfreudigen Schauer. Vor einer Woche hatte David eine Packung Kondome aus der Klinik nach Hause gebracht, und schon das Wissen um diese Schachtel hatte sie beide heiß gemacht. Zu Beginn ihrer Beziehung hatten sie für kurze Zeit Kondome verwendet; dann hatte sie die Pille genommen, bis sie beschlossen hatten, dass sie ein Kind wollten. Die Aussicht, erneut Kondome zu verwenden, gab ihr das Gefühl, wieder frisch verliebt zu sein, so wie damals, als sie kaum die Finger voneinander lassen konnten und alles total neu und aufregend und beängstigend gewesen war.
Justin begann sich zu bewegen und mit den Lippen zu schmatzen, als würde er nach ihrer Brust suchen. Er schlug die blauen Augen auf, die kleinen Fäustchen begannen zu wackeln, und dann gab er jenes kleine Grunzen von sich, das meist seinem »Ich bin nass, wickle mich«-Weinen vorausging. Aus ihrem Tagtraum gerissen, in dem sie mit seinem Vater Sex gehabt hatte, holte Milla eine saubere Windel, beugte sich über Justin und begann ihn unter gutem Zureden zu wickeln. Er schaffte es, seinen Blick auf ihr Gesicht gerichtet zu halten, und starrte sie an, als wäre sie das Einzige, was in seinem Universum existierte. Den Mund freudig aufgerissen, begann er aufgeregt mit Armen und Beinen zu pumpen.
»Mein süßes Purzelchen«, gurrte sie, während sie ihn hochhob. Sobald sie ihn in ihren Ellbogen geschmiegt hatte, begann er schmatzend nach ihrer Brust zu suchen. »Mein süßes Ferkelchen, meinte ich«, korrigierte sie, setzte sich hin und knöpfte ihr Kleid auf. Ihre Brüste begannen schon zu kribbeln, und sie seufzte genüsslich, als sich das Baby an den Nippel heftete und zu saugen begann. Während Justin trank, wiegte sie sich sanft vor und zurück und spielte mit seinen Fingerchen und Zehen. Ihre Augen schlossen sich verträumt, und sie begann, völlig dem Moment hingegeben, ein kleines Schlaflied zu summen. Auf die schmutzigen Windeln und die durchwachten Nächte hätte sie leichten Herzens verzichtet, aber in solchen Minuten liebte sie das Muttersein. Wenn sie ihr Kind so hielt, zählte nichts mehr auf der Welt.
Dann hatte er ausgetrunken, und sie legte ihn beiseite, während sie sich ein schnelles Frühstück genehmigte. Nach dem anschließenden Zähneputzen schlang sie ein Tragetuch aus blauem Jeansstoff über ihren Kopf und legte das Baby hinein. Er ließ sein Köpfchen gegen ihren Busen sinken, wo er ihren Herzschlag hören konnte, und machte in der nächsten Sekunde die blauen Augen zu, um ein wenig zu dösen. Sie schnappte sich einen Hut und einen Einkaufskorb, steckte den Geldbeutel ein und machte sich auf den Weg zum Markt.
Der Markt war nicht einmal einen Kilometer entfernt. Die strahlende Morgensonne versprach sengende Hitze am Mittag, aber noch war die Luft kühl und trocken, und auf dem kleinen offenen Bauernmarkt drängten sich die Käuferinnen. Es gab Orangen und grellbunte Paprika, Bananen und Melonen und gelbe, an langen Schnüren aufgereihte Zwiebeln. Milla erledigte in aller Ruhe ihre Besorgungen, plauderte dabei ein wenig mit den Nachbarinnen, die ihr Baby bewundern wollten, und ließ sich reiflich Zeit, die schönsten Früchte auszuwählen.
Justin hatte sich wie alle kleinen Babys eingerollt und die Füße automatisch zu jener Position angezogen, die er bereits im Mutterleib innegehabt hatte. Sie hielt den Hut in der Hand, um ihn vor der Sonne abzuschirmen. Eine leichte, angenehme Brise spielte in ihren kurzen, hellbraunen Locken und strich durch den dünnen hellen Flaum auf Justins Kopf. Er regte sich kurz und begann mit dem rosigen Mund zu nuckeln. Milla setzte den Korb ab, klopfte ihm sacht auf den kleinen Rücken, und er nickte wieder ein.
Vor einem kunstvoll arrangierten Obststand hielt sie an und begann eine angeregte, wenn auch bruchstückhafte Unterhaltung mit der alten Frau hinter den Orangen- und Melonenstapeln. Sie verstand besser Spanisch, als sie es sprach, aber es gelang ihr durchaus, sich verständlich zu machen. Mit der freien Hand deutete sie auf die Orangen, die sie haben wollte.
Sie sah sie nicht kommen. Plötzlich wurde sie von zwei Männern in die Zange genommen, deren Körperwärme und -geruch sie trafen wie ein Schlag in die Magengrube. Instinktiv wollte sie einen Schritt zurückweichen, doch die beiden Leiber drängten nur noch enger an sie heran und versperrten ihr dadurch den Rückzug. Der Mann zu ihrer Rechten zog ein Messer aus der Scheide an seinem Gürtel, packte den Träger des Tragetuchs und hatte ihn schon durchgesäbelt, ehe Milla mehr als einen erstickten Schrei von sich geben konnte. Die Zeit geriet ins Stocken; die nächsten Sekunden erlebte Milla wie eine Reihe von Diabildern: die alte Frau, die mit entsetzter Miene zurücktaumelte. Der Moment, in dem Milla spürte, wie das Tragetuch mit Justin nach unten sackte, und panisch nach ihrem Baby griff. Dann die Hand des Mannes links von ihr, die ihr das Kind entriss, während die andere sie zurückschubste.
Irgendwie gelang es ihr, auf den Füßen zu bleiben. In nackter Angst sprang sie den Mann laut kreischend an, um ihm ihr Baby zu entwinden. Ihre langen Nägel zerkratzten sein Gesicht und hinterließen blutige Furchen, die ihn überrascht zurückweichen ließen.
Das brutal wach gerüttelte Baby begann zu weinen. Die Menschenmenge zerstreute sich, erschrocken über den plötzlichen Gewaltausbruch. »Hilfe!«, schrie sie pausenlos wieder und versuchte gleichzeitig Justin festzuhalten, doch die Umstehenden schienen eher zu flüchten, als ihr zu Hilfe zu kommen. Der Fremde drückte ihr die Hand aufs Gesicht und versuchte sie erneut wegzuschubsen. Milla biss zu, schlug die Zähne tief in sein Fleisch und presste den Kiefer zusammen, bis sie Blut schmeckte und ihn vor Schmerz aufjaulen hörte. Gleichzeitig zielte sie mit den Fingern nach seinen Augen und spürte, wie sich die Fingernägel in eine schwammigweiche Masse bohrten. Seine Schreie verwandelten sich in ein fassungsloses Brüllen, und der Griff, mit dem er Justin hielt, lockerte sich. Verzweifelt versuchte sie das Baby festzuhalten und bekam sogar ein winziges fuchtelndes Ärmchen zu fassen, und einen herzzerreißenden Augenblick lang glaubte sie, ihn wieder in ihrem Arm zu haben. Dann spürte sie, wie der andere Mann hinter sie trat, und ein alles auslöschender, lähmender Schmerz durchschoss ihren Rücken.
Sie sackte zusammen und brach wie ein Stein zu Boden, wo sich ihre Finger hilflos in den Schotter krallten. Das Baby wie einen Ball unter den Arm geklemmt, rannten die beiden Männer weg, wobei der eine sich die blutige Hand vors Gesicht hielt und laut brüllend fluchte. Milla lag auf dem Rücken im Dreck, versuchte gegen die Dunkelheit anzukämpfen, die gierig von ihrem Körper Besitz ergriff, und schnappte verzweifelt nach Luft zum Schreien. Ihre Lungen pumpten wie wild, schienen aber keinen Sauerstoff mehr zu transportieren. Milla versuchte sich aufzurichten; ihr Körper reagierte nicht. Ein schwarzer Schleier schob sich langsam und unaufhaltsam vor ihre Augen, und sie brachte nicht mehr hervor als ein leises Wimmern: »Mein Baby! Mein Baby! Rettet mein Baby!«
Doch das tat niemand.
David hatte bereits einen Bruch operiert und wusch sich gerade die Hände, während Rip Kosper, Susannas Mann und der Anästhesist ihres Teams, ein letztes Mal den Blutdruck und die Herzfrequenz des Patienten prüfte, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung war, ehe der Operierte an ihre Krankenschwester Anneli Lasky übergeben wurde. Sie waren ein gutes Team; die anderen würden ihm fehlen, wenn das Jahr vorüber war und sie alle in die Vereinigten Staaten und in ihre normalen Jobs zurückkehren würden. Die voll gestopfte, ebenerdige Klinik aus unverputztem Beton mit ihren gesprungenen Bodenfliesen und der äußerst sparsamen Ausstattung würde er zwar nicht vermissen, dafür aber seine Kollegen, die Patienten – und Mexiko überhaupt.
Er dachte gerade über den nächsten Fall, eine Gallenblase, nach, als es auf dem Gang vor der Tür laut wurde. Rufe und Flüche waren zu hören, irgendetwas scharrte, und über allem gellten hohe Schreie. Er trocknete sich die Hände ab und war eben auf dem Weg zur Tür, als Juana Mendoza, eine weitere Schwester, nach ihm rief.
Im Laufschritt stürmte er in den Gang und kam draußen gerade noch zum Stehen, ehe er in einen Pulk raste, der aus Juana, Susanna Kosper, zwei Männern und einer Frau bestand, die gemeinsam eine weitere Frau heranschleppten. Die Umstehenden verstellten ihm den Blick auf das Gesicht der Frau, aber David konnte erkennen, dass ihr Kleid blutdurchtränkt war. Augenblicklich schaltete er um in den Notfallmodus. »Was ist passiert?« Er stieß mit dem Fuß eine Kiste zur Seite und zog eine Rollpritsche heran.
»David.« Susannas Stimme klang scharf und klar. »Es ist Milla.«
Im ersten Moment ergaben ihre Worte keinen Sinn, und er sah sich um, ob seine Frau vielleicht hinter ihm stand. Dann traf ihn die Bedeutung von Susannas Worten wie ein Keulenschlag. Er blickte in das bewusstlose, kalkweiße Gesicht der Frau, auf den Vorhang weicher brauner Locken um ihren Kopf, und seine ganze Welt kippte aus den Fugen. Milla? Das hier konnte unmöglich Milla sein. Sie war mit Justin zu Hause, sie war gesund und munter. Diese Verletzte, die wie ausgeblutet aussah, ähnelte seiner, Frau nur, sonst nichts. Dies konnte unmöglich Milla sein.
»David!« Susannas Stimme wurde noch schärfer. »Reiß dich zusammen! Hilf uns, sie auf die Bahre zu legen.«
Nur seine Ausbildung ermöglichte es ihm zu funktionieren, näher zu treten und die Frau, die wie Milla aussah, auf die Rollbahre zu legen. Ihr Kleid war blutig, ihre Arme und Hände waren blutig, ihre Beine und Füße und sogar ihre Schuhe waren blutig. Nein – es war nur ein Schuh, eine Sandale, die genauso aussah wie die Sandalen, die Milla so gern trug. Dann sah er den rosa Nagellack auf ihren Zehennägeln und das dünne Goldkettchen um ihren rechten Knöchel, und plötzlich hatte er das Gefühl, als würde alles in ihm zusammenbrechen.
»Was ist passiert?«, fragte er mit heiserer Stimme, die aus weiter Ferne zu kommen schien und bestimmt nicht seine eigene war, während gleichzeitig sein Körper wieder in Gang kam und sie Milla eilig in den OP schoben, den er eben erst verlassen hatte.
»Messerwunde im unteren Rückenbereich«, sagte Juana, nachdem sie kurz dem aufgeregten Stimmengewirr hinter ihnen gelauscht hatte. Dann schloss sie die Tür und damit den Lärm aus. »Zwei Männer haben sie auf dem Markt überfallen.« Sie atmete bebend aus. »Sie haben Justin mitgenommen. Milla hat sich gewehrt, da hat einer der Männer sie niedergestochen.«
Rip platzte, von dem Aufruhr alarmiert, in den Operationssaal. »Mein Gott!«, entfuhr es ihm, als er Milla sah; dann verstummte er und legte so schnell wie möglich seine Ausrüstung zurecht.
Justin! David wankte unter dem zweiten Schock und hatte sich schon halb zur Tür gewandt. Zwei Entführer hatten seinen Sohn geraubt! Er machte tatsächlich einen Schritt von der Bahre weg und auf die Tür zu, als wollte er sofort losrasen und seinen Sohn suchen. Dann zögerte er und drehte sich zu seiner Frau um.
Sie hatten keine Zeit gehabt, den Operationsraum zu desinfizieren oder neues Material bereitzulegen. Anneli kam hereingelaufen und begann alles anzuschleppen, was sie brauchen könnten. Juana wickelte eine Blutdruckmanschette um Millas schlaffen Arm und pumpte sie hektisch auf, während Susanna nach einer Schere griff und Milla die Kleider vom Leib schnitt. »Blutgruppe 0 positiv«, hörte er Susanna sagen. Woher wusste sie das? Ach ja, sie hatte Millas Blutgruppe vor Justins Entbindung bestimmt.
»Sechzig zu vierzig«, sagte Juana an. So schnell, dass er ihren Bewegungen kaum folgen konnte, legte sie Milla eine Infusion und hängte einen Beutel mit Blutplasma auf.
Er würde sie verlieren, dachte David. Milla würde hier vor seinen Augen sterben, wenn es ihm nicht gelang, den Schock abzuschütteln und endlich zu reagieren. Aus dem Einstich schloss er, dass das Messer wahrscheinlich ihre linke Niere getroffen und weiß Gott welche weiteren Schäden angerichtet hatte. Sie drohte zu verbluten; ihr blieben nur noch ein paar Minuten, ehe ihre Organe versagen würden ...
Er verdrängte alles andere aus seinen Gedanken und zwängte die Finger in die frischen Handschuhe, die Anneli ihm hinhielt. Ihm blieb keine Zeit mehr, die Hände zu bürsten; ihm blieb auch keine Zeit mehr, nach Justin zu suchen; ihm blieb gerade noch Zeit, das Skalpell zu packen, das ihm in die Hand gedrückt wurde, und seine ganzen Fähigkeiten einzusetzen. Er betete, er fluchte, er kämpfte verzweifelt gegen die Zeit, während er den Leib seiner Frau aufschnitt. Genau wie er vermutet hatte, war die Messerklinge in ihre linke Niere eingedrungen. Eingedrungen, von wegen; sie hatte das Organ praktisch gespalten. Die Niere war nicht mehr zu retten, und wenn er es nicht in Rekordzeit schaffte, sie zu entfernen und alle Blutgefäße abzubinden, dann war auch Milla nicht mehr zu retten.
Es war ein Wettrennen, wild und gnadenlos. Wenn er nur einen einzigen falschen Schnitt machte, wenn er nur ein einziges Mal zögerte, wenn ihm irgendetwas entglitt oder er auch nur nachfassen musste, dann hatte er schon verloren, und er würde Milla verlieren. Es war keine Operation, wie er sie gewohnt war; er ackerte wie ein Feldarzt im Lazarett, denn ihr Leben hing von jeder blitzschnellen Entscheidung und Aktion ab. Während sie alles Blut in sie hineinschütteten, das sie zu Verfügung hatten, kämpfte er verzweifelt dagegen an, dass es genauso schnell wieder aus ihr herausfloss. Sekunde um Sekunde versuchte er die Blutung einzudämmen, suchte er nach durchtrennten Blutgefäßen und holte tatsächlich langsam, aber stetig einen Vorsprung gegenüber dem Tod heraus. Er würde nie erfahren, wie lange sie um Milla kämpften; er fragte nie danach und wollte es auch nie wissen. Wie lange zählte nicht. Nur das Gewinnen zählte, denn die Alternative hätte er einfach nicht ertragen.
2
Zehn Jahre später Chihuahua, Mexiko
Paige Sisk lehnte sich an ihren Verlobten Colton Rawls, ließ langsam die Lider sinken, nahm einen tiefen Zug von ihrem Joint und reichte ihn dann an Colton weiter. O Mann, all die Vollspießer, die ihr ein Ohr abgekaut hatten, was ihr in Mexiko alles passieren könnte, hatten einfach keine Ahnung. Mexiko war nicht zu toppen. Hey, sie war schließlich nicht verblödet, sie war nicht so dumm, den Stoff direkt vor einem mexikanischen Bullen zu kaufen, obwohl sie gehört hatte, dass es sogar in so einem Fall genügte, ein paar Scheine abzudrücken, und schon hatte sich das Problem erledigt. Als würde sie ihr Geld an die Bullen verschleudern wollen.
Jetzt waren sie schon vier Tage hier. Colton fand Chihuahua voll cool. Er hatte so ein Ding mit Pancho Villa; bis sie hier angekommen waren, hatte sie gedacht, Pancho Villa sei, okay, vielleicht ein Haus, in dem Ponchos gemacht wurden. Der einzige Pancho, der ihr was sagte, hatte in einem ururalten Western mitgespielt, in dem so ein Vollidiot dauernd »O Pancho« zu einem noch größeren Vollidioten mit einem Riesenhut gesagt hatte, aber Colton hatte gemeint, nein-nein, dieser Pancho sei der echte. Als würde es auch gefälschte Panchos geben. Auch egal. Colton war nicht zu bremsen. Zwei Mal waren sie losgezogen, um diesen zerschossenen Dodge anzuschauen, in dem der echte Pancho angeblich zu Schweizer Käse durchlöchert worden war, genau wie Bonnie und Clyde.
Für sie persönlich war Pancho Villa bloß ein toter alter Sack. Der blöde Dodge ging ihr total am Arsch vorbei. Mann, wenn der Kerl einen richtigen Geländewagen gefahren hätte, einen Hummer am besten, das wäre echt cool gewesen.
»Wenn er einen Hummer gefahren hätte«, sagte sie, »hätte er die Arschlöcher, die auf ihn geschossen haben, platt machen können.«
Colton tauchte aus seiner Nebelwolke auf und blinzelte sie überrascht an. »Wer fährt einen Hummer?«
»Pancho Villa.«
»Nein, der ist einen Dodge gefahren.«
»Sag ich doch.« Ungeduldig rammte sie ihm den Ellbogen in die Seite. »Aber wenn er einen Hummer gefahren hätte, hätte er sie platt walzen können.«
»Damals gab’s keine Hummer.«
»Mann!« Sie schnaufte ärgerlich. »Du checkst einfach null. Ich hab doch gesagt wenn!« Sie entriss ihm den Joint, nahm noch einen Zug und stand vom Bett auf. »Ich muss aufs Klo.«
»Okay.« Glücklich, den Joint für sich allein zu haben, lehnte sich Colton in die Kissen zurück und winkte ihr kurz nach, als sie aus dem Zimmer ging. Sie winkte nicht zurück. Sie ging hier nicht gern aufs Klo; es gab auf diesem Stockwerk nur eine einzige Toilette, auf der bloß eine Zeitung und kein Klopapier lag, und außerdem stank es wie die Hölle. Aber Colton hatte darauf bestanden, hier zu wohnen und nicht in einem der besseren Hotels, weil es hier so billig war. Na logisch war es hier billig; welcher Idiot würde auch mehr für so ein Rattenloch abdrücken? Außerdem lag die Pension nahe beim Marktplatz, und das war superpraktisch.
Sie war ziemlich breit von dem Gras, aber nicht so breit, dass das Klo sie nicht gestört hätte. Zu allem Überfluss war das Schloss kaputt. Zum Ersatz hatte jemand einen Schnürsenkel um den Knauf gewickelt und einen Nagel in den Türrahmen geschlagen, und jetzt musste man das lose Ende des Schnürsenkels um den Nagel wickeln. Dadurch blieb die Tür zwar zu, trotzdem traute sie der Sache nicht recht. Also brachte sie ihr Geschäft immer so schnell wie möglich hinter sich, wenn sie hier drin war.
Ach du Scheiße; sie hatte die Taschenlampe vergessen. Bis jetzt war noch nie das Licht ausgefallen, während sie auf dem Klo saß, aber alle hatten sie gewarnt, dass das sehr wohl passieren konnte. Und sie fürchtete sich im Dunkeln, darum nahm sie sich diese Warnung durchaus zu Herzen. Sie versuchte sich zu beeilen, aber das Pinkeln braucht nun mal seine Zeit, und sie hatte bis zur letzten Sekunde gewartet, weil sie so ungern auf dieses Klo ging. Über der Toilette ausharrend – auf gar keinen Fall würde sie sich auf dieses Ding setzen – lief und lief es aus ihr raus, bis ihr nach einer Weile die Beine so wehtaten, dass sie schon Angst hatte, sie müsste sich doch noch auf die Brille hocken. Und was sollte sie dann tun – ihren Arsch auskochen etwa?
Aber schließlich war sie fertig, tupfte sich mit einer Seite aus der Zeitung ab und richtete sich mit einem erleichterten Stöhnen aus ihrer unbequemen, verklemmten Haltung auf. Wenn sie Colton jemals aus Chihuahua und von Pancho Villas durchsiebtem Dodge wegkriegen konnte, damit sie ihre Reise fortsetzten, dann würde sie darauf bestehen, dass sie nicht noch mal in so einem Loch abstiegen.
Sie zog ihre Shorts hoch, spülte ihre Hände ab und wischte sie an ihrem Hosenboden trocken, weil sie vergessen hatte, ein Handtuch mitzunehmen. Dann hängte sie das Schuhband wieder aus. Die Tür schwang auf, sie knipste die funzelnde Glühbirne aus und trat in den dunklen Flur. Nach zwei unschlüssigen Schritten blieb sie stehen. Im Gang müsste eigentlich Licht brennen. Jedenfalls war es hell gewesen, als sie aufs Klo gegangen war. Bestimmt war die Birne durchgebrannt.
Ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken. Sie hasste die Dunkelheit. Wie sollte sie in ihr Zimmer zurückfinden, wenn sie nichts sehen konnte?
Links von ihr knarzte eine Diele. Sie machte vor Schreck einen Satz und wollte schon losschreien, aber es hatte ihr die Stimme verschlagen, sodass nur ein leises Quieken zu hören war.
Eine schwielige Hand presste sich auf ihren Mund; sie bekam eine Überdosis von echt brutalem Körpergestank ab, dann landete etwas Hartes auf ihrem Kopf und sie sackte bewusstlos zu Boden.
El Paso, Texas
Millas Handy läutete. Ein paar Sekunden spielte sie mit dem Gedanken, nicht dranzugehen; sie war todmüde, entnervt und wurde von pochenden Kopfschmerzen gepeinigt. Draußen hatte es über vierzig Grad Celsius, und obwohl sie die Klimaanlage in ihrem Chevy Offroader voll aufgedreht hatte, verbrannte die durch die Windschutzscheibe dringende Sonne ihre Arme. Das Bild von Tiera Alversons zerschmettertem Gesicht und den blauen Augen der Vierzehnjährigen, die blind ins Nichts starrten, wollte ihr nicht aus dem Kopf. Heute Nacht würde sie in ihren Träumen das trockene Schluchzen von Regina Alverson hören, als sie erfahren hatte, dass ihr kleines Mädchen nicht mehr nach Hause kommen würde. Manchmal hatte Finders Erfolg, aber manchmal kamen sie auch zu spät. Heute waren sie zu spät gekommen.
Im Moment wollte sich Milla auf gar keinen Fall die Probleme anderer Menschen anhören; sie hatte auch so genug zu ertragen. Aber sie wusste nie, wer sie gerade anrief oder warum, und schließlich hatte sie selbst es zu ihrem persönlichen Kreuzzug erkoren, vermisste Kinder aufzuspüren. Also öffnete sie die Augen gerade so weit, dass sie den richtigen Knopf erkennen konnte, und kniff sie sofort wieder zusammen, um die gleißende Spätnachmittagssonne auszusperren. »Hallo?«
»Señora Boone?« Die mit schwerem Akzent sprechende Stimme hallte aus der Freisprechanlage durch das Wageninnere. Milla erkannte die Stimme nicht, aber sie redete täglich mit so vielen Menschen, dass sie sich auf keinen Fall an jede Stimme erinnern konnte. Dafür war klar, dass es sich um einen geschäftlichen Anruf handelte, denn nur bei Finders war sie als Milla Boone bekannt. Nach ihrer Scheidung hatte sie wieder ihren Mädchennamen Edge angenommen, aber die Öffentlichkeit assoziierte mit dem Thema »vermisste Kinder« den Namen Boone, darum war sie gezwungen, in der Öffentlichkeit und bei ihrer Arbeit für Finders ihren früheren Ehenamen zu verwenden.
»Ja, am Apparat.«
»Heute Abend ist eine Treffen. In Guadalupe, zehn Uhr dreißig. Hinter der Kirche.«
»Was für ein –«, setzte sie an, aber die Stimme schnitt ihr das Wort ab.
»Diaz wird da sein.«
Das Telefon verstummte. Milla setzte sich auf. Ihre Kopfschmerzen waren wie weggeblasen, und neues Adrenalin schoss durch ihren Körper. Sie schaltete das Telefon ab und blieb ganz still sitzen. In ihrem Kopf überschlugen sich die Gedanken.
»Welches Guadalupe?«, fragte Brian Cusack, der alles mitgehört hatte, frustriert vom Fahrersitz aus.
»Wenn es nicht das hinter der Grenze ist, schaffen wir es sowieso nicht hin.« In Mexiko gab es eine ganze Reihe von Orten namens Guadalupe, deren Einwohnerzahlen zwischen fünfzigtausend und wenigen hundert lagen. Das Guadalupe gleich hinter der Grenze war ein Dorf.
»Scheiße«, sagte Brian Cusack. »Scheiße!«
»Wahr gesprochen.« Es war schon nach achtzehn Uhr; im Büro war niemand mehr, der sie unterstützen konnte. Natürlich konnte sie versuchen, eine ihrer Mitarbeiterinnen zu Hause zu erwischen, aber sie durften keine Zeit verlieren. Wenn das Treffen um zweiundzwanzig Uhr dreißig stattfinden sollte, mussten sie mindestens eine Stunde zuvor Position bezogen haben. Guadalupe lag etwa fünfzig Meilen von El Paso und Juarez entfernt. Bei diesem Verkehr würden sie eine knappe Stunde bis zur Grenze brauchen. Zwar war es weniger nervenaufreibend, den Wagen zu parken, zu Fuß über die Brücke nach Mexiko zu wechseln und dort ein Fahrzeug zu organisieren, als sich auf den Papierkrieg einzulassen, der jedes Mal fällig war, wenn man mit dem Auto hinüberfuhr. Aber entscheidend war dabei das Wort »weniger nervenaufreibend«, was keinesfalls mit »nicht nervenaufreibend« gleichzusetzen war. Wenn die Zeit knapp war, konnte jede Verzögerung über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.
Sie hatten beide ihre Pässe und die Dauervisa für Mexiko dabei; das war Standard, weil sie nie wissen konnten, wann sie die Grenze überqueren mussten. Mehr hatten sie allerdings nicht dabei, abgesehen von ein paar Nachtsichtgeräten, mit denen sie nach dem kleinen Dylan Peterson gesucht hatten – erfolgreich zum Glück – und die in der Reisetasche geblieben waren, weil sie direkt im Anschluss die Suche nach Tiera Alverson aufgenommen hatten. Im Fall Alverson hatten sie praktisch keine Ausrüstung gebraucht; der Job hatte sie nach Carlsbad, New Mexico, geführt und Geduld und viel Zeit erfordert, aber keine Überlebensausrüstung.
Sie würden mit dem auskommen müssen, was sie dabeihatten, denn sie würde sich auf keinen Fall die Gelegenheit entgehen lassen, Diaz zu treffen.
Diaz. Der Mann war so schwer zu fassen wie Rauch im Wind, aber vielleicht hatten sie dieses Mal Glück.
»Wir haben keine Zeit mehr, Waffen zu besorgen«, stellte Brian gleichmütig fest, während er sich in eine Lücke im Verkehr zwängte und ihren bulligen Offroader um einen dahintuckernden Toyota mit ausufernden Rostflecken an den Türen herumlenkte.
»So viel Zeit werden wir erübrigen müssen.« Sie gingen nie das Risiko ein, Waffen über die Grenze zu schmuggeln; stattdessen hatten sie Arrangements getroffen, die es ihnen ermöglichten, Waffen zu kaufen, wenn sie drüben waren. Meistens wurden keine Waffen gebraucht – meist musste sie nur mit den Menschen reden –, aber manchmal war es ratsam, sich zu schützen.
Sie probierte es unter Joann Westfalls Nummer, in der Hoffnung, ihre Stellvertreterin zu Hause zu erreichen. Aber dort sprang nur der Anrufbeantworter an. Milla hinterließ eine Nachricht, in der sie Jo die mageren Eckdaten ihres unerwarteten Abstechers mitteilte. Immerhin hatte sie selbst die Regel aufgestellt, dass ein Finder nie allein loszog, ohne jemandem Bescheid zu sagen, wo er sich aufhielt.
Nach zwei Jahren womöglich der erste Kontakt mit Diaz!
Der Herzschlag dröhnte ihr in den Ohren. Womöglich war dies der Durchbruch, auf den sie seit zehn Jahren hoffte.
Justins Entführung lag in einem undurchdringlichen Nebel von Rätseln, Mutmaßungen und Verdächtigungen. Nie war ein Lösegeld gefordert worden, und auch die Männer, die ihr damals auf dem kleinen Dorfmarkt das Baby geraubt hatten, waren nie wieder aufgetaucht. Erst nach Jahren hatte Milla Andeutungen über einen Einäugigen gehört, der allerdings nie auftauchte, wenn sie ihn zu stellen versuchte. Dann hatte ihr vor zwei Jahren eine Frau zugeflüstert, dass ein Mann namens Diaz möglicherweise mehr über die Sache wissen könnte. Während der vergangenen fünfundzwanzig Monate hatte sich Milla mit der Hartnäckigkeit eines Bluthunds auf seine Spur geheftet, aber nichts weiter ans Licht gefördert als unzählige Gerüchte, die sie fast zum Wahnsinn trieben.
Diaz zu finden, hatte ihr ein alter Mann zur Warnung mit auf den Weg gegeben, bedeute, den Tod zu finden. Sie sollte lieber auf Abstand bleiben. Diaz wisse von oder stecke hinter vielen Entführungen. Sie hörte, dass der Einäugige Diaz heiße. Nein, ganz falsch, der Einäugige arbeitete für Diaz. Oder Diaz hatte den Einäugigen umgebracht, weil der irrtümlich ein amerikanisches Baby mitgenommen und damit einen solchen Aufruhr verursacht hatte.
All das und noch viel mehr war Milla zugetragen worden. Die Menschen schienen Angst zu bekommen, wenn sie nur über Diaz redeten, aber Milla hatte sich nicht abwimmeln lassen und einfach so lange abgewartet, bis sie schließlich eine gehetzte Antwort zugeraunt bekam. Dennoch hatte sie auch nach all den Monaten keine klare Vorstellung, wer oder was Diaz war. Sie wusste nur, dass er irgendetwas mit Justins Verschwinden zu tun hatte.
»Jemand will Diaz eine Falle stellen«, sagte Brian plötzlich.
»Ich weiß.« Einen anderen Grund konnte es für diesen Anruf nicht geben, und das gefiel ihr nicht. Sie wollte nicht in eine Racheaktion rivalisierender Fraktionen hineingezogen werden. Vor allem anderen wollte sie Justin finden. Dafür waren Finders da, sie fanden die Verlorenen, die Entführten; wenn dabei der Gerechtigkeit Genüge getan wurde, umso besser. Aber dafür zu sorgen war Aufgabe der Polizei. Sie hatte noch nie irgendwelche Ermittlungen behindert, im Gegenteil, sie hatte oft dabei geholfen, aber ihr oberstes Ziel war es stets, die Kinder zu ihren Familien zurückzubringen.
»Wenn es hässlich wird, müssen wir in Deckung bleiben«, sagte sie.
»Und wenn er tatsächlich der ist, nach dem du seit Jahren suchst?«
Milla schloss die Augen. Darauf wusste sie keine Antwort. Es war eine Sache, sich vorzunehmen, dass sie sich keinesfalls in irgendwelche Geschichten hineinziehen lassen würden. Doch was war, wenn Diaz tatsächlich der Einäugige war, der Justin gestohlen hatte? Sie wusste nicht, ob sie dann noch den Zorn zügeln konnte, der in ihr brodelte und kochte wie ein unterirdischer Vulkan. Einfach abknallen konnte sie das Schwein nicht; schließlich musste sie erst mit ihm reden, selbst wenn er es war, weil sie sonst nie erfahren würde, was er mit ihrem Baby angestellt hatte. Aber o Gott, wie gern würde sie ihn massakrieren. Sie wollte ihn so gnadenlos in Stücke reißen, wie er sie in Stücke gerissen hatte.
Weil sie nichts auf Brians Frage zu sagen wusste, konzentrierte sie sich ganz auf das Hier und Jetzt. Darin war sie gut; seit zehn Jahren überlebte sie nur, indem sie sich ausschließlich darauf konzentrierte, was sie jetzt tun konnte. Sie und Brian waren müde und hungrig und hatten eine lange Nacht vor sich. An Letzterem war nichts zu ändern, aber wenigstens konnte sie in ihren Erdnussriegel-Vorrat greifen und für jeden einen PayDay-Riegel öffnen. Die Erdnüsse und der Zucker würden ihnen neue Energie geben. Nachdem ihm klar geworden war, dass sein Abendessen aus einem süßen Erdnussriegel statt des erträumten Steaks bestehen würde, schnappte ihr Brian den PayDay aus der Hand und verschlang ihn in drei Bissen. Milla reichte ihm einen zweiten, für den er nur unwesentlich länger brauchte.
Sie hatte bei ihren Einsätzen auch stets Obst dabei, aber da sie auf dem Heimweg waren, war ihr Vorrat zusammengeschmolzen. Sie hatten noch genau eine Banane. Milla schälte sie und brach sie in zwei Hälften. Noch bevor sie mit Schälen fertig war, hatte Brian die Hand ausgestreckt.
»Noch was?«, fragte er, nachdem auch sie ihre Hälfte aufgegessen hatte.
»Mal sehen. Noch zwei PayDays. Eine Rolle Life Servers. Und zwei Flaschen Wasser. Das ist alles.«
Er schnaubte. Die PayDays würden sie für die Rückfahrt brauchen. »Das war’s dann wohl mit dem Abendessen.« Er war unüberhörbar betrübt. Brian war wie ein großer Junge, der ständig Energienachschub brauchte.
Ihr gefiel der Gedanke genauso wenig. Sie schraubte die Wasserflaschen auf, aber beide tranken nur ein paar Schlucke. Eine übervolle Blase konnte jetzt keiner von ihnen brauchen.
Sie waren früher schon in Guadalupe gewesen, aber sie kramte in der Kartenkiste, bis sie eine Karte mit einer Darstellung des Ortes gefunden hatte, und begann den Straßenplan zu studieren. »Ich frage mich, wie viele Kirchen es in Guadalupe gibt. Ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern.«
»Hoffentlich nur eine, denn der Typ hat uns keinen Namen genannt. Gib mir mal die Life Savers.«
Sie reichte ihm die Pfefferminzbonbons, und Brian machte sich über die Rolle her. Er nahm sich nicht die Zeit, die Bonbons zu lutschen; stattdessen stopfte er sich drei oder vier auf einmal in den Mund und biss dann zu.
Milla holte ihr Handy heraus und rief Benito, ihren Kontaktmann in Juarez, an – einen Nachnamen schien er nicht zu haben. Benito war unschlagbar, wenn es darum ging, zu jeder Tages- oder Nachtzeit einen fahrbaren Untersatz zu besorgen, und zwar keinen typischen Mietwagen. Benito war auf verbeulte, klapprige Pritschenwagen spezialisiert, die niemand beachtete und die kaum je aufgebrochen wurden, wenn sie unbewacht auf der Straße standen. Weil es an Benitos Pick-ups grundsätzlich nichts aufzubrechen gab. Es waren Autos ohne jeden Komfort, die kein Mensch stehlen wollte. Aber sie fuhren, und der Wagen, den er ihnen auf seiner Seite der Grenze bereitstellen würde, wäre bis zum Rand voll getankt. Außerdem hatten Benitos Wagen stets ordnungsgemäße Papiere, falls die Polizei sie aufhalten sollte.
Waffen zu beschaffen war da schon komplizierter. Bei ihren Einsätzen für Finders waren sie nur selten bewaffnet. Ihr war nie wohl bei dieser Art von Geschäften. In Mexiko galten strenge Waffengesetze; natürlich gab es trotzdem Waffen zuhauf im Land; aber falls sie mit einer Pistole erwischt würden, steckten sie bis zum Hals in der Scheiße. Gesetze zu übertreten gefiel ihr nicht, aber wer mit menschlichen Giftschlangen zu tun hat, musste auf eine Attacke vorbereitet sein. Sie erreichte ihre Kontaktperson und gab ihre Bestellung auf: nichts Ausgefallenes, nur etwas zur Selbstverteidigung. Was genau geliefert würde, wusste sie nicht, aber sie rechnete mit ein paar billigen Revolvern vom Kaliber 22, die sie irgendwo entsorgen würden, ehe sie in die Vereinigten Staaten zurückfuhren.
Genau wie sie berechnet hatten, war es schon halb acht und beinahe dunkel, als sie den Wagen geparkt, die Brücke überquert und den anfallenden Papierkram erledigt hatten. Benito wartete bereits geduldig mit einem wahrhaft bemerkenswerten Modell aus seiner Kollektion auf sie – einem uralten Ford Pick-up mit mehr Rost als Lack auf der Karosserie. Eine Stoßstange gab es nicht, die Beifahrertür war mit Draht am Holm befestigt – wahrscheinlich, damit sie nicht auf die Straße fiel –, und die Windschutzscheibe wurde von Klebestreifen im Rahmen gehalten. Obwohl sie es so eilig hatten, blieben Milla und Brian entgeistert stehen und betrachteten staunend dieses archäologische Museumsstück.
»Diesmal hast du dich selbst übertroffen, Benito«, sagte Brian ehrfürchtig.
Benito grinste breit und ließ dabei seine Zahnlücke aufleuchten. Er war klein und drahtig, irgendwas zwischen vierzig und siebzig und hatte eine unerschütterlich frohsinnige Miene, wie sie Milla noch kein zweites Mal begegnet war. »Ich tue mein Bestes«, erklärte er mit New Yorker Akzent. Benito war in Mexiko geboren, aber seine Eltern waren mit ihm in die USA ausgewandert, als er noch ein kleines Kind war, darum hatte er kaum Kindheitserinnerungen an das Land seiner Geburt. Später war er zu seinen Wurzeln zurückgekehrt, hatte sich in Juarez niedergelassen und hier sein Glück gemacht. Doch seinen New Yorker Akzent konnte er nicht mehr abschütteln. »Die Hupe ist im Eimer, und wenn die Scheinwerfer mal nicht angehen wollen, müsst ihr den Knopf noch mal tief reindrücken und ihn dann ganz sacht wieder rauspopeln. Er muss exakt sitzen.«
»Hat das Ding auch einen Motor, oder müssen wir es mit den Füßen anschubsen?«, fragte Milla nach einem Blick in den Innenraum. Das war nur halb ironisch gemeint, denn der Boden war so durchgerostet, dass sie den Straßenbelag sehen konnte.
»Hey, der Motor ist ein echtes Kunstwerk. Der schnurrt wie ein Kätzchen, und er hat mehr Power, als ihr glaubt. Das könnte ganz praktisch sein.« Er fragte nie, wohin sie wollten und was sie dort taten, aber er wusste sehr wohl, was die Leute von Finders taten.
Milla zog die Fahrertür auf und kletterte hinein, wobei sie sich vorsichtig über die Sitzbank schob, um nicht in das Loch im Boden zu treten. Brian reichte ihr die Kiste mit ihren zwei Nachtsichtgeräten, die dunkelgrüne Decke, die sie immer im Auto hatten, und die beiden Wasserflaschen; sie verstaute alles, während er hinter das Lenkrad rutschte.
Der Pick-up war so alt, dass er noch nicht einmal Sicherheitsgurte hatte; falls die Verkehrspolizei sie aufhielt, war mit Sicherheit ein Verwarnungsgeld fällig. Dafür sprang der Motor, wie von Benito versprochen, bei der ersten Drehung des Zündschlüssels an. Brian lenkte den Wagen durch die geschäftigen Straßen von Juarez und hielt kurz darauf vor einer Farmacia, einer Apotheke. Milla wartete im Auto, während er in den Laden ging, um dort ihre Kontaktperson zu treffen, eine Frau, die sie lediglich als »Chela« kannten. Vom Aussehen her war Chela eine echte Dame, stets elegant gekleidet und schien knapp unter fünfzig zu sein. Sie reichte Brian eine Einkaufstüte von Sanborn’s; er schob ihr so unauffällig Geld zu, dass niemand etwas von der Transaktion mitbekam; gleich darauf saß er wieder hinter dem Steuer, und sie waren unterwegs nach Guadalupe.
Mittlerweile war es total finster geworden, und er fummelte am Lichtknopf herum, bis die Scheinwerfer aufleuchteten. Es wurde immer wieder davon abgeraten, in Mexiko nachts Auto zu fahren. Nachts geschahen nicht nur die meisten Überfälle – die vom Asphalt abstrahlende Hitze lockte zudem das Vieh auf die Highways. Eine Kuh oder ein Pferd anzufahren war höchst unangenehm, und zwar sowohl für das Tier wie fürs Auto. Außerdem drohten Schlaglöcher und andere Hindernisse, die in der Dunkelheit schwerer zu erkennen waren. Um das Autofahren noch abenteuerlicher zu machen, fuhren manche Mexikaner nachts absichtlich ohne Licht, damit sie vor Hügelkuppen und in Kurven die entgegenkommenden Autos besser erkennen und ihnen ausweichen konnten, was nicht weiter schlimm war, solange nicht zwei Autos ohne Scheinwerferlicht aufeinander zufuhren. Dann war das etwa so, als würden zwei Lebensmüde mit verbundenen Augen aufeinander zurasen.
Brian machte es Spaß, in Mexiko Auto zu fahren. Er war jung genug, erst fünfundzwanzig, um Spaß daran zu finden, seine Nachtsicht und seine Reflexe im Kampf gegen alles, was ihn auf der Straße erwarten mochte, einzusetzen. Er strahlte eine unerschütterliche Ruhe aus und schien die Bedeutung des Wortes »Panik« nicht zu kennen, weshalb Milla ihm liebend gern das Steuer überließ und sich stattdessen mit beiden Händen betend am Handgriff festklammerte.
Es war fast zweiundzwanzig Uhr, als sie endlich ankamen, gefährlich kurz vor dem Zeitpunkt des angeblichen Treffens. Guadalupe war ein kleiner Ort mit zirka vierhundert Einwohnern und einer lang gezogenen Hauptstraße, an der sich Läden, die unvermeidliche Cantina und andere Gebäude aneinander reihten. Hier und da standen sogar noch Pfosten zum Ankoppeln der Pferde. Der Straßenbelag war zu Staub und Schotter verfallen, nur stellenweise war etwas Asphalt zu erkennen.
Sie rumpelten die Hauptstraße hinunter und überzeugten sich davon, dass es tatsächlich nur eine einzige Kirche gab; dahinter lag ein mit Kreuzen und Grabsteinen übersäter Friedhof. Im Vorbeifahren konnte Milla kaum etwas erkennen; sie ahnten nicht, ob zwischen der Kirche und dem Friedhof noch eine schmale Straße verlief. Allerdings nahm sie an, dass es dort eine Durchfahrt gab.
»Kein Parkplatz«, grummelte Brian, und sie spähte wieder auf die Straße. Er hatte recht; natürlich gab es genug Raum, um einen Wagen abzustellen, aber keinen Platz, an dem jemand, der nicht beobachtet werden wollte, ihn nicht bemerken würde.
»Wir müssen zurück zur Cantina fahren«, sagte sie. Dort hatten mehrere Autos und Lieferwagen geparkt, zwischen denen der Pick-up nicht weiter auffallen würde. Brian nickte und fuhr langsam, aber ohne anzuhalten an der Kirche vorbei. Gleich darauf bog er rechts in eine schmale Seitenstraße ein. Bei der nächsten Kreuzung bog er noch mal rechts ab und fuhr zur Cantina zurück.
Dort parkte er den Pick-up zwischen einem 1978er Chevrolet Monte Carlo und einem uralten VW Käfer. Ein paar Minuten hielten sie nur Ausschau und warteten ab, ob sich noch jemand auf der Straße befand. Aus der Cantina drang Lärm, aber auf der Straße regte sich nichts außer einem Hund, der neugierig schnüffelnd von Tür zu Tür wanderte. Milla und Brian nahmen sich je ein Nachtsichtgerät und eine Pistole. Ehe Brian die Tür öffnete, fasste Milla unwillkürlich nach oben, um die Innenbeleuchtung auszuschalten, aber die war längst entfernt worden.
Sie rutschten aus dem Auto und tauchten sofort in den Schatten ab. Der Hund glotzte zu ihnen her, gab ein neugieriges Bellen von sich und setzte, nachdem er kurz abgewartet hatte, ob sie wohl zurückbellen würden, seine Schnupperpatrouille fort.
Einen Gehweg gab es nicht, nur die Hindernisstrecke der Fahrbahn mit ihren Schlaglöchern und Asphaltbrocken. Zufällig trugen sie die ideale Kleidung für einen Späheinsatz bei Nacht: Brian ein schwarzes T-Shirt und grüne Cargo Pants, Milla Jeans und eine ärmellose Bluse in Bordeauxrot, und beide hatten Arbeitsschuhe mit Gummisohlen an den Füßen sowie ihre dunkelgrünen Baseballkappen mit dem »FA«-Logo für Finders Association auf dem Kopf. Brian hatte eher dunkle Haut, aber Millas nackte Arme leuchteten in der Dunkelheit, darum legte sie sich die Decke um die Schultern. Seit Anbruch der Nacht waren die Temperaturen empfindlich gesunken, und die Decke war ausgesprochen angenehm.
Sie rannten nicht, sie huschten auch nicht von Tür zu Tür; beides hätte einen eventuellen Beobachter stutzig gemacht. Stattdessen gingen sie zügig, aber nicht hastig die Straße entlang. Dumm war nur, dass es nicht einmal mehr fünfzehn Minuten bis zum vereinbarten Treffen waren. Andererseits kam ihnen zugute, dass Pünktlichkeit in Mexiko als schlechte Kinderstube galt und dass niemand außer einem Touristen je zur angesetzten Zeit erschien. Das bedeutete zwar nicht, dass die Kirche unbeobachtet wäre, aber es erhöhte trotzdem ihre Chancen, ungesehen einen guten Beobachtungsposten beziehen zu können.
Siebzig Meter vor der Kirche bogen sie von der Hauptstraße ab in einen schmalen Durchlass zwischen zwei Häusern, der sie zum Rand des Friedhofs führte.
»Und jetzt?«, flüsterte Brian, während er seine Pistole in die Hosentasche gleiten ließ und sein Nachtsichtgerät herausholte. »Sollen wir sie aus dem Hinterhalt überwältigen, uns Diaz rauspicken und ihn verschleppen, um ihn irgendwo zu verhören?«
»So leicht wird es wohl nicht gehen«, erwiderte sie trocken. Weil Brian jung und groß und stark und testosterongetrieben war, war er bislang mit allem fertig geworden, was sich ihm in den Weg stellte. Das Schlüsselwort dabei war »bislang«. Sie hatte am eigenen Leibe erlebt, wie schnell etwas ganz schrecklich schief laufen konnte. »Wir werden das tun, wenn sie nur zu zweit sind, aber wenn es mehr sind, unternehmen wir nichts.«
»Selbst wenn sie nur zu dritt sind?«
»Selbst dann.« Falls es nur zwei Männer waren, würden sie die beiden überraschen und in Schach halten können. Milla hatte keine Bedenken, diesen Kerlen die Waffe an die Schläfe zu drücken, bis Diaz ihre Fragen beantwortet hatte. Aber wenn es mehr als zwei waren ... Sie war weder dumm noch lebensmüde, und sie würde ganz gewiss nicht Brians Leben aufs Spiel setzen. Vielleicht würde sie zwei weitere Jahre warten müssen, bis sie erneut eine Chance bekam, mit Diaz zu sprechen, aber das war immer noch besser, als einen Freund begraben zu müssen. »Kannst du dich zur anderen Seite des Friedhofs vorarbeiten?«
»Hat eine Katze einen Schwanz?« Brian war nicht nur beim Militär gewesen, und zwar direkt nach der High School, sondern auch ein Bauernbursche aus dem Osten von Texas, der schon als Kind wie ein Schatten durch die Wälder geschlichen war, um Hirsche zu jagen.
»Dann such dir einen Posten, von wo aus du die Rückseite der Kirche überblicken kannst, und ich mache das Gleiche hier vorne. Vergiss nicht, wenn es mehr als zwei sind, dann schauen wir nur zu.«
»Klar. Aber wenn sie tatsächlich zu zweit sind, wie ist dann das Signal zum Zugriff?«