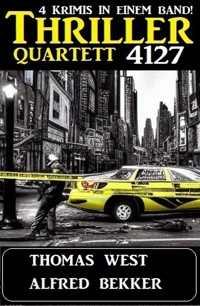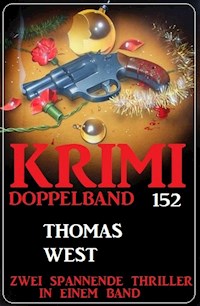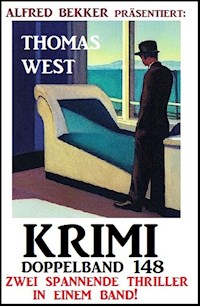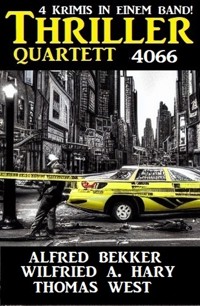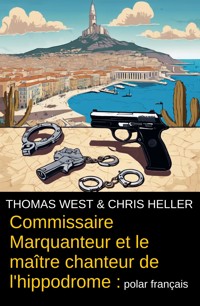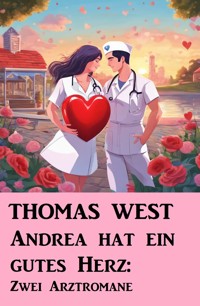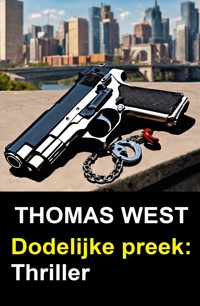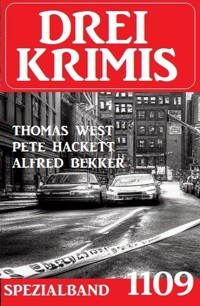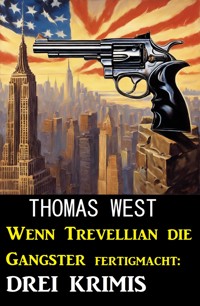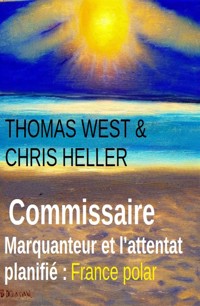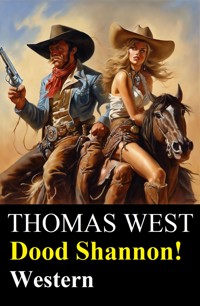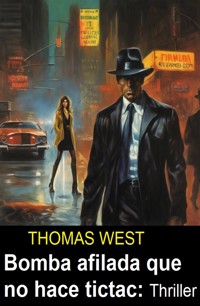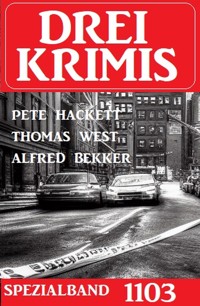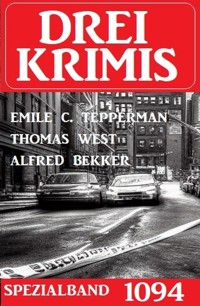Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Romane: Wendepunkt des Schicksals (Thomas West) Ein Teppich aus Bagdad (Harold MacGrath) Der Mann dudelte die Zahlen herunter, als hätte er sie die ganze Nacht über auswendig gelernt. Lars Bader musterte den jungen Mann gegenüber in der Konferenzecke seines Büros mit mürrischer Miene: Ein smarter Typ Ende zwanzig, also acht bis zehn Jahre jünger als Lars selbst. Mit schwarzen Ringen unter den Augen und einer soldatischen Frisur, mit der diese jungen Aufsteiger immer häufiger herumliefen. Wenn man einen Kahlkopf überhaupt eine Frisur nennen konnte. Der junge Mann – er hieß Becker, der Vorname war Lars entfallen – legte seine Computerausdrucke zusammen und sah seinen Chef beifallheischend an. "Gut gemacht, Herr Becker", sagte er ohne die Spur eines Lächelns. "Mit diesen Verkaufszahlen können wir uns morgen auf der Hauptkonferenz sehen lassen." Er erhob sich, um dem Jüngeren das Zeichen für das Audienzende zu geben. "Machen Sie ein paar hübsche Grafiken aus dem Material und stellen Sie morgen den Computer samt Beamer in den Konferenzraum. Wir werden alle Register ziehen." Becker verabschiedete sich und bleckte dabei sein tadellosen Gebiss. Die meisten Mitarbeiter des Verlags hielten das für ein Lächeln. Die Tür schloss sich, und Lars ließ sich in seinen Bürosessel fallen. Becker war nicht verkehrt. Es gab Schlimmere im Verlag. Karrieregeile Senkrechtstarter, die nur auf einen Fehler von ihm warteten. Bei denen wusste man wenigstens, woran man war. Doch Lars war lang genug im Geschäft – die Stelle als Vertriebschef des großen Verlagshauses hatte er vor mehr als vier Jahren erobert – um solchen Lächlern wie Becker zu misstrauen. Auch die nutzten jede Gelegenheit, um einem ans Bein zu pinkeln. Becker allerdings würde noch ein Weilchen zu ihm halten. Immerhin wurde Lars als heißer Kandidat für die Geschäftsführung gehandelt. Und Becker wäre blöd, es sich mit ihm zu verderben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herzroman Doppelband 1002
Inhaltsverzeichnis
Herzroman Doppelband 1002
Copyright
Wendepunkt des Schicksals
Ein Teppich aus Bagdad: Roman: Romance & Adventure
Herzroman Doppelband 1002
Thomas West, Harold MacGrath
Dieser Band enthält folgende Romane:
Wendepunkt des Schicksals (Thomas West)
Ein Teppich aus Bagdad (Harold MacGrath)
Der Mann dudelte die Zahlen herunter, als hätte er sie die ganze Nacht über auswendig gelernt. Lars Bader musterte den jungen Mann gegenüber in der Konferenzecke seines Büros mit mürrischer Miene: Ein smarter Typ Ende zwanzig, also acht bis zehn Jahre jünger als Lars selbst. Mit schwarzen Ringen unter den Augen und einer soldatischen Frisur, mit der diese jungen Aufsteiger immer häufiger herumliefen. Wenn man einen Kahlkopf überhaupt eine Frisur nennen konnte.
Der junge Mann – er hieß Becker, der Vorname war Lars entfallen – legte seine Computerausdrucke zusammen und sah seinen Chef beifallheischend an.
„Gut gemacht, Herr Becker“, sagte er ohne die Spur eines Lächelns. „Mit diesen Verkaufszahlen können wir uns morgen auf der Hauptkonferenz sehen lassen.“ Er erhob sich, um dem Jüngeren das Zeichen für das Audienzende zu geben. „Machen Sie ein paar hübsche Grafiken aus dem Material und stellen Sie morgen den Computer samt Beamer in den Konferenzraum. Wir werden alle Register ziehen.“
Becker verabschiedete sich und bleckte dabei sein tadellosen Gebiss. Die meisten Mitarbeiter des Verlags hielten das für ein Lächeln.
Die Tür schloss sich, und Lars ließ sich in seinen Bürosessel fallen. Becker war nicht verkehrt. Es gab Schlimmere im Verlag. Karrieregeile Senkrechtstarter, die nur auf einen Fehler von ihm warteten.
Bei denen wusste man wenigstens, woran man war. Doch Lars war lang genug im Geschäft – die Stelle als Vertriebschef des großen Verlagshauses hatte er vor mehr als vier Jahren erobert – um solchen Lächlern wie Becker zu misstrauen. Auch die nutzten jede Gelegenheit, um einem ans Bein zu pinkeln. Becker allerdings würde noch ein Weilchen zu ihm halten. Immerhin wurde Lars als heißer Kandidat für die Geschäftsführung gehandelt. Und Becker wäre blöd, es sich mit ihm zu verderben.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author /
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Wendepunkt des Schicksals
Ärztin Alexandra Heinze
Arztroman von Thomas West
Der Umfang dieses Buchs entspricht 141 Taschenbuchseiten.
Ein schrecklicher Baggerunfall ruft Dr. Alexandra Heinze zu einer Baustelle. Für den Verletzten besteht kaum noch Hoffnung, doch die Ärztin kämpft verbissen um das Leben des siebenfachen Vaters.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2019 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags geht es hier:
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
1
Der Mann dudelte die Zahlen herunter, als hätte er sie die ganze Nacht über auswendig gelernt. Lars Bader musterte den jungen Mann gegenüber in der Konferenzecke seines Büros mit mürrischer Miene: Ein smarter Typ Ende zwanzig, also acht bis zehn Jahre jünger als Lars selbst. Mit schwarzen Ringen unter den Augen und einer soldatischen Frisur, mit der diese jungen Aufsteiger immer häufiger herumliefen. Wenn man einen Kahlkopf überhaupt eine Frisur nennen konnte.
Der junge Mann – er hieß Becker, der Vorname war Lars entfallen – legte seine Computerausdrucke zusammen und sah seinen Chef beifallheischend an.
„Gut gemacht, Herr Becker“, sagte er ohne die Spur eines Lächelns. „Mit diesen Verkaufszahlen können wir uns morgen auf der Hauptkonferenz sehen lassen.“ Er erhob sich, um dem Jüngeren das Zeichen für das Audienzende zu geben. „Machen Sie ein paar hübsche Grafiken aus dem Material und stellen Sie morgen den Computer samt Beamer in den Konferenzraum. Wir werden alle Register ziehen.“
Becker verabschiedete sich und bleckte dabei sein tadellosen Gebiss. Die meisten Mitarbeiter des Verlags hielten das für ein Lächeln.
Die Tür schloss sich, und Lars ließ sich in seinen Bürosessel fallen. Becker war nicht verkehrt. Es gab Schlimmere im Verlag. Karrieregeile Senkrechtstarter, die nur auf einen Fehler von ihm warteten.
Bei denen wusste man wenigstens, woran man war. Doch Lars war lang genug im Geschäft – die Stelle als Vertriebschef des großen Verlagshauses hatte er vor mehr als vier Jahren erobert – um solchen Lächlern wie Becker zu misstrauen. Auch die nutzten jede Gelegenheit, um einem ans Bein zu pinkeln. Becker allerdings würde noch ein Weilchen zu ihm halten. Immerhin wurde Lars als heißer Kandidat für die Geschäftsführung gehandelt. Und Becker wäre blöd, es sich mit ihm zu verderben.
Lars hängte sein silbergraues Jackett über die Stuhllehne, er trug schon seit Jahren maßgeschneiderte Anzüge, und zündete sich eine Zigarette an. Die Geschäftsführung – zum Greifen nah das Ziel, endlich. Nachdenklich strich er sich über seinen blonden Bürstenhaarschnitt. Es stand Fifty-fifty. Er oder Harald Maresch, der Marketingchef. Die Sitzung morgen würde die Weichen stellen.
Lars griff zu seinem Diktiergerät, um ein paar Briefe zu diktieren. Die Tür zum Vorzimmer ging auf, seine Sekretärin stand auf der Schwelle und machte ein erschrockenes Gesicht. „Herr Dr. Barth hat angerufen – ob Sie den Termin bei ihm vergessen haben …“
„Was für einen Termin, zum Teufel?“ Sein etwas blasses, jungenhaftes Gesicht nahm einen zornigen Ausdruck an. Lars zog seinen elektronischen Planer aus der Jackentasche. Für Montagnachmittag war kein Termin vorgesehen!
„Er wartet mit Herrn Maresch in seinem Büro auf Sie.“ Die Sekretärin verhaspelte sich.
„Was haben Sie denn da wieder versaubeutelt, Frau Häring!“, rief er wütend und sprang auf.
„Ich weiß von nichts, wirklich nicht, Herr Bader.“ Sie würde gleich in Tränen ausbrechen. Seine manchmal harsche Art brachte sie jedes Mal aus der Fassung. Statt sie weiter anzuschnauzen, raffte Lars sämtliche greifbare Unterlagen über aktuelle Vorgänge zusammen. Er hatte nicht die geringste Ahnung, was der Chef von ihm wollte. Bilanzen? Statistiken? Ein Bericht über die Messe? Am besten, er nahm alles mit. Er konnte ja nicht zugeben, dass er keinen Schimmer von dem Termin hatte.
Ein stechender Schmerz bohrte sich in seinen Oberbauch. Er presste die Zähne zusammen. Der Magen. Machte ihm schon seit Monaten Schwierigkeiten. Er schob eine von diesen Kautabletten, die die Magensäure neutralisierten, in den Mund und verließ sein Büro.
Die Chefetage lag im obersten, im sechsten Stock des weiträumigen Verlagskomplexes am Rande der Stadt. Die Chefsekretärin öffnete ihm die Tür zum Geschäftsführer. Der sah ihm fragend entgegen.
„Ein Telefonat mit Köln. Der Fernsehsender, mit dem wir ins Geschäft kommen wollen. Ich konnte es unmöglich abwürgen.“ Das kalte Grinsen um Mareschs Mundwinkel entging ihm nicht.
„Schon gut, Herr Bader.“ Der Chef zeigte auf einen freien Sessel an der linken Seite seines gewaltigen Schreibtisches. Auf der rechten saß sein Konkurrent.
„Natürlich“, dachte Lars, „nicht die Häring – dieser linke Hund von Maresch hat den Termin in seinem Vorzimmer versanden lassen.“ Das war nicht das erste Mal. In den letzten vier Wochen ging Maresch sogar soweit, seinem Konkurrenten um den Chefsessel wichtige Informationen vorzuenthalten: Briefe, Faxe, E-Mails. Er wollte um jeden Preis auf den Stuhl, auf dem jetzt noch Barth saß. Der kramte gerade in irgendwelchen Unterlagen.
„Also, wer von den Herren will anfangen?“, fragte der Chef, ohne aufzusehen.
Kalt lächelnd wies Maresch mit der Hand auf Lars. „Ich lasse Ihnen gerne den Vortritt, Herr Bader.“
„Du linkes Arschloch“, dachte Lars und lächelte genauso eisig zurück. „Gerne“, sagte er und spähte auf die Papiere, in denen sein Chef wühlte. Er entdeckte Briefköpfe von Firmen, mit denen er auf der Messe zu tun hatte. „Vielleicht zunächst die wichtigsten Kundenkontakte von der Messe.“ Er sprach aufreizend gedehnt und in der sachlichen Gelassenheit, für die er im ganzen Verlag bekannt war.
Eine Stunde verbrachten sie beim Chef. Die Sitzung lief glatt, und der Noch-Geschäftsführer schien zufrieden. Er wollte einen sauberen Einstand, morgen, wenn man ihn in den Vorstand berufen würde. Maresch und Lars vermieden den offenen Schlagabtausch. Sie verabschiedeten sich vom Chef, und jeder der drei wusste, dass die große Schlacht auf morgen vertagt war.
2
„Das erste, was Sie tun, wenn Sie zu einem Notfall kommen“, Alexandra legte die rechte Hand an den Kehlkopf der Übungspuppe, „Sie tasten die Halsschlagader des Patienten. Wenn Sie keinen Puls fühlen können, und auch der Brustkorb sich nicht mehr hebt, wissen Sie, dass Sie es mit einem Herz-Atem-Stillstand zu tun haben.“
Alexandra sah in die erwartungsvollen Gesichter der jungen Frauen um sich – auch eine Handvoll Männer war unter der Gruppe. Die Notärztin gab an diesem Montagnachmittag Unterricht in der Krankenpflegeschule – Notfallmedizin. Sie hatte Jürgen Wiesenberg von der Intensivstation mitgenommen. Falls ein Notfall dazwischenkam, würde er die Unterrichtsstunde fortsetzen. Der vierunddreißigjährige Krankenpfleger hatte zwar selbst erst vor einem knappen Jahr sein Examen abgelegt, war aber in jeder Beziehung so fit, dass man ihm getrost die Lektion über Wiederbelebung überlassen konnte. Sogar die jungen Assistenzärzte fragten ihn manchmal um Rat, wenn sie sich unsicher waren.
„Und dann muss alles sehr schnell gehen“, sagte Alexandra und drehte die Puppe auf die Seite. „Stabile Seitenlagerung, den Mund des Patienten von Erbrochenem und falschen Zähnen befreien.“ Die Schwesternschülerinnen schrieben eifrig mit. „Dann wieder in Rückenlage, den Kopf in den Nacken, mit der Linken die Nase zuhalten, mit der flachen Rechten das Kinn hochziehen, und dann pressen Sie Ihre Lippen fest auf den Mund des Bewusstlosen, sehen Sie – so.“ Alexandra demonstrierte die Beatmungstechnik. Einige der Schwesternschülerinnen verzogen angewidert das Gesicht.
„Zweimal, achten Sie darauf, ob der Brustkorb sich hebt. Wenn ja, können Sie davon ausgehen, dass Sie nicht den Magen, sondern die Lungen aufblasen.“ Alexandra sah auf und bemerkte den Widerstand in einigen Gesichtern. „Falls Sie sich ekeln, legen Sie ein dünnes Taschentuch oder eine Kompresse über den Mund des Notfallopfers. Oder schieben Sie ihm einen Güdel-Tubus in den Rachen.“
Sie rutschte auf den Knien vom Kopf zur Brust der Puppe. „Und dann sofort die Herzdruckmassage. Mit dem linken Handballen auf das untere Drittel des Brustbeins, den rechten Handballen drübergelegt, und dann mit ausgestreckten Armen.“ Sie presste die Brust der Puppe zusammen. Der kleine schwarze Ball in der Zahlenskala, die an den Blasebalg im Inneren der Puppe angeschlossen war, sprang knapp über den roten Bereich.
„Fünfmal, wenn Sie allein sind. Es ist unheimlich anstrengend – täuschen Sie sich nicht! Und jetzt sind Sie dran.“
Der Kurs übte an zwei Puppen. An der einen assistierte Alexandra, an der anderen Wiesenberg. Die meisten Krankenpflegeschüler bliesen die Luft neben den Mund der Puppe, oder drückten bei der Herzdruckmassage viel zu zaghaft zu.
„Übung macht den Meister“, bemerkte Alexandra trocken. „In der Klinik werden Sie meistens zu zweit sein. Deswegen jetzt die Wiederbelebung zu zweit.“ Gemeinsam mit dem Krankenpfleger demonstrierte sie die Technik. Danach waren wieder die Schüler dran.
Die zwei Stunden vergingen im Flug, kein Notruf störte Alexandra. Später, im Krankenhausgarten, verabschiedete sie sich von dem Pfleger. „Vielen Dank, Herr Wiesenberg. Das haben Sie wirklich gut gemacht. Ich werde ein gutes Wort bei der Oberschwester für Sie einlegen, vielleicht können wir in Zukunft öfter gemeinsam unterrichten!“
„Wäre mir ein Vergnügen, Frau Dr. Heinze. Auf Wiedersehen.“ Er bog in den Parkweg zum Hintereingang des Marien-Krankenhauses ein.
Alexandra sah ihm nach. „Schwer in Ordnung, der Mann“, dachte sie. Seine zurückhaltende, besonnene Art beeindruckte sie. Sie hatte sich schon manchmal gefragt, was ihn bewogen haben mochte, mit Anfang dreißig noch einmal einen neuen Beruf zu lernen. Und noch dazu Krankenpfleger. Alexandra hatte schon miterlebt, dass manche Patienten ihn für einen Arzt gehalten hatten.
Sie ging auf den Eingang des Personalwohnheimes zu. Da kein Notfall zu drohen schien, konnte sie einen versprochenen Krankenbesuch einschieben.
Über das Treppenhaus erreichte sie die zweite Etage des Personalwohnheimes. Vor Zimmer 212 blieb sie stehen und klopfte. „Herein!“ Alexandra betrat das kleine Apartment. Sie hatte hier schon den einen oder anderen Kaffee getrunken. Doch jedes Mal, wenn sie dieses Apartment betrat, war sie überrascht von der Eleganz, mit der es eingerichtet war: Niedrige Möbel in Leder und Holz, schwarz über chromblitzenden Beinen und Verstrebungen, Musikanlage in gläsernem Regal, ein großflächiger Spiegel in schwarzem Rahmen neben dem Garderobenschrank, die Wände nur sparsam geschmückt mit zwei hängenden Topfpflanzen, einer Popart-Uhr, und über dem Bett ein großflächiges Ölgemälde. Eine Schale mit einer Magnolienblüte inmitten eines mittelalterlichen Burgturms. Durch die zinnenartigen Fenster des Turms leuchtete ein blauer Himmel. Alexandra wusste, dass die Bewohnerin dieses Apartments das Bild von ihrem ehemaligen Verlobten, einem Kunstmaler, geschenkt bekommen hatte.
„Hallo, Alexandra – wie schön, dass Sie kommen!“ Die Frau auf dem schwarz gerahmten Bett richtete sich auf. Sie schob die schwere Baumwolldecke mit den rot-gelben Ornamentstickereien beiseite und schlüpfte in ein Paar rote Lederpantoffel. Auf dem Glastisch vor dem Bett stand eine Kobaltvase mit einem Strauß dunkelroter Rosen.
„Bleiben Sie doch liegen, Ute“, sagte Alexandra, aber die Frau überhörte das einfach. Ute Reinhard schätzte es nicht besonders, von anderen in einer Situation der Schwäche gesehen zu werden. Sie stand auf und gab Alexandra die Hand.
„Kommen Sie, nehmen Sie Platz. Kaffee?“ Obwohl Alexandra ablehnte, verschwand Ute in ihrer Kochnische, um die Kaffeemaschine anzuwerfen. Alexandra betrachtete die Frau, wie sie an der Arbeitsfläche ihrer kleinen Küche stand und Kaffeepulver in den Filter löffelte. Sie war relativ groß, einen halben Kopf größer als die Notärztin. Ihr rotbraunes Haar hing zu einem lockeren Zopf geflochten fast bis zu den Hüften über ihren Rücken herab. Ein gerader Rücken – schon die Art, wie Ute dort stand, verriet die tatkräftige, energische Frau, die sie war.
„Wie geht es Ihnen, Ute?“
„Ach ja, es ging schon schlechter.“ Sie stellte die schwarze Kaffeedose zurück ins Regal. „Aber auch schon wesentlich besser.“
„Wieder eine Grippe?“ Alexandra hatte kurz nach Antritt ihres Spätdienstes einen Patienten auf der Intensivstation eingeliefert und dabei erfahren, dass die Stationsschwester sich krank gemeldet hatte.
„Die Grippe hört überhaupt nicht mehr auf“, seufzte Ute, „den ganzen April schon geht das so, und den halben März. Wird höchste Zeit, dass es Mai wird und der Frühling kommt.“ Ute nahm gegenüber von Alexandra auf ihrer Bettcouch Platz. Ihr Gesicht spiegelte eine Mischung aus Ärger und Kummer. „Ich ertrag mich bald selber nicht mehr“, fügte sie etwas leiser hinzu. Zwei braune, fast schwarze Augen glänzten in ihrem scharf geschnittenen Gesicht. Die große, schmale Nase bog sich ein wenig in der Mitte des Nasenrückens. Das verlieh ihrem ansonsten schönen Gesicht etwas Interessantes. Manchmal wurde sie gefragt, ob sie Sinti und Roma unter ihren Vorfahren hatte. „Ich bin eine ganz normale Schwäbin“, pflegte sie dann lachend zu entgegnen.
Alexandra wusste, dass Ute sich auch durch eine Grippe nicht von ihrer Arbeit abhalten ließ. Es musste ihr schon ziemlich mies gehen, dass sie sich heute krank gemeldet hatte. Aber davon sprach sie natürlich nicht – typisch.
„Haben Sie Fieber, Ute?“
Sie winkte ab. „Ein bisschen. Ich bin so wackelig auf den Beinen, dass mir heute vermutlich jede Infusionsflasche aus der Hand gerutscht wäre.“
„Ich finde es gut, dass Sie im Bett geblieben sind, Ute, Sie müssen sich endlich einmal richtig auskurieren.“ Alexandra wusste, dass sie noch mehr zu sagen hatte. Sie suchte nach Worten. „Ihre ständigen Infektionen zermürben Sie. Das ging doch schon im letzten Jahr so, wenn ich mich recht entsinne?“ Die andere nickte stumm. „Ich glaube, Sie sind ziemlich am Ende.“
Ute stand auf um in der Küche zu verschwinden. Während sie mit Tasse und Löffeln klapperte, rief sie: „Mein Immunsystem spinnt einfach!“ Sie kam mit einem Tablett zurück und stellte Tassen und Kannen auf den Glastisch.“
„Ein Zeichen, dass Sie erschöpft sind.“
„Sieben Jahre Intensiv – das haut auch eine Pferdenatur wie mich irgendwann um“, seufzte Ute. Ein für sie ungewöhnliches Geständnis. Und sie war nicht einmal eine Pferdenatur, auch wenn sie jeder dafür hielt. Ihre Größe, ihre starke persönliche Ausstrahlung und ihre unglaubliche Leistungsfähigkeit hatten ihr den Ruf der Powerfrau schlechthin eingebracht. Selbst Höper, der chirurgische Oberarzt, sonst weit entfernt von Rücksichten oder gar Hemmungen, hatte Respekt vor ihr.
Nur Alexandra wusste, dass diese imposante Frau im Grunde sehr zerbrechlich war. Und dass sie seit mindestens einem Jahr weit über ihre Grenzen ging. Sie wusste aber auch, dass Ute zu den Menschen gehörte, die keine Grenzen akzeptieren wollten.
Sie hatten sich vor etwas mehr als einem Jahr näher kennengelernt. Alexandra konnte sich lebhaft an die Nacht erinnern. Sie hatte ein Unfallopfer auf die Intensiv gebracht. Ute hatte Nachtdienst damals. Zwei Stunden hatten sie um das Leben der Frau gekämpft, bevor sie gestorben war. Die Erschütterung danach hatte den Weg der beiden Frauen zueinander geebnet. Sie sprachen lange miteinander, auch in den folgenden Tagen und Wochen. Und irgendwann waren sie so etwas wie Freundinnen geworden, die sich Dinge anvertrauten, die man nicht jedem erzählt. Obwohl sie sich immer noch siezten. Bis heute. „Merkwürdig“, dachte Alexandra.
Sie merkte rasch, dass Ute nicht weiter über ihren Zustand sprechen wollte. Also wechselte sie das Thema. „Von wem sind diese wunderbaren Rosen?“, fragte sie.
Ute lachte. „Unser guter Dr. Eisenbrand hat sie mir schicken lassen. Kaum zwei Stunden, nachdem ich mich krank gemeldet hatte.“ Felix Eisenbrand war Assistent auf der Intensiv. Noch nicht lange. Drei Monate höchstens. Alexandra hatte gleich gemerkt, dass er Feuer fangen würde. Ute war eine Frau, bei der viele Männer Feuer fingen.
Nachdenklich schlenderte Alexandra eine halbe Stunde später durch den Krankenhausgarten zurück in die Klinik. Sie hatte das Gefühl, das Ute in einer Krise war. Wahrscheinlich, ohne es vor sich selbst zuzugeben. Geschweige denn vor anderen. „Sie kann nicht mehr“, dachte Alexandra, „und irgendwann muss sie der Wahrheit ins Gesicht sehen.“
3
„Was kann ich noch für Sie tun, Herr Bader?“ Die Sekretärin schaute in sein Büro hinein. Ihr Gesicht war ein einziges Fragezeichen. Lars kannte das. Seit vier Jahren arbeitete er mit der Häring zusammen, und noch nie hatte sie gewagt zu sagen: Es ist halb fünf – ich mach jetzt Feierabend.
„Gehen Sie um Gottes Willen nach Hause, Frau Häring!“, brummte er mit seinem rollenden Bass. „Es ist ja schon nach fünf. Und nichts für ungut wegen dem Cheftermin – ich weiß inzwischen, dass die Schwachstelle nicht bei Ihnen lag.“
Ihr Gesicht hellte sich auf. „Danke, Herr Bader. Und machen Sie nicht mehr zu lange.“ Er winkte ihr zu, und sie schloss die Tür.
Machen Sie nicht mehr zu lange – auch so ein häringscher Standardsatz. Lars wusste genau, was sich dahinter verbarg: Das Bedürfnis seiner Sekretärin, den Privatmensch Lars Bader anzusprechen. Über dienstliche Belange hinaus war er in all den Jahren nicht mit ihr ins Gespräch gekommen. Und sie dürstete danach.
Die Häring war o.k., keine Frage. Lars mochte sie sogar. Aber Privates mit ihr besprechen? Das ging nicht. Mit niemandem hier. Man konnte keinem Menschen vertrauen in diesem Laden.
Lars erledigte noch einige kleinere Routinearbeiten. Immer wieder ging er zum Fenster und schaute auf den Firmenparkplatz hinab. Auf den grauen Benz von Maresch. Um viertel nach sechs war er endlich verschwunden. Vorsichtshalber wählte Lars die Nummer seines Vorzimmers. Niemand nahm ab. Also war auch seine Sekretärin schon aus dem Haus.
Dann kramte er einen Notizzettel aus seiner Brieftasche, legte ihn neben die Tastatur seines Computers und strich ihn sorgfältig glatt. Nur ein Wort stand darauf: Jäger.
Lars hatte laut lachen müssen, als Ulla – er hatte ein paar Mal mit der Sekretärin von Maresch geschlafen – ihm den Zettel mit dem Codewort ausgehändigt hatte. Maresch war kein Mensch, der die Wochenenden in irgendeiner Jagdpacht verbrachte. An Wochenenden pflegte er auf Partys, in Theater und Oper oder sonst wo seinen sogenannten gesellschaftlichen Verpflichtungen nachzukommen. Oder zu arbeiten. Genau wie Lars selbst. Und nur insofern war er ein Jäger – ein Mann auf der Jagd nach Erfolg. Und nach der nächsten Sprosse der Karriereleiter.
Jäger war Mareschs persönliches Codewort für seine wichtigsten Computerdateien. Die Dateien, in denen er die Infos vergraben hatte, die ihn auf den Chefsessel bringen sollten. Lars hatte Ulla einen Tausender für das Codewort in die Hand gedrückt. Sie hätte es ihm auch so gegeben. Aber auf diese Weise war sie in seiner Hand. Ein übles Spiel – Lars ekelte sich manchmal vor sich selber – aber alle spielten es, und wer nicht mitspielte, war out.
Lars klinkte sich ins EDV-Netz des Verlages ein. Jäger tippte er in die Tastatur. Mit dem Passwort öffneten sich die Pforten zu Mareschs Trümpfen.
Zahlenkolonnen erschienen auf seinem Bildschirm, Analysen neuer Märkte, vor allem die Prognosen für die Gewinne, die sich aus der Zusammenarbeit mit diversen Fernsehsendern ergeben sollten. Und natürlich Adressen von potentiellen Partnern in den USA.
Sicher wäre es ein Leichtes für Lars gewesen, einfach ein paar Zahlen zu ändern, Daten verschwinden zu lassen, unsinnige Berechnungen einzuschmuggeln. Aber soweit ging er nicht. Nie. Er hatte sich sehr verbogen, seit er in der Firma war. Aber nie so weit, wie Maresch und ein paar der Leute aus seiner Seilschaft. Selbst Schläge unter die Gürtellinie parierte Lars möglichst immer so, dass er sich noch ins Gesicht gucken konnte, wenn er vor dem Spiegel seiner Bürotoilette stand.
Sicher, was er hier machte, war nicht legal. Aber anders gab es kein Durchkommen in diesem Dschungel namens Bellhaus-Verlag. Er druckte die Dateien aus, die ihm wichtig erschienen, verwischte seine Spuren auf Mareschs Festplatte, und vertiefte sich stundenlang in seine Beute. Lars, der Jäger. Langsam dämmerte ihm, was für eine Strategie Maresch morgen fahren würde.
Gegen halb neun klingelte das Telefon. „Lars, wo bleibst du denn?“ Carolas Stimme. Lars schlug sich an die Stirn. „Verdammt! Tut mir leid – ich hab ganz vergessen, dir zu sagen, dass es später werden kann heute Abend.“ Schweigen am anderen Ende der Leitung. „Carola? Bist du noch dran?“
„Ja.“
„Hör mal, du weißt doch: morgen die Konferenz, da fallen die Würfel.“
„Die Würfel fallen bei dir schon seit Jahren. Tag für Tag.“ Ihre Stimme klang monoton. Wenigstens machte sie ihm keine Szene, wie sonst.
„Du weißt doch, um was es geht, Schatz! Wenn ich den Geschäftsführerposten hab, sind wir alle Sorgen los.“
„Welche Sorgen? Wir haben keine Sorgen. Abgesehen davon, dass wir weder eine Ehe noch ein Familienleben führen.“ Bitter klang sie.
„Jetzt fang nicht schon wieder damit an! Denk doch, was du dir dann alles leisten kannst. Wir …“
„Wahrscheinlich hab ich nicht genug Phantasie, um mir noch mehr Dinge vorzustellen, die ich mir leisten will.“
„Jetzt werd’ nicht grundsätzlich, verdammt, du weißt doch, dass ich weg vom Fenster bin, wenn ich nicht meine Karriere im Auge behalte.“
„Das sagst du schon seit neun Jahren. Und immer, wenn du ein Ziel erreichst hast, schmiedest du Pläne, wie du noch weiter nach oben kommst. Mich kotzt das allmählich an!“
„Carola, jetzt sei doch vernünftig, ich …“ Sie hatte unterbrochen. Einfach aufgelegt. „Scheiße!“, fluchte er und knallte den Hörer auf. „Ich hab dich nicht gezwungen, mich zu heiraten!“
Er zündete sich eine Zigarette an. Etwas in ihm wusste, dass sie recht hatte. Man war nie am Ziel in seiner Branche. Es musste immer weiter gehen. Wer stehenblieb, stürzte unweigerlich ab. Verdammt – so war das nun mal! Und er hatte es gewusst, als er in die Wirtschaft gegangen war, gewusst und gewollt.
Er stand auf und lief unruhig und rauchend in seinem Büro auf und ab. Diese Frau! Jahrelang hatte sie das Spiel mitgespielt! Und seit letztem Sommer, seit der Einschulung der älteren ihrer beiden Töchter, nörgelte sie nur noch an ihm herum. Ständig dieses unzufriedene Gesicht, ständig diese kraftraubenden Streitereien! Das Haus, die beiden Wagen, die Luxusurlaube – all das zählte plötzlich nicht mehr!
„Scheiß Frauengruppe“, murmelte Lars böse. Im Spätsommer hatte sich Carola dieser Selbsterfahrungsgruppe angeschlossen. War nicht seitdem der Wurm drin? „Was soll ich denn machen?“, fragte er laut. „Biobrot backen? Ponys züchten?“ Er drückte die Zigarette aus. „Ich wollte Karriere machen, und nun hänge ich mitten drin und muss weiter. Oder ich kann mir die Kugel geben! So ist das eben – basta!“
Natürlich gab es Augenblicke, in denen der Zweifel an ihm nagte. „All die Kraft, all der Stress – nur für die Karriere?“, sagte eine Stimme in solchen Augenblicken. Eine Stimme, die tief in seinem Inneren raunte. „Ist das Leben?“, fragte die Stimme dann. „Soll das alles gewesen sein, wenn du einmal ins Gras beißt?“
„Schluss jetzt!“, fegte er die Gedanken beiseite und ließ sich wieder in seinen Bürosessel fallen. So war er immer gewesen. Schon in der Schule, und später dann in der Uni. Alle Bedenken, die sich ihm in den Weg gestellt hatten, hatte er einfach ignoriert. Anders hätte er nicht den Weg genommen, den er genommen hatte: Klassenbester, Examen mit Auszeichnung, rasanter Aufstieg im Verlag, jüngster Ressortchef in der ganzen Firma.
Lars arbeitete die Nacht durch. Er würde einen überzeugenden Vortrag halten, morgen, vor der Geschäftsführung. Er würde alle Register der Präsentationstechnik ziehen. Er würde Maresch alt aussehen lassen. Erst als ihn am frühen Morgen diese Gewissheit erfüllte, schaltete er seinen PC aus und ging nach Hause.
4
Herbert Mall stellte seinen neuen Fiat, angezahlt mit dem fällig gewordenen Bausparvertrag – die Monatsraten würden in diesem Jahr den Urlaub kosten –, auf dem provisorischen Parkplatz vor der Großbaustelle ab. Unter dem einen Arm die Zeitung, unter dem anderen die alte Aktentasche mit Thermoskanne und Stullen, betrat er die Bauhütte. Zum letzten Mal, aber das ahnte Mall zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal.
„Morgen, Herbert, alles klar?“ Der Polier war schon da.
„Nee, muss arbeiten heute.“ Mall schlug seine Zeitung auf, um einen Artikel über den Stürmer seines Lieblingsvereins zu lesen. Ralf Birsten hieß der Torjäger des Kölner Bundesligaclubs. Er hatte am Samstag einen gegnerischen Verteidiger k.o. geschlagen.
„Sei froh, dasste Arbeit hast, Mann“, sagte der andere. Mall brummte irgendetwas Unverständliches und ärgerte sich über die Sperre, die der DFB Ralf Birsten, dem Stürmer, angedroht hatte. Das jedenfalls stand in dem Artikel. „Scheißdreck“, brummte er. Seiner Meinung nach hatte Birsten den Verteidiger versehentlich mit dem Ellenbogen erwischt. Wenn er gesperrt würde, konnte der Verein die Meisterschaft vergessen.
Mall stieß einen Fluch aus, legte die Zeitung zusammen und goss sich einen Kaffee ein. Nun gut, morgen würde man mehr wissen.
Nach und nach trudelten die Kollegen ein. Manche wortkarg und muffig, andere mit flapsigen Bemerkungen, und wieder andere schimpfend – auf das feucht-kalte Aprilwetter, den Zulieferer, der gestern den falschen Beton gebracht hatte, auf die Frau zu Hause und den Finanzminister in Bonn.
Als Mall den ersten Kipper draußen vorfahren hörte, schloss er Tasche und Zeitung in seinen Spind ein und verließ die Bauhütte. Missmutig sah er auf das erste Fundament in der riesigen Baugrube. Ein Bürokomplex mit Tiefgarage sollte das werden.
Die Raupenfahrer winkten ihm aus der Baugrube zu und stiegen in ihre schmutzig-gelben Ungetüme. Sie würden ihm wieder den ganzen Tag lang den Dreck an den Grubenrand schieben, den er mit seinem Bagger auf die Kipplaster zu packen hatte. Morgen noch, höchstens übermorgen noch einen halben Tag – dann waren die Erdarbeiten abgeschlossen.
„Morgen, Herbert!“, grüßte der Lastwagenfahrer. „Scheißwetter, was!“ Es regnete nicht direkt, es nieselte, und man musste aufpassen, dass man nicht ausrutschte auf dem modrigen Lehmboden.
„Nicht Fisch und nicht Fleisch“, brummte Herbert, hievte seine zwei Zentner in den roten Bagger, und warf den Motor an. Die nächsten Stunden verliefen in monotoner Einförmigkeit: Die Kipplaster fuhren ein und fuhren aus, die Hebel für die Hydraulik des Baggerarmes vor- und zurücklegen, nach links und nach rechts schwenken, mit leerem Löffel zur Grube, mit vollem Löffel zum Laster, und alles begleitet vom Grollen des Dieselmotors.
Herbert Malls Gedanken schweiften von der Baugrube zum gesperrten Mittelstürmer, über seinen neuen Fiat zum Balkon seines geerbten Häuschen, wo sie in diesem Jahr den Urlaub verbringen würden, er und Lore, seine Frau und fünf der Kinder. Die zwei großen gingen schon eigene Wege – der Älteste würde in diesem Jahr seine Elektrikerlehre abschließen. Stolz erfüllte Herbert, und er ließ den Baggerlöffel tief in den Dreck sausen. Martina, die Zweitälteste, hatte im letzten Herbst ein Praktikum in einem Krankenhaus angefangen, wollte Krankenschwester werden.
Herbert Mall ließ den Löffel unten, weil gerade kein Laster anrollte. Und natürlich Lore, seine Frau – auch zu ihr schweiften seine Gedanken. Nervte ihn gewaltig zur Zeit. Der Laster schoss rückwärts durch die Einfahrt des Bretterzauns. Hat’s verdammt eilig, der Kerl! Mall wandte sich dem Löffel zu und holte ihn aus dem Erdhaufen. Wollte ihm das fünfte Bier abends madig machen, die Lore, und eine Schachtel Reval statt zwei würde es auch tun. Immerhin hatte er heute erst eine einzige geraucht. Nicht im neuen Auto, nein – zu Hause auf der Toilette, bevor er ging. Das musste sein, sonst konnte er nicht.
Er schwenkte den Bagger herum – und plötzlich sah er die Schräglage des Lasters. Dieser Idiot hatte es doch glatt so eilig gehabt, dass er viel zu nah an die Grube gefahren war! Und warum zum Teufel war er ihm so dicht auf den Pelz gerückt? Er hatte ja kaum Spielraum mit dem Baggerarm!
Jetzt bröckelte die feuchte Erde unter dem Zwillingsreifen, und das schwere Gefährt kippte nach links in die Grube, ganz langsam, ganz langsam – Mall brüllte, versuchte den Baggerarm herumzureißen, denn er sah genau, dass er mit dem Löffel auf Kollisionskurs war.
Der Laster kippte immer schneller, rutschte nach hinten weg, erwischte den Löffel des Baggers und riss ihn seitlich nach unten. Mall griff nach der rechten Tür, wollte abspringen, stürzte aber zurück und prallte durch die linke Tür nach draußen, direkt in die Grube, und Bruchteile von Sekunden später begrub ihn sein schweres Arbeitsgerät unter sich.
Mall hatte nicht einmal mehr Zeit zum Schreien. Und auch keine Zeit, um Schmerz zu empfinden. Das Letzte, was er spürte war der eisige Schreck, der durch seine achtundneunzig Kilo schoss, als er den Schatten des Baggers auf sich zukommen sah. „Vorbei, Herbert“, meldete irgend eine Ecke seines Hirns, und dann wurde es sehr dunkel.
5
„Wie alt ist die Patientin?“ Albert Kranz, der Chefinternist, sah von dem Beatmungsprotokoll auf.
„Neunundachtzig“, antwortete Jürgen Wiesenberg. Die alte Dame war vor zwei Tagen mit einem schweren Hinterwandinfarkt aus einem Altenheim eingeliefert worden. Seitdem wurde sie beatmet.
Dr. Albert Kranz seufzte und warf einen hilfesuchenden Blick auf seine Oberärztin. „Was meinen Sie, Frau Keller?“ Lore Keller hatte sich schon vor der Visite in die Befunde der Patientin vertieft.
„Wir haben getan, was wir konnten. Aber der Herzmuskel ist derart vernarbt, dass ich keine Hoffnung mehr habe. Das Herz ist vollkommen insuffizient – es spricht kaum noch auf Digitalis an. Die Frau hatte ja bereits zwei Infarkte.“
Der Chefarzt warf dem Internisten der Intensivstation einen fragenden Blick zu. Richard Kallweit nickte. „Das EKG sieht verheerend aus, das Lungenödem lässt sich kaum noch in den Griff kriegen. Meine Prognose: Infaust.“
Jürgen Wiesenbergs Nackenhaare richteten sich auf. Das ging ihm jedes Mal so, wenn er dieses Wort hörte – infaust: Nicht zu retten. Das meinten die Ärzte damit, auch wenn der Begriff wörtlich übersetzt eigentlich nur ungünstig bedeutete.
„Also gut.“ Albert Kranz legte die Kurve in das Fach unter den Monitor. „Nehmen wir noch einmal die wichtigsten Laborwerte ab und lassen den Vormittag vorübergehen. Wenn sich bis dahin keine neuen Aspekte ergeben, schalten wir den Respirator ab.“ Jürgen schrieb mit. „Ich möchte aber vorher noch einmal Bescheid bekommen, Herr Wiesenberg.“
„In Ordnung, Dr. Kranz.“
„Und reanimiert wird selbstverständlich nicht mehr.“
Jürgen zog seinen roten Kugelschreiber aus der Brusttasche der blauen Schutzkleidung und dokumentierte diese Anordnung, indem er den Namen der Patientin, rechts oben auf der Verlaufskurve, mit einem roten Dreieck einrahmte. Jeder Kollege, jede Kollegin würde sofort wissen, dass man diese Patienten im Falle eines Herzstillstandes nicht mehr wiederbeleben sollte.
„Danke, Herr Wiesenberg.“ Kranz verabschiedete sich mit Handschlag von dem großen, schwarzhaarigen Pfleger. Lore nickte ihm lächelnd zu. Der ruhige Mann, dessen Schnauzer ihm etwas von der Würde eines englischen Lords verlieh, hatte ihre Sympathie vom ersten Tag an gewonnen. Damals schon, vor einem Jahr, hatte sie den Eindruck, dass er so eine Art Fels in der Brandung des manchmal chaotischen Intensiv-Betriebes werden könnte. Und sie hatte sich nicht getäuscht. Die gelassene und besonnene Ausstrahlung dieses Stoikers wirkte nicht nur auf die Patienten beruhigend, sondern auch auf das andere Pflegepersonal. Und sogar auf manche Ärzte.
Jürgen ließ die Visite ziehen und kontrollierte noch einmal die Vitalzeichen der Patientin: Blutdruck, Puls, Temperatur und Venendruck. Damit man um die Mittagszeit, wenn die Entscheidung endgültig getroffen werden sollte, verlässliche Vergleichswerte hatte. Auch die Einstellung des rhythmisch schnaufenden Beatmungsgerätes dokumentierte er: Atemdruck, Sauerstoffkonzentration und Atemfrequenz.
Danach verließ er das Zimmer und ging zwei Türen weiter, in die Zentrale der internistischen Einheit. Er nahm den Telefonhörer ab und bestellte das Labor. Hinter ihm, am Medischrank, war Ute beschäftigt. Sie löste gerade eine Brausetablette in einem Glas auf.
Jürgen sah sie fragend an. „Aspirin“, sagte sie. Und warf ihm einen dieser rätselhaften Blicke zu, mit denen sie nur ihn manchmal anschaute – Jürgen hatte das genau beobachtet. So wie jemand schaut, der sich ertappt fühlte. Er hatte keinen Schimmer, bei was sie sich von ihm ertappt fühlen könnte.
„Du solltest zu Hause bleiben und dich ordentlich auskurieren.“ Sie zuckte nur mit den Schultern.
„Was ist mit unserer Beatmungspatientin?“, wollte sie wissen.
„Wenn sich bis zum Mittag nichts tut, soll sie abgehängt werden. Und keine Reanimation mehr“, antwortete er.
„Das wäre ja auch eine Quälerei für die alte Dame.“ Ute verschwand mit ihrem Glas aus der Zentrale und ging hinüber in die Teeküche. Später sah Jürgen sie mit dem blonden Assistenzarzt Eisenbrand bei einer Tasse Kaffee stehen. Eisenbrand, wenn er nicht in den Patientenzimmern zugange war, schien es sich zum Grundsatz gemacht zu haben, die Chefin mit seiner Gegenwart zu beglücken. Und Jürgen gab es jedes Mal einen Stich, wenn er die beiden zusammen sah. Er vermied es aber, eingehender darüber nachzudenken.
Wie immer flogen die Vormittagsstunden vorüber. Kurz nach elf waren die Laborergebnisse da. Der Zustand der alten Beatmungspatientin hatte sich eher noch verschlechtert. Die Kontrolle der Vitalzeichen bestätigte dieses Bild. Die EKG-Kurve auf dem kleinen Monitor schlug wild aus, und jedes Mal nach den Rhythmusstörungen verlief die Linie beängstigend lange Sekunden auf Nullniveau. Nach Rücksprache mit dem internistischen Chefarzt schaltete Jürgen das Beatmungsgerät ab.
Richard Kallweit schaute noch einmal ins Zimmer, während Jürgen den Apparat hinaus auf den Gang schob. Schweigend nickte der Arzt ihm zu und verließ den Raum. Jürgen wusch die Frau, machte das Bett frisch und befeuchtete ihren Mund. Ihre Atemzüge wurden flacher und flacher, die Aussetzer auf dem Monitor häuften sich.
Jürgen ging so oft ins Zimmer, wie es ihm seine Zeit erlaubte. Als die Frau nur noch hechelte und dabei angestrengt mit den Schultern zuckte, setzte er sich neben sie ans Bett. Er nahm ihre Hand und strich ihr zärtlich über das weiße Haar. Beruhigend sprach er auf sie ein. Er gehörte zu der seltenen Sorte Krankenpfleger, die davon überzeugt waren, dass das Gehör eines Menschen bis zum letzten Moment funktionierte. Selbst wenn er im Koma zu liegen schien.
„Sie sind nicht allein, keine Angst“, murmelte er, „bald ist es vorbei, bald sind Sie erlöst …“
Zwanzig Minuten später – die Mittagsschicht hatte sich schon zur Übergabe in der Zentrale eingefunden – verwandelte sich das regellose Zickzack auf dem Monitor in eine gerade Linie. Still und friedlich strömte der grüne Strich über das Display und verschwand in der Unendlichkeit. Jürgen hatte die Akustik ausgestellt, um der Frau während ihres letzten Atemzuges das nervtötende Piepsen zu ersparen.
Er wartete, bis sich ihre Schultern und ihr Brustkorb entspannten. Dann drückte er ihr die Augen zu.
6
„Er atmet!“, rief Ewald Zühlke aus der Baugrube herauf.
„Und der Puls?“ Alexandra reichte einem der Arbeiter den schweren Notfallkoffer hinunter.
„Schwach, aber tastbar!“
Alexandra stieg auf die Leiter, die man ihr an den Rand der Grube gelegt hatte. Sie kletterte in das Chaos hinab, das sich unten in der Grube bot: Die mächtigen Zwillingsreifen eines auf der Ladefläche liegenden Kipplasters links von ihr, und rechts hing ein schmutzig-roter Bagger – ein Hinterrad in den niedergebrochenen Grubenrand gebohrt, den eisernen Arm seltsam verkeilt mit dem Laster, und mit seiner linken Seite halb über einem Erdhaufen. Unter dem stählernen Ungetüm sollte der Baggerführer liegen und angeblich noch leben.
Alexandra bückte sich unter den Arm des Baggers hinweg und lief zu Zühlke. Ihre weißen Schuhe versanken im Schlamm. Der Bauarbeiter hatte den Notfallkoffer schon abgestellt. Alexandra hockte sich neben Zühlke in den Dreck. Der Oberkörper des bewusstlosen Mannes war glücklicherweise zugänglich. Von den Hüften abwärts bedeckt ihn das Führerhaus seines Baggers. Die obere Kante presste seinen linken Oberschenkel tief in den aufgeweichten Lehm.
In Windeseile überprüfte Alexandra Puls und Atmung – und stutzte erschrocken: Beim Einatmen senkte sich der mächtige Brustkorb des Mannes, statt sich zu heben.
„Paradoxe Atmung!“ Zühlke fasste das schlimme Zeichen in dem trockenen Fachbegriff zusammen.
„Rippenserienfraktur“, rief Alexandra hastig, „Tubus, schnell!“
Zühlke riss die Verpackung des Tubus auf, und Alexandra, die die Zunge des Mannes schon mit dem Laryngoskop nach unten weggedrückt hatte, schob das etwa zwanzig Zentimeter lange Gummirohr zwischen die Stimmbänder in die Luftröhre. Zühlke fixierte den überlebenswichtigen Schlauch – ohne ihn würde der Mann mit einer Rippenserienfraktur über kurz oder lang an Sauerstoffmangel sterben – und schloss den Ambubeutel an.
Friederichs war inzwischen ebenfalls in die Grube hinabgestiegen. „Hubschrauber im Anflug, Feuerwehr verständigt.“ Er übernahm den schwarzen, baseballförmigen Blasebalg von seinem Kollegen und begann, ihn rhythmisch zusammenzupressen. Die Sauerstoffversorgung des Schwerverletzten war vorerst gesichert.
Von fern näherte sich das Martinshorn der Städtischen Feuerwehr. Alexandra und Zühlke legten einen venösen Zugang und schlossen kreislaufstabilisierende Infusionen an. Fünf Minuten später erschienen die ersten Feuerwehrleute oben am Grubenrand und brachten ihren Kranwagen in Position.
Alexandra hatte die Grundversorgung des armen Kerls soweit abgeschlossen. Während Zühlke ihm Elektroden auf die Brust klebte und den Monitor einschaltete, sah sie mitleidig auf ihn herab. Wie schon an hunderten von Tagen zuvor war er heute morgen zur Arbeit aufgebrochen, und schwebte jetzt plötzlich zwischen Leben und Tod.
Aus den Augenwinkeln beobachtete sie, wie die Bauarbeiter hektisch durch die Baugrube rannten und den noch unbebauten Teil von Gerätschaften, Werkzeugen und Maschinen freiräumten. Hier musste der Hubschrauber landen. Das schlagende Geräusch der Rotoren erschien so plötzlich über den Dächern der umliegenden Gebäude, dass alle erschrocken nach oben blickten.
Ächzend und quietschend straffte sich die Kette des Kranwagens. An mehreren Haken hatten die Feuerwehrleute den Bagger daran befestigt. Zentimeter um Zentimeter hob sich das umgestürzte Gefährt vom Körper des Bewusstlosen.
Der Hubschrauber landete. Die Sanitäter zogen den Verletzten behutsam unter dem Bagger hervor. Die anderen Bauarbeiter wandten sich entsetzt ab, als sie sahen, dass sein linkes Bein wie ein lebloses Anhängsel im blutigen Hosenbein hin und herpendelte.
Alexandra erstattete dem Kollegen aus dem Hubschrauber Bericht, einem Stabsarzt aus dem nahegelegenen Bundeswehrkrankenhaus. Kurz darauf hob der Helikopter mit dem Verletzten ab.
„Wohin bringen sie ihn?“, fragte einer der Bauarbeiter, offenbar ein Vorgesetzter des Baggerfahrers. Der Mann war leichenblass. Der Schweiß stand in kleinen Perlen auf seiner Stirn.
„Ins Marien-Krankenhaus“, antwortete Alexandra.
„Ich pack es nicht! Ich pack es nicht!“, rief der Bauarbeiter beschwörend. Er drehte sich einmal um seine eigene Achse, als wollte er die schrecklichen Bilder der vergangenen halben Stunde verscheuchen. „Heute morgen sag ich noch: Herbert, sag ich, sei froh, dasste Arbeit hast …“ Er verstummte. Seine Augen füllten sich mit Tränen, und er wandte sich ab. Die anderen Arbeiter senkten betreten die Köpfe.
„Ja“, Alexandra musste tief durchatmen, „manchmal dauert’s nur Sekunden, und dann ist nichts mehr, wie es mal war.“
7
Harald Maresch ordnete die Folien für den Overheadprojektor, die seine Praktikantin ihm auf den Schreibtisch gelegt hatte. Befriedigt sichtete er die Tabellen, Graphiken und Zahlenkolonnen.
„Ich bin zu Tisch!“ Die Stimme seiner Sekretärin quäkte aus der Sprechanlage. Er schenkte sich die Antwort. Ulla Meißner pflegte nicht zu fragen, ob sie zum Essen oder nach Hause gehen dürfte. Sie sagte nur Bescheid und ging dann. Sobald er Geschäftsführer war, würde eine seiner ersten Amtshandlungen darin bestehen, dieser viel zu selbstbewussten, jungen Frau die Kündigung zu servieren.
Maresch sah auf die Uhr: Viertel nach Zwölf. Die Konferenz war für halb drei angesetzt. Maresch wollte das Essen heute ausfallen lassen. Er brauchte die Zeit bis um halb drei, um sich ganz auf seinen entscheidenden Auftritt zu konzentrieren.
Er trat ans Fenster und zündete sich eine Marlboro an. „Es darf nichts schiefgehen heute, absolut nichts“, murmelte er.
Und was sollte schon schief gehen? Er nahm noch einmal seine Unterlagen zur Hand. Sein Konzept war todsicher. Der amerikanische Markt würde sich als Goldgrube für den Bellhaus-Verlag erweisen. Da hatte Maresch nicht die geringsten Zweifel. Und er würde seinen Vortrag so aufbauen, dass die Geschäftsleitung – auch Vertreter der Konzernspitze waren aus Hamburg angereist – sich seiner Argumentation anschließen musste.
Und Bader, dieser Schnösel, würde dastehen wie ein Schuljunge. Maresch grinste in sich hinein. Er hatte seine Kontakte in die Staaten vor dem Konkurrenten geheimgehalten. Er selbst allerdings wusste, dass Lars Bader den US-Markt skeptisch beurteilte. Er liebäugelte mit den Asiaten.
„Quatsch“, stieß Maresch zwischen zusammengebissenen Zähnen aus. „Fernost! Jeder Idiot weiß, dass die Wirtschaft dort den Bach runtergeht!“
Und was wollte dieser Bursche überhaupt? Sechs Jahre jünger als Maresch und seit dem Studium in ein und derselben Firma – der sollte doch erst Mal ein paar andere Firmen kennenlernen, oder wenigstens ein paar andere Filialen. Möglichst weit weg, in Norddeutschland oder Bayern. „Dass der sich mit seiner Qualifikation überhaupt eine Chance gegen mich ausrechnet!“
Maresch drückte die Zigarette aus und setzte sich an seinen Schreibtisch. „Noch höchstens eine Woche“, er schlug auf die Schreibtischplatte, „dann wird Harald Maresch an einem anderen Schreibtisch sitzen!“ Das Ziel war zum Greifen nahe. Das Ziel, auf das er jahrelang hingearbeitet hatte, das Ziel, für das er seine Zeit, seine Gesundheit und seine Ehe geopfert hatte – bald war es erreicht.
Es klopfte an der Vorzimmertür. Maresch ging durch das Reich seiner Sekretärin und öffnete die Tür. Eine der Putzfrauen stand davor. Maresch ließ sie hinein. „Und?“ Die südländisch aussehende Frau deutete mit dem Kopf zu dem Eimer herunter, den sie in der Hand hielt: Vier Rollen Toilettenpapier lagen darin. Eine angebrochene. „Sehr gut“, sagte er und zückte seine Brieftasche. Sie ließ den Hunderter in ihrer Schürzentasche verschwinden und ging.
Alles, was man in Mitarbeiter investiert, zahlte sich irgendwann aus. Maresch hatte die Türkin die letzten beiden Jahre immer wieder vor dem unzufriedenen Bader in Schutz genommen. Sie gehörte gewissermaßen zu seiner vielköpfigen Seilschaft. Leute auf allen Ebenen des Verlages, die sich Vorteile von einem Geschäftsführer namens Harald Maresch erhofften.
Es wurde natürlich nur hinter vorgehaltener Hand erzählt, aber die Leute, die schon länger mit Bader zusammenarbeiteten, wussten, dass er einen nervösen Darm hatte. Und vor der Sitzung heute würde er ganz besonders aufgeregt sein. Hämisch grinsend griff Maresch nach einer Zigarette.
8
Der Kollege Conradi kam gut gelaunt in das Notarztzimmer. Alexandra berichtete ihm stichwortartig über die Einsätze des Vormittags. Statt anschließend nach Hause zu gehen, stieg sie in den Aufzug und fuhr in den zweiten Stock hinauf. Sie öffnete eine der beiden großen Flügeltüren zum OP-Trakt und verschwand dahinter.
Im Waschraum desinfizierte sie sich die Hände und legte Mundschutz, Kopfhaube und einen grünen OP-Mantel an. In Saal 2 standen ein halbes Dutzend genauso gekleideter Gestalten um den OP-Tisch.
Alexandra trat hinter Schwester Betty, die einen Bauchhaken hielt. „Innere Verletzungen?“, erkundigte sich Alexandra.
Der Oberarzt, der die Operation leitete, brummte zustimmend. „Der linke untere Leberlappen ist Mus. Blutet wie ein Schwein.“ Er beugte sich wieder über die offene Bauchhöhle. „Ein Teil des Baggers muss ihn am Oberbauch erwischt haben. Deswegen sind rechts auch fast alle Rippen ab.“
Alexandra warf einen Blick auf den Monitor. Die EKG-Kurve zuckte gleichmäßig über das Display.
„Muss ein Herz haben wie Carl Lewis“, grinste Dr. Böhm, der Anästhesist. Am Infusionsständer über dem Kopf des Baggerfahrers hing neben zwei Infusionsflaschen auch ein Beutel mit Frischblut. Alexandra hatte damit gerechnet, dass der Verunglückte eine Menge Blut verlieren würde.
Sie ging um den Tisch herum, um sich neben Höper zu stellen und einen Blick in die Bauchhöhle zu werfen. „Nehmen Sie mir mal die Gallenblase ab, Herr Kollmann.“ Der Oberarzt hob das zerstörte Organ mit einer Pinzette hoch. Der OP-Pfleger hielt eine Nierenschale darunter, und der Chirurg ließ das blutige Konglomerat hineinfallen. „War nicht mehr zu retten“, kommentierte er Alexandras fragenden Blick.
„So, jetzt nähen wir die Leberkapsel zu und hoffen, dass wir dann alle Löcher gestopft haben hier drin.“ Er ließ sich von einer Schwester den Schweiß tupfen. „Richten Sie mal den Lichtkegel auf die Nahtstelle, Kollmann.“
„Herr Kollmann“, sagte der Pfleger in seiner trockenen Art und griff nach dem Bügel der OP-Lampe. Er zog sie ein wenig tiefer und schwenkte den Kegel leicht nach unten. „So?“
„Jawohl, Herr Kollmann.“ Der Oberarzt schien heute nicht die allerschlechteste Laune zu haben. Alexandra konnte sich an Tage erinnern, in denen er Heinrich Kollmann bei solchen Gelegenheiten schikaniert hatte, wo er nur konnte.
Als die Notärztin neben dem Operateur stand, fiel ihr Blick auf das Fußende des OP-Tisches. Sie hielt den Atem an. Da, wo sich die Umrisse des linken Beines unter den grünen Tüchern wölben müssten, lagen sie flach und glatt auf der Oberfläche des Tisches. „Um Gottes Willen!“, entfuhr es Alexandra. „Mussten Sie amputieren?“
Ingeborg Mahler, die Assistenzärztin, zog ernst die Augenbrauen an den Rand ihrer OP-Mütze. „Ließ sich leider nicht umgehen.“ Sie zuckte mit den Schultern. „Der Femur war regelrecht zermahlen, und das Gewebe total zerstört.“
„Eine halbe Schale Dreck haben wir rausgeholt“, sagte Kollmann.
„Wir hätten eine Sepsis riskiert, wenn wir versucht hätten, das Bein zu erhalten“, murmelte Höper, ohne aufzusehen.
Alexandra seufzte. Der Mann tat ihr leid. Aber wenn er dadurch mit dem Leben davonkommen sollte, würde er den Verlust seines Beines irgendwann verschmerzen. „Wie schätzen Sie seine Chancen ein?“ Ihre Frage galt dem Oberarzt.
Er verdrehte die Augen. „Müssen Sie mich während der Arbeit an die Vergeblichkeit meiner Mühe erinnern?“ In einer theatralischen Geste hob er beide Hände mitsamt des Nahtmaterials und der Pinzette zur OP-Decke. Dann beugte er sich wieder über seine Kapselnaht. „Wenn Sie mich fragen – null Chance.“
Erschrocken sah Alexandra die anderen Kollegen an. Die Mahler zuckte wieder nur mit den Schultern. Böhm wiegte den Kopf hin und her. „Würd’ ich nicht so schwarz sehen. Ohne Infektion, und wenn wir den Kreislauf im Griff behalten – Fifty-fifty.“
Müde verließ Alexandra den OP. Im Treppenhaus begegnete ihr Ute Reinhard. „Endlich Feierabend?“ Die Frau nickte. Auch sie machte alles andere als einen ausgeruhten Eindruck. Ihr Gesicht war blass, und dunkle Ringe lagen unter ihren Augen. Alexandra begleitete sie hinunter bis in die Eingangshalle.
„Irgendetwas stimmt mit mir nicht“, sagte Ute und fasste sich mit der flachen Hand auf den Oberbauch.
„Schmerzen?“, fragte Alexandra besorgt. Die andere nickte nur. „Ute, bitte legen Sie sich hin, ja? Und morgen gehen Sie zu einem Arzt und lassen sich krankschreiben, versprochen?“
„Mal sehen.“ Ute bog in den Gang ein, der zum Gartenausgang führte. „Wird schon wieder.“ Sie winkte. „Einen schönen Nachmittag, Alexandra.“
Alexandra wusste, dass ein Arzt Ute erst dann zu Gesicht kriegen würde, wenn man sie in dessen Praxis trug. Ein unbestimmtes Gefühl sagte ihr, dass die Schwester nicht mehr allzu weit entfernt war von dieser Erfahrung.
9
Zehn nach zwei. Sein Atem ging schneller. Lars legte die Papiere zusammen, auf denen er seinen Vortrag skizziert hatte. Nach dem Mittagessen – die Gelegenheit, bestimmte Herren aus der Hamburger Konzernleitung zu begrüßen, hatte er sich nicht entgehen lassen – war er im Konferenzraum gewesen und hatte sich von der Funktionstüchtigkeit der technischen Hilfsmittel überzeugt, die er für seinen Vortrag brauchen würde.
Den jungen Becker hatte er wie einen Wachhund neben Computer, Beamer und Leinwand postiert. „Sie bleiben hier sitzen, bis ich im Konferenzsaal erscheine!“, hatte er dem ehrgeizigen Mitarbeiter eingeschärft. „Und wenn Sie sich in die Hose pinkeln!“
In den Kreisen, in denen Lars sich beruflich bewegte, musste man mit allem rechnen. Auch mit Sabotageakten.
Er war die ganze Nacht nicht ins Bett gekommen. In der ersten Nachthälfte hatte er zahllose Telefonate mit Fernost geführt, vor allem mit Japan. Und dadurch einen Trumpf in die Hand bekommen, mit dem er Maresch heute ausstechen würde. Durch die Schnüffelei in seinen Datenbänken wusste Lars ja, dass der Konkurrent einen Teil seines neuen Marketing-Konzeptes auf den amerikanischen Mark zugeschnitten hatte.
Deswegen hatte Lars auch in der zweiten Nachthälfte mit einigen Wirtschaftsinstituten und Unternehmensberatungen in den Staaten gesprochen. Und anschließend hatte er sich noch durch das Dickicht des Internets gearbeitet. Er wollte die allerneusten Zahlen, und die brandaktuellen Trends vom amerikanischen Buchmarkt vorlegen, um seinem Konkurrenten den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Am frühen Morgen dann war er nach Hause gefahren, um wenigstens mit seiner Familie zu frühstücken. Carola hatte kaum ein Wort mit ihm gesprochen. Die dicke Wand, die er in den letzten Monaten immer häufiger zwischen ihr und sich spürte, war mit Händen zu greifen gewesen. Wenigstens hatte sie keinen Streit vom Zaun gebrochen. Das hätte er heute am allerwenigsten gebrauchen können.
Die beiden Mädchen, Meike und Marita, hatten dann dafür gesorgt, dass die üble Stimmung sich nicht behaupten konnte. Wie jeden Morgen plapperten sie um die Wette und hatten in ihrem Vater mal wieder den besten Zuhörer gefunden. Später, auf dem Weg zurück in den Verlag, hatte er Meike, die ältere, in der Grundschule vorbeigebracht.
„Mama hat geweint gestern Abend“, hatte sie unterwegs erzählt. Krampfhaft hatte Lars nach einem einigermaßen angemessenen Kommentar gesucht. Es war ihm keiner eingefallen. „Warum musst du eigentlich soviel arbeiten, Papa?“
„Ich muss doch Geld verdienen, mein Schatz.“
„Aber Rikes Vater ist viel öfter zu Hause als du, und verdient trotzdem Geld.“ Im Rückspiegel hatte er ihr fragendes Gesicht gesehen.
Rike war Meikes beste Freundin, ihr Vater arbeitete als Beamter bei der Bundesbahn. „Aber sicher nicht so viel wie ich“, sagte er und hatte im selben Moment gespürt, dass es keine besonders kluge Antwort war.
„Muss man unbedingt viel Geld verdienen?“ Glücklicherweise war diese Frage seiner Tochter mit der Ankunft auf dem Schulhof zusammengefallen. Die Klassenkameraden Meikes, die vor dem Schulhaus gewartet hatten, waren auf seinen BMW zugestürmt und hatten ihm so die Antwort erspart.
Lars schob die Gedanken an seine Tochter und an Carola beiseite und konzentrierte sich wieder auf die bevorstehende Sitzung.
„Wichtig ist, dass du als erster dran kommst“, sagte er sich. In diesem Fall schien es ihm günstiger, die Vorgaben zu machen, gegen die sein Gegner dann brillieren musste. „Und das dürfte dir schwer fallen, Maresch, verdammt schwer.“
Lars zog sein Jackett aus, hängte es über die Lehne und kniete vor der freien Wand neben der Sitzecke nieder. Er stemmte den Kopf auf den Boden, legte die Hände daneben und stieß sich dann ab. Kerzengerade reckten seine Beine sich zur Decke. Mit den Fersen lehnte er sie an den Schrank. So verharrte er einige Minuten.
Er spürte, wie ihm das Blut warm in den Kopf schoss. Er atmete ruhig und gleichmäßig. Er hatte diese Kopfstandhaltung von einem Yoga-Lehrer gelernt. Seit einigen Jahren bereitete er sich – und vor allem sein Gehirn – so auf schwierige Situationen vor, in denen er hundertprozentig präsent sein musste.
Nachdem er seine Beine heruntergelassen hatte und wieder auf seinen Füßen stand, meldete sich das vertraute Organ drei Stockwerke unter dem Gehirn: Sein Darm rumorte. Lars verdrehte die Augen. „Schande! Dieses leidige Übel!“
Er kannte sich gar nicht anders als mit nervösem Darm. An keine Prüfung in seinem Leben konnte er sich erinnern, vor der er nicht Durchfall bekommen hatte. Und gegen das, was ihm heute bevorstand, war die Examensprüfung ein Spaziergang gewesen. Lars sah auf die Uhr: 14.18 Uhr. Also los. Er zog sein Handy aus dem Jackett, stürmte in die ins Büro integrierte Toilette und schloss ab.
Glücklicherweise hatte er sich angewöhnt, Erleichterungen dieser Art innerhalb von wenigen Minuten zu erledigen. Seine Uhr zeigte 14.20 Uhr, als seine Hand nach dem Toilettenpapierhalter tastete, und weiter nichts als Holz fühlte. Holz? Er fuhr herum, sein Atem stockte: Nicht mal die graue Papprolle steckte noch auf dem dunkelroten Holzstab. Nackt hing er an seinem Messingträger – nackt und erbarmungslos leer.
10
Ute drückte eine Tablette aus dem Film, steckte sie in den Mund und zerkaute sie. Sie führte ihre Bauchschmerzen auf eine Magenschleimhautentzündung zurück, mit der sie seit Jahresbeginn herumlavierte. Die Grippe und die Magenbeschwerden gaben sich seitdem in verlässlicher Regelmäßigkeit die Klinke in die Hand.
Sie machte sich einen Kamillentee und wollte sich gerade auf ihr Bett legen, als es an ihrer Tür klopfte. „Herein?“
Einen Augenblick später stand Felix Eisenbrand im Türrahmen. „Darf ich hereinkommen?“
Für einen Moment brachte Ute vor Überraschung kein Wort heraus. Und als sie sich gefangen hatte, war es zu spät: Der junge Arzt – er trug den weißen Arztmantel über der blauen Schutzkleidung – hatte die Tür schon geschlossen und setzte sich einfach auf einen der schwarzen Lederstühle vor dem Glastisch. „Ich hab mir Sorgen gemacht, Sie sahen gar nicht gut aus heute.“
Ute erschrak, sah man ihr ihren Zustand an? „Ein wenig übermüdet, weiter nichts“, winkte sie ab, „und eine leichte Grippe. Tee?“ Er lehnte ab, ließ sich aber mit Vergnügen einen Kaffee anbieten.
„Darf man rauchen bei Ihnen?“, fragte er laut, während Ute die Kaffeemaschine anwarf.
„Von mir aus.“ Natürlich schossen ihr ein paar Fragen durch den Kopf. Schließlich besuchte nicht jeder Arzt einfach die Stationsschwester, mit der er zusammenarbeitet. Auch nicht, wenn ihm ihr blasses Gesicht aufgefallen war. Andererseits verstanden sie sich gut – immer besser sogar – und er war nicht der einzige Kollege, der spontan bei der kontaktfreudigen Schwester vorbeischaute.
Sie stellte Kaffee und Thermoskanne vor ihn hin. Er bediente sich selbst. Seine strohblonden Haare standen so wirr nach allen Seiten ab, als wäre er erst vor Kurzem aus den Federn gekrochen. Sein Gesicht hatte etwas Lausbubenhaftes und Verschmitztes, wozu seine geringe Körpergröße passte: Felix Eisenbrand war ein, zwei Zentimeter kleiner als Ute. Kaum jemand schätzte ihn älter als Mitte zwanzig, dabei war er drei- oder vierunddreißig.
Das jungenhafte, ziemlich unkonventionelle Auftreten des Assistenzarztes hatte ihr von Anfang an gefallen. Er schien vor niemandem Respekt zu haben. Den chirurgischen Oberarzt hatte er am Anfang sogar einmal während einer Visite geduzt. Das war ihm nach der eisigen Abfuhr, die Dr. Höper ihm anschließend verpasst hatte, zwar kein zweites Mal passiert. Dennoch gehörte er zu den wenigen, die es wagten, dem Unsympath Paroli zu bieten. Neben Alexandra natürlich. Aber die hielt Ute sowieso für eine Ausnahmeerscheinung.
„Auch eine?“ Eisenbrand hielt ihr eine halbleere, zerknitterte Schachtel hin.
„Nein, danke“, wehrte Ute ab. Die filterlosen Zigaretten in dieser dunkelroten Verpackung mit der schwarzen Hand darauf ließen sie immer sofort an Lungenkrebs denken. Ihr Onkel war daran gestorben. Nachdem er das stinkende Kraut mehr als vierzig Jahre lang geraucht hatte.
„Und es geht Ihnen wirklich gut, Ute?“ Wenn er sie so anschaute, erwartungsvoll und etwas hilflos, erinnerte er sie immer an ihren jüngeren Bruder. Das war auch so ein sonniges Unikum.
„Ehrlich“, log sie. Und dachte: Bist du eigentlich immer so eine gute Schauspielerin?
Seine besorgte Miene hellte sich auf. „Wissen Sie was, Ute? Heute Abend spielt eine geile Band im Jazzkeller – Charlies Tune Jam. Ich kenn’ den Schlagzeuger aus Studizeiten. Was ist, gehen Sie mit?“
Sie konnte nicht anders, als mit einem Grinsen auf sein erwartungsvolles Strahlen zu reagieren. Warum eigentlich nicht?, dachte sie. Wenn du unter Leute kommst und was Lustiges erlebst, geht’s dir sicher besser, als in der Bude hier. Sie wusste, dass Eisenbrand selbst als Schlagzeuger in einer Berliner Band gespielt hatte, bevor er ins Marien-Krankenhaus gekommen war.
„Okay“, sagte sie, „wann holen Sie mich ab?“
11
Er zuckte zusammen und wandte seinen Blick von den Unterlagen vor sich auf dem Schreibtisch an die Decke. Seine Hand schob sich unter das Jackett auf die Stelle neben links neben dem Brustbein. Das stechende Brennen ließ diesmal viel langsamer nach als vorgestern, wo er es zum letzten Mal empfunden hatte.
Vorsichtig atmete er durch. Jetzt wurde es besser. Schon seit einigen Wochen verspürte Harald Maresch diesen seltsamen Schmerz. Als würde ihm ein übermütiges Kind in der Brust sitzen, das versucht, ein Streichholz anzuzünden. Er schüttelte die Beklommenheit ab, die sich zusammen mit dem Schmerz gemeldet hatte, und beugte sich wieder über sein Konzept.
Ein paar Minuten später warf Maresch einen Blick auf seine Rolex: Zehn vor halb drei. Er erhob sich von seinem Schreibtischsessel und holte ein Glas aus dem Schrank. In einer der Schreibtischschubladen fand er noch ein paar Aspirin-Brausetabletten. Er hatte unruhig geschlafen in der vergangen Nacht. Und geträumt wie ein Fieberkranker. Lauter unsinniges Zeug. Wie schon so oft in den letzten Wochen war er mit einem dumpfen Kopfschmerz aufgewacht. Aus dem Wasserhahn im WC füllte er das Glas mit Wasser.
Er betrachtete sein Gesicht im Spiegel – glatt rasiert, die hohe Stirn weit in den Haaransatz hinein ausgedehnt, die dünnen, braunen Haare akkurat geschnitten, an den Schläfen der silberne Schimmer der reiferen Mannesjahre. Er rückte seinen Schlips zurecht und nahm einen Schluck aus dem Glas.
Er fixierte sein Spiegelbild, und seine Gestalt straffte sich. „Alles klar, Maresch, oder?“, sagte er laut. Seine Stimme klang hohl in dem kleinen Raum. „Du gehst jetzt nach oben, stellst dein Konzept vor und wirst Geschäftsführer. Kapiert?“
Er probte ein souveränes Lächeln. Es befriedigte ihn, und er nickte seinem Spiegelbild anerkennend zu. „Also los.“
Um 14.25 Uhr stieg er aus dem Aufzug und betrat den Konferenzsaal. Schon mehr als ein Dutzend Männer befanden sich im Saal. Auch hier und da eine Frau. Die meisten standen noch in kleinen Gruppen zusammen und sprachen leise und raunend miteinander. Mitten im Saal entdeckte er Barth, den Geschäftsführer – den scheidenden Geschäftsführer –, korrigierte er sich. Er und seine Gesprächspartner unterhielten sich deutlich lauter als die anderen. Einer von ihnen lachte plötzlich laut und schallend – Altmann, der Vorstandsvorsitzende. Maresch hatte ihn bei seiner Bewerbung kennengelernt und ihn danach öfter bei entscheidenden Sitzungen erlebt.
Altmann, das war der Mann, den er heute vor allem überzeugen musste. Und natürlich die anderen Bosse aus Hamburg. Drei außer Altmann, zählte Maresch.
Er grinste in sich hinein, als er feststellte, dass Bader noch nicht anwesend war. Bader, der als Pünktlichkeitsfanatiker verschrien war. Maresch räusperte sich und rückte seinen Schlips zurecht. Aus den Augenwinkeln nahm er die verstohlenen Blick wahr, die der Leitungscrew aus allen Ecken des Konferenzsaales zugeworfen wurden. Klar, jeder, der heute an der Konferenz teilnahm, wollte eine gute Figur vor den Bossen machen.
Gemessenen Schrittes ging Maresch auf die Gruppe um Dr. Barth und Altmann zu. An der Frontseite des Konferenzsaales entdeckte er den jungen Becker, ein Gefolgsmann seines Konkurrenten. Er saß neben dem PC. Nanu, will Bader seinen Sache etwa mit dem PC präsentieren?, schoss es ihm durch sein misstrauisches Hirn. Er rutschte unruhig hin und her, und sah abwechselnd auf seine Armbanduhr und die Eingangstür des Saales.
Du wirst wohl noch ein Weilchen warten müssen auf deinen Chef, dachte Maresch gehässig, ein ach so wichtiges Kundentelefonat kann er ja diesmal kaum vorschützen. Wozu hatte er denn eine Frau in seinem Vorzimmer sitzen, zu deren Aufgabe es gehörte, lästigen Anrufern Märchen zu erzählen?
Dann war er bei der Gruppe der Häuptlinge. Befriedigt stellte er fest, dass auch Dr. Barth auf die Uhr schaute und sich suchend im Saal umsah. Maresch streckte seine Rechte aus und bleckte die Zähne, so dass der Ausdruck seiner unteren Gesichtshälfte von fern an ein Lächeln erinnerte. „Darf ich Sie begrüßen, meine Herren?“
12
Für einen Moment schloss Lars die Augen und hielt den Atem an. Dann griff er hinter sich in den Wandschrank über der Spüle – keine einzige Ersatzrolle! Er stieß einen Fluch aus. Die Putzfrau! Er schwor sich, für ihren Rausschmiss zu sorgen.
Er streckte sich nach dem Papierkorb unter dem altrosa Waschbecken aus: frisch geleert! Hektisch wühlte er die Taschen seiner Hose durch, die zwischen seinen Knöcheln hing – nicht ein Fetzen Papier! Nicht mal ein Taschentuch! Das trug er immer in der Außentasche seines Jacketts. Und das hing, draußen im Büro, über der Sessellehne. Auch die Brieftasche mit einem Strafmandat und einigen Rechnungen steckte in dem Jackett.
Lars verbarg das Gesicht in den Händen. Die Wut stieg in ihm hoch. „Scheiße!“, brüllte er. „Verdammte Scheiße!“ Er rieb sich mit angespannten Händen die Augen und stieß zischend die Luft aus den Lungen. „Du musst jetzt ruhig bleiben, Bader“, murmelte er, „ganz ruhig. Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Für jedes, hörst du?“
Ein Blick auf die Uhr: 14.22 Uhr. „Du hast noch fünf bis acht Minuten Zeit, dieses Problem zu lösen – dreihundert bis vierhundertachtzig Sekunden …“ Er atmete einige Male tief durch, und machte dann eine Entspannungsübung, die er vor Jahren auf einem Management-Training gelernt hatte. Langsam wurde er ruhiger.
„So – und jetzt die Möglichkeiten abchecken.“ Hätte er doch bloß heute morgen eine Krawatte angezogen! Damit wäre es gegangen. Und draußen, in seinem Schreibtisch, lagen noch zwei. Aber er trug in letzter Zeit gern eine Fliege. Und die war einfach zu klein.
„Nicht lange jammern“, mahnte er sich, „weiter.“ Das Hemd! Lang genug war es. Wenn er ein Stück abschneiden könnte … Er durchsuchte den Schrank hinter sich nach dem Etui mit der Nagelschere. Verdammt – irgendwann hatte er doch so etwas mal hier gesehen! Doch nichts. Also weiter.
Sein Handy schrillte los. Er erschrak und meldete sich. Eine männliche Stimme rief ihm ein paar englische Sätze ins Ohr. Es war ein Mitarbeiter der Unternehmensberatung aus Chikago, die er in der vergangenen Nacht angerufen hatte. Lars versuchte sich auf die Informationen zu konzentrieren, die sein Gesprächspartner ihm gab. Es ging um das Geschäft mit Hörbüchern. Was der Amerikaner zu sagen hatte, bestätigte im Wesentlichen seine These: Der amerikanische Markt war dicht. Der Mann empfahl ihm, sich nach Fernost zu orientieren. Japan, Korea, und sogar die Philippinen wären vielversprechend.
Lars bedankte sich und schaltete das Handy auf E-Mail um. Seine Armbanduhr behauptete, dass es schon 14.26 Uhr wäre. Noch höchstens vier Minuten Zeit. Er unterdrückte die aufbrandende Panik. Ganz ruhig, Bader, ganz ruhig – du hast schon schwierigere Situationen gemeistert.
Die Philippinen … vielversprechend! Ein Kommilitone aus Manila fiel ihm ein. Die philippinische Regierung hatte ihm damals sein Studium in Deutschland finanziert. Der hatte erzählt, dass sie in den philippinischen Provinzen kein Klopapier benutzten. Dort machten sie es mit den Händen. „O Gott!“ Lars betrachtete seine gepflegten Hände. Mit der Rechten begrüßte man sich und führte die Speisen zum Mund. Und mit der Linken putzte man sich den Hintern ab … In den Philippinischen Provinzen.
„Du bist hier aber nicht auf den Philippinen“, flüsterte er angewidert. „Irgendwo schon“, antwortete er sich selbst, „genau wie dort gibt es in diesem gottverdammten Klo keinen Fetzen Papier.“
14.28 Uhr sagte seine Armbanduhr. Er presste die Lippen zusammen und sog scharf die Luft durch die Nase ein. „Schützt den Regenwald und macht’s mit den Händen.“
Sein Körper spannte sich an. Mit der Linken drückte er die Spüle und mit der Rechten fasste er unter sich ins rauschende Wasser, um sich zu säubern. „Du machst was falsch, Bader“, murmelte er dabei. „Auf den Philippinen machen sie’s mit der Linken.“
Sekunden später stelzte er mit tropfenden Händen zum Waschbecken, um sich zu waschen. Obwohl die Hektik ihm den Schweiß auf die Stirn und unter die Achseln trieb, musste er grinsen – er stellte sich vor, wie er Maresch und den Herren aus Hamburg die rechte Hand zur Begrüßung reichen würde …
Dann stürmte er aus der Toilette in sein Büro. Bevor er in sein Jackett schlüpfte, ein Blick auf die Armbanduhr: 14.32 Uhr.
13
Jürgen Wiesenberg verließ das Zimmer mit dem frisch operierten Beatmungspatienten und ging über den Stationsgang auf die Eingangsschleuse zu. Es hatte geklingelt. Wahrscheinlich Besucher.
Er zog die große Tür mit der Milchglasscheibe auf. Eine hochgewachsene, korpulente Frau mit kurzgeschnittenen dunklen Haaren stand vor dem Eingang. Jürgen fielen sofort ihre blasse Gesichtshaut und die rot verweinten Augen auf. Und er wusste intuitiv, wen er vor sich hatte: Die Frau des frisch operierten Unfallopfers, das er eben an das Beatmungsgerät angeschlossen hatte.