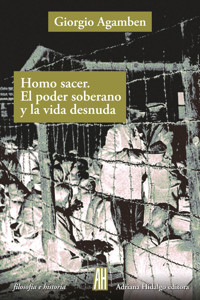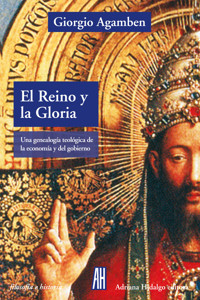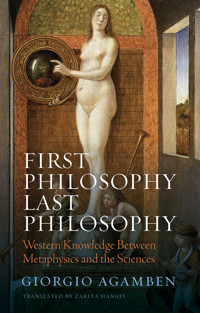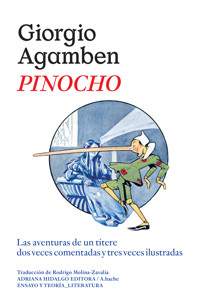13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der homo sacer ist die Verkörperung einer archaischen römischen Rechtsfigur: Zwar durfte er straflos getötet, nicht aber geopfert werden, was auch seine Tötung sinnlos und ihn gleichsam unberührbar machte – woraus sich der Doppelsinn von sacer als ›verflucht‹ und ›geheiligt‹ ableitet. Giorgio Agamben stellt im Anschluß an Foucault und als philosophische Korrektur von dessen Konzept der Biopolitik die These auf, daß Biopolitik, indem sie den Menschen auf einen biologischen Nullwert zurückzuführen versucht, das nackte Leben zum eigentlichen Subjekt der Moderne macht. Ausgehend von Carl Schmitts Souveränitätskonzept, kommt Agamben zu einer Interpretation des Konzentrationslagers als »nomos der Moderne«, wo Recht und Tat, Regel und Ausnahme, Leben und Tod ununterscheidbar werden. In den zwischen Leben und Tod siechenden Häftlingen, aber auch in den Flüchtlingen von heute sieht er massenhaft real gewordene Verkörperungen des homo sacer und des nackten Lebens. Die philosophische Begründung dessen, daß diese Möglichkeit keineswegs nur historisch ist, hat eine Diskussion entfacht, die weit über Italien und Europa hinausreicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Erbschaft unserer Zeit
Vorträge über den Wissensstand der Epoche
Band 16
Im Auftrag des Einstein Forums
herausgegeben von Gary Smith und Rüdiger Zill
In Homo sacer stellt Giorgio Agamben im Anschluß an Foucault und als philosophische Korrektur von dessen Konzept der Biopolitik die These auf, daß diese, indem sie den Menschen auf einen biologischen Nullwert zurückzuführen versucht, das nackte Leben zum eigentlichen Subjekt der Moderne macht. Im archaischen römischen Recht wurde das nackte Leben von der Figur des homo sacer verkörpert: Zwar durfte er straflos getötet, nicht aber geopfert werden, was auch seine Tötung sinnlos und ihn gleichsam unberührbar machte (woraus sich der Doppelsinn von sacer als »verflucht« und »heilig« ableitet). Der homo sacer markiert die Grenze zwischen dem nackten und dem rechtlich eingekleideten Leben. Er steht für das rechtlich ungeschützte, nur dem Souverän verfügbare Leben und charakterisiert so die Souveränität als solche.
Ausgehend von Carl Schmitts Souveränitätskonzept und im Umweg über historische Stationen der politischen Kulturgeschichte kommt Agamben zu einer Analyse des Konzentrationslagers als »nómos der Moderne«, wo Recht und Tat, Regel und Ausnahme, Leben und Tod ununterscheidbar werden. In den zwischen Leben und Tod siechenden Häftlingen, aber auch in den Flüchtlingen von heute sieht er massenhaft realgewordene Verkörperungen des homo sacer und des nackten Lebens. Die philosophische Begründung dessen, daß diese Möglichkeit keineswegs nur historisch ist, hat eine Diskussion entfacht, die weit über Italien und Europa hinausreicht.
Giorgio Agamben
Homo sacer
Die souveräne Machtund das nackte Leben
Aus dem Italienischenvon Hubert Thüring
Suhrkamp
Diese Buchreihe wurde ermöglicht durch die Berliner Festspiele GmbH
Originaltitel: Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita
© 1995 Giulio Einaudi editore s. p. a., Torino
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2012
© der deutschen Ausgabe: Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2002
Deutsche Erstausgabe
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag gestaltet nach einem Konzept von Willy Fleckhaus: Rolf Staudt
eISBN 978-3-518-78420-4
www.suhrkamp.de
Erbschaft unserer Zeit
Das 20. Jahrhundert, dessen geistiges Erbe in dieser Buchreihe geprüft werden soll, hat durch einen unvorstellbaren Verlust an Ethik Geschichte gemacht. Es war uns vorbehalten, die Techniken der Naturbeherrschung so zu entfalten, daß sie auch an der inneren Natur des Menschen keine Grenze mehr fanden und damit das Jahrhundert der Völkermorde ermöglichten. Verdun und Vietnam, Auschwitz und der Archipel Gulag waren die inhumanen Stationen jenes Fortschrittszuges, den wir lieber zu Freud und Benjamin, Picasso und Godard fahren sahen.
Kann man diese Paradoxie in einer Synthese unseres heutigen Wissens aufheben? Die Bände der »Erbschaft unserer Zeit« versuchen es mit einem Zugang, der an die Enzyklopädisten erinnert. Sie gehen auf Vorträge zurück, die bis zur Jahrtausendwende in Berlin gehalten wurden. Führende Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen leisten auf Einladung des Einstein Forums und der Berliner Festspiele GmbH Beiträge zu einer Bilanz der Moderne, die nur einen gemeinsamen Fluchtpunkt kennt: gänzliche Illusionslosigkeit über das Zeitalter – aber dennoch ein rückhaltloses Bekenntnis zu ihm.
Gary Smith
Inhalt
Einleitung
Erster TeilLogik der Souveränität
1. Das Paradox der Souveränität
2. Nomos basileus
3. Potenz und Recht
4. Rechtsform
Schwelle
Zweiter TeilHomo sacer
1. Homo sacer
2. Die Ambivalenz des Heiligen
3. Das heilige Leben
4. Vitae necisque potestas
5. Souveräner Körper und heiliger Körper
6. Der Bann und der Wolf
Schwelle
Dritter TeilDas Lager als biopolitisches Paradigma der Moderne
1. Die Politisierung des Lebens
2. Die Menschenrechte und die Biopolitik
3. Lebensunwertes Leben
4. »Politik, d. h. die Gestaltung des Lebens der Völker«
5. VP
6. Politisierung des Todes
7. Das Lager als nómos der Moderne
Schwelle
Anmerkungen zur Übersetzung und zur Zitierweise
Bibliographie
Personenregister
Homo sacer
Die souveräne Macht und das nackte Leben
I
»Das Recht hat kein Dasein für sich, sein Wesen vielmehr ist das Leben der Menschen selbst, von einer besonderen Seite angesehen.«
Friedrich Carl von Savigny
»Ita in iure civitatis, civiumque officiis investigandis opus est, non quidem ut dissolvatur civitas, sed tamen ut tanquam dissoluta consideretur, id est, ut qualis sit natura humana, quibus rebus ad civitatem compaginandam apta vel inepta sit, et quomodo homines inter se componi debeant, qui coalescere volunt, recte intelligatur.«1
Thomas Hobbes
Einleitung
Die Griechen kannten für das, was wir mit dem Begriff Leben ausdrücken, kein Einzelwort. Sie gebrauchten zwei Begriffe, die morphologisch und semantisch verschieden sind, auch wenn man sie auf eine gemeinsame Wurzel zurückführen kann: zōḗ meinte die einfache Tatsache des Lebens, die allen Lebewesen gemein ist (Tieren, Menschen und Göttern), bíos dagegen bezeichnete die Form oder Art und Weise des Lebens, die einem einzelnen oder einer Gruppe eigen ist. Wenn Platon im Philebos drei Lebensarten anführt und Aristoteles in der Nikomachischen Ethik das kontemplative Leben des Philosophen (bíos theōrētikós) vom Leben der Lust und des Vergnügens (bíos apolaustikós) und vom politischen Leben (bíos politikós) unterscheidet, hätten sie niemals den Begriff zōḗ gebrauchen können (dem bezeichnenderweise im Griechischen die Pluralform fehlt); und zwar aus dem einfachen Grund, weil es beiden in keiner Weise um das natürliche Leben, sondern um ein qualifiziertes Leben, um eine besondere Lebensweise zu tun war. Aristoteles kann sehr wohl von einer zōḗ arístē kaì aídios, einem höheren und ewigen Leben sprechen (Met. 1072 b, 28), aber nur, um die nicht banale Tatsache herauszustreichen, daß auch Gott ein Lebewesen ist (so wie er sich im selben Kontext des Begriffs zōḗ bedient, um in ebensowenig trivialer Weise den Akt des Denkens zu bestimmen); von einer zōḗ politikḗ der Athener Bürger zu sprechen hätte jedoch keinen Sinn ergeben. Nicht daß der Antike die Idee nicht vertraut gewesen wäre, daß das natürliche Leben, die einfache zōḗ als solche, an sich ein Gut sei; Aristoteles drückt dieses Bewußtsein in einem Abschnitt der Politik sogar mit unübertrefflicher Klarheit aus. Nachdem er daran erinnert hat, daß der Zweck des Gemeinwesens sei, dem Guten gemäß zu leben, sagt er:
»Und das [dem Guten gemäß zu leben] ist nun besonders das Ziel, sowohl für alle in Gemeinschaft als auch voneinander getrennt. Sie kommen aber auch bloß um des Lebens willen zusammen, und sie verfügen zusammen über eine politische Gemeinschaft. Vielleicht liegt nämlich schon ein Teil des Guten im Leben allein an sich [katà tò zē̂n autò mónon]. Wenn die Beschwerlichkeiten des Lebens nicht zu sehr überhandnehmen [katà tòn bíon], so ist es klar, daß viele Menschen in ihrem Verlangen nach Leben [zōḗ] reichlich Not ertragen, als gäbe es in diesem ein gewisses Glücksgefühl [euhēmería: schöner Tag] und eine natürliche Annehmlichkeit.« (Pol. 1278 b, 23-30)
In der antiken Welt ist das einfache natürliche Leben jedoch aus der pólis im eigentlichen Sinn ausgeschlossen und als rein reproduktives Leben strikt auf den Bereich des oîkos eingeschränkt (1252 a, 26-32). Am Anfang seiner Politik verwendet Aristoteles alle Sorgfalt darauf, den oikonómos (Kopf eines häuslichen Unternehmens) und den despótes (Familienoberhaupt), die sich um die Fortpflanzung und Erhaltung des Lebens kümmern, vom Politiker zu unterscheiden, und verspottet diejenigen, die glauben, es handle sich um einen quantitativen Unterschied und nicht um einen Unterschied in der Art. Und wo er den Zweck der Gemeinschaft bestimmt – eine Stelle (1252 b, 30), die für die abendländische Tradition kanonisch bleiben sollte –, tut er dies gerade, indem er die einfache Tatsache des Lebens (tò zē̂n) gegen das politisch qualifizierte Leben abgrenzt (tò eû zē̂n): ginoménēmèn oûn toû zē̂n héneken, oûsa dè toû eû zē̂n, »enstanden um des Lebens willen, aber bestehend um des guten Lebens willen« (in der lateinischen Übersetzung des Wilhelm von Moerbeke, die sowohl Thomas von Aquin wie Marsilius von Padua vor sich hatten: facta quidem igitur vivendi gratia, existens autem gratia bene vivendi ).
Es stimmt, daß an einer sehr berühmten Stelle desselben Werkes der Mensch als politikòn zō̂on definiert wird (1253 a, 4); hier aber (abgesehen davon, daß in der attischen Prosa das Verb biō̂nai kaum im Präsens gebraucht wird) ist »politisch« nicht ein Attribut des Lebewesens als solches, sondern eine spezifische Differenz zur Bestimmung der Gattung zō̂on. (Im übrigen wird unmittelbar danach die menschliche Politik von derjenigen der anderen Lebewesen unterschieden, weil sie durch einen sprachgebundenen Zusatz an Politizität auf einer Gemeinschaft von Gutem und Bösem, Gerechtem und Ungerechtem und nicht einfach nur von Lust- und Schmerzvollem gegründet ist).
Auf diese Bestimmung bezieht sich Michel Foucault, wenn er am Schluß von Der Wille zum Wissen den Prozeß zusammenfaßt, aufgrund dessen man auf der Schwelle zur Moderne das natürliche Leben in die Mechanismen und Kalküle der Staatsmacht einzubeziehen beginnt und sich die Politik in Biopolitik verwandelt: »Jahrtausende hindurch ist der Mensch das geblieben, was er für Aristoteles war: ein lebendes Tier, das auch einer politischen Existenz fähig ist. Der moderne Mensch ist ein Tier, in dessen Politik sein Leben als Lebewesen auf dem Spiel steht.« (Foucault 1, S. 171)
Foucault zufolge liegt die »›biologische Modernitätsschwelle‹ einer Gesellschaft« dort, wo die Gattung und das Individuum als einfacher lebender Körper zum Einsatz ihrer politischen Strategie werden. Im Brennpunkt seiner Vorlesungen am Collège de France steh von 1977 an der Übergang vom »Territorialstaat« zum »Bevölkerungsstaat« und damit die schwindelerregend wachsende Bedeutung des biologischen Lebens und der Volksgesundheit für die souveräne Macht, die sich zunehmend in eine »Regierung der Menschen« verwandelt (Foucault 2, S. 719). Daraus ergibt sich eine gewisse Animalisierung des Menschen, die durch die ausgeklügeltsten politischen Techniken ins Werk gesetzt wird. Gleichzeitig mit der Ausbreitung der Möglichkeiten der Human- und Sozialwissenschaften entsteht nun auch die Möglichkeit, das Leben sowohl zu schützen wie auch seinen Holocaust zu autorisieren. Von dieser Seite her betrachtet wären insbesondere die Entwicklung und der Triumph des Kapitalismus ohne die disziplinarische Kontrolle nicht möglich gewesen, welche die neue Biomacht ausgeübt hat; mittels einer Reihe geeigneter Technologien schuf sie gewissermaßen die »gelehrigen Körper«, deren sie bedurfte.
Auf der anderen Seite hat Hannah Arendt in The Human Condition2 bereits Ende der fünfziger Jahre (also fast zwanzig Jahre vor Der Wille zum Wissen) den Prozeß analysiert, der den homo laborans und mit ihm das biologische Leben zunehmend ins Zentrum der politischen Bühne der Moderne rückt. Sogar die Veränderung und den Niedergang des öffentlichen Raumes hat Hannah Arendt auf diesen Vorrang des natürlichen Lebens vor dem politischen Handeln zurückgeführt. Daß ihre Forschungen praktisch ohne Nachfolge geblieben sind und Foucault sein biopolitisches Feld ohne Bezug auf sie hat eröffnen können, zeugt von den Schwierigkeiten und den Widerständen, die das Denken in diesem Bereich zu gewärtigen hatte. Und gerade diesen Schwierigkeiten ist wahrscheinlich sowohl die sonderbare Tatsache geschuldet, daß Hannah Arendt in The Human Condition keinerlei Anschlüsse an die tiefgehenden Analysen herstellt, die sie zuvor der totalitären Macht gewidmet hat (und in denen jegliche biopolitische Perspektive fehlt), als auch der ebenfalls merkwürdige Umstand, daß Foucault seine Untersuchungen nie auf das Feld schlechthin der modernen Biopolitik verlegt hat: das Konzentrationslager und die Struktur der großen totalitären Staaten des 20. Jahrhunderts.
Der Tod hat Foucault daran gehindert, alle Implikationen des Konzepts der Biopolitik zu entfalten und die Richtung anzuzeigen, in der er die Untersuchung vertieft hätte. Doch das Eintreten der zōḗ in die Sphäre der pólis, die Politisierung des nackten Lebens als solches bildet auf jeden Fall das entscheidende Ereignis der Moderne und markiert eine radikale Transformation der klassischen politisch-philosophischen Kategorien. Es ist sogar wahrscheinlich, daß es, wenn die Politik heute eine fortwährende Finsternis zu durchqueren scheint, genau daran liegt, daß sie versäumt hat, es mit diesem Gründungsereignis der Moderne aufzunehmen. Die »Rätsel« (Furet, S. 7), die unser Jahrhundert dem historischen Verstehen aufgegeben hat und die ihre Aktualität behaupten (der Nazismus ist davon bloß das beunruhigendste), wird man nur auf dem Boden – demjenigen der Biopolitik – lösen können, auf dem sie gewachsen sind. Nur in einem biopolitischen Horizont wird man entscheiden können, ob die Kategorien, auf deren Opposition sich die moderne Politik gegründet hat (rechts/links, privat/öffentlich, Absolutismus/Demokratie etc.), die nun aber immer mehr verschwimmen und heute in eine eigentliche Zone der Ununterscheidbarkeit geraten, endgültig aufzugeben sind oder ob sie womöglich die Bedeutung wiedergewinnen können, die sie gerade in jenem Horizont zeitweilig verloren haben. Und nur eine Reflexion, die ausgehend von Foucaults und Walter Benjamins Ansätzen die Beziehung zwischen nacktem Leben und Politik thematisch befragt – eine Beziehung, die im geheimen auch die scheinbar am weitesten entfernten Ideologien regiert –, wird das Politische aus seiner Verborgenheit heraus- und das Denken zu seiner praktischen Aufgabe zurückführen. Eine der konstantesten Ausrichtungen von Foucaults Arbeit ist die entschiedene Abkehr von den traditionellen Zugangsweisen zum Machtproblem, weg von den juridisch-institutionellen Modellen (die Definition der Souveränität, die Theorie des Staates) in Richtung einer vorbehaltlosen Analyse der konkreten Weisen, in denen die Macht selbst den Körper der Subjekte und ihre Lebensformen durchdringt. In den letzten Jahren, wie das etwa ein an der Universität von Vermont gehaltenes Seminar zeigt, scheint diese Analyse zwei gesonderte Forschungsrichtungen einzuschlagen: auf der einen Seite das Studium der politischen Techniken (wie die Polizeiwissenschaft), mit denen der Staat die Sorge um das natürliche Leben der Individuen übernimmt und in sich integriert; auf der anderen Seite das Studium der Technologien des Selbst, mittels deren sich der Subjektivierungsprozeß vollzieht, der die Individuen dazu bringt, sich an die eigene Identität und zugleich an eine äußere Kontrollmacht zu binden. Es ist offensichtlich, daß diese beiden Linien (sie folgen übrigens zwei seit Beginn von Foucaults Arbeit vorhandenen Tendenzen) sich an mehreren Punkten verknoten und auf ein gemeinsames Zentrum verweisen. In einer seiner letzten Schriften stellt Foucault fest, daß der moderne westliche Staat in einem bislang unerreichten Maß subjektive Techniken der Individualisierung und objektive Prozeduren der Totalisierung integriert hat; er spricht von einem eigentlichen »politischen double bind, das die gleichzeitige Individualisierung und Totalisierung der modernen Machtstrukturen bildet« (Foucault 3, S. 229-232).
Der Punkt, in dem diese beiden Aspekte konvergieren, ist in seinen Forschungen dennoch seltsam unbeleuchtet geblieben, so daß man bemerkt hat, er habe sich einer einheitlichen Theorie der Macht konsequent verweigert. Doch wenn Foucault den traditionellen Zugang zum Machtproblem von juridischen (»was legitimiert die Macht?«) oder institutionellen (»was ist der Staat?«) Modellen her ablehnt und vorschlägt, sich »von der theoretischen Privilegierung des Gesetzes und der Souveränität« zu lösen (Foucault 1, S. 111) und eine Analytik der Macht aufzubauen, deren Modell und Code nicht mehr das Recht ist, wo im Körper der Macht befindet sich dann jene Zone der Ununterscheidbarkeit (oder wenigstens der Schnittpunkt), in der sich die Techniken der Individualisierung und die Prozeduren der Totalisierung berühren? Gibt es, allgemeiner gesagt, ein einheitliches Zentrum, in dem das »double bind« seinen Ort hat? Daß es in der Genese der Macht einen subjektiven Aspekt gibt, war bereits im Begriff der servitude volontaire von La Boétie implizit enthalten; doch welches ist der Punkt, in dem die freiwillige Knechtschaft der einzelnen mit der objektiven Macht kommuniziert? Ist es möglich, daß man sich in einem so entscheidenden Bereich mit psychologischen Erklärungen begnügt wie jener (gewiß nicht reizlosen), die eine Parallele zwischen äußeren und inneren Neurosen zieht? Und ist es angesichts von Phänomenen wie der Medien-Spektakel-Macht, die heute überall den politischen Raum verwandelt, überhaupt noch legitim oder auch nur möglich, subjektive Technologien und politische Techniken auseinanderzuhalten?
Obwohl eine solche Ausrichtung in Foucaults Forschungen logisch impliziert zu sein scheint, bleibt sie ein blinder Fleck im Gesichtsfeld des Forschers oder eine Art Fluchtpunkt, der sich unendlich entzieht, auf den die verschiedenen Perspektivlinien seiner Untersuchungen (und allgemeiner die ganze abendländische Reflexion über die Macht) zulaufen, ohne ihn je erreichen zu können.
Die vorliegende Untersuchung betrifft genau diesen verborgenen Kreuzpunkt zwischen dem juridisch-institutionellen Modell und dem biopolitischen Modell der Macht. Und was sie als eine der wahrscheinlichen Folgerungen hat festhalten müssen, besteht genau darin, daß die beiden Analysen nicht getrennt werden können und daß die Einbeziehung des nackten Lebens in den politischen Bereich den ursprünglichen – wenn auch verborgenen – Kern der souveränen Macht bildet. Man kann sogar sagen, daß die Produktion eines biopolitischen Körpers die ursprüngliche Leistung der souveränen Macht ist. In diesem Sinn ist die Biopolitik mindestens so alt wie die souveräne Ausnahme. Indem der moderne Staat das biologische Leben ins Zentrum seines Kalküls rückt, bringt er bloß das geheime Band wieder ans Licht, das die Macht an das nackte Leben bindet, und knüpft auf diese Weise (gemäß einer hartnäckigen Entsprechung zwischen Modernem und Archaischem, die man in den verschiedensten Bereichen antrifft) an das Unvordenkliche der arcana imperii an.
Wenn das zutrifft, dann muß man die aristotelische Definition der pólis in der Opposition von leben (zē̂n) und gut leben (eû zē̂n) mit erneuter Aufmerksamkeit betrachten. Tatsächlich vollzieht die Opposition im selben Zug eine Einbeziehung des ersten in das zweite, des nackten Lebens in das politisch qualifizierte Leben. In der aristotelischen Definition gilt es nicht nur, wie das bis anhin geschehen ist, den Sinn, die Modi und die möglichen Einteilungen des »guten Lebens« als télos des Politischen zu untersuchen; vielmehr ist es notwendig, sich zu fragen, warum die abendländische Politik sich vor allem über eine Ausschließung (die im selben Zug eine Einbeziehung ist) des nackten Lebens begründet. Welcher Art ist die Beziehung von Politik und Leben, wenn das Leben sich als das darbietet, was durch eine Ausschließung eingeschlossen werden muß?
Die Struktur der Ausnahme, die wir im ersten Teil dieses Buches nachgezeichnet haben, scheint in dieser Perspektive konsubstantiell mit der abendländischen Politik zu sein. Foucaults Feststellung, der Mensch sei Aristoteles zufolge »ein lebendes Tier, das auch einer politischen Existenz fähig ist«, muß konsequent integriert werden, und zwar in dem Sinn, daß gerade die Bedeutung dieses »auch« problematisch ist. Die eigentümliche Formel »Enstanden um des Lebens willen, aber bestehend um des guten Lebens willen« kann nicht nur als Einbeziehung der Zeugung (ginoménē) in das Sein (oûsa), sondern auch als eine einschließende Ausschließung (eine exceptio) der zōḗ aus der pólis gelesen werden, beinah als ob die Politik der Ort wäre, an dem sich das Leben in gutes Leben verwandeln muß, und als ob das, was politisiert werden muß, immer schon das nackte Leben wäre. Dem nackten Leben kommt in der abendländischen Politik das einzigartige Privileg zu, das zu sein, auf dessen Ausschließung sich das Gemeinwesen der Menschen gründet.
Es ist also kein Zufall, wenn ein Abschnitt der Politik den eigentlichen Ort der pólis im Übergang von der Stimme zur Sprache ansiedelt. Das Band zwischen nacktem Leben und Politik ist dasselbe, das auch die metaphysische Definition des Menschen als »Lebewesen, das über die Sprache verfügt« in der Verbindung zwischen phonḗ und lógos sucht:
»Über die Sprache aber verfügt allein von den Lebewesen der Mensch. Die Stimme nun bedeutet schon ein Anzeichen von Leid und Freud, daher steht sie auch den anderen Lebewesen zu Gebote; ihre Natur ist nämlich bis dahin gelangt, daß sie über Wahrnehmung von Leid und Freud verfügen und das den anderen auch anzeigen können. Doch die Sprache ist da, um das Nützliche und das Schädliche klarzulegen und in der Folge davon das Gerechte und das Ungerechte. Denn das ist im Gegensatz zu den anderen Lebewesen den Menschen eigentümlich, daß nur sie allein über die Wahrnehmung des Guten und des Schlechten, des Gerechten und des Ungerechten und anderer solcher Begriffe verfügen. Und die Gemeinschaft mit diesen Begriffen schafft Haus und Staat.« (1253 a, 10-18)
Die Frage: »In welcher Weise verfügt das Lebewesen über die Sprache?« entspricht genau der Frage: »In welcher Weise bewohnt das nackte Leben die pólis?« Das Lebewesen verfügt über den lógos, indem es in ihm die eigene Stimme aufhebt und bewahrt, so wie es die pólis bewohnt, indem es das eigene nackte Leben in ihr ausgenommen sein läßt. Die Politik erweist sich demnach als im eigentlichen Sinn fundamentale Struktur der abendländischen Metaphysik, insofern sie die Schwelle besetzt, auf der sich die Verbindung zwischen Lebewesen und Sprache vollzieht. Die »Politisierung« des nackten Lebens ist die Aufgabe schlechthin der Metaphysik, in der über die Menschheit und den lebenden Menschen entschieden wird; und wenn die Moderne diese Aufgabe annimmt, tut sie nichts anderes, als der wesentlichen Struktur der metaphysischen Tradition ihre Treue zu bekunden. Das fundamentale Kategorienpaar der abendländischen Politik ist nicht jene Freund/Feind-Unterscheidung, sondern diejenige von nacktem Leben/politischer Existenz, zōḗ/bíos, Ausschluß/Einschluß. Politik gibt es deshalb, weil der Mensch das Lebewesen ist, das in der Sprache das nackte Leben von sich abtrennt und sich entgegensetzt und zugleich in einer einschließenden Ausschließung die Beziehung zu ihm aufrechterhält.
Der Protagonist dieses Buches ist das nackte Leben, das heißt das Leben des homo sacer, der getötet werden kann, aber nicht geopfert werden darf, und dessen bedeutende Funktion in der modernen Politik wir zu erweisen beabsichtigen. Eine obskure Figur des archaischen römischen Rechts, in der das menschliche Leben einzig in der Form ihrer Ausschließung in die Ordnung3 eingeschlossen wird, liefert also den Schlüssel, dank dessen nicht nur die heiligen Texte der Souveränität, sondern allgemeiner noch die Kodices der politischen Macht selbst ihre arcana enthüllen. Aber zugleich stellt uns diese vielleicht älteste Bedeutung des Begriffs sacer vor das Rätsel einer Figur des Heiligen diesseits oder jenseits des Religiösen, die das erste Paradigma des politischen Raumes im Abendland bildet. Die Foucaultsche These muß mithin berichtigt oder wenigstens ergänzt werden: Was die moderne Politik auszeichnet, ist nicht so sehr die an sich uralte Einschließung der zōḗ in die pólis noch einfach die Tatsache, daß das Leben als solches zu einem vorrangigen Gegenstand der Berechnungen und Voraussicht der staatlichen Macht wird; entscheidend ist vielmehr, daß das nackte Leben, ursprünglich am Rand der Ordnung angesiedelt, im Gleichschritt mit dem Prozeß, durch den die Ausnahme überall zur Regel wird, immer mehr mit dem politischen Raum zusammenfällt und auf diesem Weg Ausschluß und Einschluß, Außen und Innen, zōḗ und bíos, Recht und Faktum in eine Zone irreduzibler Ununterscheidbarkeit geraten. Der Ausnahmezustand, in dem das nackte Leben zugleich von der Ordnung ausgeschlossen und von ihr erfaßt wurde, schuf gerade in seiner Abgetrenntheit das verborgene Fundament, auf dem das ganze politische System ruhte. Wenn seine Grenzen bis ins Unbestimmte verschwimmen, dann setzt sich das nackte Leben, das ihn bewohnte, im Staat frei und wird zum Subjekt und Objekt der Konflikte der politischen Ordnung, dem einzigen Ort sowohl der Organisation der staatlichen Macht als auch der Emanzipation von ihr. Es scheint ganz so, als ob im Gleichschritt mit dem Prozeß der Disziplinierung, durch den die Staatsmacht den Menschen als Lebewesen zu seinem eigenen spezifischen Objekt erhebt, ein weiterer Prozeß in Gang gekommen wäre, der im großen und ganzen mit der Geburt der modernen Demokratie zusammenfällt, in der sich der Mensch als Lebewesen nicht mehr als Objekt, sondern als Subjekt der politischen Macht präsentiert. Diese Prozesse, die einander in vielem entgegengesetzt sind und (wenigstens scheinbar) in hartem Konflikt stehen, stimmen jedoch in der Tatsache überein, daß in beiden das nackte Leben des Staatsbürgers, der neue biopolitische Körper der Menschheit, auf dem Spiel steht.
Demnach kennzeichnet sich die moderne Demokratie gegenüber der antiken dadurch, daß sie von Anfang an als eine Einforderung und Freisetzung der zōḗ erscheint, daß sie unablässig versucht, das nackte Leben selbst in Lebensform zu verwandeln und sozusagen den bíos der zōḗ zu finden. Daher rührt auch die spezifische Aporie, die darin besteht, die Freiheit und Glückseligkeit der Menschen am selben Ort – dem »nackten Leben« – ins Spiel bringen zu wollen, der doch ihre Verknechtung bezeichnete. Hinter dem langen antagonistischen Prozeß, der zur Anerkennung der Menschenrechte und der formalen Freiheiten führt, steht noch einmal der Körper des homo sacer [uomo sacro] mit seinem souveränen Doppel, seinem nicht opferbaren, jedoch tötbaren Leben. Diese Aporie ins Bewußtsein zu heben, bedeutet nicht, die Errungenschaften und Anstrengungen der Demokratie zu entwerten, sondern ein für allemal verstehen zu wollen, warum sie in dem Moment, da sie endgültig über ihre Gegner zu triumphieren und den Gipfel erreicht zu haben schien, sich wider alles Erwarten als unfähig erwies, jene zōḗ vor einem nie dagewesenen Ruin zu bewahren, zu deren Befreiung und Glückseligkeit sie alle ihre Kräfte aufgeboten hatte. Der Niedergang der modernen Demokratie und ihre zunehmende Konvergenz mit den totalitären Staaten in den postdemokratischen Spektakel-Gesellschaften (was sich bereits mit Alexis de Tocqueville abzeichnet und in den Analysen Guy Debords klar zutage tritt) finden ihre Wurzel vielleicht in dieser Aporie, die den Beginn der Demokratie markiert und sie zu einer geheimen Komplizenschaft mit ihrem erbittertsten Feind zwingt. Unsere Politik kennt heute keinen anderen Wert (und folglich keinen anderen Unwert) als das Leben, und solange die Widersprüche, die sich daraus ergeben, nicht gelöst sind, werden Nazismus und Faschismus, welche die Entscheidung über das nackte Leben zum höchsten politischen Kriterium erhoben haben, bedrohlich aktuell bleiben. Der Zeugenschaft von Robert Antelme zufolge bestand die Lektion, welche die Konzentrationslager ihren Insassen beigebracht hatten, darin: »Sobald das eigentliche Menschsein in Frage gestellt wird, stellt sich ein fast biologischer Anspruch auf Zugehörigkeit zur menschlichen Gattung ein.« (Antelme, S. 10)
Die These von einer innersten Solidarität zwischen Demokratie und Totaliarismus (die wir hier, wenn auch mit aller Vorsicht, aufstellen müssen) ist offensichtlich keine historiographische These (übrigens ebensowenig wie Leo Strauss’ These von einer geheimen Konvergenz zwischen Liberalismus und Kommunismus, was ihr Endziel angeht), die der Ausräumung und Einebnung der enormen Unterschiede, die ihre Geschichte und ihre Gegnerschaft kennzeichnen, Vorschub leisten soll. Trotzdem muß auf der historisch-philosophischen Ebene, die ihr eigen ist, an der These entschieden festgehalten werden; denn sie allein erlaubt es, uns angesichts der neuen Realitäten und der unvorhergesehenen Konvergenzen dieses Jahrtausendendes zu orientieren und das Feld für jene neue Politik frei zu machen, die im wesentlichen noch zu erfinden bleibt.
Indem Aristoteles im oben zitierten Abschnitt den »schönen Tag« (euhēmería) des einfachen Lebens den »Beschwerlichkeiten« des politischen bíos entgegensetzte, gab er der Aporie, die der abendländischen Politik zugrunde liegt, ihre vielleicht schönste Ausformulierung. Die vierundzwanzig Jahrhunderte, die seither verflossen sind, haben keine anderen als vorläufige und unwirksame Lösungen gebracht. Es ist der Politik in der Ausführung des metaphysischen Auftrags, der sie zunehmend die Form einer Biopolitik hat annehmen lassen, nicht gelungen, die Verbindung herzustellen, die den Bruch zwischen zōḗ und bíos, zwischen Stimme und Sprache hätte überwinden sollen. Das nackte Leben bleibt in diesem Bruch in der Form der Ausnahme eingefaßt, das heißt als etwas, das nur durch eine Ausschließung eingeschlossen wird. Wie ist es möglich, die »natürliche Annehmlichkeit« der zōḗ zu »politisieren«? Und vor allem: Bedarf die zōḗ wirklich der Politisierung, oder ist das Politische etwa bereits als ihr wertvollster Kern in ihr enthalten? Die Biopolitik des modernen Totalitarismus auf der einen, die Massengesellschaft des Konsums und des Hedonismus auf der anderen Seite geben gewiß, jede auf ihre Art, eine Antwort auf diese Fragen. Doch solange keine völlig neue – das heißt nicht mehr auf die exceptio des nackten Lebens gegründete – Politik da ist, wird jede Theorie und jede Praxis in einer Sackgasse steckenbleiben, und der »schöne Tag« des Lebens wird das politische Bürgerrecht nur über Blut und Tod erlangen oder in der vollkommenen Sinnlosigkeit, zu der es die Spektakel-Gesellschaft verdammt.
Carl Schmitts Definition der Souveränität (»Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet«; Schmitt 1, S. 13) ist, noch bevor man begriffen hätte, wovon sie wirklich handelt, zu einem Gemeinplatz geworden. Es ist nicht weniger als der Grenzbegriff der Staats- und Rechtslehre, die in ihm (da jeder Grenzbegriff die Grenze zwischen zwei Begriffen ist) an die Sphäre des Lebens anstößt und sich mit ihr vermischt. Solange der Horizont der Staatlichkeit den weitesten Kreis des Gemeinschaftslebens bildete und die politischen, religiösen, juridischen und ökonomischen Lehren, die ihn stützten, noch Bestand hatten, konnte diese »äußerste Sphäre« (ebd.) nicht wirklich ans Licht kommen. Das Problem der Souveränität war damals darauf beschränkt, zu bestimmen, wer innerhalb der Ordnung mit gewissen Machtbefugnissen ausgestattet wurde, ohne daß die Schwelle der Ordnung selbst je in Frage gestellt wurde. Heute, da die großen staatlichen Strukturen in einen Prozeß der Auflösung geraten sind und der Notstand, wie das Benjamin vorausahnte, zur Regel geworden ist, wird es Zeit, das Problem der Grenzen und der originären Struktur der Staatlichkeit erneut und in einer neuen Perspektive aufzuwerfen. Denn die Unzulänglichkeit der anarchistischen und marxistischen Kritik des Staates bestand genau darin, diese Struktur nicht einmal erahnt und deshalb das arcanum imperii voreilig beiseite geschoben zu haben, wie wenn es außerhalb der Simulakren und der Ideologien, die ihm zur Rechtfertigung beigestellt wurden, keinen Bestand hätte. Der Kampf gegen einen Feind, dessen Struktur einem unbekannt bleibt, endet früher oder später damit, daß man sich mit ihm identifiziert. Und die Theorie des Staates (und besonders des Ausnahmezustandes, das heißt die Diktatur des Proletariats als Übergangsphase zu einer staatslosen Gesellschaft) ist gerade die Klippe, an der die Revolutionen unseres Jahrhunderts gescheitert sind.
Dieses Buch, das anfänglich als Antwort auf die blutige Mystifikation einer neuen globalen Ordnung konzipiert worden war, mußte sich indes Problemen stellen – zuvorderst der Heiligkeit des Lebens –, mit denen es nicht gerechnet hatte. Aber im Verlauf der Untersuchung ist klar geworden, daß in einem derartigen Bereich keiner der Begriffe, welche die Humanwissenschaften (von der Jurisprudenz bis zur Anthropologie) zu definieren glaubten oder als evident voraussetzten, als verbürgt anzunehmen ist und daß viele dieser Begriffe – in der Dringlichkeit der Katastrophe – einer rückhaltlosen Revision bedurften.
Erster TeilLogik der Souveränität
1. Das Paradox der Souveränität
1.1. Das Paradox der Souveränität drückt sich so aus: »Der Souverän steht zugleich außerhalb und innerhalb der Rechtsordnung.« Wenn derjenige souverän ist, dem die Rechtsordnung die Macht zuerkennt, den Ausnahmezustand auszurufen und auf diese Weise die geltende Ordnung aufzuheben, dann »steht« er in der Tat »außerhalb der normal geltenden Rechtsordnung und gehört doch zu ihr, denn er ist zuständig für die Entscheidung, ob die Verfassung in toto suspendiert werden kann« (Schmitt 1, S. 14). Die Präzisierung »zugleich« ist mitnichten trivial: Der Souverän, der die legale Macht innehat, die Geltung des Rechts aufzuheben, setzt sich legal außerhalb des Rechts. Das bedeutet, daß das Paradox auch so formuliert werden kann: »Das Recht ist außerhalb seiner selbst«, oder: »Ich, der Souverän, der ich außerhalb des Rechts stehe, erkläre, daß es kein Außerhalb des Rechts gibt.«
Es lohnt sich, über die dem Paradox implizite Topologie nachzudenken, denn erst wenn seine Struktur einmal begriffen ist, wird klar, in welchem Maß die Souveränität die Grenze (im doppelten Sinn von Ende und Anfang) der Rechtsordnung bezeichnet. Schmitt stellt diese Struktur als die Struktur der Ausnahme dar:
»Die Ausnahme ist das nicht Subsumierbare; sie entzieht sich der generellen Fassung, aber gleichzeitig offenbart sie ein spezifisch-juristisches Formelement, die Dezision, in absoluter Reinheit. In seiner absoluten Reinheit ist der Ausnahmefall dann eingetreten, wenn erst die Situation geschaffen werden muß, in der Rechtssätze gelten können. Jede generelle Norm verlangt eine normale Gestaltung der Lebensverhältnisse, auf welche sie tatbestandsmäßig Anwendung finden soll und die sie ihrer normativen Regelung unterwirft. Die Norm braucht ein homogenes Medium. Diese faktische Normalität ist nicht bloß eine ›äußere Voraussetzung‹, die der Jurist ignorieren kann; sie gehört vielmehr zu ihrer immanenten Geltung. Es gibt keine Norm, die auf ein Chaos anwendbar wäre. Die Ordnung muß hergestellt sein, damit die Rechtsordnung einen Sinn hat. Es muß eine normale Situation geschaffen werden, und souverän ist derjenige, der definitiv darüber entscheidet, ob dieser normale Zustand tatsächlich herrscht. Alles Recht ist ›Situationsrecht‹. Der Souverän schafft und garantiert die Situation als Ganzes in ihrer Totalität. Er hat das Monopol dieser letzten Entscheidung. Darin liegt das Wesen der staatlichen Souveränität, die also richtigerweise nicht als Zwangs- oder Herrschaftsmonopol, sondern als Entscheidungsmonopol juristisch zu definieren ist, wobei das Wort ›Entscheidung‹ in dem noch weiter zu entwickelnden allgemeinen Sinne gebraucht wird. Der Ausnahmefall offenbart das Wesen der staatlichen Autorität am klarsten. Hier sondert sich die Entscheidung von der Rechtsnorm, und (um es paradox zu formulieren) die Autorität beweist, daß sie, um Recht zu schaffen, nicht Recht zu haben braucht.
[...] Die Ausnahme ist interessanter als der Normalfall. Das Normale beweist nichts, die Ausnahme beweist alles; sie bestätigt nicht nur die Regel, die Regel lebt überhaupt nur von der Ausnahme. [...] Ein protestantischer Theologe, der bewiesen hat, welcher vitalen Interessen die theologische Reflexion auch im 19. Jahrhundert fähig sein kann, hat es gesagt: ›Die Ausnahme erklärt das Allgemeine und sich selbst. Und wenn man das Allgemeine richtig studieren will, braucht man sich nur nach einer wirklichen Ausnahme umzusehen. Sie legt alles viel deutlicher an den Tag als das Allgemeine selbst. Auf die Länge wird man des ewigen Geredes vom Allgemeinen überdrüssig; es gibt Ausnahmen. Kann man sie nicht erklären, so kann man auch das Allgemeine nicht erklären. Gewöhnlich merkt man die Schwierigkeit nicht, weil man das Allgemeine nicht einmal mit Leidenschaft, sondern mit einer bequemen Oberflächlichkeit denkt. Die Ausnahme dagegen denkt das Allgemeine mit energischer Leidenschaft.‹« (Schmitt 1, S. 19-21)
Es ist kein Zufall, daß Schmitt für seine Definition der Ausnahme sich auf das Werk eines Theologen beruft (der niemand anderes ist als Sören Kierkegaard). Zwar hatte Giambattista Vico die Vorrangigkeit der Ausnahme in nicht allzu unähnlicher Weise als »letzte Konfiguration der Fakten« bestimmt (»Indidem iurisprudentia non censetur, qui beata memoria ius theticum sive summum et generale regularum tenet; sed qui acri iudicio videt in causis ultimas factorum peristases seu circumstantias, quae aequitatem sive exceptionem, quibus lege universali eximantur, promereant«;4De antiquissima, Kap. II); doch gibt es im Bereich der Rechtswissenschaften keine Theorie der Ausnahme, welche dieser einen solch hohen Rang zuspricht. Denn was Schmitt zufolge mit der souveränen Ausnahme in Frage steht, ist die Bedingung der Möglichkeit selbst der Gültigkeit der Rechtsnorm und mit ihr der Sinn der Staatsautorität. Durch den Ausnahmezustand »schafft und garantiert« der Souverän »die Situation«, deren das Recht für seine eigene Geltung bedarf. Doch was ist das für eine »Situation«? Welches ist ihre Struktur, wenn sie bloß in der Aufhebung der Norm besteht?
ℵ Vicos Opposition zwischen positivem Recht (ius theticum) und Ausnahme drückt die besondere Stellung der Ausnahme gut aus. Sie ist ein Element im Recht, das über das positive Recht in Form seiner Aufhebung hinausgeht. Sie verhält sich zum positiven Recht, wie sich die negative zur positiven Theologie verhält. Während diese Gott bestimmte Eigenschaften prädiziert, negiert und suspendiert die negative (oder mystische) Theologie mit ihrem »weder ... noch ...« die Attribution jeglicher Prädikate. Letztere befindet sich dennoch nicht außerhalb der Theologie, sondern funktioniert bei näherem Hinsehen wie das Prinzip, das die Möglichkeit von etwas wie Theologie im allgemeinen begründet. Nur deshalb, weil die Göttlichkeit negativ als das vorausgesetzt worden ist, was außerhalb jedes möglichen Prädikats Bestand hat, kann sie Subjekt einer Prädikation werden. Und analog dazu kann das positive Recht den Normalfall nur deshalb als Bereich seiner eigenen Gültigkeit bestimmen, weil die Gültigkeit des positiven Rechts im Ausnahmezustand suspendiert ist.
1.2. Die Ausnahme ist eine Art der Ausschließung. Sie ist ein Einzelfall, der aus der generellen Norm ausgeschlossen ist. Doch was die Ausnahme eigentlich kennzeichnet, ist der Umstand, daß das, was ausgeschlossen wird, deswegen nicht völlig ohne Beziehung zur Norm ist; sie bleibt im Gegenteil mit ihr in der Form der Aufhebung verbunden. Die Norm wendet sich auf die Ausnahme an, indem sie sich von ihr abwendet, sich von ihr zurückzieht. Der Ausnahmezustand ist also nicht das der Ordnung vorausgehende Chaos, sondern die Situation, die aus ihrer Aufhebung hervorgeht. In diesem Sinn ist die Ausnahme wirklich, der Etymologie gemäß, herausgenommen (excaptum < excapere) und nicht einfach nur ausgeschlossen.
Daß die juridisch-politische Ordnung die Struktur einer Einschließung dessen hat, was zugleich ausgeschlossen wird, ist oft bemerkt worden. Die »Souveränität«, so schreiben Gilles Deleuze und Félix Guattari, »herrscht nur über das, was sie verinnerlichen [...] kann« (Deleuze und Guattari, S. 494); und im Zusammenhang mit der »großen Gefangenschaft« (le grand renfermement), die Foucault in Wahnsinn und Gesellschaft beschrieben hat, spricht Maurice Blanchot vom Versuch der Gesellschaft, das »Außen einzuschließen« (enfermer le dehors), das heißt eine »Innerlichkeit der Erwartung oder der Ausnahme« einzurichten. Erfährt das System eine Überschreitung, dann verinnerlicht es das, was es überschreitet, mittels eines Verbots; auf diese Weise »bezeichnet es sich als außerhalb seiner selbst« (Blanchot, S. 292). Die Ausnahme, welche die Struktur der Souveränität definiert, ist jedoch noch komplexer. Hier wird das, was draußen ist, nicht einfach mittels eines Verbots oder einer Internierung eingeschlossen, sondern indem die Gültigkeit der Ordnung aufgehoben wird, das heißt indem zugelassen wird, daß sich die Ordnung von der Ausnahme zurückzieht, sie verläßt.5 Es ist nicht die Ausnahme, die sich der Regel entzieht, es ist die Regel, die, indem sie sich aufhebt, der Ausnahme stattgibt; und die Regel setzt sich als Regel, indem sie mit der Ausnahme in Beziehung bleibt. Die besondere »Kraft« des Gesetzes rührt von dieser Fähigkeit her, mit einem Außen in Beziehung zu bleiben. Die äußerste Form der Beziehung, die etwas einzig durch seine Ausschließung einschließt, nennen wir Ausnahme-Beziehung.
Das Besondere der Situation, die im Ausnahmezustand geschaffen wird, besteht nun darin, daß sie weder als faktische noch als rechtliche Situation bestimmt werden kann, sondern dazwischen eine paradoxe Schwelle der Ununterschiedenheit errichtet. Faktisch ist sie deshalb nicht, weil sie nur durch die Aufhebung der Norm geschaffen wird; aber aus demselben Grund ist sie ebensowenig ein juristischer Tatbestand, auch wenn sie die Möglichkeit der Geltung des Rechts eröffnet. Dies ist der letzte Sinn des Paradoxes, das Schmitt formuliert, wenn er schreibt, daß die souveräne Entscheidung, »um Recht zu schaffen, nicht Recht zu haben braucht«. Denn bei der souveränen Ausnahme geht es nicht so sehr darum, eine Überschreitung zu kontrollieren oder zu neutralisieren, als vielmehr und zuallererst um die Schaffung und Bestimmung des Raumes selbst, in dem die juridisch-politische Ordnung überhaupt gelten kann. Sie ist in diesem Sinn die fundamentale »Ortung«,6 die sich nicht darauf beschränkt, zwischen dem, was außen, und dem, was innen ist, zwischen normaler Situation und Chaos zu unterscheiden; sie zieht dazwischen eine Schwelle (den Ausnahmezustand), von der aus Innen und Außen in jene komplexen topologischen Beziehungen treten, welche die Gültigkeit der Rechtsordnung ermöglichen.
Die »Ordnung des Raumes«, in der für Schmitt der souveräne »Nomos« besteht, ist jedoch nicht nur »Landnahme«,7 Festlegung einer juridischen »Ordnung« und einer territorialen »Ortung«,8 sondern vor allem »Einnahme des Außen«, Ausnahme.9
ℵ Da es »keine Norm [gibt], die auf ein Chaos anwendbar wäre«, muß dieses zuerst durch Schaffung einer Zone der Ununterschiedenheit zwischen Innen und Außen, Chaos und normaler Situation, das heißt des Ausnahmezustandes, eingeschlossen werden. Denn eine Norm muß, um sich auf etwas beziehen zu können, das voraussetzen, was außerhalb der Beziehung ist (das Beziehungslose), und trotzdem auf diese Weise eine Beziehung damit herstellen. Die Ausnahmebeziehung führt so einfach die originäre formale Struktur der Rechtsbeziehung vor. Die souveräne Entscheidung über die Ausnahme ist in diesem Sinn die originäre politisch-juridische Struktur, von der aus das, was in der Ordnung eingeschlossen und das, was aus ihr ausgeschlossen ist, erst seine Bedeutung gewinnt. In seiner archetypischen Form ist der Ausnahmezustand das Prinzip jeglicher juridischen Lokalisierung; denn nur in ihm öffnet sich der Raum, in dem die Festlegung einer gewissen Ordnung und eines bestimmten Territoriums erstmals möglich wird. Als solcher ist er aber wesentlich unlokalisierbar (auch wenn ihm von Mal zu Mal definierte raumzeitliche Grenzen zugewiesen werden können).
Der Nexus von Ortung10 und Ordnung,11 der den »Nomos der Erde« konstituiert (Schmitt 2, S. 48), ist mithin noch komplexer, als ihn Schmitt beschreibt; es wohnt ihm eine fundamentale Doppeldeutigkeit inne, eine nicht zu lokalisierende Zone der Ununterschiedenheit oder der Ausnahme, die als Prinzip der unendlichen Verschiebung letzten Endes gegen