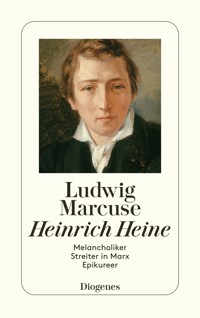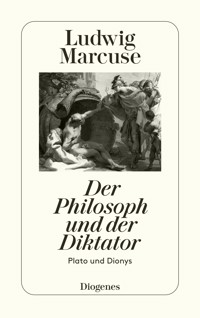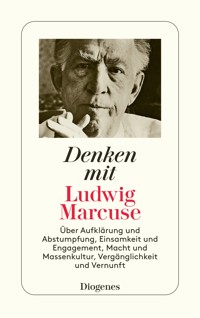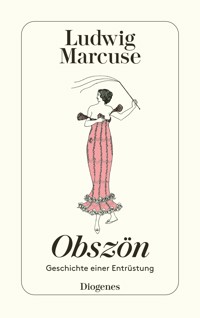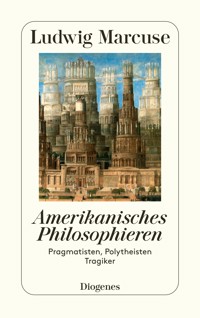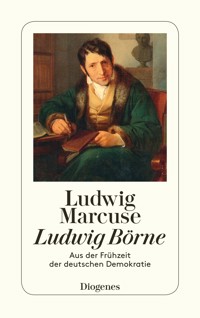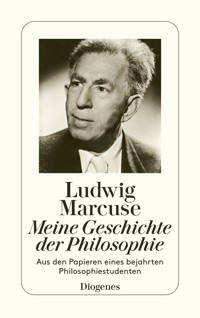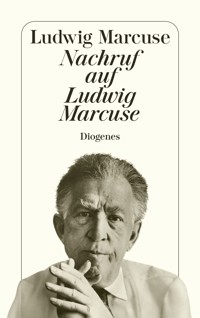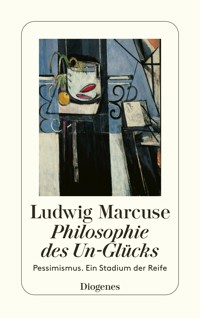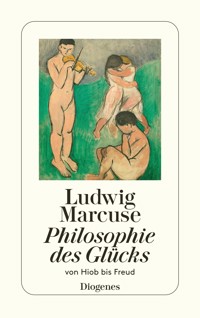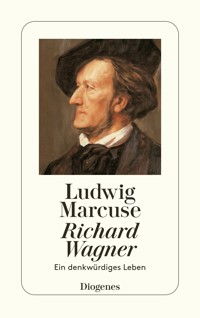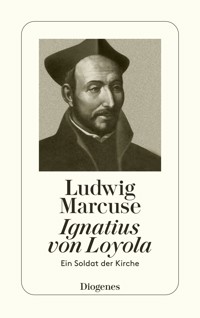
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Ignatius von Loyola – spanischer Offizier voll romantischer Leidenschaft für das Rittertum, wallfahrte nach Palästina, studierte auf einigen Universitäten, legte 1534 mit einigen Genossen das Gelübde ab, sich dem Papst zur Verfügung zu stellen, und gründete schließlich einen der mächtigsten Orden Roms: den Jesuitenorden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 538
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Ludwig Marcuse
Ignatius von Loyola
Ein Soldat der Kirche
Diogenes
»Ehedem war ich der Meinung, es würde wohlgetan sein, die weltliche Gewalt ganz von der geistlichen zu trennen. Jetzt aber habe ich gelernt, daß die Tugend ohne Macht lächerlich ist.«
Ein Redner des Basler Konzils
Erstes Buch
Wer will, dem ist nichts schwer.
Loyola
Drei Königinnen und ein Page
Isabella
Es war ein böses Jahr für dieses Land. Das Korn auf den Feldern wuchs nicht. Die Menschen in den Städten hungerten. Gefährliche Krankheiten nisteten in den kraftlosen Körpern. Am Karfreitag traf ein Erdbeben, das von Kastilien bis hinunter nach Marokko Schrecken und Elend verbreitete, besonders hart die andalusische Erde. In Sevilla fielen Häuser, Festungswerke und Kathedralen zusammen. Auch Gottes Gebäude ist auf keinem festeren Fels erbaut als auf einem schrumpfenden Erdklumpen.
Der Herbst brachte neues Unheil. Ein grauer Himmel schüttete trübe Fluten über die spanische Erde, als wollte er sie ertränken. Die neue Saat faulte. Und die Königin, die dreißig Jahre lang mit fester Hand das Reich gelenkt hatte, legte sich in Medina del Campo zum Sterben. Die Beine waren formlos geworden. Der aufgetriebene Bauch war weißlich gespannt. Das Fieber hatte sie so ausgedörrt, daß der Durst nicht mehr zu löschen war. In jeder Kirche des Landes stiegen Bittgebete zum Himmel auf. Lange Prozessionen durchzogen die Städte, um vor Gott für die Herrin zu zeugen. Doch Isabella war bereit, zu gehen. »Weint nicht um mich«, sagte sie gelassen wie ein großer Besitzer, den keine Krise erschüttern kann. »Verschwendet eure Zeit nicht in unnützen Gebeten für meine Wiederherstellung.« Sie hatte so gut für die letzten Stunden vorgesorgt, daß ihr nicht einmal mehr an einem kurzen Aufschub lag.
Und doch überschatteten schwere Sorgen den Abschied. Wer wird morgen Erbe ihres Landes Kastilien sein? Wer wird einst, nach dem Tod des Gatten, das weite Land Spanien regieren? Die Erben waren ihnen vorausgestorben. Sechs Monate hatte Portugal die Festlichkeiten vorbereitet, welche die Verbindung des Thronfolgers mit ihrer ältesten Tochter, der jungen Isabella, feierten. Vier Wochen genoß eine ausgelassene Hochzeitsgesellschaft die Liebe zweier Menschen, die Freundschaft der zwei benachbarten Nationen, die Lust, sorgenlos an einer erlesenen Tafel zu sitzen. An den Ufern des Guadalquivir hatte man um die Kampfplätze Gitter gestellt, die in seidene Goldstoffe gekleidet waren; Thronhimmel und Teppiche, mit den Wappen der alten Häuser von Kastilien bestickt, boten Schutz gegen die Sonne. Isabella, die Jüngere, thronte in einem Kreis von siebzig adligen Fräuleins und hundert Edelknaben. Am zweiundzwanzigsten November fand die Vermählung statt. Am zweiundzwanzigsten Juni stürzte der junge Ehemann vom Pferd und starb … Sechs Jahre später. Der blonde, zarte Juan, ihr Sohn, ihr Erbe, führte die Erzherzogin Margarete heim, Tochter des deutschen Kaisers. Nach stürmischer Fahrt landete die Siebzehnjährige in Santander. Der Patriarch von Alexandrien legte die Hände der Verlobten ineinander. In Burgos vollzog der Erzbischof von Toledo die Trauung. Festmähler, Hofbälle, Ring- und Pfeilstechen feierten die Ehe des spanischen Thronfolgers mit der Häbsburgerin. Im April. Im September wurde der zwanzigjährige, seit seiner Geburt schwächliche Juan zu Salamanca von einem Fieber befallen. Die Ärzte waren für eine kurze Trennung von der temperamentvollen jungen Frau. Doch Königin Isabella hielt dafür, daß der Mensch nicht scheiden soll, was Gott zusammengefügt hat. Anfang Oktober war ihr ›Engel‹ tot. Auf den Mauern und Toren der Stadt wurden schwarze Fahnen aufgepflanzt. Die Geschäfte blieben vierzig Tage geschlossen. Eine Hoftrauer führte Sackleinwand statt der weißen Serge ein, um dem ungewöhnlich schweren Verlust einen ungewöhnlichen Ausdruck zu geben. Juans nachgeborene Tochter kam tot zur Welt … Die junge Isabella, Witwe des portugiesischen Kronprinzen, hatte den König Manuel von Portugal geheiratet. Als Hochzeitsgeschenk forderte sie, echte Tochter ihrer Mutter, vom Zukünftigen die Vertreibung der spanisch-jüdischen Emigranten. Das junge Paar war zu Ostern in Guadelupe, zog feierlich in Toledo ein, beging das Fronleichnamsfest in Saragossa. Im Juni. Im August brachte Isabella, die Jüngere, im erzbischöflichen Palast einen Knaben zur Welt. Eine Stunde nach seiner Geburt war sie tot. Thronerbe, künftiger Herrscher der ganzen Iberischen Halbinsel, war Don Miguel, eine Stunde alt. Er wurde auf dem Arm seiner Amme, vom vornehmsten Adel begleitet, durch die Stadt getragen. Nur zwei Jahre lebte diese kleinste Hoffnung der Königin.
Kann die Sterbende die Geschicke des Landes in die Hände der Tochter Juana legen? Wie stürmisch ist gleich die Hochzeitsreise zum niederländischen Bräutigam gewesen! Als ob die leicht erregbare junge Frau mit ihrer Unruhe alle Winde aufgestört hätte. In den Häfen von Guipuzcoa und Biscaya hatte Isabella der Braut Juana hundertzehn Schiffe ausgerüstet. Das sechzehnjährige, reizlose und trübsinnige Geschöpf, immer eifersüchtig auf die Schwestern, immer störrisch gegen die mütterliche Lenkung, hatte kühlen Herzens das Vaterhaus verlassen. Sechs Wochen später, nach stürmischer Fahrt, nach schweren Verlusten, mit vielen Toten und Kranken an Bord, war die Hochzeitsflotte im Hafen von Middelburg eingelaufen. Juana zitterte vor Sehnsucht nach dem schönen Philipp. Wo blieb er? Hatte er ihr nicht noch vor zwei Monaten zärtlich geschrieben: »Ich wollte, ich könnte alles hinter mir lassen, um wie im Fluge Tag und Nacht zu Euch zu eilen?« Jetzt war sie, Tag und Nacht, mitten durch die wütende See, zu ihm geeilt. Wo blieb er? Er war bei seinem Vater, dem deutschen Kaiser, in Tirol. Er ließ sie warten. Juana aber konnte nicht warten.
Die Erinnerung an Juana ist für die sterbende Isabella nicht mehr die empfindliche Narbe der Vergangenheit, sondern die offene Wunde der Gegenwart. Zuerst waren blasse, kaum wahrnehmbare Gerüchte vom fernen Hof der Tochter zu ihr gedrungen. Dann hatte sie den Subprior von Santa Cruz hinübergeschickt und die volle, unerträgliche Wahrheit erfahren. Der schöne Philipp war nicht gebaut, still im Ehehafen zu liegen, zum Vergnügen einer überspannten Frau. Doch seine Extratouren wären kaum so schnell der Schwiegermutter zu Ohren gekommen, hätte nicht auch seine politische Liebschaft mit Frankreich, Spaniens Erbfeind, die Ehe schwer belastet. Der Stolz der Königin war tief verletzt. Der schöne Philipp behandelte die spanische Umgebung seiner Gemahlin so schlecht, daß ihre Diener, Isabellas Untertanen, am Hofe der Niederländer hungerten. Und Juana, bald Königin von Kastilien, ließ sich’s gefallen, daß die Geheimräte ihres Gatten alle Beschwerden mit unverschämten Antworten abtaten. Was gehen die Spanier Juana an, wenn sie nur ihren schönen Philipp mit den herrlichen langen Locken anstarren darf. Diese schmachtende Törin wird also die Erbin sein. Eine Erbin, die sich weigerte, in das Land ihrer Mutter und ihres Vaters zu kommen, weil sie sich nicht einmal für Monate vom schönen Philipp trennen kann.
Sie waren dann beide doch in Spanien erschienen, Juana und ihr schöner Philipp. Bis Bayonne hatte sie ihnen Züge von Maultieren zur Weiterbeförderung des Gepäcks entgegengeschickt; denn die flandrischen Karren waren in den pyrenäischen Bergen unverwendbar. In Burgos, in Valladolid, in Medina del Campo, in Segovia, in Madrid waren den zukünftigen Herrschern große Empfänge bereitet worden. Diese Erinnerung tut wohl; denn die süße Geborgenheit im Zeremoniell ist eine Vorstufe der seligen Geborgenheit in Jesus Christus. Was für ein prächtiger Zug war den Kindern zur Einholung entgegengezogen! Voran des Königs Falkoniere in grünen Gewändern mit aschgrauen Ärmeln. Danach Mitglieder der königlichen Kapelle. Dann der Alkalde mit den Rechtsbeiständen und vielen Bürgern in Scharlachroben und Wämsern von karmoisinroter Seide. Eine halbe Meile vor Toledo erschien Ferdinand selbst mit einer Gefolgschaft von sechstausend Würdenträgern; zur Rechten des Königs ritt Frankreichs, zur Linken Venedigs Gesandter. Unter dem Thronhimmel, der mit den spanischen und niederländischen Wappen geziert war, zogen der Vater und seine Kinder in die festlich geschmückte Stadt ein. In der Vorhalle des Doms war aus Gold und Edelsteinen das Kreuz errichtet worden. Hier warteten, unter den Orgelklängen des Tedeums, Erzbischof Ximenes und seine Domherren, während Isabella im großen Saal des Schlosses auf königlichem Sessel thronte – um sie herum standen feierlich-steife Hofdamen. Plötzlich brach die Festmusik ab. Die Farben verblaßten. Der Prinz von Wales, Gemahl der jüngsten Tochter Catilina, war gestorben.
Nach den Feierlichkeiten von Toledo war der schöne Philipp in sein Vaterland zurückgefahren. Heftig hatte sich Juana der Trennung widersetzt: doch die Schwangere mußte bleiben. Kaum hatte sie dann geboren, als sie darauf bestand, dem geliebten Mann nachzueilen. Schon im Frühjahr spürte Isabella, wie es um sie stand; so versuchte sie, Juana im Lande zu halten, das sie nun bald regieren wird. Doch was ist Spanien für Juana? Wie das verliebte Mädchen auf die Abreise drängt! In Medina del Campo muß die Ungeduldige Monate auf die Ausrüstung der Flotte warten, die sie zurückbringen soll. Da schreibt ihr der schöne Philipp, er habe für sie freien Durchzug durch Frankreich erwirkt. In flatternder Hast stürzt sie ihm entgegen. Heimlich, im Dunkel der Nacht, nur mit einem Hemd bekleidet, verläßt sie ihr Schlafzimmer. Der Bischof von Burgos und der Gouverneur eilen herbei. Sie bitten die Fliehende, in ihre Wohnung zurückzukehren. Das verstörte Mädchen zeigt ihnen den Rücken und befiehlt den Wachen, die Tore zu öffnen. Man läßt sie nicht aus der Stadt. Juana ist gefangen. Sie droht, ihre Kerkermeister an dem Tage zu hängen, an dem sie den Thron der Mutter besteigen wird. Sie weicht nicht von der Schranke, die sie vom schönen Philipp trennt. Die ganze Nacht harrt sie im Regen aus. Dann wählt sie zum Aufenthalt eine kleine Küche in der Nähe des Tors. So mußte Isabella dem leidenden Körper die Reise zur Tochter abzwingen. Vor einer großen Menge von Bürgern und Bauern wurde die Königin von der Erbin mit ungezügeltem Haß empfangen.
Kann Isabella in Frieden scheiden von einem Land, das in die Hände einer Juana kommt? Nach achtzehn Monaten hat die liebeskranke Frau endlich ihren schönen Philipp. Doch er hat die Zeit der Trennung nicht mit Warten und zitternder Sehnsucht hingebracht. Das weiß sie bald. Bei einer großen Soirée, in Gegenwart aller Gesandten, schlägt sie, besinnungslos vor Eifersucht, Philipps Geliebte; die langen blonden Haare, die er so gern geliebkost hat, läßt Juana bis auf die Wurzeln scheren. Angeekelt wendet sich der Gatte von der lästigen Frau. Das weitflächige, verschwommene, spitze Gesicht der fernen Juana sieht die sterbende Mutter nichtssagend an. Gibt es einen Ausweg? Isabella ist Königin; sie hat keinen Ausweg. Sie hat den Menschenbau, dessen Krönung sie ist, durch ihren Glanz zu schmücken, nicht nach ihrem Willen umzustoßen. So setzt sie in ihrem Testament als Universalerbin die Juana ein: ein verliebtes und betrogenes, hilfloses kleines Mädchen, das noch nicht einmal sein eigenes Leben lenken kann.
Das Testament ist ein Wille über den Tod hinaus; im Letzten Willen spiegelt sich oft besonders klar der Impuls, der das abgeblühte Dasein bestimmte. Isabellas Leben stammte aus einer Gewißheit und mündete in eine Ordnung. Melancholien und Zweifel blieben immer am Rande. So ist ihr Testament ruhig und klar – wie ihr Herz unruhig und trübe ist: eine glatte Rechnung zwischen Einnahmen und Ausgaben, zwischen guten Werken und der Seligkeit. Binnen eines Jahres sind aus dem beweglichen Vermögen und aus den Renten des Königreichs Granada alle Schulden zu zahlen. Nach der Tilgung sind die Gelder auszuwerfen, die sie zur Ausstattung unbemittelter Mädchen, zur Aufnahme armer Jungfrauen in den Klöstern, zur Abhaltung von zwanzigtausend Messen in den Kirchen ihrer Reiche, zum Loskauf von zweihundert Gefangenen aus der Gewalt der Ungläubigen, zur Spendung von Almosen an die Kathedralkirche von Toledo und an die Kirche der Jungfrau zu Guadelupe ausgesetzt hat. Die Kreuzzugsgelder, die der Apostolische Stuhl zur Eroberung Granadas beigesteuert hatte, sind nicht ausschließlich jenem Zweck zugeführt worden; diese Erinnerung lastet schwer auf dem Gewissen der Sterbenden. Sie verfügt, drei Tage vor ihrem Tod, in einem angehängten Kodizill, daß innerhalb eines Jahres die zu Unrecht verbrauchten Summen zurückzuerstatten sind. In unregelmäßigen, kaum leserlichen Buchstaben steht unter dieser Verfügung die letzte Unterschrift der Königin Isabella.
Hohe Testamentschreiber sterben gern über ihre Verhältnisse. Sie fühlen sich angesichts der sogenannten Majestät des Todes zu einer gehobenen Sprache verpflichtet, die oft genug die Ärmlichkeit ihrer Einsichten und Ziele in das entkleidendste Licht setzt. Isabellas Testament unterscheidet sich nicht von den tausend Erlassen, die sie bei weniger großartiger Gelegenheit ergehen ließ. Saß sie nicht Freitag für Freitag mit ihren Beiständen zu Gericht im Alkazar von Sevilla? Wachte sie nicht eifersüchtig darüber, daß die Urteile ohne Ansehen der Person vollstreckt wurden? Daß es so bleibe! Noch einmal mahnt sie die Granden des Landes, sie mögen die Leute ihrer Ortschaften und Ländereien nicht hindern, beim königlichen Gericht ihr Recht zu suchen. Sie mahnt die Erben, wohlwollend und gerecht die Untertanen zu regieren – vor allem das Unrecht gutzumachen, das den Bewohnern der Inseln des Cristobal Colón zugefügt worden ist. Obwohl man die Kunde von den christlichen Räubereien in den unerlösten Ländern der Königin zu verschweigen suchte, war ihr also doch zu Ohren gekommen, daß sich ihre Christen dort drüben in Hängematten herumtragen ließen, um den Wilden das Evangelium der Ausbeutung mit der Peitsche einzubläuen. Ein letztes Wort gilt Ferdinand, dem geliebten Mann, mit dem sie glücklich war, seitdem das unerfahrene Mädchen gelernt hatte, schöne Hofdamen freigebig zu pensionieren und durch tugendhafte Matronen zu ersetzen. In Ferdinands geliebte Hände legte sie ihre Juwelen. Sie sollen, ihre Stellvertreter, ihm anvertrauen, was sie, die einst diese Perlen getragen, ihm nicht mehr sagen kann: Ich warte auf dich.
In Santa Isabella, dem Franziskanerkloster der Alhambra, wird sie beigesetzt, in eine grobe Kutte gehüllt. Der Leib wird nicht einbalsamiert; ihr Vertrauen zu Gottes Zauberkraft war stärker als der Augenschein, daß alles Vergängliche zu Staub wird. Das Grabgewölbe ist niedrig und ohne Prunk, nur durch eine schlichte Inschrift geziert. Wie sie verfügt hat, wird das Geld, das man bei diesem bescheidenen Begräbnis erspart, den Armen ausgezahlt. Testamentsvollstrecker sind: ihr Beichtvater; ihr Großschatzmeister; und Don Juan Velasquez de Cuellar, ein mächtiger Grande, der über weite Ländereien, hohe Ämter und zierliche Pagen verfügt.
Einer dieser kleinen Pagen heißt Inigo; er stammt vom baskischen Schloß Loyola.
Juana
Isabella liegt noch nicht zwei Jahre in der Franziskanergruft. Der schöne Philipp ist mit der verliebten Frau, die er an die Irrenärzte abzugeben sucht, unterwegs nach Vittoria; es heißt, französisches Kriegsvolk nähere sich der Grenze. Am elften Morgen seines Aufenthaltes in Burgos fühlt er sich sehr schlecht; er hat sich beim Ballspiel, das er leidenschaftlich liebt, erkältet. Den Tag bringt er auf der Jagd zu. Das Fieber steigt. Ein berühmter Mailänder Mediziner, ein Doktor aus der Stadt und der Hausarzt des Erzbischofs von Toledo kommen zu einem Konsilium zusammen. Doktor Yangas,. Leibarzt des Ximenes, ist für einen Aderlaß. Die beiden andern Herren sind dagegen. Einige Tage später ist Philipp – zubenannt der Schöne; achtundzwanzig Jahre alt; ein sorgloser und ehrgeiziger Erdenbürger; Sohn und Erbe Maximilians, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation; Schwiegersohn und Erbe Ferdinands des Katholischen und der verstorbenen Isabella; Gemahl einer liebestollen Frau – ein toter Mann.
Nach flämischer Sitte wird sein Leichnam in köstliche Gewänder gehüllt, auf einen Thron gesetzt und in einem Saal des Schlosses zur Schau gestellt. Zwei Chirurgen öffnen den Körper, nehmen die Eingeweide heraus, balsamieren die Haut ein, winden Tücher um den präparierten Rest und legen ihn in einen Bleikasten, der in einen Holzsarg gestellt wird. Im benachbarten Kloster zu Miraflores setzt man den Toten bei. Am Sonntag nach der Bestattung erscheint, vom Kardinal Ximenes geführt, die niederländische Suite des Verstorbenen vor der Witwe. Sie soll, dem Testament des Gatten zufolge, den Niederländern das Geld für die Heimreise bewilligen. Juana, die hinter vergitterten Fenster Audienz erteilt, ist abweisend: sie habe jetzt Wichtigeres zu tun, sie habe für ihren toten Gemahl zu beten. Am nächsten Tag finden sich in ihrem Palast einige Granden ein, die Mitglieder des Königlichen Rates und die obersten Behörden von Burgos. Der Kardinal wird vorgelassen. Er bittet die Königin um ihre Unterschrift auf dem Edikt, das die Cortes einberuft. Juana lehnt ab. Der Kardinal läßt nicht nach. Juana vertröstet ihn auf die Ankunft des Vaters. Also bittet man sie, einen Brief zu unterschreiben, der Ferdinand um schnellste Rückkehr von Neapel ersucht. Ihre Finger sind wie zusammengewachsen. Sie weicht aus: sie wolle ihrem Vater nicht lästig fallen. Was will Juana?
Im dämmrigen, vom langen Schweigen verwüsteten Gemach des Schlosses zu Burgos, das spitze Kinn auf die schmale, langfingrige Hand gestützt, das Auge blicklos, den kleinen Mund gewaltsam zusammengepreßt, als wäre Gefahr, daß er ein Geheimnis hinausließe – sitzt die Erbin Isabellas und kann nicht los von dem Leid, das sie nicht fassen kann. Sie hockt in einer niedrigen, engen Höhle, die ihr den Atem nimmt. Ein unaufhebbarer Druck erlaubt ihr nicht, zu seufzen, zu schluchzen, zu weinen, zu schreien, zu klagen und anzuklagen. Doch hat auch ihr Leid seine heimlichen, unterirdischen Worte; sie vergiften das Leben, weil das Leben Juana vergiftet hat. Wozu braucht Spanien zu sein, wenn der schöne Philipp nicht mehr ist? Es gibt keine Versöhnung mit Juana; nicht für Gott und nicht für ihr Land. Sie ist nicht unzugänglich für leise Linderungen. Sie läßt die Sänger kommen, die Philipp aus Flandern mitgebracht hat. Aber sie wehrt sich hart, wenn man sie verführen will, den vorgezeichneten Weg ohne ihn weiterzugehen.
Plötzlich schreckt sie aus ihrer Erschlaffung auf. Eine Quelle von Energie ist aufgebrochen. Ein Verdacht ist in ihr wach geworden: man will ihren schönen Philipp nach seiner flandrischen Heimat entführen; man stiehlt das Herz, das ihr gehört. Am Allerheiligenfeste muß der Bischof von Burgos die Särge öffnen. Der Prälat weigert sich, da kein Toter in den ersten sechs Monaten beunruhigt werden darf. Juana gibt nicht nach. Der päpstliche Nuntius, die Gesandten Maximilians und Ferdinands, vier Bischöfe begutachten die Leiche; sie bestätigen die Echtheit. Philipp ist also noch nicht entwendet worden. Leicht fährt sie mit kalter Hand den schon gestaltlosen Körper entlang. Ihr Gesicht bleibt ohne Regung. Ihre Augen sind trocken. Sie fühlt nicht mehr als den tauben Druck der dumpfen Höhle. Das Leid findet keinen Ausgang. Es hat sich gefangen.
Die Stunde naht, in der das Kind, das sie vom Toten trägt, reif für die Welt ist. Unerwartet gibt sie Befehl zum Aufbruch. Dort, wo die Mutter Isabella ruht, in Granada, soll auch der schöne Philipp liegen. In einer Dezembernacht, begleitet von den Bischöfen der Städte Jaen, Malaga und Mondonedo, fährt die Witwe Juana mit dem stummen Mann über Cavia nach Torquemada. Ein Wagen, den vier friesische Rosse ziehen, trägt den mit Gold und Seide bekleideten Sarg des Schönen über holprige Straßen. In der Stadtkirche wird der Tote abgestellt. Die Königin läßt ihn streng bewachen. Sie besitzt den Verstorbenen, wie sie nie den Lebenden besessen hat.
Als wäre er eben erst verschieden, läßt sie jeden Tag das Totenamt am Morgen und die Totenvesper halten. Seit der Abreise von Miraflores begleiten zwei Kartäuser, schwarze Kapuzenmäntel über weißen Kutten, die Leiche. Sie stärken die Witwe, nicht vom Toten zu lassen. Sie loben die tägliche Feier, die dem Tod sein Opfer entreißen wird. Er habe – berichtet der eine Mönch seiner gierig lauschenden Juana – von einem König gelesen, der vierzehn Jahre nach seinem letzten Tag auferstanden sei. Das ist endlich der Ausweg für die Frau, die sich nicht ergeben kann. Eine Zuversicht blüht in ihr auf, die sie nicht dem Leben verbindet, sondern nur noch einsamer macht. Die Höhle wird nicht gesprengt – sie wird licht und traulich. Kann Juana in Erwartung seiner Auferstehung sich von ihm trennen? Sie muß jetzt mit ihm zusammenbleiben, bis das Wunder geschieht: daß aus dem modernden Gerippe der herrlichste Jüngling wiederersteht. Sie gibt die Reise nach Granada auf.
Bald nach der Geburt ihres Mädchens bricht in Torqüemada die Pest aus. Juana weigert sich, die Stadt zu verlassen; sie hat einen Liebsten, mit dem man nur schwer reist. Erst nachdem eine ihrer Kammerdamen und acht Personen der Dienerschaft des Bischofs von Malaga gestorben sind, entschließt sie sich, ein kleines Stück weiterzufahren. Die Nacht ist stürmisch. Die Fackeln werden schwer vom Wind bedrängt. Scheu flackert ihr irres Licht über den Sarg des umgetriebenen Toten, über das fahle Antlitz der gehetzten Frau, über die Rüstungen der Ritter und die Kutten der Mönche. Im Kloster, das auf dem Wege liegt, will sie rasten; hier wird sie sich an seinem Anblick laben. In letzter Minute erfährt sie, daß in diesem Kloster Nonnen hausen. Sie geht nicht hinein; sie muß den schönen Philipp vor den Weibern schützen. Auf freiem Feld hält der Zug. Die Särge werden geöffnet. Schmale Lichter tanzen in den wachsgelben Gruben ihres welken Gesichts. Gierig stillt sie die Sehnsucht, die ihre eigenen Augen hat. Sie sieht im Sarg, in dem ein verwesendes Bündel Fleisch liegt, den schönen Philipp in alter Jugendfrische. Ein Sturm löscht die Lichter. Das königliche Gefolge steht stumm in schwarzer Nacht um die entrückte Herrin. Ist sie nicht noch zurückzuholen? Man drängt sie, nach Palencia zu gehen, dem Sitz des königlichen Rats. Sie erwidert: »Witwen ziemt es nicht, glänzende Städte und große Ortschaften aufzusuchen.«
König Ferdinand ist von Neapel zurückgekehrt. Seine Armada ist im Hafen von Valencia eingelaufen. Nachdem die Sonne untergegangen ist, bricht Juana mit dem toten Gatten, dem Kardinal und ihrem Hofstaat auf, den geliebten Vater in Tortoles zu treffen. Sie reist nur bei Nacht. Scheut sie sich, am hellen Tag an der Seite eines Sargs durch die Welt zu fahren? Unnahbar verkündet sie ihrer Umgebung: »Witwen, der Sonne ihres Lebens beraubt, dürfen sich nicht im strahlenden Licht den Blicken der Menschen preisgeben.« Sie haßt die Sonne, weil der schöne Philipp sie nicht mehr sehen kann. Sie erfüllt mit ihren nächtlichen Fahrten mehr als eine Schicklichkeit: die trotzig-starrsinnige Rache, die eine unversöhnliche Witwe am Gestirn des Lebens nimmt. Vater und Tochter treffen einander zeremoniell und aufgelöst. Juana beugt gemessen und tief das Knie zur Erde; höflich sucht sie, seine Hand zu küssen. Ferdinand, der auf dem Wege von Valencia hierher schon viele dunkle Mären hat raunen hören, überwindet seine Bewegung, indem er die Tochter in die Arme nimmt.
Ist sie in ihrem tiefen Kerker noch zu erreichen? Die Tränen sind versiegt. Die Riegel sind nicht zu lösen. Juana kann nicht mehr fort von ihrem Leid. Eine Vereinbarung über die Regierung des Landes ist bald getroffen. Die Königin ist mit jedem Vorschlag sofort einverstanden. Nur einer Bitte, einem Verlangen, einem Befehl setzt sie einen Widerstand entgegen, der nicht zu brechen ist: sie ist mit dem Schönen zum Rendezvous gekommen, sie wird nicht abreisen ohne ihn.
Juana verkommt, als wolle sie dem Liebsten im Sarg keinen Vorsprung lassen. Ihre Haare, ein Gemisch aus vielen Farblosigkeiten, sind unentwirrbar ineinandergeheddert. Ihr Gesicht zeigt täglich neue Risse und Sprünge; graue, schimmelige Kuppen und Spalte. Nachts schläft sie in einem unsauberen, zerknüllten Kleid auf dem nackten Boden ihres Zimmers; es wäre eine Lüge, wenn sie am Tage über die Wüste glatte, frische Stoffe breiten würde. Da gelingt es dem Vater, sie ein kleines Stück zurückzureißen; gerade so weit, daß sie am Rande des Abgrunds hindämmern kann.
Die Pflege des Körpers ist der letzte Halt für den fallenden Menschen. Sie läßt sich wieder die Haare kämmen und die Nägel schneiden. Sie schläft wieder in einem Bett und trägt wieder saubere Kleider. Der König von England wirbt um die junge Witwe, Königin Kastiliens, Erbin Ferdinands von Aragon. Die Königin Juana, meint der wagelustige Brite, könne keinen bessern Gatten finden als ihn, mag sie nun krank oder gesund sein; an seiner Seite werde sie schnell wieder zu Sinnen kommen. Die Gattin des Leichnams aber sitzt in ihrem Palast zu Tordesillas und sieht mit langen Blicken hinüber zum Kloster Santa Clara. Dort steht der Kasten, der ihren schönen Philipp birgt. Jetzt hat sie ihn ganz für sich. Von ihrem Fenster aus kann sie seinen Schlaf bewachen. Geschützt liegt er unter ihren wachsamen Augen. Und gewiß wird sich eines Tages, wenn sie nach Santa Clara hinüberblickt, der Deckel heben: dann schreitet der schöne Philipp in der unvergeßlichen Grazie seiner Jugend ihr entgegen.
Die wahnsinnige Juana glaubte, daß der Geliebte noch vor dem Jüngsten Gericht im Fleisch wiedererscheinen wird. Ihre vollsinnigen Untertanen glaubten, daß Jesus Christus, vor mehr als fünfzehnhundert Jahren, zwei Tage nach seinem Tode auferstanden ist. Einer dieser Untertanen war der kleine Page Inigo.
Germana
Die selige Isabella hatte dem geliebten Gatten ihre Juwelen übergeben, um ihn über die Kluft zwischen Leben und Tod zu täuschen. Doch Ferdinand war nicht von der Art seiner Tochter Juana: er hielt dem Leben die Untreue. Die Juwelen sagten ihm nichts; wenigstens nichts von dem, was Isabella ihnen aufgetragen hatte. Zehn Monate nach dem Tode der Königin verlobte er sich mit der blutjungen Nichte Ludwigs xn. Man rümpfte die Nase. Der Herzog von Najera schalt den Grafen von Cifuentes einen ehrlosen Kastilier, weil er sich zum Vermittler dieser schändlichen Verbindung habe mißbrauchen lassen; Isabella habe es nicht um ihn verdient, mit seiner Hilfe eine so unwürdige Nachfolgerin zu erhalten.
Im Hafen von Valencia lief eine Flotte ein, die auf dreißig Schiffen Schuhe, Kleider, Hauben, Wäsche, Parfums und Schönheitsmittel der Französin anfuhr. An der spanischen Grenze wurde die königliche Braut von einem illegitimen Sohn Ferdinands, dem Erzbischof von Saragossa, begrüßt. In Duena, wo er vor dreißig Jahren mit Isabella den Bund fürs Leben geschlossen hatte, nahm der nicht sehr zartfühlende Witwer die kleine, lebenslustige Französin in Empfang; sie war achtzehn, er dreiundfünfzig. Sie hatte, wie seine Isabella vor dreißig Jahren, blaue Augen und kastanienfarbene Haare. Die weiße Atlasrobe machte ihre Zierlichkeit noch zierlicher. Die Franzosen nannten sie Germaine, die Spanier Germana.
Beim prunkvollen Einzug des schönen Philipp und der tollen Juana in Toledo trugen einst die Majestäten Ferdinand und Isabella so bescheidene Wollkleider, daß ein enttäuschter Berichterstatter es ablehnte, die königlichen Gewänder zu beschreiben. Der sparsame Ferdinand pflegte prahlend sein Wams zu rühmen: »Das ist ein trefflicher Stoff; er hat schon drei Paar Ärmel ausgehalten.« Und Isabellas Kardinal trug sein fleckiges Purpurkleid wie eine armselige Mönchskutte. Diese Zeiten waren vorbei. Die, welche säen, sind selten die, welche ernten. Unter der schlichten Isabella war Spanien in Nöten auf die Welt gekommen, arm und anständig herangewachsen, sehr groß geworden. Germana, erzogen am schwelgerischen Hof des königlichen Onkels, genoß unbekümmert, was die bescheidene Isabella aufgehäuft hatte. Die Mahlzeiten kosteten jetzt das Zehnfache. Für den verwöhnten Gaumen der jungen Herrin mußten aus Sevilla die seltensten und erlesensten Fische und Vögel nach der Sommerresidenz Arevalo geschafft werden. Die königlichen Köche waren verzweifelt: die Speisen, auf welche die Feinschmeckerin Appetit hatte, waren selbst im katalanischen Hofkochbuch des Roberto de Nola, weiland Küchenchef des serenissimo señor Rey Don Hernando de Nápoles, nicht vorgesehen. Auch unter Isabella, der Mäßigen, hatten gewiß nicht alle Kastilier nur zu Ehren Gottes gegessen und getrunken; aber erst jetzt hatte die Freß- und Sauflust ihre großen Tage. Bisweilen übernahmen sich einige unroutinierte Teilnehmer der üppigen Gelage bis auf den Tod.
Die Tugend des Dieners ist Treue bis zur Sterbestunde des Herrn – und Untreue nach seinem Tod, auf daß der Diener einem neuen Herrn treu sein kann. Die Frau des Gouverneurs von Arevalo, des Granden Don Juan Velasquez de Cuellar, hatte, treue Dienerin der Isabella, den weiblichen Putz verachtet, die kokette Konversation vermieden, Gott gelobt und andächtig den Hymnen der Chorsänger gelauscht. Jetzt genoß sie, in neuer Treue, reizvoll-unbekannte Gerichte und leichtfertige französische Madrigale. Donna Maria war eine große Dame: schön und klug, trefflich als Gattin, gut als Mutter – und immer der zuverlässige Schatten ihrer Herrin: erst der strengen Isabella, die Gott liebte; dann der lockeren Germaine, die gern über den Durst trank. Donna Maria und Königin Germana wurden intime Freundinnen.
Unter den Pagen, die neben dem Tisch des Großschatzmeisters der Katholischen Könige, des Gouverneurs der Festungen Arevalo und Madrigal, knieten, um der neuen Königin die goldenen Platten und den perlenbesetzten burgundischen Hofbecher zu reichen – unter den Pagen, die der königlichen Herrin, wenn sie fortging, mit der Kerze voranleuchteten oder den Mantel nachtrugen, war der Knabe Inigo. Er war nicht sehr groß, doch muskulös und elastisch. Er hatte eine offene, hochgewölbte Stirn und eine leicht gekrümmte Adlernase im scharfgeschnittenen olivenfarbenen Gesicht; die weiße Halskrause gab dem jungenhaften Antlitz einen feierlichen Abschluß. Inigo steckte in der weiblich-zärtlichen Uniform der Pagen: in einem samtenen Wams mit Schlitzärmeln, aus denen der Purpur des Futters herausleuchtete, in Seidenstrümpfen und in Schnallenschuhen; der Degen an seiner Seite war Spiel und Ernst in eins. Mit sieben Jahren war er in das Haus der Donna Maria, einer Verwandten der Mutter, gekommen. Hier in Arevalo hatte er, wie es sich für einen Abkömmling derer von Onaz und Loyola ziemt, die Umgangsformen des Hofs erlernt; nebenbei hatten ihm die benachbarten Dominikaner im großen Bibliothekssaal, wo an lederbespannten Wänden in langer Reihe die Rüstungen der früheren Gouverneure standen, das Lesen, das Schreiben und die Lehre des Katechismus beigebracht. Zum höheren Ruhme seines vornehmen und reichen, gebildeten und freigebigen Herrn, den die selige Isabella besonders bedacht und zum Vollstrecker des Testaments eingesetzt hatte, paradierte nun Inigo im Kreise der Kameraden, wenn eine festliche Schaustellung die Macht des Hauses Cuellar offenbaren sollte; oder wenn der Mächtige mit stattlichem Troß zu Hofe ritt, um mit seinem Glanz den Glanz eines noch Mächtigeren zu erhöhen.
Die Diener der Diener erleben die Herren nur mittelbar, erst aus größerer Entfernung; aber auch diese Entfernten müssen alle Schwenkungen mitmachen, wenn auch in weniger hartem Bogen. Die Pagen von Arevalo waren gewiß nicht bös, als mit dem Tod der strengen Isabella die Zucht gelockert wurde; Inigo von Loyola war dreizehn, als die Königin in die Franziskanergruft übersiedelte. Am fernen Horizont seiner jugendlichen Welt hatte sich das große Sterben im Königshause abgespielt; am fernen Horizont saß, fremd und gespenstisch, Juana, die so wahnsinnig war, treu zu sein. Im Mittelpunkt aber thronte Isabellas Nachfolgerin, die schöne und lustige Germana. Als Page Inigo zum Ritter von Loyola geschlagen wurde, erkor er sich die reizende Französin zur ›Herzensdame‹. Rotgelbrot waren ihre Farben. Wenn sie von der Balustrade ihres Balkons, die mit Samt ausgeschlagen war, eine Rose oder gar ein Spitzentuch dem knabenhaften Ritter in die Reitbahn warf, dann grüßte er mit Stolz zurück: rotgelbrot. Daß er nur nicht den Kopf zu entblößen vergißt, wenn er ihr begegnet! Nach dem Brevier des Minnedienstes wäre dieser Verstoß gegen das Herkommen ein Zeichen verwirrtester Verliebtheit.
Und Inigo ist verliebt. Nicht weniger als sein Intimus Amadis, der natürliche Sohn des Königs Perion de Gaula und der Prinzessin Elisena von Kleinbritannien. Was der Amadis seines Lieblingsromans für Oriana gefühlt hat, Tochter des Königs Lisuarte von Großbritannien, empfindet jetzt Inigo für die Dame Germana, Gattin seines Herrn und Königs. Amadis, Held aller Pagen und aller Ritter, Sehnsucht aller Hofdamen und aller unerlöster Prinzessinnen, ist auch sein großes Vorbild. Zu fünfzehn zog der ›Ritter vom grünen Schwert‹ hinaus in die gefährliche Romanwelt, kämpfte gegen Zauberer, Riesen und Zwerge; und bestand alle tausend Gefahren ebenso heldenhaft wie erfolgreich, zum höheren Ruhme der Frau Oriana, die ihm dann auch als Siegespreis zuteil wurde. Sollte er, Don Inigo Lopez de Recalde von Onaz und Loyola, nicht in den Fußstapfen des Amadis zu jener strahlenden Höhe gelangen, auf der seines Königs Gattin majestätisch und lockend thront? Die Germana erträumt er sich in den vielen Stunden, in denen er aus dem weiten Park von Arevalo in die Zukunft fliegt. In anderen, weniger poetischen Zeiten steigt dann der recht hinterlistige und gewalttätige Jüngling Frauen nach, auf die er nicht so lange zu warten braucht, wie sein Amadis auf die Oriana warten mußte. Doch auch für diese unromantischen Abenteuer gibt es vorzügliche Anweisungen in der Ritterbibel. Der Bruder Galaor ist der verwegene Schürzenjäger neben dem treuen Helden, den nicht einmal die süße Briolanja seinem Mädchen abspenstig machen kann. Und der lüsterne Inigo folgt nicht selten dem Bruder Galaor. Keck und herausfordernd strömt das lang herabfallende Haar unter der kleinen samtenen Mütze hervor.
Der Gouverneur von Arevalo gehörte zur Partei jener Männer, die zu verhindern suchten, daß Habsburg in Spanien zur Regierung kommt. Wird es dem alten Ferdinand noch gelingen, mit der jungen Germana den Erben zu machen? Dann ist Karl, Sohn Juanas und des schönen Philipp, Enkel der Isabella und des Ferdinand, um einen Teil der Erbschaft betrogen. Man muß der Natur etwas zu Hilfe kommen, dachten die Habsburg-Gegner. Germana und ihre Freundin Donna Maria brauten dem lendenlahmen König einen kräftigen Liebestrank; vielleicht verjüngt er den alternden Mann. Doch das Elixier schlug nicht an – oder doch nur so, daß Ferdinand bis an sein seliges Ende mehrere Hirsche hintereinander mit der Armbrust erlegte. Am Hofe raunte und spottete man über den fruchtlosen Zauber. Der König, in den Sechzigern, war schon recht hinfällig; er lebte über seine Kraft. Der eifersüchtige Greis ließ die junge Frau nicht von der Seite. Auch betrieb er die Jagd, jedem Wetter zum Trotz, mit einer Leidenschaft, die selbst einem Jüngling übel bekommen wäre. Zwölf Jahre wartete Isabella in der Franziskanergruft, als auf dem Weg von Madrid nach Sevilla Ferdinands Zustand bedenklich wurde. Bald war er mit ihr wieder vereint – nachdem er die Zeit der Trennung angenehm verbracht hatte.
Diesmal ging auf Arevalo der Umsatz einer alten Treue in eine neue nicht so glatt vonstatten. Man war Ferdinand zu treu gewesen, als man ihm den Liebestrank gegen Habsburg gemischt hatte. Diener sollen nicht Politik treiben. Die Proklamierung des Habsburgers Karl zum spanischen König war das Ende des Habsburg-Gegners von Arevalo. Gegen alle uralten, wohlverbrieften Abmachungen forderten die neuen Herren dem alten Knecht seine Festungen ab. Don Juan trotzte. Er erinnerte sich, was einst seine Ahnen den Königen am Tage der Huldigung zuzurufen pflegten: »Wir, von denen jeder ebenso viel gilt wie du, und die wir zusammen mehr gelten als du …« Er ergab sich nicht. Er versammelte seine Verwandten, seine Freunde, seine Hintersassen in der Festung. Er ließ Schanzen aufwerfen und Artillerie anfahren. Der Kardinal Ximenes, in Karls Abwesenheit Regent von Spanien, ein Freund des Rebellen, suchte vergeblich zu vermitteln. Die aufrührerische Festung wurde von königlichen Truppen belagert. Auf beiden Seiten floß Blut. Der Gouverneur mußte kapitulieren. Er hatte verspielt. Es rächt sich immer, die Ahnen zu beschwören.
Wenn Diener in Ungnade fallen, so fallen auch ihre Diener in Ungnade – und die Diener ihrer Diener. Denn es gibt immer zu wenig Platz auf der Welt; und jeder neue Herr braucht viel Raum für einen neuen Troß. Was ging eigentlich den kräftigen jungen Ritter Inigo die Impotenz seines königlichen Herrn Ferdinand an? Doch der Mensch erntet das Gute und das Schlechte, das er nicht gesät hat; und was er sät, ernten ferne, späte Menschen, von denen er nichts weiß. Nach diesem ehernen Gesetz der Ungerechtigkeit verlor Inigo von Loyola seine Chancen am kastilischen Hof. Die entthronte Gouverneurin gab ihm zwei Pferde ihres Marstalls und fünfhundert Dukaten auf seinen Lebensweg.
Der Schuß von Pamplona
In seinem fünfundzwanzigsten Lebensjahr wird der Ritter von Loyola Offizier der Leibwache des Don Antonio Manrique, Herzog von Najera, seit kurzem Vizekönig der spanischen Nord-Provinz Navarra. Der Herr von Najera ist ein mächtiger Beamter seines königlichen Herrn Karl. Der Vasall kann aus seinen Hintersassen ein stattliches Heer aufstellen: siebenhundert Reiter und dreitausend Fußgänger, die er auf eigene Kosten rüstet und verpflegt. Der Herr von Loyola, im Dienst eines solchen Manns, ist nicht herabgestiegen.
Das Schicksal des Untertanen ist nicht nur von seinen Herren abhängig; auch noch von den Herren der Nachbarn. Als der junge baskische Offizier in das spanisch-französische Grenz- und Streitgebiet Navarra kam, war der siebzehnjährige Karl seit einem Jahr König von Spanien; der dreiundzwanzigjährige Franz seit zwei Jahren König von Frankreich. Die beiden jungen königlichen Herren kannten einander nicht. Ihre Naturen harmonierten ebenso wenig wie ihre Interessen. Franz, Nachfolger des zwölften Ludwig, bis zum Tage der Thronbesteigung immer nur Anwärter auf den Thron, nicht geborener Kronprinz, deshalb mehr mit den Annehmlichkeiten als mit den Lasten eines Thronfolgers aufgewachsen, von Mutter Luise und Schwester Margarete als kommender Cäsar verhätschelt, von Natur ein vergnügter Gast dieses Sterns, hat eine recht amüsante Jugend hinter sich: mit fünfzehn machte er eine Attacke auf eine reizende Jungfrau der Schloßdienerschaft; mit neunzehn stieg er nächtens bei einer Pariser Advokatsgattin ein, während der Mann im Nebenraum schlief; und als der alte, kinderlose Ludwig, dessen Thron Franz erben sollte, die junge Schwester Heinrichs VIII, heiratete, hätte der immer verliebte Prinz fast ihr ein Kind, dem Ludwig einen Erben und sich einen siegreichen Konkurrenten gemacht. Franz liebt die Mädchen aus dem Volk, die Bürgersgattinnen und die Damen von höchstem Adel mit gleicher Zärtlichkeit. Er will ihre Gegenwart nicht entbehren: »Une cour sans femmes c’est une année sans printemps ou un printemps sans roses.« So gibt er dem Hof, der die Frau nur als Statistin im Zeremoniell und als lüsterne Episode kannte, seinen Frühling und seine Rosen. Franz ist der erste Genießer seines Staats. Wozu ist er König? Seine Lebenslust läßt sich durch keine Etikette dämmen. Da hat er mit Heinrich VIII. ein höchst seriöses Rendezvous. Morgens, in aller Herrgottsfrühe, reitet der König von Frankreich zur Wohnung des englischen Kollegen. Mit derbem Rippenstoß weckt er den Heinrich. Der Engländer ist sehr befremdet. »Ich will«, kündigt Franz ihm strahlend an, »daß Sie an diesem Morgen keinen andern Kammerdiener haben als mich.« Franz ist ein kapriziöser Regent, kein erhabener Herrscher; er nimmt sich ohne Heuchelei, was für ihn aufgehäuft ist. Schon in den ersten Tagen seiner Regierung brachte er das Edikt heraus: er wünsche nicht, durch lästige Regierungsverpflichtungen um das Vergnügen der Jagd gebracht zu werden.
Der siebzehnjährige Karl – gewachsen in der Luft des konservativen, autokratischen Burgunder Hofs; unter der strengen Obhut einer Tante; fern dem Land, dessen Sprache er nicht sprechen kann, das er aber einmal regieren soll – ist ein greisenhafter und verschlossener junger Herr von schwächlicher Konstitution: unselbständig und geizig. Er begreift schwer. Seine Worte sind schleppend. Seine Bewegungen sind bedächtig. Sein Wahlspruch heißt ›Nondum‹ – Noch nicht! Unter dem rötlichen Haar und den melancholischen Augen tritt der Unterkiefer mächtig hervor. Wirkt in ihm der Ernst von Großmutter Isabella nach? Oder die lebensfeindliche Konsequenz der Mutter Juana? Karl ist das düstere Pendant zum sonnigen Franz – und sein furchtbarster europäischer Nebenbuhler. Denn diesem blassen, gebeugten Kind sind viele Reiche aufgeladen worden: von den Eltern siebzehn niederländische Provinzen und die Franche-Comté; von Großvater Ferdinand und Großmutter Isabella die Pyrenäenhalbinsel (außer Portugal), Neapel, Sizilien, Sardinien und die Neue Welt, deren Grenzen noch nicht abzusehen sind; von Großvater Maximilian die deutschen Besitzungen der Habsburger und die Anwartschaft auf die deutsche Kaiserkrone.
Ob die Naturen der Herrscher zusammenstimmen oder nicht, ist nur von Bedeutung, wenn ihre Interessen nicht zu sehr gegeneinander sind. Die Erbfeinde Frankreich und Spanien – und welche Nachbarn sind keine Erbfeinde?! – hatten noch niemals so viel Reibungsflächen wie in dem Augenblick, da Karl zur Regierung kam. Als König von Spanien war er an den Pyrenäen, als Herzog von Burgund im Osten Nachbar der Franzosen. Als Erbe der Habsburger war er Frankreichs größter Nebenbuhler in Oberitalien. Die Diplomaten versuchten schon lange die Rivalität der Nachbarn mit der berühmtesten Medizin dieser Jahrhunderte zu kurieren; durch Heiraten den Zwist der Interessen beizulegen. Zuerst war der Knabe Karl mit Claudia verlobt worden, Tochter Ludwigs xn. Dann hatte sich der noch nicht Siebzehnjährige verpflichtet, später einmal das kaum einjährige Luischen des Königs Franz zu heiraten. Und als die kleine Braut mit drei Jahren starb, verlobte sich der fast neunzehnjährige Monarch mit Luischens jüngerer Schwester Charlotte. Doch alle Verlobungen waren ohne Erfolg. Und die Vorgefechte fanden jetzt auf dem Felde statt, auf dem der baskische Offizier von Loyola dem Vizekönig von Navarra als Gardeoffizier diente.
Das kleine Pyrenäenländchen, am Meerbusen von Biscaya gelegen, war noch immer seinem alten König treu, der ein Jahrfünft vor der Ankunft des Offiziers Loyola von den Spaniern vertrieben worden war. Dieser Exkönig von Navarra hatte sich mit seinem Schicksal nicht zufriedengegeben; er hatte noch einmal sein Glück versucht. Am Ronceval-Paß waren ihm die Spanier entgegengetreten, hatten sein Heer besiegt, seine Festungen geschleift und einen Vizekönig eingesetzt, Loyolas Chef. Doch die Rebellion schwelte in der eroberten Provinz fort. Navarras Nachbar, Frankreich, hatte ein Interesse an der Unabhängigkeit des Grenzlands. Als Karl Spaniens Thron bestieg, verpflichtete er sich, binnen acht Monaten den König ohne Land zufriedenzustellen. Wieviel Verpflichtungen vernachlässigte der junge Regent in diesen Jahren, in denen er meist fern dem Land war, das er geerbt hatte! In Spanien gärte es. Adel und Städte rebellierten. Franz hielt die Zeit für gekommen, dem mächtigen Nebenbuhler einen Fuß zu stellen. So schrieb er an den Exkönig von Navarra: »Lieber Cousin, die Stunde ist da, in der Sie sich Ihr Reich zurücknehmen können. Von mir erwarten Sie alle Hilfe, die ich Ihnen nur geben kann.« Und er stellte dem lieben Cousin Truppen aus der Gascogne zur Verfügung.
Der Offizier von Loyola diente im vierten Jahr auf diesem vulkanischen Boden, als sich jenseits der Grenze, in Bordeaux und Toulouse, französische Truppen zum Vormarsch sammelten. Schon im Winter hatte der Gegner Mannschaften konzentriert, Munition und Lebensmittel aufgehäuft. Frankreichs Agenten hatten Fühlung genommen mit den revolutionären spanischen Bürgern. Als sich die Franzosen im Frühjahr in Bewegung setzten, war zwar in Spanien schon wieder Ruhe; doch die Grenze war von Truppen fast entblößt. Außer einigen schwachen Garnisonen verfügte Loyolas Chef nur über zweihundertfünfzig Mann Infanterie und dreißig Züge Lanzenreiter, der Zug zu vier Mann. Der Feind rückte gegen diesen armseligen Haufen mit zwölftausend Infanteristen, achthundert Zügen Lanzenreitern und neunundzwanzig Geschützen an. Niemand stellte sich ihm in den Weg. Leicht fielen ihm die Festungen zu. Das Land jubelte dem alten Herrscher entgegen. Die kastilischen Behörden wurden vertrieben.
Am neunzehnten Mai ist die Vorhut des französischen Heeres in Pamplona. Die Einwohner reißen die spanischen Wappen herunter und plündern den verwaisten Palast. Der Rat kann nicht schnell genug die Schlüssel übergeben. Die kleine Garnison muß sich in die Festung einschließen. Kann sie den überlegenen Gegner aufhalten? Die Bastionen sind unfertig. Es fehlt an Kanonen, an Munition, an Lebensmitteln. Der französische Oberst richtet an den Kommandanten die Aufforderung, sich zu ergeben. Don Francisco Herrera lehnt ab. Der französische Generalissimus, der sich bereits Vizekönig von Navarra nennt, trifft ein. Er ladet Herrera zu einer Unterredung. Der bringt drei Offiziere mit. Inigo von Loyola ist der jüngste.
Fast fünf lange Jahre hat er nun auf dem öden, kahlen Felsplateau vor den Toren der Stadt exerzieren lassen. Immer dieselben Kommandos des Offiziers; immer dieselben Bemühungen der baskischen Bauernjungen, Maschinen zu werden. Lang ist es her, daß er, geziert mit verführerischem Federschmuck und goldenen Armketten, den Gegner mit einem gewandten Stoß der stumpfen Lanze aus dem Sattel hob. Keine Germana sieht mehr zu, unter deren Blicken die Muskeln straffer, die Augen leuchtender wurden. Jetzt ist er dreißig. Das also ist das Leben: tägliches Einschleifen von Automaten in störrische Körper. Im letzten Jahr gab es einige kleine Abwechslungen: die rebellische Stadt Najera sollte erobert werden. Er war schon bereit gewesen, an der Spitze seiner Kompanie, den langen Degen in der Faust, über die alte siebenbogige Brücke gegen den Feind vorzustürmen. Aber dann hatten sich die Feiglinge in letzter Minute ergeben. Als erster war er in die unterworfene Stadt eingedrungen – um die Einwohner gegen Marodeure zu schützen. Das war nicht gerade der Ruhm des Amadis. Das war mehr die Heldentat eines braven Polizisten … Dem Vizekönig war Inigos Geschicklichkeit im Umgang mit Menschen aufgefallen. Er hatte ihn in diplomatischer Mission verwandt: der junge Offizier hatte erfolgreich zwischen den streitbaren Adelsparteien seiner Heimatprovinz Guipuzoa vermittelt. Doch auch das war nicht der Ruhm des Amadis. Das war die Lehrlingsarbeit eines angehenden Diplomaten! Führen solche Aufgaben zur Laufbahn eines Helden? Ach, der Amadis von Pamplona ist nur ein kleiner Garnisonoffizier, der sofort den Säbel zieht, wenn ihn harmlose Maultiertreiber auf den engen Gassen des Städtchens an die Wand drücken. Diese Bauernjungen sind die einzigen Riesen und Zauberer, die ihm das Schicksal gönnt.
Der französische Generalissimus kann es sich ersparen, die militärische Lage ausführlich auseinanderzusetzen. Jeder Krämer kennt sie genau. Der spanische Kommandant ist mürbe. Seine Festung ist nicht zu halten. Er kann nicht mehr erreichen als freien Abzug der Garnison. Der Offizier Inigo von Loyola hat schweigend dem langen Markten beigewohnt, dessen Resultat von Anfang an vorauszusehen war, da, von Anfang an, der eine schon alles gewonnen, der andere schon alles verloren hatte. Plötzlich spürt er: die Szene wartet auf dich, auf den Hauptdarsteller, auf den Heldenspieler. Er verwandelt sich schnell. Er erkennt im französischen Partner den Riesen, der aus dem dichten Urwald hervortritt – und ihm, Inigo von Loyola, ist es bestimmt, ohne Rüstung gegen den Mächtigen anzureiten. Nun schnellt er von seinem Sitz hoch, nun ist er Mittelpunkt des großen Theaters. Alle uralten Worte strömen ihm zu, die schon die Amme dem gedankenlosen Hidalgo zugesungen hat. Die Flamme brennt – ohne Sinn, ohne Ziel. Was brauchen Flammende eine Vernunft, einen Sinn, ein Ziel? Der feurige Inigo ist verzückt, weil er endlich den monotonen Garnisontag heldisch durchbrechen kann. Lieber in den sicheren Tod als schmählicher Verrat! Wen wollen Sie denn nicht verraten, Herr von Loyola? Den Kaiser Karl – von Fuggers Gnaden, der Sie aus Ihrer Bahn geworfen hat? Der im fernen Deutschland, in Worms, seinen ersten Reichstag eröffnet und nicht nur von Ihnen nichts weiß, sondern vielleicht auch nichts von Ihrem Chef und von Ihrem ganzen Krieg? Es gibt nur einen Verrat für den Soldaten: vernünftig zu denken; dem Götzen Gehorsam den blinden und lahmen Kadaver zu verweigern. Kein Anwesender machte sich dieses Verrats schuldig. Nun, da ein Begeisterter die alten Gespenster in ihnen weckte, brannten sie alle, vom Chef bis zum Jüngsten, lichterloh. Der Jüngste, Inigo, riß seine Kameraden mit: nicht durch die Vernunft seiner Rede, die sie überzeugte, sondern durch die Glut seiner Unvernunft, die allen vorsintflutlichen Aberglauben in ihnen freimachte.
Der spanische Kommandant gab Befehl, die Kanonen gegen die abtrünnige Stadt zu richten. Der Offizier von Loyola beichtete einem Kriegskameraden. Die Franzosen eröffneten eine Kanonade, die sechs Stunden dauerte. In einer Bresche der zerschossenen Festung wurde, kurz bevor der Sturmangriff begann, der Jünger des Amadis, Inigo von Loyola, von einer feindlichen Kugel getroffen. Sie zerschmetterte den Unterschenkel des rechten Beins und riß die Wade des linken auf.
Verwandlung eines Ritters in einen Pilger
Im Schloß zu den zwei Wölfen
In der Stadt Rom, in der Kirche del Gesù, ist das Brustbild eines Ritters aufbewahrt: eines ernsten Dreißigers mit dunklem, etwas hängendem Schnurrbart. Das kurzgeschorene Kopfhaar ist in kleinen, engen Bogen ein Stückchen die hohe Stirn hinuntergewachsen. Das ovale, sehr strenge Gesicht wird von einer langen, kräftig gebogenen Nase mit starken Flügeln beherrscht. Beteuernd legt der Ritter seine Rechte auf die gepanzerte Brust, während die Linke etwas kokett – oder durch den gewaltigen Eisenärmel behindert – eine dünne Lanze anrührt. Man weiß nicht, was er beteuert; doch man glaubt ihm.
Dieser junge Offizier lag in seinem Blut, als die Franzosen nach erfolgreichem Sturm die Bastion nahmen. Sie brachten den Schwerverwundeten in die Stadt und sorgten für ihn; zwei Wochen später ließen sie ihn in einer Sänfte über den Paß Alsasua in die nahe Heimat tragen. Die Reise – bergauf, bergab, über Steinhänge, über zerweichte Straßen – bereitete ihm große Schmerzen. Doch wieviel schöner ist das baskische Bergland als die kastilische Wüste, die er an der Seite des Gouverneurs von Arevalo oft durchstreift hat: eine endlose, baumlose Ebene; staubige Stoppelfelder; ausgedörrte Heiden; todeinsame graue Tonmergelhügel. Mit großer Vorsicht tragen sie den Zerbrochenen über die Erde seiner Ahnen, über ein zerrissenes Land. Sie durchschreiten Täler des Schweigens: lange schwarze Eingänge in die Unterwelt; enge, abschüssige, beklemmende Vorhallen der ewigen Nacht. Und dann breiten sich zwischen verwitterten, rissigen Steinwänden üppige Mais- und Rübenfelder aus, sattgrüne Weiden mit wohlgenährten gelben Rindern. Durch dichte Alleen von Edelkastanien, von Eichen- und Buchenwäldern kommt der kleine Zug immer näher dem Fleck, auf dem Inigo einst geboren wurde. Aus grünen Hängen leuchten weiße Wohnkästen heraus. An greisenhaft kahlen Bergen kleben altersgraue Menschennester. Winzige Karren, auf zwei hohen Rädern schaukelnd, knarren und knurren und knirschen mitleiderregend vorbei. Die Köpfe eng aneinander unter das Joch gezwängt, ziehen Ochsen, von einem dicken Schaffell mit zwei großen roten Troddeln geziert, in schwerem Steigeschritt die winzige Last. Blondhaarige, blauäugige, spitzgesichtige Basken mit breiter, kugliger Stirn und behenden Gebärden muntern sie vergeblich auf.
Man ist im Herzen des Ländchens. Hohe Berge stehen um eine warme und fruchtbare Mulde. Am rechten Ufer des Flüßchens Urola, auf einem Hügel, ist ein kräftiges viereckiges Kastell postiert. Sein Untergeschoß, das über die halbe Höhe hinaufreicht, aus rohen Steinquadern gefügt, ist hochbejahrt; aus jenem Heldenzeitalter, da in jeder dieser Burgen ein König saß. Auf das mächtige Monument der Vergangenheit sind dann zwei jüngere und niedrigere Stockwerke gesetzt worden: ein moderner Ziegelbau mit traulichen Fenstern, gefälligen Ornamenten und vier runden, stumpfen, fensterlosen Türmchen – zierlich erkerhaften Ausbauten, die das flache Dach tragen. Der stolze, drohende und warnende Turm der Vergangenheit hat sich zu vier Ziertürmchen, die sich nicht hoch hinauswagen, verniedlicht: auf dem Leib eines Riesen sitzt der Kopf eines Höflings. Doch der Riese ist noch nicht vergessen. An ihn erinnert das rohe steinerne Relief über dem schmächtigen gotischen Portal – das Wappen derer von Onaz und Loyola: zwei hoch auf den Hinterbeinen aufgerichtete Wölfe schauen mit gierig ausgereckter Zunge in einen Kessel, der an langer Kette herabhängt. Unter diesem Sinnbild seiner Ahnen betreten die Träger der Sänfte das Schloß. Sie tragen den jüngsten Sohn des Hauses in den obersten Stock und betten ihn unter einem seidenen Betthimmel mit silbernen Fransen.
Bruder Martin, seit des Vaters Tod Oberhaupt der Familie, rief die Chirurgen und Wundärzte der Umgebung zum Consilium zusammen. Sie tasteten ab und drückten und kneteten und berieten und verkündeten: in Pamplona hat man die Splitter schlecht zusammengefügt, vielleicht sind sie auch durch die Erschütterungen des Transports in Unordnung geraten; der Knochen muß noch einmal gebrochen und neu gerichtet werden. Als Soldat, der von Beruf mutig ist, gab der Patient keinen Laut von sich; stumm wölbte er die Hand zur Faust. Die Stücke heilten abermals zusammen. Und dann stellte sich abermals heraus, daß die Chirurgen ein Partikelchen dem Mosaik nicht ordnungsgemäß eingefügt hatten. Das rechte Bein war zu kurz; unter dem Knie ragte ein häßlicher Höcker hervor. Die Ärzte erklärten offen, ein Absägen des Auswuchses würde noch schmerzhafter sein als der erste Eingriff. Doch gibt es Schmerzhafteres als die Vorstellung, nie wieder das schlanke Bein mit dem Kniestiefel aus feinem Leder den Blicken der Verehrerinnen präsentieren zu können? Die Instrumente der Knochenbrecher schreckten den Helden von Pamplona nicht. Er lag unter der Säge des Operateurs mit dem Gleichmut des Indianers am Marterpfahl. Die letzte Tortur war dann schließlich eine Maschine, die das verkürzte Bein zwingen wollte, eine kleine Spanne nachzugeben. Aber es gab nicht nach.
Also kämpfte der jüngste Herr von Loyola im Schloß zu den zwei Wölfen mit den Marterinstrumenten seiner Zeit um die verlorene Zukunft. Reglos lag das Opfer der Ruhmsucht und der Chirurgie im Streckbett des einsamen Schloßzimmers. Der strahlende Panzer war vom Körper gefallen; und wie immer das Gewand mit der Seele, die es deckt, zusammengewachsen ist, so riß der Eisen-Anzug ein ganzes Menschenleben mit sich. Noch wehrte sich allerdings der junge Edelmann gegen sein Schicksal. Noch geisterte die süße Vergangenheit durch die Phantasien des verkrüppelten Troubadours. Wenn er nur erst wieder seine schönen Waden zeigen wird! Lockend neigt sich die königliche Frau ihm zu. In verliebtem Paradeschritt stolziert er – ein Häufchen zuckendes Fleisch im Krankenbett – vor der Dame seines Ehrgeizes und seines Herzens. Mit dem Schmelz des werbenden Jünglings und der Gewandtheit des Hidalgos, der in der Schule des kastilischen Hofes geschmeidigt ist, wirft er ihr blumenhaft zierliche Wortbälle zu. Wohlig spürt er die federgeschmückte Mütze auf dem lockigen Haupt. Die enganliegenden Hosen, die Kniestiefel über den wohlgeformten Beinen jagen ihm heiße Ströme ins Herz. Elegant galoppiert er über die Bahn: bald zieht er die Beine an, bald streckt er sie von sich – wie die große Kunst es will. Ringe, Hutfedern, Handschuhe regnen aus dem Füllhorn der Feen auf ihn nieder. Bis plötzlich, vor einer ungeschicktschmerzhaften Bewegung des geschienten Knochens, Amadis und Germana im Dämmer des stillen Urola-Tals als weite, wachsende Schatten zergehen.
Die Kugel von Pamplona hat ihn aus einem Paradies vertrieben. Welcher Vertriebene erinnert sich auch an die Öde der verschwundenen Herrlichkeit! Inigo weiß nichts mehr von dem langweiligen Kasernendienst; von den Jahren der Ausweglosigkeit, der er nun entronnen ist. Die Katastrophe verklärt die Dürftigkeit, die sie vernichtet hat: ein stolzer Lebensstrom, dem es bestimmt war, in das herrlichste Märchen einzumünden – hat im Krankenbett des Schlosses Loyola eine nackte, schlechtoperierte, von Schmerzen gepeinigte und gelangweilte Hilflosigkeit stranden lassen. In dieser Not, da er steuerlos umgetrieben wird, verlangt er nach dem Kompaß seiner glücklichen Jugend, nach dem Lehrbuch der Liebe und des Ruhms, nach dem ›Amadis von Gallien‹. Doch die Schloßbibliothek besteht nur aus wenigen stattlichen und würdigen Folianten: in dem einen ist eine Heiligenlegende aufgezeichnet; in den vier andern erzählt ein frommer Kartäuser, Ludolf von Sachsen, Mönch des vierzehnten Jahrhunderts, das ›Leben Christi‹. Der Herr von Loyola ist gewiß kein Heide. Er hat regelmäßig die Kirche besucht. Er wußte immer, wieviel Kniebeugen ein christlicher Ritter dem Souverän des Himmels schuldig ist. Er hat neben vielen höfisch verliebten Madrigalen eine Hymne auf den Schutzpatron der Ritterschaft, den Apostel Petrus, verfaßt. Er hat die Blasphemie gescheut und ist großmütig gewesen gegen seine Feinde. Doch diese vielen Bußwerke und Kasteiungen in den dicken, frommen Schmökern sind ihm lästig.
Der Mönch beginnt seine Christusbiographie: »Fundamentum aliud nemo potest ponere, ut ait Apostolus, praeter id quod positum est: quod est Jesus Christus.« Wenn ein Ritter Tag und Nacht in der Streckmaschine still liegen muß, denkt er sogar über Bibelsprüche nach. Jesus ist das einzige Fundament unseres Lebens? Damit kann der Herr von Loyola wirklich nichts anfangen. Das stimmt doch gar nicht zu seiner Erfahrung. Sein Leben, zum Beispiel, ist aufgebaut auf dem soliden Namen seines Geschlechts. Wären die Seinen nicht versippt mit den Cuellars und den Manriques, dann hätte er nie die Königin Germana kennengelernt; und der französische Oberst Tolet hätte nie nach dem Sturm auf Pamplona den Kriegsgefangenen zurückbringen lassen. Der sächsische Ludolf irrt. Das Fundament, auf dem der Lebensbau eines Ritters unerschütterlich steht, ist die Wohlgeborenheit; der Name, den sein Geschlecht ihm erworben hat, die gesellschaftlichen Beziehungen, in die er hineingeboren ist. Auf diesem Grund baut sich dann der Ritter aus dem Stoffe Bravour sein eigenes Monument. Jesus Christus, gelobt sei sein Name, hat gewiß Anspruch auf höchste Ergebenheit; er ist der oberste Schutzpatron. Doch nie und nimmer die Basis der Existenz.
Inigo liest uninteressiert weiter: »Venite ad me omnes qui laboratis, scilicet labore vitiorum.« Auch diese Aufforderung interessiert ihn nicht. Hat zum Beispiel der Ritter Inigo je an seinen Lastern laboriert? Er genoß sie hochbeglückt in vollen Zügen. Es ist süß, sich am Feinde zu rächen. Es ist köstlich, Mädchen zu verführen. Es ist beglückend, sich in der Sonne des Ruhms zu wärmen. Also geht ihn, den Inigo von Loyola, Christi Einladung zur Befreiung von den Gebrechen der Seele gar nichts an. »Caveat tarnen prudenter fidelis peccator, ut nunquam in quocunque statu fuerit, confidentiam in meritis suis habeat.« Aber wenn er nicht auf seine Verdienste bauen soll, nicht auf die Turniersiege in Arevalo, nicht auf das glänzende Heldenstück von Pamplona, dann stürzt doch der ganze Lebensbau zusammen. Worin unterscheidet er sich dann noch von den Namenlosen?
»Parum enim prodest, si legerit, nisi et imitatus fuerit.« Der Autor Mönch verlangt nicht wenig: der Leser seiner Jesusgeschichte wird höflichst, aber bestimmt aufgefordert, das Leben des Helden, des Heilands nachzuleben. Ludolf von Sachsen ist ein zu anspruchsvoller Schriftsteller. Das Sitzen zu Füßen Christi und das Lauschen auf sein Wort mag vielleicht für fromme Einsiedler angebracht sein. Doch was fängt ein Anbeter der Königin Germana mit solchen Ratschlägen an? Gelangweilt legt der lesende Ritter die Schrift, die ihm nichts sagt, aus der Hand. Aber ist ein Ritter mit einem zu kurzen Bein überhaupt noch ein Ritter?
In dem Legendenbuch der mageren Schloßbibliothek findet er die wunderliche Mär vom König Latus und der Müllerstochter Pila, aus deren illegitimer Verbindung der Pontius Pilatus hervorgegangen ist; Inigo denkt an die Herkunft des Amadis, den man in einem Körbchen auf dem Meer aussetzte. Der heilige Dominikus, Spanier wie Inigo, will sich als Sklave verkaufen, um einer Mutter das Lösegeld für den gefangenen Sohn zu beschaffen. Eine Opferbereitschaft, die eines Ritters nicht würdig wäre! Und welche Macht dieser Dominikus besaß! Wenn er sich dem Gebet hingab, das Gesicht dem Himmel zugewandt, die Hände über dem Haupt gefaltet, fiel alle Schwere vom Körper. Ein herrlicher Triumph über das träge Fleisch! Franz von Assisi vermochte sogar wilde Tiere mit einem Wort, mit einem wortlosen Wink zu bändigen: ohne Ritterrüstung, ohne schlanke Beine, ohne Damenpublikum. Dominikus und Franziskus haben keine Oriana errungen, gewiß; aber auch sie haben Heldentaten vollbracht. Und auch vor ihnen haben sich Kaiser und Fürsten gebeugt wie vor einem Cäsar und Alexander. Inigo von Loyola glüht für Gottes Hidalgos, die er soeben entdeckt hat.
Jeder drängt auf dem kürzesten Umweg zur Erfüllung seiner Sehnsucht. Niemand ändert sich durch Schicksalsschläge: sie zerstören nur Kulissen – und auf der neuen Szene agiert die alte Kraft. Mitten in seiner Laufbahn war vor dem Ritter Inigo die unüberspringbare Schranke hochgegangen; jetzt öffnet sich ihm eine neue Bahn – zum alten Ziel. Auch als Nachfolger des Dominikus und Franziskus kann er glänzen, Rekorde der Willenskraft brechen; sogar mit einem zu kurzen Bein. Dem Führer, dem Granden, dem Kaiser Christus in bescheidener Uniform folgend, wird er, der Ritter von Loyola, den Weg des Ruhms fortsetzen; trotz der Kugel von Pamplona. Der Soldat späht auch im neuen Reich sofort nach Taten aus. Da ist zum Beispiel eine Schlacht zu schlagen gegen die rebellischen Triebe. Mit der blanken Waffe des Gebets ist der Stolz niederzuringen und die Prinzessin Demut zu befreien. Dann ist durch Attacken der Güte das böse Reich der menschlichen Nöte zu erobern. Der Sieg ist gewiß; denn General Christus und seine heiligen Offiziere marschieren an der Spitze. Franziskus hat in diesem Heer Lorbeeren geerntet. Dominikus ist in dieser Armee zu einem Heiligen befördert worden. Also wird auch der Ritter von Loyola nicht ruhmlos bleiben. Der Stern Amadis verblaßt. Er gibt seine lockenden Farben an den Himmel des Erlösers ab.
Seinen ersten und entscheidenden Sieg erringt Gottes Rekrut im Krankenbett zu Loyola. Der Feind ist ein unglücklicher Krüppel, der gefesselt und ohne Hoffnung in der Burg eines vergessenen Tals liegt. Der Sieger ist ein mächtiger Wille, der dem Krüppel befiehlt, dem Schicksal zum Trotz die Erde zu erobern. Was hindert ihn eigentlich? Das zerschossene Bein? Oder nicht vielmehr die matte Seele, ermattet von tausend beunruhigenden Vorstellungen? Und der werdende General kommandiert: die Vorstellungen, die mich beunruhigen, sind des Teufels und haben zu verschwinden; die Vorstellungen hingegen, die mir Ruhe geben, sind von Gott und zu fördern. Da hat er einen großartigen Kompaß gefunden! Denkt der ehrgeizige Lahme an Turniere und die lockenden Blicke der Frauen, so füllt sich zunächst seine Seele mit warmem und hellem Glück; doch dies Glück wandelt sich in Verwirrung und Düsternis bei der Erinnerung, daß er niemals mehr auf diesen Festen glänzen wird. Also sind solche Gedanken, obgleich sie so einschmeichelnd daherkommen, vom bösen Geist. Also ist seine Vergangenheit des Satans gewesen. Gottes aber ist das Reich, in dem der Hinkende gleich dem Nicht-Hinkenden ist. Die Vorstellung einer Wallfahrt nach Jerusalem oder des Lebens, wie es Dominikus geführt hat, bringt ihn zwar nicht sofort in Glut, hinterläßt aber einen süßen Frieden; sie stammt also von den Engeln. Sie hat von nun ab den Kurs seines Lebens zu bestimmen. So leicht ist das Dasein für den, der sich mit seinem Schicksal verbünden kann.
Eine freundliche Vision erscheint als Regenbogen nach dem Gewitter: dem ›Bekehrten‹ zeigt sich die Jungfrau mit dem Jesusknaben in leuchtendster Klarheit. Wie gleichgültig ist die Länge eines Beins vor der Gewißheit, Mittelpunkt des Alls zu sein; Schlachtfeld, auf dem die göttlichen Heerscharen mit Hilfe des Soldaten Inigo siegen werden. Wie würgt ihn jetzt der Ekel, denkt er an die Jahre der Eitelkeit in Arevalo und Pamplona zurück. Inigo, der einen gewaltigen Willen einzusetzen hat, zwingt sich – zum Frieden mit sich: zu seinem alten Streben und zu seinem neuen Herrn.
Konnte er keinen anderen finden?
Arbeit schändet
Im selben August, in dem Kaiser Karls Offizier ins Heer Jesu Christi als Gemeiner, doch mit dem Feldherrnstab im Tornister eintrat, weil Jesus auch hinkende Soldaten verwenden konnte – in eben diesem Monat eroberte Inigos Landsmann und Altersgenosse Hernan Cortez aus Medellin in Estremadura das Land Mexiko, das kriegerische Kaiserreich der Azteken. Mit fünfhundertfünfzig spanischen Soldaten, sechzehn Reitern, zweihundert Indianern und vierzehn Geschützen war er an der Ostküste Mittelamerikas gelandet. Er hatte seine Schiffe verbrannt. Er war die unbekannte Erde hinaufgestiegen. Und was er hier oben erblickte, hatte noch kein fahrender Ritter je vermeldet – auch nicht der große Amadis.