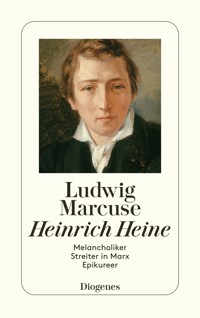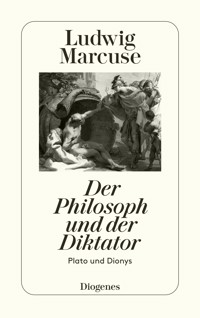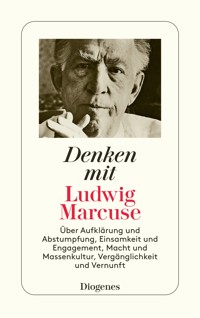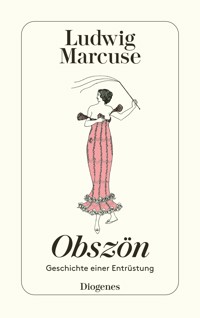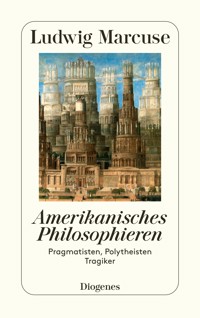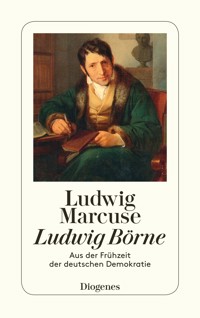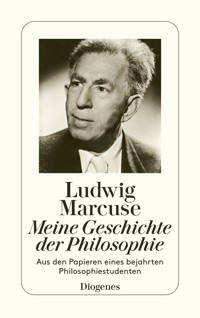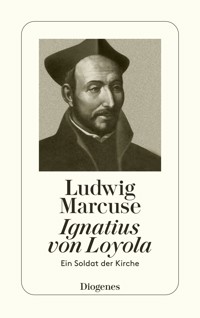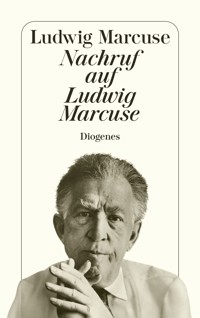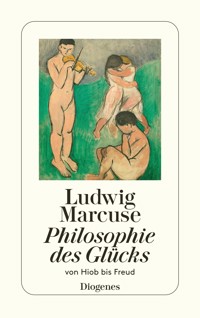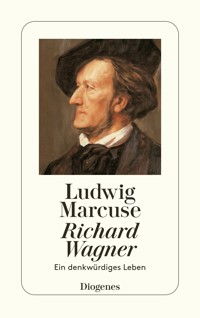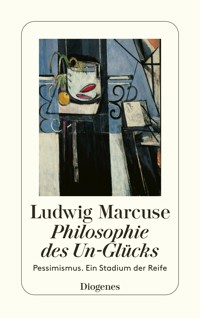
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Sein Werk, das immer ›provocative‹ war in des Wortes bester englischer Bedeutung, ist jüngst auf einen vorläufigen Höhepunkt gelangt durch seine große Schrift ›Philosophie des Un-Glücks‹, ein prachtvoll gescheites Buch, das, ohne irgendwelche falsche Tröstungen anzubieten, rein durch seine geistige Energie etwas Ermutigendes hat … Die ganze Auffassung des Pessimismus als eines Zustandes der ›Reife‹ ist mir sehr sympathisch. Im übrigen ist es ein fortwährend fesselndes, im höchsten Sinn witziges Buch.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Ludwig Marcuse
Philosophie des Un-Glücks
Pessimismus. Ein Stadium der Reife
Diogenes
Zur Erinnerung an Ernst Rowohlt:
dem Freund
und ersten Verleger
dieses Buches
Einleitung
Entmythologisierung des Atheismus
Das Wort »Entmythologisierung«, obwohl in Mode, benennt ein entscheidendes Ereignis der Epoche: zunächst eine Entfärbung, die am Trinitäts-Mythos vorgenommen wird und als Verwesentlichung oder Entchristlichung ausgelegt werden kann.
Im selben Prozeß befindet sich der Vernunft-Mythos seit den Tagen der Aufklärung; und auch die Gebilde idealistischer und materialistischer Dialektik sind Atheismen verschiedenen Grades: am Anfang war ein immerhin noch (dogmatischer) Protestantismus, am Ende ist Sartre: »Der Atheismus ist ein grausames und langwieriges Unternehmen; ich glaube ihn bis zum Ende betrieben zu haben.« Zwischen dieser verlorenen Illusion und der starken, farbigen zu Beginn gab es viele theologische oder auch hoffnungsvolle Atheismen.
Das Absinken eines Wortes ruft nicht selten den Irrtum hervor, daß auch nicht ernst zu nehmen ist, wofür es einst in die Welt trat; mit den Schlagworten außer Kurs ist noch nicht erledigt, was sie einmal bezeichneten – es versteckt sich hinter neuen Prägungen. Das Vokabular ist auch eine Maskerade, die der Zeitgeist ins Leben ruft: das Alte sieht taufrisch aus.
Die Lingua philosophica ist (um nicht weitläufiger zu werden) dreifach zu differenzieren: als Terminologie für philosophiegeschichtlich Eingeweihte; als unfachmännische, sehr persönliche Expression (etwa Georg Simmels oder Emil Lasks) und als populärphilosophisches Mosaik, das aus verbalen Spielmarken besteht. Im »Wort am Sonntag« zeigen sich feierlich: der Materialismus und der Idealismus, der Monismus und der Dualismus und viele andere berühmte Pärchen.
Eine solche Spielmarke ist auch das Wort »Pessimismus« geworden. Wenn es trotzdem in diesem Buch in den Mittelpunkt gerückt wird, so nur deshalb, weil die jüngeren Prägungen zu schamhaft einhüllen, was im alten Wort unverschleiert erschien.
Der desillusionierte Held von Balzacs Verlorenen Illusionen entdeckte in Paris: daß »hinter den schönen Kulissen Menschen, Leidenschaften und Bedürfnisse ihr Wesen treiben«. Es waren nicht nur die schönen »Kulissen« der sündigen Menschen oder der frühkapitalistischen Gesellschaft … wie man sich gern beruhigt. Es waren die alten und immer neuen Leidenschaften und Bedürfnisse – im besonderen Gewände einer datierbaren Zeit. Er verlor nicht nur die Illusionen, die sich ein Handwerker der französischen Provinz gemacht hatte. Er verlor, was jeder Pessimismus radikal abbaut. Was blieb ihm noch? Die Illusionen einer Zeit sind nie so sichtbar wie ihre Desillusionen.
»Pessimismus« ist nicht nur als Wort in Verruf, viel mehr als Entblößung des Daseins. Selbst der nichtgeglaubte Mythos wird noch respektiert.
Diesen Respekt vor dem Heiligen, dem Arkanum, dem Numinosen (drei Zauberwörter) erwies Gautier, schockiert von den Offenbachiaden, noch der Familie Zeus. »Die schöne Helena«, schrieb der Gekränkte, »verletzt und beleidigt, was wir als Künstler bewundern und verehren. Mag auch eine himmlische Offenbarung die Altäre der Götter gestürzt haben, die Göttergestalten der Kunst bleiben bestehen, und es grenzt an Blasphemie, die Helden Homers der Lächerlichkeit preiszugeben.« Die großen Künstler der Renaissance wurden dem Olymp als Schutztrupp zur Verfügung gestellt.
Ein Gautier von heute könnte Leonardo designieren, die christlichen Mythen unangreifbar zu machen; und es steckt ein Sinn in Gautiers Gereiztheit. Wird auch nur ein einziger Mythos preisgegeben, so ist kein Halten mehr: Gautier schützte im antiken Himmel bereits den Nachfolger; denn ohne Himmel sind die Erfahrungen, die zum Pessimismus führen, nicht wegzuinterpretieren.
So spornt gerade die Mythen-Dämmerung Poeten und Begriffsbildner an, wenigstens ein Minimum zu retten; mit zeitgemäßeren, wenn auch schwächeren Illusionen die verbrauchten zu ersetzen. Diese Versuche sind vielleicht der auffallendste Zug gegenwärtigen Theologisierens und Philosophierens, das sich bemüht, in Wort und Bild zuzudecken, was unerträglich erscheint. Das Aufdecken der Entmythologisierer ist zugleich ein Zudecken, wie eh und je. Die Frage lautet immer: was ist nicht entmythologisiert?
Gegen die Künste, die Unschönes rücksichtslos zeigen, wehrt man sich nicht so sehr wie gegen ebenso rücksichtslose Theorien, die immer ernster genommen werden. Poeten haben (in Ländern, die nicht straff zentralisiert sind) viel Narrenfreiheit. Marx hätte seinem Freund Heine nie erlaubt, in Begriffe zu bringen, was er reimen durfte.
So blüht die Poesie des Sinnlosen und Häßlichen; eine vergleichbare Philosophie gibt es kaum. Dem mythisierenden Hegel, nicht dem entmythologisierenden Schopenhauer gehörte unser Jahrhundert – allerdings nur an der Oberfläche aus bedrucktem Papier. Zwar bauten in den letzten hundert Jahren Theologen und Philosophen die großen Mythen ab … woben aber zu gleicher Zeit an Gottes lebendem Kleid, welches zu verdecken hatte, daß außer ihm nichts lebte. Die Entmythologisierer taten es ein bißchen der Penelope gleich: sie machten der Götter Gewand immer fadenscheiniger und flickten es immer passionierter.
Das ist den gegenwärtigen Entchristlichungen, Entrationalisierungen, Entmarxisierungen gemein: eine vorsichtigere, nebulosere, weniger wirksame Gesundbeterei kam ins Dasein.
Das Vulgärchristentum, das verfeinerte und La crise pyrrhonienne
Parallel zum Vulgärmarxismus und Vulgärrationalismus (dem sogenannten Aufkläricht) gibt es ein Vulgärchristentum, das niemand so unvergeßlich ins Licht gestellt hat wie Kierkegaard. In vielen Bezirken geht also die Richtung auf eine Verdünnung des Mythos: man nahm einige unhaltbare Positionen zurück; das Subtilere soll noch leisten, was einst dem Kompakteren aufgetragen war. Selbst die Freimaurer suchen sich zu entmythologisieren; sie geben ihre Riten der Fernsehkamera preis. Wo bleibt der Zauber, wenn immer mehr Geheimnisvolles eliminiert wird? Der Zauber war stets das Antidot gegen den Pessimismus.
Ihn zu besiegen war die Hauptfunktion der vielfältigen Götter, auch noch der abstraktesten. Selbst die Religion des Kreuzes war auch eine Austreibung der Tristitia. Alle, die in der Passion einen Hymnus auf das Tal der Tränen sahen, mißverstanden das Christentum: am stärksten Heine, Richard Wagner und Nietzsche. Das Kreuz schwächte, um zu stärken; es war die Last, unter der man zusammenbrach, um das Heil klarer zu erblicken. Melancholia gehörte bisweilen zu den Sieben Todsünden. Erwachsen im Schatten des Leidenswegs, zeichnete man dennoch exzessive Trauer, Verzweiflung als sündhaft aus; Schmerz und Leid, Vorbereitung fürs Paradies, durften nicht abgewertet werden. Und heute verdammt Evelyn Waugh, unter Berufung auf Thomas von Aquin: Traurigkeit »im Angesicht des geistlich Guten«. Das Christentum konnte einer der stärksten Widerstände gegen jeden Pessimismus werden – gerade weil es so viel von ihm aufgenommen hatte.
Heute sucht man mit Hilfe von geeigneten Bibelzitaten Vertrauen zu wecken: »Selig die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden.« Besonders gut eignet sich das Alte Testamentf »Und Gott sah, daß alles gut war.« Was ist das Echo im Herzen der Leser? In den »blassen und ermüdeten Religionen«, in den »Gelehrtenreligionen« erkannte Nietzsche klar, was wir heute trübe als Entmythologisierung feiern. Sie wurde von Biologie und Archäologie erzwungen, vor allem von den Geschichtswissenschaften; und außerdem noch von den antiautoritären Tendenzen innerhalb der Demokratien. Die Kirchen sollen demokratisiert werden – und mit ihnen Jehova, der Zürnende, und Christus Pantokrator; vom Pietismus bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil mühte man sich, hoffnungslos. Alle Zuschauer, welche diese »Liberalisierungen« bejubeln, machen sich nicht klar, daß ein demokratisch gehandhabter Mythos (vom päpstlichen bis zum marxschen) nichts leisten kann. Wer außerhalb steht, ist eher geneigt, Verständnis zu haben für die Retardierenden, welche wissen, daß Entmythologisierung in eine unbekleidete Welt führt.
Im Neoprotestantismus ist der zersetzende Prozeß schon weiter fortgeschritten als selbst im progressivsten Thomismus. Barth, Tillich und Niebuhr haben die Christus-Mythe sehr winzig gemacht – bis auf einen nicht mehr faßbaren Kern, den sie nicht preisgeben. Sie wollen nichts mehr wissen vom dreidimensionalen christlichen Firmament … und halten fest, daß in Jesus das Trans diesseitig wurde; nur ist seine Biographie ziemlich bläßlich geworden, eine Konzession an die Historiker. Selbst die Worte Christi werden preisgegeben, wenn Barth alle, die in den Evangelien berichtet und dann von den Kirchenvätern und Päpsten interpretiert wurden, den Historikern überläßt. Das Irdisch-Absolute wird aus der wissenschaftlichen Feuerlinie gezogen. Die Jünger und ihre Nachfolger sind nur noch eine Serie von Menschen, die über das menschlich-göttliche Ereignis Vermutungen anstellten – auch wenn sie nicht wußten, daß ihre Zitate subjektive Spiegelungen waren.
Tillich sucht einen Minimum-Mythos zu retten, indem er auf alle Ausstattung, die Zeitgenossen, Gottesgelehrte und Maler hinzugetan haben, verzichtet … und sich so unangreifbar macht. Seine Entmythologisierung kommt zu einem Stop vor dem, was bei ihm »Der objektive Glaube« heißt. Der mit allen philosophischen Wassern getaufte Tillich erfand, hegelsch geschult, die Dialektik: Jesus offenbarte die »Unbedingtheit des Unbedingten«… und zugleich »daß ihm diese Unbedingtheit gerade fehlt«. Wer aber einwendete: das bekunde jeder reflektierende Mensch, erhält die Antwort, die sehr angreifbar ist: »Alles Reden über göttliche Dinge ist sinnlos, wenn es nicht im Zustand letzter Ergriffenheit geschieht.«
Jeder Fanatiker ist in diesem Zustand. Wo ist die Grenze zwischen ergriffenen Gläubigen, ergriffenen Abergläubigen und ergriffenen Ungläubigen? Ich höre die Ergriffenheit mehr aus den schmucklosen Kirchenliedern des Novalis als aus dieser Anstrengung der dialektischen Jesus-Metaphysik, die wohl mehr ein Akt des Willens ist.
Niebuhr hat zwei große Hoffnungen: den Sozialismus und das zweite Kommen Christi. Er schreibt: »O Gott, laß uns gelassen hinnehmen, was nicht zu ändern ist; gib uns Mut, zu ändern, was geändert werden kann.« Vor einem halben Jahrhundert hat Max Brod dies Hinnehmen und Ändern als »edles und unedles Unglück« bezeichnet. Aber diese amerikanischen Neoprotestanten begnügen sich nicht mit dem Ändern, Humanisieren – und dem Resignieren, der Abweisung aller »höchst absurden Hoffnungen auf die Möglichkeiten des irdischen Menschen«.
Niebuhr hebt die Resignation (die zum Pessimismus führen würde) auf in der Erwartung der Wiederkehr Christi: das ist nicht Gegenaufklärung. Tillich weiß: nicht nur die Utopie, auch »die Kirche ist nicht imstande, die Gesellschaft zu erlösen«; aber der Einzelne ist geborgen in der Garantie, daß der (inzwischen völlig entleerte) Gottessohn ihm zur Seite steht.
Sie klammern sich noch an einen Mythos, der fast schon nicht mehr da ist. Sie sind Atheisten – und sträuben sich.
Sind die Enkel Voltaires weniger problematisch?
Die Aufklärung, so pessimistisch sie war: vom Candide und Sades Mißgeschick der Tugend bis zu Kants Klagen im Opus postumum …, wurde am massivsten mit dem Dunkel fertig in der Kritik der praktischen Vernunft: die Emotionen wurden verächtlich beiseite geschoben. Vater Schöpfer, der noch Qualen dämpfen konnte, wurde ersetzt durch eine schwächere Gottheit, die Vernunft. Der Anti-Emotionalismus stand und steht im Dienste des Anti-Pessimismus.
Die »Wissenschaftsreligion« wurde eine der mächtigsten Mythen, bis ins Zwanzigste Jahrhundert. Am kräftigsten lebte sie in Amerika, lebt sie in der Sowjetunion; in Europa wurde sie am frühesten entmythologisiert.
Aber auch hier trat ein Gegenspieler auf, der verhinderte, daß zuviel entblößt wird: die skeptische Betrachtung des Deus Ratio wurde als Irrationalismus stigmatisiert, als neue Verdunkelung. Schon der große Kant, welcher der Vernunft eine eherne Grenze gezogen hatte, versuchte zugleich, seine gewaltige Tat aufzuheben, indem er dann doch noch aus der Vernunft Gott, Glückseligkeit und den kategorischen Imperativ hervorzauberte. Und seine Nachfolger produzierten noch viel mehr. Nur selten war ein Rationalist so vernünftig wie Freud: er restaurierte nicht den Glauben an die Weltvernunft … und verkündete zurückhaltend, daß er etwas helfen, aber keinen Trost bringen könne. Einige der Seinen mythisierten dann wieder kräftig gegen ihn. Ein Amerikaner schrieb ein Buch, das den Titel haben sollte: Prinzip Psychoanalytische Hoffnung.
Viele, die sich liberal nennen, naschen von allen noch minimal existierenden Mythen ein wenig: von den Theosophen, von den Weisen Asiens in Europa, von den Zeugen Jehovas. Am wesentlichsten ist die Entmythologisierung der Ratio in jenem Denken zu finden, das der junge amerikanische Erkenntnistheoretiker Bartley »Kritischen Rationalismus« nennt. Er sagt: die Einsicht in die Grenze der Ratio öffne noch nicht Tür und Tor für analphabetische oder gezielte Verdunkelungen. Er zitiert seinen Lehrer Popper mit dem Satz: daß wir »in unserer Unwissenheit allesamt gleich sind«; eine Feststellung, die Bertrand Russell einmal so umschrieb: Die Wahrheiten, die wir finden, sind nicht von letzter Wichtigkeit; und die Wahrheiten, die von letzter Wichtigkeit sind, finden wir nicht.
Aber die »Crise pyrrhonienne« will auch der entmythologisierende »Kritische Rationalismus« aufhalten, sonst nennte er sich besser Skeptizismus. Alles, was sich nicht ausweisen kann (z.B. in der Technik), ist in Frage zu stellen. Luthers »Die Vernunft ist eine Hure« (wenn wir einmal das Wort gefälliger als ›zugänglich‹ bezeichnen), gilt für alle Wünsche, alle Leidenschaften, alle Stimmungen und alle Theorien.
Die Vernunft ist schon in allen Diensten gewesen; es ist ebenso töricht, sie zu heiligen wie zu verketzern. Es gibt einen bösen Rationalismus und einen menschenfreundlichen Irrationalismus: dies zur Zerstörung der Wortgespenster. Es gibt keinen feindlichen Köhlerglauben und keine Menschlichkeit, denen die Vernunft nicht schon Waffen geliefert hätte; alle Gebiete des Daseins können etwas aufgehellt werden. Aber von dieser Leistung bis zur rationellen Stützung eines Heils gibt es keinen annehmbaren Weg. Die Vernunft ist nicht vernünftig, keine Gottheit, die vor dem Pessimismus schützen kann. Aber sie hat, als Technik, mehr geleistet als alle Revolutionen; nicht Lenin, sondern hundert industrielle Praktiken haben bewirkt, daß der russische Bauer weniger Schweiß vergießt als sein Ahn.
Die Gefahren der Technik werden jeden Tag plakatiert, ihre Wohltaten nicht genug besungen. Die Ratio, die in ihr nützlich und schädlich geworden ist … ist eine neutrale Kraft. Sie erhellt und verdunkelt, sie nützt und schadet. Sie ist ein Lumen neutrale: man kann Hexenprozesse sehr logisch führen. In der Anbetung der Vernunft bewahren die sakralen Rationalisten den Rest eines noch nicht entmythologisierten Mythos.
Die mythische Dialektik
Im Vulgärmarxismus ist der Mythos von dem heranwachsenden Gott noch nicht so geschwächt wie im Elitärmarxismus. Die Funktionäre (ihre erlauchteste Erscheinung ist Georg Lukács) tragen zu Unrecht den verächtlichen Namen »vulgär«; ihre Lehre hat noch etwas vom alten Kampfcharakter, Soldaten sind nie elitär.
Der Himmel jener geist- oder auch nur wortreichen Neos wurde farblos wie der neoprotestantische: dem christlichen Minimum entspricht das kategoriale. Als der sowjetische Staat nicht abstarb, vielmehr in Terror und Ausbeutung immer kräftiger wurde, sah die klassenlose Gesellschaft so fahl aus wie der entmythologisierte Gottessohn. Vielleicht hätte ohne russische und chinesische Revolution der Mythos von der Dialektik des materiellen Weltgeistes noch den alten Glanz. Sie zersetzten den massiven Marxismus wie historische Dokumente (bis zu den Rollen am Toten Meer) die massive Geschichte des Helden der Evangelien.
Die reale Niederlage der Theorie rief die marxistischen Entmythologisierer auf den Plan … welche zugleich die neuen Mythologen wurden. Wie der Himmel der Trinität von intellektuell beweglichen, in Rückzugsgefechten geübten Theologen als Vorstellung ungebildeter Fischer des ersten Jahrhunderts preisgegeben – und zugleich ein sehr abstrakter Erlöser als letztes Bollwerk stabilisiert wurde, so ist auch das »letzte Gefecht« zwielichtig geworden. Das Kommunistische Manifest wurde neu redigiert: hymnisch nichtssagend oder dünkelhaft-dunkel. Die Neoprotestanten verspeisen nicht mehr den Sohn und trinken nicht mehr sein Blut. Und die vorsichtigsten (und deshalb in der feinen westlichen Gesellschaft beliebtesten) Marxisten gehen in der Überbau-Theorie nicht einmal so weit, wie noch der vorsichtige Engels gegangen war.
Aber auch unter den Neuen leben die alten Götter weiter: in älteren und jüngeren Wendungen wie: Verdinglichung, Umschlag, Entfremdung, Noch-Nicht, »dem Weltlauf widerstehen, der den Menschen immerzu die Pistole auf die Brust setzt«. Dieses Vokabular ist breitgestreut. Man fragt sich, sieht man solche Wendungen wieder und wieder: wieviel weniger Kulturkritik es gäbe, wenn nicht dieser Wortschatz der Meinungsmacher zur Verfügung stände – nicht Schatzgräbern, sondern Schatzrentnern. Ein einziges Beispiel. Da definiert einer der Schar die Satire: »Satire ist Utopie ex negativo.« Hier ist, im schmälsten Sätzchen, das blasse königliche Mythenpaar vereint: Herr Utopie und der beinahe noch mächtigere Diener Negatio. Diese paradiesschaffende Negation wird auch von Poeten besungen, die zu ihrem Unglück ins soziologische Seminar geraten waren. Die Sprachregelung der schreibenden Upperclass ist total. Der Fundamentalismus strammer Dorfgeistlicher, der Rationalismus naiver Erben Christian Wolffs und der Vulgärmarxismus haben ihre vornehme Entsprechung unter den schreibenden oberen Zehntausend, die krampfhaft, raffiniert – und wirkungsloser dasselbe sagen. Der elitäre Marxismus ist nicht mehr ein anspornender Tyrtäusgesang, wie der entmythologisierte christliche Himmel nicht mehr erlöst. Skrupelvolle Theologen beruhigt er: daß sie, immerhin, noch Christen sind; und die entmythologisierten Marxisten haben sich zwar von der Weltrevolution noch weiter entfernt als die gleichzeitig Kompakteren, welche die alten Parolen noch gebrauchen, um die Ihren bei der Stange zu halten. Aber das gängige Wort »Noch Nicht« gibt doch das gute Gefühl, daß man immer noch das alte Panier hochhält. Die Vulgären aber haben, mit Recht, festgestellt, daß die Elitären zu überhaupt nichts mehr gut sind. Allerdings: der demokratisch-marxistische Westen ist verliebt in diese ästhetische, tief lotende Entmythologie: man bildet sich ein, so zugleich militant zu sein und auf der Höhe unserer Kultur.
Neo-Vatikaner, Neo-Mystiker, Neo-Voltaires und Neo-Dialektiker, idealistische und materialistische, sind an Anschauung fast so arm wie die stärkste Entmythologisierung der Zeit: die Physik … und haben ein gemeinsames Ziel, das die Quantenmechanik nicht hat: doch noch ein Minimum an Mythos zu verteidigen. Jetzt ist man sogar dabei, von den Poeten zu verlangen, daß sie die Chiffren der Naturwissenschaftler in ihren Werken dichterifizieren: was zu einem kernphysikalischen Mythos führen könnte. Die Geisteswissenschaften brauchen solche Verkünstlichungen nicht mehr: sie haben bereits ihren Heiligen … ich schlage als Kollektivnamen Entdinglichung vor.
An allen ihren Vokabeln ist abzulesen, was der verfeinerte Mythos noch immer leistet (für eine Handvoll von Granden des Geistes): dem Pessimismus zu huldigen – und zu entgehen. Ihre Worte sind unheilverkündend, was die Gegenwart betrifft. Jeder Ausspruch eines Ministers, jede Konvention der Rundfunkansager wird zum überlebensgroßen Zeichen des entfremdeten Menschen. Man bohrt sich in jedes sprachliche Mißgeschick ein, um den hippokratischen Zug unserer Kultur offenzulegen. Nur die, welche die Lingua der Verfolgung betreiben, offenbaren das Heil: an ihren Stilanalysen wird die Welt genesen. Weder Hegel noch Marx haben sich je so passioniert als Schulmeister betätigt. Es gibt eine Ausnahme: Sartre schrieb gegen diese Mythisierung sein Buch Die Wörter: an der Verhextheit des Kindes durch sie entlarvte er das Gehabe erwachsener Wortfexe.
Sprachkritik (sehr nützlich in begrenztem Bezirk) wurde mythenbildend: Austreibung des Teufels aus dem Vokabular – in der Zuversicht: was nicht in den Worten ist, ist auch nicht in der Welt. Dieser Exorzismus betätigte sich bisweilen in einem Jargon, der dem verfolgten nichts nachgab, nur penetranter war. Der Stil ist manchmal l’homme und manchmal auch nicht; Stilkritik zur Förderung einer nicht ausbeutenden Menschheit ist meist nichts als hämisch-arrogantes Getue. Man wäre in Versuchung, den naiveren Funktionären recht zu geben, könnte man ihre Feindschaft gegen die marxistischen Ästheten trennen vom Terror.
Die pseudo-militanten Neos sind vereinigt in einer sakralen Soziologie. Ihr zentrales Dogma: es gibt keine menschlichen Gebrechen, die nicht mit der Ausbeutung verschwinden werden. Und die atheistischen Kirchenväter wagen sich ebensoweit vor wie die christlichen: eliminieren den Tod. Wie wird das praktiziert? Fall eins: »Der Tod, welcher als individueller wie als ferne Möglichkeit kosmischer Entropie dem zukunftsgerichteten Denken als absolute Zwecknegation begegnet, der gleiche Tod geht nun, mit seinem möglichen Zukunftsinhalt, in die Endzuständlichkeit, Kernzuständlichkeit ein, welche von noch ungedeckter Freude und den Latenzlichtern des Eigentlichen beleuchtet wird. Der Tod wird darin nicht mehr Verneinung der Utopie und ihrer Zweckreihen, sondern umgekehrt Verneinung dessen, was in der Welt nicht zur Utopie gehört … im Todesinhalt selber ist dann kein Tod mehr, sondern Freilegung von gewonnenem Lebensinhalt, Kerninhalt. Das ist eine erstaunliche Wendung …« Wer (außer dem Autor am Schreibtisch) wird diese »erstaunliche Wendung« vollziehen können? Wer wird vor einem geliebten Menschen, der leblos daliegt, denken: in seinem »Todesinhalt« ist er nicht tot?
Diese und ähnliche Mythisierungen erfordern eine autoritäre Oberakademie, um die Menschheit an solche Schleichwege zu gewöhnen. Fall zwei ist weniger elitär – und kaum praktikabler. Hier wird nicht der Tod weggeredet, aber doch die Angst vor ihm: ist vielleicht die Furcht vor dem Tode »den Menschen ebenso absichtlich auferlegt wie die Gesetze gegen Blutschande – nicht weil wir sie instinktiv verabscheuen, sondern weil das Sterben wie die Blutschande so leicht fällt?« Der Tod wird also beiseite geschoben als manipuliert, als Machenschaft denunziert.
Im dritten Fall (man müßte die ganze Kollektion hersetzen) wird argumentiert: vom Tod, sagt man, er sei »anzunehmen, nicht zu ändern«. Wie reaktionär! Und es wird den Jahrtausenden der Ausbeutung die Zeit der nicht entstellten Wirklichkeit entgegengesetzt … einer Wirklichkeit, in der also der Tod geändert sein wird. Hier legt man sich nicht fest (wie es jeder wirksame Jenseitsglaube wagte), hier verscheucht man den Tod, indem alle, die nicht glauben, daß man ihn »ändern« könne, als Finsterlinge verdammt werden. So verbal ist geworden, was in Zeiten des Wunderglaubens das paradiesische Jenseits des leiblichen Individuum war. Shaw sagte: »Das Wunder ist ein Ereignis, das Glauben schafft.« Die Halb-, Dreiviertel- und Rundherumdialektiker bis hin zur Auflösung der Antagonie können nicht mehr Wunder produzieren. Sie sind zu entmythologisiert … und versuchen dennoch, in herausgequälten Sätzen eine Zukunft zu produzieren, die Augustinus einst mit allen Sinnen imaginierte. Der Glaube an das herrliche individuelle Leben nach dem Tode war wohl immer die wirksamste Methode, mit allen Übeln, auch mit dem Sterben fertigzuwerden. Jede Einkapselung durch Vorwegnahme einer Zukunft, die weniger leistet, war ein Kopfin-den-Sand-stecken – wie Kierkegaard, Unamuno, Heidegger und Sartre wußten … sosehr sie uneins waren über die Folgen, die daraus zu ziehen sind.
Die philosophisch-anthropologische Voraussetzung des zukünftigen Diesseitsheils ist das Dogma: es gibt keine Konstanten in der Geschichte der Menschheit, die unbegrenzt wandlungsfähig ist … auch was die bisherige Erfahrung betrifft: Alle Menschen müssen sterben. Die phantastische Hypothese wird als Gewißheit durchgesetzt, indem man die Vorstellung von einem Ewigen im Menschen demoliert. Das zeitgenössische Werkzeug der Destruktion ist der Ukas: es ist infam, Situationen als ewig zu proklamieren, weil sich so Interessenten vor dem Wandel schützen. Und wirklich hat sich schon zu viel Zeitliches als »ewig« aufgetan – und damit eine aufhebbare Not stabilisiert. Man sollte nicht einmal sagen: es sei die ewige Natur des Menschen, zwei Arme und zwei Beine zu haben. Wir kennen nur die Vergangenheit.
Aber ebenso reaktionär (rücksichtslos gegen die Lebenden) wie die, welche genau zu wissen vorgeben, was nicht zu ändern ist, sind die Andern, welche genau zu wissen vorgeben, daß alles zu ändern ist. Es ist verrucht, dem Einzelnen einzureden, es läge nur an den ausbeutenden Mächten, wenn nicht längst alle miteinander im Paradies schweben.
Zu Beginn dessen, was heute Vulgärmarxismus genannt wird, lebten eine Hoffnung und ein militanter Wille. Die lebende Hoffnung wurde herabgesetzt zum Prinzip. Der Elitärmarxismus ist, im besten Fall, eine Gescheitheit und ein ästhetischer Reiz; moralisch-politisch ohne Belang. So wie der sehr belesene und gescheite Neoprotestant und andere glauben machen, daß er noch Christ ist, bildet sich der ebenso gewitzte Neomarxist ein (und propagiert es), daß er noch im Kampf steht. Ziselierte Worte sind die letzte Heimat der zäh absterbenden Mythen, die einst Bataillone zum Schlachten anfeuerten.
Fromme Atheismen: antike, trinitäre und materialistische
Die vielen Erfahrungen, die zu vielen Pessimismen führen konnten, waren am zuverlässigsten eingekapselt, wenn mächtige Götter sie überglänzten: wohlwollende Großmächte über dem Schicksal des ohnmächtigen Einzelnen.
Die Gottheit konnte so unvorstellbar sein wie Jehova oder so nah und vertraut wie der liebe Freund und Bräutigam Jesus: der Schutz war nie abhängig von der Intimität mit dem Beschützer, sondern vom Grad des Vertrauens zur Allmacht. Als es schwand, flüchteten sich die Denkstärksten in den mathematischen Deus des Spinoza, in den emotionalen Atheismus Goethes, in die Vergöttlichung der Zeit: der liebe Gott wird eines Tages ganz göttlich sein (meinte Hegel). Auch suchte man Unterschlupf in einer sakralen Moral ohne Sinai und in unendlich vielen anderen Verflüchtigungen.
Diese blassen Gestalten und Abstracta, nur noch metaphorische Himmel, sind eng verwandt: in ihnen wird mehr der Wille zum Glauben sichtbar als ein Glaube … am großartigsten bei Kierkegaard. Der Aufstand der Atheisten gegen den Atheismus – bis zu Strindberg, bis zu Döblin, eine Entschlossenheit, nicht ein Glaube … ist viel ernster atheistisch als die aufklärerisch-marxistische Attacke gegen Kirchen und Klöster. Die Entschlossenheit zum Glauben wurde sehr falsch religiös ausgelegt: nicht von Kierkegaard, dessen einsame Größe auch darin zu erkennen ist, daß er härter als irgendwer versuchte, in den Himmel zu kommen – und illusionsloser als irgendwer und aufrichtiger als irgendwer erkannte und sagte, daß er dazu nicht fähig war. Wenn der Atheismus einen Heiligenkalender schaffen sollte, an erster Stelle steht der »Christ«, der schrieb: »Eine religiöse Bewegung kann ich nicht machen, das ist gegen meine Natur.«
Die Ungläubigen waren oft genug verzweifelt, weil von Göttern, die nicht existieren, nichts zu erwarten ist. Schließlich beerdigte man feierlich das Wesen, das, wenn es auch nie gelebt hatte, stärker am Leben gewesen war als irgendein Lebender. Melancholisch beschrieb Heinrich Heine die Grablegung der imaginären Allmacht. Nietzsche verfaßte den lapidarsten Nachruf.
Er kann auch als Wehklage ausgelegt werden, wurde vor allem aber ein Jubel. Die Atheisten sind jubelnde Hinterbliebene seit Epikur. Gott ist nicht nur der große Protektor gewesen, auch der oberste Despot: er hatte Menschenopfer gefordert, in Jesus sogar ein Gottesopfer … und, mit Hilfe vieler Mosesse auf vielen Sinais, striktesten Gehorsam. So erlebten die Gott-losen, die Gott los geworden waren, den Tod des Mächtigsten auch als Sieg nach einem Jahrhunderte langen Befreiungskampf … und durchaus nicht nur gegen die Kleriker.
Was festlich »Aufklärung« genannt wird: Voltaires fröhliche Austreibung der beamteten Gottesdiener (in den Gesängen der Pucelle), de Sades Gespräch zwischen einem Priester und einem Sterbenden, Nietzsches Hymnus auf den »Übermenschen« (den nur mittelmächtigen Thronfolger des allmächtigen Toten), Haeckels freche Verballhornung der Christologie in den Welträtseln, auch noch Sartres »Freiheit« (welche jede Gotteskindschaft radikal negiert – selbst die freiwillige Abhängigkeit von einer Weltvemunft, die der deutsche Idealismus erfolgreich durchgesetzt hatte) … diese Atheismen waren nie nur antiklerikal, wenn sie auch hier ihren Ausgangspunkt hatten.
Zum Beispiel in der Revolution von 1917, als auch die Popen gestürzt wurden, die Alliierten der Zaren. Dem sowjetischen Atheismus wird unrecht getan, wenn der gute Beginn übersehen wird; in den »antireligiösen Museen« der Union wurde gute Arbeit geleistet. Dann allerdings wandelte sich der politische Atheismus in einen mythischen. Es entstanden die Priester der »Wissenschaftsreligion«: ebenso eifernd, wenn auch nicht ebenso raffiniert, wie die, welche sie abgelöst hatten. Nietzsche, der in der Wissenschaft, der fröhlichen, nur die Zersetzung der Mythen gesehen hatte, ahnte noch nicht, daß sie selbst zum Mythos werden würde: zum Beispiel im weihrauchgeschwängerten dialektischen Atheismus. Das heilige Es-war-einmal wurde ersetzt durch das heilige Es-wird-einmal-sein. Aber es braucht ein erstes Kommen Christi, um die Hoffnung auf ein zweites wirksam zu machen. Das reine Futurum versucht vergeblich, den leeren Himmel zu füllen. Im übrigen werden das Christentum (sowohl rückwärts gewandt, als auch mit dem Blick auf das Paradies am Horizont) und der Neomarxismus, dem ersten Kommen der guten und schönen Wirklichkeit entgegensehend, auf verschiedenen Wegen dieselbe gottlose Gegenwart los.
Heute tragen Oberpriester nur noch hehre Worte durch die alte und die neue Kirche; die Gemeinde senkt den Kopf und alles, was drin sein könnte … und respondiert. Jeder sakrale Atheismus ist keiner. Der atheistische Mythos, dessen Gott die dialektische Zeit ist, die sich häutende, immer reinere Kultur, ist die jüngste Illusion. Sartre vertrieb Gott auch aus diesem Kulturversteck, mit dem blanken Satz: »Die Kultur vermag nichts und niemand zu retten; auch rechtfertigt sie nichts.« Das ist ein Nihilismus, der weder zynisch noch gefährlich ist. Die Wortgespinste derer, die glauben machen, daß Wahrheit mit Menschlichkeit in schöner Ehe lebt, tragen heute die unverlorenen Illusionen.
Nur hätte Sartre hinzufügen sollen, daß die Schöpfungen der Götter und ihrer Kulturen manchen Schmerz und manche Angst gelindert haben … wie Marx und Freud wußten.
Wer im Kreise der Professionellen lebt, vergißt allzu leicht, daß sie zwar vorgeben, das Bewußtsein der Ladenmädchen, Ingenieure und Krebsforscher zu spiegeln, aber kaum darüber nachdenken, ob dem wirklich so ist. Einsamkeit, Leere, Ennui, die Flucht vor sich selbst (das Bündel wird meist Entfremdung genannt) … ist leicht zu photographieren – und mit Hilfe des gängigen Vokabulars wortreich zu beschreiben: sowohl für Illustrierte als auch im Dienste einer soziosophischen Leithammel-Idee.
Köhlerglauben sind ebenso stringent zu beweisen wie Wahrheiten; wäre die Vernunft nicht so ein großartiges Werkzeug – wie könnte sich sonst soviel Unvernünftiges durch die Jahrtausende erhalten haben. Aber die bisher letzte atheistische Mythe ist so dünn, daß nicht einmal die raffinierteste Vernunft ihr helfen kann. Von der guten Dialektik leben wohl nur ihre tüchtigen Verkäufer.
Wie aber ist der Atheismus von Millionen Christen, Rationalisten, Klassenkämpfern und Kaufleuten beschaffen? Wie stand es gestern mit ihm? Es gilt vielen als ausgemacht, daß es vor der Ära der Schutzlosigkeit, in der wir (den Diagnostikern zufolge) leben, eine Jahrhunderte lange Epoche der Geborgenheit gab. So sagten es die großen Fabeldichter Novalis und Henry Adams und einige fragwürdigere Hinterbliebene, die den ›Verlust der Mitte‹ beweinen.
Wahrscheinlich war der fruchtbarste Hersteller der »Mitte«: ein weiter und breiter Analphabetismus. Wer ohne Abece lebt, quält sich nicht (wie Teilhard de Chardin): Gott, Vater und Geist mit der neuesten Version des Darwinismus zu versöhnen. Zur Zeit der »Mitte« wurden die Naturforscher erfolgreich beschattet; sie konnten auch nicht gefährlich werden, solange das Volk nicht imstande war zu lesen – und schon gar nicht lingua latina. Der Analphabetismus war in allen Kulturen der haltbarste Kitt ihrer Einheit. Heute ist das monolithische Vokabular der straff zentralisierten Staaten immerhin noch das Zweitbeste, der Analphabetismus des Zwanzigsten Jahrhunderts.
Es war leicht, sich mit einem erlernten Himmel zu trösten, als man vor dem Nachdenken behütet war; auch sind hundert Arbeitsstunden pro Woche eine große Protektion. Zwar war Papst Innozenz III. ungeschützter als Schopenhauer. Eine Reihe anarchischer Nonnen des zwölften deutschen Jahrhunderts, deren Briefe wir haben, hätten ins Fin de siècle gepaßt, am Ende des Jahrtausends. Aber die Massen waren recht gebunden – an die Bibel und ihre Sterndeuter.
Der herrschende Zeitgeist hingegen produziert den zerrissenen, ausgebeuteten, verdinglichten, gequälten, entmenschten, materialistischen, gottfernen Menschen (wenn man die Wortschätze vermischen darf). »Ist es nicht so, daß alles innere Leben der Menschen einem Feld von Unkraut gleicht?« fragen evangelische Bischöfe. Und die atheistischen, deren Pathos der Hohn ist, machen »Innerlichkeit« zu einer Vokabel der Verachtung. Seit je benutzten die erfolgreichsten Prediger das Dunkel als Hintergrund für den Glanz, den sie anboten. Das mythische Düster und das mythische Hell sind auch die beiden Hauptrequisiten der atheistischen Theologen. Trotzdem sind sie nicht populär, angesehen nur in der Luxusklasse der Eingeweihten.
Das neue Heil ist in Zirkulation nur im kleinen Kreis derer, die es herstellen und ästhetisch genießen. Der (verehrte) Tillich versucht passioniert, mit seinem Gottmenschen gegen das Sinnlose anzugehen. Wie weit es ihm hilft, ist sein Geheimnis; Kierkegaards Größe bestand darin, daß es ihm nicht gelang, gerettet zu werden. Die Entmythologisierung des Atheismus ist am gründlichsten da – nicht in der von Spezialworten glänzenden Elitenkultur, sondern in der Massenkultur, die (primitiver, gröber, wahrer) den herrschenden Unglauben weniger verdeckt. Es fragt sich, ob die »Entfremdung« nicht ein Selbstporträt der Intellektuellen ist. Man könnte sie als die Rasse bezeichnen, die gewohnheitsmäßig distanziert, also fremd macht. Die andern haben weniger Zeit für dieses Geschäft, rücken sich und die andern weniger ab. Die Entfremdeten aber verketzern das Nahe als »unreflektiert«, »privat«.
Privat ist: wer überleben will – Essen, Kinder und andere Ablenkungen. Diese milliardenfachen Aktivitäten liegen unterhalb des Höhenblicks der Höhenmenschen – jener Kulturdiagnostiker, die ihre Arbeitszeit damit verbringen, sich zu empören, weil der Fernsehansager, sich anschmierend, so tue, als meine er mich und dich (übrigens: die Phantasie eines hypertrophen Narziß). Was diese professionell Entfremdeten aber tun, wenn sie nicht reflektieren – reflektieren sie nicht.
Die täglichen Auflagen, die jedermann präsentiert werden, sind die Dämme gegen das Überfluten durch eine Trauer, die einst am zuverlässigsten von dicken Ammenmärchen ausgesperrt wurde. Wer kann sich heute noch ihrer rühmen, wo jedes Kind lernt, daß die Menschheit sich um ein so gefährliches Gestirn wie die Sonne dreht? ln Deutschland gibt es noch achtzig hilfreiche Sekten; ihre Mitgliederzahl ist minimal.
Hilfreicher sind die Ablenkungen: sowohl die Kinos an der Ecke als auch die spirituelleren für alle, die gelernt haben, sich raffinierter zu entziehen. Musil konnte sich in ein Gebilde einspinnen, das ein Meisterwerk wurde; doch: was es für ihn leistete, war unabhängig vom Gelingen. Es gibt wohl nur wenige, die imstande sind, sich eine so mächtige Höhle zu bauen.
Die Elitärkultur hat mit der Massenkultur gemein: daß in der Freizeit (zu der auch der Schlaf gehört) vergessen werden kann, was man in der nicht freien durchmachen muß. Wer Kartoffeln kauft oder den Malerpinsel auswäscht oder Fingerübungen macht oder eine Fakultätssitzung durchsteht oder Müll abtransportiert, ist gnädig verhindert, der Vergeblichkeit menschlichen Denkens und Tuns nach-zu-denken. Auch der blanke Atheismus ist deshalb nicht so gefährlich, wie die meinen, deren Position durch ihn gefährdet wird. Man hatte immer sowieso nur wenig Zeit, an Gott zu denken. Eine alte bayerische Bäuerin, die ich verehrte, hatte nur auf dem Klo die Ruhe, den Rosenkranz zu beten.
Daß gerade der Atheismus zur Barbarei führen soll, ist durch die Geschichte aller Religionen widerlegt, die oft genug dahin führten; und die Historie der dialektischen Vernunft weiß ebenso von Morden und vom Sengen zu berichten wie die Geschichte der undialektischen Unvernunft. Im Namen des Lichts wurde viel Dunkel propagiert; diese Gefahr wenigstens ist heute etwas geringer, weil kein Licht mehr so blendet wie einst. Und es besteht Hoffnung, daß Kreuzzüge immer weniger Chancen haben, weil die Skepsis wächst: das einzige Heil, das etwas leisten kann.
So haben die Pessimisten eine Chance. In vielen Gewändern ist ihnen eins gemein: daß ihre Hoffnung auf die Zukunft nicht überschwenglich ist … und daß sie deshalb die Gegenwart nicht so ressimentalisch negieren. Die Priester reden zuviel vom Materialismus. Die Aufklärer reden zuviel von Dummheit. Die Dialektiker reden zuviel von Entfremdung. Die drei Erlösungsspezialisten sehen zu wenig das, worauf man nicht wartet, sondern was man hat: etwas Liebe, etwas Güte, etwas Treue, etwas Solidarität, die man gezeigt und empfangen hat.
Es ist leicht, die Gegenwart zu verdammen. Man schüchtert ihre leisen Liebhaber ein, indem man sie heruntermacht: sie fixierten das Bestehende, eine schlechte Wirklichkeit, ein falsches Bewußtsein … und so weiter und so weiter; jeden Tag werden die alten Schulmeister-Muster kopiert und (geschickter oder verquatschter) abgewandelt. Die, welche die Gegenwart nicht als dunkle Folie des Es-wird-einmal sehen, werden als Lakaien der Ausbeuter verketzert. Kurz: ein Optimist ist ein Mann, der den Jüngsten Tag strahlend ahnt … und sich in wohl- oder weniger wohlgesetzten Worten windet vor der Häßlichkeit des letzten Films. Der Pessimist hingegen darf im Heute Paradiesisches sehen, versucht mit schwachen Kräften, ein böses Detail zu zerstören … und schenkt dem jenseitigen und diesseitigen Jenseits keine Gedanken, weil er es für einen nicht mehr wirksamen Trost hält.
Einer der herrischsten Progressisten (auf dem Papier) meinte: die Freudenträne während eines Schubertlieds entquelle der Vorwegnahme einer ausbeutungsfreien Gesellschaft. Was für eine trockene Träne! Der Mann hat offenbar nie Schönheit und Liebe erlebt – und muß sich deshalb an fiktive Drüsen halten. Aber jeder x-beliebige Film, der (unabhängig von seinem künstlerischen Rang) die Erfahrung des Mitleids, der Dankbarkeit, der Vertrautheit aktualisiert, kann diese Freudenträne hervorbringen. Nur verhärtete Individuen flüchten in die Zukunft … und zur Reduktion der Massenkultur auf die Habgier der Hersteller (die doch nicht das geringste sagt gegen eine gute Wirkung der hergestellten Produkte).
Gibt es Trost vor dem Schicksal (wie wir es kennen – und über ein anderes zu reden ist billigste Phantasterei)? Es gibt ein bißchen Trost: ein Bach, ein Lied, eine Mahlzeit, ein beglückendes Buch, eine Zweisamkeit, deren Bedeutung nicht davon abhängt, wie lange sie dauert … es gibt manchen Trost unter einem Himmel, der auch einmal strahlend blau sein kann, ohne von einem Mythos angestrahlt zu werden.
Wer sich weder mit dem Zweiten Kommen Christi noch mit dem ersten Kommen der ausbeutungsfreien Gesellschaft trösten kann, wer weder bei atheistischen noch stalinistischen Theologen Schutz findet, hat als skeptischer Atheist nur einen Weg: die Übel, die zugänglich sind, gemäß seiner bescheidenen Kraft entfernen oder wenigstens schwächen zu helfen – und zu akzeptieren, wo sich Gesundbeter auf eine ferne Zeit hinausreden, die wir nicht ahnen können und schon gar nicht erleben.
Die Zukünftler existieren in vielen Schattierungen: die besten sind noch die, welche ernsthaft glauben, daß ohne ihren Überschwang nichts verbessert wird. Die Schlechtesten sind alle, die vor sehr konkreten Übeln ausweichen in imaginäre; die hämische Interpretationen erfinden, um literarisch über das Erfundene siegen zu können. Manche Kulturkritik ist nichts als Wichtigtuerei.
So ein Kulturarzt stilisiert sich und die Freunde auf platonische Ideen … das Private, das Psychologische verheimlichend. Es fehlt ein Buch über die Geschichte der deutschen Antipsychologie und die Vielfalt ihrer Motive. Von Hegel bis zu Stefan George und einigen lebenden Soziologisten wird das Psychologische verachtet – bisweilen, um sich zu tarnen. So schafft man die Denkmäler einer Siegesallee, der Clique zu Ehren. So wird man billig fertig mit den zentralen Übeln, zum Beispiel dem Körper, dem sichtbarsten Zeugnis der Vereinzelung. Wer nicht wegsieht, wird als unreflektiert, naiv, vor allem als Unterdrücker stigmatisiert. Wo ist der Humorist, der die Marschkolonnen im Elfenbeinturm zeichnet? Sie weben am letzten Mythos des Atheismus.
Sie sind die letzten Priester. Wenn sie abgetreten sind, gibt es für die Befreiten nur noch: Staunen vor der Sphinx und eine Entschlossenheit zur Vermenschlichung, die nicht prinzipiell, nur jetzt und in diesem Wirkungsfeld praktiziert werden kann.
Alles philosophische Raunen ist da nur ein Ausweichen … ärmlicher Rest theologischer und philosophischer Gewißheiten. Pessimismus wird eine Selbstverständlichkeit werden … und nie verhindern, daß es Freuden gibt und die himmlische Vielfalt der Lust. Wir Armen sind am wenigsten erzogen, unter einem schwarzen Himmel die Stunden einer kurzen Aufheiterung zu genießen. Aber nur der kann heiter sein, der weiß, was auf ihn wartet.
I. Zur Orientierung
Geburt, Verfall und Wiedergeburt eines Wortes
Lange, bevor es das Wort Pessimismus gab, war da, was es ausdrückt.
In der Ilias heißt es: nichts Elenderes als der Mensch. Von Hesiod stammt, was im Oedipus zu Colonus die Jahrtausend-Prägung erhielt: »Das Beste ist, nicht geboren zu sein, oder, wenn schon geboren, dann bald wieder von hinnen zu gehen.« Thaies erklärt: er bleibe unverheiratet – »aus Liebe zu Kindern«. Heraklit verglich die Zeit einem spielenden, sich im Brettspiel übenden Kind – »und dies Kind hat die Königsgewalt«. Aristoteles fragte: »Was ist der Mensch?« – und antwortete (gut schopenhauersch): »Ein Denkmal der Schwäche, eine Beute des Augenblicks, ein Spiel des Zufalls; der Rest ist Schleim und Galle.« Der Komödiendichter Menander fügte hinzu: »Am glücklichsten ist, wer früh den Jahrmarkt des Lebens verläßt … Wenn ein Gott dir nach dem Tode ein neues Leben verspräche, so solltest du dir wünschen, lieber alles andere, selbst ein Esel zu werden, nur nicht wieder ein Mensch.« Im dritten Jahrhundert vor Christo lebte in Athen ein Mann, der den Beinamen Peisithanatos erhielt. Er sprach in seinen Vorträgen mit gutem Erfolg für den Selbstmord. Der Titel einer seiner Schriften, die Cicero erwähnt, hieß: Apokarteron – einer, der das Leben nicht mehr aushält und sich durch Hungern tötet. Die westliche Zivilisation begann mit den heiteren Griechen.
Mehr als zweitausend Jahre später wurde der trübe Sinn auf das Wort Pessimismus getauft. Nach Kant, dessen Werk voll ist von den bittersten Klagen, hatte keinen Namen, der sie zusammenfassend benannte. Der »Optimismus« war als aggressiver Spitzname in die Welt gekommen, geprägt von einem Professor Jean Pierre de Crousaz in Lausanne. Die Betroffenen hatten ihn, wie das oft geschah, als Ehrennamen akzeptiert und führten ihn als ihr Panier ins philosophische Feld.
Der »Pessimismus« hatte offenbar eine weniger ansehnliche Herkunft; er ist als sprachliches Seitenstück entstanden. Vor dem Jahre 1776 kann er nicht nachgewiesen werden. Damals tauchte er auf in einer Wendung Georg Christoph Lichtenbergs: »der eine mit seinem Optimismus, der andere mit seinem Pessimismus«. Fast gleichzeitig kam er in vielen Ländern auf: 1793 bei Jacques Mallet du Pan, 1794 in den Briefen des englischen Dichters Coleridge, 1801 bei Friedrich Maximilian Klinger.
Im neunzehnten Jahrhundert wuchs er dann mächtig heran – sehr langsam. 1819, im ersten Band der Welt als Wille und Vorstellung, kam er noch nicht vor – auch den Rezensenten des Buches ist er noch nicht geläufig, obwohl in jenem Jahre bereits ein Internationaler Pessimisten-Kongreß hätte stattfinden können: Byron, Leopardi, Chateaubriand und Schopenhauer hielten sich zur gleichen Zeit in Italien auf. 1835 ließ die Académie Française das Wort »Pessimiste« zu, 1878 das Wort »Pessimisme« – hundertsechzehn Jahre nach dem »Optimisme«. 1844, im zweiten Band von Schopenhauers Hauptwerk, erschien es zwar an drei Stellen – aber erst an drei. Heinrich von Stein irrte sich, als er schrieb: dies Wort sei als geistvoller Scherz von Schopenhauer erfunden worden.
Erst in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts kam es zu hohem Ansehen. Da gab es ein Pessimisten-Gesangbuch und Perlen pessimistischer Weltanschauung; die Perlen-Sammlung versprach im Vorwort, »einen Teil des Reinertrags dem Fonds für die Errichtung des Schopenhauer-Denkmals zuzuwenden«. Das Monument Schopenhauers wuchs und wuchs. Es bestand aus Scherben, gesammelt von einem müden Mann; die Stimmen des Weltleids