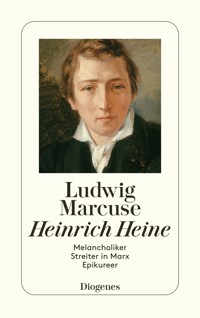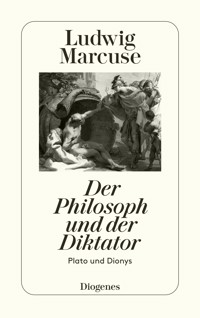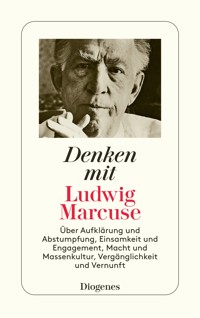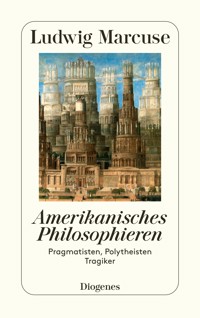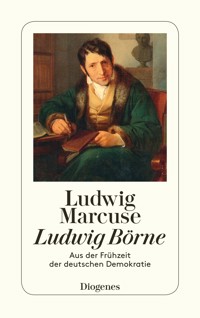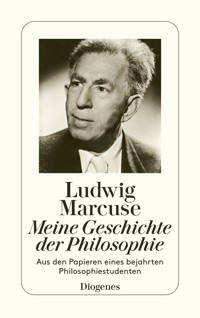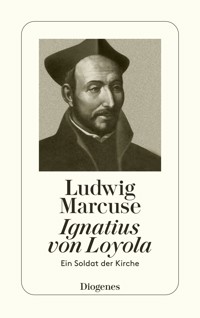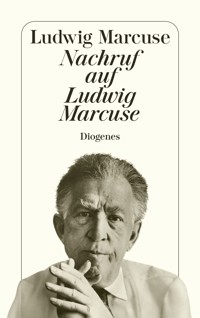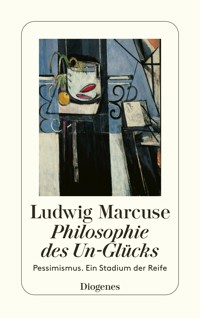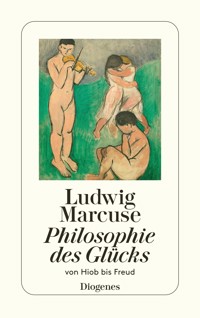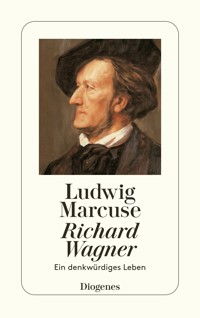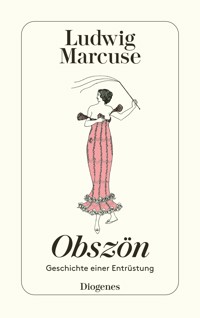
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Frage: was empfindet man in der Literatur als obszön? demonstriert und erläutert Marcuse an sechs großen literarischen Skandalen: Schlegels ›Lucinde‹, Flauberts ›Madame Bovary‹ und Baudelaires ›Blumen des Bösen‹, Schnitzlers ›Reigen‹, ›Lady Chatterley‹ von D.H. Lawrence und ›Wendekreis des Krebses‹ von Henry Miller. Ludwig Marcuse zieht in dieser seiner bekanntesten Veröffentlichung als kritischer Freigeist und Entlarver mit viel Temperament gegen Muckertum und Heuchelei ins Feld.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 534
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ludwig Marcuse
Obszön
Geschichte einer Entrüstung
Diogenes
Obszön: seit Jahrhunderten steckbrieflich verfolgt – und nicht gefaßt
»Priapeia« (eine berühmte lateinische Anthologie):
Sehr unanständig,
obwohl für ein gebildetes Publikum geschrieben.
Wörterbuch der Antike
Das lehrt die lange Geschichte: obszön ist, wer oder was irgendwo irgendwann irgendwen aus irgendwelchem Grund zur Entrüstung getrieben hat. Nur im Ereignis der Entrüstung ist das Obszöne mehr als ein Gespenst.
Die Identität ist noch nicht komplett. Die spezielle Entrüstung, die einen ihrer beliebtesten Namen im Schimpfwort Obszön hat, richtet sich gegen den Bereich des Sexuellen und benachbarte Gebiete.
Und weil dies Obszöne eine Gleichung mit mindestens sechs Unbekannten ist, seufzen die Juristen noch heute: daß es keine Definition gibt, mit der man Gesetze machen kann … und machen sie dennoch.
Das Wort: Verwandtschaft, Ton, Herkunft
Der zweisilbige Laut Obszön ist die Königin im Schwarm der Synonyme. Sie heißen, sehr allgemein: pikant, unschicklich, ungebührlich, frech, verdorben; etwas enger: unanständig, unzüchtig, unrein, unkeusch; sehr aggressiv: schmutzig, schlüpfrig, unflätig, schamlos. Alle diese Vokabeln und noch viele mehr sind schon einmal füreinander gesetzt und gegeneinander gesondert worden. Die Sprache war sehr erfinderisch in der Verlautbarung dieser Abneigung.
Bisweilen auch grotesk irreführend. Die stärksten jener Abwertungen sind die erstaunlichsten: »tierisch«, »schweinisch«. Übernehmen sich eigentlich Tiere sexuell? Haben Schweine das große Reich sexueller Vergröberungen und Verfeinerungen (auch Perversionen genannt) entdeckt – wie sie im indischen Kamasutra geschildert sind, an den Wänden der römischen Villen in Pompeji und in der unsterblichen Liebes-Technik, die der Dichter Ovid verfaßt hat? Wie man auch diese Früchte menschlicher Phantasie und phantasievoller Praxis einschätzen mag, die Tiere im allgemeinen und die Schweine im besonderen pflegen nicht ihre Einbildungskraft in den Dienst von Steigerung und Differenzierung der Lüste zu stellen; das ist ein Privileg der menschlichen Kultur.
Die Linguistik hat diese Kultivierung kaum beachtet. Das Vokabular rund um das Obszöne ist nicht arm; doch ist die Geschichte der verfemenden Worte ebensowenig aufgehellt wie das, was sie bezeichnen. Im Achtzehnten Jahrhundert redete man gern von »Libertinage« und, galanter, von »Galanterie«. Sie benannte einmal etwas Lockeres; Christian Thomasius empörte sich, daß sie »bei uns Teutschen so gemein und sehr mißbraucht worden ist«. Unfreundlicher klingt heute das damalige Wort Frivolität; es war wohl schon immer (wenn auch nicht immer so böse) die zynische Variante der unanständig-galanten Tändelei. Wer studierte den Bedeutungswandel?
Die Gelehrten, deren Pflicht es ist, den Wortschatz zu registrieren, blank zu putzen und dem Ursprung nach zu bestimmen, lassen das Obszöne seinen schlechten Ruf entgelten. In einem programmatischen Brief an Lachmann erlaubte Jacob Grimm nur jenen unanständigen Wörtern Eintritt in sein Wörterbuch, welche Schriftsteller im Affekt nicht entbehren können und ein guter Komiker nötig habe. Der größere Rest, den die Menschheit nicht entbehren will, kümmerte ihn nicht. Das Wort Obszön kam nicht zur Darstellung. Wann und in welchem Sinn hielt es seinen Einzug ins Deutsche?
Man sollte ein Lexikon der gemiedenen Sprachen schaffen. Ethnologen hätten in Erfahrung zu bringen, ob es auch außerhalb der Hoch-Kulturen Vokabeln gibt, die privat mit Genuß gebraucht, deren öffentliche Preisgabe aber bestraft wird. Klassische Philologen sollten mitteilen, ob dies »Naturalia non turpia« sagt: daß es in der Antike keine bemakelten Worte gegeben hat; ob der berüchtigte Pornograph Sotades aus Thrazien eine Ausnahme gewesen ist oder nur einer der wenigen Überbleibsel eines blühenden Zweigs der Schriftstellerei. Die Sprachforscher aber sollten eine Universal-Geschichte der linguae obscoenae schreiben: der alltäglichen und der literarischen.
Wer auf der Suche nach der Identität eines Begriffs ist, pflegt, wenn er sich keinen Rat mehr weiß, dem Ursprung des Wortes nachzugehen. Der verliert sich bei solchen Existenzen nicht selten im Dunkel. So ist es auch mit unserem Helden Obszön. In welchem Land ist er zur Welt gekommen? Bei den Römern? Die Etymologie ist eine der fruchtbarsten Stätten der Phantastik; sie hat auch auf der Suche nach dieser Geburt üppig geblüht.
Haben die Osker, die Ureinwohner Latiums, dies Zukunftsreiche hervorgebracht? Ihre Sprache starb schon zu Beginn der römischen Kaiserzeit aus; nicht günstig für die Fahndung nach dem oskischen Erzeuger. Vor allem muß man daran denken, daß ein Wort mehr als einen Vater haben kann.
War einer die scena: was einem vor der Bühne bewußt wurde, erhielt von ihr den Namen? Vielleicht am populären Feste der Flora, wo es hoch herging – und doch besuchte an diesem Tag selbst der strenge Cato das Theater? Während jener unpolitischen Mai-Feier gürteten die Schauspieler ihre Lenden mit Phallen aus Leder – und trieben einen Schabernack, den man obszön nannte? Der englische Sexual-Forscher Havelock Ellis, auf denselben etymologischen Spuren, fand das genaue Gegenteil; und übersetzte Obszön mit »off the scene«, hinter den Kulissen – ein Wort für etwas, was nicht im Rampenlicht erscheinen konnte.
Heute wird es von caenum abgeleitet: Schmutz, Schlamm, Kot, Unflat. Auch wurde caenum für Schamglied gebraucht, der Plural sowohl für Schamteile als auch für den Hintern. Im römischen Schrifttum drückte obscenum eine ästhetische Aversion aus (scheußlich), eine moralische (unsittlich) und eine vitale (eklig). Bei Cicero, Ovid, Livius, Tacitus trat es bisweilen auch recht unspezifisch auf: im Sinne von pöbelhaft, garstig.
Im Kern aber war fast immer das Sexuelle. »Obsceno verbo uti« bedeutete: eine Zote reißen. Das Wort zotig ist auf der Grenze zwischen moralischer und ästhetischer Abwertung.
Der Papst, der amerikanische Supreme Court und ein deutscher Candidatus philosophiae definieren
Kommt man auf der Suche nach dem Ahn eines Findlings wie Obszön nicht weiter, so wendet man sich an die Geschichte der Definitionen, die er erhalten hat.
Viele sehen in solchen Produkten ein hartes Stück konzentriertesten Denkens: hergestellt von strengen Gelehrten für strenge Gelehrte in strengem Bemühen. Schaut man genauer hin, so ist das Geschäft des Begriff-bestimmens bei solchen Windhunden von Worten viel lustiger; es handelt sich nur um Emotionen, die auf akademisch stilisiert worden sind. In den definitorischen Antworten auf Fragen wie: was ist Glück? was ist obszön? hat man die epigrammatischen Autobiographien von Zeiten, Schichten, Persönlichkeiten.
Dies Obszön ist immer recht passioniert definiert worden. Denn im Verhalten zur Sexualität hat man eine noch leidenschaftlichere Anteilnahme gezeigt als im Verhalten zu Gott und zum Staat – heute, in unserem Klima, heiße Eisen zweiten und dritten Ranges. Ja, ein schlechtes Benehmen in sexualibus war immer auch eine Beleidigung des Herrn im Himmel, des Landesfürsten und des Mitmenschen. Es ist noch nicht lange her, daß ein englischer Richter (im Oscar Wilde-Prozeß) sagte: ein Mord-Fall wäre ihm nicht so zuwider wie diese Verhandlung über die Liebes-Briefe, welche der angeklagte Dichter an seinen Freund Lord Douglas geschrieben hatte. Und es geschah im Jahre 1962, in einem bayrischen Mord-Prozeß, daß der Vorsitzende, der die Angeklagte zu Geständnissen ermutigen wollte, breit verkündete: »Eine unverheiratete Frau, die Beziehungen erotischer Natur hat, braucht deshalb noch keine Mörderin zu sein.«
Da ist es kein Wunder, daß dem Obszön durch die Jahrhunderte immer wieder einmal ein Steckbrief nachgesandt wurde: auf daß man es endlich dingfest mache, wo immer man es träfe. Das Resultat ist beängstigend. Es ist wie im »Sommernachtstraum«: im Irrgarten der Entrüstung glaubt man hier und da den Bösewicht gepackt zu haben – und hat ihn dann doch nicht. So beschlossen die Amerikaner, Goyas »Maya« nicht mit der Post zu befördern (ihre Form der Zensur); während die Spanier diese Obszönität als Briefmarke benutzten. Das katholische Spanien sah nichts Unzüchtiges in einem Bild, das in dem Land, in dem (wenigstens der Verfassung nach) Staat und Religion getrennt sind, als obszön betrachtet wurde. Bei diesen Verfolgungen handelt es sich ganz offenbar um einen der rätselhaftesten Banditen.
Es gibt zwei Gruppen, die an seiner Identifizierung schon professionell interessiert sind: die Juristen und die Moral-Philosophen; die Rechtsprecher noch mehr, weil die ewigen Probleme auf Lösung warten können (die wichtigsten warten schon Jahrtausende), die Verbrecher aber nicht. Sie sterben weg, bevor man das zuverlässige Gesetz gemacht hat, nach dem sie ihre verdiente Strafe erhalten. So klagten Staatsanwälte, eingestandenermaßen, mit schlechtem Gewissen an. Aber lieber Gesetze, an die man nicht glaubt, als gar keine. Schon Paulus sagte: »Wo kein Gesetz ist, wird die Sünde nicht registriert.« Um dieser Registrierung willen hat man Obszönitäts-Paragraphen in die Welt gesetzt – und zu gleicher Zeit gestanden, daß man nicht weiß, was das eigentlich ist: obszön.
Unter den Gesetzgebern ist einer der ältesten die katholische Kirche. Allerdings war sie in manchem Jahrhundert nicht so sehr interessiert, wie man meint. Ihr erster Katalog Verbotener Bücher stammt aus dem Jahre 496 und verzeichnet vor allem, was auch späteren Indices immer das Wichtigste war: die Schriften der Häretiker. Nur selten wurde auch einmal Unflätiges aufgenommen. So setzte Pius II., mit seinem Schriftstellernamen Aeneus Silvius de’Piccolomini, die Erotica, die er in seinen frühen Jahren verfaßt hatte, auf die Verbots-Liste.
Neunzehnhundert erschien die endgültige Redaktion: »Der Index der Verbotenen Bücher, neu bearbeitet und herausgegeben auf Geheiß und im Namen Leo XIII.«. Hier heißt es: »Bücher, welche schmutzige und unsittliche Dinge planmäßig (ex professo) behandeln, erzählen oder lehren, sind streng verboten.« Dies »planmäßig« war bereits eine alte, aufklärerische Einschränkung und hatte außerdem eine große Zukunft; wenn Unanständiges nicht »planmäßig« dargestellt wurde, war offenbar kein Einwand. Das öffnete eine Tür, sperrangelweit.
Der amerikanische Supreme Court sagt es heute ganz ähnlich. Vielleicht unterstreicht er stärker das Erlaubte: »Die Darstellung von Sexuellem, zum Beispiel in den bildenden Künsten, der Literatur und wissenschaftlichen Werken, genügt noch nicht, um die konstitutionelle Rede- und Presse-Freiheit zu verweigern.« Im übrigen arbeiten die Juristen des Staats, der keine Religion hat, mit ähnlichem Wort-Schaum, wie die Juristen jenes Staats, der nichts als Religion hat.
Das amerikanische Law Institute, eine Vereinigung von Richtern und Anwälten, welche neue Gesetze präparieren, definiert: etwas ist obszön, wenn es vor allem der Unzucht dient – zum Beispiel einem schändlichen, morbiden Interesse am Nackten, am Geschlecht oder am Exkrement. Der päpstliche Gesetzgeber ging nicht ins Detail und sagte trotzdem nicht weniger; aber das ist auch gar nicht möglich. Die amerikanischen Gelehrten machen mit Floskeln wie »schändlich« und »morbid« das Unbekannte nicht bekannter.
Doch steckt hinter den Nichtsen aus Buchstaben eine Metaphysik, die den Tautologien einen Sinn gibt (wenn auch nicht einen lebenden). Die christliche, mit dem Wert-Dualismus von Leib und Seele, ist bekannt; in vielen Schattierungen wird der Körper ein wenig oder noch weniger zugelassen. Die amerikanischen Rechtslehrer, in einer nicht so glücklichen Lage, weil sie nicht mehr eine massive Philosophie vorfinden, auf der sie ihre Gesetze errichten können, müssen bei Soziologie und Tiefen-Psychologie kurzfristige Anleihen machen, um die große gefürchtete Unbekannte Obszön streng wissenschaftlich zu exorzieren. Die Kirche tut es mit dem schlichteren Requisit: Sünden-Fall.
Der moderne Mythos ist viel wackliger, weil er nicht so ehrwürdig ist. Er steht im Falle der amerikanischen Theoretiker auf zwei Thesen. Erstens: jeder ist zwei einander entgegengesetzten Trieben unterworfen: dem sexuellen (inklusive der geschlechtlichen Neugierde) – und der Furcht vor der Gesellschaft, die ihn kontrolliert. These Zwei: diese Unterdrückung bringt Schamgefühl, schlechtes Gewissen und Verlegenheit hervor, wenn Sexus aktiviert wird. Die Anklage lautet: Leute, die Geld damit machen, daß sie jenen Konflikt noch verschärfen, indem sie Salz in die Wunde streuen, sind jenseits der Grenze des Erlaubten.
Der Garten Eden leuchtet ein. Auch der Grund, weshalb Adam und Eva ihn wahrscheinlich verlassen mußten: der Teufel entrüstete sich noch obendrein. Diese Juristen aber, unsere Zeitgenossen, reden Kauderwelsch. Frage Eins: also ist etwas Fragwürdiges dann obszön, wenn es für Geld hergestellt worden ist? Dann müßte man Shakespeare daraufhin untersuchen, bei welchen unflätigen Sätzen Gewinnsucht im Spiele war. Und wenn jemand nun zu seinem Privat-Vergnügen höchst Riskantes offenbart? Frage Zwei: das Obszöne streut Salz in die »Wunde« (eine pathetische Methapher für Konflikt)? Ist dies Obszöne wirklich eine Verschärfung der Spannung? Nicht vielleicht für den, der es schafft, und für die, welche es genießen, eine Entspannung? Wagt man sich heraus aus dem Schutz der Metaphysik vom »Gefängnis« Leib und der himmlisch-freien Seele – so verliert man den Boden, auf dem allein man dem Obszönen begegnen kann: mit dem platonisch-christlich-deutschidealistischen Dogma.
Die päpstlichen und demokratischen Definitionen sind Zwillinge in einem charakteristischen Zug: sie leiten gern die Armut von der pauvreté her, das Obszöne von der Schweinerei. Das Ganze paßt ihnen nicht: theologisch oder wissenschaftlich begründet. Das Zeughaus für ihre Argumente steht schon eine ganze Weile. Im Jahre 1688 schrieb ein Leipziger Doktorand seine Dissertation unter dem Titel »De libris obscoenis«: so seien alle Schriften zu nennen, »deren Verfasser sich in deutlich unzüchtigen Reden ergehen und frech über die Geschlechtsteile sprechen oder schamlose Akte wollüstiger und unreiner Menschen in solchen Worten schildern, daß keusche und zarte Ohren davor zurückschrecken«. Dieser Johannes David Schreber aus Meißen hat bereits alles gesagt, was in den letzten Jahrhunderten von der Kirche, der Moral-Philosophie und der Jurisprudenz wieder und wieder repetiert – und nie aufgeklärt worden ist.
Er hat einen Teil des Vokabulars der Entrüstung ausgespien – kam man je weiter?
Zwei Griffe: das Obszöne zu packen
Unser X gehört zu jenen Rätseln von erheblicher Lebensdauer, die zwar nie gelöst – aber doch im Laufe der Zeiten in ihrer Rätselhaftigkeit etwas erhellt wurden.
Die beiden Königswege zur Erhellung zeichneten sich schon bei dem Kandidaten von 1688 ab. Der eine führt zum obszönen Menschen und seiner bösen Absicht: Reizung der Sinnlichkeit. Der andere führt zur bösen Wirkung: obszön ist, was reizt, beabsichtigt oder nicht. Die beiden Methoden gehören zwei verschiedenen Moral-Systemen an: die eine dem protestantisch-kantischen: der Sünder rechnet, nicht die Sünde; die andere dem katholisch-gesellschaftlichen: was einer wirkt, ist entscheidender als, was er will.
In den Rechtshändeln rund um das Obszöne hat man sich bald auf den subjektiv-moralischen, bald auf den objektiv-pragmatischen Standpunkt gestellt. Kläger und Verteidiger obszöner Kunst haben von beiden Maßstäben Gebrauch gemacht – je nachdem, was ihnen gerade günstig zu sein schien. Diese Schrift hier ist nicht im Dienste irgendeines bestimmten Streits. Kein Individuum und kein Werk wird angeklagt oder in Schutz genommen. Beide Wege, zum Obszönen zu gelangen, werden abgeschritten, um zu zeigen, daß sie Holzwege sind.
Die Frage nach dem Schöpfer des Obszönen hat (unter anderem) auch eine liberalisierende Wirkung gehabt: das unzüchtige Wort, die unzüchtige Wendung, das unzüchtige Bild, das unzüchtige Thema ist noch nicht – unzüchtig; alles kann züchtig werden, wenn der Urheber eine anima candida ist. In diesem Sinne liebten angeklagte Obszöne und ihre Anwälte, den Römer-Brief xiv 14 zu zitieren: »Ich weiß und ich bin des Herrn Jesus gewiß, daß nichts an sich gemein ist; nur dem, der es rechnet für gemein, dem ist’s gemein.«
Aber diesem Gemein ist immer wieder der Inhalt gegeben worden, den sogar der liberale Sexual-Forscher Iwan Bloch so formulierte: produziert »zum Zweck der geschlechtlichen Erregung«. Die Gleichung: Obszön gleich beabsichtigte sexuelle Stimulierung gleich niedrig beherrschte und beherrscht die Gedanken. Als im Jahre 1933 das New Yorker Bezirksgericht entschied: James Joyce’s »Ulysses« dürfe in den Vereinigten Staaten verkauft werden, schrieb der Richter John M. Woolsey als Begründung: das Werk sei zwar in manchen Passagen eine starke Dosis für einen empfindsamen normalen Menschen; »doch nach langer Überlegung bin ich der wohlbegründeten Überzeugung, daß der ›Ulysses‹, wenn er auch an vielen Stellen zweifellos etwas abstoßend wirkt, nirgends auf eine aphrodisische Wirkung zielt.«
Also: der deutsch-liberale Gelehrte Iwan Bloch schrieb gegen die »Erweckung grobtierischer Sinnlichkeit«, der amerikanischliberale Richter gegen jede »aphrodisische Wirkung«. In dem einen Fall wie im andern und in tausend ähnlichen Fällen fand man das verdammenswerte Obszön im Anfeuern jenes Triebs, dem jeder sein Leben, dem fast jeder die begehrteste, intensivste Lust verdankt. Vor der Verdammung dieses Reizens ist es nie zum Streit gekommen zwischen Anklägern und Verteidigern, zwischen den Engherzigsten und den sogenannten Freiheitlichen. Mit anderen Worten: die Debatte über Obszön hat noch gar nicht begonnen.
Die Männer, die hier kurz und bündig Liberale genannt werden oder die Freiheitlichen, sollten besser die Liberaleren, Freiheitlicheren heißen; denn nur im Vergleich mit ihren Gegnern verdienen sie den Ehren-Namen. Und da sie im Zentrum des Bildes stehen, das hier gegeben wird, ist zuvor ein Wort zum Thema Aufklärung, Befreiungs-Kampf nötig. Kaum jemand war je rundum ein Lichtbringer; dort erhellte er, an einem anderen Ort verdunkelte er vielleicht. Am meisten Widerstand gab es immer dort, wo sexuelle Vorurteile herrschten. Der Freisinn – weitgehend frei von religiösem und politischem Aberglauben – war und ist oft den ältesten Schauergeschichten über das Geschlechtliche verhaftet.
Oder es wurden einige gelichtet, andere aber nicht. Die liberale Illiberalität ist unerforschter als der Typ des unbeweglichen Konservativen; vor allem im Gebiet, auf das sich die Entrüstung über das Obszöne bezieht. Jene großzügigen Verständigen, die einen halben Schritt vorwärts machten, wurden auch dort als Helden des Fortschritts gefeiert, wo sie nicht fortschritten. Sie haben verdeckt: daß, wo das Reizen der Sinnlichkeit als unmoralisch verdammt wird, die ganze Sphäre der Sexualität bemäkelt ist. Die Stimulierung des Auges und des Ohrs wird gefördert. Die Sinne, welche man für zweitklassig hält, Geruch und Geschmack, werden gewohnheitsmäßig gereizt und nur selten böse zensiert. Was aber pointiert »Sinnlichkeit« genannt wird, ist unter strengster Bewachung.
Zwar hat man sich – mit Ausnahme einiger Unentwegter, von den Kirchenvätern bis zu Schopenhauer – mit der Geschlechtlichkeit des Menschen abgefunden. Aber doch nicht so sehr, daß nicht auch noch hinter den Sentenzen des mutigen Iwan Bloch so etwas geistert wie Ängstlichkeit: man kann den Geschlechts-Trieb nicht ignorieren, soll ihn aber nicht auch noch nähren. Das ist die Haltung in Zeiten, die nicht mehr unter dem Ideal der Enthaltsamkeit stehen … und nicht von ihm freikommen.
Deshalb wurde in den Gesprächen über das Obszöne nie in den Mittelpunkt gerückt, was allein entscheidend ist: weshalb ist »die Erweckung grobtierischer Sinnlichkeit« unmoralisch, gar kriminell? Und gibt es neben der »grobtierischen« noch eine feintierische? Und darf sie gereizt werden? Die Verurteilung hat in unserer Kultur nur einen Sinn innerhalb der platonisch-katholisch-protestantisch-idealistischen Metaphysik. Die Aufklärung hat dies Fundament zerstört, aber eben nur teils-teils. Die Vorbehalte gegen den Körper wurzeln hier nur noch in einer kraftlos gewordenen Tradition. Die Verfemung des »Grobtierisch«, der »geschlechtlichen Erregung« hängt bei den liberalen Verteidigern (gegen Angriffe auf Obszön) in der Luft.
Weshalb auch viele sich auf eine Linie zurückgezogen haben, die im Theologisch-Philosophischen weniger problematisch ist. Die Absicht des einzelnen wird in den Hintergrund gerückt, das Wohl der Gesellschaft in die erste Linie. Frühere Zeiten sorgten sich mehr um den Sünder, unsere Tage kümmern sich mehr um die Gruppe. Als das Individuum aus dem Zentrum der Aufmerksamkeit verschwand, wurden seine Verfehlungen belangloser. Die Sorgen wurden umfangreicher: die Nation, die Klasse, die Gemeinde wurden diagnostiziert und auf den Weg des Heils und der Heilung befördert. So soll, was als Obszön verschrien ist, zugelassen werden, wenn es »eine erlösende Wirkung im gesellschaftlichen Maßstab« mit sich bringt. Die Wendung klingt, als stamme sie aus der Sowjet-Union, kommt aber aus dem zwillingshaft ähnlichen Amerika. Der gute Wille, den allein Kant als moralischen Maßstab kannte, ist ersetzt durch das Wohl der Gesellschaft.
Schon der Doktorand von 1688 zog in seinen Betrachtungen nicht nur die Absicht der Autoren obszöner Bücher in Betracht – auch die Wirkung, die sie hervorbringen. Die Sittlichkeits-Hüter von heute, ihre Polizisten und Gerichte, sind mehr an den gesellschaftlichen Folgen interessiert als an der makellosen Seele des Inkriminierten (obwohl sie bei Freisprüchen immer noch herhalten muß).
Doch tritt sie in unseren Tagen zurück hinter dem anonymen Schaden, den eine anonyme Gesellschaft erleidet. »Schädlich«, eines der Lieblingsworte in diesem Zusammenhang, kam allenthalben in Gebrauch: bei Christen und Atheisten, Idealisten und Krämern, Kapitalisten und Sozialisten, Leuten von der Fürsorge und dem Altersheim, die sich sorgten, ihre Greise könnten angespornt werden, sich zu übernehmen; des Jugend-Pflegers muß noch gründlich gedacht werden. Dem Obszön wurde mancher Schaden zur Last gelegt: von Priestern und Ärzten und Lehrern und Gesetzgebern. Der Gegensatz von Schädlich wurde »Heilsam« (eine ins Religiöse spielende Kategorie) oder (biologisch) »Gesund« oder »Nützlich« (unter dem Aspekt der Staats- und Partei-Raison).
Die Entrüstung über den obszönen Einzelnen ist immer total gewesen. Wo die Wirkung der Maßstab ist, gibt es Teil-Entrüstungen – wie die mittelalterliche Kirche großartig illustriert. Sie war großzügig und ließ dem Würdenträger, sogar dem Volk sein Vergnügen, solange ihr Interesse nicht berührt war; und wurde erst empfindlich, wenn Darstellungen von Unanständigem Beamte des Kirchenstaates kompromittierten. So war der herrschende Katholizismus viel generöser als die nachkirchliche Gesellschaft. Boccaccio wurde scharf zensuriert, wo er Klosterbrüder hernahm; und dann enthielten die gereinigten Ausgaben alle Zoten, welche der kirchlichen Administration nicht wehtaten. Man hatte Geistliche in Zauberer verwandelt, Nonnen in adlige Damen, den Erzengel Gabriel in einen Märchenkönig … und das vorher beanstandete Buch war in Ordnung.
Am leichtesten ist die »Gesundheit« autoritärer Gruppen zu bestimmen, schwarzer oder roter. Da dekretiert ein Sowjet-Ideologe, im Namen seiner Herren: »Pflicht der Gesellschaft gegenüber ist stärker als irgendein Gefühl«. Und da das Obszöne ein Gefühl stimuliert, stärker von Natur als irgendeines, muß dieser mächtige Konkurrent niedergehalten werden. So war es logisch, daß die Sowjet-Union, die (wie das Frankreich von 1789) in ihren großen Tagen auch die sexuelle Befreiung durchzuführen suchte, am 25. November 1935 zu verstehen gab: man könne ohne ein Gesetz gegen obszöne Bücher und Bilder nicht auskommen. Es hat den entsprechenden kapitalistischen Brüdern eins voraus: die Strafe im Lande des freien Sozialismus ist besonders hoch, fünf Jahre Gefängnis. Der liberale englische Dichter E.M. Forster nannte diese Entwicklung rückschrittlich – und kommentierte: die »magische Frische«, die dem »Volk« zugeschrieben wird, gibt es nicht. Damit tat er dem Volk unrecht. Was hat es zu sagen, im Lande der Diktatur über das Proletariat? Daß aber das Obszöne auch dort so gefürchtet wird, weist daraufhin: daß Sexus ein sehr gefährlicher Revolutionär ist – besonders für Sprößlinge der Revolution.
Dort, wo die Interessen-Sphäre des Herrschers nicht so leicht abzugrenzen ist, wird die Bestimmung der gesellschaftlichen Gesundheit schwieriger. Da erfand man denn Definitionen wie: ungesund ist, »was geeignet ist, die eingeborene und erworbene erotische Reaktionsfähigkeit des Menschen physiologisch zu reizen«. Die Frage nach der Moral dessen, der reizt, fällt also fort; das Objekt der Reizung, »die eingeborene und erworbene erotische Reaktionsfähigkeit« ist im Vordergrund. Wer oder was aber ist dieser neue Unbekannte?
Er hatte eine Reihe von Vorgängern. 1688 waren es »keusche und zarte Ohren«. Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts berief sich das Deutsche Reichsgericht auf ein gewisses »normales Schamgefühl des Mitteleuropäers«. Heute sprechen amerikanische Soziologen von community standards. Reichsgericht und moderne Soziologie haben den keuschen und zarten Ohren voraus: daß sie eine starre Definition ausschließen. Das Obszön ist also in verschiedenen kulturellen und sozialen Schichten verschieden; diese Einsicht ist ein Vorwärts in der Richtung auf Toleranz.
Und trotzdem noch immer eine kindische Mär, gerade in der jüngsten Version. Was heißt: obszön ist, »was geeignet ist, die eingeborene und erworbene erotische Reaktionsfähigkeit physiologisch zu reizen«? Erregende Schriften und Bilder reizen nie »physiologisch«, immer nur die Einbildungskraft; und erst auf diesem Umweg die zuständigen Drüsen. Direkt »physiologisch« reizt nur – Nicht-Obszönes.
Der Forscher G.V. Ramsey veröffentlichte 1943 eine Untersuchung über siebenundsiebzig Ursachen, welche Knaben sexuell stimulieren. Nur dreizehn sind erotischer Natur. Unter den anderen fand er: Strafen, Prüfungen, Sitzen im warmen Sand, enge Kleidung, Fahren im Auto, aufregende Sportveranstaltungen. Und unter den dreizehn erotischen stand das Lesen von Liebesgeschichten (das man vielleicht verhindern kann) sehr bescheiden neben unendlich viel mehr Stimulantien, die nicht zu eliminieren sind: zum Beispiel das Denken an Mädchen und Beobachten von Tieren, die es treiben. Wie gering ist der Einfluß der erotischen Welt-Literatur zuzüglich der klassischen und weniger vornehmen Pornographie neben den nicht-fabrizierten psychologischen und physiologischen Reizungen der Sinnlichkeit!
Ist also schon diese »eingeborene und erworbene erotische Reaktionsfähigkeit«, die von Mensch zu Mensch wechselt, von Saison zu Saison, von Stunde zu Stunde … problematisch, so ist der Schaden, der dieser Reizung zugeschrieben wird, ein höchst abenteuerliches Gerücht, eins der unfundiertesten On dits. Eindeutig ist dieser Schaden nur, wo Sexus und Teufel gleichgesetzt werden. In Zeiten aber, in denen man mit der »Gesundheit« als oberstem Wert operiert (man sagt auch gern: leibliche und seelische Gesundheit), müßte schon sehr augenfällig gezeigt werden, in welcher Beziehung dieses sagenhafte Wohlbefinden affiziert wird; abgesehen davon, daß natürlich zuviel Sex ebenso ungesund ist wie zuviel Fett.
Immer mehr Forscher haben in jüngster Zeit bekundet, wie wenig der Schaden, den das Obszön anrichten soll, bisher substantiiert worden ist. Ein Jugend-Richter sagte: zu den 878 Gründen, die für Störungen in jungen Jahren verantwortlich zu machen sind, gehört nicht das Lesen von unschicklichen Büchern. Der Chef-Psychiater des Elizabeth Hospital in Washington: Wer obszöne Literatur liest, ist, da sie als Ventil angesehen werden kann, weniger in Gefahr, ein Sexualverbrecher zu werden. Der englische Gelehrte Dr. Robert Gosling: bisher hat noch kein Forscher etwas über die Wirkung der Pornographie veröffentlicht; eigene Erfahrungen deuten darauf hin, daß sie keinen gesellschaftlich belangvollen Effekt hat, zumindest keine Verbrechen hervorruft. Das New Research Center for Human Relations veröffentlichte eine Arbeit, die gegen die Überschätzung der Lektüre als Ursache für Wandlungen im Charakter des einzelnen gerichtet ist. Und der Psychologe Robert Lindner schrieb: wenn morgen alle zweifelhaften Bücher von der Erde verschwinden würden, wäre noch nichts geändert an der Kriminalität, dem unsozialen Verhalten, an Krankheit und Not.
Jeder spricht über den Schaden des Obszön-Konsums – und keiner hat diesen Schaden je gesehen. In England kam einmal ein Fall wegen Verkauf von Giften und ein Fall wegen Verkauf von Obszönitäten in denselben Tagen zur Verhandlung. Und die Sprache, diese größte Kupplerin, ermutigte den Richter zu der zeitgemäßen Metapher: daß der Verkauf von Obszönem »ein Handel mit Giften ist, tödlicher als Blausäure, Strichnin und Arsenik«. Anstatt Forschung – Wörter der Hölle: diese Technik aller Dunkelmänner ist in der Geschichte der Kreuzzüge gegen das Obszöne besonders beliebt gewesen.
Die empörte Anständigkeit verdient einen besonderen Abschnitt, weil sie durchaus nicht immer, wie Simplifikateure vorgeben, Heuchelei ist. Baudelaire erzählt, daß er einmal die Fünf-Franken-Dirne Louise Villedieu in den Louvre mitnahm, in dem sie noch nie gewesen war. Sie errötete, hielt sich die Hände vors Gesicht, zupfte ihren Begleiter immer wieder am Ärmel. Und fragte dann, »vor den unsterblichen Gemälden und Statuen, wie man nur solche Unanständigkeiten ausstellen könne«. Diese Anekdote verdient, als Monument errichtet zu werden über einem Massengrab, in dem »alle keuschen und zarten Ohren« beigesetzt sind.
Mademoiselle Villedieu ist viel ernster zu nehmen als jeder Feinschmecker, der für das kulturell servierte Obszöne eine Ausnahme macht; denn sie legte die Wurzeln der aufrichtigen Entrüstung bloß. Sie hatte gelernt, daß das Geschlechtliche als Beruf anständig ist … unanständig aber, wenn es überflüssigerweise an die große Glocke gehängt wird. Sie hatte nicht gelernt, daß Kunst ein Privileg ist, zu zeigen, was ohne das Prädikat künstlerischwertvoll nicht gezeigt werden darf; und sie kannte nicht die Namen der privilegierten Künstler. Sie wäre also, in aller Reinheit, bei den Prozessen um obszöne Kunst immer auf seiten der Staatsanwälte gewesen.
Obwohl diese Herren einen ganz anderen Beruf hatten – auch das Mädchen Louise spürte nicht, daß Kunst die gefährliche Wirkung mindert. Und es wird eine der reizvollsten Fragen sein: hat Baudelaires Begleiterin, hat mancher unmusische Ankläger nicht auch etwas recht gehabt … und worin?
Die vier unanständigen Literaturen
Jedes Pamphlet ist parteiisch, auch dies; unparteiisch allerdings in dem Glauben, daß die Stellungnahme nicht der Einsicht vorausgehen darf. Leider gibt es viel mehr Engagement als Nachdenken; die Engagierten sind oft in nichts als einen Mangel an Wissen engagiert. Im Elfenbeinturm, nicht auf dem Marsch erscheint das Ziel. Am Anfang ist die Idee – und dann erst die Praxis, die sie realisiert.
Das Interesse der hier vorliegenden Philosophia militans ist nicht, zum soundsovielten Mal, noch einmal mehr die bösen Zensoren zu treffen – sondern zum ersten Mal die Illiberalitäten ihrer liberalen Gegner. Deshalb kann es geschehen, daß die Engherzigsten glauben werden, diese Schrift auf ihrer Seite zu haben. Es sieht nur so aus, wenn sie den Gegner ihrer Gegner für einen Gleichgesinnten halten; wenn sie die Abwehr eines schlechten Arguments gegen sie als ein gutes Argument für sie mißverstehen. Ein Fechten nach zwei Seiten verwirrt immer die Eingleisigen; zumal wenn die schlimmere Partei weniger attackiert wird, weil alles Notwendige bereits gesagt worden ist. Wenn sich Obskuranten aus diesem Buch Zitate holen sollten: die Angst davor soll mich nicht hindern, vor allem die ängstlichen Aufklärer, die stationären Fortschrittlichen aufs Korn zu nehmen.
Ich richte mich deshalb ganz besonders gegen sie, weil ihre Rückschrittlichkeit schwerer zu erkennen ist. Man hat Muckern, Heuchlern, reaktionären Klassenkämpfern zuviel aufgebürdet – und so verschleiert, daß ihre lautesten Feinde, was die Sexual-Moral betrifft, nur ein bißchen weniger engherzig sind. Von Clemens Brentano wird berichtet, er habe zu einer Fürstin, die auf seinen Roman »Godwi« zu sprechen kam, gesagt: »Pfui, schämen Sie sich, daß Sie als Frau und Mutter so etwas lesen.« Derart gespalten waren viele wackere Kämpfer gegen die Anklage auf Obszönität, wenn sie sich außerdem über Obszönes entrüsteten. Friedrich Schlegel nahm die »Lucinde« nicht in seine Werke auf. Schnitzler verbot testamentarisch für alle Zeit die Aufführung des »Reigen«. Nabokov warf D.H. Lawrence Obszönität vor.
Dies Plädoyer kennt keinen entscheidenen Unterschied zwischen den einander bekämpfenden Parteien. Es ist nicht auf seiten der Kunst-Liebhaber gegen die Amusischen (diese Parteiung verschleierte immer die gemeinsame Sexual-Moral), sondern für die Sinnen-Lust gegen die musischen und amusischen, reaktionären und etwas liberalen Puritaner, die in gleicher Weise, deutlicher oder weniger ausgesprochen, Sinnen-feindlich waren. Man stritt sich immer nur um die Frage: ob das strafende Wort Obszön auf diesen oder jenen Künstler, auf dieses oder jenes Werk angewendet werden dürfe oder nicht. Man zog kaum in Betracht, daß das Wort selbst vielleicht ohne jede Existenzberechtigung ist. Gerade sie aber steht hier zur Debatte; und nur nebenbei wird auch viel Trübes auf der Grenze zwischen Religion, Moral und Kunst aufzuhellen sein.
Die wichtigsten Dokumente, in denen Auseinandersetzungen über das Obszöne überliefert sind, beziehen sich leider nur auf die Welt-Literatur; auf jenes schmale Gebiet, in dem Erotisches zum Thema geworden ist. Beziehen sich also nicht auf das individuelle und gesellschaftliche Leben des Sexus, das von den Künsten nur bescheiden gespiegelt worden ist. Es existiert keine gleichwertige Erörterung der Reizung »eingeborener und erworbener erotischer Reaktionsfähigkeit«: wie sie täglich von Millionen Männern und Frauen auf das eigene oder das andere Geschlecht mehr oder minder »planvoll« ausgeübt wird. So kam man auf die Idee, das Obszöne für eine ästhetische (oder unästhetische) Kategorie zu halten; und beim Streit um sie sein Dasein außerhalb der Künste und der kunstloseren Produktion zu ignorieren.
Begreiflich! Die lebendigen Reizungen sind so zahllos und vielfältig, daß kein Ankläger ihnen nachjagen kann. Und die Wurzel des Übels, »die eingeborene und erworbene erotische Reaktionsfähigkeit«, kann man sowieso nicht packen – ganz abgesehen davon, daß es neben ihr noch eine (völlig unbeachtete) Aktionsfähigkeit gibt. Auch der mächtigste Diktator könnte nicht verfügen, daß die beiden gleich bei Geburt zerstört werden. Selbst wenn er eine Entsinnlichung der Menschheit riskierte … das Verschwinden der Lust wäre nicht das einzige Resultat. Es ist ein Glück, daß Menschenrasse und sexuelles Vergnügen so unauflöslich miteinander verknüpft sind; man hätte es sonst längst aus der Welt hinausmanipuliert.
Das geht also nicht; so findet die Jagd auf die Reizung der erotischen Reaktionsfähigkeit nur in jenem schmalen Gebiet statt, das man immer wieder unter Kontrolle zu bringen hofft: im Bezirk der Darstellung, vor allem der literarischen. Es war gelegentlich auch einmal ein »obszöner Walzer« unter Anklage (zum Beispiel im »Reigen«-Prozeß) oder die obszöne Schlafzimmer-Musik in Richard Strauss’ »Feuersnot« und Schrekers »Gezeichneten«. Man ging gelegentlich auch gegen ein Bild oder eine Statue vor. Aber stand je ein Werk der bildenden Kunst eine ganze Woche lang von morgens bis abends im Mittelpunkt des Für und Wider?
Dabei hat sie sich manches geleistet. Die gotischen Kathedralen mit ihren Figuren, Reliefs und Statuetten sind auch ein großes pornographisches Bilderbuch. In der Vorhalle der englischen Kirche Isle Adam steht eine junge nackte Frau, vor ihr sitzt ein ebenso jugendlicher und nackter Teufel, der seinen Kopf in ihren Schoß preßt. Ein Relief an einer frühmittelalterlichen Kirche im französischen Pairon zeigt zwei Nackte, die mit den unteren Partien gegeneinanderliegen. Correggios Jo, Rubens’ pissende Männer, auf die Flaubert hinwies: eine Kette von Obszönitäten bis zu Hogarth und Rowlandson und Hokusai und Aubrey Beardsley, der die Schmerzen der Lysistrata-Genossinnen noch eindeutiger illustrierte als Aristophanes.
Doch sind die gemeißelten und gemalten Unanständigkeiten nicht so gegenwärtig wie die literarischen. Man hat mit Recht bemerkt: es gibt in der modernen Malerei und Musik keine Paralele zum Joyce-Skandal. Henry Miller deutete es so: bei Büchern fühlen auch Klempner und Metzger, daß sie ein Recht auf Meinung haben … Die Literatur ist die wenigst esoterische Kunst; das Obszöne aber ist immer eine Entrüstung der Massen, von wem sie auch dirigiert sein mögen.
So setzten nur im Zusammenhang mit der Literatur weitläufigere Debatten ein. Und dies enge Feld ist noch dreimal eingeengt. Es gibt vier unanständige Literaturen – und nur eine, der wir Einblick in Auseinandersetzungen über das Obszöne verdanken. Wir haben zunächst über die drei anderen zu sprechen. Da ist die Kiosk-Literatur für verheiratete und unverheiratete Junggesellen, für Jungen und Mädchen, die nicht die Paralipomena zu Goethes »Faust« mühsam in der Bibliothek heraussuchen. Sie ist nicht immer an Kiosken ausgestellt worden, aber immer von gleicher Art gewesen. Sie wurde nie einer (mehr als polizeilichen) Beachtung gewürdigt; daneben vielleicht noch als Thema donnernder Prediger, die kaum mehr sagten, als daß sie des Teufels sei.
Noch weniger Aufmerksamkeit hat man der offeneren und weniger öffentlichen Pornographie geschenkt; sie erscheint geheim, ist nur einem kleinen Kreis für viel Geld zugänglich. Um sie hat es nie Streit gegeben, weil niemand je für sie eingetreten ist; und niemand trat für sie ein, weil diese erotischen Arcana, die auch das Neben-Gebiet behandeln, unter Titeln wie »The benefit of farting explained« – nur selten einmal einen berühmten Verfasser hatten: obwohl Benjamin Franklin und Mark Twain hier zu nennen sind; auch Deutsche, Franzosen und Engländer bis zu Musset und Frank Harris. Und niemand kann sagen, wieviel Obszön-Klassisches nicht ängstlichen Erben in die Hand gefallen ist. Die Großherzogin Sophie schloß Goethes schmale Produktion von »Hanswursts Hochzeit oder der Lauf der Welt« bis zum Marienbader »Tagebuch« von ihrer umfassenden Ausgabe des Gesamtwerks aus. Wieviel aber wurde hier und sonst vernichtet?
Zu unterscheiden von dem Unanständigen der Klassiker sind die klassischen Unanständigkeiten. Die Bibliographie der hohen Pornographie, 1936 zusammengestellt in einem Registrum Librorum Eroticorum, verzeichnet 5000 englische, französische, deutsche, italienische Titel. Diese Publikationen können in den feinsten Bücher-Mausoleen besucht werden. Das größte ist im Vatikan: 25000 Bände, 100000 Drucke. Folgt das Britische Museum: 20000 Stück. Die Bibliothèque Nationale in Paris nennt ihre Kollektion »L’enfer«; die Library of Congress in Washington »Delta«, nach dem griechischen Symbol für die Frau. I.P. Morgan soll für seine Sammlung eine Million ausgegeben haben; der amerikanische Staat hatte es billiger, ihm wurde zugeschanzt, was Post und Zoll beschlagnahmt hatten. Die große Sammlung des Instituts für Sexualwissenschaft in Berlin ist unter Hitler spurlos verschwunden. Man hat diesen Verlust mit dem andern beim Brand der Bibliothek von Alexandria verglichen.
Manche berühmten Stücke, die keinen Cotta zum Verleger hatten, von keiner Oxford History of Literature verzeichnet und von keinem Georg Brandes zergliedert wurden, können auf eine lange Lebenszeit (nicht nur Ruhezeit im Archiv) zurücksehen. Da zirkuliert noch immer die im Geburtsjahr Goethes erschienene »Fanny Hill« oder »The Memoirs of a Woman of pleasure« – die Geschichte eines armen Mädchens vom Lande, die in die Hauptstadt kommt und ihre Abenteuer in Briefen erzählt. Der Autor, John Cleland, war ein britischer Ex-Konsul. Und es gehen immer noch von Hand zu Hand »Die Memoiren einer Sängerin«, schon ein Jahrhundert alt, verfaßt von der großen Wilhelmine Schröder-Devrient – soweit man etwas mit Sicherheit sagen kann auf einem Gebiet, das von den wissenschaftlichen Ordnern ignoriert wird. Eins der Glanzstücke dieser Gattung, klassisch und zugleich von einem Klassiker, ist Alfred de Mussets lesbische Erzählung »Gamiani«. Manchen großen Schriftsteller lockte dieses Gebiet. Die ungeschriebenste Literatur-Geschichte wird vielleicht einmal von einem Außenseiter verfaßt werden.
Wenn immer »Pornographie« (vom griechischen Porné: Dirne) auf diesen Seiten erscheint, ist das Wort rein deskriptiv gemeint, nicht abwertend. Die Grenze zwischen der Pornographie (einem Schrifttum, das den meisten Literatur-Historikern nicht bekannt sein dürfte, weil es auf der Universität nicht gelehrt wird und aus denselben Gründen auch den meisten Richtern nicht – nicht einmal denen, welche in Obszönitäts-Prozessen fungieren) und jener Welt-Literatur, die erotische Themen sehr realistisch behandelt, wird gewöhnlich so gezogen: pornographisch sei, was von einem schlechten Menschen und drittklassigen Schriftsteller zur Reizung der Lust für Geld hergestellt ist. Oder, wie ein englischer Experte im »Lady Chatterly«-Prozeß viel feiner und dünner sagte: Literatur und Pornographie unterschieden sich in »dem Ziel des Autors«.
Vielleicht aber kann man der unfreundlichen griechischen Vokabel mehr begrifflichen Umriß geben. Das Genre Pornographie zeichnet sich vor allem durch seine Irrealität aus: das Dasein wird auf den vitalen Bezirk eingeschränkt – und dann noch einmal auf den, der öffentlich nicht zur Sprache kommen darf (wie die Sprache so schön sagt); er ist offiziell von allen Sprachen, auch den buchstabenlosen, ausgesperrt … und erhält nur in der »Dirnen-Literatur« sein Wort.
Die zentralen Figuren pornographischer Geschichten sind Helden: in ihrem märchenhaften Verlangen, ihrem märchenhaften Können und ihrer märchenhaften Freude am Sichzeigen. Als wäre die Welt von Gott Sexus und Gott Anus und anderen verbannten Göttern nach ihrem Bilde gemacht. Es ist eine verzerrte Welt. Die Donjuanerie ist eine Unterabteilung der Donquichoterie … und auch entstanden aus mächtigen, unerfüllten Sehnsüchten.
Innerhalb dieses Schrifttums gibt es besser und schlechter Geschriebenes, Eintags-Literatur und die große, die sich über Jahrhunderte gehalten hat. Vielleicht wird man bei einer künftigen Bestandsaufnahme hier nicht so viel ästhetisch Beträchtliches finden, daß eine Einreihung dieser Gattung in die Geschichte der Literatur gerechtfertigt ist. Vielleicht – hat aber je einer eine gründliche Untersuchung vorgenommen? Wie verhalten sich die Josefine Mutzenbacher-Geschichten literarisch zu vielen, die in den Literatur-Geschichten gepriesen werden? Ganz gewiß gehören jene Erzählungen in eine Kultur-Geschichte; sie spiegeln die intimste Sphäre der Sitten und Gebräuche.
In dem hier versuchten schematischen Abriß bleibt noch – nach Abzug der sehr sichtbaren Kiosk-Literatur, der sehr geheimen Werke großer Schriftsteller und der ansehnlichen pornographischen Klassik – die erotische Welt-Literatur, die allein Gegenstand eingehender Auseinandersetzungen geworden ist. Man definiert sie am besten als eine Reihe von Erotica, die von berühmten Schriftstellern unter ihrem Namen vor aller Welt publiziert und deshalb von den Literatur-Professoren zur Kenntnis genommen worden sind. Hier aber muß eine immer unterdrückte Frage sehr laut gestellt werden: wo hört die Pornographie auf – und wo beginnt die nicht einwandfreie, aber dennoch angesehene erotische Literatur?
Man hat schöne Kategorien geschaffen, um die Wahrheit freundlich zu dämpfen; die jüngsten heißen: »Krasse Pornographie« und »Erotischer Realismus«. Aber schließlich kommt es doch darauf hinaus: was Griechenland geschaffen hat und Rom und der Mönch, der das altenglische Exeter-Buch herausgab, und das Sechzehnte Jahrhundert – gehört nicht zum Krassen. Wohingegen: was im Neunzehnten und Zwanzigsten Jahrhundert verfaßt worden ist – von Autoren, deren Nachruhm noch ungewiß war … war, am Tage des Erscheinens: krasse Pornographie.
Auf der Grenze unehrlicher Benennungen haben wir zum Beispiel die Carmina priapeia. Alexander von Bernus übersetzte sie ins Deutsche, sie erschienen als Privat-Druck des angesehenen Verlages Schuster & Löffler, in 530 Exemplaren; den Käufern wurde versprochen: »Eine Neuauflage findet nicht statt.« Zum ersten Mal wurde die Anthologie 1469 gedruckt, als Anhang zu einer Virgil-Ausgabe, später auch mit den Werken des Petronius und Martial. Ovid und Catull sind bestimmt beteiligt gewesen, wahrscheinlich auch andere bedeutende Dichter des goldenen Zeitalters der römischen Dichtung.
Wie die Kollektion zusammengekommen ist, weiß man nicht. Eine nicht sehr fundierte, wenn auch reizvolle Vermutung lautet: im Garten des Maecenas hätten dichtende Gäste ihre Verse an die Wände eines Priapus-Tempelchens gekritzelt. Diese Konjektur mag zurückgehen auf Strophen wie:
Wenn Du rings unsere Dachwand mit Verszeilen vollgeschmiert siehst,
die etwas unzarte Witze enthalten, und wenn du sie liest,
fühl durch die saftigen Späße dich nur nicht beleidigt, du Tor:
unser Schwanz trägt den Kopf hoch und hat einen guten Humor.
Lessing, im Zeitalter der Aufklärung, die nur sehr begrenzt aufklärte, war diesen »unsauberen Torheiten« nicht wohlgesinnt. In mancher Beziehung ist die Antike spurlos an den eifrig griechisch und lateinisch studierenden Generationen vorübergegangen. Und mit großem Recht schrieb der bekannte Übersetzer geheimer Klassiker, Heinrich Conradt, im Jahre 1903: »Unsere sogenannte humanistische Bildung verfolgt allem Anschein nach absichtlich den Zweck, dem Lernbegierigen und Wahrheitssucher einen ganz falschen Begriff vom klassischen Altertum zu geben.« Nämlich: einen idealistisch-preußischen!
Das Thema der Carmina priapeia kreist um jenen Mythos, der nicht so bekannt ist wie die Geschichte von der Geburt der Pallas Athene aus Papas Schädel. Strabo und Diodor schrieben die Kurz-Biographie des Priapus, Sohn des Dionysos und der Aphrodite. Als sie in den Wehen lag, in Lampsakos, tat ihr Hera, Göttin der Entbindung und eifersüchtig auf die Schönheit der Gebärenden, etwas Böses an. So kam Baby Priapus verkrüppelt zur Welt – und mit einem abnorm großen Glied. Seinetwillen waren die Damen der Stadt verrückt nach dem Jüngling, während die Männer aus demselben Grunde ihn wegjagten. Auf inständige Bitten der betroffenen Lampsakosserinnen, die Herren der Stadt zu strafen, sandten ihnen die barmherzigen Götter die Syphilis. Von dieser Plage könnten sie nur erlöst werden, meinte das Orakel zu Dodona (Vorgänger der demoskopischen Institute), wenn Priapus zurückkäme.
Er kam und wurde zum Gott erhoben: als Beschützer der Gärten und Repräsentant der Geilheit. In dieser Doppel-Funktion ist er Held der Carmina, wie schon Carmen Eins zeigt.
Liest du das lockere Spiel, das in kunstlosen Versen versteckt ist, so entsag auch dem Ernst, der dem Römer die Würde verleiht. Denn dies Tempelchen ist nicht der Schwester des Phoebus geweiht, noch der Vesta, noch ihr, die dem Haupte des Vaters entsprang, sondern dem roten Hüter der Gärten, dess’ Brunstknippel lang und durchaus nicht züchtig von keuschem Gewande bedeckt ist.
Anmutig, oft auch lakonisch derb ist hier in 86 zweizeiligen oder etwas längeren Verschen zusammengereimt, was auf vielen, nicht zu gut duftenden Wänden dieser Erde weniger mythologisch zu lesen ist. Zum Beispiel dies Gedichtchen Ovids:
Durch die Blume gesprochen, sagte ich ungefähr: Gib mir,
was du mir geben kannst, ohne daß dir’s durch Schaden vergällt
wird, was nach Jahren – zu spät – du selbst vielleicht gerne zulieb mir
tätest, wenn rauh deine Wangen ein häßlicher Bartwuchs entstellt,
was dem Jupiter der gab, der einst geraubt ward vom heiligen
Vogel – die köstlichen Lustbecher mischt er dem Liebhaber heut –
was in der Brautnacht die Jungfrau dem geilen Gemahl zur einstweiligen
Abfindung reicht, weil sie töricht den Schmerz der Entjungferung scheut. –
Laß dich päderastieren! – Wie sonst? Meine Kunst ist gemein.
Auch diese Antike hatte Folgen, die den von der Antike idealistisch-preußisch begeisterten Jüngern ebenfalls nicht offenbart wurden. Im Jahre 1903 erschien im hochangesehenen Insel-Verlag eine deutsche Ausgabe von:
Elegantiae latini sermonis
Alisiae Sigaea Toletanae
Satira Sotadica
de
Arcanis Amoris et Veneris.
Aloisia Hispanice scripsit
Latinitaete donavit
Johannes Meursius.
Als Privatdruck in einer einmaligen Auflage von 1200 Exemplaren ausgegeben, wurde auch hier schwarz auf weiß den Käufern zugesichert: »Ein Nachdruck wird niemals veranstaltet werden.«
Diese sodatische Satire wurde zum ersten Mal im Jahre 1658/9veröffentlicht, mit der Versteck spielenden Angabe: Autorin dieser Gespräche der »Aloisia Sigaea« sei eine junge, 1530 in Toledo geborene Hofdame der Donna Maria von Portugal gewesen. Als lateinischer Übersetzer stellte sich ein ebensowenig existenter Leydener Professor Johannes Meursius vor.
Tatsächlich war der Verfasser ein französischer, lateinisch schreibender Advokat, Maitre Nicolas Chorier. Er schuf ein kräftiges Sitten-Gemälde, die Skandalaffären der Grenobler Gesellschaft als Material verwendend, nach dem berühmten Muster des Aretino; und schilderte Leben und Treiben der oberen Schichten, die bei ihrer munteren Beschäftigung unbekannte Ereignisse aus der Antike zum besten gaben, wie Vorbild Aretino dieselben Aktivitäten unter den weniger Glanzvollen dargestellt hatte. Kein Werk der sogenannten Pornographie übertrifft an Deutlichkeit diese klassischen Gespräche, die mit einem Dialog zwischen der verheirateten Lesbierin Tullia und der erst verlobten, aber bereits sehr entzündlichen Jungfrau Oktavia zwecks Aufklärung der Novize beginnen. Sechs robuste, nicht nur gesprochene Duette folgen. Pornographie oder »Erotischer Realismus«?
An der Ecke kaufte ich gerade für 35 cents ein harmloses Büchlein, um dessentwillen sich im Moment ein Verleger der Großstadt Los Angeles Sorge macht. Im Titel kommt das Wort Sex vor. Dies Heft zeigt das Bild eines Jungen mit breitem Rücken und eines verschüchterten kleinen Mädchens. Es ist harmlos im Vergleich zu manchem Horaz-Gedicht; und trüge dies unschuldige Gift eine Jahreszahl vor Christi Geburt oder auch noch 1658 – dann wäre es bestimmt ein »Kultur-Dokument«. Im Zeitalter des Augustus und des Rabelais brauchte man stärkere Reize. Wir aber leben im Zeitalter der hochorganisierten, keimfreien UNESCO, weshalb jede Darstellung, welche die ehrwürdigen Ahnen kopiert, ungeheuerlich ist.
Vor der Vergangenheit aber, die uns von den Schulen vergoldet wurde, ist man feige. Obszön mit Patina wird geduldet.
Ein Beischlaf, von Rembrandt gezeichnet, ist ein moralisches Kunstwerk?
Im Bezirk der unanständigen Welt-Literatur sind in den letzten hundertundfünfzig Jahren nur Werke angeklagt worden, die zur Zeit der Anklage noch nicht klassisch waren. Platon ist mutiger gewesen; er warf dem klassischen Homer die pornographischen Zeus-Hera Stellen vor. In unsern Zeiten aber ist man zu gebildet, um Ovid, Apulejus, Petronius, Shakespeare, Rabelais vor Gericht zu ziehen. So hat man für die Anerkannten eine Ausnahme gemacht. Leo XIII. verkündete: »Die Bücher Älterer und Neuerer, die als Klassiker gelten und von jenem Schmutz nicht frei sind, werden mit Rücksicht auf die Eleganz und Reinheit der Sprache gestattet, doch nur solchen, deren Amt oder Lehrberuf diese Ausnahme heischt.« Die Säkularisierten gaben sogar noch diese Einschränkung auf: die Zoll-Behörde, die in Amerika zensiert, hat in ihren Regulationen auch ein Ausnahme-Recht für die »sogenannten Klassiker« – ohne »doch nur«. Ergo: wer sich in die Welt-Literatur hineingeschrieben hat, über dessen »Schmutz« wurde von Leo XIII, und amerikanischen Behörden der Mantel der Ungerechtigkeit gebreitet. Er wurde auch D.H. Lawrence zuteil – als sein »Schmutz«, dreißig Jahre nach der Entstehung, Teil eines klassischen Opus geworden war.
Wer noch nicht so sehr über den Wolken thronte, war dem Zugriff ausgesetzt. Als Friedrich Schlegel die »Lucinde« schrieb, Flaubert »Madame Bovary«, Baudelaire »Die Blumen des Bösen«, Henry Miller den »Wendekreis des Krebses«… waren sie noch keine Klassiker – und ihre Anwälte hatten erst mit Mühe die »Eleganz« und »Reinheit der Sprache« gerichtsnotorisch zu machen. In jenen frühen Tagen blamierte sich noch kein Richter, wenn er Flaubert und Baudelaire behandelte, wie er es heute nicht wagen würde. Damals mußten die moralischen Blößen des Noch-nicht-Anerkannten mit viel Rhetorik ästhetisch zugedeckt werden. So wurde die Entrüstung über das Obszöne auf das ästhetische Neben-Gleis geschoben. Nie kam es zu einer Klärung dieser Empörung: weil sie nur aus Anlaß von Kunstwerken beachtet – und mit kunstphilosophischen Argumenten zurückgewiesen wurde. Nie fragte jemand: angenommen, Lady Chatterley wäre nicht ein Werk der Dichtung, sondern der Schöpfung – wäre ihr Leben mit dem Liebhaber, wäre die Mitteilung davon obszön? Das wurde immer als selbstverständlich vorausgesetzt.
Es ist ein künstlerischer Unterschied zwischen den saftigen Szenen des »Simplicius Simplicissimus« und jenen flauen, die in den Büchern »Ratschläge eines Nimmerschlappen oder die Kunst, die Vergnügungen der Wollust zu vervielfältigen«, »Liebeskämpfe im Brautgemach oder der Sieg des Wüstlings über die weibliche Schamhaftigkeit«… geschildert sind; obwohl man in diesen Brautgemächern oft Erzähler-Talente findet, welche die Titel nicht vermuten lassen. Da ist zwar in der Regel ein künstlerischer Unterschied – auch ein moralischer? Der liberale Forscher versichert uns, daß das »Grobsinnliche hinter der höheren künstlerischen Auffassung« verschwinde. Ist das wahr, rundum?
Ist je untersucht worden, wie sehr die erotische Reaktionsfähigkeit von jenen hochliterarischen Liebes-Geschichten »physiologisch« gereizt wird, die zu Aufsatz-Themen verschrottet werden? Diese Frage blieb vor der anerkannten Erotik ungestellt; denn man hatte zwar nie etwas gegen den Druck auf die Tränen-Drüsen – ignorierte aber jenen, der minder respektable Säfte hervorruft. Deshalb forschte man jener kränkenden Hypothese nie nach.
Und welche Sekretionen rufen den Mord-Rausch hervor? Hat je jemand gefragt, wieviel Verbrecher Shakespeare mit seinen kunstvollen Darstellungen von Kriminellen auf dem Gewissen hat? Nein: weil man »Richard III.« nicht mehr rückgängig machen kann. Wer einmal das Tor der Welt-Literatur passiert hat, steht unter dem Schutz der Kulturwächter. Und die große Rechtfertigung hieß immer: die erhebende Macht der Kunst. Sie schützt den Künstler. Und man bewies, daß Friedrich Schlegel und Flaubert und Baudelaire und Schnitzler und D.H. Lawrence und Henry Miller »rein« sind, das heißt Unschuldslämmer.
Eines der ungeschriebensten, aber unentbehrlichsten Kapitel einer Literatur-Geschichte der Zukunft wird die Überschrift haben: die Neigung der großen Dichter für mehr oder weniger anerkannte Erotica. Goethe und Schiller erfreuten sich an den »Gefährlichen Liebschaften«. Lichtenberg las mit größtem Vergnügen eines der Glanz-Stücke der Pornographie, »Fanny Hill«. Flaubert war vernarrt in den »Goldenen Esel«. Baudelaire bestellte pornographische Literatur – mit der Bemerkung, er brauche sie nicht, er könne auch ohne sie alles dank seiner Phantasie herbeizaubern, aber Kollege Sainte-Beuve habe sie nötig.
Gewiß hatte sie auch Schiller nötig, dessen Phantasie eher aufs Unkörperliche ging. Er bekannte in einem Brief des Jahres 1798 an Goethe, wie sehr ihn die »heftig sinnliche Natur« des Poeten Rétif de la Bretonne ergötzte: »Haben Sie vielleicht das seltsame Buch von Rétif ›Coeur humain devoilé‹ je gesehen oder davon gehört? Ich habe es nun gelesen und ungeachtet alles Widerwärtigen, Platten und Revoltanten mich sehr daran ergötzt. Denn eine so heftig sinnliche Natur ist mir nicht vorgekommen, und die Mannigfaltigkeit der Gestalten, besonders weiblicher, durch die man geführt wird, das Leben und die Gegenwart der Beschreibung, das Charakteristische der Sitten und die Darstellung des französischen Lebens in einer gewissen Volksklasse muß interessieren. Mir, der so wenig Gelegenheit hat, von außen zu schöpfen und die Menschen im Leben zu studieren, hat ein solches Werk einen unschätzbaren Wert.«
Ist diese Selbst-Interpretation seines Ergötzens korrekt? Vermittelte der Franzose ihm nur eine unbekannte Wirklichkeit, nicht vielleicht auch Lust? Tausend Ernsthafte waren sich nie im klaren, was sie an einem Buch genossen, wenn sie sich zu genießen erlaubten, was sie eigentlich nicht genießen wollten. Weshalb sie auch immun waren gegen die ernsthaftesten Sätze der »heftig sinnlichen« Schriftsteller. Rétif de la Bretonne schrieb: »Die Moral hat alle Übel in die Liebe gebracht.« Schillers Lehrer, Kant, hätte sagen können: die Liebe hat alle Übel in die Moral gebracht. Aber die Berührung mit dem Unanständigen wurde erst problematisch, wenn es ums Theoretisieren ging. Und leider besitzen wir mehr davon als Kenntnis vom Genuß der Poeten an Darstellungen, die zu geben sie sich verboten.
Haben ihre sublimeren, weniger »heftig sinnlichen« Schöpfungen vielleicht dieselbe Quelle? Haben die großen Künstler nie aus Wollust geschaffen und ihren Lesern nie Wollust verschafft? Jedenfalls haben sie die »Reaktionsfähigkeit« immer gereizt. Generationen von Lesern Shakespeares und Schillers und Byrons und Dostojewskis danken den Meistern ungeheure Steigerungen der Emotionen. Mit Ausnahme der sexuellen? Indem die sogenannten Liberalen leugneten, daß die große Literatur die erotische Phantasie stachle, verdeckten sie höchst illiberal einen ihnen unbequemen Zustand der Dinge. Sie wollten unter keinen Umständen den Boden der Tradition verlassen, die vorschrieb: das Geschlechtliche ist nur zugelassen, wenn es im poetischen Äther verdunstet. Es gibt herrliche Auflösungen des Irdischen in eine Musik aus Worten. Wer aber die Verdampfung des Irdischen als Kunst-Kanon etabliert, vor allem im Zusammenhang mit der vitalsten Sphäre, leugnet die lebendige Herkunft aller erregenden Schöpfungen, weil sie in einer Sphäre weiterleben, die fälschlich die ideale genannt wird.
So war die Liberalität der Verteidiger angeklagter Künstler nur Fortschritt auf einem Boden, der das Fortschreiten eng begrenzte. Alles, was diese gefeierten Sieger gesetzgeberisch zustandebrachten, ist dies: daß man außerordentliche ästhetische und wissenschaftliche Qualitäten gegen die (nie bestrittenen und immer mißbilligten) obszönen abwog. Als im Jahre 1960 Jean Genets »Notre-Dame-des-Fleurs« vor den großen Straf-Senat des Hamburger Landgerichts kam, wurde verfügt: »Es soll Beweis erhoben werden über die Frage: überwiegen in ›Notre-Dame-des-Fleurs‹ die Obszönitäten oder umgekehrt? durch Einholen einer gutachtlichen Analyse.« Die Gutachter waren Kunst-Experten. Die moralische Verurteilung im Worte »obszön« wurde gar nicht in Frage gestellt. So benahm man sich durch die Jahrhunderte: der Moral-Kodex verstand sich von selbst; der Fortschritt bestand nicht darin, daß man ihn untersuchte, sondern nur darin, daß mehr und mehr andere Aspekte auf das Werk als mildernde Umstände zugelassen wurden. Und dieses »Überwiegen«, dies Mehr oder Weniger, angewandt auf zwei inkommensurable Größen, dieses Aufrechnen unmoralischer Elemente gegen andere, kulturell wertvolle (vor allem ästhetische), wurde nie zum Problem.
Die Anerkennung des ästhetisch und wissenschaftlich und pädagogisch Bedeutsamen als Kompensation für den Mangel an Moral war auch eine Barriere gegen die Gefahr: womöglich die Bibel und Shakespeare vor Gericht ziehen zu müssen. Die kühnste Ideologie zwecks Unsichtbarmachung des Obszönen holten sich die Liberalen aus der Antike: das berühmte Kaloskagathos. In diesem Sinne verkündeten sie: Kunst ist immer moralisch. Wie immer die Griechen diese zwillinghafte Verbundenheit von Gut und Schön gemeint haben mögen – die schlichte Partnerschaft, als handle es sich um zwei berühmte Kompagnons einer weltberühmten Firma: der Halske ist ohne den Siemens nicht zu denken … ist schlichter Aberglaube.
Wer nicht bereit ist, diese traurige Einrichtung der Welt: die Möglichkeit einer Diskrepanz von Schön und Gut zu akzeptieren, denke wenigstens über Thomas Manns Worte nach: es sei eine »vorgefaßte Meinung«, zu behaupten, »Literatur und Fortschrittlichkeit seien identisch«; er fügte hinzu, »daß man mit dem größten Talent, mit dem erdenklichsten Witz und Glanz den Lobredner der Inhumanität, des Henkers, des Scheiterhaufens, der Inquisition, kurz dessen machen könne, was Fortschritt und Liberalismus das Reich des Untergangs nennen.« Mit dieser Einsicht sollte der Versuch, ästhetisch zu retten, was man moralisch verurteilt, erledigt sein.
Das Dogma: Kunst macht moralisch … ist Teil der Theorie: die ästhetische Distanz sublimiere jeden irdischen Vorgang, beraube ihn seiner vitalen Kraft. Der Maler Emil Orlik fand für diese Illusion den stärksten Satz: »Ein Beischlaf, von Rembrandt gezeichnet, ist ein moralisches Kunstwerk.« Man ist verblüfft und fragt: wie hat der Maler ihn moralisch gemacht – und was war er vorher? Diese Transsubstantion wird auch Veredelung genannt. Sogar Freud, dessen ästhetische Arbeiten nie die Herkunft der Künste aus dem Trieb-Bereich verleugneten, sah nur ihr Dämpfendes. Und seltsamerweise war es gerade der Idealist Platon gewesen, der mehr die Triebstärkung der Kunst beachtete. Er wollte Homer in der »Republik« nicht zulassen, weil seine Götter nicht Pädagogen, sondern schlechte und außerdem noch wirksame Vorbilder seien. Die Heutigen, mindestens ebenso streng wie Platon, haben nicht mehr die Courage, mit den Enkeln und Urenkeln Homers anzubinden.
Kunst distanziert – oder rückt näher, je nachdem; pazifiert oder aktiviert – je nachdem. Künstler dämpften … und steigerten Affekte ins Ungemessene: nicht nur in der Tragödie, in der sich Ödipus die Augen ausreißt, Othello im Rausch der Eifersucht mordet, Penthesilea aus Enttäuschung ihre Zähne in die Brust des Achilles gräbt, im Bunde mit ihren Hunden. Kein Don Juan hat so viele Menschen verliebt gemacht wie Werther; kein Liebesbund so die Sehnsucht gesteigert wie Romeo und Julia, Tristan und Isolde … sie beruhigten nicht, sie sind die großen Quellen des Aufruhrs der Sinne.
Die Macht der Kunst kommt auch dem Morden zugute, das Shakespeare und Dostojewski wirksamer dargestellt haben als die Kleineren, von den Kleinsten nicht zu sprechen. Und die wirksamsten Werke der Pornographie sind vom Range der »Lady Chatterley« – gerade weil das Obszöne hier auch noch große Kunst ist. Die Pornographie der Künstler hat eine Eindringlichkeit, die kraftloseren Darstellungen fehlt. Das Fremdmachen, in dem Novalis das wesentliche Element des Romantischen, ja aller Poesie sah, die Verfremdung, die Brecht als wichtigstes Mittel seines anti-emotionalen Kunst-Willens proklamierte, haben nur an der Oberfläche eine Ähnlichkeit mit den vital-feindlichen Lehren des epigonalen Idealismus.
Trotz der liberalen Vermummungs-Versuche, deren populärster die Schein-Identität von Moral und Kunst ist … das liberalisierende Element in der Frage nach dem guten Willen des Schöpfers und dem ästhetisch-kulturellen Wert moralisch-fragwürdiger Produkte darf nicht übersehen werden. Die so etablierte Praxis: daß ein Wort, eine Wendung, ein Thema noch nicht an sich als obszön zu verurteilen ist, änderte zwar nicht die Sexual-Moral, engte aber den Machtbereich der Engstirnigkeit wesentlich ein.
Ein Viertel-Jahrtausend Feigenblatt
Die Geschichte der Entrüstung über das Obszöne ist wohl nicht älter als zweihundertundfünfzig Jahre – und vielleicht nicht verbreiteter gewesen als die europäisch-amerikanische Gesellschaft, deren Vorstellungen allerdings die Welt eroberten. Japan war eins der Länder, das durch die Jahrhunderte recht frei von dieser Entrüstung war: bedeutende Künstler haben das Unanständige in Holzschnitten, Kunst-Gegenständen, Bildern und Versen dargestellt, die Lust erzeugen sollten. Seit der amerikanischen Besetzung nach dem letzten Krieg hat auch dies Land sein Obszönitäts-Gesetz und seine Sittlichkeits-Streifen, mit allen Paraphernalia.
Die Vorgeschichte des »Lady-Chatterley«-Prozesses 1960 geht also nicht weiter zurück als bis zum Beginn des Achtzehnten Jahrhunderts. 1708 machte die englische Krone den ersten Versuch, ein Buch als obszön zu verdammen: »Die fünfzehn Plagen einer Jungfernschaft«. Etwas später wurde die erste Bestrafung zelebriert. Ein Pornographie-Verleger kam an den Schandpfahl in Charing Cross. Der Verbrecher wurde aber nicht, wie üblich, mit Dreck beworfen, sondern, als er wieder frei war, von der Menge im Triumph in die nächste Taverne getragen. Nur selten sah man später so deutlich die lichte Seite der dunklen Medaille Obszön: die dankbaren Empfänger.
Weil zwischen die Spender des Vergnügens und die Beschenkten die Kontrolleure traten; sie mäkelten an der Bibel herum und an Shakespeare, sperrten noch 1927 das »Satyricon« des Petronius aus und 1930 sowohl Brantômes »Les Vies des dames galantes« als auch Huysmans’ »La Bàs«. Und ein Chirurg, W. Acton, schrieb in seinem Buch »Funktionen und Störungen der Geschlechtsorgane«: die »Unterstellung«, daß Frauen sexuelle Gefühle hätten, sei eine »gemeine Verleumdung«. Die Liste jener Welt-Literatur, die in England Schwierigkeiten hatte und verboten wurde, ist stattlich.
Der deutsch-katholische Erotiker Franz Blei tat alles, um seine Kirche von dem Vorwurf zu reinigen, an dieser Entrüstung schuld zu sein; erst die moderne Aufklärung habe sie in die Welt gebracht. Und er zitierte den Kirchenvater Klemens von Alexandrien, als Muster der Liberalität: »Warum soll ich mich schämen, jene Körperteile zu nennen, die zu erschaffen Gott sich nicht geschämt hat?« Ein isoliertes Zitat hat wenig Gewicht vor einer kontinuierlichen Praxis. Doch liegt eine große Wahrheit in der Anklage gegen die nur ein bißchen aufgeklärte Aufklärung.
Franz Blei gehörte zu den Seltenen, die den überalterten, lächerlich strapazierten Gegensatz Heidentum – Christentum unter die Lupe nahmen. Die Christenheit lebte auch recht heidnisch, unbehelligt von den Theologen, welche den Blick auf die Wirklichkeit verstellten; Ideologen funktionierten immer auch als Verhüller der Realität.
Vor allem allerdings als Apologeten. Thomas von Aquino, der Systematiker des Katholischen, kam zu folgendem Schluß: da Gott das Fortbestehen der Menschen-Rasse wolle, da er die Erzeugung von Nachkommenschaft an den Geschlechtstrieb gebunden habe, wäre der Kampf gegen ihn eine Rebellion gegen den Herrn im Himmel.
Der hohe Klerus war, wie man weiß, noch weniger rebellisch. Im Fünfzehnten Jahrhundert liebten Martin V. und seine Kardinäle die Obszönitäten des italienischen Humanisten Poggio sehr. In der berühmtesten geht es um »eine junge Frau, die ihren Mann anklagte, unzulänglich gerüstet zu sein«: weil das Werkzeug des Esels, eines Tieres nur, doppelt so lang sei. Über diese und ähnliche Geschichten unterhielten sich die hohen Herren des Vatikan.
Es darf aber der Einfluß sexual-feindlicher christlicher Theologien nicht unterschätzt werden. Paulus sah in der Ehe einen Schutz gegen noch größere Unzucht. So riet er der Gemeinde von Korinth: »Um der Unzuchtsünder willen soll jeder seine eigene Frau und jede ihren eigenen Mann haben.« Aus einer Negation heraus war auch Tertullian fürs Heiraten: es sei besser als in Brand stehen. Und Augustinus meinte: Der Königsweg zur vollkommenen Ehe sei die Entsagung. Er hatte bereits eine Einsicht, die dann leider verloren ging: daß die Verdammung des Sexuellen und der Sprache, die es bezeichnet, gleichen Ursprungs sei; ohne Sündenfall gäbe es auch keine obszönen Worte.
Luther genießt zu Unrecht das Prestige, das Geschlechtliche zu Ehren gebracht zu haben. Er bezeichnete die Ehe als ein »Spital der Siechen«: »Gutt ist nicht freyen, es sei denn nott.« Eine Not aber bestehe überall, wo Gott die seltsam edle Gabe der Keuschheit nicht gewährt habe. Da die Ehe also eine Protektion gegen Hurerei sei, fand der Reformator auch noch den Beischlaf während der Schwangerschaft gerechtfertigt.
Calvinisten und Puritaner waren dann strenger, erkannten nur noch den Fortpflanzungs-Akt an, nicht die begleitende Wollust, und nahmen so dem ehelichen Vergnügen die letzte Rechtfertigung: daß es wenigstens nicht ganz so vergnüglich sei wie der Harem … Diese Lehren können nicht ohne Folgen geblieben sein.
Es ist wohl eine autobiographische Rechtfertigung katholischer Erotiker wie Blei, wenn sie die Feindseligkeit der christlichen Kirche gegen das Sexuelle schlicht zu leugnen suchen und philosophieren: »Alle Religionen integrieren sich das Sexuelle, indem sie es sublimieren und sanktifizieren.« Tatsächlich hat das Christentum kaum sublimiert und sanktifiziert – außer vielleicht im Marienkult und der spirituell-sexuellen Nonnen-Mystik. Vielmehr hat die Kirche getan, was alle diplomatischen Utopisten taten: sie hat das Soll und das Ist hübsch separiert gehalten … und in ihren großen Jahrhunderten nicht noch durch Entrüstung die Aufmerksamkeit auf das Nebeneinander gelenkt.
So drang die Unzucht unbehelligt in die offiziellsten Kundgebungen ein – in die Ausschmückung der Kathedralen, in die Literatur der Geistlichen. Eines der ältesten anglo-sächsischen Denkmäler, das sogenannte Exeter-Buch, ist eine Sammlung von Äußerungen der Frömmigkeit, der Reue, erzieherischer Ideen. Der Herausgeber war ein Mönch. Aufgenommen wurden auch die gesalzensten Charaden:
Etwas Seltsames hängt dem Mann zwischen den Beinen
Unter seiner Kleidung. Es ist vorn gespalten,
Ist steif und hart, hat einen guten festen Platz.
Wenn der Mann seine Kleidung aufmacht
Über dem Knie, wünscht das Ding zu besuchen
Mit dem Kopf des herunterhängenden Werkzeugs das bekannte Loch,
Das es, wenn es hineinpaßt, schon oft vorher gefüllt hat.
Auflösung: der Schlüssel. Auf vielfältige Weise drang das Anzügliche in alle Gattungen der Literatur ein.