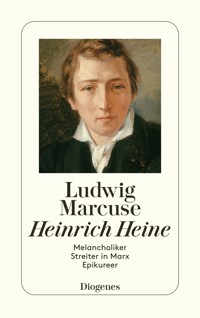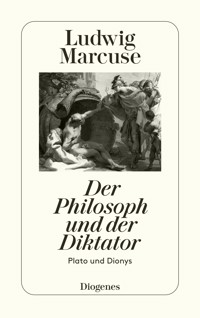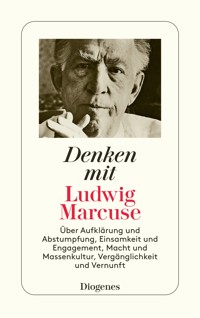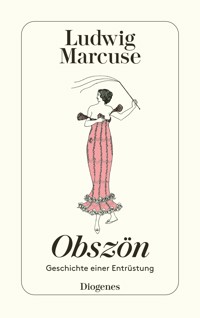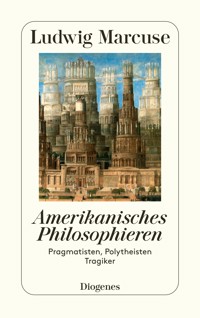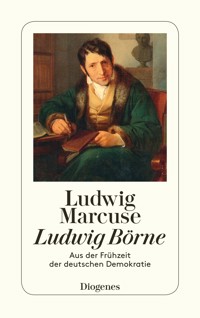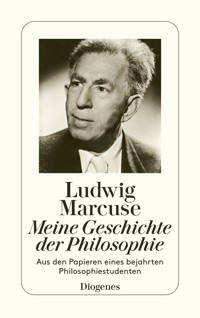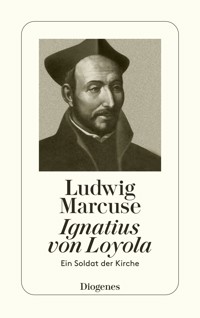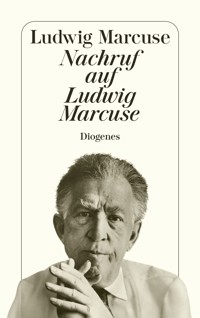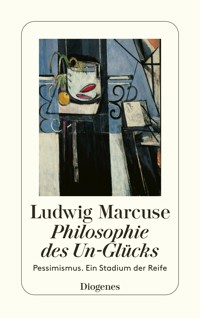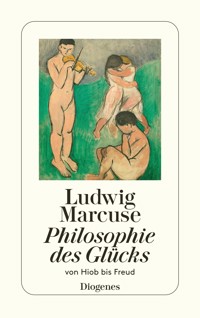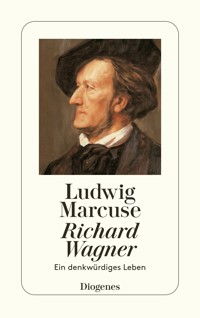8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Kaum etwas hat den Blick auf das menschliche Dasein so verändert wie die Psychoanalyse. Ebenso geist- wie kenntnisreich stellt Ludwig Marcuse, einer der »gescheitesten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts« (›Die Zeit‹), deren Gründervater in dieser biographischen Studie vor – der »Fall Sigmund Freud« als anregendes Leseabenteuer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Ludwig Marcuse
Sigmund Freud
Sein Bild vom Menschen
Diogenes
Für Frederick J. Hacker
Zur Erinnerung
an unsere Jahre in Hollywood
und das Thema Nummer Eins:
Sigmund Freud
Freundschaftlichst
L.M.
Einleitung
Von Mesmer zu Freud
Die Tiefen-Psychologie und die Psycho-Therapie, wie sie gegenwärtig in vielen Versionen gelehrt und praktiziert werden, haben lange historische Wurzeln. Man könnte diese Geschichte mit den Medizin-Männern beginnen oder mit Hippokrates und Galen oder mit dem berühmten Arzt Paracelsus. Für diesen knappen Abriß ist der beste Ausgangspunkt der Wiener Doktor Anton Mesmer (1733–1815).
In der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts war man schon zu aufgeklärt, um noch den Teufel ernst zu nehmen, der die Befallenen quäle, oder die spirituellen Austreiber, welche zu den Qualen noch neue hinzufügten. Aber man war – von einem späteren Standpunkt aus gesehen – noch nicht aufgeklärt genug, um zu beachten, daß die Verhexten echtes Leid erduldeten, auch wenn die Theologen es falsch interpretierten. Man behandelte nur die Verrückten, indem man sie einsperrte – und mit bitteren Medizinen. Diejenigen aber, die nicht reif fürs Irrenhaus waren, überließ man ihrem Schicksal. Da kam Mesmer. Er war auch ein Scharlatan … vor allem aber auf dem richtigen Weg. Es führt eine direkte Linie von Mesmer zu Freud (eine andere: von Mesmer zur Christian Science).
Dieser seltsame Vorfahr wurde am Bodensee geboren und praktizierte in Wien. 1766 veröffentlichte er ein Buch ›De planetarum influxu‹: die Sterne beeinflussen unser Leben mittels magnetischer Ströme. 1775 erschien sein ›Schreiben an einen auswärtigen Arzt über den Magnetismus‹: mit Hilfe von ›tierischem Magnetismus‹, der in uns sei, könnten wir Krankheiten heilen. Der Mann bekam Schwierigkeiten mit den Behörden, wurde als Quacksalber vertrieben und ging 1778 nach Paris. Sein Erfolg war enorm. Die magnetischen Séancen machten Furore. Da rüsteten sich auch hier die Gegner.
1784 setzte die Académie des Sciences ein Komitee ein, dem unter anderen der amerikanische Gesandte Benjamin Franklin und der Chemiker Lavoisier angehörten. Sie hatten zusammen mit der medizinischen Fakultät Mesmers Heilerfolge nachzuprüfen. Das Resultat lautete: starke Einbildungskraft ohne Magnetismus kann Konvulsionen hervorrufen, Magnetismus allein kann nichts hervorrufen; das Berühren der Patienten und die Stimulierung ihrer Phantasie mag gefährlich werden. Damit war der Heiler verurteilt. Er wurde zum Thema für lustige Theaterstücke. Aber seine Wirkung war nicht zu Ende, vielmehr im Beginn.
Der englische Chirurg James Braid (1795–1860) studierte den Mesmerismus. Obwohl er Chirurg war und an die Phrenologie glaubte, erkannte er, daß Mesmers große Entdeckung nicht in der Annahme eines magnetischen Fluidums lag, sondern in den subjektiven Elementen: den Erscheinungen, die er produzierte – z.B. diesem schlafartigen Zustand. Braid war der erste, der in seiner ›Neurohypnology or the rational of nervous sleep‹ (1843) die Worte Hypnotismus, hypnotisieren, hypnotisch einführte. Einige Forscher nannten deshalb den Hypnotismus: ›Braidismus‹.
Im Jahre 1860 begann der französische Landarzt A.A. Liébault (1823–1904) den Mesmerismus zu studieren. Er ließ sich in Nancy nieder. Nach jahrelangen Forschungen veröffentlichte er ein Buch ›Du sommeil et des états analogues, considérés surtout au point de vue de l’action de la morale sur le physique‹. Von diesem Buch wurde ein einziges Exemplar verkauft. Liébault arbeitete mit Hypnose bei Behandlung hysterischer Blindheit, Paralyse, Tics. Es war nicht leicht, die armen Bauern, mit denen er es zu tun hatte, zu dieser Kur zu bewegen. Er pflegte zu sagen: wenn ich Sie mit Apothekermitteln behandeln soll, müssen Sie zahlen; mit Hypnose mache ich es unentgeltlich. Braid und Liébault sind die Väter der modernen Psycho-Therapie. In den achtziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts war sie durchgesetzt. Der Schweizer Forel ließ 1889 sein Buch ›Der Hypnotismus‹ erscheinen, in Rußland arbeitete Bechterew mit der neuen Methode. Der entscheidende Sieg wurde in Paris errungen.
Jean Marie Charcot wurde 1825 geboren. Er wurde ein Neurologe, der (wie die meisten Psychiater des Jahrhunderts) in den Kategorien der Gehirn-Pathologie dachte. ›Wissenschaftlich‹ war für ihn (wie später für den jungen Freud): bezogen auf die Funktion des Gehirns und der Nerven. Charcot fragte: was geht im Gehirn und in den Nerven während des hypnotischen Schlafs vor? Seine große historische Leistung bestand darin, daß er die Hysterie, die er (gegen die Konvention) auch den Männern zuschrieb, bei der offiziellen Wissenschaft zur Anerkennung brachte; und daß er, einer der angesehensten Psychiater seiner Zeit, die Hypnose verwandte. In dem großen Pariser Frauen-Krankenhaus, der sogenannten ›Salpêtrière‹, wurden jene Forschungen angestellt, deren Ergebnisse er dann veröffentlichte in dem Buch ›Leçons sur les maladies du système nerveux faites à la Salpêtrière‹.
An dieser Forschungs-Stätte erschien im Jahre 1885 der 29jährige Wiener Arzt Sigmund Freud, um bei dem berühmten Kollegen zu studieren. Von 1886 an erschien dann seine Übersetzung Charcots: ›Neue Vorlesungen über die Krankheiten des Nerven-Systems, insbesondere über Hysterie‹. Im Todesjahr des Meisters, 1893, schrieb Freud einen Nachruf. Charcot sprach einmal über die Neurose einer jungen Frau und sagte nebenbei: Sexualität liegt immer zugrunde. Freud hörte diese Bemerkung.
Als er im Jahre 1885/86 an der ›Salpêtrière‹ arbeitete, hatte er schon zwölf Veröffentlichungen vorzuweisen: u.a. ›Über Spiralganglien und Rückenmark des Petromyzon‹ (1878), ›Beitrag zur Kenntnis der Cocawirkung‹ (1885), ›Über den Ursprung des Nervus acusticus‹ (1886). Diese Arbeiten zeigen die Felder seiner Studien. Geboren am 6.5.1856 in der kleinen mährischen Stadt Freiberg, 1860 nach Wien verpflanzt, wo er dann achtundsiebzig Jahre wirkte, absolvierte er 1873 das Wiener Sperl-Gymnasium, um Medizin zu studieren. Von 1876 bis 1882 arbeitete er im Physiologischen Institut des berühmten Professors Ernst Brücke, dann bei dem Gehirn-Pathologen Professor Meynert. 1885 wurde Freud Dozent der Neuropathologie an der Universität Wien. Zum ordentlichen Professor und zum Nobelpreisträger brachte er es nicht.
Auf dem Gebiet der Psychiatrie wurde rege gearbeitet. Zwischen 1818 und 1893 gab es fast fünfzig Fachzeitschriften in den Ländern Europas und in den Vereinigten Staaten. Es gab über 15 nationale und internationale Gesellschaften für Psychiatrie. In Deutschland erschienen zwischen 1830 und 1836 die historisch-kritischen Übersichten von Johannes Friedrich. 1847 hatte die Gesellschaft ›Deutsche Naturforscher‹ eine Sektion für Anthropologie und Psychiatrie, die ursprünglich aus dreizehn Mitgliedern bestand. Seit 1867 gab es die ›Berliner medizinische psychologische Gesellschaft‹ (Vorsitzender Griesinger), die nach 1885 ›Gesellschaft für Psychiatrie und Nervenkrankheiten‹ hieß. Das Interesse für diesen Zweig der Medizin wuchs unter den Medizinern von Jahrzehnt zu Jahrzehnt.
Freud hätte vorgezogen, sich der Forschung zu widmen; seine materielle Situation erlaubte es ihm nicht. So ließ er sich 1886, nach seiner Rückkehr aus Paris, in Wien als Psychiater nieder. Im selben Jahr heiratete er. Damals begann auch seine Zusammenarbeit mit dem Wiener Arzt Josef Breuer, welche schließlich zur Entdeckung jener Heil-Methode und zu jenen wissenschaftlichen Ergebnissen führte, die Freud auf den Namen ›Psycho-Analyse‹ taufte. Josef Breuer (1842 bis 1925) hatte es in den Jahren 1880 bis 1882 mit einer hysterischen Patientin zu tun gehabt, der er dadurch half, daß sie sich im Trance an den Beginn ihrer Leiden während der Pflege ihres kranken Vaters zu erinnern begann. Dieses Sicherinnern erleichterte sie. Das Resultat hatte Breuer bereits 1884 Freud mitgeteilt; der hatte Charcot davon erzählt, ohne Eindruck zu machen. 1886 begannen dann Breuer und Freud in der Richtung zusammenzuarbeiten, welche ihnen durch Breuers Erfolg gewiesen war. Sie nannten ihre Methode die ›kathartische‹. 1895 gaben sie in dem Buch ›Studien über Hysterie‹ Rechenschaft von den Ergebnissen. Es war das erste Mal, daß die Methode der Heilung und die Methode der Forschung miteinander verknüpft wurden.
Im Jahre 1889 ging Freud wieder nach Frankreich, diesmal nach Nancy, um die hypnotische Methode gründlicher zu studieren – an dem Platz, wo sie in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt worden war: bei Liébault und seinem Freund Hippolyte Marie Bernheim (1840–1919). Die sogenannte Schule von Nancy war mit der Schule der ›Salpêtrière‹ in einem schweren wissenschaftlichen Streit. Charcot war der Ansicht: die Fähigkeit, in hypnotischen Schlaf zu fallen, sei bereits ein hysterisches Symptom. Bernheim hingegen verfocht die These, daß fast jeder bis zu einem gewissen Grad hypnotisierbar sei; daß dahinter das allgemeinere Phänomen der Suggestibilität stände. Er studierte (wie später Freud) den Kranken, um ein Bild von der Psyche des Gesunden zu bekommen. Bernheim war auch einer der ersten, der seine Einsichten für die Rechtspflege fruchtbar zu machen suchte. 1897 las er auf dem Internationalen Kongreß für Medizin in Moskau eine Arbeit ›L’Hypnotisme et la Suggestion dans leurs rapports avec la médicine légale et les maladies mentales‹.
Bei diesen großen Nachkommen des bedeutenden Scharlatans Mesmer konnte Freud studieren, bevor er einen Schritt vorwärts machte. Er versuchte es nur kurze Zeit mit der Elektro-Therapie. Er verzichtete auch auf die Hypnose, aber nicht auf das, was sie Breuer geleistet hatte … den Patienten zum Sprechen zu bringen. Dasselbe Resultat suchte er zu erlangen mit dem, was er Freie Assoziation nannte. Der Patient wird nach Kräften veranlaßt herauszusagen, was ihm einfällt. Es war die neue Methode, welche die Psychoanalyse zunächst unterschied von dem hypnotischkathartischen Weg. Und die Einsichten, die ihm seine Kranken so vermittelten, führten zur neuen Theorie, deren wesentlichste Stücke wurden: der ›Widerstand‹ des Patienten, über das Entscheidende zu reden; der Prozeß der Verdrängung; der Oedipus-Komplex; die lange Geschichte der Sexualität vor der Pubertät; die Umsetzung des Verdrängten in Krankheits-Symptome.
Im ersten Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts erweiterte sich dann der Kreis seiner Probleme. Daß er mehr an psychologischen als an physiologischen Fragen interessiert war, zeigte schon die ›Traumdeutung‹ (1900) und ›Zur Psychopathologie des Alltagslebens‹ (1904). Noch vor Ende des Jahrzehnts, 1907, erschien sein erster großer Beitrag zur Ästhetik: ›Der Wahn und Träume in W. Jensens Gradiva‹. 1912 kam seine entscheidende Arbeit auf dem Gebiete der Anthropologie heraus: ›Totem und Tabu‹. Im Anschluß an eine Kritik der Massen-Psychologie, wie sie in Frankreich blühte, gab er die soziologische Analyse des Führers in ›Massen-Psychologie und Ich-Analyse‹ (1921). Dann folgten die großen kulturdiagnostischen Arbeiten: ›Die Zukunft einer Illusion‹ (1927); ›Das Unbehagen in der Kultur‹ (1930); ›Der Mann Moses und die monotheistische Religion‹ (1939). Wie sehr die Psychoanalyse an anthropologischen, soziologischen, ästhetischen, religions-psychologischen, zeitkritischen Problemen interessiert ist, an den ›Kolonien‹ des Mutterlandes, der medizinischen Psychologie, zeigt die Zeitschrift ›Imago‹, die 1912 zu erscheinen begann: Otto Rank und Hanns Sachs redigierten sie. Es ist nicht wahr, daß Freud auf die Psychologie des Individuums und hier vor allem auf die Sexual-Neurosen sich beschränkte. Früher als irgendein Schüler, bereits im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts, begann er, seine Methode auf alle Gebiete der Geisteswissenschaften anzuwenden.
Die äußeren Ereignisse seines Lebens können am besten so charakterisiert werden: es gab kaum welche. Er praktizierte am Tag, schrieb bei Nacht und machte in den Sommerferien Reisen nach Italien, nach der Schweiz, nach Berchtesgaden, nach vielen Plätzen Österreichs. 1886 heiratete er Martha Bernays. Sie hatten sechs Kinder: Martin, Oliver, Ernst, Sophie, Mathilde, Anna; die Kinder-Psychoanalytikerin Anna Freud wurde im Jahre 1895 geboren. Der Älteste war Rechtsanwalt, der zweite Sohn Ingenieur in Philadelphia, der jüngste Architekt. Anna und Mathilde lebten in London, Sophie starb in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Seit 1923, dem Jahre seiner ersten Kieferoperation, kränkelte Freud. Seine produktive Kraft ließ nicht nach. 1930 wurde ihm eine der wenigen Ehrungen seines Lebens zuteil: die Stadt Frankfurt am Main verlieh ihm den Goethe-Preis. 1936 wurde er zum Mitglied der ›Royal Academy‹ (London) ernannt. 1938 verließ er das von den Nationalsozialisten besetzte Wien und ging nach London ins Exil. Hier starb er am 23. September 1939. Einige seiner Schwestern gingen in Auschwitz zugrunde.
Am 4. Februar 1955 wurde in der Wiener Universität eine Freud-Büste aufgestellt, die der Bildhauer Königsberger 1921 geschaffen hatte.
Die bekanntesten Ereignisse im Leben Freuds waren die Kämpfe innerhalb der Schule. Freud hat sie beschrieben in seiner Schrift von 1914: ›Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung‹.
Im Herbst 1902 bildete sich die ›Psychoanalytische Mittwochs-Gesellschaft‹, die sich wöchentlich bei Freud traf: Adler, Kahane, Reitler und Stekel. Im Jahre 1906, als schon Brill, Ferenczi, Jones und Sadger dazugekommen waren, hörte Freud, die klinischen Ergebnisse der Psychoanalyse würden nachgeprüft von dem Direktor des ›Burghölzli‹ in Zürich, Professor Eugen Bleuler (1857–1939) und seinem Oberarzt Dr. med. Carl Gustav Jung (1875–1961). Im selben Jahre wurde die erste Arbeit über Psychoanalyse in Englisch publiziert: von Dr. James J. Putnam, Professor der Neurologie (Harvard University). 1908 fand der erste Kongreß für Psychoanalyse in Salzburg statt (bis 1954 gab es 18); Bleuler und Jung nahmen an ihm teil. Auf den Einladungen hieß es: ›Zusammenkunft für Freudsche Psychologie‹. 1909 begann das von Freud und Bleuler herausgegebene ›Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen‹ zu erscheinen; Jung wurde sein Redakteur (bis 1914 kamen 6 Bände heraus). Im selben Jahr, 1909, reiste Freud mit Jung nach Amerika. Der Präsident der Clark University, Worcester, Mass., Stanley Hull, hatte beide Gelehrte aufgefordert, zur Feier des zwanzigsten Geburtstags seiner Universität Gast-Vorlesungen zu halten. 1910 wurde in Nürnberg die Internationale Gesellschaft für Psychoanalyse gegründet, mit Jung als Präsident. Im selben Jahr erschien zum ersten Mal das monatliche ›Zentralblatt für Psychoanalyse‹ (Herausgeber: Adler und Stekel) und das ›Correspondenzblatt der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung‹. 1911 fand in Weimar der dritte, 1913 der vierte Kongreß statt. In diesem Jahr erschien der erste Band der ›Zeitschrift für ärztliche Psychoanalyse‹. 1912 war anstelle des ›Zentralblatts‹ unter der Redaktion von Ferenczi, Rank und Jones die ›Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse‹ entstanden.
Ein Jahr vor dem Münchner Kongreß, 1912, war Jungs Buch ›Symbole und Wandlungen der Libido‹ erschienen; Freud erklärte nun in München, daß Jungs Theorie keine echte Entwicklung der Psychoanalyse sei. Trotzdem wurde Jung noch einmal für zwei Jahre wiedergewählt. Aber der Bruch war da. Jung hatte das Wort ›Libido‹ über seinen engeren Begriff sexuelle Libido hinaus zu dem sehr umrißlosen erweitert: Libido gleich Seelen-Energie. Freuds Kritik lautete: »Von der Absicht, das Anstößige der Familienkomplexe zu beseitigen, um dies Anstößige nicht in Religion und Ethik wiederzufinden, strahlen alle die Abänderungen aus, welche Jung an der Psychoanalyse vorgenommen hat. Die sexuelle Libido wurde durch einen abstrakten Begriff ersetzt, von dem man behaupten darf, daß er für Weise wie für Toren gleich geheimnisvoll und unfaßbar geblieben ist. Der Oedipus-Komplex war nur symbolisch gemeint, die Mutter darin bedeutet das Unerreichbare, auf welches man im Interesse der Kulturentwicklung verzichten muß; der Vater, der im Oedipus-Mythos getötet wird, ist der ›innerliche‹ Vater, von dem man sich freizumachen sucht, um selbständig zu werden … In Wirklichkeit hatte man aus der Symphonie des Weltgeschehens ein paar kulturelle Obertöne herausgehört und die urgewaltige Triebmelodie wieder einmal überhört.«
Jung hat seine Differenzen mit Freud in einem Aufsatz ›Freud und Jung‹ dargestellt. Am deutlichsten sprach er über Freud und seine Lehre im Jahre 1934, im ›Zentralblatt für Psychotherapie‹: »Meines Erachtens ist es ein schwerer Fehler der medizinischen Psychologie gewesen, daß sie jüdische Kategorien unbesehen auf den christlichen Germanen anwandte; damit hat sie nämlich das kostbare Geheimnis des germanischen Menschen, seinen schöpferisch-ahnungsvollen Seelengrund, als kindisch-banalen Sumpf erklärt. Diese Verdächtigung ist von Freud ausgegangen. Er kannte die germanische Seele nicht, so wenig wie alle seine Nachfolger sie kannten. Hat sie die gewaltige Erscheinung des Nationalsozialismus, auf die die ganze Welt mit Erstaunen blickt, eines Besseren belehrt? Wo war die unerhörte Spannung und Wucht, als es noch keinen Nationalsozialismus gab? Sie lag verborgen in der germanischen Seele, in jenem tiefen Grunde, der alles andere ist als der Kehricht unerfüllbarer Kinderwünsche … Eine Bewegung, die ein ganzes Volk ergreift, ist auch in jedem einzelnen frei geworden.« Ernest Jones, der unparteiische Historiker, fand schon im Jahre 1913, daß Jung in Rasse-Kategorien dachte.
Jung nannte seine Abzweigung von der Psychoanalyse: ›Analytische Psychologie‹. (Seine bekanntesten Bücher: ›Psychologische Typen‹, 1921; ›Seelenprobleme der Gegenwart‹, 1931; ›Wirklichkeit der Seele‹, 1934.) Der Registrator dieser Fehde wird am besten den Zwist so resümieren: Jung wurde in gewisser Weise dadurch gerechtfertigt, daß Freud bald selbst dahin kam, den Begriff Libido weiter zu fassen, als es in den ersten Jahrzehnten geschehen war. Freud aber sah schon damals voraus, daß Jung die Psychoanalyse auf den Weg der Respektabilität zu führen gedachte: nicht nur, was die Sexualität – auch was die Religion anbetrifft. Noch im Jahre 1955 gab Jung der amerikanischen Zeitschrift ›New Republic‹ eine Äußerung zur Veröffentlichung (16. Mai), in der er von Freuds ›notorious inability to understand religion‹ sprach. Mit solchen verhetzenden, dem allgemeinen Geschmack entgegenkommenden, aber nicht treffenden Bemerkungen wird nur verschleiert, daß Jung sich (ebenso wie Freud) der Religion als Psychologe, nicht als Gläubiger näherte; auch Jung betonte, daß seine Forschungen auf dem Gebiete der Religion es nicht mit Gott, sondern nur mit den menschlichen Vorstellungen von Gott zu tun haben. Überhaupt ist die Differenz zwischen Freud und Jung (auch z.B. was das ›Kollektive Unbewußte‹ anbetrifft; 1911 bereits von Freud angenommen – ohne diese Wort-Prägung) nicht so groß wie die Parteinahme der ›religiösen‹, über das Sexuelle erhabenen Zeitgenossen vermuten läßt. Jung war der große Schüler Freuds, der versuchte, die Welt mit der Psychoanalyse diplomatisch auszusöhnen. Wahrscheinlich wird die Zukunft das Wort Professor Victor von Weizsäckers bestätigen, das in seiner Autobiographie zu finden ist: »daß alle wesentlichen Entdeckungen und Erkenntnisse der Psychoanalyse ausschließlich auf Freud zurückgehen«. Dieser Spruch gilt wohl auch für den ersten großen ›Abfall‹ aus dem Jahre 1911: den Abfall Alfred Adlers (1870–1937). Er promovierte 1894 in Wien, war als Psychiater und Dozent des Pädagogischen Instituts in Wien tätig und lehrte an der Columbia University (New York). Er starb in Aberdeen. Von seinen Arbeiten sind vor allem zu nennen: ›Studie über Minderwertigkeit von Organen‹ (1907), ›Über den nervösen Charakter‹ (1912), ›Praxis und Theorie der Individualpsychologie‹ (1912), ›Der Sinn des Lebens‹ (1933). Einer der besten Kenner der Konflikte innerhalb des Kreises um Freud, Fritz Wittels, sagte von Adler: er sei einer der fähigsten Freud-Schüler gewesen; nur hätte er einen Fehler gehabt, er konnte nicht analysieren. Adler, stark beeinflußt von Nietzsches ›Wille zur Macht‹, sah in diesem Willen und den Niederlagen in seinem Gefolge die ›Ursachen des Inferioritätskomplexes‹, des ›männlichen Protests‹ – ein wesentlicheres Agens, seiner Meinung nach, als die Sexualität. Freud schätzte Adler sehr und stellte ihn an die Spitze der Wiener Psychoanalytischen Gesellschaft. Er hoffte, ihn zu halten. Auch Adler wollte einen Ausgleich.
Im Jahre 1911 bewilligte ihm Freud drei Abende der regelmäßigen Mittwoch-Zusammenkünfte, um seine Abweichung von der Lehre darzustellen. Am vierten Abend begann die Diskussion. Am fünften gab es einen erbitterten Zusammenstoß. Adler verließ mit neun Anhängern, alle zehn Sozialisten, die ›Gesellschaft‹. Er nannte seine Lehre zur Unterscheidung von der Psychoanalyse ›Individualpsychologie‹. Freud verwarf durchaus nicht Adlers Theorie. Er betonte, daß ›die Adlersche Forschung der Psychoanalyse etwas Neues brachte, ein Stück der Ich-Psychologie‹; wandte aber auch energisch ein, Adler wolle sich ›dieses Geschenk allzu teuer bezahlen lassen durch die Verwerfung aller grundlegenden analytischen Lehren‹. Gerade der Fall Alfred Adler stellt die Frage, ob Freud nicht mit mehr Entgegenkommen den Verlust eines so bedeutenden Mitarbeiters hätte vermeiden können. Doch darf nicht vergessen werden, daß auch wissenschaftliche Gruppen die Toleranz nur bis zu dem Punkt ausüben können, wo Nachgiebigkeit – Auflösung aller Konturen bedeutet. 1912 folgte der Bruch mit Wilhelm Stekel (1868–1940).
Die Geschichte der psychoanalytischen Bewegung ist mehr als ein halbes Jahrhundert alt. Es ist in dieser kleinen Skizze nicht möglich gewesen, alle die Namen zu nennen, die hier eine Erwähnung verdienen. Infolge der deutschen Jahre 1933–1945 ist die Forschung auf diesem Gebiet und das Interesse für sie in den Ländern Mitteleuropas sehr zurückgegangen. In dem (1934 bei Alfred Kröner erschienenen) Lexikon ›Philosophisches Wörterbuch‹ ist zu lesen: »Die Psychoanalyse – als Ganzes – wird mehr und mehr als ›artfremdes‹, ›mechanistisch-materialistisches Denken‹ bekämpft, wenn auch bestimmte Ergebnisse Freuds als Forschungsfortschritte anerkannt werden.«
Vielleicht liegt hier einer der Gründe, daß Theorie und Praxis der Psycho-Analyse in den englischsprechenden Ländern noch immer üppiger gedeihen als in Deutschland und in Österreich.
I. Freud – analysiert
Diskretion
»Schade, daß man sich für’s Intimste immer den Mund verschließt.«
Freud
Augustin begann die Beschreibung seines Lebens mit Gott, dessen er so gewiß war, daß er sein Dasein von ihm ableitete. Von den frühen Jahren berichtete er ausdrücklich nichts: er erinnere sich an sie so wenig wie an die Zeit im Mutterleib. Allerdings schaltete er eine kleine, unakzentuierte Frage ein: »Wo ist diese Zeit hingekommen?« Fünfzehnhundert Jahre später versuchte Freud, dieses unbeachtete Rätsel zu lösen.
Im übrigen beantwortete Augustin mehr, als irgendeiner seiner großen Nachfolger zu fragen wagte. Er konnte sein Leben sehr umfänglich deuten, weil er genau wußte, was ein Mensch ist: von Gott gemacht und außerdem noch in Sünde empfangen. Man weiß von sich soviel, wie man von ›Gott‹ weiß. Man wurde sich rätselhaft in dem Maße, in dem man ihn aus den Augen verlor.
Als Rousseau nach den Confessiones die Confessions schrieb, kam für ihn Augustinus’ Bild vom Menschen so wenig in Frage, daß er mit den Worten begann: »Ich plane ein Unternehmen, welches kein Vorbild hat.« Das war also historisch falsch – und doch nicht ganz; denn er wollte einen Menschen ›in aller Wahrheit der Natur‹ abbilden … und diese Rousseausche Menschennatur war vor ihm allerdings unbekannt gewesen. Sie bestand im ›Anders‹-Sein, auf das es ihm allein ankam; er schilderte in seiner Autobiographie eine Abweichung. Eins aber teilte der unheilige Rousseau mit dem heiligen Augustinus: auch er stellte nicht in Frage, daß so etwas wie eine Selbstdarstellung möglich ist.
Rousseau hatte sich sehr geirrt, als er schrieb, daß er ›niemals einen Nachahmer finden wird‹. Sein großes Thema ›Einzig und allein ich‹ beherrschte auch Stendhal, als er mit siebzehn daran ging, seine unpathetischeren, weniger exhibitionistischen Tagebuch-Eintragungen zu machen. Auch Stendhal fragte sich nicht, ob er denn wisse, was ein Mensch sei – so daß er ihn darstellen könne; sah aber, obwohl er nicht für den Druck schrieb, daß ein ungewöhnlicher Mut nötig ist. Die Problematik solch eines Unternehmens trat ins Bewußtsein.
›Dichtung und Wahrheit‹ beginnt goethesch-unbekümmert, ohne dogmatisch-feierliche Anrufung des Gottes oder der Natur, mit den Worten: ›Am 28ten August 1749 …‹ Er hatte die Augustinische und Rousseausche Präambel nicht nötig; brauchte sich nicht einmal à la Stendhal Mut zu machen. Er suchte gar nicht mehr die fragwürdige ›Wahrheit‹ seiner Existenz; er wollte sie nur zum Kunstwerk erhöhen. Das ist ihm voll gelungen; so sehr, daß er heute als Mythos unter uns lebt. Im ›Vorwort‹ zu diesem gedichteten Leben steht der Satz: es werde mit einer wahren Autobiographie »kaum Erreichbares gefordert, daß nämlich das Individuum sich und sein Jahrhundert kenne«. Goethe versuchte gar nicht mehr, die unverfälschte Wahrheit abzubilden. Diese Bescheidenheit stammte schon aus der post-dogmatischen Ära unserer Überlieferung. In ihr wuchs die mißtrauische Haltung zum Selbst-Bekenntnis enorm. Dies Mißtrauen weiß meist nicht genau, wem es eigentlich mißtraut. So wird an Konfessionen, Selbst-Darstellungen, Memoiren immer wieder die Frage gerichtet: wie weit Wahrheit? von wo ab Dichtung? Alles, was man herauszubringen trachtet, ist die bewußte oder unbewußte Entstellung. Kaum wird je gefragt: was ist das eigentlich – autobiographische Wahrheit?
Das Vorurteil sagt, es sei leichter, das Leben eines anderen zu beschreiben. Manchmal: ja, manchmal: nein. Wenn ich mit jemand spreche – und beobachte zu gleicher Zeit ihn und mich, so ist nicht von vornherein ausgemacht, wen ich richtiger sehe. Es mag sogar sein: mich; weil ich vielleicht in diesem Moment nicht so interessiert an mir bin. Es ist also ein Aberglauben, daß Selbst-Bildnisse mehr von Illusionen gefährdet sein müssen als Bildnisse von Zeitgenossen oder historischen Figuren, nach Dokumenten gemalt.
Das Selbst-Bildnis teilt mit der Biographie die Gefahr der Ablenkung durch zwei Kräfte: das besondere Motiv, welches das Porträt veranlaßt; und die allgemeine Vorstellung von dem, was ein Mensch ist. Ihr allgemeinstes, metapsychologisches Vorurteil ist den meisten Darstellern von Menschen verborgen. Die großen Vorbilder Augustin, Rousseau, Stendhal durchschauten nicht das Bild vom Menschen, welches ihr Selbst-Porträt erst ermöglichte. Aber nicht bevor dies Vorurteil ins Bewußtsein gehoben wird, ist vollendete Selbst-Erkenntnis möglich. Erkenne dich selbst! hat zur Voraussetzung: wisse, was ein Mensch ist. Man kann deshalb annehmen: der ideale Autobiograph wird ein großer Psychologe sein – begabt mit soviel Phantasie, daß er sein Leben als Illustration seiner Theorie von der Natur des Menschen abbilden kann.
Diese seltene Vereinigung von psychologischer Bewußtheit und poetischer Begabung, den individuellen Fall darzustellen, war im zwanzigsten Jahrhundert gegeben: in Freud. Nach seinen ersten Arbeiten schrieb Krafft-Ebing: »Es klingt wie ein wissenschaftliches Märchen.« Freud selbst fand, daß seine Krankengeschichten sich wie ›Novellen‹ lesen. Sein Gesamtwerk könnte man überschreiben: von der ›trockenen Phantastik der Wissenschaft‹ – eine Wendung, in der er die beiden Elemente seines Schaffens glücklich verschmolz. Wenige Jahre vor seinem Tod bezeichnete er in einem Brief an Einstein diese ›trockene Phantastik‹ als Merkmal jeder Wissenschaft. »Vielleicht haben Sie den Eindruck«, heißt es da, »unsere Theorien seien eine Art Mythologie, nicht einmal eine erfreuliche in diesem Fall. Aber läuft nicht jede Naturwissenschaft auf eine solche Art von Mythologie hinaus? Geht es Ihnen heute in der Physik anders?« Man hat in unseren Tagen die Methode der Philosophie ›vernünftige oder systematische Phantasie‹ genannt. Freud besaß sie in hohem Maße. Er wäre also der Mann gewesen, ein Selbst-Bildnis zu schaffen: durchsichtig wie noch keins gewesen ist zwischen Augustinus und Strindberg. Er hätte seine Psychologie in einem Fall, in seinem Fall, darstellen können. Daß er es nicht tat, ist einer seiner wesentlichsten Züge.
Der französische Philosoph Jean Wahl teilte mit, sein Freund Bergson habe testamentarisch jede Veröffentlichung aus dem Nachlaß – aus Vorlesungen, Vorträgen, Briefen – untersagt. Er wollte, daß die Welt ihn nur als Autor der für den Druck bestimmten Aibeiten kenne. Freud machte keine so scharfe Trennung zwischen Werk und Werkstätte. Aufs schroffste aber wehrte er der Welt den Zugang zum Werker. Bergson scheint nur ästhetische Bedenken gehabt zu haben. Der furchtlose Freud fürchtete nichts mehr als das Erkanntwerden. Der Schöpfer der indiskretesten Wissenschaft war, was sein eigenes Leben angeht, von einer geradezu aggressiven Diskretion.
Es ist nicht festzustellen, wieweit er sich selbst sein Leben erhellte von den Lichtquellen her, die er geschaffen hatte; dargestellt hat er das erhellte Leben nicht. Seine selbstbiographischen Skizzen und Bemerkungen verdienen nicht diesen Namen. Sie dürfen sich eher rühmen, durch Beschreibung (nicht seines Selbst, sondern) seiner wissenschaftlichen Probleme von diesem Selbst abgelenkt zu haben. Wie die Romantiker liebte er es, Bekenntnisse zu verschlüsseln. Aber hinter den Verschlüsselungen Kierkegaards verbargen sich wirkliche Geheimnisse. Hinter Freuds unkenntlich gemachten Offenbarungen stecken die harmlosesten Mitteilungen. Einige ›Deckerinnerungen‹ hat ein detektivisch begabter Forscher aufgedeckt. Was da zutage kam, waren die unverfänglichsten Angaben über Freuds frühe Jahre. Trat er selbst hervor, vor allem in der ›Traumdeutung‹, so sorgte er dafür, daß nicht mehr herauskam, als unbedingt nötig war, das Problem zu illustrieren. Manches geheimnisvolle Bis-hierhin-und-nicht-weiter gibt zu verstehen, daß er es ablehnte, sich zu zeigen. Der offizielle Biograph, der englische Freund Ernest Jones, versichert: Freud zensurierte alle Informationen über sich viel strenger, als man gewöhnlich annimmt.
Man ziehe nicht den Schluß, er hätte weniger gewagt, wäre weniger aufrichtig gewesen als die klassischen Beichtkinder. Er hätte sich nur nicht mit Wahrheit und Dichtung begnügt. Auch war seine seltene Empfindlichkeit für wahr und nicht-wahr, seine Unfähigkeit, Täuschungen zu unterliegen, zu groß, als daß er sich à la Rousseau hätte pathetisch zieren können. Dem Fanatiker der Nüchternheit fehlte der Hang zum Exhibitionismus – dem größten Fälscher öffentlicher Beichten. Er hätte die ideale Konfession ablegen können. Aber das einmalige Zusammen von ungewöhnlicher Unfähigkeit zum Selbstbetrug und einer für einen Aufklärer ungewöhnlichen Schüchternheit vor dem, was seine Gesellschaft erwartete, verdarb die größte Chance, die es in der Geschichte der Selbst-Bildnerei gegeben hat: das Freud-Porträt Freuds.
Er war über alle Maßen scheu. Er vertrug nicht, daß man ihn anstarrte; auch deshalb saß er hinter dem Kopfende des Patienten. Er wollte eher noch einen ungünstigen Eindruck machen als etwas preisgeben von seinem persönlichsten Leben. Deshalb – und nur deshalb – kam für ihn nicht in Frage, sich analysieren zu lassen. Eine seiner Ausreden lautete: »Ich bin noch heute der Meinung, daß bei einem guten Träumer und nicht allzu abnormen Menschen die Selbstanalyse mit Hilfe der Traumdeutung genügen kann.« Ein anderes Mal entschuldigte er sich: alle Analytiker seien steine Schüler; das hätte ihm unmöglich gemacht, in die Analyse zu gehen. Der Mann, der die Preisgabe des Verschwiegensten zum Fundament der Therapie machte, war selbst nicht bereit, sich preiszugeben.
Auch trug er schon früh Sorge, daß nur ein sehr zensuriertes Bild von ihm auf die Nachwelt kam. Als er neunundzwanzig war, schrieb er an die Braut: machen wir es meinen künftigen Biographen schwer! ›Ich habe alle Tagebücher der letzten vierzehn Jahre vernichtet. Soll jeder von ihnen glauben, er allein habe die richtige Vorstellung von der Entwicklung des Helden!‹
Diese fast gehässige Schadenfreude verrät Angst vor den Einbrechern in sein Privatleben. In den künftigen Biographen sah er bereits als junger Mann – Feinde, gegen die man beizeiten Maßnahmen zu ergreifen hat. Wer immer sich an ihn um persönliche Informationen wandte, erhielt eine unfreundliche Abfuhr. Da hieß es: das Publikum geht nichts an, wer ich bin; da ist nichts zu lernen, wenn ich nicht alles sage – und ich kann nicht alles sagen. Das war die Antwort an einen biographierenden Schüler. ›Selbstschutz‹ nannte Freud sein Motiv. Später dachte er, sich dem Unabwendbaren anpassend: wenn schon Eindringlinge – dann wenigstens lizensierte. Der Autor eines der besten Freud-Bücher wurde als ›ungebetener Biograph‹ gebrandmarkt … als ob es Biographie-Lizenzen gäbe. Und selbst der offizielle Ernest Jones, nach Freuds Tode von der Familie approbiert, wußte, daß der Meister ihm nicht einmal seine sehr zurückhaltende Darstellung gestattet hätte.
Freuds Abneigung gegen eine psychologische Obduktion wurde auch von den Erben respektiert. Sie halten unser Wissen von der Seele des großen Seelenforschers in sehr engen Grenzen; darin Nachfolger der Nietzsches und der Wagners. Fünfundzwanzighundert Familienbriefe, zum guten Teil Briefe, die Freud schrieb, sind ungedruckt. Fünfzehnhundert Liebesbriefe, neunhundert von Freud an die Verlobte, sechshundert von ihr an ihn, sind ungedruckt … und wieviel mehr an Freunde, an Schüler, an Fremde? Eine ›Geheime Chronik‹, welche die Brautleute gemeinsam verfaßten, ist ungedruckt. Alles dies stellte die Familie als einzigem dem englischen Analytiker Ernest Jones, einem der ältesten Schüler und Freunde Freuds, zur Verfügung; er machte davon nur sehr zurückhaltend Gebrauch. Jones, der das ganze ungeheure Material kennt – auch die vielen hundert Briefe an Abraham, Ferenczi, Jung –, Jones, der Eingeweihteste, ist im Sinne des Meisters nicht ein ›ungebetener‹, sondern ein gebetener Biograph. Er ist eingesetzt als der große Zensor; das verringert nicht den Respekt vor diesem hingebenden, durch Kenntnis, Fleiß und Sorgfalt ausgezeichneten Porträtisten.
Er ist besonders einsilbig, wenn er von Freuds Liebeserfahrungen spricht. Nietzsche sagte von Schopenhauer: die große Rolle, die er dem Eros zugewiesen habe, sei charakteristisch für das Lebensalter, in dem sein System entstand. Es ist keine Schlüsselloch-Neugierde, wenn man in allen Freud-Darstellungen die individuelle Geschichte jenes Triebs vermißt, dem er die Allmacht über das Leben (wenn auch nicht über den Tod) zugesprochen hat. Sein voreheliches Liebesleben wird von dem Eingeweihtesten in einem Paragraphen abgetan – mit der Versicherung, daß es keins gegeben habe; obwohl schon aus den spärlichen (als Zitate veröffentlichten) Briefen hervorgeht, daß er einer der stürmischsten Liebhaber gewesen sein muß. Der nicht ›ungebetene‹ Biograph schreibt: Freud schenkte dem andern Geschlecht wenig Beachtung, habe fast alles sublimiert. So ähnlich sagt’s der Pfarrer auch. Über sein Eheleben, das doch, angesichts von sechs Kindern, offenbar konsumiert, nicht sublimiert worden ist, findet sich kein Wort. Man weiß nur, daß Freud der Tradition folgte: der Mann habe zu führen. Die amerikanische Frau hielt er für ein Unglück, weil sie an die Gleichheit der Geschlechter glaube. Der stärkste Ausdruck dieser männlichen Überheblichkeit war Freuds Erfindung des weiblichen Penis-Neids. Wie aber der Familienvater Frau und Töchter regierte, hat niemand beschrieben.
Denn die Freunde, die ihn abgemalt haben, sind ebenso verschwiegen – wie der Meister es nicht liebte, wenn das Thema nicht Sigmund Freud war. Als einer der ältesten Freudianer, einer der engsten Freunde, fn einem Kreis von Analytikern gebeten wurde, den Liebhaber Freud darzustellen, lehnte er scheu ab; nachdem er einen Tag zuvor in breitester Öffentlichkeit die gewagtesten Mitteilungen aus seiner Praxis zum besten gegeben hatte. Diejenige Wissenschaft, die den Respekt vor dem Verhüllten mehr als irgendeine zerstört hat, respektiert unerbittlich das verschleierte Bild zu Wien. Übrigens würde wohl eine soziologische Untersuchung von Dichter-und-Denker-Bünden ergeben, daß die Freudianer sich zu dem Stern ihres Bundes nicht anders als andere Sekten zu ihrem Stifter verhalten.
Gegen seinen ausdrücklichen Willen wurde nach seinem Tod der Briefwechsel mit Doktor Fliess, der in andere Hände gekommen war, gedruckt. Freud hatte sich einer Veröffentlichung um so mehr widersetzt, als hier seine Selbst-Analyse publik gemacht würde. Dieses Dokument erschien also schließlich – aber zensuriert. Und wieweit hatte Freud bereits die Mitteilungen von seiner Selbst-Analyse zensuriert? Und wieweit war dieses Sich-Öffnen nicht auch das Gegenteil: ein Sich-Zudecken? Das wird die Frage sein, die immer wieder gestellt werden muß.
Im einundvierzigsten Jahr seines Lebens, im Sommer 1897