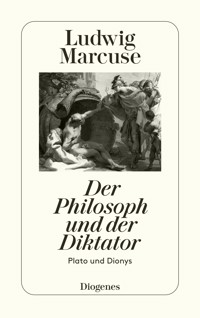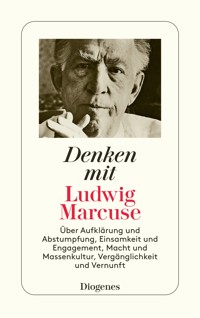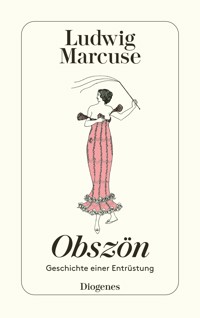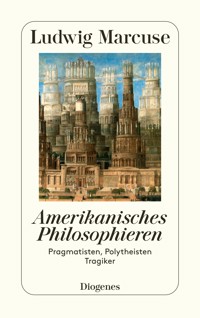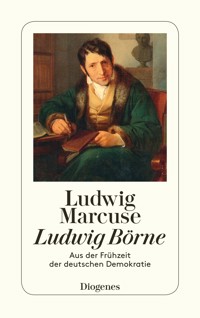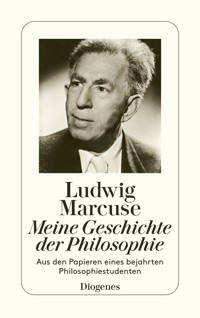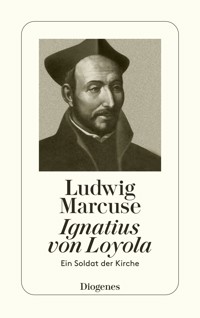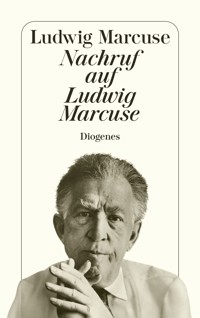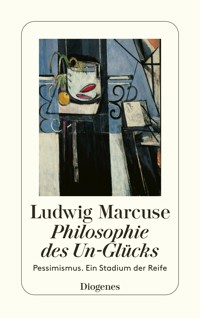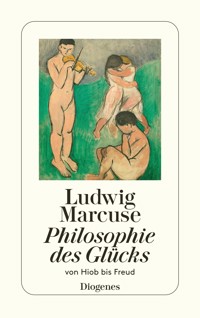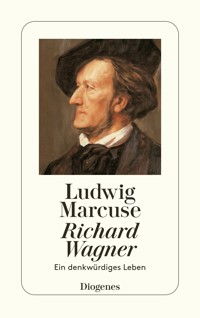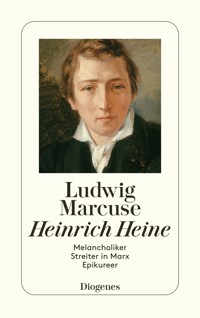
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die erste Auflage des Buchs erschien 1932, ein Jahr vor Beginn des Dritten Reichs, die zweite 1951, sechs Jahre nach seinem Ende. In Nazideutschland war Heine verboten, und Marcuse musste fliehen: »Ich hatte mir nie überlegt, was ich tun würde, wenn ich etwas tun müsste – sondern schrieb ein Heine-Buch, in dem ich sehr scharf die Position des geliebten Dichters beschrieb. Er wuchs mir deshalb so ans Herz, weil er mich und meine Freunde schon ausgesprochen hatte, bevor wir auf der Welt waren, und er ist heute ebenso aktuell, wie er es 1840 war und 1933. Als ich das Buch 1932 herausbrachte, hatte ich keine Ahnung, wen ich alles beschrieben hatte.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ludwig Marcuse
Heinrich Heine
Melancholiker, Streiter in Marx, Epikureer
Diogenes
1932, 1951, 1970
Die erste Auflage erschien 1932 bei Rowohlt, ein Jahr vor Beginn des Dritten Reiches, die zweite sechs Jahre nach dem Ende, wieder im Rowohlt-Verlag; sie enthielt auch die Mitteilung einiger Erfahrungen, die der Emigrant von 1933 mit dem Emigranten Heine hundert Jahre zuvor gemacht hatte. Die dritte Auflage hat eine größere Zahl von Zusätzen erhalten: Heine und Marx, Heines Lyrik und das Heine-Bild nach 1945 betreffend.
L.M.
I. Figuren einer Jugend
Erstes Gastspiel der Égalité in Deutschland
Eines März-Morgens – es war im Jahre 1806 – wachte in Düsseldorf am Rhein ein kleiner Junge auf. Er wollte, wie gewohnt, mit den anderen kleinen Jungen und den Erwachsenen im Chor rufen: »Guten Morgen, Vater!« Denn damals herrschten Väter über die Länder. »Die Krone war ihnen am Kopf festgewachsen, und des Nachts zogen sie noch eine Schlafmütze darüber« – schrieb später der kleine Junge, als er ein großer Mann geworden war, von diesen gekrönten Häuptern. Doch an diesem Morgen war die Schlafmütze weg und die Krone weg und der ganze Landesvater weg.
Die Landeskinder waren betreten. Das Wetter war trübe. An der Tür des Rathauses hing ein langes Papier. Der dünne Schneider Kilian stand davor – er hatte die Nanking-Jacke an, die er eigentlich nur zu Hause trug; und die blauwollenen Strümpfe sackten traurig herab. Neben ihm las ein alter pfälzischer Invalid mit verblichener Uniform und vernarbtem Soldatengesicht das Plakat – die Tränen sickerten in den Schnauzbart. Der kleine Junge schnappte nur abgerissene Worte auf: »Der Kurfürst läßt sich bedanken … für die bewährte Untertanstreue … und entbinden Euch Eurer Pflichten …« Vom Rathaus holte man das kurfürstliche Wappen herunter. Die Stadtväter schlichen betrübt durch die Gassen.
Der neunjährige Junge ging weinend zu Bett. In der Nacht hatte er einen schweren Traum: die Welt wurde ausgeräumt; Gärten und Wiesen wurden wie Teppiche zusammengerollt; die Sonne wurde vom Himmel abgehängt; die Sterne glitten abwärts wie gelbes Herbstlaub; die Menschen verloren sich; der Junge irrte einsam umher, voller Angst – bis er an die Weiden-Hecke eines verfallenen Bauernhofes kam, auf dem ein Mann Erde auswarf und ein Weib den Mond, den sie in der Schürze hielt, ins offene Grab legte. Der Traum zerging. Über der Straße lag Sonne. Unter der Sonne schallte vergnügtes Trommeln. Der Vater des Jungen saß im weißen Puder-Mantel vor dem Friseur. Der Friseur erzählte, von welch guter Familie der neue Großherzog, Napoleons Schwager, sei; wie gute Manieren dieser Joachim Murat habe; daß er sein schönes, schwarzes Haar in Locken trage; und bei seinem Einzug demnächst den Weibern gefallen werde. Die erregenden Trommelwirbel lösten sich auf in die bunten Bilder der einmarschierenden französischen Truppen: in den heiteren Ernst der Grenadiere; in die stolze Wucht der Bärenmützen; in die Lustigkeit der Voltigeurs; in das Vivat der dreifarbigen Kokarden; in das Blinken der Bajonette; und in die imposante Figur des gewaltigen, silberbestickten Tambourmajors, der einen Stock mit vergoldetem Knopf hinauf zur ersten Etage warf und seine Augen sogar bis zur zweiten, wo schöne Mädchen am Fenster saßen.
Der Junge lief zum Marktplatz. Dort sah es ganz anders aus als gestern. Der alte Mieter war ausgezogen, der neue eingezogen. Alles war überglänzt von Renovierung. Am Rathaus prangte ein neues Wappen. Vom Balkon hingen gestickte Sammetdecken herab. Französische Grenadiere standen Wache. Die Gesichter der Stadtväter strahlten in frischen Farben. Sie hatten ihre Sonntagsröcke aus den Schränken genommen und grüßten: bon jour. Die Fenster waren dicht besetzt mit Damen, die neugierig auf die Straße hinuntersahen, auf welcher großer Trubel war, ein buntes Durcheinander von Bürgern und Soldaten. Die Jugend hatte schulfrei zu Ehren des neuen Herrn, dem jetzt gehuldigt wurde. Der Düsseldorfer Junge kletterte mit einem Kameraden auf die kolossale, schwarze Reiterstatue des seligen Kurfürsten Jan Wilhelm, der in seinem schwarzen Harnisch und seiner tief herabhängenden Allonge-Perücke inmitten dieser fremden Szene ehern-unnahbar thronte. Auf dem Balkon des Rathauses: Soldaten, Fahnen und Trompeten; im roten Rock der Bürgermeister, der eine lange Rede hielt. Er teilte den Düsseldorfer Bürgern mit, daß man sie glücklich machen werde. Nach seinem letzten Wort wurde posaunt, wurden Fahnen geschwenkt, wurden Trommeln gerührt, wurde Vivat gerufen – und auch der Junge rief Vivat, wobei er sich an der Allonge-Perücke seines alten Kurfürsten sicherheitshalber festhielt. Vom Wall her wurde gebollert. Dann stieg der Junge von seinem massiven Pferd herunter, lief zur Mama und berichtete ihr wortgetreu: »Man will uns glücklich machen und deshalb ist heute keine Schule.«
Am nächsten Tag war wieder Schule; das Leben besteht nur zum kleinsten Teil aus schulfreier Welt-Geschichte; der große Rest ist schulpflichtiger Alltag. Der Junge mußte sich wieder um die römischen Könige kümmern; um die verba irregularia; um Griechisch, Hebräisch, die deutsche Sprache, Geographie und Kopfrechnen. Einen Augenblick lang hatte ihm die Weltgeschichte eine ihrer imposanten Szenen gezeigt; dann verschwand sie wieder hinter dem Alltag des Knaben und wirkte unsichtbar weiter, bis er erwachsen war und selber Geschichte machte.
Wer war der große Unruh-Stifter, der den dreihundert deutschen Fürsten die dreihundert Schlafmützen von den dreihundert Köpfen riß und mit ihnen die dreihundert Kronen? Der die Kinder fortholte von den mehr oder weniger guten Herzen ihrer fürstlichen Väter? Nicht nur in Düsseldorf und in Deutschland, sondern auch in den Niederlanden, in Italien, in Spanien, in Polen? Der große Unruh-Stifter war die Französische Revolution und das Heer der Französischen Revolution und der stärkste Mann der Französischen Revolution, Napoleon. In dem Jahre, in dem der Düsseldorfer Junge geboren wurde, siegte Napoleon bei Rivoli; als der Junge schulfrei hatte und von dem ehernen Pferde seines alten Kurfürsten herab Vivat schrie, war Napoleon schon zwei Jahre Kaiser der Franzosen. Das Römische Reich Deutscher Nation – oder, wie Talleyrand sagte, die Confédération germanique – lag im Sterben. Wie Leichensteine auf einem Kirchhof, schrieb ein Historiker der nächsten Generation, standen Kaisertum und Reichstag, Reichsgericht und Reichsarmee umher und bekundeten, daß hier jetzt steif und starr und kalt liege, was sich einst in frischem Lebensmute bewegt hatte.
Ein frischer Lebensmut kam von außen, von Frankreich. Die einen sahen nach Westen und waren hoffnungsfreudig, wie Görres in Coblenz und Forster in Mainz. Die andern spürten den Zerfall; und klagten, wie die ›Mainzer Zeitung‹: »Es gibt kein Deutschland mehr. Was man für Anstrengungen einer gegen ihre Auflösung ringenden Nation zu halten versucht sein könnte, sind nur Klagen weniger Menschen am Grabe eines Volkes, das sie überlebt haben.« Der Landesherr des Düsseldorfer Jungen zur Zeit seiner Geburt, Karl Theodor von der Pfalz, gehörte zu denen, die weder selig nach Westen blickten noch verzweifelt den Untergang des Reiches bebrüteten; ihm war die Zeitenwende nur ein Episödchen der Weltgeschichte. Als er die Nachricht von der Hinrichtung Ludwigs xvi. erhielt, meinte er: man solle lieber den Vulkan in sich ausbrennen lassen, nicht noch durch einen Krieg gegen Frankreich nähren. Solch ein Krieg werde erst alle Franzosen eines Sinnes machen; man solle durch einen militärischen Kordon die deutsche Grenze gegen alle Franzosen, welcher Partei sie auch angehörten, sperren. Die Enthusiasten und die Klageweiber und die, welche glaubten, das Morsche könne durch ein paar Schildwachen an ein paar Grenzpfählen erhalten werden, wurden in gleicher Weise weggeschwemmt von den Fluten der Französischen Revolutions-Heere.
Die deutschen Landesväter waren nicht alle so elend, wie sie, als vorteilhafter Hintergrund für Napoleon, im Nach-Ruhm, in der Nach-Schande weiterlebten: infantile Paschas, Despoten in Schlafrock und Pantoffeln. Max Joseph von Pfalz-Zweibrücken, der Nachfolger Karl Theodors, hob das Censur-Kollegium auf, »weil es den liberalen Gang der Wissenschaften aufzuhalten scheine«. Friedrich Wilhelm I. verbot das Tragen von Pantinen, um die Lederindustrie zu heben; und allzulanges Trauern, um den Absatz bunter Wollstoffe zu fördern. Kurfürst Klemens Wenzel von Trier ließ die für die Schiffahrt gefährlichen Steine aus dem Rheinbett holen und belehrte die Köchinnen, daß sie beim Kochen von Schmalz vorsichtig sein müßten und brennendes Schmalz nicht mit Wasser, sondern nur mit Asche löschen dürften.
Wie intim mancher Landesfürst mit seinen Untertanen lebte, wie familiär mancher Landesfürst für das Wohlergehen seiner großen Familie sorgte, ist uns recht anschaulich überliefert in einer Erklärung, die der Rat einer kleinen Ackerstadt, Meckenheims, 1797 dem Verwalter des Kantons Bonn abgab, um das Fernbleiben der Meckenheimer von der Errichtung des Freiheitsbaums zu begründen: »Unsere alte Regierungsart kennen wir und lebten ruhig und zufrieden; noch erinnern wir uns, als unser gnädigster Landesfürst nach dem schrecklichen Brande des hiesigen Städtchens wie ein Vater unter seinen Kindern in unserer Mitte stand. Diese Auftritte werden wir nie vergessen, und wenn es uns nicht mehr erlaubt sein kann, unter unserer vorigen Verfassung, und unserm gnädigsten Landesherrn zu leben, so entsagen wir unserer Freiheit, doch nicht unserem Dankgefühl und erklären, daß wir uns derjenigen Regierungsart unterwerfen, welche Zeit und Umstände über uns bestimmen.« Nicht alle Fürsten fielen damals aus ihrem Land heraus, wie hohle Zähne aus einem gesunden Kiefer. Aber nicht darauf kam es an!
Mit Frankreich, mit Napoleon kam die Zukunft: nicht irgendein neuer Fürst, sondern die Diktatur der Vernunft; bescheidener gesagt: die lebende Vernunft einer Gegenwart sprengte die Fesseln der abgestorbenen Vernunft einer Vergangenheit. Als der Düsseldorfer Junge zwei Jahre alt war, hatte Napoleon das Gesetzbuch einer neuen Zeit vollendet. In den ersten Jahren, im ersten Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts, schickte der Kaiser diese Gesetze auf Reisen: nach Düsseldorf, der Hauptstadt des neugeschaffenen Großherzogtums Berg, unter Aufsicht seines Schwagers Joachim Murat. Diese Brüder, diese Neffen, diese Schwäger, die Napoleon überall in der Welt zu Königen, Prinzen und Großherzögen machte, waren Satrapen eines Diktators; und er war zunächst der Vollstrecker der Idee von der Gleichheit der Ungleichen, der Égalité. Der Wille zu ihr, das herrschende Motiv innerhalb der europäischen Gesellschaft seit der Französischen Revolution, schuf eine neue Luft. Patriarchalisch, sentimental hatte sich Max Joseph von seinen Landeskindern verabschiedet. Der rotberockte Oberbürgermeister hatte dem fremden Großherzog eine devote, salbungsvolle Begrüßungsrede gehalten. Der neue Mann von Napoleons Gnaden, Joachim Murat, antwortete mit neuen Worten: »Es ist unmöglich, daß man mich in einem Lande, für das ich noch nichts getan, schon lieben kann, aber man wird mich lieben, ich versichere es.« Das war die Sprache der Illegitimität, das Pathos der Sachlichkeit – überglänzt von dem romantischen Schimmer, der den Kaiser Napoleon umgab. Im Stil von Bonapartes pathetischem Lakonismus kündigte der neue Mann an: nachdem die göttliche Vorsehung und das Vertrauen des großen Mannes, der jetzt das Weltall in Erstaunen setzt, mich zum Souverän des Großherzogtums berufen haben, halte ich mich für verpflichtet, meine Untertanen glücklich zu machen … und Murat sorgte dann auch wirklich für das Wohl seiner Untertanen; zum Beispiel für Getreide vom linken Rheinufer. Mit Murat, mit anderen napoleonischen Beamten, die bisweilen der Königstitel schmückte, kamen nicht irgendwelche neue Herren ins Land, mehr oder weniger besorgt um das Wohl der Regierten, mehr oder weniger persönlich untadelig; hinter den bunten Soldaten und dem gigantischen Tambourmajor, mit dem der Düsseldorfer Junge herzliche Freundschaft schloß, kam etwas ins Land, was damals für den Knaben noch nicht sichtbar war, was aber den Rahmen bestimmte, in dem der Mann leben sollte: der Feind aller gottgewollten, von den Menschen gewollten Privilegien, die Égalité. So konnte im Jahre 1811 der Präsident des Staatsrats den Kaiser Napoleon in Düsseldorf mit den Worten begrüßen: »Ihre Gesetze sind mächtiger als Ihre Waffen.« So konnte einer der napoleonischen Präfekten an die Maires seines Departements schreiben: »Sagen Sie Ihren Mitbürgern, daß die jetzige, für immer bestellte Regierung, welche Menschen und Dinge wieder auf ihren Platz setzt, die Willkür entwaffnet und das Reich des Gesetzes gründet, nichts Gemeinsames hat mit den früheren, vorübergehenden, mitten in den Unordnungen des Krieges geschaffenen Regiments.« Napoleon: das war zunächst eine bessere Gesellschaftsordnung.
Schon im Jahre 1792, drei Jahre nach Ausbruch der großen Revolution, hatte der Pariser Nationalkonvent beschlossen, allen deutschen Gebieten links des Rheins die Errungenschaften der Französischen Revolution zuteil werden zu lassen. Was dann zwei Jahrzehnte lang in Deutschland eindrang, war mehr als das Militär eines fremden Landes: es war der Code civil des Français, der Code Napoléon mit seinen 228 Artikeln – Napoleons Gesetzgebung aus dem Geist von 1789. Dieser Code überwand das Chaos der tausend individuellen Rechtszustände. Die europäische Zeit war für dies Gesetzbuch reif; deshalb konnte es sehr tolerant sein. So schrieb es für die Ehe-Schließung den Zivil-Akt vor, die kirchliche Trauung wurde zu einem privaten Nebenbei. Es blieb auch weiterhin den Ehepaaren unbenommen, sich nach altem Ritus trauen zu lassen und dem Zivil-Akt nur die Bedeutung einer staatlichen Zustimmung zur kirchlichen Handlung zu geben; Beispiel eines weitherzigen Radikalismus, dessen Weitherzigkeit bewies, auf wie wenig Widerstand er stieß. Der Radikalismus war die Konsequenz des einen zentralen Gedankens: Mensch gleich Mensch, Égalité. Égalité hieß damals: alle Bürger sind vor dem Gesetze einander gleich; das bürgerliche Recht ist unabhängig von dem religiösen Bekenntnis; das bürgerliche Recht schützt die persönliche Freiheit und das individuelle Eigentum. Deutschland wurde von Napoleon nicht nur okkupiert, es wurde vor allem bürgerlich revolutioniert. Die Leibeigenschaft wurde aufgehoben; die Leibeigenen und die dienstbaren Bauern erhielten alle bürgerlichen Rechte. Die Lehen wurden freies Eigentum der Lehn-Sassen. Alle Frondienste wurden ohne Entschädigung außer Kraft gesetzt. Die adligen Besitzungen wurden rechtlich den Bauernhöfen gleichgestellt. Das Verbot von Heiraten zwischen Adligen und Bürgermädchen oder Bäuerinnen fiel. Die väterliche Gewalt über Volljährige hörte auf. Ohne Rücksicht auf Stand und Wohnort sollte ein allgemeines Erbrecht zur Anwendung gebracht werden. In hundert Gesetzen ein einziges Prinzip: Égalité oder Ende – des Feudalismus.
Man darf sich keine Illusionen machen über die Quellen jener Zufriedenheit, die, namentlich im Westen und Süden Deutschlands, während der Herrschaft Napoleons herrschte; so daß Heinrich Heines Vater, als später alle frei herumlaufenden Philister über den gefangenen Löwen Napoleon herzogen, seufzen konnte: »Wollte Gott, wir hätten ihn noch.« Die Historiker sehen nur die ›Idee‹ einer vergangenen Zeit, die Gegenwart durchlebt Wünsche, Zufriedenheiten und Unzufriedenheiten. Der Godesberger Steuerbeamte konnte spät abends im Dunkeln mit seinem Geldsack allein den einsamen Weg nach Bonn gehen; nach der Hinrichtung des Johannes Büchler-Schinderhannes und seiner Bande war Ruhe und Ordnung im Land. Das Funktionieren der Polizei ist die erste Quelle aller Zufriedenheit einer Gesellschaft. Die zweite Quelle: der wirtschaftliche Aufstieg. Den Bauern ging es so gut, daß Görres am ersten März 1812 an Perthes schrieb: »Auf dem Lande nimmt der Wohlstand zu, überhaupt, nachdem in Europa zuerst der Adel geblüht und dann die Städte, scheint jetzt das Bauern-Regiment gekommen zu sein.« Dank Napoleon konnte der Bauer Land erwerben in einem früher nicht geahnten Umfang. 1802 bekamen die in Frankreich über den Verkauf der National-Domänen erlassenen Gesetze auch für die rheinischen Departements Geltung; die unmittelbar danach einsetzende massenhafte Veräußerung der früheren Kammer-Güter und geistlichen Besitzungen dauerte bis 1814 an. Meistens brachten Gesellschaften von Groß-Kapitalisten die zur Versteigerung ausgeschriebenen Besitzungen des Adels und der Kirche an sich; zerstückelten sie; verkauften sie in kleinen Stücken; und gaben so vielen bäuerlichen Familien Gelegenheit, Grundeigentum zu erwerben. Und die dritte Quelle der damaligen Zufriedenheit: es tat dem Bürger und dem Bauer wohl, wenn der barsche Amtmann von einst sie höflich als seinesgleichen begrüßte; sie waren jetzt nicht mehr Untertanen, sie waren citoyens. Kurze Zeit nach der Befreiung vom »fremdländischen« Joch, das heißt: nach dem Sturz Napoleons, berichtete ein Koblenzer Regierungsmann dem deutschen Staatskanzler: »Kein Mensch ist mehr hier, der nicht Gott auf den Knien danken würde, wenn das Land wieder unter französischer Botmäßigkeit stände.«
Zufriedenheit und Schmeichelei verschmolzen zur Vergötterung Napoleons – die der Düsseldorfer Junge Heinrich Heine zeit seines Lebens praktizierte. Daß Napoleon »den Ruhm Solons und Lykurgs mit dem Cäsars und Alexanders vereinigt« habe, war unter all den vielen, süß stilisierten Ansprachen und Adressen an Napoleon und seine Stellvertreter noch das wahrste Lob. Es gab viel Übleres. Da führte man in Düsseldorf am fünfzehnten August 1806, zur Feier des St. Napoleon-Tages, einen Prolog auf dem bergischen Nationaltheater vor. Die Szene: eine ländliche Gegend. Festlich geschmückte Landleute bringen einen mit Bändern und Kränzen verzierten Lorbeerbaum. Ein Greis hält eine schwungvolle Lobrede auf Napoleon. Feierliche Musik ertönt. Minerva steigt aus den Wolken auf die Erde herab; die Landleute weichen ehrfurchtsvoll zurück und knien nieder. Minerva preist Napoleon: als größten Sohn der Zeiten, als Liebling der Götter, als Schirm und Stolz der Menschheit. Die Göttin schwebt wieder auf zu den Wolken. Unter den Klängen einer sanften Harmonie verwandelt sich die Szene in den strahlenden Tempel des Nachruhms. Napoleons Brustbild, in kolossaler Ausführung, ruht auf den Schultern der Europa, die ihren Arm über die alte Erdhälfte streckt. Über dem Bild leuchtet ein Stern in einem lorbeernumkränzten Oval.
Das Regiment dieses Lieblings der Götter, dieses Schirms und Stolzes der Menschheit, war nicht eitel Freude. Heinrich Heine zeichnete ein halbes Jahrhundert später die geographische Farce: »Damals hatten die Franzosen alle Grenzen verrückt, alle Tage wurden die Länder neu illuminiert; die sonst blau gewesen, wurden plötzlich grün, manche wurden sogar blutrot, die bestimmten Lehrbuch-Seelen wurden so sehr vertauscht und vermischt, daß kein Teufel sie mehr erkennen konnte, die Landesprodukte änderten sich ebenfalls, Cichorien und Runkelrüben wuchsen jetzt, wo sonst nur Hasen und hinterherlaufende Landjunker zu sehen waren, auch die Völker-Charaktere der Völker änderten sich, die Deutschen wurden gelenkig, die Franzosen machten keine Komplimente mehr, die Engländer warfen das Geld nicht mehr zum Fenster hinaus, und die Venezianer waren nicht schlau genug, unter den Fürsten gab es viel Avancement, die alten Könige bekamen neue Uniformen, neue Königtümer wurden gebacken und hatten Absatz wie frische Semmeln, manche Potentaten hingegen wurden von Haus und Hof gejagt, und mußten auf andere Art ihr Brot zu verdienen suchen.«
Es ist nicht alles Vernunft, was das Gegebene zerstört. Neben der Rücksichtslosigkeit der Vernunft gibt es noch die Rücksichtslosigkeit der gewalttätigen Willkür. Napoleons Herrschaft war nicht nur Vernunft-Diktatur, auch die Tyrannis eines selbstsüchtigen Individuums. Diese Tyrannis entstammte seinem Majestäts-Wahn: seine Gesetzgebung aus dem Geist der Égalité wurde durchkreuzt von seiner Dynastie-Eitelkeit. Die Neigung zum Legitimismus beherrschte plötzlich alle seine Äußerungen; und nahm Formen an, deren sich die ältesten europäischen Potentaten nicht hätten zu schämen brauchen. 1806 ließ er auch in den rheinischen Departements den ›Katechismus zum Gebrauche in allen Kirchen‹ des französischen Kaiserreichs einführen. Die siebente Lektion dieses Katechismus behandelte das vierte Gebot, das in folgenden Reim gebracht war: »Die Eltern ehre alle Zeit hoch, damit Du lange lebest noch.« Der Kommentar zu diesem Gebot begann mit der Frage: Welche Pflichten müssen wir insbesondere gegen Napoleon I., unseren Kaiser, erfüllen? Antwort: Die Christen sind den Fürsten, von denen sie regiert werden, und wir besonders Napoleon I., unserem Kaiser, Liebe, Ehrfurcht, Gehorsam, Treue, Kriegsdienste und die zur Erhaltung und Verteidigung des Reiches und seines Thrones eingeführten Auflagen schuldig. An einer anderen Stelle hatten die Kinder zu antworten: Gott hat unseren Kaiser unter den allertraurigsten Umständen erweckt, um die öffentliche Ausübung der heiligen Religion unserer Väter wiederherzustellen und der Beschützer derselben zu sein. Der Kaiser hat uns die öffentliche Ordnung wiedergegeben und dieselbe durch seine tiefe und tätige Weisheit erhalten; er verteidigt den Staat durch seinen mächtigen Arm; er ist der Gesalbte des Herrn dadurch geworden, daß er vom Oberpriester, dem Oberhaupte der allgemeinen Kirche, eingeweiht ist. Gott hat unserm Kaiser große Gaben, sowohl im Frieden wie im Kriege, verliehen, ihn zu unserem Herrscher, zum Diener seiner Macht und zu seinem Ebenbilde auf Erden gemacht. Unseren Kaiser ehren und ihm dienen ist folglich soviel, als Gott selbst ehren und ihm dienen; diejenigen, welche ihre Pflicht gegen den Kaiser aus den Augen setzen, würden der von Gott selbst eingeführten Ordnung widerstreben und sich der ewigen Verdammnis schuldig machen …
Rief hier der anonyme Exekutor einer Idee, der Idee ›Mensch gleich Mensch‹, nur deshalb den Herrgott vor den Augen des Volkes auf seine Seite, um mit der stärksten Hilfe diese Idee zu propagieren? Dienten die Maßnahmen gegen das Schrifttum, die strenge Überwachung der Vervielfältigung und Verbreitung von Schriften jeder Art, dem Schutz seiner Idee? Der Inhalt, den Napoleon Europa gab, war zuerst die Religion: bürgerliche Égalité; und dann die Religion: Dynastie Napoleon. Beide Religionen oktroyierte er Europa mit der gleichen Rücksichtslosigkeit auf. »Was kommt es auf die Meinung von Bauern an bei politischen Fragen?« schrieb er an Murat; »die Meinung der Bevölkerung bedeutet absolut nichts.« Er war zuerst Vernunft-Diktator – und dann Despot.
So wurden die Lasten, die sein Regiment brachte, nicht mehr aufgewogen von einem sinnvollen Wozu. Diese Lasten häuften sich – nicht nur im bergischen Land: wo die französische Aushebung, die drückenden Steuern, die Einführung der Salz- und Tabak-Regie, die strenge Handhabung der gegen England gerichteten Kontinental-Sperre (durch welche die bergische Industrie eine wichtige Absatz-Quelle verlor) viel Unzufriedenheit schuf. Und mit dem Despotismus wuchs der salbungsvolle Ton der Napoleoniden. Als Murat, Großherzog von Berg, 1808 zum König von Neapel avancierte und Napoleons Neffe, der fünfjährige Louis Napoleon, sein Nachfolger wurde (unter der Vormundschaft des Kaisers Napoleon), verabschiedete sich Murat genau wie irgendein Karl Theodor: »Ihr waret unsere Kinder, und unsere väterlichen Gesinnungen gegen euch werden nie aufhören! Nur der Gedanke an die großen Vorteile, welche ihr von dem Genie und der Macht des Gebieters über euer Schicksal, der gewohnt ist, über alle ihm unterworfenen Völker Wohltaten und Ruhm zu verbreiten, zu erwarten habt, kann das schmerzhafte Gefühl lindern, mit dem wir von euch scheiden.« Die Düsseldorfer Zeitung beantwortete diesen imitierten Patriarchalismus mit kindlicher Dankbarkeit: »Da die Einwohner des Großherzogtums einmal einen Fürsten verlieren sollten, den sie liebten, so konnte ihnen nichts Rühmlicheres und Glücklicheres begegnen, als unter des Kaisers von Frankreich Botmäßigkeit zurückzukehren.« Was war hier noch gegen früher geändert?! Als Wesel mit Frankreich vereinigt wurde – sorgte man für Volksbelustigungen, für Musik und Tanz und Illumination der Stadt. Die Untertanen des Großherzogtums wurden für den Verlust von Wesel reichlich entschädigt: Murats Tochter, die unmündige Prinzessin Lätitia, nahm die Abtei Elten in Besitz. »Welches Glück«, schrieb später ein Historiker, »die Tochter des Landesherrn künftighin als Äbtissin von Elten zu sehen.« Mit diesem Glück und der Schlacht bei Leipzig endete das erste Gastspiel der Égalité im Deutschland der französisch-revolutionär-kaiserlich-patriarchalischen Napoleoniden.
Die großen geschichtlichen Ereignisse – Schlachten, Revolutionen, neue Institutionen – geben den Jahrzehnten ihre Namen; aber wenn man von diesen Etiketts die Inhalte der Zeit ablesen wollte (etwa von der Einführung des Code Napoléon in Deutschland die gesellschaftliche Atmosphäre dieser Zeit), würde man sehr falsche Vorstellungen gewinnen. Denn die großen geschichtlichen Ereignisse wirken sich meist erst viele Jahre nach ihrem ersten Erscheinen an der Oberfläche aus, so daß sie für lange einer fremden Zeit zu Unrecht ihren Namen geben. Wer die Antwort der geistigen Repräsentanten Deutschlands auf die Französische Revolution hört, die Stimmen Klopstocks, Herders, Kants, Schillers, Fichtes, wer die französischen Revolutions-Gesetze mit den Siegen der französischen Revolutions-Armeen eindringen sieht: der wird das Deutschland im ersten Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts für ein revolutionäres Land halten. »In Wahrheit aber«, schrieb der Geschichtsschreiber Clemens Theodor Perthes, »war in Deutschland auch nach der Revolution nur das Denken und Reflektieren, nicht die Gesinnung revolutionär.« Aber die Gesinnung entscheidet, nicht das Denken; denn erst in der Gesinnung wird das Denken Wirklichkeit, Quelle von Handlungen. Deutschland ist das klassische Land des Zwiespalts von Denken und Gesinnung. So war Kants Denken skeptisch, seine Gesinnung optimistisch. So war der Fichte der ›Reden an die deutsche Nation‹ in seinem Denken Erbe der Französischen Revolution, in seiner Gesinnung ein Vorläufer des Nationalismus. Goethe, dessen Denken sich nie mit seiner Gesinnung entzweite, schrieb deshalb Deutschland repräsentativer auf als die Kant und Fichte: »Die französische Nation ist eine Nation der Extreme; in nichts kennt sie Maß. Mit einer ungeheuren intellektuellen und physischen Kraft ausgestattet, könnte sie die Welt heben, wenn sie den Mittelpunkt zu finden verstände; sie scheint es aber nicht zu wissen, daß man, um große Gewichte zu heben, ihren Mittelpunkt auffinden muß. Es ist das die einzige Nation in der Welt, in deren Geschichte wir das Gemetzel der St. Bartholomäusnacht und das Fest der Vernunft finden; die Willkür Ludwig XIV. und die Zügellosigkeit der Sansculotten; fast in demselben Jahre die Einnahme Moskaus und die Übergabe von Paris …«
Die Französische Revolution hatte in Deutschland nur hier und da am Rhein gezündet – zum Beispiel in Mainz, wo Georg Forster in der »Gesellschaft der Freunde der Freiheit und Gleichheit« an eine Verschmelzung der romanischen und deutschen Franken gedacht, einen »Freistaat« gegründet hatte. Selbst das literarische Eintreten Deutschlands für die Französische Revolution hörte auf, als in Paris der Radikalismus siegte. Wie wenig die Gesinnung in Deutschland durch die Invasion der französischen Ideen geändert war, zeigte sich unverkennbar, als die Epoche Napoleons nach seiner Niederlage bei Waterloo vom deutschen Körper wieder heruntergekratzt wurde wie ein bißchen Schorf. Neun Jahre nach dem Sturz des Kaisers sprach man in Berlin, wie Heine berichtete, vom Code Napoléon als den »Fesseln der französischen Tyrannei«, als »dem schlechten Gesetzbuch, das nicht mal erlaubt, der Magd eine Maulschelle zu geben«. Zwei Jahrzehnte Zwangs-Kurse in Égalité hatten in Deutschland nicht mehr gesät als ein paar aufrührerische Konventikel, die zwischen Wiener Kongreß und Juli-Revolution ihre kompromittiertesten Mitglieder verstecken, zwischen Juli-Revolution und Achtundvierzig außer Landes schicken mußten.
Zu Düsseldorf am Rheine
Heinrich Heines Kindheit ist nicht mehr gegenwärtig zu machen.
Sein späteres Leben rankte sich auf an Ereignissen und Ideen – es war ein ewiges Reagieren auf diese Ereignisse, diese Ideen. Und da seine Antworten zum guten Teil in der Helle des Bewußtseins sich vollzogen und sich abbildeten in Briefen und Gesprächen, in Handlungen und Werken – läßt sich sein waches Dasein zurückrufen. Seine Kindheit ist uns nur aufgehoben in wenigen Anekdoten, die zweifelhaft sind, die auch nicht viel sagen, wenn man sie nicht preßt; und in Figuren, die zwar auf diese Jugend wirkten, sie aber doch nicht spiegeln.
Sie – der Vater, die Mutter, die Onkels, die Lehrer, die Freunde –, gewissermaßen die wesentlichen Menschen-Wände, innerhalb deren das Kind gelebt hat, müssen die Geschichte der frühen Jahre ersetzen, die nicht viel sichtbare Spuren hinterlassen haben … außerhalb seines Werks.
In Düsseldorf, Bolkerstraße zehn, wohnte am Ende des achtzehnten Jahrhunderts ein Mann namens Samson Heine, Sohn eines Kaufmanns aus Hannover. In Hannover und Altona war Samson kaufmännisch einexerziert worden. Dann hatte er im Gefolge des Prinzen Ernst von Cumberland einen Feldzug in Flandern und Brabant als Proviantmeister mitgemacht. Um die Dreißig kam er durch eine Empfehlung in das van Geldernsche Haus nach Düsseldorf. Er heiratete Betty van Geldern und machte mit ihrem Geld einen kleinen Tuch- und Manufakturwaren-Laden auf, in dem er vor allem Manchester führte. Er kaufte diesen Stoff in England und verkaufte ihn an die Handelsjuden der Umgebung. Auch hatte er Tuchlieferungen für die französische Armee.
Ein Porträt zeigt den achtzehnjährigen Samson: scharlachrote Uniform, das Haupt kreideweiß gepudert und von einem Haarbeutel weich unterstrichen, unter einem rosigen Gesicht eine weiße Halsbinde. Das Gesicht »einer Zeit, die eben keinen Charakter besaß«. Ein echtes Rokoko-Gesicht: zierlich, kokett, süßlich; mehr Pastell als Fleisch, mehr Duft als Umriß, mehr ein Statist in Watteau-Idyllen als ein Mensch. Samson Heine wurde ein schöner und stattlicher Mann mit weichem, goldblondem Haar, das immer gepudert war; mit einer blendendweißen, gutgeformten, noblen, von Mandelkleie zarten Hand; mit einer männlich-volltönenden, doch kindlichen Stimme; und mit gewinnenden Umgangsformen. Er war eine feminine Schönheit: ihr Reiz lag nicht in rassigen Konturen, sondern im üppig-weichen Schmelz.
Samson Heine war kein Mann der Tat und kein Mann des Worts, das Stellung nimmt; er war zurückhaltend und einsilbig. Sein Handeln war ein Spielen, seine Geschäfte waren kindliche Geschäftigkeiten. So war er in sein Manchester vernarrt: die Ware war ihm nicht ein Tauschwert, sondern ein Endwert; das Manchester war seine »Puppe«. »Eine grenzenlose Lebenslust füllte ihn aus«: das Leben war ihm ein Medium des Genießens; er genoß ohne raffinierte Zwischenschaltungen, unmittelbar, mit Selbstverständlichkeit. Er war immer heiter, immer bereit, neuen Freuden sich zu öffnen; »in seinem Gemüt war beständig Kirmes«. Er hatte ein »glückliches Temperament«: das fraglose Vertrauen, das unbekümmert gibt und unbekümmert nimmt; das wohlige Sicheinkuscheln in Wolken von Sympathie, ohne jede kritelnde Skepsis, wieweit die Sympathien der Mitmenschen echt sind oder aus welchen trüben Quellen sie fließen.
Samson hatte neben seinem Manchester noch viele andere Passionen: Karten und Schauspielerinnen, Pferde und Hunde und das Soldaten-Spiel. Als die Bürger-Garden in Düsseldorf errichtet wurden, ergötzte sich der Offizier Samson Heine an der dunkelblauen Uniform mit den himmelblauen Sammetaufschlägen und an dem Federbusch auf dem dreieckigen Hut; er freute sich wie ein Kind, wenn er an der Spitze seiner Kolonnen vor seinem Haus vorbeidefilieren und zu seiner Frau hinaufsalutieren konnte. Hatte er als kommandierender Offizier der Hauptwache die Sorge für die Sicherheit der Stadt, so sorgte er in erster Linie für Rüdesheimer und Aßmannshäuser. Samson Heine liebte das Militär: als klingende Wachtparade, als klirrendes Wehrgehenke, als straff anliegende Uniform.
Dieser unschuldige Genießer trug sich sehr würdig, ohne ein Tartuffe zu sein. Ruhe und Strenge lagen auf seinem Gesicht, prägten seine Haltung und seine Gebärden – und wurden freundlich belebt von einem Lächeln. Dies »Lächeln, das manchmal um seine Lippen spielte, und mit der oben erwähnten Gravität gar drollig-anmutig kontrastierte, war der süße Widerschein seiner Seelengüte«. Woher aber die würdigen Züge? Das weltnaschende Kind, voll lächelnder Herzlichkeit für seine Mitmenschen, war ein seriöser Familienvater. Er verbot seinen Kindern jeden musikalischen Unterricht, weil er ihn für »Zeitverlust und luxuriösen Tand« hielt; merkwürdige Worte im Munde dieses großen Verspielten. Im allgemeinen war er auch den Kindern gegenüber tolerant bis zur diplomatischen Grenze. Er hielt nichts von der Philosophie, sah in ihr einen Aberglauben und hatte die Ansicht: ein Kaufmann brauche seinen Kopf fürs Geschäft. Als man ihm die irreligiösen Spötteleien seines Sohnes Harry überbrachte, forderte er nur, daß Harry seinen Atheismus für sich behalte – die Kunden brauchten nicht zu erfahren, daß sein Sohn Gottesleugner sei.
Dies Leben, angelegt auf einen ewigen Sonntag, war doch nicht temperamentvoll, nicht überströmend genug, um die eintönige Abfolge der Alltage in überschäumender Lebenslust zu sprengen. Es kamen strenge Falten in die Rosa-Haut. Er war ein besorgter Epikureer. Die englische Philosophie seiner Zeit lehrte die Einheit von Gutsein, Genießen und Glückseligkeit. Samson Heine hatte dies genießende Gutsein – das der unerbittliche Kant, Vorbote einer zwiespältigeren Zeit, nicht mehr anerkannte. Samson Heine war gut aus Genuß am Gutsein, nicht aus Pflicht. Er bezahlte gern für dies Gutsein; in vollen Zügen atmete er dann den Weihrauch, den ihm dankbare Mitmenschen spendeten; zum Beispiel als dem charmantesten Armenpfleger. Da saß er an manchem dunklen Wintermorgen vor einem mächtigen Tisch, auf dem Geldtüten aller Größen lagen, und legte oft zur kleinen Tüte der Armenkasse noch eine größere Tüte aus der eigenen Tasche. Bevor seine Armen kamen, wechselte er die silbernen Leuchter mit Wachskerzen gegen zwei kupferne Leuchter mit Talglichtern aus; er besaß jene Höflichkeit des Herzens, die nur der Moral-Enthusiast besitzt, die der kategorische Pflicht-Imperativ nicht kennt.
Man hielt ihn für einfältig, weil seine Seele nicht viele Falten hatte: er war nur ein Mann, vor dessen vertrauensvoller Naivität sich das Leben teilte, als er hindurchging. Er bestand nicht aus Vordergrund und Hintergründen; aus Worten, die Gedanken verbergen, und aus Gedanken, die Worte vorschieben; er war ohne Bruch. So kindlich fragte der Vater des berühmt werdenden Poeten: »Wie soll mein Junge aufkommen, wenn man immer und immer von Goethe spricht?« So einfach war dieses erwachsene Kind zu behandeln, daß man Goethes Namen mit dem Namen »Ernst Schulze« überkleben mußte, um ihm die Peinlichkeit zu ersparen, dauernd Goethes Namen im eigenen Hause sehen zu müssen. Ohne Argwohn zu sein ist den meisten Menschen fast so, wie ohne Verstand zu sein. Samson Heine war ohne Argwohn: nicht weil er beschränkt war, sondern weil er aus einer kindlichen, unverwundbaren Sympathie heraus nur Güte kannte.
In einer Handelskrise verlor er viel Geld, ging Anfang der zwanziger Jahre nach Lüneburg, lebte hier in bescheidenen Verhältnissen und starb Ende 1828 in Hamburg. Heinrich Heine bekannte: »er war von allen Menschen derjenige, den ich am meisten auf dieser Erde geliebt«. Vielleicht hat der melancholische Lebensgenießer Heinrich Heine im glücklicheren Vater das Paradies einer zufriedenen Kreatur geliebt.
War Samson die Heiterkeit, die Grazie, die umfriedete Lebensbejahung des achtzehnten Jahrhunderts, so war Betty dieses Jahrhunderts praktische Vernunft, optimistische Aktivität. Die kleine, anmutige, lebhafte Frau war Ende zwanzig, als Samson sie heiratete. Sie stammte aus einer jüdischen Arzt-Familie, die seit Generationen wohlhabend und angesehen war und zur geistigen Elite gehörte. Sie sprach Englisch und Französisch, las Latein, war begeistert für Rousseaus ›Emile‹ und Goethes ›Elegien‹ und spielte Flöte. Eine mit Bildung überfütterte, empfindsame junge Dame? Betty Heine war eine selbständige, selbstbewußte, zielsichere Natur. Von den zwölf Hunden, mit denen Samson nach Düsseldorf kam, nahm sie ihm elf; aus dem für Schauspielerinnen und Uniformen Passionierten machte sie einen braven Kaufmann in Manchester. Betty regierte. Sie räumte die Hindernisse aus dem Wege, die der Rabbiner von Düsseldorf der Niederlassung des mittellosen Heine entgegensetzte. War sein Lebenselement Genuß, Hingabe an das Dasein, so war ihr Lebenselement souveränes Handeln, selbständige Gestaltung des Daseins mit Hilfe der eingeborenen Vernunft.
Mit vierundzwanzig schrieb sie an eine Freundin: »Nur der Schwache muß sich auf das große, dennoch aber schwankende Rohr Etikette, stützen. Obgleich ich mit einem alltäglichen Gesicht und Figur auch einen alltäglichen Geist verbinde, so fühle ich dennoch die Kraft, mich über die Chimären Vorurteile, Konvenienz und Etikette hinauszuschwingen und nur den Wohlanstand als die einzige Grenzlinie zu betrachten, um mich alsdann freiwillig unter den Schutz der Religion und Tugend zu begeben.« Hier funkelt schon etwas von dem uneitlen Stolz auf die unabhängige Moral, die in Kant triumphiert hatte. Gesetzgeber zu sein und zugleich nach dem Gesetz zu handeln, Herr zu sein und zugleich der Idee zu dienen, unabhängig zu sein und zugleich sich einzuordnen in die Ordnung der Welt-Vernunft, nur ein Durchschnittsmensch zu sein und zugleich ein Vorbild: dieser demütige Stolz, die reinste Frucht des achtzehnten Jahrhunderts, war auch im Dasein dieser Betty Heine. Eines Daseins, das noch nicht gefährdet war von den Zweifeln und Verzweiflungen der folgenden Generation. »Gewisser Leute ihr Glück und Unglück hängt weit mehr an ihren Empfindungen als an deren Bewegungsgründen«, schrieb sie mit einer Verstandeskühle, vor der diese ›Empfindungen‹ wohl kaum zählten.
Die Mutter hatte ihre vier Kinder gut in Räson. Sie hatte eine kräftige Hand und feste Erziehungs-Prinzipien; »das Erziehungswesen war ihr Steckenpferd.« Die Kinder wuchsen auf unter festumrissenen Gesetzen. So lautete eins: wenn ihr irgendwo eingeladen seid, dürft ihr nicht alles aufessen, was auf euren Tellern liegt. Diesen Pflicht-Rest nannte man in der Familie Heine den »Respekt«. An einem Sommertage tranken die Heines Kaffee außerhalb der Stadt. Als sie den Garten verließen, nahm der siebenjährige Maximilian heimlich das letzte große Stück aus der Dose. Harry, der Älteste, war über die Verletzung des Heineschen Kodex, den er vielleicht mit dem Glauben energisch erzogener Kinder für ein Weltgesetz hielt, tief erschrocken: »Mama, denke Dir, Max hat den ›Respekt‹ aufgegessen.« Die Gesetze der Mutter waren in Kraft.
Betty Heine nahm teil an den politischen Ereignissen der Zeit. In ihrer Korrespondenz mit einer Freundin gedenkt sie wehmütig der Zeiten, »wo Deutschland noch Deutschland war, und wo alles, was deutsch sprach, Brüder waren«. Sie las die Schriften deutscher Patrioten und wies ihre Söhne immer wieder hin auf die traurigen politischen Zustände. Über das Deutschland der Kleinstaaterei war sie hinaus. »Versprecht mir«, mahnte sie die Söhne, »nie in einem kleinen Staate Eure Heimat zu suchen, wählt große Städte in großen Staaten, aber behaltet ein deutsches Herz für das deutsche Volk!« Sie spielte die entscheidende Rolle in den Jahren Heinrich Heines, in denen nach dem Lauf der Natur die Umgebung mehr zu bestimmen hat als der unmündige Mensch. Für Harry hatte sie »hochfliegende Pläne«. Zuerst flogen diese Pläne auf zur Sonne Napoleon; die »Pracht des Kaiserreiches« lockte ihn. Die Tochter eines Eisenfabrikanten der Gegend, mit der sie befreundet war, wurde Herzogin, wurde Gattin des französischen Marschall Soult. Der Herzog gewann Schlachten und stand schon vor dem Avancement zum König, da träumte Frau Betty Heine von Harrys goldenen Epauletten. Aber sie war zu nüchtern, zu sehr auf Resultate eingestellt, als daß sich ihre Wünsche in flatternden Phantasien verflüchtigten. Sie setzte ihre Hoffnungen in Handlungen um. Sie ließ dem Jungen Privatstunden in Geometrie, Statik, Hydro-Statik, Hydraulik geben – in allen Wissenschaften, die ihn vorbereiten konnten, »ein großer Strategiker oder nötigenfalls der Administrator von eroberten Provinzen zu werden«. Als der Stern Napoleons erlosch, erlosch auch dies Berufsideal. Und es ging ein neuer Stern auf, der nun – nach ihrem Willen – Leitstern für die Karriere des Sohnes werden sollte: Bankier Rothschild. Napoleon oder Rothschild – Betty Heine war nicht belastet mit Sentiments oder Vorurteilen. Sie war eine im praktischen Leben stehende Frau mit einem sicheren Blick für irdische Chancen. Ihr religiöser Glaube war – gemäß ihrer »vorwaltenden Vernunftrichtung« – ein »strenger Deismus«: am Anfang aller Dinge ist Gott, und er hat alles gut gemacht; und wenn wir unsere Kräfte nach unserer Vernunft auswirken, tun wir, was Gott will. Ein Glaube, der nicht zu Gott führt, aber zu Leistungen.
Vor der Poesie hatte sie Angst. Sie riß Harry jeden Roman aus den Händen und verbot ihm den Besuch des Schauspiels, die Teilnahme an Volksspielen. Sie schalt die Mägde aus, die Gespenstergeschichten erzählten. »Nicht von ihr erbte ich den Sinn für das Phantastische und die Romantik«, schrieb später der Sohn. Sie lebte nicht im Dämmer; sie lebte von Ziel zu Ziel. Deshalb fabelte sie nicht Märchen, sondern verkaufte Halsband und Ohrringe, um Harry das Universitäts-Studium zu erleichtern.
In dem engen, niedrig gebauten, einstöckigen Haus Bolkerstraße zehn, in dem Samson Heine sich etabliert hatte, wurde sein Ältester, Harry, geboren. Die Ungewißheit über sein Geburtsjahr hat Heinrich Heine mitverschuldet. Er nannte sich scherzweise »einen der ersten Männer des Jahrhunderts«, da er in der Neujahrsnacht 1800 geboren sei. Dies Datum ist offenbar um der Pointe willen erfunden. Sichere Zeugnisse über seinen Geburtstag fehlen, da ein Feuer alle Familien-Papiere vernichtete. Einige wichtige, scharfsinnig eroberte Argumente sprechen für den dreizehnten Dezember 1797. Heines eigenes Zeugnis, sowie das Zeugnis seiner Schwester Charlotte, geben an, er sei laut Taufschein am dreizehnten Dezember 1799 geboren. Aus diesem Widerspruch hilft ein echter Heine-Satz heraus: »La chose la plus importante, c’est que je suis né«; Hauptsache, ich bin da. Er wurde also geboren und einem Liverpooler Geschäftsfreund des Vaters zu Ehren Harry genannt. Erst später, bei seinem Übertritt zum Christentum, nahm er den Namen Heinrich an.
In dem Häuschen Bolkerstraße zehn naschte Harry Trauben; wurde Harry zur Strafe in den Hühnerwinkel gesperrt, wo er durch sein Krähen das Geflügel der Nachbarhöfe in Aufruhr brachte; lernte Harry die Buchstaben, welche die Mutter mit Kreide auf die braune Tür schrieb. In diesem Häuschen spielten Harry und die Schwester Charlotte, sein Liebling, morgens miteinander, wenn die andern noch schliefen; sie suchten Reime.
Der Knabe Harry war sehr empfindlich: lautes Sprechen, Klavierspiel, jeder Lärm schmerzte ihn. Obwohl Charlotte ein klangvolles, sympathisches Organ hatte, bat er sie immer wieder: »Liebes Lottchen, schrei nicht so laut.« Unter den Mitschülern nahm er den ersten Platz ein; er war wild, ausgelassen, frühreif, den Kameraden überlegen. Er faßte leicht auf, arbeitete schnell und gab zeitig Proben seines Talents. Zum Beispiel damals, als er für die Schwester, die einen Schulaufsatz brauchte, eine Geschichte schrieb von einem Gespenst mit glühenden Augen, einem Pferdefuß und einem feuerspeienden Rachen, der so groß war, daß er alles verschlang. Die Arbeit machte Furore unter den Lehrern Charlottes.
In der ABC-Schule der Frau Hindermanns war er der einzige Bub unter einem Dutzend Mädchen. Vor den Kindern saß auf einem Lehnstuhl, Brille auf der Nase, die Frau Hindermanns, wackelte mit dem Kopf hin und her und schlug die Kleinen mit einer Birkenrute braun und blau. Gegen Frau Hindermanns schoß Harry seine erste Polemik ab; er leerte ihre Schnupftabaksdose und füllte sie mit Sand. »Warum hast Du dies getan?« »Weil ich Dich hasse …« Motto für alle seine Polemiken! Nach wenigen Jahren Privatschule kam er 1807 mit neun in die unterste Klasse des Düsseldorfer Lyzeums, das von den Franzosen in den Räumen des ehemaligen Franziskanerklosters errichtet war. Da saß er in der dumpf-katholischen Klosterschule den ganzen langen Vormittag auf der hölzernen Bank, mußte Latein, Geographie und Prügel ausstehen – und jauchzte unbändig, wenn die alte Franziskanerglocke zwölf schlug, die Stunde der Befreiung. Die Glocke war franziskanisch, aber was sie einläutete und abläutete waren die Exerzierübungen des Geistes à la Napoleon. Die Schulen hatten einst geistlichen Orden gehört, vor allem den Jesuiten. Als 1773 der Jesuiten-Orden aufgelöst worden war, kamen sie unter die Führung der Kongregationisten und Franziskaner. Dreißig Jahre später wurden die Klöster entmachtet; die Schulen gingen aus Mangel an Vermögen ein. Die Franzosen bauten sie nach dem Modell der französischen Anstalten wieder auf; ohne Rücksicht auf die Verschiedenheiten der Sprache, der Sitte und der Bildung – wie es das kaiserliche Edikt von 1808 ausdrücklich bestimmte. Der Kaiser wollte, daß die Lehrer aller höheren und niederen Schulen, von der Nordsee bis zum Mittelmeer, einen einzigen Lehrkörper bildeten, unter dem Präsidium eines dem Minister des Innern verantwortlichen Großmeisters. Dieser Mann hieß Fontanes. Fontanes entschied: wer angestellt, befördert, abgesetzt werden sollte. Die Politik regelte die Erziehung. Unterrichtssprache und Lehrbücher, selbst die Lehrbücher der Geometrie, mußten französisch sein. Lehrer, die nur deutsch verstanden, wurden entlassen; fast ein Drittel des Stundenplans gehörte der französischen Grammatik und Literatur. Die französische Kultur rangierte über allen Kulturen. Fontanes stellte Racine und Corneille über die griechischen und römischen Schriftsteller; das Empire über Athen und Rom; Napoleon über Alexander und Cäsar. Vor allem die Lyzeen waren klösterlich-militärisch organisiert; am stärksten spürten dies die Internen. Während des Essens wurde vorgelesen; Briefe bekamen die Zöglinge nur durch den censeur, Taschengeld nur durch den proviseur. Die Schüler waren in Kompanien eingeteilt, welche Sergeanten unterstanden. Sie marschierten bei den gemeinsamen Ausgängen in Reih und Glied, unter Führung des censeur und des Exerziermeisters. Die Schüleruniform bestand aus einem grauen Rock mit rotem Soldatenkragen und dem großen Bonaparte-Hut. Mit Trommelschlag begann der Unterricht, mit Trommelschlag hörte er auf. Die deutschen Lehrer waren nicht sehr gebildet: sie wurden weder gut bezahlt noch geschätzt; in den meisten Anstalten unterrichteten frühere Ordensgeistliche, die keine andere Chance hatten.
Im Düsseldorfer Lyzeum, das Harry Heine besuchte, unterrichteten viele katholische Priester, unter ihnen einige Jesuiten. Rektor Schallmeyer stand an der Spitze des Lehrer-Kollegiums; er gehörte zu jenen souveränen Geistlichen, die in frühen Jahren Heines spätere Stellung zum Katholizismus entscheidend bestimmten: »Ich habe eigentlich immer eine Vorliebe für den Kaholizismus gehabt, die aus meiner Jugend herstammt und mir durch die Liebenswürdigkeit katholischer Geistlicher eingeflößt ist.« Nicht von Jugend auf war ihm der Katholizismus fortschrittsfeindlich. Von Jugend auf waren ihm die katholischen Riten nah durch das tägliche Leben. Das Haus, das die Heines bezogen, als sie Harrys Geburtshaus aufgaben, mußte bei den Prozessionen einen Altar errichten. Samson Heine setzte seinen Stolz darein, diesen Altar so kostbar wie möglich zu machen; und der junge Harry wirkte freudig mit. Sein erster, lange nachwirkender Eindruck von der katholischen Kirche war nicht die ecclesiamilitans, die kämpfende Kirche, sondern die ecclesia ornans, die schmückende – und die katholische Humanität. Denn der Rektor Schallmeyer, der neben dem deutschen Sprachunterricht noch philosophische Stunden für die oberste Klasse gab, erörterte hier ohne Scheu die radikalsten griechischen Philosophien; ohne Rücksicht auf die Dogmen, die er als Priester im Ornat vom Altar zu verkünden hatte. So war Heine von Jugend auf gewöhnt, »Freisinnigkeit und Katholizismus vereint zu sehen«; ein Eindruck, der noch seine schlimmsten Erfahrungen überleben sollte. Der freisinnige Schallmeyer sprach mit Harrys Mutter über die Zukunft des Jungen; und bevor Napoleon, bevor Rothschild als Stern am Himmel seiner Karriere auftauchte, sah der Knabe – vielleicht nur für Sekunden, vielleicht nur in spielerischer Phantasie – seinen Weg unter einem andern Licht: Rom, katholisches Theologen-Seminar; Protégé von Prälaten höchsten Ranges, den Freunden Schallmeyers. Die verstandesklare Betty hatte für den Papst weniger Neigung als für Napoleon und für Rothschild. Und Harry gab schon in jungen Jahren auf die Frage: wie heißt der Glaube auf französisch? die echte Rothschild-Antwort: »le crédit!«
Und wurde doch kein Rothschild. Schon die Freunde seiner Jugend, die er in sein Leben verwob, die schon etwas die Art des Jungen verraten, deuten nicht auf einen zukünftigen Rothschild hin, eher auf einen zukünftigen Poeten. Da war der Sohn des wucherischen Kornhändlers, ein käsiger, frühreifer Jüngling; schüchtern, Misanthrop, mit zu Haus überworfen wegen seines exaltierten Radikalismus. Er aß nicht am väterlichen Tisch; haßte seinen jüngeren Bruder, der sich unter väterlicher Anleitung zum wackeren Geschäftsmann entwickelt hatte; und trieb sich einsam in den Alleen des Düsseldorfer Hofgartens herum – in der einen Tasche ein Stück Brot und einen Hering, in der anderen philosophische Schriften. Nach der einen Tasche nannte man ihn den »Herings-Philosophen«, nach der anderen den »Atheisten«. Harry kam mit diesem Herings-Atheisten nur heimlich zusammen; auch im Heineschen Haus sah man den unheimlichen Burschen nicht gern. Die Jungen lasen Spinoza und zeitgenössische rationalistische Schriften. Was hatte Harry an diesem Freund? Vielleicht eine verwandte Natur. Denn die »Zusammenmischung von Galle, Zerknirschung, Exaltationen und einigen guten Anlagen zu einem Marquis Posa«, die er später als Formel für die Art dieses Freundes fand – war sie nicht auch die Formel für die eigene Mixtur?
Und neben dem galligen Posa das schauerromantische Sefchen. Sie war, falls die Dichtung die Wahrheit nicht überrankt, die Nichte eines Scharfrichters. Harry hatte ihre Tante, die »Hexe von Goch«, durch seine alte, runzligbraune Wärterin Zippel kennengelernt. Die »Hexe« erzählte den Kindern geheimnisvolle Volkssagen, sang ihnen grausige Totenlieder vor, verkaufte den Bierwirten die Totenfinger von unschuldig Gehenkten, durch die dann das Bier wohlschmeckender wurde, sich vermehrte – und gab an Verliebte Liebestränke ab. Die hochaufgeschossene, schlanke, enghüftige Josepha war kaum sechzehn. In ihrem edelgeschnittenen, weißen Gesicht lagen zwei große, tiefdunkle Augen und breit unten der Mund mit schmalen, hoch aufgeschürzten Lippen und kreideweißen, länglichen Zähnen. Ihr rotes Haar hing lockig-lang bis auf die Schultern herab; sie konnte es unter dem Kinn zusammenbinden. Das rote Sefchen, deren klanglos-verschleierte Stimme in der Leidenschaft metallreich wurde, kannte viele alte Volkslieder, die sie ihm vorsang; sie war sein Erlebnis lebender Romantik vor dem Einfluß der Literatur. Die düster-grausamen »Traumbilder« seiner ersten Dichtung tragen die Farben Josephas. Sie schrieb ihm alte Strophen auf, die er bewahren wollte. Menschenscheu, zog sie sich vor allen Fremden ängstlich zurück, träumte nur von Tieren und wehrte sich störrisch, patzig, heftig, eigensinnig gegen die Außenwelt. Ihre Außenwelt war eine Innenwelt: die gehenkten Diebe, welche die ihnen von den Scharfrichtern gestohlenen Finger in kalten Winternächten wieder zurückholten oder Laken aus den Schränken entwendeten. Wenn der Scharfrichter eine große Hinrichtung vorhatte, kamen die Henker der Gegend ins Freihaus zum großen Schmaus: man sprach wenig und sang gar nicht. Auf den Henkern lastete der Fluch ihres Sonderseins innerhalb der Gesellschaft: man mied sie; in den Wirtshäusern reichte man ihnen nur eine Kanne mit hölzernem Deckel, während die andern Gäste aus Kannen mit zinnernen tranken. Hier und dort zerbrach man das Glas, aus dem der Henker getrunken hatte. Er gehörte nicht zur Gemeinschaft; deshalb heirateten die Familien der Gemiedenen nur untereinander. Sie waren eine Welt für sich.
Diese beiden Freundschaften, mit dem Atheisten und Josepha, beeinflußten wohl stärker Harrys Leben als die von der Mutter empfohlenen Reisebeschreibungen und Bücher der Länder- und Völkerkunde; stärker als das ganze Pensum der guten Erziehung: als der Violin-, Tanz- und Zeichen-Unterricht. Harry gehörte nicht zu den Jungen, die alle Bildungs-Stoffe wahllos in sich hineinfressen, alle Kultivierungs-Attacken ergeben in Talentchen umsetzen. So sträubte er sich gegen die Violine. Als er ein Jahr Musik-Unterricht hatte, ging die Mutter einmal zur Unterrichtszeit im Garten spazieren. Befriedigt hörte sie das Spiel. Sie wollte Lehrer und Schüler ihre Anerkennung aussprechen: da lag der Sohn bequem hingestreckt auf dem Diwan; der Lehrer spielte zur Unterhaltung des Schülers. Auf diese Weise hatten beide ein Jahr Violin-Unterricht herumgebracht. »Schade, daß Du mich störst«, rief Harry der verblüfften Mutter zu, »die Töne der Musik kamen meiner Idee zu Hilfe und ich war eben im Begriff, ein schönes Lied zu dichten.« Noch weniger wußte Harry mit dem kleinen, dürren, groben Tanzlehrer anzufangen, der ihn mit Schritten quälte, die seine Füße nicht gehen wollten. Die Spannung zwischen Lehrer und Schüler wurde immer größer, bis der gereizte Junge den leichten Tanzmeister aus dem Fenster warf. Der fiel weich auf einen Misthaufen; und die Eltern des rabiaten Zöglings hatten das Schmerzensgeld zu zahlen.
Mit neun hatte Harry von der Düsseldorfer Statue des Kurfürsten Jan Wilhelm herab den Einzug Murats angesehen. Fünf Jahre später war er vierzehn, es war das Jahr 1811, wenige Monate vor dem Rußland-Krieg: da sah er ihn selbst, den Napoleon, die »Weltseele« Hegels. »Wie ward mir, als ich ihn selber sah, mit hochbegnadigten eigenen Augen, ihn selber, Hosiannah, den Kaiser. Es war in der Allee des Hofgartens zu Düsseldorf. Als ich mich durch das gaffende Volk drängte, dachte ich an seine Taten und Schlachten, mein Herz schlug den Generalmarsch – und dennoch dachte ich zu gleicher Zeit an die Polizei-Verordnung, daß man bei fünf Taler Strafe nicht mitten durch die Allee reiten dürfe. Und der Kaiser ritt ruhig mitten durch die Allee, kein Polizeidiener widersetzte sich ihm; hinter ihm, stolz auf schnaubenden Rossen und belastet mit Gold und Geschmeide, ritt sein Gefolge, die Trommeln wirbelten, die Trompeten erklangen, und das Volk rief tausendstimmig: es lebe der Kaiser!« Diese tausend Stimmen vergaß Heine nie – ein unvergängliches Gedicht, die ›Grenadiere‹, war ein Echo dieser tausend Stimmen. Diesen Kaiser von 1811, noch erhöht durch die Phantasie eines enthusiastischen Vierzehnjährigen, vergaß Heine nie: immer sah er ihn »hoch zu Roß, mit den ewigen Augen in dem marmornen Imperator-Gesicht, schicksalsruhig hinabblickend auf die vorbeidefilierenden Garden«. Der Zauber wich sein ganzes Leben nicht; nur der unhistorisch denkende, seelenblinde Historiker Treitschke konnte in dieser großen Liebe eines großen Dichters ekelhafte »Bedienten-Gesinnung« sehen – Symptom seines Antisemitismus, da er die Napoleon-Verehrung der Hegel, Goethe, Wieland geflissentlich ignorierte.
Überall wurde ausgehoben für den russischen Zug. Die Fabriken standen still aus Mangel an Arbeitskräften. Der Landbau wurde von Frauen besorgt. Der Handel litt unter dem Druck der Kontinental-Sperre. Den Staatsgläubigern wurden nicht einmal die Zinsen ihrer Schuldforderungen ausbezahlt. Und alle Übel hatten den einen Herd: Napoleon. Dann kam die Kunde von dem russischen Débâcle. Schon im Januar Dreizehn rebellierten die Rekruten von Solingen und Barmen; vom bergischen Lancier-Regimente desertierte der größte Teil. Anfang November verließ Beugnot, Napoleons Statthalter, Düsseldorf. Mitte November wurde die Stadt von einer Abteilung russischer Dragoner besetzt. Endkampf: Leipzig; Elba; Wiener Kongreß; Waterloo; St. Helena. Napoleon war nur noch ein gefangener Löwe … Wir wissen nicht, was er zur Zeit der Befreiungskriege für Harry war. Als der Kaiser noch einmal zurückkam, zu hunderttägiger Herrschaft, meldeten sich sämtliche Schüler der obersten Klasse des Düsseldorfer Lyzeums freiwillig. Auch Harry Heine! Aus Solidarität? Unter dem Druck einer Massen-Psychose? Aus nationaler Begeisterung? Ehe Harry eingezogen wurde, war Napoleon schon wieder im Käfig. Harry trat ins Leben, in den nachnapoleonischen Alltag; und ein sächsisches Blatt feierte den Kaiser a.D. als die Schutzwehr der Verfassung, als einen geschworenen Feind des Feudalsystems, als kräftigen Erzieher der Nation zum Widerstande gegen mutwilligen Druck und abgenutzte Vorurteile.
Wir wissen nicht, welche Stern-Konstellation bei der Geburt Heinrich Heines war; und wenn wir es wüßten, würden wir keine Schlüsse ziehen – die Sterne sind schweigsam. Die Politik ist ein Stern bescheidener Größe, etwas Berechenbares. Das politische Horoskop hat das Sternen-Horoskop abgelöst. Schon zu Beginn der Lebensbahn Harry Heines erkennen wir die Verflechtung der Weltgeschichte mit dem Schicksal des Einzelnen: im Berufs-Ideal. Das war bis 1813: möglichst nahe der Sonne des Kaisers. Das war, als diese Sonne ins Meer gefallen war: das Gold; und der Repräsentant des Goldes: der Bankier. Die Rothschilds waren en vogue. Eine neue Sonne war aufgegangen: die Köpfe der jungen Pflanzen wendeten sich ihr zu. Heine wurde nicht mehr mit den Nährstoffen der Geometrie und Hydraulik gedüngt, sondern mit Englisch, Geographie, Buchführung – mit all den Kenntnissen, die Handel und Gewerbe brauchen.
In der Familie Heine gab es schon einen Rothschild en miniature, den Bruder Samsons, den Hamburger Millionär Salomon, »vor dem alle Senatoren den Hut« zogen. Salomon wurde Harry als Ideal vorgehalten. Bevor er mit diesem Meister in Berührung kam, schickte man ihn in die Vahrenkampsche Handelsschule. 1815 nahm ihn der Vater auf die Frankfurter Messe mit, wo er, oberhalb der Zeil, Wachsfiguren, wilde Tiere, außerordentliche Kunst- und Naturwerke bewundern konnte. Auch lernte er die großen christlichen und jüdischen Magazine und den Römer kennen. Der Vater fuhr ab, Harry blieb zurück. Im Kontor eines Bankiers seines Vaters, des Herrn Rindskopf, sollte er als Volontär etwas vom Geschäft lernen; er blieb drei Wochen und kapierte, wie man Wechsel ausstellt. Dann studierte er vier Wochen in den Gewölben eines Spezereihändlers das Kolonialwarengeschäft; zum Beispiel, wie Muskatnüsse aussehen. Der berühmte Kaufmann, bei dem er »ein apprenti millionnaire« werden sollte, meinte, Harry hätte kein Talent zum Erwerb. Kein Talent, nicht etwa keinen Willen; denn Heinrich Heine ist nie ein Verächter irdischer Güter gewesen. »Gott weiß, ich wäre gern Bankier geworden, es war zuweilen mein Lieblingswunsch gewesen, ich konnte es aber nicht dazu bringen. Ich habe früh eingesehen, daß den Bankiers einmal die Weltherrschaft anheimfalle.« Nach zwei Monaten, in denen er Traumbilder statt Rechnungen geschrieben hatte, war Harry wieder in Düsseldorf, ein »ungeratener Junge«. Sein erster Ausflug in den Ernst des Lebens war mißglückt.
Harry hatte drei Onkels, die sein Leben beeinflußten: die beiden Simon van Geldern hatten den Knaben beeinflußt; Onkel Salomon beeinflußte nicht nur das Leben des angehenden Bankiers. Onkel Simon van Geldern – klein, behäbig, streng – war Privatgelehrter in Düsseldorf. Der altmodische, ritterliche Sonderling trug kurze Beinkleider, ein unscheinbares Röckchen mit Bachstelzenschwanz, weißseidene Strümpfe, Schnallenschuhe und – nach der alten Mode – einen ziemlich langen Zopf, der ihm beim Gehen von einer Schulter auf die andere flog. Harry zog oft an diesem Zopf wie an einer Hausklingel. Onkel Simon hatte im Kolleg der Jesuiten studiert, dann auf jedes Brotstudium verzichtet und sich im Haus seiner Eltern, über dessen Tür die Arche Noah in kolorierter Plastik zu sehen war, eingenistet. Er wurde ein Bücherwurm und schrieb für Zeitschriften, die unter Ausschluß der Öffentlichkeit erschienen. Schrieb im alten, steifen Kanzleistil und war nicht zufrieden mit der tändelnden, unseriösen Art des Neffen. Ihn hatte er mit der Atmosphäre von Büchern umgeben; oben in der Dachstube der Arche Noah, wie das Haus nach seinem Front-Schmuck hieß, durfte der Knabe die Kisten und Kästen, welche Bücher und alte Schriften des seligen Großvaters enthielten, nach Herzenslust durchwühlen. In dieser von Staub, Spinngewebe und altem Gerümpel angefüllten Kammer herrschte eine dicke Angorakatze über der Wiege und der mit einem verblichenen Rosaband verzierten Flöte seiner Mutter; über der vermoderten Staatsperücke und dem verrosteten Galanteriedegen des Großvaters; über dem ausgestopften, federlosen, aschgrauen, einäugigen Papagei der seligen Großmutter; über einer einarmigen Feuerzange; über dem großen grünen, inwendig hohlen, am Hintern lädierten porzellanenen Mops; über Weltkugeln, Planetbildern, Kolben und Retorten. Unter den Büchern hatte der Junge neben vielen medizinischen Schwarten geheimwissenschaftliche und philosophische Literatur aufgestöbert: Descartes und Paracelsus und Agrippa von Nettesheim.
In diesen Kisten hatte er auch das Notizbuch des Bruders seines Großvaters gefunden, ein mit arabischen, syrischen, koptischen Buchstaben durchsetztes Heft des berühmten »Chevaliers«, des »Morgenländers«. Dieser Großoheim Simon van Geldern, ein Glücksritter und Schwärmer des achtzehnten Jahrhunderts, war in den Küstenstädten Nordafrikas Waffenschmied gewesen; hatte nach Jerusalem eine Wallfahrt gemacht; und war schließlich von einem unabhängigen Beduinenstamm der nordafrikanischen Sandwüste, einem Schrecken der Karawanen, zum Scheik erkoren worden. Dann hatte er verschiedene Höfe besucht und überall durch Schönheit, orientalische Pracht und Geheimwissen geglänzt. Ein Liebesabenteuer mit einer sehr vornehmen Dame zwang ihn zur Flucht und setzte wohl seiner Karriere ein Ende. In London ließ er ein Oratorium in französischen Versen ›Moses auf dem Horeb‹ drucken, das der Großneffe Harry einmal zufällig auf irgendeinem obersten Regal der Düsseldorfer Bibliothek entdeckte. Zu Hause hatten sich dann um den in orientalischer Tracht gekleideten, Pferdezucht-kundigen, in Reiterkünsten bewanderten genialen Scharlatan Legenden gebildet. Dieser tote Simon van Geldern beschäftigte noch lebhafter als der lebende die Phantasie des Jungen.
Die beiden van Geldern nährten seine Träume, der Onkel Salomon Heine aus Hamburg nährte seinen Leib und seine Einsicht in den Alltag. Der Bruder des Vaters, Salomon, siebzehnjährig von zu Hause mit ein paar Ledersohlen und sechzehn Groschen losgezogen, jetzt Mitinhaber der Firma Heckscher & Co. in Hamburg, ein tüchtiger und anständiger Mann, einer der angesehensten Bürger der Stadt, war dank seiner Millionen ein rechter Pascha, gewohnt zu regieren. Die würdigen Senatoren Hamburgs, in Ehrerbietung vor dem Aus-eigener-Kraft zogen tief den Hut vor dem »großen Heine«. In seinem Hause verkehrten die ersten Männer der Stadt und die berühmtesten Gäste. 1816 traf Harry auf einem Fest, das der Onkel gab, den Feldherrn Blücher.
Harry war nach Absolvierung des Frankfurter Ausflugs in der Hamburger Firma des Bankiers tätig. Zwei Jahre später gab ihm der Onkel die Mittel zu einem eigenen Geschäft, dem Kommissionsgeschäft in englischen Manufakturwaren »Harry Heine & Co«. Im Frühjahr Neunzehn war der junge Kaufmann Harry pleite. Der Onkel war nun bereit, den »dummen Jungen« drei Jahre Jura studieren zu lassen; er sollte den Doktorgrad erwerben und sich in Hamburg als Anwalt niederlassen. Als es dann später anders kam, als er Anwalt in einem sehr andern Sinn wurde, sagte der Bankier: »Hätte der dumme Junge was gelernt, so brauchte er nicht zu schreiben Bücher.« Der fünfundzwanzigjährige Heine aber sagte vom Onkel: »Das Beste an ihm ist, daß er meinen Namen trägt.«
Junge Leiden
D