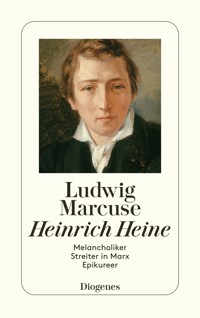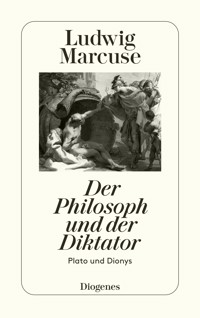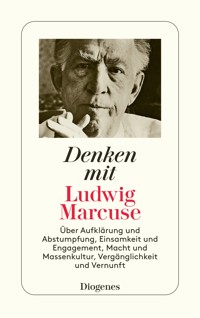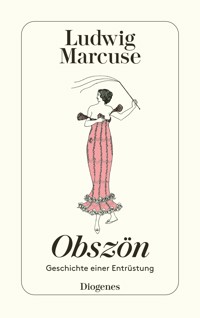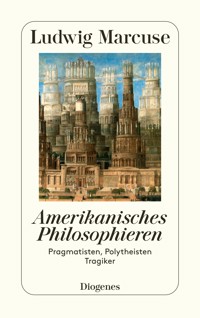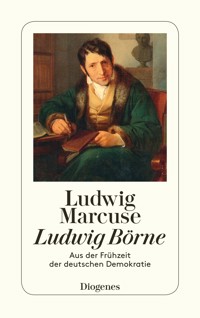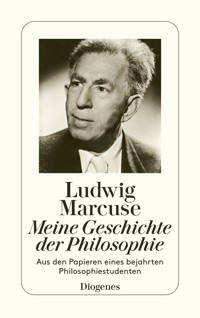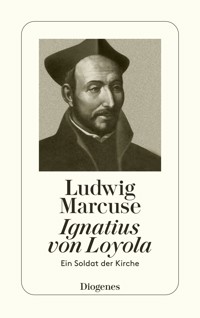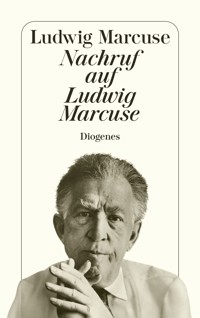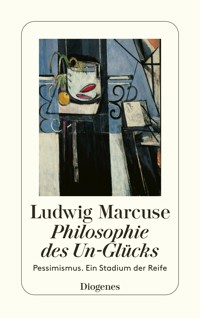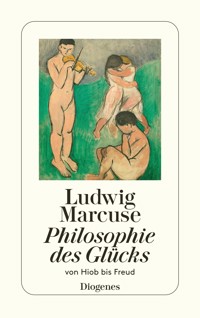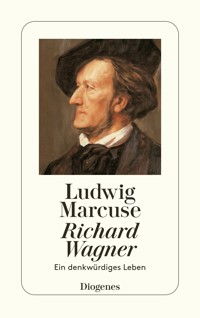12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»In seiner Autobiographie ›Mein 20. Jahrhundert‹ berichtet er über Begegnungen mit Zunftkollegen und Freunden, erinnert er sich an die Tage in Sanary, Paris, New York und Los Angeles. Schicksalsgefährten wie Bruno Frank, Joseph Roth, Ernst Bloch, Alfred Döblin oder Julius Meyer-Gröfe werden in wenigen Zeilen lebendig.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 649
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Ludwig Marcuse
Mein zwanzigstes Jahrhundert
Auf dem Weg zu einer Autobiographie
Diogenes
»Jeder schreibt seine eigene
Geschichte der Weltereignisse.«
Henry Miller
ERSTES KAPITEL
»Das Auge des Geistes fängt erst an,
scharf zu sehen, wenn das leibliche
von seiner Schärfe schon verlieren will.«
Symposion
Das Koordinaten-System
Die Hilfs-Konstruktion, die ich hier hinzeichne, um aus der Fülle meiner undurchschaubaren Vergangenheiten eine Schau zu gestalten, besteht aus drei Zeiten und drei Räumen.
Was meine Lebenszeit betrifft, so war ich im neunzehnten Jahrhundert ein Kind, bis zum Ersten Weltkrieg ein Jüngling, zwischen den Kriegen ein Mann. Seit einem Vierteljahrhundert wird mehr und mehr Druck auf mich ausgeübt, weise zu werden; denn das ist die Forderung an die Alten. Das Alter aber beginnt früher, als man im Zeitalter der ebenso jugendlichen wie lächerlichen Urgroßmütter wahrhaben will. Und unser Altern begann besonders früh. Als Gustav Freytag im Jahre 1886 Erinnerungen aus seinem Leben aufschrieb, aus den Jahren zwischen dem deutschen Freiheitskrieg und dem Ende der Regierung Wilhelms I., bemerkte er, daß hier ›etwas von dem fröhlichen Wirken einer aufsteigenden Volkskraft erkennbar‹ sei. In unserem Leben verfiel sie mehr und mehr.
Die zweite Zeit, für mich bis zu diesem Tage Gegenwart, ist das Neunzehnte Jahrhundert – soweit es mit der Frühromantik begann und in Nietzsche seinen Gipfel erreichte; soweit es aussah wie Heine, Kierkegaard, Flaubert, Jakob Burckhardt; soweit es nicht aussah wie Queen Victoria, Treitschke, Bismarck und Marx (den ich nur tief bewundere). Novalis und Leopardi sind mehr meine Zeitgenossen als die kindlichen Philosophen Albert Schweitzer und Albert Einstein, die ich von ganzem Herzen verehre.
Was vor der europäischen Romantik liegt (und wieviel Heutiges liegt weit davor), ist für mich vergangen – von Goethe zurück bis zu Hamurabi; Historie, oft mächtig angestaunt, oft sogar geliebt. Ich habe meine Freude an Epikur und Horaz und dem jungen Augustin und dem christlichen Epikuräer Malebranche und an ›Candide‹, Mozart, Kants Briefen und Fichtes lutherischem Zuschlagen … aber sie sind nicht meinesgleichen, wie der junge Friedrich Schlegel und Chopin und Strindberg. Ich glaube, daß meine Zeit um 1800 begonnen hat; obwohl vordem schon einer hier und da mir aus der Seele sprach: zum Beispiel Hiob in seinen deutlichen Worten gegen die Guten Freunde und den Guten Gott, deren Güte ihm nicht recht plausibel wurde. Meine erste Zeit umspannt also bisher nur 66 Jahre, meine zweite etwa 150; die dritte geht vielleicht bis zu Adam zurück … auf jeden Fall so weit, wie von Vätern und Väters-Vätern, von Lehrern und Lehrers-Lehrern noch etwas in mir rumort.
Der weiteste Raum meines Lebens (für die Sterne habe ich mich immer nur poetisch interessiert) ist Deutschland; nichts wurde dadurch geändert, daß ich – seit einem Vierteljahrhundert – dort nicht mehr lebe. Ein engerer Raum ist das deutsche Bürgertum; nichts wurde dadurch geändert, daß es das nicht mehr gibt – im Sinne meiner Jugend. Der engste Raum ist meine arme Freiheit. Ich war mein Leben lang (mit zwei unbedeutenden Ausnahmen) ›freier‹ (das heißt: auch schlecht bezahlter) Schriftsteller, ›freier‹ (das heißt: parteiloser) Bürger, ›freier‹ Denker (das heißt auch: nie Freidenker): ein Mensch also, der immer so frei war, sich ohne Gewissensbisse zu widersprechen, von keiner Weltanschauung beschützt und deshalb tausend Anfälligkeiten ausgesetzt zu sein. Von 1925–1929 war ich allerdings Theaterkritiker; da ich aber immer terrorisierte, weil ich nie finassieren konnte, rettete ich so etwas Freiheit in mein Angestelltsein. Und von 1945 bis 1959 war ich beamteter, das heißt: unkündbarer Professor. Aber meine Freiheit wurde nie beschädigt von meinem Beamtentum.
In beiden Fällen war es nicht mein Verdienst, sondern mein großes Glück, daß ich kein Knecht zu werden brauchte.
Mein alter Vater und mein junger Kaiser
Mein Vater war ein armer Junge, der sich mit Zähigkeit und strengster Selbstzucht zwischen 1871 und 1914 hochgearbeitet hatte. Er wurde vermögend – was sein Leben nicht änderte, aber meins bestimmte.
Ich habe die beiden großen Briefe der großen Söhne Novalis und Kafka gelesen. Ich habe im Licht meiner Erfahrungen den Konflikt zwischen dem Vater Anton und seinem Sohn (in Hebbels ›Maria Magdalena‹) sehr gründlich erwogen. Ich habe auch den Ödipus-Komplex im Sinn, der viel mehr ist als Konkurrenz-Neid. Am ehesten ist mein Verhältnis zu meinem Vater ausgesprochen in dem Sätzchen des Jahres 1783: »So freundschaftlich und warm Du bist, so eine hinreißende Güte Du oft äußerst, so hast Du doch auch sehr viel Augenblicke, wo man sich Dir nur mit schüchterner Furchtsamkeit nähern kann.«
Ich weiß nicht, weshalb der alte Graf von Hardenberg so unnahbar war. Ein bißchen mehr weiß ich von der Kluft zwischen meinem Vater und mir. Er war schon über Fünfundvierzig, als ich, der Erstgeborene, recht schwächlich zur Welt kam. Ich erinnere mich nur noch an die Zeit, da er bereits bejahrt war. Er ist hager und grau und immer sorgenvoll und sehr jähzornig und hält sich ganz gerade. Er lacht nicht, schmunzelt selten und hustet bemitleidenswert – geplagt von einem chronischen Bronchial-Katarrh, an dem Ems und Reichenhall nichts ändern konnten. Er weint viel und nie laut. Er war nicht zum Genießen geschaffen; ich sollte sagen: es war bei ihm nie dazu gekommen, die frühen Pflichten hatten es gar nicht erst zugelassen. Man kann zu alt werden, um es noch zu lernen. Mein Vater lernte das Genießen nicht. Er vergaß keine Sekunde, wie viele Familien von ihm abhingen: vom Patriarchen und vom Fabrik-Herrn. Er war nie schlechter gelaunt als in den Ferien, wenn er, vom gewohnten Joch des Planen-müssens befreit, die schreckliche Freiheit hatte, vom Sich-Sorgen-machen nicht abgelenkt zu werden.
Er war ein ergebener Sohn, Bruder, Mann, Vater und Chef. Die Familie war sein Glaubensbekenntnis. Auch die Angestellten, vor allem die Lehrlinge seiner Fabrik, waren zwangsweise zur Familie eingezogen; er fühlte sich verpflichtet zu ihrem Schutz und deshalb zur Aufrechterhaltung der von ihm für selbstverständlich gehaltenen Ordnung. Er war von schroffer Güte und ein ebenso wohlwollender wie strenger Herr; er hätte es für pflichtvergessen gehalten, nicht so unerbittlich zu regieren. Die schwerste Strafe, die er verhängte, war ein Schimpfwort seiner ostpreußischen Heimat: ›Lorbaß‹. Er war auf sehr barsche Weise ein großer Wohltäter und gab unfreundlich, weil er keinen Dank wollte.
Er trank gern Pilsner, aß gern Eisbein, rauchte gern Zigarren und spielte gern Skat; er konnte das alles auch lassen. Zuweilen ging er in die Oper und ins Theater; ich glaube nicht, daß es Eindruck auf ihn machte. Ich kann mich nicht erinnern, daß er las – aber woher stammte die stattliche Bibliothek, die ich erbte, mit den Cotta-Klassikern und allen Bänden von Spielhagen? Bestimmt las er das ›Berliner Tageblatt‹. Zuerst sah er die Kurse nach, interessierte sich auch für Innenpolitik, ganz und gar nicht fürs Feuilleton. Er war ein Liberaler, besser: ein Freisinniger, Mitglied des lokalen Hansa-Vereins.
Er war der unprätentiöseste Mensch. In dem Gästebuch eines Schweizer Hotels fand er die Eintragung ›Fabrik-Direktor‹. Das belustigte ihn sehr, weil das doch kein Beruf sei. Ich bin ›Kaufmann‹, schärfte er uns ein. So unwilhelminisch war er in wilhelminischer Zeit. Ich aber trug die Farben meines jungen Kaisers, nicht meines alten Vaters. Ich wurde höchst unsolide. Seine Haare waren ordentlich gebürstet. Ich sah schon in der Jugend wie Einstein aus.
Wir haben wenig miteinander gesprochen und viel um einander gezittert: er war überbesorgt, wenn ich wieder einmal eine Mandelentzündung hatte; ich verging vor Angst, wenn er eine Viertelstunde später nach Hause kam und meine immer verängstigte Phantasie sich ausmalte, daß er von einem Pferde-Omnibus überfahren sei. Aber wir waren nie miteinander in freiem Austausch. Er war zu griesgrämig, ich zu verschlossen – auch für mich. Er war kein Kamerad, sondern unnahbar, fremd – aber nur deshalb, weil ich mich ihm nicht nahte, was er so innig wünschte. Es ist schwerer für einen König als für einen Untertanen, den ersten Schritt zu machen; aber mir ist es noch heute schwer, auf jemand zuzugehen … vor allem auf einen König.
Darin ähnele ich meinem Vater, in meiner Schwerfälligkeit im Umgang. Ebenso wie im Mangel an Lebensmut, an leichtem Sinn. Auch in der spröden Zurückhaltung im Nettsein, aus Angst vor der Verwechslung von Entgegenkommen und Liebedienerei. Und dann noch im Eigensinn und Jähzorn, der in unserer Familie offenbar erblich war. Wenn er die Zeitung schon entfaltet auf seinem Tisch vorfand, sprach er eine Woche nicht. Meine Schwestern waren imstande, ihn schnell zurückzugewinnen. Ich beantwortete Schweigen mit Schweigen. Es war mein Stummsein, das ihm das Leben verbitterte. Es war der Stolz auf mich, der sein Leben beglänzte. Worauf war er eigentlich stolz? War es die alte jüdische Ehrfurcht vor dem ›Klären‹ – und sah er in mir, der immer las, solch einen Klärer, Grübler und Schriftgelehrten voraus? Ganz gewiß ahnte er nicht, daß das Buch ebensosehr ein Versteck sein kann wie ein Himmel – und ich habe den Verdacht, daß ich mich jahrelang hinter Büchern verschanzte; es war die Höhle, in die man, innerhalb des gutbürgerlichen Spielzimmers, entweichen konnte.
Ich ähnele ihm gar nicht in jenem felsenfesten Pflichtgefühl, das ihn beherrschte. Im Gegensatz zu ihm bin ich, seit ich mich von seiner Gesetzgebung losmachte, ein Anbeter des Genießens, ein Feind alles Spartanischen – obwohl mir so viele Gaben fehlen, so lebenslustig zu sein, wie ich gern möchte. Nie habe ich die distanz-setzende Macht, die in mir ohne mein Einverständnis wirkt, überwunden. Nie habe ich das Sichhingeben gelernt. Ich bin leider nur ein recht armer Anbeter der Freude geworden. Wo ich mich als Epikuräer gab, war es Größenwahn.
Auch vor meiner Mutter war ich scheu. Sie war fast zwanzig Jahre jünger als der Mann, mit dem sie in sehr solider Ehe lebte. Sie stammte aus einer Familie, die dem Leben geneigter war: sie spielte enthusiastisch auf dem Bechstein ›Ja ein Walzer, das ist mein Leben, da liegt, da liegt Musik darin‹ – aber diesen Walzer hat sie wohl nie getanzt, bestimmt nicht zur Zeit meines Daseins. Sie war eine energische kleine Frau, die mich heiß liebte und (nach einer Sitte der Zeit) regelmäßig mit dem Kantschu traktierte. Sie hatte wohl ebenso gründliche Anschauungen wie mein Vater. Als einmal (ich war vielleicht elf) aus meiner Matrosen-Bluse ein Zehnpfennig-Heft fiel, mit dem Titelbild ›Die tolle Lola‹ (sie hatte rote Haare und lag auf einem Diwan, die langen Flechten flössen bis auf den Boden hinab), fiel meine Mutter in eine der echtesten Ohnmächten. Auch das war ein Beweis ihrer Stärke. Sie regierte uns mit ebenso sicherer Hand, wie mein Vater ganz ohne Kantschu und Worte sie regierte. Es kann keine Familie geben, in der man mehr füreinander da war.
Wir wußten, Vater und Mutter werden alles für uns tun, was in ihren enormen Kräften steht; ich aber fühlte, solange ich zurückdenken kann, einen unüberwindlichen Widerstand, mich zu öffnen. Ich wurde maßlos verwöhnt, teils weil ich anfällig war, teils weil man auch in unserer Familie die Vorstellung hatte, die Kinder müßten über die Eltern hinauswachsen … was immer dies Hinaus bedeuten mochte. So verehrte man, trotz aller Strenge, in den Kleinen die künftig Größeren. Ich, der Kronprinz, wurde besonders umsorgt, war tief gerührt und wurde nie zutraulich. Meine Schwestern Henni und Edith, mit den Eltern viel intimer als ich, vermittelten leidenschaftlich und erfolgreich. Ich nahm ihnen alles weg, was für sie bestimmt war: von der Amme bis zur Mademoiselle. Sie aber waren meine großen Gesandten am Hof der Erwachsenen; ich bekam alles und gab nichts. Wenn ich dem heute nachsinne, so kommt mir vor: ich hatte Vater und Mutter sehr lieb … und keine andere Beziehung zu ihnen. Ich sah sie nicht an und lernte sie nicht kennen. Es gibt viele Erklärungen für diesen Stand der Dinge. Ich kann nicht herausfinden, welche von ihnen zutrifft.
Was immer ich in den ersten Zeiten meines Lebens lernte (und ich, ein schlechter Schüler, lernte sehr langsam, sehr wenig), erst in meinem vierten Jahrzehnt begriff ich, was Geld ist … und auch dann noch sehr unvollkommen. Mein Vater hatte es sehr früh erfahren und hielt diese Erfahrung für unanständig. Als Kinder wurden wir aus dem Zimmer geschickt, wenn von Geschäfts-Bilanz und Aktien gesprochen wurde; Mutter hörte wohl bereitwillig zu, aber nur mit halbem Ohr und verstand noch weniger als die Hälfte. Der frühe Schutz vor den rauhen Tatsachen des Lebens bestimmte mein Leben mehr als die Literatur, die sie mir dann deutlich machte: zum Beispiel der große Lehrer Marx. Viele haben ihre Mathematik-Blindheit bekannt. Ich war Ökonomie-blind. Kurszettel und Banken existierten nicht – auch noch nicht, als ich schon erwachsen war. Zwar kannten wir einige Bankiers; doch waren sie nur (zuerst) Onkels und (dann) Freunde der Familie; und erst viel später unfreiwillige Zerstörer unseres Vermögens.
Als ich fast Dreißig war, zur Zeit der großen Inflation, nahm ich, sehr ungern, Geld fast so ernst wie vorher nur Kant und das deutsche Theater. Damals wurde mein erstes Buch-Manuskript von einem Verlag akzeptiert; nichts setzte mich mehr in Erstaunen als der Paragraph, der mir Prozente versprach. Inzwischen habe ich gelernt, daß einer sich wesentlicher manifestiert in seinem Verhältnis zum Geld als in seiner Religion, seiner Soziologie und seiner Stellungnahme zur Atombombe. Mein Vater, Inhaber von Carl Marcuse & Co., machte mit Hüten und Mützen viel Geld; und zog einen Sohn heran, den eine Bibliothek dicht umstellte.
Es gab viele Öffentlichkeiten, als ich 1900 zur Schule kam: meine, meines Vaters und auch die öffentliche Welt des zweiundfünfzigjährigen Hellenisten, des Professors Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff. Er war einer der interessantesten Gratulanten am Geburtstag des neuen Jahrhunderts; die Festrede hielt er in der Aula der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. Sein Abschied vom neunzehnten Jahrhundert begann mit Versen aus dem ›Faust‹ und endete mit Versen aus dem ›Faust‹. Zur feierlichen Erhebung hatte sich der lyrisch gesinnte Gelehrte den Preis auf »die unbeschreiblich hohen Werke« ausgesucht, die herrlich sind »wie am ersten Tag«. Das Fin de siècle ignorierte er absolument. Er hätte auch Schillers Begrüßung des neunzehnten Jahrhunderts deklamieren können, die Dominante war Stolz und Dankbarkeit. Sie bezogen sich nicht nur auf die himmlischen Sphären; auch vom Staaten-Universum und dem Juwel Deutschland im Mittelpunkt wurde viel Rühmens gemacht. Wilamowitz war ein Gelehrter und hatte die Gewohnheiten dieser Art und kam so erst nach und nach zu seinem eigentlichen Thema. Als er aber dort angelangt war, wurde er deutlich und versicherte: daß schon am 16. März 1888 »dem Jahrhundert das Grablied« tönte, da die Glocken »dem Heimgange des ersten deutschen Kaisers auf jedem Kirchturm seines Landes läuteten«. Wer ihn aber fragte, was eigentlich der Tod des sehr lokalen alten Herrn mit dem Jahrhundert zu tun gehabt habe, dem antwortete er hegelsch: »Nur ein Ereignis des führenden Volkes kann den Markstein liefern.« Er hielt also im Jahre 1900 Deutschland für ein führendes Volk und den alten Kaiser für einen Markstein.
Obwohl der schlesische Aristokrat von der »Brüdersphären Wettgesang« ausgegangen war, endete er schließlich doch bei der preußisch-deutschen Krone … oder sollte man nicht eher sagen: bei Bismarck? Jedenfalls verkündete der große Lehrer unserer Gymnasial-Lehrer, der schöne Greis, vor dem ich später noch anbetend saß: »Was immerdar im Gedächtnis der Menschen den Hauptinhalt des Neunzehnten Jahrhunderts bilden wird, das ist freilich die Erhebung Deutschlands zu einer Weltmacht.« Dabei verabscheute er mit großem Nachdruck (wie der größte deutsche Erzieher, Fichte) »die nationalistischen Dünkel«. Er pries, was man der Französischen Revolution verdanke, und der stolze Preuße, der die Tage der Demütigung nicht vergessen hatte, zitierte dennoch den Frankreich-Freund Goethe: »Wie soll ich ein Volk hassen, dem ich soviel von meiner Bildung verdanke.« Pries auch Rußland – wenngleich mit dem verdächtigen Herren-Partizipium: »arische Kultur tragend über die Steppen Turans, aus denen sooft culturmordende Horden westwärts gezogen waren.« Und dann sah er sogar noch nach Amerika bewundernd hinüber. Es war alles eitel Freude … anno 1900, vor allem aber wohl, weil Deutschland unter die Herren-Nationen aufgenommen worden war.
Wilhelm II. war für ihn, auch noch nach zwölf Jahren Regierung, nur »der Enkel«, dem er wohl nur um des Großvaters willen die Treue hielt; gerade die Gelehrten wußten in puncto »Enkel« Bescheid. Auf dem Thron, vor dem Wilamowitz demütig das Knie beugte, war viel mehr das preußische Heer, »die nationale Hochschule«, die er (wie Spengler später) dem Bildungsdünkel einer kleinen Clique entgegensetzte. Die »befreiende allgemeine Bildung des Volkes« (das heißt: der Kommiß) produziere »das Gefühl der Mannesehre«. Von Kadavergehorsam ist hier keine Rede; keine Frage, daß Wilamowitz sich seine Vorstellung vom kaiserlichen Heer nach den gebildetsten und humansten Generalstäblern modelliert hatte.
Er war ein Konservativer, wie er nicht in den Büchern steht – aber im Leben stand. Mit gleicher Liebe umfaßte er den deutschen Soldaten und den energischen deutschen Kaufmann, Borsig und Krupp. Gar nichts hielt er von dem zusammengebrochenen ständischen »Stockwerkstaat«; und gar nichts von einer Kopie der griechischen Demokratie, die nur mit Hilfe einer modernen Sklaven-Wirtschaft wieder ins Leben zu rufen sei. Die sozialistischen Utopien schob der muntere Grandseigneur als eine Sehnsucht von Kindern und Bettlern beiseite. Er verlangte »freie Bewegung« und erklärte, das deutsche Volk habe niemals eine seiner würdigere Vertretung gehabt als in der Paulskirche. So sah ein führender Konservativer um die Jahrhundert-Wende aus.
»Geschwunden ist die Furcht«, jubelte er in dem Jahr, in dem sein Schulkamerad Nietzsche starb, am Ende von Kierkegaards und Flauberts Jahrhundert – »geschwunden ist die Furcht, seit dem Auge der Seele der ewige Kosmos aufgegangen ist, ihrem Ohre vernehmlich geworden die heilige Harmonie.« Wie so oft: nicht die Sehnsucht war falsch, sondern ihre Identifikation mit einer häßlichen Wirklichkeit. Es waren immer die falschen Identifikationen, von denen die schlechten Realitäten gut lebten.
Die Öffentlichkeit des Schülers Ludwig Marcuse waren zwischen 1900 und 1913 vor allem der »Enkel« und seine uniformierten Untertanen. Den Untertan in Anführungsstrichen, den Heinrich Mann später so glänzend dargestellt hat, daß er einen guten Teil meiner Erfahrung lange verdeckte, lernte ich erst durch den Roman kennen. Bis dahin war ich ebenso selbstverständlich ein kaiserlicher Deutscher wie ein Warmblüter. Neben meinem alten Vater thronte mein junger Kaiser, gar nicht sorgenvoll; ein Muster für einen Knaben, von dem man auch hätte sagen können, er möchte am liebsten jeden Tag Geburtstag haben.
Die drei großen Geburtstage des Jahres waren in dieser Reihenfolge: der 27. Januar Wilhelms II.; der 2. September, Sedan, Geburtstag des Deutschen Reichs; und der dritte, der eigene. Wir waren an den beiden glänzendsten schulfreien Tagen keine ›Untertanen‹, sondern Volk, das gierig war nach Pauken und Trompeten und romantischen Kostümen; denn die Uniformen waren das Nicht-Uniformierte, das Festliche – langweilig-uniform war nur der Sakko. Der Kaiser war kein Problem, erst recht nicht zum Lachen. Als ich dreizehn war, sah ich im ›Simplizissimus‹ Bilder, die ich nie verstand und nie vergaß. Ich habe sie mir gestern herausgesucht. Auf der ersten Seite: ein Hinterkopf, aufgestülpt eine Krone – bis über die Ohren. Darunter der Dialog: »O erhabener Kaiser von Byzanz! Deine Krone ist zum Paradies der Ohrenkriecher geworden …« »Laß man gut sein; die lieben Tierchen kitzeln mich so angenehm.« Eine andere erste Seite: der bestirnte Himmel. Darunter: »Das sind die Orden, die dem lieben Gott für seine Verdienste um das Haus Hohenzollern verliehen worden sind.« Das war nicht unser Kaiser. Der war ein Federbusch und ein Hupensignal, das uns elektrisierte. Er wurde von uns weniger geliebt als begeistert angegafft: ein Theater, das so glänzend nie wieder über unsere Szene ging. Die Hochzeit des Kronprinzen, die ich als Elfjähriger von der ersten Etage des vornehmen Hoflieferanten Fabian & Rhiech, Unter den Linden, hingerissen anstaunte, prägte mein Mädchen-Ideal. Das Lächeln dieser Braut wurde mein Himmel. Meine schönsten Träume trugen die Züge Cecilies. So geschah es wohl den Ahnen mit der Königin Luise, die – in einem Gewand aus Marien-blau, ein ätherisches Krönchen über einer blonden Wolke – auch in unserem Salon lieblich anzuschauen war … Als aber zwanzig Jahre nach der Kronprinzen-Hochzeit mein guter Freund Louis Ferdinand mich mit seiner Mutter zusammenbringen wollte, war es schon viel zu spät. Ich sah nicht mehr die Lockung von 1905, eine würdige ›Legitimistin‹ hatte sie zugedeckt.
Schon meine erste Erinnerung an öffentliches (die erste nichtprivate Szene) ist ein Hohenzollern-Bild, das seltsamste meiner Galerie. Gerade eingeschult in die Vorschule von E.B. Krafft (Berlin NW23, Hansa-Viertel), nehme ich teil an der Feier zum Geburtstag des neuen Jahrhunderts; von meinem älteren Zeitgenossen Wilamowitz wußte ich noch nichts. Vor uns hängt eine Karte mit pyramidenförmig aufgeschichteten Köpfen. Ganz oben, die Spitze, Wilhelm II. Unten, im Fundament, Albrecht, der Bär. Ich habe mich nie als Deutscher gefühlt, nie als Preuße, immer nur als Märker. Ich stehe dem Oberst Kottwitz (wie ihn Heinrich von Kleist geschaffen hat) näher als irgendeinem deutschen Patriotismus. Der Große Kurfürst, wie er den alten Oberst an drei Silberhaaren zu dem, was ihm zukommt, zurückführen will – ist mein fürstlicher Stammesgenosse. Meinen brandenburgischen Bruder Fontane hatte ich noch nicht entdeckt; der grelle, laute, erregende Hauptdarsteller jener Tage verdunkelte ihn noch.
Das Schuljahr des Friedrich Werderschen Gymnasiums in Berlin kreiste um den 27. Januar und den 2. September. Da waren die Lehrer nicht so sehr Schulmeister als Reserve-Offiziere … mit einer Autorität, die aus beiden Kasernen kam; erst an diesen festlichsten Tagen des preußischen Kirchenkalenders zeigten sie sich in ihrer wahren Gestalt – und dann schien der Bunte Rock das ganze Jahr gebietend durchs graue Zivil. Daß er auch ein Waffenrock war, bekam man zu fühlen, wenn die Aufsatz-These ›Ubi bene ibi patria‹ freudig bejaht – und der Rekrut-Tertianer Ludwig Marcuse vor versammelter Mannschaft rauh abgekanzelt wurde. Daß es außer dem Patria nichts gab, was wirklich zählte, merkten wir auch, wenn den Schlachten von Gravelotte und Mars-la-Tour und den anderen Scharmützeln auf einem winzigen Fleck der weiten Erde ebensoviel Stunden gewidmet wurden wie den Jahrtausenden zuvor; ach, wir merkten es gar nicht und wurden Provinzler: Patria übertönte die Harmonie der Sphären.
Es trat uns laut und ohrenbetäubend entgegen, wenn der Direktor R. Lange, schlicht ›Rex‹ genannt, die Klassentüre zuknallte – und alles hatte in die Höhe zu spritzen wie ein Mann. Unser lieber Ordinarius, Speyer, der vielleicht heute noch am Leben ist (zwischen 90 und 100; ein Junge aus meiner Klasse, er sprach, als wäre er der Komiker Waßmann persönlich, Heinz Ullstein, der erklärte, der Vorletzte wäre für ihn noch ein Streber, führte mich vor einiger Zeit in Berlin zu ihm, und der uralte Professor Speyer machte den alten Schüler Marcuse sehr glücklich, als er ihn bei seinem Spitznamen ›Marmel‹ anrief) – also: unser blutjunger Oberlehrer Speyer skandierte die ›Odyssee‹, als sei er ein altgriechisches Maschinengewehr. Wir jungen Griechen und Römer (von Havenstein, Kohn, von Dombois, Ullstein, von Gerlach, Marcuse, von Einem, Jackier) waren von märkisch-preußischer Schattierung; und ein bißchen anders als die andern – Kohn, Ullstein, Marcuse und Jackier gehörten nicht zur Hautevolee. Die Antike war unser arroganter Hochmut; unser Vorbild aber war die majestätische Zwergkiefer auf der Höhe. Hellas hat nicht auf Preußen abgefärbt, sondern Preußen auf Hellas – ein Unteroffiziers-Preußen zudem, das illuminiert war von einem ganz unfriderizianischen, ganz unkantischen, stark überfärbten, die Phantasie aufstachelnden, aufreizenden, unvergeßlichen Heldenspieler.
Es gab seit der Renaissance viele Wiedergeburten der Antike: viele sehr verschiedene Gegenwarten im Anschluß an einige Motive der Alten. Was haben die Kapitole zu Washington, Sacramento und Albany zu tun mit der ›Geburt der Tragödie‹ – und sind dennoch gemeinsam verwurzelt in der hellenischen Antike. Wir Berliner Gymnasiasten lernten neun Jahre lang acht Stunden wöchentlich Latein, nicht viel weniger Griechisch, kaum Französisch und ganz und gar nicht Englisch – eine Koofmich-Sprache. Zwar waren unter meinen Mitschülern der Sohn des Finanzministers und der Sohn des Präsidenten der Preußischen Seehandlung. Aber unsere Gespräche drehten sich nie um Anleihen jener balkanisierten Länder, die einst vom Homer und Pindar und Herodot besungen und beschrieben worden waren – und oft um die Griechenland-Reisen unseres Kaisers; und dann noch um die Frühjahrs-Riten in Ilm-Athen. Perikles hatte einen forschen Schnurrbart – und Goethe stellte ich mir immer etwas wie meinen Zahnarzt Kunimund Wegner (Lützowstraße) vor, ein unentwegtes Mitglied der Goethe-Gesellschaft. Er pflegte mir den neuesten Vereins-Band auf die Knie zu legen, bevor er mich anbohrte; der Beitrag ›Klassische Stätten an der Ilm‹ sollte mich anästhetisieren. Bielschowskys himmelblaue Goethe-Biographie (Herzblättchens Dichterfürst und poetischer Casanova), daneben die preußischen Editionen der Mommsen-Schüler, unserer Pauker, die stramm einen Zenturio einen Feldwebel nannten, schufen die innere Welt der humanistischen Pennäler – nachdem wir das Stadium absolviert hatten, wo wir bei Wesenberg in der Friedrichstraße Lindt-Würstchen stibitzt und den Förster an der Löwenbrücke mit Tomahawks in die Flucht geschlagen hatten.
Es war damals, daß ich, perfekter Anführer einer Diebes-Bande in Schokoladen-Geschäften, den Nobel-Preis für Beute-machen bekam. Seitdem ist mir nie wieder eine Auszeichnung, ein Orden, eine Ehrung zuteil geworden. Berühmt aber wurde ich noch dreimal: als ich 1940 von einem Hollywood-Hügel in einem hellgrünen offenen Wagen, mich fünfmal überschlagend, ins Tal stürzte – und doch am Leben blieb; als ich 1948 durch eine dicke Glastür unserer Universität vorwärtsstürmte und mich wunderte, woher der Glasregen kam; und als 1959 der Berg hinter unserem kalifornischen Haus (frei nach Shakespeare) in die gute Stube eindrang und ich gegen die Polizei protestierte, die mich herausrettete …
Viele Erzieher und keine Erziehung in Berlin
Zurück zu 1910: Athen und Weimar, gesehen aus der Perspektive großstädtischer Schuljungens adliger und gut-bürgerlicher Herkunft.
Und dann prägte uns noch eine dritte Gegenwart; E.T.A. Hoffmann, Spitzweg und Jean Paul hatten unsere Lehrer erfunden – abgesehen davon, daß diese außerdem noch kaiserliche Befehlsempfänger waren. Dies Kauzig-Deutsche, Grotesk-Originelle, Eigensinnig-Provinzielle formte uns nicht weniger als ›Des Attischen Reiches Herrlichkeit‹ und der Mythos vom Reich der Dioskuren aus Frankfurt und Marbach. Vielleicht sind einige von uns komische Käuze geworden in Nachahmung der verehrten, hochgebildeten, unvergeßlichen Narren, die uns erzogen. Ihr Kauderwelsch ist immer noch die Geheimsprache, in der ich mich mit Mitschülern von einst lustig verständige. Man müßte ein Meister wie Raabe sein, um jene Wesen, die wirklich existierten, glaubhaft zu machen. Ein Zeichner hätte es schon leichter. Wie sie nur saßen! standen! watschelten! gekleidet waren! grollten! scherzten! Selbst die eindrucksvollsten Figuren der großen Komödie haben für mich nie diese Eindringlichkeit gehabt. Nur Vokabular, Idiomatik und Syntax des ›Professor Unrat‹ hat ihre (verschüttete) Sprache aufbewahrt: ein Gemisch aus schulmeisterlichen Übersetzungen, Kasernen-Reglements, Stammtisch-Witzen und Wilhelminischer Rhetorik. Ich denke mit Sehnsucht zurück an die bunteste Sprache, die je an mein Ohr schlug.
Noch ein viertes wirkungskräftiges Element entdecke ich, wenn ich mir das Friedrich Werdersche Gymnasium im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts zurückrufe: die abstrakt-bürgerliche Moral, die mit Hilfe des deutschen Aufsatzes einexerziert wurde. Zu Hause regierte die mehr oder weniger effektive (mehr oder weniger wohlwollende) Diktatur der Eltern – wenn sie nicht schon abgelöst worden war vom Libertinismus unter der freundlichen Aufsicht, unter der lockenden Weg-Sicht weiblicher Angestellter; Dienstmädchen, Gouvernanten, Mademoiselles waren die großen Erzieherinnen der kleinen Don Juans. In der Schule regierte der Rex, auch der Alte genannt, der Direktor, ein unumschränkter Polizeipräsident mit einer Koppel imposanter Jagdhunde und einem ebenso scharfen Kollegium: eine Art von gebildetem Terror, welcher Schüler und Eltern unter Druck hielt, denn das Ziel der Klasse nicht zu erreichen, war der Weltuntergang. Lehrerschaft und Elternschaft in ›Frühlings Erwachen‹ sind nur milde Abbilder, weil sich hier als Karikatur gibt, was beklemmende Wirklichkeit war. Tausend Broschüren von damals über ›Schülerselbstmorde und das Elternhaus‹ können die Historiker unterrichten.
Die sehr reale Disziplin (oder Anarchie) zu Haus und die ebenso reale Kasernierung in der Klasse wurde ergänzt durch ein Luftigeres – zum Beispiel die Sorge um ›Schuld und Sühne der Jungfrau von Orleans‹. An solchen Themen wurde das Moralische eingebleut, und Schiller (der Held von Hundert-Jahre-Schiller-Feiern) wurde unser Führer ins Gebiet des Wackeren, soweit wir uns verführen ließen; und wir ließen. Im Laufe der Zeit blieben alle schicklichen Goethe- und Schiller-Sentenzen an uns hängen, so daß wir, schön garniert, 1914 dem Leben in den Rachen geworfen werden konnten.
Was das eigentlich war: ›Leben‹, davon hatten wir nicht die geringste Ahnung; denn auch das strengste Elternhaus, der harte Exerzierplatz ›Schule‹ und die herbe Moral des schwäbischen Kantianers waren immer noch Schutzparke. Wir waren noch mit zwanzig – Kinder. Jetzt, ein halbes Jahrhundert später, wundern wir uns über die zehnjährigen Erwachsenen. Und fragen erstaunt: wie kurz kann die Kindheit sein? Unsere war sehr lang.
Von heute gesehen (von den Folgen des Damals her) war auch das Leben unserer liberal-fortschrittlichen, freisinnig-gläubigen Alten Herren nicht der ›Ernst des Lebens‹. Es muß das Jahr 1913 gewesen sein, als Vater mich eines Sonntag-Morgens aufforderte, mit ihm einen Spaziergang um den Neuen See zu machen. Ich war neunzehn; er war fünfundsechzig, schrieb jeden Sonntag in Abschiedsstimmung an seinem Testament und legte nicht nur für meine Mutter, meine beiden jüngeren Schwestern und mich das Leben nach seinem Tode fest; er kümmerte sich auch um die noch ungeborene Generation. Er nahm die Zukunft – als Gegenwart. Drei Jahre vor seinem Tod schrieb er im Abschieds-Brief an meine Mutter: »Bedenke, daß ich ohne langes Leid entschlafen bin.« Er ließ Unerwartetes nicht zu.
Er war ohne Skepsis. »Man tut das«, »man tut das nicht« war die ewige Wendung. 1847 geboren, in der deutschen Welt nach Gründung des Bismarck-Reiches vom blutarmen Jungen zum wohlhabenden Fabrikanten aufgestiegen, nicht so sehr durch Glück als durch einen sagenhaften Fleiß und eine Sparsamkeit, die mit den Jahren immer schrulliger wurde und sich wesentlich auf aufzuknippernde Bindfäden und zu wendende Couverts bezog, nie aber auf die fürstlichen Ausgaben für die Erziehung der Kinder … kam er gar nicht auf den Gedanken, daß Kriege, Revolutionen und Inflationen noch möglich seien; kam auch nicht darauf, daß Fleiß und Sparsamkeit vielleicht noch nicht den Erfolg garantieren.
So richtete er, als wir zur Rousseau-Insel kamen (wir betonten Rousseau in diesem Zusammenhang auf der ersten Silbe) folgende feierliche Worte nüchtern-unpathetisch an mich: »Für deine Mutter, deine Schwestern und dich ist ausreichend gesorgt. Ich hoffe, auch noch für eure Kinder. Du hast es immer abgelehnt, dich in den Stand unseres Vermögens einweihen zu lassen. Es ist auch nach meinem Tod in sicheren Händen. Merke dir: man soll sein Geld verteilen! Eine gute Portion steckt in der Fabrik, ein Teil in Börsenpapieren, in Land, in Häusern … Ich erwarte von dir, daß du ein guter Sohn und Bruder bist. Ich erwarte von dir, daß du sehr fleißig bist und auf dem Gebiet, das du dir aussuchst, etwas Besonderes leistest. Ich hätte dir gern mein Geschäft übergeben; aber du hast dich schon als Kind mit einem Buch in der Hand fotografieren lassen. Ich erwarte von dir die Anspannung aller deiner Kräfte. Geld zu verdienen brauchst du nicht. Für das Geld habe ich gesorgt.«
Er starb 1922 und hinterließ eine Gold-Million. Ein Jahr später war sie kaum noch 10000 Mark. Die Testamentsvollstrecker, sehr ordentliche Bankiers und Industrielle, hatten nicht gewagt, die mündelsicheren Papiere, Preußische Consols, anzutasten. Und ich hatte, mitten in der Inflation, auf Liquidation unseres Anteils am Geschäft, auf Verkauf des Hauses und der besten Aktien gedrungen, weil ich mir unter Bargeld etwas vorstellen konnte, nicht aber unter Geld heckendem Besitz … mit dem Titel ›Stiller Teilhaber‹ und Mieten eintreibender ›Hauswirt‹.
Mein Vater lebte nach jenem Gespräch noch zehn Jahre – wenn auch nicht mehr ganz so sicher, nachdem zu Beginn des Krieges Betrügereien einer Privatbank aufkamen, die Geld von ihm hatte. Ich richtete mich 1913 nach seinen Worten, was das Nichtverdienen betraf. In jenem Jahr machte ich mein Abitur und wählte enthusiastisch – kein Brot-Studium. Das hieß für mich: ›Philosophie‹; worunter ich ungefähr verstand: die Summe der seltsamen Fragen, auf die ich anläßlich der deutschen Aufsätze gestoßen war … und die am Rand von Herrn Professor Köhler mit soviel roter Tinte grell beleuchtet wurden. Sehr klein war ich im Zeichnen, Singen und Turnen (deshalb gehören diese Drei für mich immer noch zusammen); überlebensgroß hingegen in einer psychologischen Ausdeutung der ›Iphigenie‹. So strich ich mir, Frühling 1913, im Vorlesungsverzeichnis ganz dick ›Psychologie‹ an.
Der Professor war ein Mann, von dem man mir sagte, er sei eine Welt-Autorität. Ich betrat seinen Hörsaal und war ebenso schnell wieder draußen; denn es hing an der Tafel das überlebensgroße Abbild eines Ohr-Labyrinths, ganz offenbar war ich in ein medizinisches Kolleg geraten. Schließlich entdeckte ich, daß die Psychologie des Professor Carl Stumpf gar nicht war, was ich darunter verstand; und daß die Logik der andern Welt-Autorität, des Professor Benno Erdmann, eine Summe von mathematischen Formeln, gar nicht war, was mir Logik zu sein schien. Und dann war noch da der hausbackene, zuverlässige Kantianer Alois Riehl. Wir sangen:
»Die Philosophie gilt hier nicht viel.
Man rottet sie aus mit Stumpf und Riehl.«
Kurz, mein emotionelles Grübeln, das sich mir im Wort ›Philosophie‹ zusammenfaßte, war nirgends zu finden bei den Verkäufern von riesenlangen Bibliographien und gelehrten Details, die mich überschwemmten.
Ich war drauf und dran, mich loszusagen. Aber die Arbeits-Moral meines Vaters steckte mir in den Knochen. Ich hatte gewählt und war deshalb verpflichtet, dabei zu bleiben; man arbeitet zuerst aus Notwendigkeit oder Vergnügen – dann, weil man einmal angefangen hat. Ich studierte im ersten Semester die berühmte vierbändige Geschichte der Griechischen Philosophie bis auf die letzte Fußnote, las Aristoteles und die ›Prolegomena‹, langweilte mich ganz fürchterlich, vergewaltigte mich, war todunglücklich, unterhielt mich mit unserem lieben Hausarzt Dr. Ely Gumpert (dem Vater von Martin) sehr gelehrt – und litt Schaden an meinen Nerven, der nicht wiedergutzumachen war; denn meine Konstitution ist nie solide gewesen. Ich litt auch Schaden an meiner Seele, da der philosophische Eros (die unvergänglichste Entdeckung Platons) nie wieder die Stärke der früheren Jahre gewann. Das Philosophieren, ein Forschen, nicht ein Wissen, wird durch nichts mehr geschwächt als durch Gelehrsamkeit. Ich lud mir auf, was nicht zu tragen war, und fühlte mich wie ein Ertrinkender; und brachte alle diese Opfer nicht für ein Examen, nicht für eine Stellung, sondern um einer sehr nebelhaften ›Pflicht‹ willen.
Dann kam die Erlösung: ich fand zwei Philosophen, Georg Simmel und Adolf Lasson. Sie hatten miteinander nichts gemein – nur dies: daß sie meiner Vorstellung von Philosophie entsprachen. Ich glaube an die Macht des Vorbildes, des ganz individuellen und sehr sterblichen Ideals; an den beispielgebenden Einzelnen, den man in früheren Zeiten einen Helden nannte. Ich glaube, daß man in unseren Zeiten sich der Pflicht, musterhaft zu sein, entzieht mit der Ausrede, es gilt den Führern zu entgehen und die Institutionen zu verbessern. Man soll das nur tun; doch werden sie niemand zur Selbständigkeit erziehen, zum Mut, zu denken, was man denkt, zu fühlen, was man fühlt, zu wollen, was man will. Der beste Weg zum Selbst ist die Faszination durch ein anderes Selbst; die lebende Illustration, wie einer sich traut, Er zu sein. Die Romantiker haben erkannt, was ein leibliches Vor-Bild bedeutet; Novalis hat gewußt, was es für den Staat sein kann. Er war kein Monarchist; eher ein Voraus-Denker, der die ›Exekutive‹, den Manager auf dem Thron, schon ablehnte, bevor er noch die Kommandohöhe erobert hatte. Im Zwanzigsten Jahrhundert benutzt man die gute Gelegenheit, mit den Ver-Führern die Führer – aus der Welt zu schaffen und zu verhindern, daß sie auf die Welt kommen.
Nur Menschen, nicht Ideen haben mich beeinflußt; oder nur Ideen, die sehr individuelle Züge zeigten. Philosophie war mir immer Menschen-, nicht Ideen-Geschichte. Die biographische Einleitung als unbedeutendes Präludium zum sogenannten Werk schien mir immer den Philosophen nicht gemäß: den Sokrates, Fichte, Kierkegaard, Nietzsche, die am besten anschaulich machten, daß Philosophie nicht Wissenschaft ist. Meine beiden Berliner Philosophen trugen kein Sach-Gebiet vor, sie philosophierten. Als ich Simmel denken sah und denken hörte, begann ich – nicht ein Gelehrter zu werden, sondern ein Denkender. Simmel belastete nie (selbst nicht mit Wissenswertem); er setzte im Hörer Prozesse in Bewegung, die mich zum ersten Mal fühlen ließen, was Freiheit ist: unkontrolliertes Sich-Bewußtwerden, man hat keine Ahnung, wohin es noch führen wird. An der äußersten Kante des Katheders stehend, mit einem spitzen Bleistift sich in irgendeine Unzulänglichkeit einbohrend, von Rembrandt und Stefan George und dem Geld und der Ästhetik des Henkels sprechend, setzte der zarte, behende, mausfarbene Mann etwas in Gang, was nie wieder zum Stillstand kam und eine der Seligkeiten ist: das grenzenlose Fort und Fort des Einsehens – auch in das, was es mit dem Einsehen auf sich hat. Er war mein Sokrates. Er gab nicht Lösungen, sondern einen Anhieb, der sich als Perpetuum erwies. Er war im Sinne geistiger Beweglichkeit und Unruhe der philosophischste Philosoph, den ich im Leben getroffen habe. Und wenn ich noch etwas hinzufügen sollte, was ich ihm verdanke – er vermachte mir das »Vielleicht«, »Wahrscheinlich«, den Enthusiasmus gegen die Sicherheit. Selbst ein hurrapatriotischer Brief, den ich am 14. August 1914 schrieb und der von »heiligen Zeiten« und »Weltgeist« nur so strotzte, endete in einem simmelschen Zweifel. Sein Oder verließ mich nie, auch nicht in meinen verblendetsten Stunden. Der Berliner Simmel, geboren Friedrich- Ecke Leipziger Straße, vermachte mir auch die Liebe zum Märker Fontane, welcher das »Vielleicht« in Romane übersetzt hatte.
Adolf Lasson war einige Achtzig, als ich vor ihm, unter ihm saß. Er sprang im Schluß-Sprung auf die recht hohe Plattform, auf der das Katheder stand – und gestikulierte dementsprechend. Man nannte ihn ein Monument aller Zeiten. Er war ein Überbleibsel aus der Epoche des Hegelianismus, der 1913 schon lange töter war als tot und noch lange nicht wieder zu lebendig werden sollte. Simmel war der Fragen gebärende, Lasson der Gesetze erlassende Philosoph. Er war Partei. Hoch hielt er das Panier des griechisch-philosophischen Idealismus. Die Materialisten, ohne jede Qualifikation, waren Feinde der Menschheit. Wenn er den Namen Demokrit aussprach, verzog sich das weite, uralte, vielgefurchte, ausdrucksmächtige Gesicht, als hätte er etwas unsagbar Saures geschluckt. War das eine Harlekinade? Viele Studenten grölten vor Wonne. Einige waren tief angerührt von den flammenden Runen, die auf uns zusprangen. Er machte keine Propaganda, er legte Zeugnis ab. Er überzeugte mich nicht – außer davon, daß hier auf Leben und Tod philosophiert wurde. Auch in ihm war meine (zur Universität mitgebrachte) Idee von Philosophie lebendig. Ich hatte also, wie ich plötzlich fand, zwei Vorstellungen von ihr.
Ich näherte mich dem stürmischen Greis nur zaghaft. Er forderte mich auf, ihn ein Stück zu begleiten, die Linden entlang. Vor dem Palais des Alten Wilhelm blieb er mit einem Ruck stehen (auch sein Sprechen war ruckartig) und wetterte (den Hut in der Hand, die spärlichen weißen Haare wurden vom Regen gepeitscht) gegen Ibsen, den »Unterleibsdichter«. Er lispelte vor Wut. Junge Frauen, bunte Schächtelchen in der Hand, blieben stehen und gafften, als sei ein Pferd gestürzt. Er hatte nichts Muffiges, Verklemmtes. Ein vitaler Greis, der in weißer Blüte stand, schrie seinen heiligen Zorn heraus. Ich war ein Ibsen-Enthusiast – und bewunderte Lasson in seinem Haß. In dieser gewaltigen Feindschaft ähnelte er dem großen Radikalen (so sahen wir Ibsen damals) mehr als die gesamte Ibsen-Internationale; auch Lasson hätte das Vorbild für Brands ›Alles oder Nichts‹ sein können.
Das also waren – zwischen Enttäuschung und Begeisterung – meine ersten beiden Semester; im Testierbuch finde ich noch Roethe (den chauvinistischen Clown), Oppenheim (den sarkastischen Sozialisten), Dessoir (der besser Dvorak als Philosophie spielte), Adolf Wagner (Kathedersozialist und uralt), Breysig (den tief verehrten Historiker, der Spengler und Toynbee vorwegnahm). Im Frühjahr 1914 fuhr ich in mein drittes Semester, das letzte vor der Zeitenwende, nach Freiburg im Breisgau: mit einem bescheidenen Monatsgeld, das auch noch für ein paar Osterfeiertage auf der Isola Bella reichte, für Blumen an die filia hospitalis hinter der Dreisam, für einige Bonbonnieren an eine sehr mädchenhafte Neu-Kantianerin; damals gab es noch nicht die weibliche Karrieristin, hingegen las man in den ›Kantstudien‹ Annoncen: »Kantianer sucht Kantianerin zwecks ehelicher Verbindung«.
Ich brachte nach Freiburg auch eine klare Vorstellung von den drei großen Satrapien mit, in welche das deutsch-philosophische Reich zerfallen war; die Diadochien des Kantianismus. In Berlin herrschte Alois Riehl, in Marburg Hermann Cohen und Natorp, in Heidelberg und Freiburg Windelband und Rickert. Diese vier Orte waren die Hauptstädte des philosophischen Deutschland. Als es bald nötig wurde, zu wissen, wo Serbien lag, fand ich es nur mit vieler Mühe. Auf dem deutsch-philosophischen Atlas des Jahres 1914 wußte ich genau Bescheid.
Heinrich Rickert in Freiburg hatte eine Löwenmähne und war der tyrannischste Philosoph, den ich kennengelernt habe. Sein Kolleg hielt er in der Bibliothek; er hatte Platzangst und mied die Universität. Das Seminar tagte in seiner Villa; Teilnehmer waren Professoren, Doktoren – und auch einige geringere Götter, sehr fortgeschrittene Studenten. Als ich, ein drittes Semester, ihn bat, mich zuzulassen, unterwarf er mich einem hochnotpeinlichen Verhör. Ich sah nichts als zwei gefährlichscharfe Gläser und furchterregend viel Haar rundum. »Bei wem haben Sie in Berlin gehört?« Ich spielte sofort meine beiden Asse aus, die Welt-Autoritäten: »Carl Stumpf!« Rickert warf unwirsch seine Mähne auf die Seite: »Das ist doch ein Psychologe.« (Ich hatte geglaubt, Psychologie sei eine Disziplin innerhalb der Philosophie.) Ich sagte, schon ohne Vertrauen: »Benno Erdmann.« Rickert, verächtlich: »Formale Logik.« Ich wagte kaum noch Simmel zu nennen, einen Außenseiter, nur Außerordentlicher Professor. Aber dieser Name war das ›Sesam-öffne-dich‹. Die Höhle tat sich auf; ich saß ein Sommer-Semester lang im Landhaus am Bahnhof Wiehre mäuschenstill auf der äußersten Kante eines Stuhls – so weit von ihm entfernt, daß er mich wohl nicht sehen konnte. Blickte er einmal in meine Richtung, so senkte ich sicherheitshalber die Augen.
Rickert diktierte Gut und Böse in der Philosophie; seine beiden jungen hervorragenden Privatdozenten, Georg Mehlis und Richard Kroner, durften ihm ab und zu vorsichtig ein Stichwort reichen. Ich war überwältigt. ›Der Gegenstand der Erkenntnis‹, ›Die Erkenntnis des Gegenstandes‹, ›Die Grenzen naturwissenschaftlicher und geisteswissenschaftlicher Begriffsbildung‹ verdeckten mir alle Welträtsel; denn Rickert kommandierte, mit einem seiner unvergeßlichen Dikta: daß nach ihnen nicht einmal gefragt werden dürfe. Ich wurde ein wilder Parteigänger, Neu-Kantianer dezidiert südwestdeutscher Prägung. Ich wurde sehr intolerant (wozu ich schon immer neigte) und ein hochgelehrter Streithammel. Die philosophische Zeitschrift ›Logos‹ war meine Bibel. Eine poetische Abstraktheit, die ich mir hier anlas, formte meinen ersten Stil; Georg Engel, der Roman-Schriftsteller, klagte meinen Eltern – und betrübte sie sehr: »Ihr Sohn wird ein hartes Leben haben. Seine Sätze gibt es nicht.« Ich fühlte mich als Missionar und versuchte, meinen guten Freund Alfred Jackier (der Rechtsanwalt wurde, um all mein Unrecht zu legalisieren) zum Freiburger Kult zu bekehren, als wir, auf zwei Sänfte-artigen Polstern gelagert, am Gründonnerstag 1914 zur ›Schönen Insel‹ hinübergerudert wurden.
Bekehren – wozu? Zum ›System der Werte‹, in dem Abstrakta wie ›Staat‹, ›Wissenschaft‹, ›Kunst‹ – den Orden ›Werte‹ trugen. Rickert erklärte dies System, nach einem Lieblings-Trick des Zwanzigsten Jahrhunderts, für ›offen‹; obwohl ein Offenes System ein hölzernes Eisen ist. Aber es manifestiert sich, ›offen‹ gesagt, in dieser Offenheit deutlich (von Rickert bis Bloch und Heidegger) die ängstliche Freiheit der Epoche: man will weder Gott aufgeben (den Alten Herrn des jüngeren Systems) noch wirklich frei sein für jede Überraschung; nur Nietzsche, Bergson und William James waren etwas mutiger. Man will ein pluralistischer – Monotheist sein. Ach, man war nur anfällig für jede Extra-Tour der Weltgeschichte: bis zu Hitler und Stalin. Das Offene System war leider so ›offen‹, so gastfreundlich, daß es von Heinrich Rickert, dem Sohn des berühmten deutschen Freisinnigen, in den dreißiger Jahren – mit ihrer deutschen Ideologie gefüllt werden konnte … Zwanzig Jahre zuvor aber, 1914, war ich überwältigt von der gedanklichen Schärfe dieses scharfsinnigen Scholastikers des Neu-Kantianismus. Das Rickert-Seminar war mein Delphi. Die Welt war hinter den Tannen des Schwarzwalds zu Ende. Serbien lag nicht etwa im Mond, sondern nicht einmal dort.
Im Hochsommer, einen Monat vor Ferienbeginn, kam der Kompagnon meines Vaters nach Freiburg – und lud uns zu einem solennen Mahl in den Zähringer Hof. Er hieß Katz und war an jenem Abend leichenblaß: »Der Thronfolger Franz Ferdinand ist in Serajewo ermordet worden.« Uns erschütterte diese Nachricht mitnichten. Mein Freund war Jurist im zweiten Semester und kannte bereits außer dem römischen, ekklesiastischen und deutschen Recht die spitzfindigsten Drehs. Ich war schon imstande, vor einem Welt-Forum die Kategorie des ›Transzendenten Soll‹ zu verteidigen. Jetzt sahen wir einander hilflos an. Im ›Berliner Tageblatt‹ hatte ich immer nur die Theaterkritiken von Schlenther, die Feuilletons von Auburtin und die Beilage ›Zeitgeist‹ gelesen. Da war nie die Rede gewesen vom österreichischen Thronfolger und dem Distrikt, in dem dies Serajewo lag.
Am nächsten Tag erkundigten wir uns bei Gleichaltrigen, im Restaurant am Martinstor, wo ich einmal die Aufforderung eines Couleurs zu einem tiefroten Austrag mit blankem »Nein« beantwortet hatte (was seiner Seele einen tiefen Schmiß applizierte): ob dies Serajewo wirklich so wichtig sei. Alle meinten: viele alte Leute interessieren sich eben für Politik.
In jenen Tagen fuhren wir nach Heidelberg hinüber; ich, um den berühmtesten Rickert-Schüler, Emil Lask, zu hören – einen mystisch-scharfsinnigen Logiker, der mich tief beeindruckte; mein Freund, um in ein Kolleg von Alfred Weber zu gehen. Da war immerzu von serbischen Schweinen die Rede. Ich dachte: »Schon wieder die Affaire Thronfolger.« Viel später erfuhr ich, es waren eßbare Schweine gemeint.
Ende Juli traf ich einen meiner respektabelsten Seminar-Genossen, Helmuth Falkenfeld, in der Goethestraße. Er sagte verzweifelt: »Haben Sie schon gehört, was passiert ist?« Ich sagte voll Verachtung und gottergeben: »Weiß schon, Serajewo.« Er sagte: »Nein, morgen fällt das Rickert-Seminar aus.« Ich sagte, erschrocken: »Ist er krank?« Er sagte: »Nein, wegen des drohenden Krieges.« Ich sagte: »Was hat das Seminar mit dem Krieg zu tun?« Er zuckte schmerzlich die Achseln. Er war der Hauptleidtragende, denn er sollte das Referat halten. Das war damals kein Pensum, sondern eine hohe Auszeichnung.
Falkenfeld wurde mir unvergeßlich, weil er bewies, daß der Kantianismus auch ein Glaube war – mit Blutzeugen. Als Kriegsfreiwilliger schrieb er, Ende 1914, aus dem dichtesten Kugelregen, an die Redaktion des ›Logos‹: »Mir geht es nach wie vor gut, obwohl die Schlacht, an der ich am 30. Oktober teilgenommen habe, mit ihrem Kanonendonner von 24 Batterien, meine Ohren fast taub gemacht hat. Trotzdem jede Minute daran erinnert, daß wir im Kriege und in Feindesland sind, bin ich immer noch der Ansicht, daß die 3. Kantische Antonomie wichtiger ist als dieser ganze Weltkrieg und daß Krieg zur Philosophie sich verhält wie Sinnlichkeit zur Vernunft. Ich glaube einfach nicht daran, daß die Geschehnisse dieser Körperwelt unsere transzendentalen Bestandteile auch nur im mindesten tangieren können, und werde nicht daran glauben, selbst wenn mir ein französischer Granatsplitter in den empirischen Leib fahren sollte. Es lebe die Transzendentalphilosophie.« Auch an diese Christian Science der Transzendentalisten denke ich, wenn ich mich an uns Zöglinge der deutsch-philosophischen Freiheit erinnere. Sie war einmal eine reale Macht, nicht nur Fest-Schmaus. Man kann nicht sagen, sie beherrschte die Studentenschaft; doch jenen kleinen Sektor wohlsituierter, liberaler, hochgestimmter Söhne, die (auch wenn sie Medizin, Jura oder Theologie studierten) in der Atmosphäre des ›Logos‹ lebten. Die Couleurs hingegen residierten auf einem anderen Stern. Zwischen uns war mehr als ein Eiserner Vorhang: der Zweifel, ob die Anderen auch Menschen seien.
Ich verstand nicht, was vorging. Wenn wir abends auf dem Wege zu unserer ruhigen Bude jenseits des Flüßchens waren, schon etwas auswärts, bremste ein Radler hart hinter uns und warnte vor dem Trinken von Wasser, da alle Brunnen vergiftet seien. Saß ich auf der Terrasse meines Lieblings-Cafés und machte mir Aufzeichnungen für meinen ersten ›Logos‹-Essay, der nie das Licht der Welt erblicken sollte, so wurde ich plötzlich von gefährlichen Stimmen aus den Gedanken gerissen; denn alles stand bereits eisern, zu den Klängen irgendeines patriotischen Aufschwungs. Man flüsterte von Spionen, gesprengten Brücken; ich hatte, da Jonas Cohn es verlangte, Schleiermachers ›Ethik‹ zu studieren … und glaubte nicht so recht, daß das Andere, das Lärmend-Aufgeregte, real sei.
Die Welt, in der einer eingeschlossen sitzt (ein business oder der Transzendentalismus oder ein wissenschaftliches Problem oder eine unglückliche Ehe oder die Christian Science oder der Applaus des Publikums oder irgendein anderer Ehrgeiz, irgendein anderes Märchen), ist undurchlässiger, als sich alle Außenstehenden – das heißt: der Rest der Menschheit – vorstellen.
Das Akademische Disziplinaramt bestätigte mir, daß hinsichtlich meiner »sittlichen Führung seit Ostern 1914 etwas Nachteiliges nicht« bekannt sei. So unbescholten traf mich der Krieg an.
Meine ersten Wirklichkeiten im ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts
Ich hänge meinen Vergangenheiten nach. Entscheidend gewesen ist für jede: was real war und was nicht. In den ersten achtzehn Jahren war real: das Schloß – und wir, die wir es nur besichtigen durften; nicht real waren das Dorf und der Bauer, die Requisiten der Ferien. Als ich zum ersten Mal einen Hahn krähen hörte, auf dem Gehöft meiner Verwandten in Woltersdorf, überwältigte mich das Irreale, das Märchenhafte; und noch heute ist die ›Natur‹ für mich nicht eine Wirklichkeit, sondern eine geliebte geistige Ausschweifung.
Nicht real war auch der Arbeiter im Zentrum und Norden der Stadt. Wir lebten eine halbe Eisenbahn-Stunde vom Alexanderplatz und von der Fabrik meines Vaters entfernt – das heißt: einige Millionen Meilen. Ich kannte nur Bürger, Gouvernanten und Dienstmädchen. Sie waren real. Real waren: Häuser ohne Felder, Verwandte ohne Zahl; Ferien in Norderney mit Strandkörben und Burgen; die ersten Annäherungen an Backfische in den Badekarren am Nachmittag, wo diese, außer Betrieb, ganz ohne Pferde verwaist herumstanden. Diese Strand-Realitäten (von Lichtenberg beschrieben in der Skizze: ›Warum hat Deutschland noch kein großes öffentliches Seebad?‹) gewannen in meinem Leben eine solche Stärke, daß ich die Beach von Los Angeles, meine Heimat seit zwanzig Jahren, nie anerkennen konnte; denn hier gibt es keine Körbe und keine Fahnen im Winde und keine Wälle aus Sand und keine Dogcarts, welche von Rossen ins Meer gezogen werden, und keine Mädchen, denen man zu vierzehn Jahren und sieben Wochen Gedichte machen – und sich zeigen kann, in geheimnisvoller Entblößung. Meine Strand-Wirklichkeit vom Anfang des Jahrhunderts ließ keine andere mehr aufkommen neben ihr.
Nicht real war auch, was mir auf der Schule geboten wurde: gleichschenklige Dreiecke, die Perser-Kriege, der Teutoburger Wald, Lützows wilde verwegene Jagd und der Auszug jener Kinder Israels aus Ägypten … obwohl bei uns die Zeder-Abende gefeiert wurden, welche dies Ereignis mit vielen verschollenen, sehr seltsamen Gebräuchen zelebrierten. Zu Chanukka wurde gewürfelt. An den beiden höchsten Feiertagen, Neujahr, das in den Herbst fällt, und am Versöhnungstag, mußte ich neben meinem Vater im Tallis sitzen – und mich gewaltig langweilen. Nicht einmal die frischgeputzten Mädchen lenkten mich ab, da ich von Kind an auf die andere Rasse aus war … eine der unaufgeklärtesten und verbreitetsten Neigungen.
Die festtäglichen Unternehmungen waren schon bei meinem Vater nicht mehr Glaube, Gebundenheit, nur noch Pietät – Anhänglichkeit an das Elternhaus, dem er mit der Wiederholung des Rituals auch im hohen Alter noch kindlichen Respekt erwies. In seiner letzten Stunde schrie er laut und innig das ›Schmah Jisroel‹; er wird, während er die uralte Formel gewaltsam herausstieß, ganz gewiß nicht von Angesicht zu Angesicht mit Jehova gewesen sein – eher zurückgesunken in die früheste Vergangenheit, als der Zauber-Spruch Wurzel gefaßt hatte. Für mich gewann diese Welt nie eine Realität. Schon meine Eltern fuhren am Sabbat, unser Haushalt war nur ein bißchen koscher, wir Kinder durften Schinken essen, ich fastete am Versöhnungstag nicht, mein Hebräisch war kaum der Rede wert. Ich wuchs nicht in der jüdischen Tradition auf; ich lernte nur noch einige ständig repetierte Szenen und die berühmtesten Nummern kennen.
Eine mächtige Realität hingegen war für mich Weihnachten: der Baum, die Lichter, die Bescherung, Schnee mit Tannennadelgeruch, die familiäre Zusammengehörigkeit von Herrschaft und Dienstboten – nicht ein Herablassen, sondern die Wiederherstellung eines echten Zustands, wenn auch nur für einen Abend. Diese Weihnachts-Freude aneinander war viel realer als jenes ›Das nächste Jahr in Jeruschulajim‹. Bis zu diesem Tag sind meine besten frühen Stunden aufgehoben in den Weihnachtsliedern, die mich immer an Pfeffernüsse, Gänsebraten, Lametta, Karten mit winterlichen Ansichten – und jene Lupe unter dem Weihnachtsbaum erinnern, welche ich mir sehnlicher wünschte als irgend etwas später. Heute könnte mich genauso bezaubern nur eine Hupe an meinem Wagen, die mir erlauben würde, durchs rote Licht zu fahren.
Weihnachten – das ist auch jene Stunde, als ich am Wasserturm, in der Nähe des Tattersalls und nicht weit von der Tiergarten-Schleuse, Gustel um einen Kuß bat. Sie sagte, zitternd: meine Mutter findet das unhygienisch. Zitternd hüllten wir unsere Köpfe in ihr dünnes Mäntelchen. Es war viel Läuten in der Luft von Weihnachtsglocken und Glitzern von Sternen und Schnee. Wir standen dicht beieinander und vergingen, am Weihnachtsabend. Am Weihnachtsabend betrat ich den mächtigen Kontinent Liebe – als Verliebter; und glaubte lange Zeit: Lieben und Vergehen ist dasselbe; Lieben und der süße Strom Sehnsucht ist dasselbe; Liebe ist nicht erfüllbar und deshalb immer glücklich; Weihnachten ist Sich verlieben. Daß es Liebe ohne Verliebtheit gibt, ahnte ich nicht; daß Verliebtsein dem Liebes-Genuß abträglich ist, lernte ich ein bißchen langsam. Und erst kürzlich kam ich darauf, daß von Platon bis zu Stendhal und Georg Simmel die Liebe immer als Verliebtsein geschildert worden ist. Sein physischer Ausdruck ist die Selbstbefriedigung. Sie ist auch ein Notzustand in den Jahren, in denen die kleinen Herkulesse ihre Keulen mächtig schwingen, ohne treffen zu dürfen. Aber Verliebtsein ist mehr als eine Not, obwohl sie es begünstigt.
Die Dienstmädchen, die Gouvernanten, die Schwestern und die Cousinen ersten, zweiten und sehr fragwürdigen Grades waren die ersten Jagdgründe, von denen die männliche Jugend des Berliner Hansa-Viertels halbe, viertel und noch fragmentarischere Beute heimbringen konnte. Das Heim war eine Bank im Park oder ein leeres Stadtbahn-Coupé oder der günstig gelegene Schlafraum einer langen Berliner Wohnung, und die Eltern schliefen weit weg, hinter dem umfangreichen Berliner Eßzimmer. Aber die Angst war so groß wie die Aufregung und die Technik gering; im Gedicht, nicht in der Wirklichkeit war Erfüllung … bis man dann einsah, viel später, daß das Platonische und das Fleischliche zwei Selbstherrlichkeiten sind, die ehrerbietig einander respektieren sollten; zwei Souveräne ohne Grenzen, nicht zwei Konkurrenten. Wer hier ausschließt, entmannt sich. Auch ohne Sehnsucht ist man kein Mann.
Im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts lernte ich sehr stümpernd und nie richtig, ohne Lehrer, was entscheidender für mein Leben wurde als die Riesenwelle am Reck und am Thucydides, die offiziell von kulturellem Belang war und deshalb eingeübt wurde. Damals ahnte ich noch nicht: der Körper wird sich dafür rächen, daß man ihm (trotz Jugendbewegung, Schiller-Kragen und dem Stock zwecks Gradegehen im Rücken) die Kellerwohnung gab, dem ›Geist‹ aber die Beletage: dort wurde die Hexerei mit Begriffen eifrig betrieben – die Sinne mochten sehen, wo sie blieben. Finge ich noch einmal an, so kümmerte ich mich um meine Augen und meine Ohren, meinen Geruch und meinen Geschmack, mein Herz und meine Bronchien und meine Leber und alle meine lieben Organe so gründlich, wie ich mich in vergeudeten Jahren um Carl August gekümmert habe und um das Gespräch zwischen Goethe und Schiller nach der Naturforscher-Versammlung in Jena – dem ewigen Steckenpferd der Lehrer, die nicht abreißen. In meiner Wirklichkeit gab es meinen Körper nicht. Platon ist auch der Schutzheilige der größten Sünde unserer Tradition. Die Dichter folgten ihm und beschrieben fast nie (von vornehmen Krankheiten abgesehen) die körperlichen Schicksale ihrer Figuren: als ob sie nur aus Eifersucht und Ehrgeiz handelten, psychische Raumlosigkeiten.
Höchstens der kranke Körper findet die Beachtung, auf die der gesunde einen viel höheren Anspruch hat. Jeder hat ganz gewiß eine nicht ganz unbekannte Geschichte seiner Schmerzen, von den ersten Zähnen bis zu den letzten Kreislaufstörungen. Aber auch die Gesundheit hat ihre Historie, eine viel wesentlichere, weil sie zum guten Teil ein ignorierter Prozeß der unmerklichen Verkrüppelung ist. Würden die göttlichen Möglichkeiten, die im Atmen liegen und im Entspannen der Muskeln und im Ausschließen aller Organ-Gefühle, trainiert werden wie die überflüssigsten Scharfsinnigkeiten, so würden wir viel mehr Götter sein, als wir es sind, mit unseren ungehobenen leiblichen Schätzen.
Entfremdung: das ist zunächst einmal die Fremde zwischen mir und meinem Fleisch – und manche nehmen es ihm sogar übel, wenn es bei soviel Nichtbeachtung den großmächtigen Geist nicht mehr nährt. Der erhabene Regisseur Individuum kennt einige seiner Haupt-Akteure nicht; sie mischen sich ein – unbemerkt und ungenossen. Es ist kein dialektischer Bürgerkriegs-Marsch nötig, um diese grundlegende Fremdheit aufzuheben. Jedoch sind die studierenden Zeitgenossen leider zu sehr von sich abgelenkt durch das Märchen von der pompös ausschreitenden Weltgeschichte, die nur am Glück en gros interessiert ist und nur an den Nachfahren, welche wiederum nur ihre Nachfahren in Betracht ziehen dürfen. Und nur im geheimen essen die revolutionären Autoren dieses Aufrufs zur militanten Askese ihre Schmalzstullen.
In den letzten Schuljahren tauchte schließlich noch jene Realität empor, die man heute gern Ideologie nennt; mit Recht, weil sie nur selten mehr ist. Wir nannten sie noch, nach großen Vorbildern: ›Die Welt des Geistes‹ – was damals noch nicht geisterhaft klang und inzwischen eine öde Redensart geworden ist; dazu noch belastet mit ›Bildung‹, die sich als ein Synonym für Geist präsentiert. Man kann Geist und Bildung in ironische Anführungsstriche setzen; in dieser Form sind sie sehr kräftig am Leben. Geist ist allerdings auch immer weniger … wir hatten 1914 den Horizont von Fabrikanten-Söhnen. Bildung ist allerdings auch immer weniger: Klassen-bedingt. Wir waren so subtil gebildet, wie es nur Bürger waren. Man sieht vom soziologischen Engpaß aus manches sehr klar. Die exklusive Bildung wurde verbreitert – und eingeebnet, den Arbeitern wurde eine Ideologie aufoktroyiert, die Bürger verschrotteten den Geist des deutschen Idealismus als Kriegs-Propaganda … Unter dem lauten Lärm um die Ideologien (das heißt: Kampf-Parolen), unter der Bildungs-Hausse (das heißt: dem Interesse für respektables Bescheidwissen und Unterhaltung durch Sach-Literatur) wurde der Geist immer feister – und geisterhafter; immer mehr ›Ideologie‹ plus ›Bildung‹. Da ist es gut, sich auf eine Zeit zu besinnen, wo er noch ursprünglich war – wie ein Wahn.
Soll man ihm diesen abfälligen Namen geben? Weshalb ist er so abfällig? Weil das Reich des Wahns kaum erforscht ist. Weil pathologisch genannt wird, was einer sehr beschränkten Gesundheit sehr fremd ist. Weil man nicht gesteht, daß die ungelösteste Frage lautet: welche Realität ist real? Es gibt aber mehr Realitäten, als die Realisten ahnen.
ZWEITES KAPITEL
War is a private affair
Wer anschaulich machen will, wie ein großer Teil der Deutschen 1914 den Ausbruch des Krieges erlebte, muß darauf hinweisen, daß nach dreiundvierzig Jahren Frieden die meisten phantastische Vorstellungen von dem höchst unbekannten Ereignis Krieg hatten; er war modelliert nach den mehr lustigen oder mehr elegischen Reiterstückchen, die der General von der Tann und die Remarques der siebziger und achtziger Jahre hervorgebracht hatten. Neunzehnhundertvierzehn erfuhren nicht nur die Jünglinge, auch ihre Väter zum ersten Mal das Sich-aufbäumen einer Gruppe gegen den Tod; denn im Krieg geht es um Tod und Leben, ebenso für den Angreifer wie für den Angegriffenen.
Heute ist solche Unerfahrenheit schwer zu verstehen; man lebt seit Jahrzehnten im Dreißigjährigen Krieg des Zwanzigsten Jahrhunderts, der bereits sechsundvierzig Jahre dauert. Der Friede von einst ist heute ebensowenig nachfühlbar, wie es damals der Krieg war. Die Historiker sollten die Bilder vom 1. August 1914 und vom 1. September 1939 hart nebeneinander setzen; Kriegsbeginn und Kriegsbeginn ist nicht dasselbe.
Wer (wie ich) zwanzig war, als der Erste Krieg ausbrach, erlebte ihn, wie man zu sagen pflegt, schon bei vollem Bewußtsein. Aber niemand hat ein ›volles‹ Bewußtsein; und was das nicht volle anlangt, so gibt es viele Grade der Leere – je nach Umfang des Wissens und Tiefe der Einsicht (nicht dasselbe), auch nach dem Maß der Verantwortung, die man auf sich zu nehmen bereit ist.
Ich war zwar ein erwachsener Zeitgenosse, ein Genosse der Zeit von 1914; doch war es mit dem Wissen, der Einsicht und der Verantwortung gleich schlecht bestellt. Heute erst sehe ich: auch eingeweihtere Mitbürger wußten damals nicht annähernd soviel, wie sie später in ihren Memoiren vorgaben; denn was in einer Gegenwart geschieht, erfährt man in der Regel erst eine ganze Weile danach von den Historikern. Man reagiert zunächst weniger auf Fakten als aus seiner Situation heraus, die ein durchaus privates Gebilde ist. Man verwechsle nicht, was in den Geschichtsbüchern steht, mit dem, was einer, dessen Zeit sie beschreiben, durchgemacht hat. Jeder hat seinen ganz persönlichen Krieg gehabt und vier Jahre später seine ganz persönliche Revolution. In historischen Werken steht höchstens das Historische; im Gedächtnis findet man, wenn man gewissenhaft gräbt, viel weniger – und viel mehr.
Ich schreibe hier eine Geschichte, die in den Büchern mit dem Titel ›Der Erste Weltkrieg‹ nicht zu finden ist; ich erzähle eine jener Lebensgeschichten, von denen Hegel sagte, sie ständen auf den leeren Seiten im großen Buch der Erinnerung. Mir scheinen, im Gegensatz zu ihm, diese Millionen leeren Seiten denkwürdiger zu sein als die bedruckten.
Es gibt ganz gewiß auch gemeinsame Stunden im Leben einer Gesellschaft, wo sie zu einer Person zu gerinnen scheint; der Ausbruch des Kriegs ist gewöhnlich solcher Art. Diese Gemeinsamkeit wird um so umfangreicher und unvergeßlicher sein, je kleiner die Gruppe ist; die deutsche war 1914 bereits 60 Millionen breit. ›Der Geist von 1914‹ brach also nur in ein paar rauschhaften Minuten durch und unterjochte in ihnen einen sehr großen Teil der Herde. Die erlauchtesten Dichter brachten diesen Geist in Verse, die erlauchtesten Professoren in Sentenzen. Sie vereinigten sich zu einem Unternehmen, das früher ein Einzelner bewältigt hatte: zu ›Reden an die Deutsche Nation‹. Der Germanist Roethe titulierte die Zuhörer: »Deutsche Männer und Frauen«, teilte ihnen mit, daß »Gott der Herr zu uns im Schlachtendonner spricht« und zitierte den Danziger Dichter Hasentödter aus dem 16. Jahrhundert:
»Durch dies begangene Bubenstuck
Bist ärger als ein Mameluck,
Weil du gestärkt die Russen
Wider Gott und dein Gewussen.«
Wilamowitz sprach sein Publikum ziviler mit »Meine lieben Mitbürger« an und teilte ihnen mit: ich stehe hier, um ein »Feuer in Ihren Herzen zu schüren«. Der Theologe D. Adolf Deißmann sagte von seinem Thema ›Der Krieg und die Religion‹ die Zusammenstellung »der beiden Begriffe ›Krieg‹ und ›Religion‹ in einer einzigen Zeile« wirke »grotesk«; alsdann