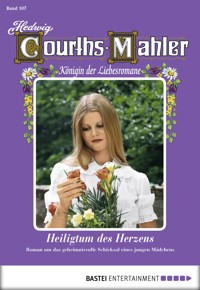Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Traude Karsten hat von Kindheitsbeinen an kein einfaches Leben. Ihre Mutter heiratet Ministerialrat Rutland, einen sehr ernsten und strengen Mann, der für lebhafte Kinder kein Verständnis hat. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, wird Traude als junge Frau auch noch zur Vollwaise und kommt notdürftig bei Verwandten unter. Ihr einziger Lichtblick in dieser schweren Zeit ist Heinz, der Sohn des verstorbenen Stiefvaters. Doch der lebt mittlerweile in Amerika und bewirbt sich gerade in New York als Testfahrer…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hedwig Courths-Mahler
Im fremden Land
Saga
Im fremden Land
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1955, 2022 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788728472934
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
1
»Heinz, mein lieber Bruder!
Deinen letzten Brief, in dem Du mir Deine Ankunft in New York anzeigst, habe ich erhalten. Ich bin froh, daß Du es dort anscheinend so gut getroffen hast und es Dir gelungen ist, nach dem Zusammenbruch Deiner Lebenshoffnungen Dir eine neue Existenz zu gründen.
Mir war bange um Dich, mein Lieber, denn ich wußte gut, wie verzweifelt es in Dir aussah, als Dir nichts, gar nichts, gelingen wollte, seit Du aus dem Krieg heimgekehrt warst. Immer wieder standest Du dem Nichts gegenüber, und ich hatte Angst, wenn Du mir mit blassem Gesicht einen neuen Mißerfolg meldetest und dabei die Zähne zusammenbeißen mußtest, um die Fassung nicht zu verlieren. Ich wurde die Sorge nicht los, daß Du in Verzweiflung etwas tun könntest, was nicht wiedergutzumachen war. Der Existenzkampf war schwer in diesen Jahren, und was Du verdientest, reichte nur von der Hand in den Mund. Ich sehe Dich noch vor mir, als Du mir sagtest, daß Du nach Amerika gehen würdest. ›Es geht nicht so weiter, Schwester, hier komme ich auf keinen grünen Zweig. Ich muß das Leben mit festen Arbeiterhänden anpacken, damit es mir gibt, was ich brauche. Vielleicht erschrickst Du, wenn ich Dir sage, daß ich drüben in einem großen Automobilwerk eine Stellung als Einfahrer angenommen habe.‹ So sprachst Du zu mir. Ich erschrak nicht, wie Du wohl geglaubt hattest, sondern sagte Dir nur: ›Es muß sein, Heinz, jede ehrliche Arbeit ehrt den Mann.‹ Du nahmst meine Hände und sagtest: ›Tapfre Schwester! Ich verlasse die Sphären der ich bis jetzt angehörte, aber ich werde endlich Geld genug verdienen, um ein menschenwürdiges Dasein führen zu können. Das Werk, bei dem ich durch Vermittlung eines Amerikaners Anstellung gefunden habe, ist die Stemberg-Kompanie in New York. Sie suchte einen furchtlosen Menschen zum Einfahren neuer Motoren, auf einen Hals- oder Beinbruch darf es einem da nicht ankommen, aber es wird gut bezahlt.‹ Du lachtest zum erstenmal wieder seit langer Zeit.
›Willst Du nun die Courage verlieren, Schwester? Hat mich der liebe Gott nicht durch tausend Gefahren geführt, ohne daß mir etwas geschehen ist? Er wird mich auch jetzt nicht umkommen lassen.‹
Ach, Heinz, wie schwer mir ums Herz war, ahntest Du nicht. Aber Du bist kaltblütig entschlossen, wo es darauf ankommt, und deshalb will ich mich nicht unnötig sorgen. Ich bin jedenfalls mit all meinen Wünschen bei Dir und hoffe, Gutes von Dir zu hören.
Rührend lieb ist es von Dir, daß Du mir helfen und mich aus meiner bedrückenden Lage erlösen willst, sobald Du etwas zusammengespart hast. Onkel und Tante sind natürlich außer sich, daß Du eine untergeordnete Stellung angenommen hast. Sie hätten es richtiger gefunden, wenn Du verhungert wärst, als daß Du Testfahrer geworden bist. In ihrem engstirnigen Sinn empfinden sie es als eine Schmach, und sie machen mich mitverantwortlich, weil ich es Dir nicht ausgeredet habe, diese Stellung anzunehmen. Du kennst sie ja. Ich lasse sie reden, es kommt nicht darauf an, ob sie noch ein wenig mehr nörgeln. Aber eins will ich Dir sagen: Dein Entschluß hat auch mich wachgerüttelt aus meiner Stumpfheit. Ich frage mich jetzt hundertmal am Tag: Warum ißt du bei deinen Verwandten, die kaum genug für sich selbst zu essen haben, immer noch das Gnadenbrot? Wäre es nicht richtiger, für Geld zu arbeiten, um von dieser Gnadenbrotmisere frei zu werden? Freilich — ich habe nichts Rechtes gelernt. Die Eltern haben mich für das Leben einer Tochter aus begüterten Kreisen erzogen, ich kann von allem ein wenig, aber nichts gründlich genug, um mich damit auf eigene Füße stellen zu können. Solange Papa lebte und seine Stellung im Ministerium ihm sicher war, gab es keine Veranlassung zur Sorge. Es reichte immer zu einem guten, auskömmlichen Leben, und für später dachten die Eltern an eine Versorgung durch eine entsprechende Heirat. Aber wie anders ist alles gekommen! Nachdem Papa zu Beginn des Krieges fiel und auch Mama bald starb, stand ich allein und verlassen da, denn Du weiltest ja an der Front. Hilflos ließ ich mich von Tante Agathe in ihre bescheidene Beamtenwohnung schleppen und mußte noch froh sein, daß ich ein Unterkommen fand. Für die ersten Jahre konnte ich mich wenigstens noch selber kleiden aus dem Erlös der Möbel unserer Eltern, den Du mir großmütig überließest. Aber dann war ich ganz auf die Gnade meiner Verwandten angewiesen. Und weil ich es entsetzlich fand, von Almosen zu leben, ließ ich es ohne Gegenwehr geschehen, daß Tante Agathe ihrer Hausangestellten kündigte und mich ihre Arbeiten verrichten ließ. Wenn ich mit Tante Agathe ausgehe und Bekannte treffe, darf ich allerdings nichts von Arbeit erzählen, ich muß mich ganz als Dame geben — als Drohne. Die Nichte des Geheimrats Karsten muß als unnützer Brotesser erscheinen. Warum nur? Warum in diesen furchtbar ernsten Zeiten noch dieses rückständige Komödienspiel aus Standesrücksichten? Warum darf ich mir mein Brot nicht als freier Mensch verdienen, gleichviel, in welcher Stellung?
Wenn ich nur wüßte, wie ich mich unabhängig machen könnte! Ich überlege mir immer wieder, was ich leisten könnte, was ich gelernt habe. Es ist verzweifelt wenig. Ich kann englisch und französisch sprechen — aber nicht genug, um damit etwas anfangen zu können. Dann fertige ich geschickt Damengarderobe — ich arbeite alles, was Tante und ich tragen, und niemand würde glauben, daß ich es selbst genäht habe. Ich fragte Tante, ob ich nicht noch einen Kursus besuchen und mich dann als Modistin betätigen könnte. Da fiel sie beinahe in Ohnmacht. — Was kann ich noch? Waschen und bügeln, frisieren und nähen. Aber — wenn ich vor Onkel und Tante aussprechen wollte, daß ich eine Stelle als Hausmädchen suche — ich glaube, sie würden mich einfach einsperren. Onkel hat mir ohnedies schon klargemacht, daß ich, solange ich nicht mündig bin, nichts ohne seine Zustimmung unternehmen darf. Sonst hätte ich wohl schon etwas begonnen.
Die einzigen ›standesgemäßen‹ (wie ich dieses Wort hasse!) Stellungen, die ich vielleicht annehmen dürfte, wären die einer Gesellschafterin oder einer Krankenpflegerin. Aber trotzdem, lieber Heinrich, werde ich eine Stellung als Modistin oder Hausmädchen annehmen, sobald ich mündig bin. Onkel und Tante werden sich natürlich entsetzen, aber darauf kann ich nicht länger Rücksicht nehmen. Du hast mir durch Dein tapferes Zugreifen Mut gemacht, etwas Ungewöhnliches zu unternehmen und mir eine Lebensberechtigung zu schaffen. Ich mag nicht mehr von der Gnade anderer Menschen leben — auch von Deiner Hand nicht, mein lieber Bruder. Ich nehme kein Geld von Dir an, der Du mein liebster Mensch auf der Welt bist. Frei will ich sein und selber meine Kräfte regen. Spare Dein Geld. Vielleicht kannst Du doch eines Tages in die Heimat zurückkehren und Dir hier eine Existenz schaffen, die Deiner Bildung entspricht. Ich wünschte, ich würde auch eine Anstellung im Ausland finden. Aber solche Stellen fallen nicht vom Himmel. Jedenfalls wundere Dich nicht, wenn ich Dir nach meinem einundzwanzigsten Geburtstag melde, daß ich irgendeine Stellung angenommen habe. Und bitte, schreibe mir, sooft Du Zeit hast. Ob ich Dir immer antworten kann, hängt davon ab, ob ich genügend Geld zum Frankieren eines Briefes habe. Geld ist bei mir immer rar, und Auslandsbriefe sind besonders teuer. Aber wenn ich Dir auch nicht schreiben kann — mein Herz ist immer bei Dir, lieber Heinz. Alles Glück auf Deinen Wegen!
Deine Schwester.«
Traude Karsten legte aufatmend die Feder hin, als sie den Brief an ihren Stiefbruder Heinz Rutland beendet hatte. Die beiden Stiefgeschwister liebten sich zärtlich.
Heinz Rutland war bereits zwölf Jahre, als sein Vater sich zum zweiten Mal verheiratet hatte. Von seiner Mutter wußte er nur, daß sie früh gestorben war. Er konnte sich ihrer nicht mehr erinnern, doch zuweilen huschte eine schöne glänzende Erscheinung durch seine Träume, nach der er die Arme ausstreckte, die er Mutter nannte im Traum. Die gütige, aber farblose und verblühte Frau, die sein Vater in zweiter Ehe heimführte, konnte sich mit dieser glänzenden, schönen Traumgestalt nicht messen; aber sie kam ihrem Stiefsohn freundlich entgegen, gar nicht als Stiefmutter. Und sie brachte »Traude« mit in ihre zweite Ehe.
»Traude« war ein süßes kleines Mädchen. Kaum ein Jahr verheiratet, war »ihr« Vater einem Unfall erlegen, und nach zweijähriger Trauer um diesen einst geliebten Mann nahm Traudes Mutter die Bewerbung des Ministerialrats Rutland an, um eine Versorgung für ihr vaterloses Töchterchen zu haben. Traude wurde das Bindeglied zwischen Stiefmutter und Stiefsohn. Heinz Rutland war entzückt von dem kleinen Schwesterchen, so daß er gar nicht daran dachte, sich gegen ihre Mutter aufzulehnen, und die Kleine hing sehr an ihm. Der Bruder war der Inbegriff alles Guten, Lieben und Schönen für sie. So wuchsen sie miteinander auf in der leidenschaftslosen Ehe ihrer Eltern. Herr Ministerialrat Rutland war ein äußerst korrekter und — etwas langweiliger Herr, und seine zweite Frau suchte ihren Mangel an Liebe durch Ergebenheit zu ersetzen. Heinz und Traude aber waren zu temperamentvoll für die etwas steife Atmosphäre, in der sie aufwuchsen. Der Sohn mußte oft von seinem Vater ermahnt werden, ruhiger und korrekter zu sein. Der Herr Ministerialrat pflegte seiner zweiten Frau zu sagen: »Dieses unglückselige Temperament hat er von seiner Mutter.«
Später, als Schicksalsschläge die Stiefgeschwister trafen, hielten sie erst recht fest und treu zusammen.
Heinz Rutland war Offizier, und als sein Vater und seine Stiefmutter starben, konnte er nichts für seine Schwester tun. Er mußte es geschehen lassen, daß sie bei einem Bruder ihres Vaters, dem Geheimrat Karsten, eine Unterkunft fand. Damals war Traude Karsten etwa sechzehn Jahre alt und nicht fähig, den Lebenskampf aufzunehmen. So wurde sie zu einem Gnadenbrotdasein verdammt, das sie sich zwar doppelt und dreifach verdienen mußte, das ihr aber dennoch täglich vorgeworfen und vorgerechnet wurde. Ihr Onkel und Vormund und seine Frau Agathe waren keine bösen Menschen, aber Sorgen, Nöte und Beschränkungen hatten sie kleinlich und engherzig gemacht. Tante Agathe hätte ganz gewiß keinen Dienstboten gefunden, dem sie so viel hätte aufbürden können wie Traude, und das ohne Lohn.
Wenn Traude zuweilen sagte, sie möchten sie doch gehen lassen, damit sie sich auf andere Weise ihren Lebensunterhalt verdienen könne, fragte die Tante spöttisch, was sie gelernt habe, um auf eigenen Füßen stehen zu können.
»Wäre es nicht möglich, daß ich noch irgend etwas lernen könnte?« fragte Traude eines Tages.
Da lachte der Onkel Geheimrat sarkastisch. »Wo sollen wir das Geld dazu hernehmen? Du kostest uns ohnehin genug, und wir können unseren Opfern nicht noch neue hinzufügen. Sei froh, daß du in unserem Haus unterkriechen konntest, und danke es uns. Ich bin dein Vormund und dulde nicht, daß du abenteuerlichen Plänen nachhängst. Auch will ich nicht hoffen, daß du uns eine ähnliche Blamage zufügst wie dein Bruder.«
Das war gewesen, als Heinz Rutland die Stelle eines Werkseinfahrers bei der Stemberg-Kompanie in New York angenommen hatte.
So mußte Traude bleiben und ihr freudloses Tagewerk fortsetzen. Sie verrichtete an den Vormittagen die Arbeiten eines Dienstboten, frisierte dazwischen neuerdings Tante Agathe, die Rheumatismus im Arm hatte, kochte die Mittagsmahlzeiten und saß des Nachmittags in einem engen Kämmerchen an der Nähmaschine, um für Tante Agathe und sich Garderobe zu ändern. Das halte ich nicht aus auf die Dauer, dachte sie oft. Im Geist begleitete sie ihren Bruder auf seinem Flug ins Weite und sehnte sich danach, es ihm gleichtun zu können. Sie wartete voll Ungeduld, daß sie mündig wurde. Würde sie dann den Mut und die Kraft haben, sich frei zu machen?
Seufzend erhob sie sich und klappte ihre Briefmappe zu. Sie wollte schnell noch den Brief an ihren Bruder in den Postkasten tragen. Als sie wieder heraufkam, deckte sie im Speisezimmer den Tisch und ging dann in die Küche, um das Abendessen zu bereiten.
Tante und Onkel waren von ihrem täglichen Spaziergang noch nicht zurückgekehrt. Das Leben im geheimrätlichen Haus lief wie ein präzises Uhrwerk ab. Die Tage des Onkels waren leer, denn er hatte weiter nichts zu tun, als ängstlich zu berechnen, wie er mit seiner Pension und den geringen Zinsen von einem kleinen ersparten Kapital auskommen sollte. Tante Agathe rechnete mit. Und wenn sie manchmal kalkulierten, was sie sparen könnten, wenn Traude nicht im Hause wäre, dann kamen sie zu einem recht betrüblichen Resultat.
»Aber ein Dienstmädchen würde uns noch viel mehr kosten. Sie verlangen jetzt so hohen Lohn«, sagte Tante Agathe mit seltener Einsicht.
Dem Geheimrat leuchtete das ein, und Traude blieb nach wie vor im Haus das Aschenbrödel, mußte aber nach außen immer noch die Dame repräsentieren.
Das quälte sie sehr, denn sie war ein ehrliches Geschöpf und sehnte sich nach Befreiung aus dieser Abhängigkeit. Bloß nicht mehr zur Dankbarkeit gezwungen werden!
Freudlos bereitete sie das Abendessen und trug es auf. Jeder Bissen wurde gewürzt mit der Bekanntgabe des Preises. Auch heute jammerte Tante Agathe wieder darüber.
»Was soll nur werden? Es nützt nichts, daß wir nur einmal in der Woche Fleisch essen und nur Margarine aufs Brot streichen. Was soll nur werden? Es ist eine trostlose Zeit.«
Traude taten die alten Herrschaften nun doch wieder leid; sie wußte, wie schmal ihr Einkommen war und wie rapid die Preise stiegen. Doch es war ihr furchtbar, diese Klagen anhören zu müssen. Sie trafen sie wie ein Vorwurf, und jeder Bissen quoll ihr im Munde. Sie wagte kaum, sich satt zu essen.
2
Einige Wochen waren vergangen. Traude hatte Antwort auf ihren Brief von ihrem Bruder erhalten. Er schrieb:
»Meine liebe Schwester! Deinen lieben Brief habe ich erhalten und mich sehr darüber gefreut. Es ist ein eigen Ding, wenn man so einsam und allein im fremden Land haust. Da tut ein liebes Wort von daheim Wunder. Und mein Daheim bist Du, Traude, ich habe ja sonst keinen Menschen auf der Welt, der zu mir gehört.
Und ich frage mich jetzt, da ich hier gut verdiene, täglich, was ich tun könnte, um Dich zu erlösen aus Deiner Knechtschaft. Manchmal denke ich, daß es das klügste wäre, wenn ich Dich herüberkommen ließe. Nur eins gefällt mir daran nicht: daß du hier als Schwester eines Werkseinfahrers auftreten müßtest. Für einen Mann ist das nicht schlimm, aber für Dich? Vielleicht folgst Du mir doch noch nach hier. Laß mich nur erst das Reisegeld für Dich zusammensparen.
Ich selbst habe mich sehr gut in meine neuen Verhältnisse eingewöhnt. Hier ist jeder ein Gentleman, der auf festen Füßen steht und sich gut beträgt. Man wird nicht geringer eingeschätzt, wenn man eine untergeordnete Stellung einnimmt, man muß nur ein ganzer Kerl sein. Mister Ernest Stemberg ist ein Dollarfürst, aber sein Vater kam als Klempnergeselle von Deutschland herüber und wurde ein reicher Mann. Er ist sehr stolz darauf, daß er die Millionen, die sein Vater hinterließ, noch vervierfacht hat. Seine einzige Tochter Maud, eine richtige Dollarprinzessin, hat sich gestern mit mir unterhalten. Sie kam dazu, als ich mit ihrem Vater sprach, und ließ sich von mir einen neuen Motor vorführen. Schließlich setzte sie sich neben mich, um mit mir zusammen eine Probefahrt zu machen. Und dann bat sie mich, sie gleich nach Hause zu fahren. Sie habe ihren Chauffeur weggeschickt. Die Wohnung von Mister Stemberg liegt im vornehmsten Teil New Yorks. Als ich vor dem Haus ihres Vaters anhielt und sie ausstieg, reichte sie mir die Hand.
›Mister Rutland, es war eine ausgezeichnete Fahrt‹, sagte sie lachend. ›Sie sind kein Einfahrer, Sie sind ein Gentleman. Sie haben sehr interessant mit mir geplaudert, dafür bekommen Sie Shakehands von mir. Ich bleibe nichts schuldig. Good bye!‹ Sie nickte mir zu und verschwand. Und ich, Traude, sah wie verzaubert hinter ihr her — nicht nur, weil sie ein schönes, entzückendes Geschöpf ist, sondern weil sie sich so menschlich mit einem Angestellten ihres Vaters unterhielt und ihm die Hand gereicht hatte. Vor allen Dingen aber — weil sie deutsch mit mir sprach. Wer sie kennt, ist begeistert von ihr. ›Miß Maud ist die schönste und beste Lady von New York‹, sagte ein kleiner Boy, der den Fahrstuhl bedient.
Und was sage ich? Ich weiß es nicht, Schwesterherz, weiß nur, daß ich sehnsüchtig nach ihr Ausschau halte — ich hoffe, daß sie wieder deutsch mit mir spricht. Aber, ich rede immerzu von Miß Maud Stemberg und habe doch noch anderes mit Dir zu besprechen. Also, Du willst nichts von mir annehmen und auch Deinem Bruder nicht verpflichtet sein. Das lasse ich mir einfach nicht gefallen. Ich sende Dir heute erst einmal einige Dollars. Die kann ich jetzt sehr gut entbehren, und für Dich ist es immerhin so viel, um Dich ein wenig flottzumachen. Ich möchte, daß Du Dir für das Geld einen warmen Wintermantel kaufst. Dazu wird es reichen und auch noch für einige Tafeln Schokolade, die Du doch immer so gern gemocht hast. Betrachte die Dollars als Geburtstagsgeschenk. Du bist nun mündig, und Onkel Karsten kann Dich nicht mehr festhalten, wenn Du Dich nicht festhalten lassen willst. Ich denke, Du kommst nach New York herüber, sobald ich das Reisegeld zusammen habe. Du brauchst mir gar nicht auf der Tasche zu liegen, Traude, hier findet sich auch etwas für Dich, wo Du verdienen kannst. Laß mich nur sondieren. Und schreib mir bald, für das nötige Porto sorge ich schon. Ich freue mich so sehr, wenn ich von Dir höre.
Sei herzlich und innig gegrüßt von Deinem
Bruder Heinz.«
Traude Karsten hatte diesen Brief ihres Bruders immer wieder durchgelesen. Und einige Tage später, an ihrem Geburtstag, traf das Geld ein. Über diese Geldsendung gab es große Aufregung, Onkel und Tante konnten es nicht fassen, daß »der Chauffeur« seiner Schwester ein Geburtstagsgeschenk in solcher Höhe machen konnte.
Traude sah ihr armseliges Wintermäntelchen an. Es sah freilich sehr fadenscheinig aus, und sie konnte einen neuen Mantel gut gebrauchen.
Sie beschloß, gleich auszugehen und sich Stoff für einen Mantel zu kaufen. Nähen wollte sie ihn selbst, dann bekam sie etwas Solides, und es wurde billiger. Sie teilte Tante Agathe ihren Entschluß mit. Diese atmete tief auf.
»Ich kann dich heute nicht begleiten, Traude, du weißt, daß ich mir den Fuß verletzt habe. Warte ein paar Tage, bis ich mitgehen kann.«
Aber Traude fieberte danach, einmal allein einkaufen zu können und nach eigenem Geschmack. Es war ihr einundzwanzigster Geburtstag, und sie fühlte einen Drang nach Selbständigkeit. So war sie froh, daß Tante sie nicht begleiten konnte.
»Ich möchte lieber heute gehen, Tante Agathe, die Preise steigen täglich, und was ich haben möchte, kostet morgen vielleicht mehr.«
Also machte sich Traude auf den Weg, nachdem sie pflichtgetreu ihre Arbeit beendet hatte. Sie trug ein hübsches, von ihr selbst gefertigtes Kostüm von dunkelgrauer Farbe. Es sah gediegen und vornehm aus. Traude war eine von den Frauen, bei denen auch der schlichteste Anzug elegant wirkte.
In einem renommierten Geschäft erstand sie einen schönen flockigen Wollstoff, nachdem sie den Schreck über die hohen Preise überwunden hatte. Mit ihren Schätzen beladen, machte sie sich auf den Heimweg, wartete auf die Straßenbahn. In diesem Augenblick fuhr ein Auto so schnell um die Ecke, daß sich Traude, von dem Auto gestreift, nur durch einen Sprung retten konnte, wobei sie ihre Pakete verlor. Der Insasse des Autos hatte das bemerkt. Er ließ sofort anhalten, sprang aus dem Wagen und hob Traudes Pakete auf. Sie waren auf der feuchten Straße schmutzig geworden.
»Ich bin untröstlich, gnädiges Fräulein, daß mein ungeschickter Chauffeur Sie angestoßen hat. Sind Sie verletzt?« fragte der Fremde besorgt.
Traude hatte ihren Schreck schnell überwunden, und wenn sie auch ein wenig bleich geworden war, lächelte sie doch schon wieder. »Es war nicht schlimm, und Ihren Chauffeur trifft keine Schuld. Ich war unachtsam, weil ich nach der Straßenbahn Ausschau hielt.«
Der etwa in der Mitte der Dreißig stehende Herr konnte seine Augen nicht von Traude losreißen. Dies feingeschnittene Gesicht mit dem klaren Teint, das von leicht gelocktem Haar umrahmt war, entzückte ihn. Und noch mehr entzückte ihn das reizende Lächeln. Er sah sie an wie hypnotisiert.
In dem Moment kam die Straßenbahn, sie war aber völlig besetzt. Für Traude war kein Platz, sie mußte auf die nächste warten.
Der Fremde blickte auf ihre beschmutzten Pakete hinab und richtete sich entschlossen auf.
»Gnädiges Fräulein, mit diesen schmutzigen Paketen kann ich Sie unmöglich gehen lassen.« Er legte ihre Pakete einfach in seinen Wagen und öffnete den Schlag. »Bitte, steigen Sie ein. Mein Chauffeur wird Sie nach Hause fahren. Ich bin gleich am Ziel und kann die wenigen Schritte gehen.«
Traude sah unschlüssig auf ihre Pakete, die schon im Wagen verstaut waren. Der junge Herr sah sie mit seinen grauen, auffallend hell leuchtenden Augen bittend an.
»Ich weiß nicht, ob ich das annehmen darf, mein Herr.«
»Darüber besteht doch kein Zweifel. Wie soll ich sonst die Ungeschicklichkeit meines Chauffeurs gutmachen? Bitte, steigen Sie ein, wenn Sie mich nicht tief beschämen wollen.«
Er sprach so korrekt deutsch, daß sie annahm, er müsse Amerikaner oder Engländer sein. Er dankte ihr mit einer Verbeugung, daß sie seinen Wunsch erfüllte. Dann wandte er sich an den Chauffeur.
»Sie fahren die Dame nach Hause und holen mich dann bei Schwäb und Kompanie ab. — Bitte, Ihre Adresse, gnädiges Fräulein.«
»Goethestraße 20«, sagte Traude, noch immer unschlüssig und beklommen.
Er trat mit einer tiefen Verbeugung zurück und sah dem Wagen nach. Dann ging er, in tiefe Gedanken verloren, weiter.
Traude saß inzwischen mit gemischten Gefühlen in dem Auto. Schön war so eine Autofahrt, wenn es auch nur ein Mietauto war, in dem sie saß. Sie dachte bei sich, wie teuer so eine Fahrt wohl sein mochte. Sicher kostete sie viel Geld.
Jäh stieg ihr Röte ins Gesicht. Du lieber Himmel! Sie konnte sich doch von dem Fremden nichts schenken lassen. Wie hatte sie nur einsteigen können? Freilich — er hatte ihr keine Wahl gelassen, ihre Pakete lagen im Wagen, ehe sie es sich versah.
Das Herz klopfte ihr, wenn sie an seine Augen, seinen Blick dachte, der sich so tief in die ihren gesenkt hatte. Sie wußte, diese Augen, diesen Blick würde sie nie vergessen — niemals. —
Mußte sie nicht dem Chauffeur die Fahrt bezahlen? Was mochte sie kosten? Verstohlen zählte sie ihre Barschaft nach. O ja — das reichte auf alle Fälle. Hin und her gerissen sah sie immer wieder begeistert um sich. Das war ein herrlicher Geburtstag — so anders als andere Tage! Sie hatte einkaufen können, als sei sie reich, hatte noch soviel Geld in ihrer Handtasche, wie sie lange, lange nicht mehr besessen hatte. Und nun fuhr sie auch noch im Auto — nach der interessanten Begegnung mit dem Fremden. Wenn aber Onkel und Tante sie im Auto kommen sahen, gab es einen Aufstand, das war sicher. Und wenn sie ihnen erzählte, daß ein fremder Mann sie habe nach Hause fahren lassen, dann gab es Vorwürfe — ganz gewiß. Doch was tat es — schön war dieser Tag doch!
Gleich darauf bog der Wagen in die bescheidene Goethestraße ein und hielt vor dem Haus, in dem Geheimrat Karsten wohnte. Traude sah zu den Fenstern empor. Richtig, Tante Agathe saß hinter der Gardine und starrte mit ungläubigen Augen auf sie herab.
Ehe Traude ihre Pakete an sich nahm, trat sie an den Chauffeur heran. »Was habe ich zu zahlen?« fragte sie und erwartete herzklopfend den Bescheid.
»Ich bin von dem amerikanischen Herrn für den ganzen Tag engagiert, und er hat mir befohlen, das gnädige Fräulein nach Hause zu fahren. Also habe ich in seinen Diensten gestanden und nichts zu verlangen.«
»Der Herr ist Amerikaner?«
»Jawohl. Ich stehe ihm schon seit Wochen zur Verfügung.«
»Es ist mir so peinlich, daß Sie keine Bezahlung annehmen.«
»Na, darüber machen Sie sich besser kein Kopfzerbrechen. Der Amerikaner scheint viele Dollars zu haben, dem macht das nichts aus. Und ob ich eine Stunde auf ihn warte oder Sie nach Hause fahre, ist ganz gleich.«
Traude atmete auf und reichte dem Chauffeur etwas Geld. »Dann nehmen Sie wenigstens als Trinkgeld, was ich für die Straßenbahn hätte zahlen müssen. Und bitte, sagen Sie dem Herrn, daß ich nochmals danken lasse.«
»Das werde ich bestellen. Soll ich Ihnen die Pakete ins Haus tragen, weil sie schmutzig geworden sind?«
»Nein — danke, das Papier ist schon trocken, es macht nichts.« Traude nahm ihre Pakete und ging ins Haus. Gar zu gern hätte sie den Chauffeur gefragt, ob er den Namen des Amerikaners wisse, aber sie wagte es nicht.
Aufatmend stieg sie die Treppe empor. Tante Agathe stand schon an der geöffneten Wohnungstür. Ihr Gesicht war ein einziges großes Fragezeichen. Dann aber kam es in überstürzter Hast aus ihrem Munde:
»Traude, du bist wohl nicht bei Trost? Im Auto zu fahren ist doch ein sträflicher Leichtsinn.«
Während sie das hervorstieß, war ihr Mann auf den Korridor getreten.
»Ich muß Tante recht geben, es ist sträflicher Leichtsinn — du hast wohl ein Vermögen bezahlen müssen?« fragte der Onkel mit strafender Miene.
Traude mußte nun doch lachen, sie konnte sich nicht heilen. »Das Auto hat nichts gekostet, Onkel, nur ein Trinkgeld für den Chauffeur.«
»Was soll das heißen?«
Doch Traude war nicht aus ihrer Geburtstagsstimmung zu bringen.
»Ein Prinz ist dem armen Aschenbrödel begegnet und hat es in seinem goldenen Wagen heimfahren lassen. Ich bin wirklich umsonst im Auto nach Hause gefahren. Der Prinz war ein Dollarfürst oder was weiß ich, und er hat mich ganz dringend gebeten, seinen Wagen zu nehmen. Ist das nicht wie ein Märchen?«
»Mir scheint, du willst ungehörige Scherze mit uns treiben«, schalt Tante Agathe.
»Komm herein und erklär uns das«, gebot der Onkel.
Traude nahm ihre Pakete und folgte ihm. Im Wohnzimmer legte sie diese auf den Tisch und erzählte von ihrem kleinen Unfall und der Ritterlichkeit des Amerikaners.
Tante Agathe war außer sich. »Ich bitte dich, Traude, wie konntest du nur? Wenn das ein Bekannter beobachtet hätte, daß du dich mit einem fremden Herrn unterhältst, gar in seinem Wagen davonfährst! Ich hatte doch gleich so eine Ahnung, als dürfe ich dich nicht allein fortgehen lassen.«
»Es ist keinesfalls korrekt gewesen, daß du von einem Fremden eine solche Gefälligkeit angenommen hast«; sagte der Onkel salbungsvoll. »Ich muß dich sehr tadeln, Traude. Wir müssen froh sein, daß er dir nie mehr begegnen wird. Das ist der einzige Trost.«
Traude fand es durchaus nicht tröstlich, daß sie ihren Märchenprinzen nie wiedersehen würde. Sie hätte es nur zu gern getan.
Sie dachte nur, wie eng begrenzt der Horizont der Alten doch war, daß sie aus solch geringem Anlaß so viel Worte machten. Seufzend atmete sie auf, als der Sturm sich gelegt hatte, und Tante Agathe sagte:
»Nun zeig nur, was du gekauft hast.«
Traude packte den Mantelstoff aus und auch ihre anderen kleinen Einkäufe. Natürlich fand nichts den Beifall der alten Dame. Sie behauptete, daß sie alles billiger und besser eingekauft hätte.
»Wieviel hast du denn um Gottes willen ausgegeben?« fragte sie.
Traude zeigte, was sie noch besaß. Nun ging ein neues Lamento los. Der Onkel zog sein Gesicht von neuem in strenge Falten.
»Es ist unglaublich, Traude. Gib mir den Rest in Verwahrung.«
»Nein, Onkel, das Geld behalte ich. Ich will auch einmal das Gefühl haben, etwas Geld zu besitzen. Ich bin doch kein Kind mehr. Hätte ich einen billigeren Stoff gekauft, hätte er nicht lange gehalten. Solides war nicht billiger zu haben.«
»So — und die Schokolade? Mußtest du gleich zwei Tafeln davon kaufen?«
»Die eine Tafel ist für Tante Agathe bestimmt — und dies ist ein Päckchen Tabak für dich. Eine kleine Freude wollte ich euch doch auch gern machen.« Dann wurde Traude ungeduldig und rief: »Ich bitte euch, hört endlich auf zu schelten, ich kann es nicht länger anhören!«
Da sahen sie die beiden an, als hätte sie etwas Furchtbares gesagt.
»Ist das der Dank für alles„ was wir für dich getan haben?« fragte Tante Agathe empört.
Traudes Lippen zuckten. »Verzeiht, daß ich ungeduldig wurde, aber schließlich ist heute mein Geburtstag — mein einundzwanzigster —, und ich möchte an diesem Tag gern auch etwas anderes hören als nur Vorwürfe. Warum laßt ihr mich nicht fort?«
»Weil du eine Karsten bist und nicht in der Welt herumstreichen kannst. Das verpflichtet dich. Womit willst du denn dein Brot verdienen? Es gibt für eine Dame aus unseren Kreisen nur zwei Berufe, die sie ergreifen kann, den einer Gesellschafterin oder den einer Krankenpflegerin.«
»Onkel, dazu hätte ich keine Lust und keine Begabung. Ich könnte Menschen, die ich liebe, mit der größten Aufopferung pflegen, aber nicht Fremde, die mir gleichgültig sind.«
»Nun also, was willst du sonst tun?«
Traude schwieg. Aber sie hatte sich endgültig vorgenommen, sich aus diesen Fesseln zu lösen.
Es war zwei Tage später. Traude hatte, nachdem Onkel und Tante den üblichen Spaziergang angetreten hatten, Zeit gefunden, die Zeitung durchzusehen.
Heute blieb ihr Blick wie hypnotisiert auf einer großen fettgedruckten Annonce haften, die folgenden Inhalt hatte:
»Gesucht wird junges, gebildetes Mädchen aus guter Familie, das geneigt ist, als Begleiterin einer Dame, Deutsche von Geburt, nach Südamerika zu gehen. Die Bewerberinnen müssen alle Fertigkeiten einer geschickten Zofe haben, gewandt und sicher im Auftreten sein. Sprachkenntnisse, hauptsächlich in Englisch und Spanisch, erwünscht, doch nicht Bedingung. Alter Anfang Zwanzig. Auf sympathisches angenehmes Äußeres wird Wert gelegt. Hohes Gehalt, freie Reise und anständige Behandlung werden zugesichert. Bedingung: Tadellose Umgangsformen und gute Erziehung. Schriftliche Offerten an Señora Guarda, Grand-Hotel.«
Traude starrte auf dies Inserat. Das war eine Stellung wie für sie geschaffen. Und daß es ins Ausland, nach Südamerika gehen sollte, war ihr gerade recht.
Es schien sich um eine Stellung bei einer vornehmen Dame zu handeln. Onkel und Tante würden natürlich außer sich sein. Eine Karsten — und Zofe! — Kurz entschlossen setzte sich Traude zum Schreiben nieder.
»Sehr geehrte, gnädige Frau!
Bezugnehmend auf Ihr Inserat in der heutigen Zeitung erlaube ich mir, Ihnen meine Dienste anzubieten. Ich bin einundzwanzig Jahre, gesund und kräftig, bin imstande, elegante Damengarderobe in Ordnung zu halten, eventuell auch anzufertigen. Frisieren kann ich auch. In der englischen und französischen Sprache kann ich mich geläufig ausdrücken, in der spanischen leider nicht. Ich habe die übliche höhere Töchterschulbildung erhalten. Daß ich mich vor keiner ehrlichen Arbeit scheue, möchte ich besonders betonen. In Stellung war ich noch nicht. Ich bin Waise, lebe im Hause meines Onkels, eines pensionierten höheren Beamten, und bin von dem Wunsch durchdrungen, auf eigenen Füßen zu stehen, um meinen Verwandten die Sorge um mich abzunehmen. Wenn Sie mich engagieren wollen, werde ich mir die größte Mühe geben, Sie zufriedenzustellen, und würde Ihnen sehr dankbar sein. Jederzeit bin ich bereit, mich Ihnen persönlich vorzustellen.
Mit vorzüglicher Hochachtung Traude Karsten.«
Aufatmend las Traude noch einmal durch, was sie geschrieben hatte. Es gefiel ihr gar nicht. Aber bei der Wahrheit mußte sie bleiben. Und so ließ sie den Brief, wie er war, und schickte ihn ab.
Voll Unruhe wartete sie fortan auf Antwort. Und schon am übernächsten Morgen überreichte ihr der Briefträger, dem sie jetzt bei jeder Post auflauerte, ein Schreiben, und sie las es erst, als sie in ihrem Stübchen war. Das Schreiben lautete: