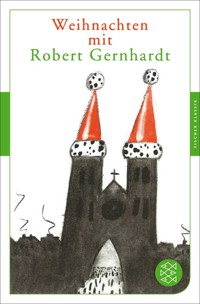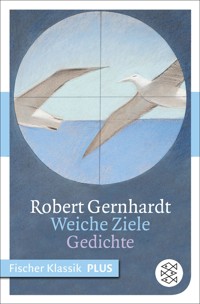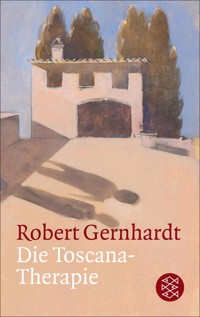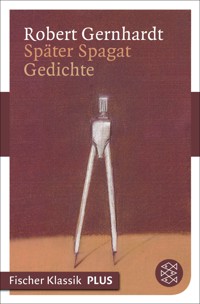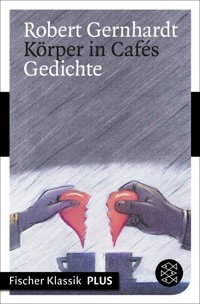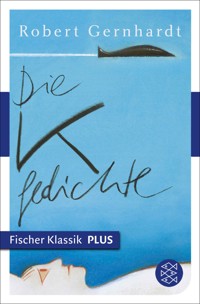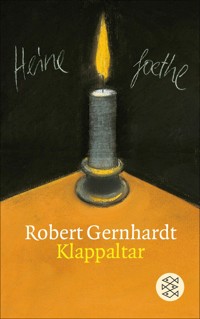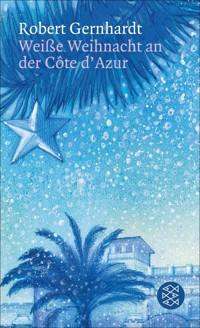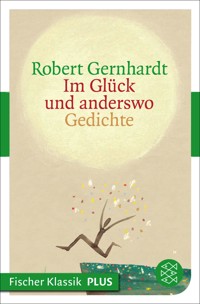
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
Lyrik, die glücklich macht In seinem umfangreichsten Gedichtband ›Im Glück und anderswo‹ entfaltet Robert Gernhardt das Leben in all seinen Facetten: das Glück von Liebe und Freundschaft, die Freude an der Natur, das Leid von Mensch und Tier. Ob Sonett oder Blues, Ballade oder Parodie – Robert Gernhardt spielt dabei virtuos auf der gesamten Klaviatur der Dichtkunst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 114
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Robert Gernhardt
Im Glück und anderswo
Gedichte
Fischer e-books
I Im Glück
Rede vom Glück
Wie übers Glück reden?
Wenn das einmal glückte:
Wäre das nicht das Glück?
Mir glückte es nie,
das Glück zu beschwören
ohne Unglücksgrundierung.
Als ob das Glück,
um zu glücken, bedürfte
der Folie des Unglücks.
Braucht nicht das Unglück
vielmehr das Glück,
das Mißglücken das Glücken?
Der Wortstamm ist: Glücken.
Mißglücken, Nichtglücken:
Verunglückte Zweige,
Glücklose Triebe
auf glückhaft wurzelndem
Grundglück.
Vor allem Unglück
war Glück. Vor allem
Mißglücken glückte es.
Ihr glücklichen Tage!
Nur wen ihr beglückt,
der kennt glücklose Nächte.
Wir glücklichen Menschen!
Vor unserem Glück erst
erstrahlt hell euer Unglück.
Schlafenszeit
Reck ich die Hand,
ist da ein Hund.
Streck ich den Fuß,
ist da ein Katz.
Dreh ich den Kopf,
ist da ein Du:
So hat ein jedes seinen Platz.
Nach der Nacht
Glücklicher Morgen: Wir in der Sonne
Unter uns Nebel, über uns Vögel
Zwei graue Reiher auf geradestem Wege
Im Gleichschlag der Flügel
Im Gleichtakt des Fluges
Aus tiefem Blau in weit fernere Bläue.
Der glorreiche 29. April 2000
Der Tag beginnt mit Gleißen.
Mag meinen Blick nicht wenden.
Solch Gleißen will verheißen:
So wird der Tag auch enden.
Die Bäume läßt ein Wehen
erst zittern, dann erbeben.
Solch Wehen hilft verstehen:
Deshalb lohnt es, zu leben.
Den Sandstrand netzt das Fluten
ganz leicht bewegter Wellen.
Solch Fluten läßt vermuten:
Hier sitzt man an den Quellen.
Die Abendröte spiegeln
schön schwarzgefaßte Seen.
Solch Spiegeln mag besiegeln:
Heut nacht kann es geschehen.
Auf Rügen
Abends
Das Meer bricht sich matt am Strand.
Vom Land bläst ein kräftiger Wind her.
Tiefblaue Schauer eilen über das Meer
und verlieren sich auf dem Weg zum Horizont.
Die Dämmerung läßt sich viel Zeit.
Immer dunkler wird das erschauernde Meer.
Zag blinkt ein Licht von weit her.
Wer noch am Strand ist, beschleunigt seinen Schritt.
Bald wird das Meer tiefschwarz sein.
Schon ist der Strand fast menschenleer.
Ohne Licht macht das Meer nicht viel her,
macht nur noch »slosch«, wenn es sich matt am Strand bricht.
Morgens
Rechts fabelhaftes Glänzen.
Es ist nicht anzusehen!
Dann lieber links das Blau im Blick,
vor dem schwarz Menschen gehen.
Sie werfen lange Schatten,
teils einzeln, teils zu zweien.
Ihr Weg führt sie durch Naß und Sand,
was Möwen laut beschreien.
Im Flug vier wilde Schwäne!
Es ist kaum auszuhalten:
Für einen Augenblick scheint ganz,
was heillos sonst gespalten.
Kurzer Aufenthalt in und um Krems A.D. Donau I.D. Wachau
Einer von jenen gesegneten Landstrichen.
Gesegnet mit Fluß, mit Hügeln gesegnet,
mit Wein auf den Hügeln, gesegnet mit Sonne,
die mir auf den Pelz brennt.
Gesegnet mit Orten, die Orte gesegnet
mit Toren und Türmen, gesegnet mit Plätzen,
mit leeren und andren, gesegnet mit Menschen,
die mir gelassen nachschaun.
Gesegnet mit Stille, mit Bäumen gesegnet,
mit Vögeln in ihnen, gesegnet mit Zwitschern,
mit Enten am Fluß gesegnet, mit Schnattern
entbieten sie mir ihren Gruß:
Gesegnet seist du, Fremder, in Krems,
mit einem Bahnhof gesegnet, mit Zügen.
Gesegneter Zug, der dich hertrug. Er trag dich
marsch, marsch zurück zu den andren Verdammten.
Alles über den Sonnenuntergang vom 3. Juli 2001
Wir da oben. Die da unten.
Kennen nicht die Neun-Uhr-Sonne.
Neun? Ich sprech von neun Uhr abends.
Woran hatten Sie gedacht?
Sie da unten. Wir da oben.
Rückgelehnt auf unsern Sitzen.
Golden wärmt die Neun-Uhr-Sonne
uns im Licht. Nicht euch im Schatten.
Ihr im Schatten. Wir hier oben,
wo die Neun-Uhr-Fünfzehn-Sonne
nicht mehr wärmend, noch vergoldend
herrlich allen Horizont frißt.
Sie am Sinken. Wir am Recken,
bis die Sonne neun Uhr zwanzig
uns zurückläßt, wo ihr längst seid:
Ihr im Schatten. Wir im Schatten.
Lob der Bescheidung
Natürlich gibt es auch den Pavillon am Meer.
Auf Säulen ruht sein Dach. Von ihnen eingerahmt,
erstrahlt was irgend des Planeten Schönheit ausmacht:
Land, Wasser, Luft.
Natürlich kühlt nicht jeden solch ein Pavillon.
Doch künden Gartenlauben rings um den Planeten
davon, daß Menschen sich das Glück was kosten lassen:
Geld, Liebe, Zeit.
Natürlich hat nicht jeder eine Gartenlaube.
Doch bietet vielen der Planet etwas. Im Fenster
genießen sie an warmen Abenden den Dreiklang:
Lärm, Abgas, Stein.
Natürlich scheints dem Menschen, so sich zu bescheiden,
daß er nicht mehr verlangt, als ihm das Leben zuteilt.
Wie anders sollte der Planet sie alle fassen:
Reich, nicht reich, arm dran?
Verfluchung dreifach
Ein dreifach Fluch der Makellosigkeit:
Fluch erstens, weil sie einfach ohne Makel.
Fluch zweitens, weil sie zwiefach den verwirrt,
der Makel bisher teils nicht sah, teils schluckte.
Fluch drittens, weil das Leben weitergeht.
Was soll dem da die makellose Trias
von letztem Licht, von Frau und warmer Nacht,
der tags darauf doch weitermachen muß,
so, wie er bisher lebte: makelvoll–?
II Im Licht
Wetterlehrgedicht
Da fängt wieder so ein goldener Tag an.
Wird er wohl auch so golden enden?
Ich lasse ihn auf mich zukommen.
Kann ihn sowieso nicht ändern.
Mit dem Wetter ist kein Bund zu schließen.
Darauf, daß es schön bleibt, sollte man nicht wetten.
Lob und Tadel kratzen es nicht groß.
Warum also dagegen wettern?
Schlechtes Wetter geduldig wegstecken.
An gutem sich stillvergnügt laben.
Aus allen Wettern das Beste machen.
Und nie über das Wetter labern.
Montaieser Mittagsgedichte
Ins Grün starrn. Es scheint dem Menschen eigen,
daß er ins Grün starrt. Das Grün läßt ihn schließen
auf Vögel, auf Tiere, auf Früchte, auf Wasser,
auf Essen und Trinken. Aufs Überleben.
Die Nester, ich raub sie nicht aus, die Tiere,
ich töte sie nicht. Die Früchte, das Wasser
kauf ich im Laden. Und sitz doch und starre
verzückt in das Grün und kann mich nicht lösen
vom leicht bewegten Versprechen: Du findest
hier Vögel und Tiere, Mensch, und Früchte
und Wasser und Schatten der Erde und starrend
vor Grün einen Ort, da überlebt sichs.
Als ich bei Tisch das Glas ergriff,
war das zu rasch getan.
Vier Tropfen fielen auf den Stein,
da sah der Tod mich an.
Vier Flecken Wein auf Ziegelstein,
das macht zwei Augen und
darunter einen Nasenpunkt
und unter dem ein Mund.
Die Augen wie zwei Höhlen starr,
die Nas wie abgehaun,
der Mund, wie wenn er sprechen wollt:
da spürte ich ein Graun.
Ich wischte rasch die Flecken weg
und hob das Glas zum Mund.
Da fiel mir jener andre ein,
der nicht mehr sprechen kann.
Der vor drei Jahren auf den Tag
am nahen Meer verstarb.
Ich trank und dachte mir: Er fehlt
und fehln wird er hier immer.
Habe Stimmen im Kopf,
sollte sie reden lassen.
Hörend pack ich sie beim Schopf.
Schreibend kann ich sie fassen.
Stehn sie erst auf dem Papier,
seh ich das Jubeln, das Hassen,
das Raunen der Stimmen vor mir.
Sie sprechen von mir und für sich,
aus ihnen stöhnt Engel, tönt Tier:
Mich lesend, erfahre ich mich.
Was einer sieht, was einer hört,
das ist nicht einerlei.
Ich sehe schiere Schönheit, doch
ein Piepen ist dabei.
Schön bist du, Licht. Schön bist du, Land.
Wie schön, daß es euch gibt!
Wie unschön, daß ein steter Schall
euch sowie mich bepiept!
Der Schall, der dringt vom Steinbruch her.
Dort stehn Geräte groß.
Die fressen sich mit aller Macht
in Mutter Erdes Schoß.
Ich sehe diese Schändung nicht,
ich höre bloß von ihr.
Ich blick in schiere Schönheit, doch
das Piepen dringt zu mir.
Das Piep, Piep, Piep war taglang still.
Vielleicht, weil mans vergaß.
Vielleicht, weil das das Piepen ließ,
was sich ins Erdreich fraß.
Jetzt aber piepts und teilt mir mit:
Was immer du beschaust
an schönem Schein, er schützt dich nicht
vor dem, wovor dir graust.
Vor Macht, vor Gier, vor Geld vor Recht,
vor Kraft, Dreck, Staub und Schall:
Blick du nur lieb ins schöne Grün -
uns gibt es überall.
Schon um das Eck siehts anders aus:
Unschön und ungeliebt.
Du kannst und willst davon nichts sehn?
Dann wirst du halt bepiept.
Ich bin ein schwerer, alter Herr,
mein Herz ist leicht und jung.
Das war schon einmal umgekehrt,
sagt die Erinnerung.
Denk, wie du auf der Mauer standst!
Ein Foto hielt es fest.
Du warst ein Strich, Bub, was sich von
dem Herz nicht sagen läßt.
Dein Herz war wund. Dein Herz war schwer.
Es sehnte sich nach Ruh.
Daß du nicht von der Mauer sprangst,
verwundert heut noch. Du
hast damals nicht auf dich gesehn.
Hast nur aufs Herz gehört.
Was dich am Leben halten sollt,
hätt dich ums Haar zerstört.
Dein Körper hielt dem Herzen stand.
Das arme Herz genas.
Verdenke deinem Körper nicht,
was der zusammenfraß
aus Freude, daß das schwere Herz
ihn nicht nach unten zog.
Er fraß und fraß, bis daß er selbst
mehr als das Herze wog.
Wenn er heut auf die Mauer tritt,
wird ihm ums Herz so leicht:
Mir ist, als ob ich fliegen könnt!
Wohl dem, der das erreicht.
Was hat die Linde denn davon,
daß ich sie rieche?
»Wer net dumm froagt, bekommt koa Antwort«,
sagt der Grieche.
War das der Grieche? War es nicht
vielmehr der Bayer?
»Mensch, Schnaps ist Schnaps, und Dom ist Dom«,
sagt man in Speyer.
War das in Speyer? War es nicht
vielmehr in Chartres?
»Macht zu! Was quält ihr euch?« sprach Petrus
auf der Marter.
War das der Petrus? War es nicht
vielmehr – ich finde
grad keinen Schluß – »Macht nichts, ich find ihn«,
sagt die Linde.
Mein Gott, bist du mir fremd. Du Tier
bist unverbindlich, kommst, und ich
begreif nicht, was dich kommen hieß,
frag mich, wann du wohl gehst.
Du lebst dein Leben, ich leb meins.
Zu Zeiten gibt es Brot und Wein
für mich. Und Dosenfleisch für dich
und Schweigen und Gefühle.
Du schweigst. Ich fühl. Und manchmal hoff
ich schweigend auf Gefühle, die
du mir entgegenbringst fürs Fleisch,
das ich dir täglich reiche.
Mein Gott, ja! Es ist Dosenfleisch!
Herrgott ja! Es gibt Besseres!
Gibt Putenbrust und Hühnerklein,
gibt Leber, Milz und Herz.
Tier! Sind wir jetzt auf dem Niveau?
Ich schrei dich an. Du schweigst dich aus,
bleibst fremd und stumm und undankbar,
erhebst dich, gähnst und gehst.
Woher du kamst? Ich weiß es nicht.
Wohin du gehst? Gott weiß wohin.
Ich sag mir: Mensch, das weiß, wo's langgeht.
Tier, ich bedanke mich bei dir!
Das Reißen
der heißen
Pinienzapfen im Ohr
Das Schwanken
der ranken
Olivenbäume vor Augen
Das Zittern
der bittern
Kapernfrüchte auf der Zunge
Das Walten
des alten
Chiantiweins im Hirn
Das Nagen
des zagen
Abschiedsschmerzes im Herzen:
Ein Narr, wer in der Volksküchen ißt!
Fehlte der Wiedehopf,
fehlte noch mehr:
Fehlte ein steter Ruf
fehlte ein rascher Flug
fehlte ein lichtes Braun
fehlte schwarz-weißes Flirrn
fehlte dieses
ganz einzigartig
mitreißend Fremde
fehlte dies Anderssein
fehlte dies Ich bin ich
fehlte dies Sei wie ich
fehlte dies Ihr könnt mich
fehlte dies Du bleibst du
fehlte dies Upupu
fehlte sein heller Kopf
fehlte sein greller Schopf:
Fehlte der Wiedehopf.
Weiss auf weiss
Wenn sich regennaß die Dolde
der Akazie, blütenweiß,
derart senkt, daß des Holunders
blütenweißer Teller sich
derart der Gesenkten annimmt,
daß vor lauter Blütenweiß
niemand weiß: Was hängt, was stützt da?
Ist nur eins klar: Dies Vermischen
weißer Blüten ist das reine
Gegenteil von allem Sagen,
allem Deuten, allem Schreiben,
denn es zeigt nur. Und man kann da
nichts getrost nach Hause tragen,
weiß auf weiß.
Eine schöne Vorstellung
Gesetzt, die Sonne stünde hoch,
so hoch, daß Pinienschatten schützt.
Gesetzt, es zög von Stamm zu Stamm
sich eine Schnur, nicht ungenützt.
Gesetzt, dran hing ein Tuch, nein zwei,
bewegt von traumhaft warmem Hauch.
Gesetzt, die Tücher klafften auf;
dann sähst du, was ich sähe auch:
Der Feige Blattwerk, schön durchleuchtet,
Goldgrün von Zweigen schwarz gefaßt,
umrahmt vom Gleißen des Olivgrüns,
das sich im Tal verliert, wo klar
der See mit Spiegelgrün auftrumpft
von Tanne, Weide, Wein, Zypressen,
dahinter, schattig terrassiert,
Gelände ansteigt, bis zum Kamm
mit Wald besetzt, gesäumt von Kiefern.
Und dazu käm noch:
Ich röche, rieche Pinienduft,
Ich sähe, sehe Wirklichkeit,
Ich hörte, höre Weihenschrei,
Ich fühlte, fühle Hiesigkeit,
Ich spürte, spüre Fächelwind,
Ich dächte, denke Endlichkeit.
Und auch das wär noch nicht alles:
Ach, all das übersteigt ein Blau,
so unerhört dem Hügelkamm
klar hinterlegt, dem Wolkenglanz
und auch den Tüchern, die, gesetzt,
sie schlössen sich, doch, so entgrenzt,
erahnen ließen, welche Pracht
der sähe, der sie teilte.
Lob des Alleinseins
Süße des Alleinseins. Niemand
Da, der dir versalzen könnte
Deine Freude beim Beschauen
Beim Bedenken, beim Beschweigen
Schaut und denkt und schweigt am besten
Wer sich sicher weiß: Hier, nimmt mir
Niemand des Alleinseins Süße.
Über die Unmöglichkeit von der Stille zu reden
»Wie still es hier ist! Keine andren Geräusche
als Murmeln des Baches und Summen der Bienen
und Singen der Vögel!«
»Und eine Stimme, die redet von Stille,
vom Murmeln des Baches, vom Summen der Bienen,
vom Singen der Vögel. Und übertönt sie.«
30. Juni 1997, zwölf Uhr mittags
Daß ich des nicht vergess' -
doch wie's behalten?
Da lag der Hund im Gras
Ich saß daneben
Gefleckt der Hund, der Herr
Vom breiten Schatten
Des Aprikosenbaums, aus dem ich eben
Noch Frucht um Frucht geholt
Vollreif und handwarm.
Da kam der Wind vom Berg
Und brachte Kühlung
Gekräuselt tief im Tal
Der kleine Stausee
Kaum sichtbar, so versteckt in den Oliven
Hielt er doch aller Welt
Ihr Blau vor.
Da krault die Hand den Hund
Worauf der seufzend
Dem selbstvergeßnen Herrn
Die Kehle darbot:
Dies eine Seufzen lang war in der Schwebe
Die Waage dieses Tages
Wenn nicht Jahres.