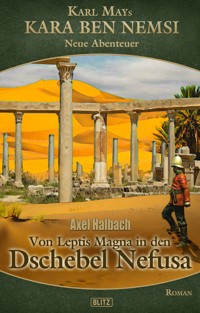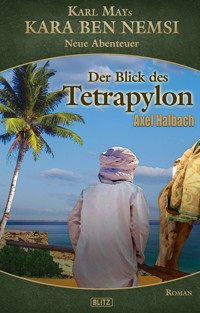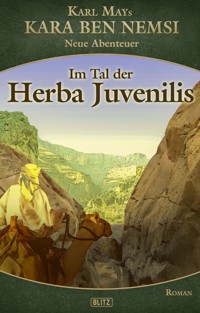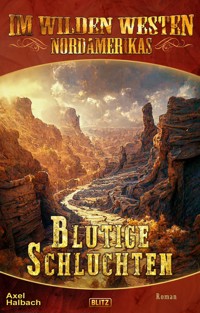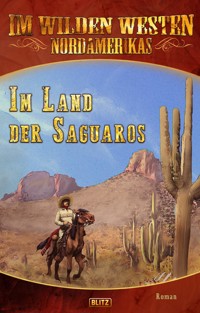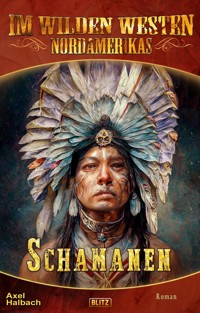Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Im Wilden Westen Nordamerikas (Neue Abenteuer mit Old Shatterhand)
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Old Shatterhand reist von Mexiko nach New Orleans, um sich dort mit seinen Freunden Sam Hawkens und Hobble-Frank zu treffen. Dabei trifft er auf eine Bande, die drei Ziele verfolgt: illegalen Waffenhandel mit Indianerstämmen zu treiben, einer rechtmäßigen Erbin ihr Hab und Gut zu entziehen und eine Goldgräber-Karawane aus Kalifornien zu überfallen.Old Shatterhand steht mit seinen Gefährten vor einem außergewöhnlichen Abenteuer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 281
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Im Wilden Westen NordamerikasBLOODY FOX
In dieser Reihe bisher erschienen
2201 Aufbruch ins Ungewisse
2202 Auf der Spur
2203 Der schwarze Josh
2204 In den Fängen des Ku-Klux-Klan
2205 Heiße Fracht für Juarez
2206 Maximilians Gold
2207 Der Schwur der Blutsbrüder
2208 Zwischen Apachen und Comanchen
2209 Der Geist von Rio Pecos
2210 Fragwürdige Gentlemen
2211 Jenseits der Grenze
2212 Kein Glück in Arizona
2213 Unter Blutsbrüdern
2214 Im Land der Saguaros
2215 Der Schatz der Kristallhöhle
2216 Das Gold der Apachen
2217 Bloody Fox
Axel J. Halbach
Bloody Fox
Als Taschenbuch gehört dieser Roman zu unseren exklusiven Sammler-Editionen und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt.Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.© 2022 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannHerausgeber: H. W. SteinTitelbild: Ralph KretschmannUmschlaggestaltung: Mario HeyerSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-448-0
1. Vorwürfe aus Kötzschenbroda
„Kreuzbombenelement und Schockschwerenot! Beim heiligen Krematorium! Da hast du es ja wieder mit einem ganz vermaledeiten Schurken zu tun gehabt! Erzähle! Wie ging es weiter? Wann und wie hast du diesen Al-Khadir in die Hölle geschickt?“
Es war natürlich mein Onkel Friedrich Holunderbusch, ehemaliger Hauptmann bei den preußischen Kürassieren und später Förster in Waldeshausen bei Kötzschenbroda, der in seiner typischen Art auf den Bericht meines letzten Abenteuers in der Syrischen Wüste reagierte. Jetzt aber befand er sich schon lange im Ruhestand. Den größten Teil seiner Zeit musste er leider mit gichtgeplagten Füßen in seinem Schaukelstuhl verbringen, der an einem großen Fenster stand, von dem aus er einen schönen Rundblick auf seinen nach wie vor geliebten Wald hatte.
Es war ja seit langem Brauch, dass ich ihm nach Rückkehr von meinen Reisen von den Erlebnissen berichtete, die ich in der Ferne gehabt hatte. So konnte ich dann doch noch einen kleinen Teil der weiten Welt in seinen eng gewordenen Lebensraum bringen. Heute war es wie gesagt mein derzeit letztes Abenteuer in der Syrischen Wüste – es war keine zwei Wochen her, dass ich mit der Jacht von Sir David wieder in Hamburg eingetroffen und von dort aus zurück nach Radebeul gekommen war. Seine Ungeduld war natürlich wie immer exemplarisch ...
„Tausend Blitze, Donnersturm und Hagelwetter! Nun erzähle endlich weiter! Kann es gar nicht mehr erwarten!“
„Gemach, gemach, lieber Onkel! Du wirst schon nicht zu kurz kommen! Da war also dieser geheimnisvolle Blick des Tetrapylon ...“
„Ha! Sapperment! Und mit dem hast du dann diesen Erzschurken aufs Kreuz gelegt!“
„Eigentlich nicht. Zumindest zwischendurch war es eher umgekehrt.“
„Wirst du etwa nachlässig, lieber Neffe? Wo bleibt deine Kampferfahrung? Du bist doch bis jetzt immer mit allen Schurken dieser Welt fertig geworden?“
„Warte nur ab!“
Ich erzählte weiter und befand mich schließlich in absolut hilfloser Lage in dem mit Sprengfallen versehenen Goldbergwerk ...
„Krötensumpf und Schlangenbrut! Da warst du ja mehr als nur ein argloser Dummkopf! Lass das nicht zur Gewohnheit werden! Wie bist du da wieder herausgekommen? Denn mit dem ganzen Berg in die Luft geflogen bist du ja offensichtlich nicht!“
Ich erzählte weiter.
„Haubitzendonner, Schrapnell und Pulverdampf! Der Berg ist tatsächlich explodiert! Und das ohne dich! Heureka! Aber warum hast du diesen Al-Khadir, diese schurkische Ausgeburt des Verderbens, nicht schon vorher erledigt? Die Gelegenheit hattest du doch? Wieso konnte er fliehen? Mit dem Gold? Du hattest doch deinen Henrystutzen wieder!“
„Onkelchen, du weißt ja ...“
„Sapperlot! Ich weiß, ich weiß – immer dasselbe! Deine Menschenfreundlichkeit! Dein Widerwillen, Blut zu sehen – nur dein eigenes vielleicht ausgenommen! Wohin wird das eines Tages noch führen? Schockkreuzdonner noch einmal! Du wirst nicht wiederkommen! Ich werde vergeblich warten!“
„Mein lieber Onkel – glaube mir: Das werde ich auf jeden Fall zu verhindern wissen!“
„So! Aha! Na ja – Sapperlot ... diesmal hat es ja schließlich noch geklappt! Und wie geht es nun endlich weiter?“
Ich erzählte die weiteren Erlebnisse bis zum Ende.
„Kreuzmillionendonnerwetter! Der steinreiche Lord hat einen Goldklumpen mitgenommen, den er überhaupt nicht brauchte! Und du? Zwei Kisten voller Gold ... und du ... hast nicht ...“
„Ich wusste ja gar nichts von diesen Goldkisten! Wie hätte ich ...“
„Dummkopf! Man kann ja fragen – vorher! Und dieser britische ... Oberhausmensch ... hat dir nichts ... gesagt?“
„Gar nichts, Onkelchen.“
„Potzdonner! Elender Kerl! Wusste doch, dass du fast immer am Hungertuch nagst! Und ich? An mich hat er natürlich auch überhaupt nicht gedacht! Hätte mir davon einen neuen Schaukelstuhl kaufen können!“
„Aber, lieber Onkel – dieser hier ist doch noch ganz in Ordnung!“
„In Ordnung, in Ordnung! Hätte dann eben zwei! Und vielleicht gibt es auch ein neues, aber teures Medikament gegen meine Gicht?“
„Das würde ich dir auch so besorgen. Das Problem ist nur ...“
„Problem, Problem! Säbelkampf und Flintendonner! War äußerst unfreundlich von der Lordschaft, das steht fest! Sehr und überhaupt! Du bist zwar ohne erkennbare Blessuren davongekommen ...“
„Dieses Mal tatsächlich! Aber erinnere mich nicht an meinen früheren Bericht, als ich auf meiner Suche nach dem Apachengold einen Durchschuss erlitt ...“
„Richtig! Auch damals hattest du nichts für dich behalten!“
„... und die Narbe, die ich dir nach der Rückkehr zeigte, hast du für einen Kratzer aus meinem Rosengarten gehalten! Damals war ich wirklich ärgerlich auf dich!“
„Kein Wunder! Sapperlot! Wie kann man diese unglaublichen Erlebnisse von dir selbst bei bestem Willen für Wahrheit halten? Und diesmal hast du wirklich nicht die kleinste Schramme mitgebracht! Das ist wirklich ...“
„Sage bloß, du glaubst mir wieder nicht?“
„Ich ... ja ... vielleicht ... doch, doch ... aber es ist wirklich eine – Schockkreuzdonner! – ganz und gar und vollkommen unglaubliche Geschichte! Und deshalb will, muss ich sie noch einmal hören!“
„Aber Onkelchen ... ich habe doch ...“
„Keine Widerrede! Wenn du sie noch einmal genauso erzählst, glaube ich dir jedes Wort, bei allen Heiligen und denen, die es noch werden wollen!“
Es blieb mir tatsächlich nichts anderes übrig und mein guter Friedrich Holunderbusch hing an meinen Lippen, als würde er von diesem Verbrechen in der Syrischen Wüste und den sich daraus ergebenden Folgen wirklich zum ersten Mal hören. Als ich schließlich – zugegeben, ein wenig erschöpft – geendet hatte, meinte er: „Beim Säbelklirren der Kürassiere – ich glaube dir, wahr und wahrhaftig! Aber ... aber ...“
„Onkelchen – was hast du denn immer noch für ein Aber?“
„Ich will mehr hören, immer mehr! Du hast schon einmal versäumt, mir von einem früheren, beinahe vergessenen Abenteuer zu berichten! Denk nach! Kannst du deine Erlebnisse überhaupt noch zählen? Ich bin mir sicher – du hast noch viel mehr vergessen!“
„Wie ... wie kommst du darauf? Ich ...“
„Denk angestrengt nach, lieber Neffe! Irgendwo in deinem Kopf ist mit Sicherheit ein kleines Kämmerlein, das du noch nicht geöffnet hast!“
Ich dachte nach. Vielleicht hatte er ja wirklich recht – dass bei meinen vielen Reisen doch noch eine unter den Tisch gefallen war? Und da kam mir ... tatsächlich ... eine vage Erinnerung ...
„Ich weiß nicht recht, Onkelchen ...“
„Potzhaubitzenblitz! Du wirst ja wohl deine grauen Zellen noch etwas sortieren können!“
„Habe ich dir ... damals ... nur zwei oder drei Jahre nach dem Ende des Sezessionskriegs in den Staaten ... wie ich von New Orleans aus ...?“
„Nichts! Gar nichts und überhaupt nichts! Habe nie davon gehört! Erzähl ... jetzt ... gleich ... sofort!“
„Mein lieber Onkel – das geht nun wirklich nicht! Erstens bin ich von meinem zweimaligen Syrienbericht immer noch erschöpft, zweitens habe ich auch noch etwas anderes zu tun und drittens muss ich wirklich überlegen, ob und wie ich die damaligen Erlebnisse noch abrufen kann – ich komme in einer Woche wieder und hoffe, dir dann vielleicht doch noch von einer fast vergessenen und ziemlich verzwickten Unternehmung berichten zu können!“
„Heureka! Schockkreuzhaubitzendonner und Schrapnell! Ich wusste es! Komm so bald wie möglich, lieber Karl, und verkürze mir die Zeit im Schaukelstuhl – auch wenn ich mich wegen der beiden zurückgelassenen Goldkisten immer noch furchtbar ärgere!“
So kam es also, dass ich mich mit einiger Mühe an ein früheres Abenteuer erinnern musste – und diese Erlebnisse sollen jetzt auch meinen Lesern nicht vorenthalten werden!
2. In New Orleans, mit unerwarteten Folgen
Wie schon erwähnt – es muss um das Jahr 1868 herum gewesen sein, drei Jahre nach dem von den Südstaaten verlorenen Sezessionskrieg, als ich mich von Veracruz in Mexiko aus per Schiff durch den Golf von Mexiko auf dem Weg nach New Orleans befand. Ich kam von einem Besuch bei Don Enriquo, dem Haciendero auf der Hacienda del Arroyo, östlich der Sierra Madre del Sur gelegen. Seit meinem ersten Aufenthalt dort – meine Leser werden sich an Das Land der Saguaros erinnern – verband mich mit ihm eine enge Freundschaft.
In New Orleans hatte ich mich mit Sam Hawkens und dem Hobble-Frank verabredet, die beide an den damaligen Ereignissen beteiligt gewesen waren. Wir hatten vor, noch einmal die so unglaublich bunte Vielfalt dieser einmaligen Stadt am Mississippi auf uns wirken zu lassen, die jetzt, drei Jahre nach dem Bürgerkrieg, vielleicht schon wieder ein wenig ihrer früheren Leichtigkeit und Ausgelassenheit zurückgewonnen hatte.
Wie ich gelesen und auch gehört hatte, musste es in New Orleans in den Jahren der damals baldigen Besetzung durch die Unionstruppen des Nordens wirklich schlimm zugegangen sein. Südstaaten-Rebellen brachen in die Lagerhäuser am Kai ein, steckten die dort befindliche Baumwolle in Brand und vernichteten alle Vorräte, die dem Feind von Nutzen hätten sein können. Riesige Baumwollballen wurden auf Flöße geladen, dann angezündet und in Bewegung gesetzt, sodass sie brennenden Totenschiffen gleich auf den Feind zutrieben.
Als Folge der Seeblockade der Unionstruppen blühte der Schmuggel in bis dahin nicht gekannter Weise. Das ehemals luxuriöse Leben der stolzen aristokratischen Kreolen war dahin, die Ställe standen leer, Pferde und Kutschen waren von der Armee beschlagnahmt worden, die riesigen Zuckerrohr- und Baumwollplantagen im Hinterland mit ihren großartigen Herrenhäusern waren zu einem guten Teil verwüstet und zerstört. Niemand besaß Vernunft genug, um diesem sinnlosen Wüten Einhalt zu gebieten. Und die Schwarzen, die ehemaligen Sklaven, machten das zivile Leben in der Stadt ebenso unsicher wie der weiße Pöbel, der bei mangelhafter Sicherheit seine Chance gekommen sah.
Das alles waren nun wahrlich keine guten Voraussetzungen für eine baldige Rückkehr des normalen Lebens – ich hoffte aber, dass jetzt, drei Jahre nach Kriegsende, doch vieles wieder zu ruhigeren Bahnen zurückgefunden hatte. Außerdem war jetzt gerade die Zeit des Mardi Gras, des traditionellen Karnevals in New Orleans, der der Stadt immer ihre besondere Fröhlichkeit gegeben hatte.
Auf dem Dampfschiff hatte ich während der drei- oder viertägigen Fahrt viel Zeit und Muße, mich umzusehen und meine Mitpassagiere zu beobachten, die – wie es für New Orleans und Louisiana überhaupt galt – den perfekten Mix aus amerikanischen, karibischen, französischen, spanischen und afrikanischen Einflüssen widerspiegelten.
Dabei fielen mir vor allem zwei Personen auf: ein wirklich einfach riesiger Kerl, dessen massiver und bärenstärker Körperbau an einen aufrecht auf einen zukommenden Grizzly erinnerte, und ein wesentlich kleinerer, fast zierlicher Mann, beide ganz offensichtlich indianischer Abstammung. Bei diesen beiden hatte der Kleine anscheinend das Sagen, denn es war deutlich zu sehen, wie der Große dem Kleinen auf Schritt und Tritt folgte und dessen Hinweisen oder Wünschen entsprach. Ich war aber nicht der Einzige, dem gerade diese beiden aufgefallen waren. Durch Zufall stand ich einmal in Hörweite von zwei recht anständig gekleideten Herren europäischer Herkunft, die sich über dieses ungewöhnliche Duo unterhielten.
„Hast du diese zwei Kerle gesehen, Fred? Der eine könnte fast ein Gorilla aus dem Urwald sein – an Kräften tut er es diesem auf jeden Fall gleich! Ein Riese, dem ich wahrlich nicht in die Finger geraten möchte!“
„Ich ebenso wenig! Tatsächlich kann ich dir sogar etwas mehr über die beiden erzählen! Du weißt, dass ich diese Fahrt von Veracruz nach New Orleans aus geschäftlichen Gründen öfter, wenn auch in Abständen, machen muss. Nicht immer, aber doch mehrmals, befand sich dann auch dieses auffällige Paar unter den Passagieren.“
„Und? Was hat der Kleinere für eine Funktion?“
„Er ist der Kopf der beiden und der Gorilla die abschreckende Kraft. Er gehorcht dem Kopf aufs Wort – gemeinsam eine durchaus gefährliche Paarung, zumal der Kleinere auch sehr gut mit dem Schießeisen umgehen kann, wie ich gehört habe. In Mexiko sind sie allgemein unter dem Namen Die beiden Azteken bekannt.“
„Und was treiben sie? Was haben ihre verschiedentlichen Fahrten nach New Orleans zu bedeuten?“
„Keine Ahnung. Ich habe nur gehört, dass sie in Mexiko schon mehrfach wegen irgendwelcher illegaler Aktivitäten unter Beobachtung standen. Man konnte ihnen aber nie etwas nachweisen.“
„Der Sezessionskrieg und seine Folgen! Schmuggel und Korruption blühen sicher auch heute noch!“
„Ohne Frage. Aber – was schert es uns, welchen Geschäften diese beiden nachgehen?“
„Du hast vollkommen recht! Da mischen wir uns nicht ein, das überlassen wir anderen! Die zwei Azteken, sagst du? Man sieht, dass sie indianischer Abstammung sind – aber zwei so gegensätzliche Pueblo-Indianer habe ich noch nie gesehen!“
„Wer weiß, wer ihnen diesen Namen gab? Vielleicht gehen ihre Vorfahren tatsächlich bis auf die Azteken zurück? Uns soll das nun aber wirklich nicht weiter kümmern – mich verlangt es jetzt nach einem kühlen Trunk in dieser schwülen Hitze!“
Damit war das Gespräch beendet, die beiden Männer verschwanden in Richtung Bar und ich hatte dasselbe Bedürfnis. Nur noch einen Tag und ich würde New Orleans und meine beiden Freunde wiedersehen – hoffentlich sowohl als auch in guter Verfassung!
*
Je näher wir den Hafenanlagen kamen, umso belebter wurde die Szenerie um uns herum. Der Dampfer verdrängte immer mehr das Segel. Dreimaster, Schoner und Briggs standen in zunehmend aussichtsloser Konkurrenz zu den flach im Wasser liegenden Flussdampfern mit ihren riesigen Schaufelrädern und unförmigen Schornsteinen. Und an den Kais herrschte ein Leben, wie es an Vielfalt kaum zu überbieten war.
Nicht nur das Menschengewimmel aller Rassen und aus aller Herren Länder zeigte mir, wie sehr sich New Orleans schon wieder dem Vorkriegsstand angenähert hatte – auch das bunte Warengewirr spiegelte die Bedeutung dieses Hafens an der Mississippi-Mündung wider.
Baumwollballen aus dem Hinterland, Indigo aus dem Delta-Gebiet, Melasse und Zucker aus Louisiana und Alabama, Roggen und Weizenmehl aus Illinois, gedörrtes Rindfleisch aus Arkansas, gepökeltes Schweinefleisch und Bleibarren aus Missouri, Tabakfässer aus Virginia, Ohio und Maryland und nicht zuletzt die stinkenden Felle aus Kentucky, die auf Flößen befördert wurden, da ihr Geruch einem auch Passagiere befördernden Dampfer nicht zugemutet werden konnte. Der Mississippi, auf dem all diese Waren ihren Weg nach New Orleans gefunden hatten, war zu dieser Zeit der wohl meistbefahrene Fluss der Welt – ausgenommen vielleicht nur die Themse. Er war der Verbindungsweg nach St. Louis und über den Ohio hinaus bis nach Kansas in die Randgebiete der Zivilisation.
Und ebenso war New Orleans natürlich auch das Eingangstor für den Warenstrom aus aller Welt, vor allem aus Europa. Inmitten der verwirrenden Warenstapel liefen Händler und Makler geschäftig hin und her, um die aus Europa eingetroffene Fracht zu übernehmen – Weinfässer aus Madeira und Bordeaux, alter Whiskey, Portwein, Schnapssorten aller Art, Sättel, Schuhe, Porzellan, Kaschmirseide und Baumwollstoffe, Türschlösser, Pendeluhren, Klaviere und andere Musikinstrumente, es war einfach alles vorhanden, von Kachelöfen aus Lothringen bis zu Gewürznelken und Erdbeermarmelade. Und natürlich auch verschiedenes Kriegsmaterial, das aber unter besonderer Kontrolle stand.
Wie es meine Gewohnheit war, machte ich als Erstes einen Rundgang durch dieses bunte Kaleidoskop des Lebens, nachdem ich die Einreiseformalitäten mit meinen Waffen ohne Probleme hinter mich gebracht hatte. Halt ... da waren ja vor mir ... tatsächlich: Es waren die beiden Azteken, die offenbar etwas zu verzollen hatten. Ich trat näher heran und befand mich in einem Areal, das wohl unter besonderer Aufsicht stand, denn es war eingezäunt, ein schwarzer Wachmann lehnte gelangweilt an einer mannshohen Kiste und ein Zollbeamter war gerade dabei, eine von drei länglichen Kisten (etwa sechzig Zentimeter breit, fünfzig Zentimeter hoch und eineinhalb Meter lang) zu öffnen, die wohl dem Azteken-Paar gehörten. Unmittelbar neben diesen drei Kisten befanden sich einige weitere, die äußerlich – das überraschte mich – mit diesen dreien vollkommen identisch waren.
Der Beamte öffnete die drei Kisten – sie enthielten, völlig unspektakulär, Stoffe mit indianischen Mustern und Motiven aus Mexiko. Darauf wurde kein Zoll erhoben. Der Beamte verschloss die Kisten wieder, schob sie zu den anderen identischen hin und versah die drei Kisten mit einem Freigabe-Zertifikat ... aber ... aber ... hatte ich mich geirrt, getäuscht? Hatte der Beamte nicht drei der danebenstehenden ... anderen Kisten ... mit der Freigabebescheinigung versehen? Genau konnte ich das nicht erkennen, weil mir die Azteken im Blickfeld standen. Auch wunderte ich mich, dass der kleinere der beiden Azteken dem Zollbeamten anschließend offenbar einen Geldschein in die Hand drückte. Seit wann war es üblich, einem Beamten für die Ausübung seiner Arbeit ein Trinkgeld zu geben?
Ich schüttelte den Kopf. Irgendwie merkwürdig – aber weiter darüber nachdenken wollte ich jetzt auch nicht. Es war an der Zeit, mich nach meinen beiden Freunden, Sam und Hobble-Frank, umzusehen, denn so ungefähr um diese Zeit hatten wir uns verabredet. Sam hatte vorgehabt, schon einen Tag früher in New Orleans einzutreffen, um den Karnevalsumzug am heutigen Morgen verfolgen zu können. Anschließend wollte er sich dann mit Frank bei irgendwelchen mit dem Mardi Gras zusammenhängenden Veranstaltungen aufhalten und bei denen würde ich ihn dann finden. Und so machte ich mich auf die Suche.
Auch wenn meine Leser wohl mit dem äußeren Erscheinungsbild und einigen besonderen Charaktereigenschaften meiner beiden Freunde vertraut sind, möchte ich sie hier doch noch einmal vorstellen, um ein möglichst vollständiges Bild zu vermitteln.
Sam war von vergleichsweise kleiner Statur. Unter der wehmütig herabhängenden Krempe eines Filzhutes, dessen Alter, Farbe und Gestalt ihm eigentlich Kopfschmerzen bereiten müssten, blickte unter einem Wald von verworrenen schwarzen Barthaaren eine Nase von ziemlich außergewöhnlicher Dimension hervor, die durchaus einer Sonnenuhr als Schattenwerfer hätte dienen können. Wegen des enormen Bartwuchses waren von seinen anderen Gesichtsteilen eigentlich nur seine zwei kleinen klugen Augen zu bemerken, die von außerordentlicher Beweglichkeit waren. Sein Körper blieb bis auf die Knie herab unsichtbar, da er in einem alten bockledernen Jagdrock steckte, der wohl ursprünglich einmal für eine wesentlich umfangreichere Person angefertigt worden war. Aus dieser ziemlich länglichen Umhüllung guckten zwei dünne, sichelkrumme Beine hervor, die in ausgefransten Leggins steckten und den Blick auf ein Paar Indianerstiefel gestatteten.
Sein wilder Haarwuchs allerdings war nicht Natur – da er einst von den Pawnees skalpiert worden war, trug er seitdem eine seinem Bartwuchs angepasste Perücke. Er ritt kein Pferd, sondern ein Maultier namens Mary, und eine weitere Besonderheit war sein Gewehr Liddy, dessen Lauf eine leichte, äußerlich allerdings nicht wahrnehmbare Biegung aufwies. Um mit diesem Gewehr treffen zu können – Sam war darin ein Meister –, musste man seine Liddy schon sehr gut kennen, um die Krümmung beim Zielen auszugleichen. So manche besondere Situation hatte darin ihre Ursache. Mit dem Bowiemesser in seinem Gürtel konnte er sehr gut umgehen. Sein Revolver allerdings war wohl kaum von Nutzen, solange er ihn unter seinem Jagdrock trug.
Nicht zuletzt schließlich war Sam mein Lehrer gewesen, als ich seinerzeit als junger und in der Westmannskunst unerfahrener Mann in die Staaten gekommen war, auch wenn ich heute wohl behaupten darf, meinem ehemaligen Lehrer in manchen Fertigkeiten nicht nur gleich, sondern auch überlegen zu sein. Das hinderte Sam aber nicht daran, mich weiterhin bei passender Gelegenheit als Greenhorn zu bezeichnen – um dann vielleicht auch noch seinen typischen Satz: „... wenn ich mich nicht irre, hi hi hi“, hinzuzufügen.
Ja – mein Sam war schon ein wahres Original, aber es gab keinen tüchtigeren, liebenswerteren und zuverlässigeren Gefährten als ihn! Der Westen und das Leben in der dortigen oft gefährlichen Wildnis hatten ihn ebenso zu einem besonderen Menschentypen geformt, wie es natürlich auch beim Hobble-Frank der Fall war.
Diesem Frank – sein eigentlicher Name lautete Heliogabalus Morpheus Edeward Franke – hatte einmal ein Ogalala-Indianer durch den Fuß geschossen, was seinen hinkenden Gang und damit die Bezeichnung Hobble-Frank zur Folge hatte. Gebürtig in Moritzburg, Sachsen, war er dort vor seiner Auswanderung zwar nur Forstgehilfe gewesen, hielt sich aber dennoch angesichts seiner verschiedenen, aber immer wieder abgebrochenen Schulbesuche für besonders gebildet. In der Realität brachte er deshalb vieles durcheinander und konnte sehr heftig reagieren, wenn man ihn auf seine Fehler aufmerksam machte oder gar verbesserte. Auch sonst bestritt er gerne anscheinend ernste, tatsächlich aber neckische Wortgefechte in sächsischem Dialekt, wobei ihm immer wieder lustige Missverständnisse klassischer Zitate oder Begriffe passierten. Auch wenn man ihm zweifellos eine gewisse Selbstüberschätzung nicht absprechen konnte, war er aber eine durchaus ehrliche, mutige, zuverlässige und nicht zuletzt auch listige Haut.
Seine Kleidung – auch er war eher nur mittelgroß – war ein Gedicht für sich. Betrachtete man indianische Schuhe und Lederhosen noch als normal, so war sein Überrock – ein einst dunkelblauer, jetzt aber arg verschossener Frack mit hohen Achselpuffern und blank geputzten Messing-Knöpfen – doch mehr als nur außergewöhnlich. Zu Pferd hingen rechts und links an dessen Seiten die Frackschöße flügelartig herunter und seinen Kopf zierte ein riesiger schwarzer Amazonenhut, den eine gelb gefärbte unechte Straußenfeder schmückte. Bewaffnet war er mit einer Doppelbüchse, einem Messer und zwei Revolvern im Gürtel, an dem außerdem mehrere Beutel zur Aufnahme von Munition und anderen Kleinigkeiten hingen.
Das also waren meine beiden Freunde, auf deren Suche ich mich jetzt machte. New Orleans pulsierte vor Leben und das zweifellos nicht nur während des derzeitigen Mardi Gras. Wo gab es besondere Vorführungen, zu deren Zuschauern auch Sam und Frank gehören konnten? Ich lief zunächst ein wenig ziellos durch die Gassen, bis ich plötzlich auf einem mittelgroßen Platz eine größere Menschenmenge vor mir sah und aus der ich eine Stimme hörte, die mir durchaus bekannt vorkam: „Ich wiederhole, meine Damen und Herren! Wer mit dieser meiner Liddy – mein Gewehr hat nämlich einen Namen! – einen der dort vorne aufgestellten Tonkrüge trifft, dem spendiere ich eine Flasche edlen Kentucky-Whiskeys! Warum so zurückhaltend? Ich habe euch doch schon gezeigt, wie es geht!“
Natürlich war es Sam. Ich sah, dass es sich hier offenbar um einen Schießwettbewerb handelte. Hinter einer Absperrung durch ein Seil, vor dem die Menschenmenge sich staute, befanden sich in etwa fünfundzwanzig Meter Entfernung und in einer Reihe aufgestellt einfache Tontöpfe, von denen einige schon getroffen und zerbrochen waren, eine größere Zahl aber noch auf einen treffsicheren Schützen wartete.
Ich beschloss, Sam einen kleinen Streich zu spielen. Vorsichtig drängte ich mich durch die Menge, bis ich mich direkt hinter ihm befand. Neben ihm stand Frank. Beide hatten mich noch nicht bemerkt und es hatte auch noch kein anderer Zuschauer Anstalten gemacht, der Aufforderung von Sam zu folgen. Also schnappte ich mir von hinten mit einem raschen Griff seine Liddy (deren Tücken ich natürlich kannte), legte an und drückte ab – und ein weiterer der Tontöpfe zerbarst.
„Ha! Die Flasche Whiskey gehört mir!“, jubelte ich, während San, der sich natürlich sofort umgedreht hatte, seinen offenen Mund nur langsam wieder zu bekam.
„He! Halt! Das Greenhorn! Wo kommst du Schleichkatze her? So war das nicht ge...“
„Die Flasche werden wir uns heute Abend zu Gemüte führen, da führt für dich kein Weg vorbei!“
„Charley! Old Shatterhand! Du hinterlistiger Gauner!“
Natürlich lagen wir drei uns jetzt erst einmal in den Armen.
„Ha! Da liegt die Maus im Senftopf und der Hase im Pfeffer, den unser lieber Shatterhand dem Sam um seine lange Nase gewickelt hat!“, gab auch Frank seinen Kommentar ab.
Sam fügte sich in das Unvermeidliche. Aber als wir drei uns jetzt unseren Weg zurück durch die Menge bahnen wollten, drängten weitere Männer auf Sam ein, um von seinem Angebot Gebrauch zu machen.
„He – Finger weg! So war das nicht gemeint! Es stand nur eine Flasche Whiskey zur Verfügung und die hat euch jetzt dieses Greenhorn, dieser größte aller Gauner, weggeschnappt, wenn ich mich nicht irre, hi hi hi ...“
Schließlich hatten wir den Pulk hinter uns gelassen und konnten kurz darauf bei einem kühlen Trunk unser glückliches Wiedersehen endlich richtig begießen. Sam und Frank waren von St. Louis aus mit einem der neuen großen Flussdampfer den Mississippi herunter gekommen und ich berichtete kurz von meiner ebenso unproblematischen Anreise von Veracruz aus. Die beiden hatten schon in der Bourbon Street, im French Quarter, Zimmer für uns drei reserviert. Ich war damit nicht so ganz einverstanden, denn die Bourbon Street war für eine besonders lebhafte Atmosphäre bekannt. Eine ruhigere Ecke etwas außerhalb hätte mir eher gelegen – ich sagte aber nichts.
Wir machten uns jetzt auf den Weg dorthin, denn ich wollte meine beiden Gewehre und mein übriges Gepäck, das ich ja immer noch bei mir hatte, endlich loswerden. Nur wenige Hundert Meter von der Pension entfernt aber gab es erneut einen Menschenauflauf, und als wir uns durch die Menge drängten, standen wir plötzlich vor einem kleinen freigeräumten Platz, auf dem ein Voodoo-Priester und zwei seiner Mitarbeiter ihre rituellen Tänze vollführten, bei deren Endzustand sie in angeblich übersinnliche Trance geraten würden.
Wir beschlossen, uns das Spektakel noch eine Weile anzusehen, und da ich mich schon bei früheren Gelegenheiten mit Ursprung und Ausdrucksform des Voodoo-Kults beschäftigt hatte, will ich meinen Lesern hier ein paar grundsätzliche Informationen nicht vorenthalten.
Voodoo ist eine ursprünglich aus Westafrika stammende und von Geistern und Ahnen beseelte Naturreligion, die durch die Sklaverei bis in die Karibik und Teile von Louisiana vordrang. New Orleans ist zur Metropole des amerikanischen Voodoo geworden, Haiti der Staat mit den meisten Voodoo-Anhängern; rund siebzig Prozent der dortigen Einwohner bekennen sich zum Voodoo, neunzig Prozent aber auch gleichzeitig zum Katholizismus.
Eine klare Definition von Voodoo gibt es nicht. Vielmehr handelt es sich um ein Ensemble von teilweise sehr unterschiedlichen Glaubensvorstellungen, die alle als gleichwertig akzeptiert werden. Zum einen ist Voodoo ein Ahnenkult. Ebenso gibt es von Menschen erschaffene Skulpturen, die als Gottheit verehrt werden. Und schließlich können auch Gegenstände der Natur – ein Baum, ein ganzer Wald, der Regenbogen oder Blitz und Donner – ein Voodoo enthalten und als Sitz einer Gottheit angesehen werden. Besessenheit, in die man bei Trance als Folge der rituellen Tänze gerät, spielt beim Voodoo eine große Rolle. Ein Geist oder ein Gott schlüpft für kurze Zeit in den Körper eines Menschen. Diese Geister oder Götter können dann heilende Kräfte entfalten, aber auch Tod und Verderben bringen.
Gruselige, mit Nadeln gespickte Horrorpuppen oder auch schwarz lackierte Hühnerfüße, die an oder über Wohnungstüren befestigt werden, können Dämonen sowohl fernhalten als auch anlocken, um ihnen den Weg zu Sündern zu zeigen. Ursprünglich gab es diese Voodoo-Puppen gar nicht. Sie entstanden erst im Laufe der Zeit unter den Sklaven, die ihre Naturreligion nicht praktizieren durften. Deshalb tarnte man die Abbildungen und Statuen der Voodoo-Gottheiten einfach als Puppen. Später dann wurde die Voodoo-Puppe fester Bestandteil der entsprechenden Rituale.
Um einen solchen rituellen Tanz handelte es sich hier. Während der Priester – ein wenig im Hintergrund – eine wirklich Furcht verbreitende Horrorpuppe in den Händen hielt, die mit Nadeln an den Stellen aller wichtigen Organe gespickt war und der sich mit magischen Lauten um sich selbst drehte, tanzten seine beiden Assistenten – wenn man sie so nennen will – im Vordergrund und ihr Verhalten zeigte, dass sie dem angeblich übersinnlichen Trancezustand nicht mehr fern waren. Plötzlich aber hielten sie inne, gingen noch ein, zwei Schritte auf meine Nachbarn – und damit auch auf mich – zu, stießen unheimliche, bedrohliche Laute aus und eilten dann zum Priester, an dessen beiden Seiten sie stehen blieben.
Dieses Ritual mit zwei Assistenten war mir neu – ich konnte aber nicht weiter darüber nachdenken, denn im nächsten Augenblick stürzte der Priester mit seiner Horrorpuppe direkt auf mich zu ... nein, doch nicht ganz, mein rechter Nachbar war gemeint. Ihm wurde die Puppe direkt vor das Gesicht gehalten und der Priester stieß unheimlich drohend die Worte aus: „Du hast etwas bei dir, das dir nicht gehört, etwas, das du gestohlen hast. Wenn sich dies heute Abend noch in deinem Besitz befindet, wird diese Puppe den Dämonen den Weg zu dir zeigen! Sie werden Besitz von dir ergreifen und dir ein furchtbares Ende bereiten!“
Dann sprang der Priester wieder zurück zu den beiden Tänzern und machte ein Zeichen, dass seine Vorstellung jetzt beendet sei. Die Menge um den kleinen Platz herum war noch wie erstarrt und auch mir war es noch nicht möglich gewesen, über dieses bizarre Geschehen ein wenig nachzudenken. Im gleichen Augenblick aber spürte ich, wie mein dunkelhäutiger rechter Nachbar mir blitzschnell etwas in die Außentasche meiner Lederjacke steckte, um sich dann ebenso schnell durch die Menge zu drängen und zu verschwinden.
Diese kurze Bewegung meines Nebenmanns war vom Priester nicht unbemerkt geblieben. Er kam wie zufällig noch einmal auf mich zu und flüsterte mir ins Ohr: „Kommt heute Abend bei mir vorbei! Das letzte Haus der Bourbon Street auf der rechten Seite!“
Dann war er – wie schon seine beiden Mitstreiter zuvor – ebenfalls in der Menge verschwunden, die sich anschließend auflöste. Ich war immer noch ein wenig verwirrt, als Frank in seiner typischen Art die Situation charakterisierte: „Herrjemerschnee! Da kann man ja Zepter und Mordio schreien! Was hat dir der Bursche ins Hemd jesteckt? Und was hat der Meister dämonischer Besessenheit dir ins Ohr jebrüllt? Merschtendeels brat mir da eener ’nen janzen Truthahn, wenn du da nicht wieder mal een Abenteuer in der Tasche hast! Da beißt nu’ keene Maus nich’ den Strick durch!“
„Du meinst: den Faden ab – oder?“
„Was ich meine, ist hier ziemlich unjeheblich! Meene Jroßtante Eulalia hat schon jesagt: Hüte dir, mein Junge, dass man dir nie unjewollt etwas in die Stiefel schteckt!“
„Du meinst: in die Schuhe schiebt?“
„Nu ja, det ooch. Aber du hast ja Schtiefel an.“
„Lieber Frank – ich gebe zu: Diese beiden Vorfälle sind schon ein wenig seltsam. Ich schlage vor, wir gehen jetzt, unserer ursprünglichen Absicht entsprechend, zu unserer Pension und nehmen uns dort dann vor, was man mir in die Tasche gesteckt hat. Dann sehen wir weiter.“
„Det is eene Idee, die an Jroßartigkeit ooch von mir hätte schtammen können! Also brechen wir auf mit Hornjebläse!“
Dem war nichts hinzuzufügen. Es war nicht mehr weit bis zu unserer Unterkunft, die durchaus akzeptabel war, und als Erstes dort musste natürlich die Frage geklärt werden: Was hatte mir mein dunkelhäutiger Nachbar voller Furcht vor dem Voodoo-Priester eigentlich in die Tasche gesteckt?
Ich holte ein pergamentartiges Dokument hervor, das ... ja, ohne Zweifel, es handelte sich um eine notariell ausgestellte und beglaubigte Besitz- beziehungsweise Eigentumsurkunde an einem Farmbesitz nordwestlich, ziemlich weit von New Orleans entfernt, nicht unweit vom östlichen Rand des Llano Estacado, der uns dreien von früheren Unternehmungen her durchaus nicht unbekannt war. Was hatte das zu bedeuten?
Der genau definierte Landbesitz umfasste 8.000 Hektar, es handelte sich also um eine gut mittelgroße Farm am Ostrand des Llano, die dort in jedem Fall nur extensive Viehzucht erlauben würde. Die Farm hatte den Namen Hoffnung und als Eigentümerin war eine junge Frau namens Eileen Markham eingetragen, die – tatsächlich! – erst vor einer guten Woche volljährig geworden war. Ich musste mir erneut die Frage stellen: Was hatte das alles zu bedeuten? Ohne zunächst weiteren Kommentar reichte ich die Urkunde an Sam und Frank weiter, wobei Sam nach einiger Zeit meinte: „Nu ja – ziemlich voller Fragezeichen, das Ganze, wenn ich mich nicht irre! Schlage vor, wir bringen das Papier dem Notar zurück, dem es ja offenbar abhandengekommen ist. Name und Adresse desselben sind ja hier angegeben.“
Erst jetzt erzählte ich kurz, was mir der Priester ins Ohr geflüstert hatte, nachdem das Dokument in meine Jackentasche gelangt und was mir ziemlich dringlich erschienen war.
„Sicher hast du recht, Sam. Aber warum sollten wir nicht noch vorher diesen Priester aufsuchen, nachdem er uns darum gebeten hat? Er weiß offensichtlich mehr von den Hintergründen, die hinter dieser mysteriösen Angelegenheit stecken. Und die sollten wir uns anhören. Ich muss zugeben, dass ich neugierig geworden bin.“
„Merschtendeels een Vorschlag, der mir mehrere Hände und Füße zu haben scheint!“, meinte Frank. „Dahinter schteckt sicher wieder eene abjekartete Sache, der wir off den Unterjrund gehen müssen!“
Da mochte Frank durchaus recht haben. Wir einigten uns darauf, uns kurz nach Anbruch der nicht mehr weit entfernten Abenddämmerung auf den Weg zu machen. Das letzte Haus auf der rechten Seite der Bourbon Street – das durfte weder weit noch zu verfehlen sein.
*
„Meine Herren – ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Es gibt wohl einiges im Hinblick auf das Dokument, das in Ihre Hände gelangt ist, zu erklären, und das will ich jetzt tun.“
Der Priester trat uns in völlig anderer Aufmachung als vorhin bei seiner Voodoo-Vorführung an der Tür entgegen. Er sah eher wie ein Geschäftsmann der schwarzen Mittelschicht aus, etwa fünfzig Jahre alt, mit einem offenen Blick und vertrauenerweckendem Gesicht. Wir grüßten alle drei freundlich, er bat uns hinein und ich stellte kurz meine beiden Freunde vor. Als ich dann aber auch noch zu mir selbst kommen wollte, unterbrach er mich: „Ich weiß, ich weiß! Ein Glücksfall! Wer hat nicht schon von Old Shatterhand, dem ständigen Kämpfer gegen das Böse und für die Gerechtigkeit, gehört?“
„Das ... das ... wundert mich, ehrlich gesagt! Hier bin ich weniger bekannt als im Westen, Herr ... Herr ... wie kann ich Sie ...“
„Mein eigentlicher Name ist Samuel Parker, auch wenn ich als Priester unter einem anderen Namen bekannt bin ...“
„Mister Parker – das ist alles immer noch ziemlich verwirrend für mich ... Sie wissen, dass ich jetzt hier eine Urkunde bei mir habe ...“
„Genau darum dreht es sich. Ich bin seit vielen Jahren mit dem Advokaten, der diese Besitzurkunde ausgefertigt und beglaubigt hat, befreundet. Wie ich – durch Zufall und erst sehr viel später – zu meiner Funktion als Voodoo-Priester gekommen bin, spielt jetzt hier keine Rolle. Vielleicht nur so viel: Ich versuche, den Aberglauben und die Furcht dieser einfachen Menschen vor dem Übersinnlichen zu ihrem Guten zu nutzen, indem ich wie Sie das Böse enttarne und das Gute fördere. Dank vielfältiger Verbindungen wird mir manches zugetragen, das mir dabei hilft. Und dazu gehört auch die Geschichte dieses Pergaments.“
„Ich bin aber ... noch immer ... etwas ratlos ...“
„Natürlich – wie kann es anders sein? Es war ein ungeheurer Glücksfall, dass ich Sie neben demjenigen erkannte, der diese Urkunde dem mit mir befreundeten Advokaten entwendet hatte ... das Weitere wissen Sie!“
„Aber ... aber ... wie konnten Sie wissen, dass er mir ...“