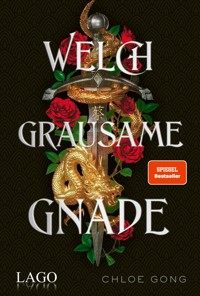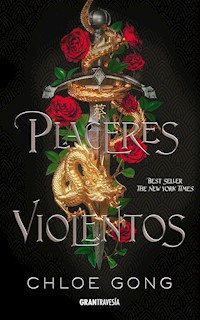19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Von der TikTok-Bestsellerautorin in limitierter Erstauflage mit wunderschön gestaltetem Farbschnitt Die Spiele sind vorbei. Lasst das Chaos regieren. Calla hat das Unmögliche geschafft. Trotz aller Widrigkeiten hat sie die blutigen Spiele von San-Er gewonnen und König Kasa, ihren tyrannischen Onkel und den ehemaligen Herrscher von Talin, beseitigt. Nun dient sie als königliche Beraterin von Kasas Adoptivsohn August, der den Thron bestiegen hat. Nur dass es nicht wirklich August ist, der da auf dem Thron sitzt... Anton ist immer noch wütend über Callas Verrat in der letzten Runde der Spiele. Um zu überleben, hat er in einer unmöglichen Aktion Augusts Körper übernommen. Und als plötzlicher Thronfolger hat er nicht die Absicht, diese neu gewonnene Macht wieder aufzugeben. Doch als seine erste Liebe, die schöne, explosive Otta aus einem jahrelangen Koma erwacht und ein Geheimnis lüftet, das die Autorität der Monarchie Talins ins Wanken bringt, bricht Chaos aus. Ihre Rückkehr ist zudem nicht nur eine Bedrohung für Talin, sondern auch für die Gefühle zwischen Calla und Anton. Als die Spannungen den Siedepunkt erreichen, müssen Calla und Anton ihre Konflikte beiseitelegen und sich in die entlegenen Gebiete des Königreichs begeben, um eine Revolution zu verhindern – auch wenn ihr Reich vielleicht besser in Flammen aufgehen sollte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Chloe Gong
Immortal Longings
Ein Spiel zwischen Verlangen und Verrat
– False Gods 2 –
Aus dem Englischen von Elena Helfrecht
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Hobbit Presse
www.hobbitpresse.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Vilest Things« im Verlag Saga Press, New York
© 2024 by Chloe Gong
Published by Arrangement with TRIADA US, INC., Sewickley, PA 15143 USA
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Für die deutsche Ausgabe
© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte sowie die Nutzung des Werkes für Text
und Data Mining i. S. v. § 44b UrhG vorbehalten
Cover: Birgit Gitschier, Augsburg
unter Verwendung einer Illustration des Originalverlags von © Will Staehle/Unusual Corporation
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-96656-5
E-Book ISBN 978-3-608-12399-9
Für die d. a. c. u. – Christina Li, Racquel Marie, Tashie Bhuiyanund Zoe Hana Mikuta.
Ihr wisst, weshalb.
Ihr trauert, Freunde? So strafe Zeus mich! Dies ist eine Botschaft, Ein Königsaug zu feuchten.
William Shakespeare, Antonius und Cleopatra übersetzt von Wolf Graf von Baudissin
Kapitel 1
Davor
Macht hat einen unverkennbaren Eigengeschmack. Heiß und golden schlängelt sie sich die Kehle hinab und hinterlässt eine rauchige Note, wie scharf angebratenes Fleisch oder gut gereifte Spirituosen. Die Muskeln entkrampfen, das Herz schlägt ruhiger. Sie stillt jede Art von Hunger – ein Luxus, der süchtig macht, ein Balsam, nur dazu gedacht, jede noch so kleine Leerstelle auszufüllen.
Allerdings hat Macht auch einen unverkennbaren Geschmack, wenn sie einem wieder hochkommt. Und Anton Makusa kann nicht behaupten, dass ihm der besonders mundet.
Zittrig atmet er ein und ringt mit seinem rumorenden Magen. Die Gardisten im Thronsaal lugen zwischen den golddurchwirkten Vorhängen auf den Balkon hinaus und erkundigen sich besorgt nach ihm, doch er wischt sich über den Mund und winkt ab. Er sieht doppelt, alles flimmert. Seine Haut spannt unerträglich; dieser Körper ist nicht groß genug für sein Qi, es will sich einfach nicht in die neue Form fügen. Die Geschehnisse der letzten Minute entziehen sich fast seinem Verständnis. Mit aller Kraft klammert er sich ans Bewusstsein, ans Leben. Vor seinem geistigen Auge flackern Erinnerungen auf, fremde wie vertraute. Als er seine Hände betrachtet, verändert sich das Bild. Er wäscht sich Blut von den Fingern. Schreibt mit alter Tusche.
Und dann, von jetzt auf gleich, lässt der Schmerz nach. Die Übelkeit bleibt, doch äußerlich ist er unversehrt. Allmählich nimmt er seine Umgebung wieder wahr. Eine Gardistin tritt zu ihm hinaus und fragt, ob er sich beim Reingehen an ihr abstützen möchte. Anton blickt ungläubig über die Balustrade.
Er weiß nicht wie – aber er hat es geschafft. Wieder spricht ihn die Frau an, und ihr Blick huscht zu der Pfütze auf dem Balkonboden, wo Anton seinen Magen entleert hat. Abwehrend hebt er die Hand und unterdrückt nur mit Mühe die nächste Welle des Zitterns. Vielleicht reagiert er bloß überempfindlich auf den grausamen Anblick da unten. Dort hat Prinzessin Calla Tuoleimi – Nummer Siebenundfünfzig – soeben ihren letzten Gegner niedergemetzelt und ist zur Siegerin der alljährlichen Spiele gekürt worden. Aus dem Lautsprecher dröhnen noch immer die Ergebnisse: Der alles entscheidende Kampf … das Juedou geht zu Ende … der letzte Herausforderer ist gefallen …, und selbst wenn er die Augen schließt, suchen ihn die Bilder noch heim. Augusts aktuelle Erinnerungen vermischen sich mit Antons letzten Momenten in der Arena: Calla, die ihn zu sich lockt; der Rat, der spätnachts in den Kriegssälen tagt; Calla, die den Kopf auf seiner Schulter ablegt; ein Wachssiegel mit Schwalbe, das bricht, als der Umschlag aufgerissen wird; Calla, Calla, Calla …
»Mir geht’s blendend«, sagt Anton. Seine Stimme klingt fremd und vertraut zugleich. Er öffnet die Augen und die Welt hört auf, sich zu drehen. Sein alter Körper liegt bäuchlings im Staub der Arena. Obwohl Spieler Sechsundachtzig bereits tot ist, fließt das Blut noch. »Ich bitte um Verzeihung. Das ist alles ziemlich ekelerregend.«
Bei dieser untypischen Entschuldigung wird der Gardistin unbehaglich zumute, und sie zieht sich fügsam in den Thronsaal zurück. Anton verlässt den Balkon nicht – noch nicht. Er überblickt die Arena, betrachtet die Abertausenden, die sich dicht um die Seilabsperrung drängen. Als er sich an der Brüstung festhält, treten seine Fingerknöchel wie polierte Marmorkugeln hervor, und die Silberringe schneiden in seine langen Finger ein.
An der steinernen Balkonmauer hängt ein großer, dekorativer Schild. Dass er nun hier steht, beweist seine erfolgreiche Flucht, die von den unzähligen Zeugen unbemerkt geblieben ist. Und obgleich ihm klar ist, was er hier vollbracht hat, fühlt er sich noch wie betäubt, als er sich nach vorn beugt und im spiegelnden Schild einen ordentlich gekämmten blonden Schopf mit Stirnreif ausmacht. Das ist zweifellos August Shenzhi. Der einzige Unterschied ist der violette Schimmer, der das schwache Blau in den fast schwarzen Augen abgelöst hat: Es sind Antons Augen.
Allmählich bricht der Wahnsinn über ihn herein. Irgendwo ertönt lautes Gelächter, und erst als er auf sein Spiegelbild achtet, wird ihm klar, dass er derjenige ist, der da lacht – du bist das. Niemand sonst steht hier vor dem Thronsaal. Du trägst diese Seidengewänder – ja, den Prinzen selbst.
Die Stelle, an der er vorhin noch in der Arena stand, und die, von der August aus zusah, liegen unfassbar weit voneinander entfernt. Dennoch ist er in August hineingesprungen, ohne Blitz, ohne ihn überhaupt ins Visier genommen zu haben. Seine Tat hat keine Spur hinterlassen außer der Blutlache mitten in der Arena, verdorben vom Qi, das er im Sterben aus seinem alten Körper herausgepresst hat, um genug Energie für den Sprung zusammenzukratzen. Ein Amateurversuch.
Anton verschränkt die Hände hinter dem Rücken. Dabei rascheln Augusts Ärmel, das helle Blau ohne jeden Makel. Niemand beachtet ihn gerade, insbesondere, solange Calla von der Garde in den Palast der Einheit geleitet wird. Er beobachtet sie kühl, wartet auf einen Anflug von Reue, auf ein Anzeichen, dass seine Ermordung Gewissensbisse bei ihr hinterlässt – doch sie verschwindet ruhigen Schrittes aus dem Sichtfeld, ohne sich auch nur einmal umzudrehen.
Er hat tatsächlich zu hoffen gewagt, die Sache würde anders ausgehen, aber das war ein Fehler. Vielleicht fliegt er innerhalb der nächsten fünf Minuten auf, vielleicht kommt er damit bis ans Ende seiner Tage ungeschoren davon. Da eine solche Übernahme nie vorgekommen ist, wäre beides gleichermaßen möglich. Fest steht jedenfalls: Sobald Calla zuschlägt, gehört der Thron ihm.
»Du bist schwach«, sagt Anton laut. Er winkt dem Arenapublikum zum Abschied, und die Hälfte erwidert die Geste sogleich. Er hat nicht erwartet, dass jemand ihn zur Kenntnis nehmen würde, doch wie hätte es anders sein sollen? Schmerz durchzuckt seine Wirbelsäule, so heftig, dass er fast den Drang verspürt, nachzusehen, ob er verletzt ist. Allmählich wird ihm das volle Ausmaß seines Kunststücks bewusst. Königliche wie adelige Blutlinien sind über Jahrhunderte hinweg bewahrt worden, in dem Glauben, die alten Götter wären ihnen besonders gewogen. August Shenzhi wurde als August Avia geboren. Dieser Tatsache kann er nicht entrinnen, so sehr er es auch versucht hat.
»Bitte, bitte, hört auf zu klatschen«, flüstert Anton und macht auf dem Absatz kehrt. Die Worte erinnern ihn an sein altes Leben, vor einer gefühlten Ewigkeit. Anders als damals wird sein Abgang diesmal von Applaus begleitet. Unzählige Blicke folgen ihm, und er weiß: Alles, was er auf diesem Balkon verkündet, wird Gesetz. Die Gardisten schrecken zusammen, als er zwischen den sich bauschenden Vorhängen hindurch in den Thronsaal zurückkehrt, und setzen sich sofort in Bewegung. Anton sagt nichts – noch nicht. Als das hier noch der Erdpalast war und er den anderen Flügel bewohnte, gab es für ihn wenig Anlass, den Thronsaal zu betreten. Die Wände schimmern samtig-rot, und die hohe Decke wird von Goldsäulen getragen, deren kunstvolle Reliefierung alte Götter zeigt. Er betrachtet die ungewohnte Umgebung, während seine Sohlen in den tiefgrünen, flauschig weichen Teppich sinken. Wäre er klüger, würde er die Schatzkammer öffnen lassen, sich die Taschen vollmachen und einfach abhauen.
»Ich muss zu den Kriegssälen«, verkündet er stattdessen.
Diese Entscheidung kommt den Gardisten seltsam vor. Einer tritt nach vorn – seine Augen orange, kein Weisanna – und sagt: »Eure Hoheit, man erwartet Euch beim Bankett. Es geht bald los.«
»Ich weiß.« Irgendwie riecht der Palast anders als damals. Es ist Jahre her, dass er ihn zuletzt betreten hat, doch der Grundriss ist in seiner Erinnerung nicht verblasst. So eine Verbannung ist einsam. Gnadenlos. Da es in den ruhigen Nächten kaum etwas zu tun gab, träumte er sich oft in die Säle hier und tat, als sei er von unschätzbaren Reichtümern umgeben, statt sich am nächsten Morgen mit einem läppischen Spiegelei begnügen zu müssen.
»Hoheit?«
Doch Anton hastet bereits die Stufen hinab, wohlbedacht darauf, nicht über die Unebenheiten zu stolpern. Er huscht an den Adeligen in Türnähe vorbei und bahnt sich den Weg durchs Gedränge, ohne auf verwunderte Begrüßungen und perplexe Nachfragen einzugehen. Es ist spät. Die Speichellecker da müssen auf der Lauer gelegen haben, um ihn zum Bankett zu begleiten; jetzt aber blicken sie ihm erstaunt in die entgegengesetzte Richtung nach. Die Garde zerstreut die wartenden Palastadeligen schnell: Seine Hoheit wird in Kürze bei Euch sein, würdet Ihr wohl bitte weitergehen …
Anton hält nicht an.
Als ihn die zwei Gardisten vor den Kriegssälen erblicken, machen sie ihm hastig Platz. Er bittet sie, dort zu warten – gemeinsam mit denen, die ihm aus dem Thronsaal bis hierher gefolgt sind –, und schließt die Flügeltüren hinter sich, eher sich einer von ihnen dazu äußern kann. In der Ferne ertönt Jubel. Nach dem Kampf wird das Zuschauermeer aus der Arena strömen und an den Palast branden, in der Hoffnung, einen Blick auf das Bankett zu erhaschen oder im Anschluss ein paar Reste zu ergattern.
Anton beißt die Zähne zusammen und marschiert geradewegs auf die Archivschränke an der gegenüberliegenden Wand zu. Obwohl Talin seit gut einem Jahrhundert nicht mehr angegriffen wurde, werden die Kriegssäle rege genutzt und dienen als zentraler Treffpunkt, um sämtliche Palastbelange zu besprechen. Links von ihm steht ein kunstvoll verzierter Tisch. Er lässt die Finger über die raue Oberfläche gleiten, stößt gegen die benutzten Teeschalen und reißt die erstbeste Archivschublade scheppernd bis zum Anschlag auf. Als er durch die Karteireiter blättert und alles überfliegt, wirbelt eine kleine Staubwolke auf. Diebstahl, Körperverletzung, Vermögensdelikte, Waffengesetzverstöße, Schutzverfügungen …
Er knallt sie wieder zu. Nur stadtinterne Bagatelldelikte. Nicht das, wonach er sucht. Er lässt den Blick umherschweifen und überlegt, wo er die Akte finden könnte. Statt mit Bildschirmen und Gerätschaften sind die Kriegssäle mit Regalen und Wälzern bevölkert. Die Wände verschwinden hinter vergilbten Karten mit gerollten Rändern. Die schweren Fenstervorhänge sind halb zugezogen, durch den Spalt fällt aber noch genug Licht herein, um etwas zu sehen.
Anton versucht sein Glück beim nächsten Schrank. Hier steht jeder Karteireiter für eine Provinz, sortiert nach ihrer jeweiligen Nähe zur Hauptstadt. Eigi, Dacia, Cirea, Yingu, Pashe, Daol, …
Diese Schublade schließt er ebenfalls wieder. Und öffnet gleich die nächste. Palastangestellte. Die nächste. Immobilienkäufe des Rates.
»Wo steckt sie nur?«, murrt er. Anton hat immer noch einen säuerlichen Geschmack im Mund. Er geht in die Hocke und öffnet eine Schublade auf Kniehöhe, eingesäumt von zwei wild wuchernden Topfpflanzen. Hier stößt er endlich auf die Karteireiter mit alphabetisch sortierten Adelsnamen: Makusa findet er ganz hinten – die dickste Akte von allen.
Er starrt sie an. Eine Strähne fällt ihm in die Augen, zart und golden, wie ein zu Seide gesponnener Sonnenstrahl. Er schiebt sie beiseite und widersteht nur mit Mühe dem Drang, sie sich auszureißen.
»Hoheit?« Ein Gardist klopft an der Tür. »Braucht Ihr Hilfe?«
»Nein«, antwortet Anton knapp. August hätte garantiert nicht freundlicher oder rücksichtsvoller reagiert – und der Beweis dafür befindet sich in der Mappe, die er nun in die Hand nimmt.
»Ich würde ja helfen, wenn ich könnte«, sagte August einmal, als das hier noch der Erdpalast war. Damals hatte Anton den Mördern seiner Eltern Rache geschworen und verbrachte jede freie Minute im Übungssaal. »Stünden mir die Mittel zur Verfügung, um mehr herauszufinden, würde ich es tun. Aber wir wissen so wenig im Palast. Diese Leute entziehen sich unserer Kontrolle.«
Anton blättert durch die Mappe. Er überfliegt den Stammbaum, Geburts- und Sterbedaten sowie die Grafiken, die ihre Verwandtschaftsverhältnisse mit anderen Adelsfamilien aufzeigen.
Auf der letzten Seite der Familienakte findet er endlich, wonach er gesucht hat.
Anton Makusa – Lagerraum 345, Nordflügel.
Als Otta ins Koma fiel und Anton allein für ihr gemeinsames Verbrechen geradestehen musste, konfiszierte der Palast seinen Stammkörper und verbannte ihn in die Zwillingsstädte, wo er von seinem früheren Leben ganz und gar abgeschnitten war. Er hat immer gewusst, dass sie seinen Körper im Palast der Einheit aufbewahren – nur nicht, wo genau. Das hielten sie geheim, damit er nicht versuchen würde, ihn sich zurückzuholen. Das Ratsmitglied, das ihm sein verhängnisvolles Urteil überbrachte, versprach, man würde auf sein Gefäß gut achtgeben. Und vielleicht bekäme er es sogar irgendwann zurück – vorausgesetzt, er säße sein Exil ab, ohne Ärger zu machen. Fast ist er überrascht, dass sie Wort gehalten haben. Den Adel achtet der Palast. Folglich ist es verboten, adelige Stammkörper zu zerstören. Trotzdem hat Anton erwartet, man würde den seinen nach ein paar Jahren aus reiner Willkür entsorgen. Alle anderen Makusas sind tot, nur Anton ist noch übrig. Sobald er nicht mehr ist, kann der Palast die ganze Akte schreddern, unter den Teppich kehren und so tun, als hätte es sie nie gegeben.
»Kannst du nicht Kasa bitten, ein paar Einheiten loszuschicken?«, fragte Anton. »Ach komm schon, August. Er ist der König. Er regiert Kelitu! Er kann die Palastgarde beauftragen, Nachforschungen anzustellen. Irgendjemand in dieser Provinz muss doch wissen, wer dafür verantwortlich ist.«
August war immer der Ruhige, Vernünftige, Anton hingegen der Laute, der zu Dramatik neigte. August hörten die Erwachsenen im Palast gern zu.
»Er hat es schon versucht«, erwiderte August sachlich. In all den Jahren, die sie befreundet waren, konnte Anton nie sicher sagen, ob August ehrlich mit ihm war. Was also blieb ihm übrig, als seinem Freund stets einen Vertrauensvorschuss zu geben? »Ich versprech es dir. Nichts ist dabei rausgekommen.«
Anton richtet sich auf, trägt die Mappe zum Schreibtisch inmitten des Saals und breitet den Inhalt darauf aus. Die Geschichte der Makusas lässt sich lange zurückverfolgen, allerdings nicht länger als die der übrigen Adelsfamilien – nicht so lange, um eine so dicke Akte zu rechtfertigen. Er schiebt den Atlas zu seiner Linken und den ambossförmigen Briefbeschwerer zu seiner Rechten beiseite. Nach und nach nehmen die Blätter den gesamten Schreibtisch ein, und mit jedem Dokument, das Anton überfliegt, nimmt seine Verwirrung zu:
Da liegen Kopien von den Verwaltungsschreiben seiner Eltern in Kelitu, Schnappschüsse von Dörfern und Steuerberichte mit roten Markierungen. Als Anton zwei Inventarlisten voneinander löst, die sich im Lauf der Zeit miteinander verklebt haben, segelt dazwischen ein kleinformatiger Abzug heraus, auf dem er in seinem kindlichen Stammkörper abgebildet ist. Er starrt direkt in die Kamera, eine Frontalaufnahme, die mitsamt seiner Kennnummer im Register des Königreichs abgespeichert wurde.
Zuerst begreift er nicht, warum das alles aufgehoben wurde – bis sein Blick auf ein getipptes Schreiben ganz hinten in der Mappe fällt, unterzeichnet von Kasa höchstpersönlich.
Ich werde mich kurzfassen. Selbstverständlich sollte Ihre Loyalität eigentlich dem Rat Ihrer Provinz gelten, doch uns liegen unbestreitbare Beweise vor, dass Fen Makusa ein aufständischer Widerstandskämpfer ist. Normalerweise wird ein versuchter Coup umgehend mit Verhaftung und Hinrichtung geahndet, sein Ziel allerdings hat sich als weitaus gefährlicher erwiesen: Er plant den Zerfall des Königreichs. Diese Information darf unter keinen Umständen nach draußen gelangen. Um Ihrer Provinz und Ihres Volkes willen: Stellen Sie sicher, dass die Makusas ausgelöscht werden – und zwar auf eine Art, die ihre Anhänger nicht radikalisiert. Der Palast darf mit ihrer Bestrafung keinesfalls in Verbindung gebracht werden.
Antons Blick wandert weiter, ohne den Rest jedoch wirklich zu lesen. Immer wieder springt er zum Anfang zurück. Und schließlich, als er jeden Zweifel ausgeräumt hat, schnellt seine Hand wie von selbst vor und wischt alles vom Tisch. Die Blätter segeln zu Boden.
Anton saugt scharf die Luft ein, doch als er sie wieder ausstoßen will, verfällt er plötzlich in Schnappatmung. Sein Körper gehorcht ihm nicht.
Im ersten panischen Moment ist er sicher, dass August ihn gerade hinauszudrängen versucht. Auch nach ein paar Minuten hält der Zustand noch an, bis er einer spontanen Eingebung folgt und die Luft anhält. Es klappt. Das geht alles nur von ihm aus. Mangelnde Selbstkontrolle ist gerade das Einzige, was ihm schaden kann. Seine Panik verwandelt sich in lodernde Wut. Er richtet sie auf die Dokumente vor sich, auf sich selbst.
Hinter dem Mord an seinen Eltern steckt allein Kasa – und nicht irgendwelche Banditen, die sie zufällig überfallen haben. All die Jahre hat er sich gefragt, warum seiner Familie etwas so Schreckliches zugestoßen ist, warum selbst seine Schwestern sterben mussten. Und nun stellt sich heraus, dass das alles auf Geheiß des Palastes geschah.
Es klopft. »Eure Hoheit? Was ist das für ein Lärm?«
»Herein«, sagt Anton. »Aber nur einer von euch.«
Eine Gardistin reckt den Kopf in den Saal. Zunächst ruht der Blick ihrer silbrigen Augen auf den Blättern, die auf dem Boden verstreut liegen. Sie hebt den Kopf. »Ja, Hoheit?«
»Wer hat sich zuletzt an den Akten zu schaffen gemacht?« Anton macht eine ausladende Geste. »Hier herrscht ja das reinste Chaos.«
Unruhig tritt die Weisanna vom einen Fuß auf den anderen. Ihr Zögern bestätigt seinen Verdacht – sein Wissen, wenn man bedenkt, dass vor den Kriegssälen immer Gardisten postiert sind.
»Außerhalb der Ratssitzungen ist nur Euch und Seiner Majestät der Zutritt gestattet. Womöglich war das Fenster zum Lüften offen, bestimmt war es der Wind.«
Eine taktvolle Ausflucht, die sie sich auf die Schnelle hat einfallen lassen. In Wahrheit denkt sie wohl eher: Eure Hoheit, dafür könnt nur Ihr allein verantwortlich sein.
Anton betrachtet den Namen auf der Mappe, die nun schräg neben einer Topfpflanze liegt. Am liebsten würde er das Etikett abreißen und es auf eine andere kleben – als könnte er das grausame Schicksal seiner Familie nachträglich ändern; als würde es so auf eine andere überspringen. Aufständischer Widerstandskämpfer. Das ist absurd. Sie waren Palastadelige … warum hätten sie daran etwas ändern wollen?
»Nein, das war nicht der Wind«, gibt Anton schlicht zurück. »War nicht ich zuletzt an den Schränken zugange? Ich bin doch derjenige, der sämtliche Informationen für König Kasa verwaltet, weil er keinerlei Überblick hat, was in seinem Reich vor sich geht.«
Die Gardistin zuckt kaum merklich zusammen und wägt ab, ob das eine Fangfrage ist. Aber es spielt keine Rolle. Anton weiß: In diesem Palast gibt es keine Akte, die August nicht gelesen hat. Der Kronprinz hat es sich zur Aufgabe gemacht, stets auf dem Laufenden zu bleiben, unter Zuhilfenahme sämtlicher Ressourcen, die ihm dafür zur Verfügung stehen. Obendrein ist zwischen dem Zeitpunkt, zu dem August Zugang zu diesen Räumlichkeiten erhalten hat, und Antons Verbannung viel Zeit vergangen.
»Schon gut«, sagt Anton und erspart der zunehmend verängstigten Weisanna die Antwort. Wahllos hebt er Mappe und Blätter auf und klemmt sich alles unter den Arm. »Lasst niemanden rein.«
»Ja, Hoheit …«
Er schreitet an ihr vorbei durch die Tür. Ein Stück weiter im Gang passiert er die Abzweigung zum Festsaal und begibt sich stattdessen zu Augusts Schlafzimmer. Die Absätze seiner polierten Schuhe klackern wie Kriegstrommeln. Vielleicht hat Calla beim Bankett schon zugeschlagen. Mit Kasas Tod wird sie ihr großes, ihr einziges Ziel endlich erreicht haben. Dann wird sie sich in ihrem Erfolg suhlen können.
»Prinz August.« Hastig holt ihn jemand ein. Wieder ein Gardist. »Nach Euch wird dringend beim Bankett verlangt.«
»So dringend ist das nicht.«
Die Verwirrung ist fast greifbar, und einen Moment lang fragt sich der Gardist womöglich, ob August ihn falsch verstanden hat. Anton macht sich auf eine Diskussion gefasst. Natürlich wird es eine Diskussion geben, das hier ist schließlich der Palast der Einheit. Veranstaltungen lassen sich nicht abblasen, nur weil einem nicht danach ist.
Doch August Shenzhi ist der rechtmäßige Thronfolger und kein dahergelaufener Adeliger, der jemandes Gunst gewinnen muss. Der Gardist nickt und Anton setzt seinen Weg ohne Widerrede fort. Er biegt nach links ab und betritt Augusts Vorzimmer.
»Du kannst gehen.«
Vor Augusts Gemächern halten ausschließlich Weisannas Wache, nur Galipei fehlt. Vermutlich erwartet er seinen Schützling beim Bankett.
»Ihr könnt alle gehen.« Er weist energisch zur Tür.
Es dauert ein paar Sekunden, bis die Weisannas tatsächlich hinausgehen. Erst dann knallt Anton die Akte auf den Schreibtisch und donnert die Faust aufs Papier, worauf ein stechender Schmerz durch seinen Arm zuckt.
Stellen Sie sicher, dass die Makusas ausgelöscht werden.
Das war alles, was es gebraucht hat. Nur ein einziger Befehl hatte das Leben, wie Anton es kannte, ausradiert. Hat sich Kasa diese Ausrede ausgedacht, weil sein Vater ihn bei irgendeiner belanglosen Ratsangelegenheit ein Dorn im Auge war? Widerstandskämpfer. Lachhaft, bei ihrer Abstammung. Und doch schlängelt sich Argwohn in seine Hirnwindungen und erweckt die blassen Kindheitserinnerungen zu neuem Leben. Viel ist ihm von den damaligen Provinzausflügen nicht geblieben, aber er weiß noch, dass sie oft hinausfuhren. Es könnte etwas dran sein. Trotzdem …
Lautes Getrommel dröhnt durch den Palast: Entweder beginnt das Bankett gerade oder es endet. Das Geschrei, das durch die Gänge schallt, könnte entweder von Ekstase oder Entsetzen herrühren. Als Anton aufblickt, begegnet er seinem Blick im Wandspiegel. August kleidet sich immer standesgemäß, sein Haar ist ordentlich gekämmt und er steht kerzengerade da. Nur Antons spöttisches Lächeln verzerrt das Bild. Einfach so nimmt er die Vase vom Tisch und schleudert sie gegen den Spiegel. Das Glas bricht, scharfe Scherben rieseln auf den Teppich.
»Dir war vollauf bewusst, was er mir genommen hat«, sagt Anton zu August aus dessen Mund. Die reinste Farce. »Und du hast ihn ungestraft davonkommen lassen.«
August hat nicht den Anstand, reumütig dreinzublicken. Die fehlenden Spiegelsplitter schneiden Stücke aus seinen Wangen, bohren sich in seine Stirn und entstellen seinen Mund. Anton kann sich kein Szenario ausmalen, in dem sich sein ehemaliger Freund bei ihm entschuldigt hätte. Der Kronprinz, der Goldjunge, der nur auf den Thron hinarbeitete.
Auch gut. Wenn König Kasa die Makusas unbedingt als Widerstandskämpfer brandmarken wollte, wird Anton dieses Erbe bereitwillig antreten. Er wird zu Ende bringen, was seine Eltern angeblich angefangen haben.
Und dann wird auch Calla Tuoleimi bezahlen.
Kapitel 2
Danach
Am äußersten Rand Talins liegt eine Provinz namens Rincun. Allerdings hieß sie nicht immer so. Fragt man die Menschen dort, wie sie ihre Heimat einst nannten, erhält man keine Antwort, denn die ist ihnen verboten. Zehn Jahre, in denen durchgängig Soldaten in den Dörfern stationiert waren, haben ihnen mächtig Angst eingeflößt. Sie hat einen Belag auf ihren Zähnen hinterlassen, und wann immer sie die Zunge zum Sprechen bewegen, haben sie den bitteren Geschmack der Furcht im Mund.
Sie haben die Enthaupteten gesehen, die entlang des Yamens auf Pfählen zur Schau gestellt wurden: ein Exempel, das man an denen statuierte, die den alten Namen der Provinz weiterhin in den Mund nahmen. Und als solches will niemand enden.
Calla Tuoleimi kannte Rincuns ursprünglichen Namen einmal, hat ihn aber über die Jahre vergessen, ebenso wie ihren eigenen.
»Waren Sie denn schon mal draußen in den Provinzen, Rätin?«
Calla versucht, das Gespräch in der Kutsche auszublenden. Heute Morgen sind sie in Rincun angekommen und haben General Poinin von zu Hause abgeholt. Nun sind sie auf dem Weg zum Yamen im Westlichen Hauptdorf. Nachdem er daran scheiterte, mit Calla ein Gespräch anzufangen, ist er dazu übergegangen, Rincuns neue Rätin zu belehren.
»Nein, das ist mein erstes Mal«, antwortet sie. Der Blick ihrer himmelblauen Augen huscht zu Calla hinüber, ein stummer Hilfeschrei. »Mein Vater hat mich bei seinen Besuchen nie mitgenommen.«
Venus Hailira ist die Erstgeborene von Buolin Hailira und hat dessen Ratssitz geerbt, nachdem er kürzlich für immer eingeschlafen ist. Zwar haben die anderen Mitglieder infrage gestellt, ob es klug sei, den nächsten Delegationsbesuch nach Rincun so früh anzutreten, wo Venus noch grün hinter den Ohren ist, aber nach der Krönung hatte der König es offenbar eilig, sich seine neueste Beraterin vom Hals zu schaffen. Calla hatte keine Zeit, ihn um Vergebung zu bitten oder gar zu fragen, wie es sein kann, dass er noch vor ihr steht. Sobald die Krönung vollzogen war, wurde sie auf seinen Befehl hin von den Weisannas hinausgeführt. Stunden später erst, als sie im Salon vor den königlichen Gemächern auf und ab tigerte – jede Bitte um eine Audienz wurde abgeschmettert –, informierte man sie schließlich, dass sie die Delegation nach Rincun begleiten würde.
»Sie werden sich wundern, wie rückschrittlich hier draußen alles ist«, sagt General Poinin und klatscht sich auf die Schenkel. »Als ich zum ersten Mal jemanden getroffen hab, der noch die alten Götter verehrt, hab ich das für einen Scherz gehalten.«
»Mir ist bewusst, dass in den Provinzen noch gebetet wird«, gibt Venus höflich zurück.
»Oh, die beten hier nicht bloß. Zählen Sie mal die Vogelfiguren hier im Dorf. Ich würde vorschlagen, in nächster Zeit eine provinzübergreifende Säuberungsmaßnahme einzuleiten. So was gehört sich doch nicht.«
Mit finsterem Blick wendet sich Calla dem Fenster zu. Wo die notdürftig gepflasterte Straße an den Lehmboden grenzt, liegen immer noch gefrorene Schneeklümpchen. Sich Vogelstatuetten im Haus aufzustellen, ist das Einzige, was den Dorfbewohnern noch bleibt, um den alten Göttern zu huldigen. Ihnen das auch noch zu nehmen, wäre übertrieben.
»Ich werde es auf die Agenda setzen.« Venus räuspert sich. »Wir könnten sie ja vorher von den Soldaten zählen lassen.«
Das scheint Poinin zu beschwichtigen. Er lässt sich gegen die Sitzlehne sacken und verschränkt die Hände über seiner weißen Jacke.
Calla spürt, wie sein Blick wieder zu ihr wandert.
»Prinzessin Calla, Ihr scheint damit nicht einverstanden zu sein?«
Sie unterdrückt ein Seufzen. Diese Reise ist nur eine Formalität, eine Erhebung zu reinen Repräsentationszwecken. Weder bringt der Palast dabei wirklich Neues in Erfahrung, noch haben die Provinzen etwas davon, wenn ein Ratsmitglied mit einer ganzen Entourage aus Beratern vorbeikommt, um Getreidebestände und Wasserpegel zu prüfen. Rincun und Youlia sind die einzigen Provinzen, für die noch regelmäßige Delegationsbesuche vorgesehen sind. Sie liegen am nördlichen Ende des Reichs und gehören noch nicht so lange dazu, dass gut ausgebaute, beschilderte Straßen hinausführen. Auch ist die allgemeine Infrastruktur zu marode, um dort Urlaubsdomizile für die Ratsmitglieder zu errichten. Solcherlei Ausflüge, bei denen der Rat den heißesten Wochen in San-Er entflieht, genügen in den anderen Provinzen als Regierungsbesuche. Wenn also jemand aus dem Palast nach Rincun möchte, ist tatsächlich eine ganze Delegation vonnöten. Der Horizont erstreckt sich über Kilometer, ohne das geringste Anzeichen auf Leben: schier endlose Weiten, die sich der Palast bei seinem Eroberungsfeldzug einverleibt hat, samt Dörfern und dem See inmitten der Provinz. Um sich hier draußen zurechtzufinden, sind die Palastdelegationen auf die langjährige Erfahrung der Generäle vor Ort angewiesen. Vom Meer, das entlang des ausgedehnten Westrands der Provinz tost, ahnt man in den Dörfern nichts, so lange dauert die Reise bis dorthin.
»Sprechen Sie nicht mit mir.«
Schweigen senkt sich über die Kutsche. Die anderen beiden Berater rutschen unbehaglich hin und her.
»Ich … wie bitte?«
Kurz erwägt sie, ihre unverhohlene Verachtung nachträglich abzumildern. Sie könnte Poinin darauf hinweisen, dass sein Vorschlag angesichts der geltenden Gesetze überflüssig ist: Da es in den Provinzen untersagt ist, irgendetwas außer Talinesisch zu sprechen, können die Dorfbewohner nicht wirklich beten, wurden die althergebrachten Fürbitten doch in ihrer Muttersprache verfasst. Übermäßigem Götterkult wurde in den Provinzen bereits ein Riegel vorgeschoben. Der Palast hat es nicht nötig, den Zorn der einfachen Leute weiter anzufachen.
»Sie sollen nicht mit mir sprechen«, wiederholt Calla stattdessen. »Ihre Stimme ist verdammt nervig.«
Vor seiner Krönung hat der echte August Shenzhi offiziell verfügt, dass Calla zu seiner Beraterin ernannt und freigesprochen wird, damit sie an seiner Seite herrschen kann. Dieser Anordnung kann sich niemand widersetzen – es sei denn, August höchstpersönlich bräche sein Wort und entzöge ihr den neuen Titel wieder.
Dann aber würden die Leute womöglich Fragen stellen.
Und der Rat würde genauer hinschauen und feststellen, dass August in Wahrheit Anton Makusa ist, der sich im Körper ihres Königs eingenistet hat. Solange Anton aber Calla in ihrem Amt belässt, gibt es im ganzen Reich keine Menschenseele, der es in den Sinn käme, solche Behauptungen aufzustellen. Und diese Situation wird Calla voll auskosten.
Die restliche Reise über herrscht Schweigen.
***
»Ich glaube, wir wären soweit fertig«, verkündet Calla und dehnt ihren Hals mit einem Knacken. Die Sonne geht langsam unter. Sie sollten schnellstmöglich aufbrechen, bevor sie noch eine dritte Nacht auf den Dorfpritschen schlafen müssen.
Sie ist ungeduldig. Von San-Er bis hierher haben sie mit der Kutsche eine geschlagene Woche gebraucht, zurück wird es voraussichtlich ebenso lange dauern. Die Zeit in den Zwillingsstädten steht nicht einfach still, bis sie wieder da ist. Während sie im entlegensten Winkel des Reichs festsitzt, kann Anton in San-Er tun und lassen, was er will, ohne dass sie etwas davon mitbekommt. Der Gedanke nagt an ihr und erfüllt sie mit einer unerträglichen Unruhe.
»Das denke ich auch. Braucht Ihr eine Decke, Hoheit?«, fragt die Rätin.
Calla betrachtet ihre Beine, die schmutzigen Stiefel. Das fragt Venus bestimmt nicht ohne Anlass. Vielleicht zittert Calla, ohne es bemerkt zu haben? Doch alles kommt ihr vor wie immer. Sie verschränkt die Arme und lehnt sich an die Mauer, die das Yamen umschließt. Sie hinterlässt einen schmutzigen Fleck an ihrer Jacke. Nach wie vor zieht Calla ihre Lederkluft den edlen Seidengewändern vor, in die man sich im Palast hüllt. Sie kleidet sich immer noch, als würde sie sich in San-Er herumtreiben, als müsste sie als Spielerin mit der ewig währenden Nacht der Zwillingsstädte verschmelzen.
Tatsächlich ist ihr hier so warm wie schon lange nicht mehr, obwohl selbst die Palastgardisten, die die Delegation eskortieren, in ihrer zweckmäßigen schwarzen Baumwollgewandung frösteln; ebenso wie die Pferde, die schon gesattelt und vor die Kutschen gespannt sind.
»Nein?« Das rutscht Calla als Frage heraus. »Seh ich aus, als hätte ich eine nötig?«
»Äh, nein. Ich wollte nur vorsichtshalber nachfragen.« Venus wirft einen Blick über die Schulter, zu dem Gebäude hinter der Mauer. »Vielleicht hätte man im Yamen gern ein paar mehr.«
»Niemand im Yamen will Decken«, erwidert Calla trocken.
»Aber die sind hier wirklich Mangelware. Ein paar Fensterscheiben sind gesprungen und …«
»Ich korrigiere: Niemand im Yamen will Decken von uns. Lassen Sie die Leute einfach zufrieden. Sie haben doch gesehen, wie sie sich bei unserem Besuch verhalten haben.«
Seit kaum drei Tagen sind sie hier, und ihr Empfang in Rincun hätte nicht unterkühlter ablaufen können. Die Dorfbewohner bleiben alle in ihren Häusern. Der Palast ist den Landbewohnern nicht von Nutzen – wenn überhaupt, sind sie dem Palast von Nutzen. Während die anderen Berater ihre Runden gedreht und die Berichte von Generälen und Soldaten eingeholt haben, ist Calla entweder im Yamen geblieben oder Venus Hailira nachgedackelt, wobei sie mit den Gedanken in San-Er war. Die Menschen, die mit ihr gesprochen haben, kann sie an einer Hand abzählen.
Venus runzelt die Stirn. »Ihr lasst Euren Stand ganz schön raushängen.«
»Ich gehöre nun mal zum Adel.« Calla zupft an ihren Handschuhen herum. »Die können uns nicht ausstehen. Sparen Sie sich den gespielten Großmut und lassen Sie die Leute in Ruhe.«
»Ich spiele nichts …«
»Doch.« Immer mehr Gardisten strömen nach ihrer letzten Toilettenpause aus dem Yamen. »Wir sind der Adel. Und wenn Sie wirklich großzügig wären, würden Sie für die Leute Ihr Familienvermögen plündern, statt sie mit Resten abzuspeisen. Sagen Sie ruhig, dass Sie das nicht tun werden. Das dürfen Sie.«
Venus öffnet den Mund. Ehe sie aber etwas erwidern kann, zeigt Calla – immer noch beiläufig wie eh und je – auf ihre Tasche. »Ihr Handy piept.«
»Oh.« Erschrocken holt Venus ihr Mobiltelefon hervor, zieht die Antenne aus und entfernt sich, um den Anruf entgegenzunehmen. Sobald ihre Generäle die Bestandsaufnahme im Westlichen Hauptdorf abgeschlossen haben und zurück sind, wird die Delegation aufbrechen können. Auch die Palastgarde, die vor dem Yamen wartet, wirkt ungeduldig: Die ungefähr zehnköpfige Einheit bleibt in der Nähe, bereit, sich sofort auf den Weg zu machen. Venus hat die Zügel hier nicht besonders fest in der Hand. Das überrascht Calla nicht. Sie kennt die Hailiras nur flüchtig, doch Gerüchten zufolge hat der Erdpalast über Venus die Nase gerümpft, weil sie ihren Stammkörper aufgegeben hat. Dabei ist es Gang und Gebe, dass Palastadelige ihren Kindern klammheimlich zu neuen Körpern verhelfen, zum Beispiel, wenn kleine Jungs plötzlich feststellen, dass sie eigentlich kleine Mädchen sind. Das Problem bestand darin, dass Venus eigenmächtig handelte, als sie schon in der Pubertät war, womit die Hailiras die Sache nicht mehr so einfach vertuschen konnten.
»Wie eigenartig«, sagt Venus, als sie zurückkommt. Ihr Kopfschmuck ist nach links gerutscht, die blauen Edelsteine haben sich in einem schwarzen Haarknoten verheddert.
»Erzählen Sie mir jetzt nicht, dass sich die Abreise verzögert.«
Stirnrunzelnd reckt Venus ihr Gerät gen Himmel. In Rincun ist der Empfang generell schlecht. Nur Mobiltelefone, die speziell auf den Provinzgebrauch ausgelegt sind, funktionieren hier. »Leutnant Forin erreicht General Poinin nicht. Er will zurückrufen, sobald er mit dem Yamen des Östlichen Hauptdorfs Rücksprache gehalten hat. Sollte nicht lange dauern.«
»Warum warten wir auf Poinin? Er tut nichts, außer Ihnen schlechte Ratschläge zu erteilen.«
Venus übergeht die Bemerkung. »Eigentlich sollte er inzwischen mit dem Abschlussbericht aus dem Östlichen Hauptdorf zurück sein.« Als sie das Telefon senkt, bemerkt sie Callas Gesichtsausdruck. »Der Palast erwartet schließlich, dass wir die Berichte beider Hauptdörfer vorlegen.«
»Ach, ist das so?«, erwidert Calla mit gespieltem Erstaunen. »Mein Fehler.«
Sie würde wetten, dass sich die Generäle in Eigi und Pashe immer prompt bei den zuständigen Ratsmitgliedern zurückmelden. Dort ist die Befehlskette gut geölt – vom König über die Ratsmitglieder und Generäle bis hin zu den Soldaten. Jeder weiß, wem seine Loyalität gilt; alle Aufgaben sind klar verteilt. Rincun jedoch wurde nach seiner Eroberung gespalten: Die einzige Provinz, die in Ost und West unterteilt ist. Trotzdem ist nur ein Ratsmitglied dafür zuständig, dem die Generäle aus beiden Hälften unterstehen. Venus Hailira ist keineswegs inkompetent. Aber sie ist ungefähr in Callas Alter und so naiv wie jede andere Adelige, die wohlbehütet und ohne jeden Kummer aufgewachsen ist – was bedeutet, dass der Palast sie früher oder später in Stücke reißen wird. Und nach ein, zwei Monaten wird die nächste Adelsfamilie um die unbeliebteste aller Provinzen buhlen.
Calla gibt Venus allerhöchstens drei Monate, bis sich ihre Soldaten gegen sie wenden und der Palast ein Machtwort sprechen muss.
Sie warten noch ein paar Minuten ab. Venus’ Telefon schweigt.
»Falls sich nach Sonnenuntergang immer noch niemand gemeldet hat«, schlägt Calla vor, »sollten wir einfach den Bericht fälschen und abhauen.«
»Das wird dem Palast gar nicht gefallen.«
»Der Palast wird davon nichts erfahren, Rätin Hailira.«
»Aber …«
»Es piepst schon wieder.«
Venus schreckt zusammen und senkt den Blick. »Tatsächlich. Entschuldigt mich.«
Sie entfernt sich wieder. In der Zwischenzeit ruft einer der Palastgardisten nach Calla, und obwohl sie ihn hört, kommt ihr nicht in den Sinn, zu reagieren. Erst, als er lauthals »Prinzessin Calla!« brüllt, ist ihre Aufmerksamkeit geweckt.
»Ich bin nur Beraterin«, sagt sie. »Die königliche Anrede ist unnötig.«
»Wie Ihr wünscht, Hoheit«, gibt der Gardist unbeeindruckt zurück. Entgegen ihrer Einwände trägt sie einen glänzenden Goldreif auf dem Kopf, der im Kontrast zu ihrem schwarzen Haar steht. Ganz egal, ob Prinzessin, Beraterin oder Palastadelige – diese Titel bedeuten alle dasselbe: Nämlich, dass sie hier in Rincun ein Eindringling ist. »Falls es noch länger dauert, sollten wir über Nacht hier bleiben. Es wird langsam kalt.«
Calla entschränkt die Arme und zieht einen Handschuh aus, um die kühle Brise an ihre Haut zu lassen. Der Horizont färbt sich allmählich orange und kündigt den Sonnenuntergang an, der seine langen Finger nach den Wolken ausstreckt.
An diesen Anblick erinnert sie sich gar nicht, obwohl er ihr vertraut sein müsste. Ihre Erinnerungen an Rincun sind vage und scheinen in endlos weite Ferne gerückt zu sein, wie ein Traum kurz nach dem Aufwachen. Zwar weiß sie noch, was passiert ist, unmittelbar bevor sie die Gegend hier hinter sich gelassen hat – was sie dazu bewegt hat, mit acht Jahren in Prinzessin Calla Tuoleimis Körper zu schlüpfen –, doch die Provinz fühlt sich nicht wie ihre einstige Heimat an.
Sie ballt die Faust so fest, dass ihre Hand taub wird. Ihre Erinnerungen sind schrecklich unbeständig. Aber das müssen sie wohl sein, um nicht nur den Palast, sondern auch sich selbst zu täuschen. Wenn sie zu lange in die flache Landschaft hinausblickt, dreht sich ihr vor Abscheu und Sehnsucht der Magen um. Irgendwo in dieser Provinz, am Grund einer tiefen Schlammpfütze, verwest der Körper des Mädchens, in dem sie auf die Welt kam. Der Ort hier mag sich fremd anfühlen, doch die Verbindung zwischen ihr und jenem Mädchen hat sie hierhergeführt. Sie war es, die im Himmelspalast ihre Hand gelenkt und sie dazu gebracht hat, die letzten fünf Jahre als Ausgestoßene statt in Saus und Braus zu verbringen.
»Seltsam«, bemerkt Calla. »Gestern Nacht war es noch nicht so kalt.«
Und noch während sie das sagt, sinkt die Temperatur um ein paar Grad mehr. Ein bitterer Geschmack macht sich in ihrem Mund breit. Ihr Herz pocht schneller.
»Was?«
Auf den spitzen Schrei der Rätin hin blickt Calla schnell zu ihr hinüber.
»Was ist los?«
Zuerst antwortet Venus nicht und bleibt nur reglos stehen, das Handy fest umklammert.
Calla stößt sich von der Mauer ab. »Rätin Hailira«, sagt sie so scharf, dass Venus sich anspannt und ihr endlich in die Augen schaut. »Ich frage noch mal: Was ist los?«
»Sie haben General Poinin gefunden«, flüstert Venus und schiebt die Hand über die Sprechmuschel. »Er … er ist tot.«
Mit einem Mal scheint hinter der eisigen Luft mehr zu stecken als nur eine Wetteranomalie. »Wo? Im Östlichen Hauptdorf?«
»Nein, hier bei uns im Westlichen. Vor der Kaserne«, presst Venus hervor, und schon rennt Calla los und schnappt sich das nächstbeste Pferd. »Sie versuchen, seine Einheit zu kontaktieren, aber niemand meldet sich …«
»Bin gleich wieder da«, fällt ihr Calla ins Wort und schwingt sich in den Sattel. Die Gardisten wuseln unruhig durcheinander, irritiert vom plötzlichen Tumult.
»Wartet!« Venus steckt das Telefon weg. »Wenn Ihr nachsehen wollt, was passiert ist, komme ich …«
»Nein! Sie bleiben hier. Bei der Palastgarde.« Sie zeigt auf einen der Gardisten und wirft ihm einen drohenden Blick zu. »Du da, behalt sie im Auge!«
Calla lässt die Zügel schnalzen und das Pferd prescht los. Sie ist sich nicht ganz sicher, wie sie zur Kaserne gelangt, die sie vorhin inspiziert haben, aber ehe sie sich Gedanken machen kann, zieht Rincun bereits mit mörderischer Geschwindigkeit unter ihr vorbei. Der Wind peitscht ihr schmerzhaft ins Gesicht. Schwer atmend hält sie sich zum Schutz den Kragen vor die Nase und reitet einhändig weiter. Entlang der Hauptstraße, die durch das Westliche Hauptdorf führt, wirbelt ihr Pferd eine dichte Staubwolke auf. Sie galoppiert an zwei ärmlichen, kargen Wohnsiedlungen vorbei, wirft einen Blick auf die Eingangspforten und überfliegt die Schilder.
Da. Die Kaserne muss in der Nähe dieser braunen Bäume liegen. Daran erinnert sie sich noch.
Abrupt hält sie an und schwingt sich vom Pferd. Es ist totenstill. Höchst beunruhigend in Anbetracht der Haupteinkaufsstraße, die gleich rechts von ihr verläuft. Trotz Jacke fröstelt Calla jetzt, und sie hält inne, um einen Blick auf die Wolken zu werfen, die plötzlich immer finsterer werden. Für all das muss es eine plausiblere Erklärung geben als das, was ihr Bauchgefühl ihr sagt.
»Was ist hier nur los?«, murmelt sie vor sich hin, umrundet schnurstracks die Kaserne und zieht ihr Messer aus dem Stiefel. Weil sie ihr Schwert nicht mitnehmen durfte – diese Delegation kommt in Frieden, Prinzessin Calla; die Palastgarde ist Euer effektivster Schutz –, hat sie eine kürzere Klinge aus dem Palast mitgehen lassen. Der Wind bläst ihr das lange Haar kreuz und quer ins Gesicht.
Hinter der Kaserne fällt ihr Blick auf drei Männer in Beamtenkleidung: Angestellte aus dem Yamen, die man vermutlich gleich zum Kundschaften losgeschickt hat, nachdem man auch im Östlichen Hauptdorf keine Spur von Pionin entdeckt hat.
»Eure Hoheit!«, grüßt einer von ihnen steif, als Calla näherkommt. Gleich bei ihrer Ankunft wurde sie mit der Delegation bekannt gemacht, sie erinnert sich aber nicht mehr an seinen Namen. Er verbeugt sich, doch Callas Aufmerksamkeit gilt allein dem toten General, der vor ihm liegt.
Ein Arm ist unter ihm eingeklemmt, der andere ausgestreckt. Seine linke Gesichtsseite ist in den Boden gedrückt, der Blick glasig, die Augen weinrot. Schwer zu glauben, dass er vorhin noch pausenlos geplappert hat. Vielleicht hatte ein Dörfler die Schnauze voll von seinen Forderungen, ihnen den Glauben an die alten Götter auszutreiben.
»Was ist passiert?«, fragt Calla und steckt ihr Messer weg.
»Schwer zu sagen«, antwortet der Beamte in der Mitte.
»Der Leichenbeschauer ist schon auf dem Weg«, sagt der dritte. »Wir haben den Vorfall umgehend gemeldet. Die finden es bestimmt bald raus.«
»Macht Platz. Ich erspare euch die Ermittlung.« Calla beugt sich über General Poinin und dreht ihn herum. Im ersten Moment ist seine linke Gesichtshälfte knallrot, im zweiten wird sie schneeweiß. Den Beamten muss das ebenfalls aufgefallen sein, denn einer von ihnen stößt einen angeekelten Laut aus, und Calla bedeutet ihm, zurückzutreten. Sie geht in die Hocke und schiebt die Jacke des Toten hoch.
Zwei Beamte würgen.
»Ich hab euch doch gesagt, ihr sollt Platz machen.«
In der Brust der Leiche klafft ein tiefes Loch. Ein brutaler Anblick, doch das Erschreckendste daran ist das fehlende Blut: Es ist ein glatter, kreisförmiger Schnitt auf Höhe des Sternums, die Rippen wurden sauber durchtrennt. Als Calla die Hand in die Öffnung steckt, wird das Würgen hinter ihr lauter. Behutsam tastet sie die bleichen Knochen ab. Glatte, saubere Kanten. Als die Klinge angesetzt wurde, muss schon kein Blut mehr geflossen sein.
»Das ergibt keinen Sinn«, murmelt Calla und steht auf.
Es passiert schon wieder. In San-Er experimentierte der Sichelbund unter Leida Milius Aufsicht mit Qi herum. Doch die sitzt derzeit in einer Kerkerzelle unter dem Palast fest, und der Einflussbereich des Sichelbundes beschränkt sich auf San-Er – wer also steckt dahinter?
Calla lockert ihren Kragen und zieht ihn vom Gesicht weg. Die Temperatur normalisiert sich wieder, ebenso rapide wie sie vorhin abgefallen ist.
»Was hatte er hier draußen überhaupt zu suchen?«, fragt der erste Beamte und fächelt sich Luft zu, um seinen Brechreiz zu unterdrücken.
»Wahrscheinlich wollte er mal sehen, ob ihm für seinen Bericht noch einfällt, warum der Palast mehr in die Soldaten investieren sollte«, antwortet der dritte, der sich immer noch die Nase zuhält. »Poinin hat sich für eine Umverteilung der Gelder eingesetzt: Weniger für die Agrarwirtschaft, mehr fürs Militär.«
»Tja« – der zweite Beamte sucht das Gras um die Leiche herum ab – »vom Bericht ist jedenfalls nichts zu sehen.«
»Vielleicht hat er ihn schon eingereicht.«
»Aber was hatte er dann hinter der Kaserne zu suchen?«
»Was fragst du mich? Wenden wir uns doch einfach da drin an einen Leutnant …«
Zu diesem Gespräch hat Calla nichts beizutragen. Wortlos macht sie auf dem Absatz kehrt und begibt sich zum Kaserneneingang. Auf ihren abrupten Abmarsch hin verstummen die Beamten, jedoch ohne ihr zu folgen. Als sie wieder um die Ecke biegt, durch das erhöhte Eingangstor schreitet und die ummauerte Anlage betritt, ist sie allein.
»Meine Güte«, murmelt sie.
Als Yilas während der Spiele entführt wurde, fanden sie sie ohnmächtig im Hohlen Tempel, inmitten eines reglosen Körperhaufens. Inzwischen ist genug Zeit verstrichen, dass Calla sich die Einzelheiten dieser Szene ins Gedächtnis rufen kann, ohne dabei zusammenzuzucken, stets begleitet von der Frage, ob es in dieser Nacht vielleicht einen leichteren Ausweg gegeben hätte – ohne rohe Gewalt, ohne Stich ins Herz, ohne sich von Anton Makusa retten zu lassen und unter seiner Aufsicht wieder zu Kräften zu kommen. Sie erinnert sich an seine Finger in ihrem Haar, an das flüchtige Gefühl von Frieden, das seinen Laken anhaftete.
Und wann immer es ihr gelingt, sich aus diesem Gedankengang zu reißen, zieht es sie unweigerlich zum Hohlen Tempel zurück. Sie hätte mehr daran setzen sollen, die anderen dort zu befreien; die namenlosen Entführten, die einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Sobald Yilas in Sicherheit war, betrachtete sie die Aufgabe als abgehakt. Dabei lagen dort noch so viele andere. Manche atmeten noch, waren noch am Leben. Sie ist nie zurückgekehrt, um sie zu holen.
Calla atmet aus und sieht sich innerhalb der Kasernenmauern um: das Gras, die Wassertröge am anderen Ende, die Strickleitern am Wachturm, der sich hoch über die Mauer erhebt. Und die Leichen, unzählige, überall verstreut, alle in Soldatenuniform.
Calla geht auf den nächsten Toten zu. Er sitzt in sich zusammengesackt da, das Schwert in der Scheide. Sie wagt kaum zu atmen, als sie sich herabbeugt und vorsichtig seine Schulter anschiebt, sodass sein Kopf zurückklappt und das Gesicht in den sich rasch verfinsternden Himmel gerichtet ist.
Er weist keine Verletzungen auf. Stirnrunzelnd öffnet sie seine Lider, die Augen darunter sind glasig, aber nicht farblos. Sie tastet seine Brust ab, durchsucht die Uniform. Seine Haut ist unversehrt, auch die Organe scheinen unbeschädigt zu sein, kein Blut ist auf dem Boden zu sehen.
Er scheint einfach tot umgefallen zu sein, ohne ersichtlichen Grund.
Calla steht auf. Die Kaserne beherbergt mehr als dreißig Soldaten. Wie kann es sein, dass sie alle einfach umgekippt sind, ohne das geringste Anzeichen von Gegenwehr?
»Was ist hier nur passiert?«, murmelt sie. »War hier ein Gott auf Rache aus?«
Von den Trögen her erklingt ein Rascheln.
Calla zieht blitzschnell ihr Messer. Noch ein Geräusch, ein unterdrücktes Schniefen. Sie wirft das Messer einmal hoch, um es danach fester im Griff zu haben.
Da regt sich etwas – und gerade, als sie es werfen will, tauchen hinter dem Trog zwei Kinderköpfe auf.
»Scheiße.« Calla bremst sich in letzter Sekunde und steckt die Waffe zurück in ihren Stiefel. »Hey! Ihr da!«
Sofort tauchen die beiden wieder ab.
Calla hastet los. Eigentlich können sie nicht wegrennen, aber sie will ihnen so schnell wie möglich die Angst nehmen. Vor dem Trog hält sie an, setzt ihre freundlichste Miene auf und beugt sich darüber.
»Hallo, ihr. Geht’s euch gut?«
Die Kinder kreischen los.
»Pssst, psssst!«, zischt sie. Immerhin hat sie es versucht. Ihre freundlichste Miene ist allem Anschein nach weniger freundlich als gedacht. »Ist ja gut, ihr seid in Sicherheit!« Zum Beweis hebt sie die Hände. »Seht ihr? Ich tu euch nichts, versprochen.«
Der Junge holt zitternd Luft, schlingt die Arme um sich und wird ruhiger. Das Mädchen zu seiner Rechten braucht etwas länger, ihr hektischer Atem geht erst nach und nach langsamer.
»Na also. Euch wird nichts passieren.« Auf der anderen Seite des Troges geht Calla in die Hocke, um mit ihnen auf Augenhöhe zu sprechen. »Könnt ihr mir verraten, was hier passiert ist? Was treibt ihr denn hier?«
Keine Antwort. Für den Bruchteil einer Sekunde fragt sie sich, ob die zwei überhaupt Talinesisch sprechen, doch diesen Gedanken wischt sie ebenso schnell beiseite, wie er gekommen ist. Kein Kind hier wächst ohne Talinesisch auf. Wäre das der Fall, hätte längst jemand beim Yamen angeklopft, um die entsprechende Familie gegen eine ordentliche Belohnung ans Messer zu liefern, worauf der Bürgermeister sich direkt der Bestrafung angenommen hätte.
Dennoch …
»Mir könnt ihr’s sagen«, flüstert sie. Die Vergangenheit bricht wie eine Welle über sie herein, rauscht in ihren Ohren und hinterlässt einen sonderbaren Geschmack auf der Zunge. Das Wort kommt ihr über die Lippen, ehe sie weiß, woher: Bitte, nichts weiter – und das, obwohl sie der Überzeugung war, den Dialekt Rincuns vergessen zu haben. Sofort spitzen die Kinder die Ohren, ihre Augen blitzen.
»Du sprichst unser Geheimnis«, stellt der Junge fest.
»Ja.« Calla wirft einen Blick über ihre Schulter. Bald werden die Beamten aus dem Yamen hier sein. Sie hat gezeigt, auf welcher Seite sie steht; jetzt wechselt sie wieder zurück ins Talinesische. »Ich bin wie ihr. Ich kann helfen. Erzählt mir, was hier passiert ist.«
Die Kinder tauschen einen abwägenden Blick aus. In diesem Moment wirken sie viel weiser, viel verständiger, als man von jemandem in diesem Alter erwarten sollte. Schließlich treffen sie eine Übereinkunft. Das Mädchen nickt und lehnt sich an den Trog, nur ihre grauen Augen sind über der Holzkante sichtbar.
»Die lassen uns hier spielen und geben uns Reis ab, wenn von den Mahlzeiten was übrig bleibt«, flüstert die Kleine bedächtig. »Wir sind keine Soldaten.«
Calla verkneift sich ein Schmunzeln. »Das hab ich mir schon gedacht. Ist hier jemand reingekommen und hat die Soldaten angegriffen?«
»Nein, niemand.« Der Junge fasst sich ein Herz und steht auf. »Hier in der Kaserne ist es auf einmal eiskalt geworden. Mutter hat gesagt, wenn’s so plötzlich kalt wird, sollen wir wegrennen. Kälte bedeutet, jemand stiehlt Qi. So ist unser Urgroßvater umgekommen.«
Jemand stiehlt Qi? Aus den Augenwinkeln betrachtet Calla die Leichen, die überall verstreut herumliegen. Vor ihrem geistigen Auge blitzen wieder die aufgeschnittenen Leiber im Hohlen Tempel auf. Qi stehlen. Normalerweise kann man eine solche Behauptung getrost unter provinziellem Aberglauben verbuchen. Manche Menschen hier glauben auch, wenn man zu neugierig ist, springen die Götter in einen hinein und saugen einem das Qi aus.
»Ist das …« Calla weiß nicht, wie sie die Frage formulieren soll, ohne wie eine zwielichtige Städterin zu klingen, die die alten Götter für tot hält. »Passiert das hier öfter?«
Die beiden schütteln den Kopf und schweigen.
»Aber ihr seid nicht weggelaufen.«
»Das war meine Idee«, verkündet die Kleine. Auch sie steht jetzt auf, als sähe sie sonst ihre Ehre in Gefahr. Sie geht Calla kaum bis zur Hüfte. Ihr kommt der absurde Gedanke, dass sie das Mädchen einfach hochnehmen und einstecken könnte. »Verstecken ist mir sicherer vorgekommen.«
»Zu recht«, murmelt Calla. Inmitten von Tod und Verderben sind zwei Dorfkinder völlig unversehrt geblieben.
»Da seid ihr ja!«
Calla dreht sich um. Eine Frau kommt in den Kasernenhof gerannt, ihre Augen ebenso grau wie die der Kinder. Die beiden hasten um den Trog herum zu ihrer Mutter. Da fallen Calla die Kerben im Holz auf: Drei Linien, so schlicht, dass es auch Zufall sein könnte.
Doch vor dem Hintergrund des Unerklärlichen ist kaum etwas zufällig.
»Was ist das?«, fragt Calla und zeigt auf die Striche.
»Eine Sigille«, erklärt das Mädchen heiter, die Finger im Kleid der Mutter vergraben. »Zum Schutz …«
»Deera«, fällt sie ihrer Tochter ins Wort, und im Tonfall schwingt eine subtile Ermahnung mit. »Was haben wir übers Fabulieren gesagt?« Die Frau blickt zu Calla. »Tut mir schrecklich leid. Darf ich die zwei jetzt nach Hause bringen? Ein solcher Anblick sollte ihnen wirklich erspart bleiben.«
Eigenartig, dass die Frau nicht nachgefragt hat, was hier vorgefallen ist. Auch die vielen Toten scheinen sie nicht zu schockieren.
»Natürlich.«
»Eure Hoheit!«, tönt es vom Eingang her. Die drei Beamten haben sie eingeholt. »Eure Hoheit, die Palastgarde ist gleich da!«
Calla zerbricht sich immer noch den Kopf über die rätselhafte Situation und nimmt die Ankündigung nur am Rande wahr.
»Hoheit?«, ruft die Kleine erstaunt, und Calla nickt knapp. Zum ersten Mal kommt ihr der Gedanke, dass die Provinzen womöglich doch mehr Geheimnisse vor dem Palast haben als gedacht.
»Beeilt euch lieber, ehe die Garde zum Aufräumen kommt«, sagt Calla freundlich. Sie sieht die Mutter an. »Falls die beiden noch mehr zu dem Vorfall sagen können, kontaktieren Sie mich bitte direkt über den Bürgermeister.«
Die Frau senkt den Kopf. »Sehr wohl, Hoheit.«
Ich bin wie ihr, hat Calla vorhin gesagt. Doch alles, was die Kinder gehört haben, als die Beamten nach ihr gerufen haben, war: Ich habe nichts mit euch gemein.
Sie blickt ihnen nach. Die Beamten treten in den Innenhof und reden wild durcheinander, diskutieren, was hier passiert ist und wie es dazu kommen konnte. Aus Angst, ihre Aufmerksamkeit auf die Sigille zu lenken, verzichtet Calla auf einen weiteren Blick; stattdessen zeichnet sie die drei Kerben auf ihrem Handrücken nach. Das erinnert sie an die zwei Linien, die sich die Sicheln im Heiligen Tempel aufgemalt hatten.
»Scheiße«, flüstert sie.
Gerade als die Palastgarde im Kasernenhof ausschwärmt, fasst Calla einen Entschluss und stürmt hinaus.
»Das Yamen soll sich um alles kümmern«, befiehlt sie. »Wir brechen auf.«
Kapitel 3
An Galipei Weisannas fünfzehntem Geburtstag stellte der Palast ihn Prinz August zur Seite. Man wählte ihn zufällig aus einer Liste aller Weisannas aus, die ungefähr im Alter des Prinzen waren und ihm, getarnt als Spielkamerad, wie ein Schatten überall hin folgen konnten. Ebenso gut hätte es einen von Galipeis Cousins treffen können: Untereinander waren alle Weisannas austauschbar. Wichtig waren nur die silbernen Augen, die mit dem Gen einhergingen, das sie vor einer Übernahme schützte.
Doch wie der Zufall wollte, landete der Finger des Ratsmitglieds, das die Liste erstellt hatte, auf Galipeis Namen, der daraufhin gleich über die übliche Befehlskette weitergegeben wurde. Damals hatte Kasa August gerade als seinen Nachfolger bestimmt. August brauchte jemanden, der ihm Ärger vom Leib hielt, insbesondere nach dem kolossalen Eklat im Erdpalast: Man hatte Otta Avia und Anton Makusa dabei erwischt, wie sie die königliche Schatzkammer plündern wollten. Jetzt, da Otta zwischen Leben und Tod schwebte, und der achtzehnjährige Anton als körperloser Exilant durch die Straßen San-Ers irrte, hatte der arme Prinz kaum noch Freunde.
»Hier entlang, bitte.«
Sie brachten Galipei in einen der Salons, der im ersten Stock des Ostflügels lag und in den kaum Tageslicht drang. Der Staubwolke zufolge, die ihm zur Begrüßung entgegenwirbelte, wurde der Raum kaum genutzt. Auf seinen Hustenanfall hin warf ihm die Anführerin der Garde, Mayun Miliu, einen fragenden Blick zu; und obwohl sie nichts weiter sagte, hielt Galipei das Kribbeln in seiner Kehle mit Müh und Not im Zaum, denn eingeschüchtert, wie er war, wollte er wirklich nicht noch mehr Aufmerksamkeit auf sich lenken. Seine Tagesaufgaben teilte man ihm in der Garde sonst immer recht distanziert mit: Angesprochen wurde er nur gemeinsam mit den anderen jungen Weisannas. So viel individuelle Beachtung war ihm noch nie zuteilgeworden, und mit der Anführerin der Garde war er bisher nicht persönlich in Kontakt getreten. Sie hatte ihre Tochter Leida mitgebracht, der Galipei bei diesem Anlass ebenfalls zum ersten Mal begegnete. Aber in Galipeis Erinnerung wird der Moment immer von Augusts Ankunft überschattet.
»Setz dich ruhig«, sagte Mayun. »Darf ich dir etwas bringen? Wasser vielleicht?«
Galipei schluckte. Seine Kehle war zwar staubtrocken, doch er würde sich unterstehen, Mayun Miliu um ein Glas Wasser zu bitten. »Nein, vielen Dank.«
Unter ihm knackte der Stuhl. Der Boden verschwand fast gänzlich unter dem großen Teppich, der jedoch nicht das Knarren der Dielen zu dämpfen vermochte. Die alten Porträts an den Wänden blickten finster auf den Kreis aus Holzstühlen hinab. Ansonsten gab es hier wenig zu sehen. Galipei findet es nicht verwunderlich, dass er sich auch heute noch an jede noch so kleine Einzelheit des Zimmers erinnert, von den silbernen Vorhängen bis hin zur weinroten Tapete.
»Schau nicht so verkrampft.« Mayun Miliu ließ sich auf den Stuhl gegenüber fallen. »Betrachte das einfach als kleine Anpassung deiner Tagesroutine. Du wirst wie vorher auch essen, schlafen und zur Schule gehen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass du dabei ab jetzt immer an der Seite des Prinzen sein wirst.«
Ihre Tochter blieb hinter ihr stehen und starrte Galipei mit unverhohlener Neugier an. Sie hatte sich Glitzer auf die Stirn geschmiert – Miliublau.
Bis zu diesem Moment hatte man ihm im Palast keine besondere Beachtung geschenkt. Er war nur ein Junge von vielen, die frühmorgens trainierten und tagsüber in die Akademie geschickt wurden, damit sie als Gardisten oder Leibwächter später nicht als Analphabet dastanden. Nur eine Waise von vielen, die am Abend nichts zu tun hatte, außer weiter zu trainieren. Schon bevor seine Eltern im Dienst ums Leben kamen, war er dem König als austauschbare Ressource zum Geschenk gemacht worden. Und als solche lief man den Milius oder Shenzhis natürlich nicht über den Weg.
Aber dann kam August hereinspaziert und Galipeis Leben schlug eine neue Bahn ein. Damals hatte er kein Mitspracherecht gehabt, aber hätte man ihn im Nachhinein noch einmal vor die Wahl gestellt, hätte er alles wieder genauso gemacht.
»Hallo.« August neigte den Kopf zum Gruß. »Du gehörst wohl mir.«
Ja, beschloss Galipei. August war sein ganzer Lebenssinn. Was August brauchte, würde er beschaffen; hatte August einen Wunsch, würde er ihn erfüllen. In den nachfolgenden Jahren war er August nicht nur ein Gefährte, sondern ein verlängerter Arm. Galipei ging dorthin, wo der Prinz nicht hin konnte und bedachte, was er nicht auf dem Schirm hatte. Galipei brauchte keine Anerkennung. Er wollte nur seine Bestimmung erfüllen, und seit August Shenzhi bot ihm jeder Tag schier endlose, erquickende Gelegenheiten dazu.
Vermutlich ist das der Grund, warum Galipei sich seit einer Weile aus der Bahn geworfen fühlt. Jahrelang gab es für ihn nur einen vorgezeichneten Weg, eine Bestimmung, die einen Großteil ihrer Zeit gemeinsamen ausfüllte. Und eines Nachts stieg August aus dem Bett, kauerte sich neben Galipei hin und setzte an, sie ihm ins Ohr zu flüstern. Galipei wollte sich aufsetzen und fragen, was los war, doch August legte ihm die Hand auf die Schulter und drückte ihn wieder auf die Matratze, den Finger der anderen Hand an den Lippen. Vor Augusts Gemächern hielten ein paar Weisannas Wache. Er sprach so leise, dass man ihn kaum verstand. Galipei war der einzige Zeuge.
»Ich werde Kasa stürzen.«
Er musste seinen Leibwächter nicht einmal überreden, ihn bei seinem Unterfangen zur Hand zu gehen, denn in Galipeis Augen war das keineswegs Hochverrat: Seine Loyalität galt nur einem im Königshaus.
»In Ordnung«, antwortete er und hob die rechte Hand, als schwöre er seinem neuen König die Treue. »Wie stellen wir das an?«
Und jetzt war es so weit. August saß auf dem Thron der Zwillingsstädte. Dennoch scheint sich in San-Er kaum etwas verändert zu haben, was vielleicht der erste verräterische Gedanke ist, den Galipei je gegen August gehegt hat.
»Scheiße.«
In Galipeis Erinnerung nimmt August seine Hand und flicht ihre Finger ineinander, während ein seltenes Lächeln seine Lippen umspielt. Im Hier und Jetzt allerdings knallt Galipeis Faust mit voller Wucht gegen den Boxsack, den er schon seit gut vier Stunden bearbeitet, und knickt weg, worauf greller Schmerz durch sein Handgelenk zuckt. Die Bandagen um seine Fingerknöchel lösen sich allmählich. Dabei gehen ihm nur zwei Gedanken in Dauerschleife durch den Kopf. Erstens: Mit August stimmt etwas nicht. Zweitens: Es ist verdammt heiß hier drin.
Der Boxsack schwingt hin und her. Endlich legt Galipei eine Pause ein, atmet laut aus und stützt sich mit den Händen auf den Knien ab.
Die Boxhalle befindet sich im Süden Ers, aber so oft, wie die Türen aufschwingen, könnte man glatt meinen, man sei hier mitten in San. Die meisten Besucher sind Geschäftsmänner, die in der Gegend wohnen und während ihrer Mittagspausen in Sportklamotten auf die Säcke und Holzfiguren eindreschen. Galipei kommt gern her, trotz der sechs Treppenläufe, die er dafür auf sich nehmen muss, und der fragwürdigen Qualität der Boxsäcke, die mit Lumpen gefüllt und dementsprechend unförmig sind. In den Palastsporthallen ist die Ausstattung zwar vom Allerfeinsten – für die Boxsäcke wurde extra Sand aus den Küstenprovinzen angekarrt –, aber dafür ist er dort ständig den Blicken seiner Verwandten ausgesetzt. Beim Aufstehen steht ein Weisanna vor seinem Zimmer, beim Frühstück isst ein Weisanna neben ihm. Und überhaupt scheint er plötzlich kein Wort mehr mit August unter vier Augen wechseln zu können, denn jetzt ist nicht mehr nur Galipei sein Leibwächter, nein, jetzt verfügt er über eine ganze Leibwache und Galipeis Verwandte wuseln in ständiger Alarmbereitschaft um August herum.
Hier hingegen ist er ganz für sich, niemand beobachtet ihn. Als Galipei die Arme nach hinten durchstreckt, um die Anspannung in seinen Schultern zu lösen, schlägt er fast einen Mann, der direkt hinter ihm steht. Der aber zuckt nicht einmal mit der Wimper. Tatsächlich hat er es kaum bemerkt, obwohl Galipei ihn nur um Haaresbreite verfehlt hat.
Galipei wischt sich den Schweiß von der Stirn. Er sollte abhauen, ehe er wirklich noch mit jemandem aneinandergerät. Jede öffentliche Räumlichkeit in San-Er ist so platzsparend wie möglich angelegt – in der Boxhalle hier ist alles mit Seilen abgeteilt, damit mehr Leute in einen Bereich passen. Auch haben die Betreiber die Umkleiden mit Vorhängen in den Ecken abgetrennt, statt eigene Räume dafür einzuplanen. An der Decke dreht sich ein Ventilator, der Galipei auf dem Weg zu einer Umkleideecke zwar kaum abkühlt, dafür aber den Vorhangzipfel tanzen lässt. Galipei reißt ihn beiseite und öffnet seinen Spind. Auf dem Pager darin blinken ein paar neue Nachrichten auf.
Wo steckst du?
Bitte komm bald wieder
Die Mauererneuerung soll bald losgehen und mich hat keiner informiert??????
Und findet die Gala dieses Jahr statt?
Bestimmt nicht, oder?