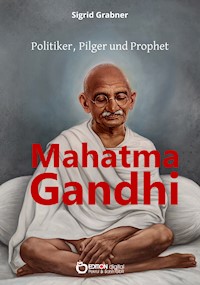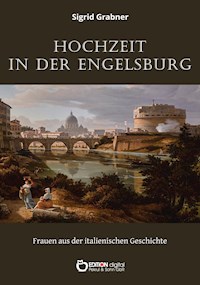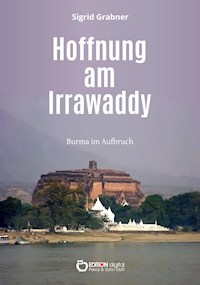8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Am 29. Oktober 2022 wird die heute in Potsdam lebende Schriftstellerin Sigrid Grabner 80 Jahre alt. Rechnet man nach, dann kommt man logischerweise auf den Jahrgang 42 – so auch der Haupttitel des ersten Bandes der Autobiografie der Autorin, Indonesienkundlerin und Katholikin. Jahrgang 42, das bedeutet auch, dass die in Böhmen geborene kleine Sigrid in einem Kriegsjahr geboren wurde, und wie wir Nachgeborenen wissen, sollte dieser Krieg noch weitere 31 schreckliche Monate dauern. Unschwer kann man sich vorstellen, dass ein solcher Kriegsjahrgang für die Zukunft nichts Gutes verhieß. Und schon die allerersten Sätze dieser bewegenden Selbstlebensbeschreibung machen ebenso betroffen wie zugleich neugierig: Mein Leben war unerwünscht. Die Welt, in der ich ankommen wollte, bot alles auf, mich zu vernichten: Feuer, Wasser, Stürme, Erdbeben. Ich klammerte mich am Mutterboden fest, stillte meinen Durst mit Essig, nährte mich von Abfall, duckte mich vor Angriffen – ein unaufhörliches Ringen um Leben und Wachsen gegen den Unwillen des mütterlichen Körpers. Warum gab ich nicht auf, ließ einfach los? Niemals würde dieser Kampf ums Dasein enden, nicht im Dunkel dieser Höhle, nicht im Licht, das mir verheißen. Wer oder was zwang mich zu dieser Qual? Trotz allen Gefährdungen wuchs ich, bis ich an die Grenzen des mütterlichen Leibes stieß. Doch nun wollte er, der sich geweigert hatte, mich aufzunehmen, mich nicht freigeben. An mir selber sollte ich ersticken. Ein mutiger Arzt befreite mich in letzter Minute mittels eines geglückten Schnittes. Stolz auf seine Kunst, die Mutter und Kind das Leben erhalten hatte, präsentierte er das Neugeborene: ein Mädchen! Meine Mutter, soeben aus der Narkose erwacht, wandte sich enttäuscht ab. Wenn denn schon ein Kind, sollte es wenigstens ein Junge sein. Außer sich vor Zorn – es war Ende Oktober 1942 und sein erster Sohn war vor einem Monat an der Ostfront gefallen, sein zweiter Sohn würde in der Eiswüste von Stalingrad sterben – fuhr der Arzt sie an. Undankbar sei sie, so ein gesundes, schönes Kind. Meine Mutter rettete sich wieder in die Bewusstlosigkeit. Während der erste Teil der beiden autobiografischen Bände von Sigrid Grabner vom „Jahrgang 42“ bis zum 10. November 1989 reicht, schreibt sie im zweiten Teil „Im Zwielicht der Freiheit. Potsdam ist mehr als Sanssouci“ über die Zeit von 1989 bis zur Gegenwart einer bewegenden Wiederbegegnung mit ihrer böhmischen Heimat im Sommer 2018.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 661
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Sigrid Grabner
Jahrgang 42
Mein Leben zwischen den Zeiten
ISBN 978-3-96521-655-6 (E-Book)
Umschlaggestaltung: Ernst Franta
Das Buch erschien 2003 bei: Evangelische Verlagsanstalt GmbH, Leipzig.
2022 EDITION digital
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
Den Freunden und Weggefährten
I. Teil
Gott warf sich aus seinen,
zum Weinen,
unendlich geöffneten tiefen
Augen auf uns herab.
Franz Werfel
1
Mein Leben war unerwünscht. Die Welt, in der ich ankommen wollte, bot alles auf, mich zu vernichten: Feuer, Wasser, Stürme, Erdbeben. Ich klammerte mich am Mutterboden fest, stillte meinen Durst mit Essig, nährte mich von Abfall, duckte mich vor Angriffen – ein unaufhörliches Ringen um Leben und Wachsen gegen den Unwillen des mütterlichen Körpers. Warum gab ich nicht auf, ließ einfach los? Niemals würde dieser Kampf ums Dasein enden, nicht im Dunkel dieser Höhle, nicht im Licht, das mir verheißen. Wer oder was zwang mich zu dieser Qual? Trotz allen Gefährdungen wuchs ich, bis ich an die Grenzen des mütterlichen Leibes stieß. Doch nun wollte er, der sich geweigert hatte, mich aufzunehmen, mich nicht freigeben. An mir selber sollte ich ersticken. Ein mutiger Arzt befreite mich in letzter Minute mittels eines geglückten Schnittes. Stolz auf seine Kunst, die Mutter und Kind das Leben erhalten hatte, präsentierte er das Neugeborene: ein Mädchen!
Meine Mutter, soeben aus der Narkose erwacht, wandte sich enttäuscht ab. Wenn denn schon ein Kind, sollte es wenigstens ein Junge sein.
Außer sich vor Zorn – es war Ende Oktober 1942 und sein erster Sohn war vor einem Monat an der Ostfront gefallen, sein zweiter Sohn würde in der Eiswüste von Stalingrad sterben – fuhr der Arzt sie an. Undankbar sei sie, so ein gesundes, schönes Kind. Meine Mutter rettete sich wieder in die Bewusstlosigkeit.
Ihre Brüste gaben keine Milch, sie konnte mich nicht ernähren. Der Arzt, in diesem Jahr des großen Sterbens geradezu davon besessen, Leben zu erhalten, hielt im Krankenhaus eine Zigeunerin versteckt, die er von Zwillingen entbunden hatte. Eines der Kinder war gestorben, und die Frau besaß Milch für zwei. Der Arzt bat meine Mutter, mich der Zigeunerin an die Brust legen zu dürfen. Für mein Leben riskierte er das seine. Er schützte nicht nur eine Zigeunerin, er verstieß auch gegen das Gesetz zur Reinhaltung der arischen Rasse. Zigeuner seien lebensunwert, zur Vernichtung bestimmt wie Ungeziefer, eiferte der Pöbel, der sich zum Herrscher und Herrenmenschen ernannt hatte. Was konnte schon aus einem arischen Kind werden, das mit Zigeunermilch aufgezogen wurde! Den Arzt, meine Mutter und die Zigeunerin beschwerten solche Gedanken nicht, und so reckte und streckte ich mich an der vollen braunen Brust zum lustvollen Wachsen.
Ich weiß weder, was aus der Zigeunerin und ihrem Kind, noch was aus dem Chefarzt geworden ist. Ich war mit Überleben beschäftigt: ein uneheliches Kind mit einem tschechischen Vater, der ab und zu heimlich auf Besuch kam, und mit einer Mutter, die schwer arbeiten musste, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Es gab keine Großeltern, nur immer neue Gesichter, andere Hände: freundliche, gleichgültige, nachlässige. Beim Wickeln fiel ich vom Tisch; ich kämpfte gegen Masern, Mundfäule und Windpocken, überstand alles unbeschadet, war fröhlich und lächelte auch jene an, die finster dreinblickten. Mein Appetit war maßlos, als ahnte ich, dass mir Hungerzeiten bevorstünden. Im Kindergarten setzte man mich zu den Mäkligen, die im Essen herumstocherten. In Windeseile leerte ich meinen Teller, um mich dann über die meiner Nachbarn herzumachen. Die schätzten plötzlich, was ich begehrte, und wussten ihr Eigentum nicht anders zu verteidigen, als es in sich hineinzuschlingen.
Sprache faszinierte mich. Mit Worten konnte man andere zum Lachen und Weinen bringen, Ereignisse in Gang setzen, Schrecken hervorrufen, sich verweigern, Leichtigkeit gewinnen. Vom Laufen hielt ich nichts. Lange vermied ich es, auch nur den Versuch zu unternehmen, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Ich ließ mich zu Boden fallen und brüllte, bis man mich wieder auf den Arm nahm. So trieb ich es bis zu meinem zweiten Geburtstag. Meine besorgte Mutter suchte Rat bei einem Arzt, der mich gründlich untersuchte und dann lachend meinte: Dem Kind fehlt nichts, es ist nur faul.
Ich fühlte mich durchschaut und zugleich missverstanden. Was hieß hier faul! Fliegen wollte ich, schweben, in Licht und Ewigkeit, wie ich es gewohnt war. Mutter blieb nichts übrig, als mich weiterhin zu tragen und zu fahren. Auch in das Haus ihrer Kindheit in den Hügeln nördlich von Leitmeritz, wo die Schwägerin mit ihren Kindern wohnte, der Jüngste ein halbes Jahr älter als ich. Walter konnte kaum sprechen, aber er lief wie ein Wiesel, er neckte mich und suchte vor meiner Wut das Weite. Lachte mich aus. Worte, mit denen ich sonst die Erwachsenen betörte, vermochten nichts gegen die schnellen Beine meines Vetters. Mein Urvertrauen in die Wirkung von Sprache und damit in die Leichtigkeit des Seins wurde erschüttert. Heulend hangelte ich mich Schritt für Schritt an der langen Küchenbank entlang und lernte laufen.
Es wurde auch höchste Zeit. Der Krieg, ein feuerspeiender Drache, der junges Fleisch besonders liebt, näherte sich der Stadt, dem Haus, der Wohnung, die mir als Zuflucht dienten. Mit Essen, Lächeln und Reden war ihm nicht beizukommen. Man musste weglaufen und sich verstecken können. Zwar schien der Krieg zu verenden, doch ein sterbendes Ungeheuer kann noch gefährlicher sein als ein lebendiges.
Immer trachtete mir etwas nach dem Leben, das war so gewiss wie ich atmete. Und ebenso gewiss zwang mich von Anbeginn etwas, um mein Leben zu kämpfen. Ich aß, redete, lächelte und lief um meine Existenz. Aber noch nicht wie ein gejagtes Wild, vorerst spielte ich mit dem unsichtbaren Jäger. Aus kindlichem Übermut und um mir zu bestätigen, dass ich nicht nur bedroht, sondern auch beschützt wurde.
Ich riss mich von Mutters Hand los und lief vor ein fahrendes Auto. Wenige Zentimeter vor mir kam es zum Stehen, der Fahrer schrie meine Mutter an, sie schrie mich an, aber ich freute mich: Ich hatte das Monstrum gestoppt.
Einen ehemaligen Funktionär der NSDAP aus der Nachbarschaft begrüßte ich stets mit einem lauten Heil Hitler!, wobei ich mein zweieinhalbjähriges Ärmchen steil in die Luft riss. Zu meinem höchsten Wohlgefallen lief der Mann davon, sobald er mich nur von ferne sah. Das russische Militärarzt-Ehepaar, das in unserer Wohnung einquartiert wurde, umgab ich dagegen mit solcher Liebenswürdigkeit, dass es bei seiner Abreise einen Koffer mit Lebensmitteln in der Küche zurückließ. Auf der Straße wartete mit laufendem Motor ein Lastwagen voller russischer Soldaten. Ich winkte ihnen zu. Einer von ihnen sprang herunter und warf mich in die Arme seiner Kameraden. Ich genoss das Fliegen, genoss die Liebkosungen der stoppelbärtigen Männer und verschwendete keinen Blick an meine vor Entsetzen erstarrte Mutter. Als der Wagen anfuhr und Mutter mich schon verloren gab, landete ich wohlbehalten wieder in ihren Armen. Jubelnd verlangte ich die Fortsetzung des Spiels.
Doch dann war das Ungeheuer plötzlich da. Ich kannte seinen Namen schon, Mutter nannte es Svoboda, manchmal auch Svoboda-Truppen. Ich wusste nicht, dass Svoboda Freiheit bedeutet und in diesem Fall der Name eines tschechischen Generals war.
Bei den Männern, die mit Knüppeln in die Wohnung stürmten, versagten alle Verteidigungsstrategien. Mein Lächeln und Geplapper besänftigten sie nicht, also schrie ich aus Leibeskräften: Svo-bo-da! Svo-bo-da!, um das Ungeheuer in die Flucht zu schlagen. Mein Geschrei erbitterte sie noch mehr, sie gingen auch auf mich los. Mutter drückte mich an sich und hielt mir den Mund zu. So jagten sie uns die Treppe hinunter aus dem Haus. Auf den Gehwegen drängten sich johlende Menschen, schlugen nach meiner Mutter und spuckten in den Kinderwagen, in dem ich saß. Als ich später in der Schule das Wort Spießrutenlauf hörte, verstand ich ohne Erklärungen, was damit gemeint war. Wir erreichten einen großen Platz, auf dem eng zusammengedrängt Frauen und Kinder standen; zornige Männer trieben uns mal hierhin, mal dorthin, entrissen den Frauen Bündel und mir einen kleinen Teddybären und stießen uns schließlich in einen Viehwaggon. So entkam ich mit knapper Not einer Welt, die Mutter bis an ihr Lebensende Heimat nennen sollte.
Man schrieb den 13. Juli 1945. Der Krieg war schon länger als zwei Monate zu Ende, für mich begann er jetzt. Mit Essen war ihm nicht beizukommen, denn es gab nichts zu essen. Lächeln, Reden und Laufen halfen auch nicht. Meine Ohnmacht verlangte nach Ausdruck. Ich schrie auf dem Sammelplatz, ich schrie im Güterwaggon, ich schrie, bis ich vor Erschöpfung verstummte. Niemand beachtete mich, denn alle Kinder weinten, und manche Erwachsene auch. Wenn ich Mutters Gesicht berührte, fühlte es sich nass, hart und kalt an. Im Waggon stank es, wahrscheinlich nach Schweiß, Tränen und Urin. Und nach Tod. Man warf und stieß die Leichen aus dem fahrenden Zug. Mutter befeuchtete meine Lippen mit ihrem Speichel, und als die menschliche Fracht der Viehwaggons endlich bei Torgau ausgekippt wurde, stopfte sie mir Wurzeln und Kräuter in den Mund, und ich, gierig nach Leben, kaute und schluckte das bittere Zeug.
Wir lagerten am Flussufer; die Elbe hatte den Zug auf die Fahrt ins Nirgendwo begleitet. Wenn sie sich auf Sichtweite näherte, lief der Name von Mund zu Mund, beschwörend und hoffnungsvoll. Ich vergaß das Wort Svoboda und plapperte nach: E-lb-e, mit einem langen „e“ am Anfang, mit aufgeblasenen Backen in der Mitte und einem jähen, fast nur noch gehauchtem „e“ am Ende. Es gefiel mir, und ich wiederholte unablässig: E-lb-e.
Nun nahm der Fluss Tränen, Schweiß und Schmutz der Gestrandeten auf, aber auch die zu Tode Erschöpften und Mutlosen. Einige warfen sich dem Fluss nachts in die Arme, und kaum jemand bemerkte ihr Verschwinden. Ich sah, wie eine Frau mit zwei Kindern an der Hand in den Fluss stieg. Die Kinder wehrten sich, sie weinten, da drückte die Mutter sie unter Wasser. Dann trug auch sie der Fluss davon. Mama!, rief ich und: Hilfe! Doch keiner der Umsitzenden rührte sich von der Stelle.
Mama? fragte ich leise. Sie sind davongeschwommen, weit weit weg, antwortete sie, es geht ihnen besser als uns, sie haben keinen Hunger und Durst mehr.
Obwohl sie mich anblickte, schien sie mich nicht wahrzunehmen. Ihr fremdes Gesicht erschreckte mich. Die anderen nickten und meinten, es wäre das Beste für uns alle, es der Frau mit den Kindern nachzutun. Ich begann zu weinen. Jemand zog mich an sich und sagte: Sie sind jetzt Engel im Himmel. Ich riss mich los. Wie konnten sie Engel im Himmel sein, wenn sie im Wasser verschwunden waren? Lieber Hunger und Durst haben als mit Mutter ins Wasser zu gehen. Ich war sehr erleichtert, als wir aufbrachen und den Fluss hinter uns ließen. Das Wort Elbe, das mir so gefallen hatte, strich ich aus meinem Wortschatz.
In drückender Sommerhitze zogen wir von Ort zu Ort, immer auf der Suche nach einem Dach über dem Kopf und etwas zu essen. Marodierende russische Soldaten überfielen den Trupp, vergewaltigten die Frauen, stahlen die letzten Habseligkeiten. Die Bewohner der Häuser verschlossen die Türen, wenn wir uns näherten. Noch Jahrzehnte später äußerte sich Mutter bitter über die „Reichsdeutschen“. Doch es gab auch Ausnahmen. Eine junge Frau hatte unseren Trupp, der inzwischen nur noch aus etwa zehn Leuten bestand, in ihrem mit Flüchtlingen voll belegten Haus willkommen geheißen. Sie konnte uns zwar nur für eine Nacht aufnehmen, aber in dieser Nacht schliefen wir in eigens für uns bezogenen Betten, und vor dem Aufbruch am Morgen steckte sie jedem ein Paket mit belegten Broten zu. Eine Hochschwangere mit einem kleinen Kind behielt sie dann doch noch in dem überfüllten Haus. Mutter erinnerte sich nicht mehr an den Namen der jungen Samariterin, als sie mir davon erzählte, aber sie hat ihrer dankbar gedacht.
Mit vielen anderen Vertriebenen standen wir auf einem Marktplatz. Kräftige Männer schritten die Reihen ab, musterten uns mit prüfenden Blicken, betasteten die Arme meiner Mutter, wollten ihre Zähne sehen, schüttelten den Kopf, als sie mich bemerkten: zu klein, um zu arbeiten, nur ein unnützer Esser. Schließlich nahm uns doch ein Bauer auf seinem Fuhrwerk mit und wies uns einen Schlafplatz in der Scheune an. Ein paar Tage ging alles gut, Mutter arbeitete, wir bekamen zu essen. Doch dann drängte der Bauer Mutter in eine Ecke und warf sich auf sie, sie entwand sich ihm und trieb ihn mit einer Heugabel vor sich her. Vom Geschrei angelockt, erschien die Bäuerin und schrie nun ihrerseits: Gib’s ihm, dem Hurenbock, gib’s ihm! Dann wies sie uns vom Hof.
Ich lächelte, redete, weinte nicht mehr. Orte und Gesichter zogen an mir vorbei, Worte, deren Sinn ich nicht verstand. Tränen, Seufzer, Flüche. Jesseschmaria und Josef! Himmisakra!
Wieder ein Lager voller Flüchtlinge. Wie ein großer schwarzer Schatten geisterte das Wort Typhus durch die Zelte und Baracken. Es krallte sich an mir fest, es drängte sich an meinen Mund, doch diesmal weigerte ich mich, es nachzusprechen, so widerlich klang es. Als man daran ging, das Lager mit Stacheldraht einzuzäunen, hob Mutter mich in den Kinderwagen und floh zusammen mit anderen Lagerbewohnern in die Herbstnacht. Sie klopften an Türen, baten, versprachen, beschworen, bis sie eine Bleibe fanden. Nur die Frau mit dem kleinen Kind wollte niemand. Vielleicht war Mutter zu stolz zum Betteln, vielleicht hielt sie aber auch die anderen für bedürftiger als sich selbst und ließ ihnen den Vortritt, vielleicht hatten sie Kraft und Mut verlassen. Sie sprach niemals darüber.
Es war kalt und schon dunkel, der Winter stand bevor. Ich fror in meinem Sommerkleidchen und jammerte leise nach etwas zu essen. Mutter schien mich nicht zu hören, sie hockte am Ufer eines Dorfteiches und starrte reglos auf den blinden Wasserspiegel. Endlich stand sie auf, nahm mich auf den Arm und stieg in den Teich. Langsam und ganz ruhig, ohne etwas zu sagen. Ich klammerte mich an sie und schrie gellend: Nicht Teich, bitte! Nicht Wasser, bitte! Doch sie setzte ihren Weg fort, als sei sie taub. Wasser, überall Wasser …
Ein herbeilaufender Mann erfasste die Situation sofort. Er stürmte in den Teich, entriss mich meiner Mutter und zerrte sie hinter sich her. Vor einem nahen Gehöft blieb er stehen, klopfte erst, ein Hund bellte, dann trat er mit den Füßen gegen das Tor und brüllte: Aufmachen, oder ich komme mit dem Beil! Eine erschrockene Frau öffnete. Er herrschte sie an, während er auf uns zeigte: Die wohnen jetzt bei euch. Wenn ihr sie nicht gut behandelt, lasse ich euch an die Wand stellen!
Mutter sträubte sich und wäre, nass wie sie war, davongelaufen, aber nicht ohne ihr Kind. Der Mann hielt mich fest an sich gepresst. Lieber sterben als so leben, weinte sie und fuchtelte wild mit den Armen. Ich hatte sie noch nie so gesehen, sie machte mir Angst. Der Mann stellte mich auf die Erde, um sie zu beruhigen. Ich wollte nicht sterben. Ehe Mutter nach mir greifen konnte, lief ich zu der Bäuerin, schob meine Hand in ihre und sagte: Ich bleibe bei dir. Sie nahm mich auf den Arm und ging voran. Meine Mutter und der Mann folgten ihr. An diesem 15. Oktober 1945 hatten wir nach drei Monaten und zwei Tagen ziellosen Herumirrens endlich eine Bleibe gefunden.
2
Für die nächsten beiden Jahre wurde der Bauernhof in dem Dorf mit dem seltsamen Namen Dörstewitz meine Heimat. Ich kenne den Namen unseres Lebensretters nicht, weil Mutter es vermied, über jenen Abend zu sprechen. Nur einmal erzählte sie beiläufig, sie sei im Herbst 1945 in die KPD eingetreten, weil der Dorfbürgermeister, ein ehemaliger kommunistischer KZ-Häftling, sich ihrer in höchster Not angenommen und uns ein Quartier verschafft habe. Ein Jahr später sei er an Tuberkulose gestorben.
Im Dachgeschoss des Wohnhauses bewohnten wir ein schmales Zimmerchen, das mit zwei Betten, einem kleinen Schrank, einem Ständer mit Waschschüssel und einem Tisch mit Stuhl voll ausgefüllt war. Ein eisernes Öfchen diente als Wärmespender und Kochgelegenheit.
Meine Welt, im vergangenen Vierteljahr auf einen Kinderwagen beschränkt, weitete sich nun zu einem großen gepflasterten, von Gebäuden umstandenen Hof: Wohnhaus, Scheune mit der Dreschmaschine, Taubenschläge, Schaf-, Ziegen-, Enten-, Gänse- und Hühnerställe, Wagenremise, Pferdestall, Kuhstall, Schweinestall, Waschküche und Futterküche, dahinter Gemüse- und Blumengärten. Ein breites Hoftor für die Gespanne und eine Tür führten auf die Dorfstraße. In der Mitte des Hofes lagerte breit ein ständig dampfender Misthaufen über einer Jauchengrube. An derem Rande stand das hölzerne Aborthäuschen, wo sich in schwindelerregender Tiefe menschliche und tierische Exkremente vermischten und einen strengen Geruch verströmten. Von der Plumpe mit dem Waschstein gelangte man direkt in die große Küche. An dem gescheuerten Holztisch fanden mindestens zehn Personen Platz. Der Herd füllte fast ein Viertel des Raumes aus. Eine Standuhr neben dem alten Sofa ließ alle Viertelstunden ihren weichen Gong ertönen. Von der Küche gelangte man in die gute Stube der Bauern und auf einen Flur, von dem aus eine Holztreppe zu den Schlafzimmern der Bauern und unserem Zimmerchen unter dem Dach führte.
Der Hof wurde von drei unverheirateten Geschwistern namens Kahle bewirtschaftet: Alma, die mich an jenem Oktoberabend wortlos auf den Arm genommen hatte, war die Jüngste und im Alter meiner Mutter; sie regierte über die Küche und das Kleinvieh. Die beiden Brüder hatten ihre Gebrechen vor der Einberufung in den Krieg bewahrt. Kurt, der Älteste, war fast taub und Fritz verwachsen, seine linke Hand krümmte sich nach innen, und er ging leicht gebeugt. Die Geschwister ähnelten sich im kleinen, gedrungenen Wuchs und im hellen Blau ihrer Augen. Bei Kurt blickten sie gütig, bei Fritz spöttisch und bei Alma kritisch. Kurt schloss ich sofort ins Herz, obwohl er nie auf meine Fragen antwortete. Aber er lächelte, wenn unsere Blicke sich trafen. Um die Liebe der nüchternen Alma warb ich ausdauernd, denn sie war die Herrin der Speisekammer. Fritz mochte ich nicht sonderlich, er schimpfte oft mit hoher, heller Stimme, und wenn er lachte, klang es wie das Meckern einer Ziege. Auf dem Sofa in der Küche saß immer eine uralte, schwarz gekleidete Frau, schweigend, reglos, die Hand auf einen Stock gestützt. Ich fürchtete mich vor ihr und machte einen großen Bogen um sie. Alma, Fritz und Kurt nannten sie Mutter. Irgendwann verschwand sie. Nun trug Alma schwarze Kleider, trotzdem erschien mir die Küche heller als früher, da die Alte vom Sofa aus alles mit argwöhnischen Blicken verfolgt hatte.
Manchmal kam eine verheiratete Schwester von Kurt, Fritz und Alma zu Besuch, eine energische Frau, der eine Knochenkrankheit bereits den Rücken zu beugen begann. Sie lebte ebenfalls im Dorf. Ihre Tochter Lisbeth, die damals um die zwanzig gewesen sein muss, war der einzige fröhliche Mensch weit und breit.
Die Erwachsenen machten sich in den Ställen und auf den Feldern zu schaffen. Mutter schinderte für Essen und Unterkunft und konnte sich doch den Städtern gegenüber glücklich schätzen, die täglich an die Türen der Bauern klopften, um ihren Besitz zum Tausch gegen Lebensmittel anzubieten.
Wir hätten ja nicht einmal etwas zum Tauschen gehabt. Da Mutter vom Lande stammte, konnte sie zupacken. Obwohl sie nur 1,54 Meter klein und zierlich war, schleppte sie Zentnersäcke auf dem Rücken, wenn es sein musste. Die meiste Zeit des Tages war ich mir selbst überlassen. Ich erkundete den Hof und die Ställe, suchte Schutz und Unterhaltung bei den Tieren, ließ mich einhüllen vom warmen Geruch der Kühe, schaute respektvoll zu den Pferden auf und schalt die Schweine, wenn sie in Erwartung des Futters ohrenbetäubend quiekten. Ich streichelte die weichfelligen Kaninchen, lockte die sanften Enten und beobachtete die Tauben, wenn sie ihre Kreise über dem Hof zogen. Oft war mir, als sei ich eine der Tauben und sähe mich selbst von oben, wie ich klein und mit emporgerecktem Hals auf dem Hof stand. In diesen Momenten genoss ich den Flug, stieg und sank, kreiste und schwebte. Sonst fürchtete ich mich immer vor der Höhe; mir wurde schon schwindlig, wenn Mutter mich zum Anziehen auf einen Stuhl stellte. Die ersten Träume, an die ich mich erinnere, waren Absturzträume, und sie haben mich zeitlebens heimgesucht.
Nur für die angriffslustigen Gänse brachte ich keine Sympathien auf. Ein Ganter hatte Mutter in den Daumen gebissen, sie bekam eine Blutvergiftung und lief wochenlang mit einer dick verbundenen Hand herum. Wenn sich ihr fortan eine Gans zischend näherte, ergriff sie das Tier beim Hals und schleuderte es weit über den Hof. Ich bewunderte den Mut und die Kraft meiner Mutter, verfolgte begeistert den Flug der empört schnatternden Gans. So hätte ich mich auch gern vor den Gänsen geschützt, aber ich war noch zu klein und musste bei Gefahren mein Heil in der Flucht suchen.
Wäre Mutter nicht das Missgeschick mit der schnappwütigen Gans passiert, hätte ich vielleicht auch mit den Gänsen Freundschaft geschlossen. So wie mit Harras, dem Kettenhund. Ein imposanter Schäferhundrüde, der tagsüber an seiner Hundehütte und nachts an einem in Mannshöhe quer über den Hof gespannten Laufseil angekettet war, damit er das gesamte Areal bewachen konnte. Nur Bauer Kurt durfte sich dem Hund nähern, jeden anderen fiel er an. Dazu war er abgerichtet. In den unsicheren Zeiten nach dem Krieg trieb sich viel Gesindel herum, das sich mit Gewalt nahm, was es wollte, ein Menschenleben galt nicht viel. Harras lehrte auch die hartgesottensten Burschen das Fürchten.
An einem Frühsommertag, ich war inzwischen dreieinhalb, strich ich über den Hof. Die Erwachsenen arbeiteten auf den Feldern, Alma wirtschaftete in der Küche, die Ställe waren verschlossen, weit und breit niemand, mit dem ich hätte reden können. Nur Harras lag vor seiner Hütte und jaulte leise; er schien sich ebenso zu langweilen wie ich. Wollen wir spielen? fragte ich ihn. Erwartungsvoll setzte er sich auf. Ich ging zu ihm, kraulte sein Fell, schüttelte seine Pfote und umarmte ihn, während ich auf ihn einredete. Schwanzwedelnd ließ er sich alles gefallen. Als ich des Spielens überdrüssig war, kroch ich in die Hundehütte und schlief ein. Irgendwann weckten mich Gebell und Geschrei. Die Erwachsenen waren vom Feld zurückgekehrt, sahen meine nackten Beine aus der Hundehütte heraushängen und glaubten, Harras habe mich totgebissen. Alle Versuche, sich der Hütte zu nähern, vereitelte der zähnefletschende Hund. Da ich mich in der engen Behausung nicht drehen konnte und es nicht fertigbrachte, rückwärts herauszurutschen, blieb ich reglos liegen. Es dauerte eine Weile, bis der Bauer Kurt herbeigeholt worden war und mich aus der misslichen Situation befreite. Meine Mutter muss besinnungslos vor Angst gewesen sein. Sie erdrückte mich fast und verbot mir, jemals wieder mit dem Hund zu spielen. Ihre Angst übertrug sich auf mich und hielt mich fortan von Hunden fern. So endete meine kurze Freundschaft mit Harras, dem Kettenhund, und wir wussten beide nicht, warum.
Zum Tierbestand gehörten auch drei Pferde, zwei braune und ein schwarzes. Eines Tages fand ich Kurt, der sonst unermüdlich auf den Beinen war, im Pferdestall auf einem Schemel hocken. Vor ihm im Stroh lag das schwarze Pferd Jonas, übersät mit blutigen Geschwüren. Es atmete schwer, Tränen flossen aus seinen großen Augen. Hin und wieder hob es den Kopf und blickte zu Kurt auf. Auch er weinte lautlos, den Kopf in beide Fäuste gestützt. Eine Weile sah ich von einem zum anderen. Kurt war nicht mehr Kurt, Jonas nicht mehr Jonas. Pferd und Bauer schienen zu einem Wesen verschmolzen, im Atem, im Blick, im Schmerz; unerreichbar für meine Fragen. Leise stahl ich mich davon. Als ich abends noch einmal in den Stall hineinschaute, hockte Kurt in unveränderter Haltung neben dem Pferd. Ich zupfte an seinem Ärmel, aber er bemerkte mich nicht. Im Verschlag nebenan schnaubte leise einer der Braunen, hin und wieder brüllte eine Kuh, sonst war es still. In dieser Stille lauerte etwas Unheimliches. Ich lief zurück ins Haus und ließ mich gegen meine Gewohnheit bereitwillig zu Bett bringen. Bis ich einschlief, raschelte ich mit der Zudecke, um die Stille zu vertreiben. Am nächsten Morgen hörte ich, dass Jonas tot war, und Kurt die ganze Nacht hindurch bei dem Pferd gewacht hatte.
Im Frühsommer 1946 richtete sich ein Mann in unserem Zimmerchen ein. Mutter und ich schliefen nun in einem Bett, der Neuankömmling in dem anderen. Der Mann war mein Vater. Die Bauern nannten ihn Herr Professor; er arbeitete nicht wie meine Mutter auf den Feldern und in den Ställen, sondern verließ morgens den Hof und das Dorf und kehrte spätabends zurück. Ich freundete mich schnell mit ihm an, denn er lachte viel und trieb Späße mit mir, wenn er zu Hause war. Im Juli 1946 heirateten meine Eltern. Nun waren wir eine richtige Familie aus Vater, Mutter und Kind. Doch meine Hoffnung, dass mich nun bald ein Brüderchen oder Schwesterchen aus meiner Einsamkeit erlösen würde, blieb unerfüllt.
Mein Vater Josef Bedrich Vaclav Hauf, geboren 1888 in Bodenbach, das damals noch zum Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn gehörte und von Kaiser Franz Josef regiert wurde, war das einzige Kind seiner Eltern. Sein Vater Alois Josef, ein strenger Mann und wesentlich älter als seine Frau Aloisia Sidonia, besaß eine kleine Buchbinderei. Aloisia Sidonia liebte ihren Sohn abgöttisch und er sie. Alois Josef war Tscheche, hatte aber auch deutsche Vorfahren; Aloisia Sidonia war Deutsche mit ungarischen Vorfahren, wie das in der Habsburger Monarchie häufig vorkam – ein Völkergemisch bis in die Familien hinein. Die Mutter redete mit dem Sohn Ungarisch, der Vater Tschechisch. Sie schickten ihn in eine deutsche Schule, und so sprach mein Vater Deutsch, Tschechisch und Ungarisch fast gleichwertig als Muttersprache. Kroatisch und Serbisch lernte er nebenher von Verwandten und Freunden. Seinen Abituraufsatz schrieb er in Latein. Altgriechisch und Neugriechisch beherrschte er fließend. Er studierte in Prag und in Wien Altphilologie und träumte davon, als Orientarchäologe ruhmvolle Entdeckungen zu machen. Seine Mutter starb früh, noch nicht einmal vierzig Jahre alt. Der Betrieb seines Vaters ging bald darauf in Konkurs, die restlichen Ersparnisse brachte der alte Herr mit seiner neuen Frau durch. Der Sohn musste die Träume vom Orient begraben und sich auf das Lehramt vorbereiten. Schnell wurde ihm bewusst, dass er sich nicht als Gymnasialprofessor eignete. Er quittierte den Schuldienst und schlug sich als Fremdsprachenkorrespondent für verschiedene Firmen durch.
Als der Erste Weltkrieg ausbrach, war er sechsundzwanzig. In den Akten der k.u.k. Armee als Einjährig Freiwilliger vermerkt, wurde er in eine fesche Leutnantsuniform gesteckt und nach Italien abkommandiert. Er folgte dem Befehl höchst ungern, denn er war Pazifist, nicht so sehr aus Prinzip wie aus seiner innersten Natur heraus. Er konnte keiner Fliege, geschweige denn einem Menschen etwas zuleide tun. Im Krieg verließ er sich auf die Weisheit des alten Sprichwortes, dass nichts so heiß gegessen wie gekocht wird und verhielt sich entsprechend zurückhaltend. Nur zwei „Heldentaten“ vollbrachte er: Er wich einem Felsbrocken, den die Gegner ins Rollen brachten, um ihn und seine Abteilung zu zerschmettern, geschickt aus, und er zeugte mit einer Italienerin ein Kind. Jedenfalls behauptete die Schöne, der Sohn sei von ihm, und er zahlte klaglos die geforderten Alimente an die italienischen Behörden, ohne diesen Sohn je kennenzulernen.
Nach Kriegsende wurden die Grenzen neu gezogen. Österreich-Ungarn und der Kaiser gehörten fortan zu einer viel beschworenen, aber unwiederbringlichen Vergangenheit. An ihre Stelle traten Republiken, Chaoten und schließlich Diktaturen. Nur die Tschechische Republik unter Präsident Masaryk führte sich, wie Vater meinte, einigermaßen manierlich auf, wenn man von der diskriminierenden Behandlung der Deutschen absah. Tschechisch ersetzte nun Deutsch als Amtssprache. Meinem tschechischen Vater gefiel das nicht sonderlich, denn er zog die deutsch geprägte Kaffeehaus-Kultur dem aggressiven Panslawismus vor. Die Nationalstolz-Gockelei in einem Land, in dem sich seit Jahrhunderten die Ethnien mischten, war ihm ein Graus. Er unterschied nicht zwischen Deutschen, Tschechen, Ungarn, Österreichern, sondern zwischen angenehmen und unangenehmen Zeitgenossen. Wovon und wie er leben sollte, war ihm allemal wichtiger als ein nebulöser Patriotismus. Er gewann dem ärgerlichen Umstand des neuen Staates das Beste ab und verdiente sein Brot mit Sprachunterricht. Der einstigen deutschen Elite Böhmens – Ingenieuren, Doktoren, Professoren, vor allem Technikern, die ohne Beherrschung der neuen Amtssprache ihren Berufen nicht mehr nachgehen konnten, brachte er Tschechisch bei und machte sie in kürzester Zeit zu einsatzbereiten tschechischen Staatsbürgern. Dafür erntete er von seinen Schülern viel Lob und genügend Honorar, um weiter seinem Kaffeehausleben frönen zu können.
Mit seinen Ehen hatte er weniger Glück. Der ersten, kurz nach dem Krieg geschlossenen Ehe mit einer Deutschen entspross ein Sohn, doch sie ging bald in die Brüche. Die zweite Ehe mit einer deutschen Malerin endete nach zwei Jahren mit dem Selbstmord der depressiven Frau.
Mein Vater mag an den gescheiterten Ehen nicht unschuldig gewesen sein. Im Dienst einer einzigen Frau zu stehen, reichte ihm nicht. In den Cafés und Parks wimmelte es von schönen, sehnsüchtigen Frauen. Und er sah gut aus: stattlich gewachsen, dunkles gelocktes Haar, leuchtende blaue Augen. Obwohl sich seine Ritterlichkeit eher durch Charme als durch soldatische Tugenden auszeichnete und er im Konflikt mit einem Nebenbuhler es vorzog, das Weite zu suchen, flogen ihm die Frauenherzen zu, ob tschechische, deutsche, jüdische oder die von Zigeunerinnen. Er spielte Geige, liebte Wein und Gesang, und er muss ein guter Liebhaber gewesen sein. Schnell aufbrausend und zugleich von weichem Gemüt war er in allem, was er tat, großzügig. Wenn er Geld hatte, gab er es mit vollen Händen aus. Sparsamkeit hielt er für keine erstrebenswerte Tugend.
Meine Mutter lernte er Mitte der Dreißigerjahre in einem Kaffeehaus kennen. Sie hatte vor einiger Zeit ihren wenige Tage alten Sohn durch plötzlichen Kindstod verloren. Schon während der Schwangerschaft war sie vom Vater des Kindes verlassen worden. Nach dem Verlust des Sohnes hatte sie mit einem Sprung von der Elbbrücke versucht, sich das Leben zu nehmen. Zwei Männer retteten die Nichtschwimmerin vor dem Ertrinken, und da das Leben noch einiges mit ihr vorzuhaben schien, gewann sie auch wieder die notwendige Vitalität. Klein und knabenhaft zierlich, temperamentvoll, mit dichter kastanienroter Haarmähne und tiefbraunen Augen muss sie eine reizvolle Erscheinung gewesen sein.
Meine Eltern fanden bei ihrem ersten Gespräch Gefallen aneinander und verabredeten ein nächstes Treffen. Da sie nicht bedachten, dass das als Treffpunkt vereinbarte Kaufhaus zwei Eingänge hatte, verfehlten sie einander, weil jeder an einem anderen Eingang wartete. Ein halbes Jahr später trafen sie sich zufällig auf der Straße wieder, und nach gegenseitigen Vorwürfen wegen des angeblich nicht eingehaltenen Versprechens nahm die uralte Geschichte zwischen Mann und Frau ihren Lauf.
Trotz seiner leidenschaftlichen Liebe zu meiner Mutter konnte mein Vater das Fremdgehen nicht lassen. So viele Frauen warteten darauf, von ihm glücklich gemacht zu werden, und er besaß nicht das Herz, sie zu enttäuschen. Meine Mutter aber wollte ihren Joschi nicht mit anderen teilen, dann lieber eine Trennung. Dies wiederum konnte Joschi sich nicht vorstellen. Es kam zu dramatischen Auseinandersetzungen mit vielen Tränen, Beteuerungen und Schwüren – bis zum nächsten Rückfall des notorischen Fremdgängers.
Als das Malheur meiner Zeugung passiert war, versprach mein Vater, er werde der Geliebten so oder so beistehen: Wolle sie das Kind nicht, werde er einen vertrauenswürdigen Arzt und das Geld dafür auftreiben; wolle sie das Kind behalten, freue er sich darauf und werde sie auf jede nur mögliche Weise unterstützen. Eine Heirat wurde nicht erwogen. Ein Altersunterschied von fünfundzwanzig Jahren und die Rassengesetze der Nazis standen zwischen ihnen.
Meine Mutter wollte das Kind nicht. Als alle Versuche, die Leibesfrucht mit den herkömmlichen Hausmitteln abzutreiben, fehlgeschlagen waren, nahm sie den Erzeuger beim Wort, ihr behilflich zu sein. Mit dem Geld in der Handtasche suchte sie die angegebene Praxis auf. Doch als die Schwester sie endlich ins Behandlungszimmer rief, verließ meine Mutter der Mut, und sie lief davon. Dieser Flucht verdanke ich mein Leben. Die nächsten sieben Monate verbrachte sie zum großen Teil im Krankenhaus. Wenn sie sich auch äußerlich mit ihrem Schicksal abgefunden zu haben schien, ihr Unterbewusstsein wehrte sich gegen das Kind. Sie behielt keine Nahrung bei sich und musste künstlich ernährt werden. Doch als man sie bedrängte, das uneheliche Kind zur Adoption freizugeben, lehnte sie ab.
Für Hitler hatte mein Vater nur Verachtung übrig, auch meine Mutter konnte nicht verstehen, was man jenseits der Grenzen, in Reichsdeutschland, an dem Schreihals fand.
Massenaufläufe waren beiden von Grund auf zuwider. Dass die deutsche Minderheit nach dem Einmarsch der Wehrmacht in die Tschechische Republik und der Schaffung des Reichsprotektorats nicht mehr unter dem militanten Nationalismus der Tschechen zu leiden hatte, wog in ihren Augen die Nachteile des neuen Regimes nicht auf. Zu den Freunden meiner Eltern gehörten Juden und Menschen aller Ethnien des einstigen Vielvölkerstaates. Dass sie plötzlich weniger wert sein sollten als die Deutschen, widersprach dem gesunden Menschenverstand und jeglicher Erfahrung. Hinzu kam die Abneigung meines Vaters gegen alles Militärische.
Als Tschechischlehrer für Deutsche wurde er nun nicht mehr gebraucht. Beim Einmarsch der deutschen Truppen in die Tschechische Republik fünfzig Jahre alt, musste sich mein Vater wieder nach einer anderen Erwerbsquelle umsehen. Sein deutscher Familienname, die deutschen Vorfahren und seine Findigkeit ermöglichten ihm bald ein neues Auskommen. Die Behörden verlangten von allen staatstragenden Personen einen Ariernachweis. Mein Vater besann sich auf sein lebhaftes Interesse für Geschichte und eröffnete ein Ein-Mann-Büro für Ahnenforschung. In Standesämtern und Bibliotheken, auf Friedhöfen und in Kirchenbüchern verfolgte er für zahlende Kunden die Spuren ihrer Ahnen. In seinem Büro endete die Karriere so manches stolzen, blonden deutschen Mannes, der von einem Aufstieg in der SS geträumt hatte und nun erfahren musste, dass bereits sein Urgroßvater oder die Urgroßmutter mosaischen Glaubens gewesen war. Die um ihre Zukunft Betrogenen überschütteten meinen Vater mit Schimpfkanonaden oder schlichen wortlos davon, je nach Temperament. Dabei hätten sie ihm eigentlich dankbar sein müssen, dass er sie vor Schlimmerem bewahrte. Aber nur wenigen ist der Blick in die Zukunft gegeben.
Auch für sich und meine Mutter erstellte er Ahnenreihen zurück bis zum Dreißigjährigen Krieg, wo die meisten Nachforschungen endeten, weil Kämpfe und Brandschatzungen die Kirchen samt Inventar zerstört hatten. Vor der Deportation nach Deutschland warf meine Mutter ihre Papiere weg; mein Vater ließ seine in Bodenbach zurück.
Die Vorfahren meiner Mutter lebten seit Jahrhunderten in den Gebirgsdörfern nördlich der alten Bischofsstadt Leitmeritz. Die Äcker lagen an steilen Hängen, ihre kargen Erträge ernährten die Familien nicht. Die Männer verdingten sich im Sommer als Saisonarbeiter in der Ebene und arbeiteten im Winter als Holzfäller. Die Frauen und Kinder hüteten das Vieh, bestellten die Gemüsegärtchen, spannen, webten, butterten, schlissen Federn und verdienten sich ein Zubrot durch die Sommerfrischler, die ab Anfang des 20. Jahrhunderts für Tage oder Wochen von den Städten aufs Land zogen. Die nur von Deutschen bewohnten Dörfer bestanden aus zwanzig bis dreißig Häusern. Es gab keinen Arzt, keine Apotheke, keinen Laden und nur eine zweiklassige Dorfschule in Hlinay, die von Kindern aus einem weiten Umkreis besucht wurde.
Der Großvater meiner Mutter väterlicherseits hatte sich im 19. Jahrhundert durch Salzpaschen (Salzschmuggel) über die sächsische Grenze ein kleines Vermögen erworben und davon in Kundratitz ein einfaches Bauernhaus mit einer Schmiede errichtet. Er hinterließ es hoch verschuldet seinem Sohn, meinem Großvater Ferdinand Veit, der seine Geschwister – einen Zwillingsbruder und eine Schwester – auszahlen musste und damit den Schuldenberg weiter vergrößerte. 1897 heiratete der rotblonde, blauäugige Ferdinand die für ihre dunkle Schönheit und ihren Stolz weit gerühmte Dienstmagd Maria Staudler aus Tschersing. Geburten und harte Arbeit verbrauchten schnell den Liebreiz ihrer Jugend. Auch Ferdinand hatte sich schon halb tot geschunden, als er im Ersten Weltkrieg in eine Munitionsfabrik bei Wien als Arbeiter verpflichtet wurde. Zurück ließ er seine Frau Maria mit zwei halbwüchsigen Söhnen und der einjährigen Tochter Albine, meiner Mutter, die sie im Alter von 44 Jahren als letztes Kind 1913 geboren hatte. Der älteste Sohn war bereits als Soldat eingezogen worden und sollte aus dem Krieg nicht zurückkehren. Maria, die sich geschämt hatte, in so hohem Alter noch ein Kind zu gebären, gab das kleine Mädchen nach der Abreise Ferdinands zu tschechischen Pflegeeltern nach Leitmeritz. Auf dem Hof wurde jede Hand gebraucht, das Kleinkind wäre nur im Wege gewesen. Die Pflegeeltern entlohnte Maria mit Butter und Eiern – in der Kriegszeit kostbarer als Gold und Geld. Wöchentlich einmal begab sie sich mit der Kiepe auf dem Rücken auf den dreistündigen Weg zum Markt nach Leitmeritz, hielt dort ihre Waren feil und kaufte die nötigsten Dinge des täglichen Bedarfs ein.
Als Ferdinand nach dem Kriege heimkehrte, mit fünfzig Jahren ein Greis, bestand er darauf, die kleine Albine in die Familie zurückzuholen. Das fünf Jahre alte Mädchen, das seit fast vier Jahren in der Stadt lebte, kam heim zu Fremden – einer strengen alten Frau, einem kranken Mann und zwei viel älteren Brüdern.
Man sprach nicht viel in diesem Haus. Wozu auch, es redeten ja schon die Steine auf dem Feld, Pflanzen, Tiere, Sonne und Mond, Regen, Schnee und Wind. Maria, im Sternzeichen Skorpion geboren, galt im Dorf als heilkundige Kräuterfrau. Sie sah Mensch und Tier sofort an, welches Kräutlein ihnen half. Ferdinand, der seinen Söhnen ein strenger Vater war, verwöhnte das kleine Mädchen zwar, aber er war selten zu Hause. Er pflückte Erdbeeren und Kirschen in der Ebene, verdingte sich als Waldarbeiter, arbeitete als Böttcher in den Weingegenden.
Als Albine neun Jahre war, beging ihr Bruder Ernst Selbstmord. An einem späten Oktobersonntag war der Forstwart in die Stube der Veits getreten. Ferdinand, sagte er, Allerheiligen steht vor der Tür, wir brauchen Reisig für die Kränze. Kann Ernst nicht Reisig schneiden kommen? Ferdinand nickte: Ist schon recht. Am nächsten Morgen brach Ernst in den Wald auf und kehrte nicht zurück. Fünf Tage und fünf Nächte suchten ihn die Dorfbewohner. Am Freitagabend stieß jemand die Tür zur Stube auf, ein Mann sagte: Wir haben den Ernst erhängt in der Scheune des Forsthauses gefunden.
Sein Körper war noch warm gewesen.
Ferdinand gab sich die Schuld am Tod des Sohnes, er klagte sich an, zu hart und fordernd gewesen zu sein. Sonst wäre Ernst in seiner Not doch zu ihm gekommen, statt fünf Tage durch den Wald zu irren. Alle Nachforschungen, ob eine unglückliche Liebe, Schulden oder ein geschwängertes Mädchen den Sohn zu dieser Verzweiflungstat getrieben hatten, blieben ergebnislos. Ferdinand setzte eine Anzeige in die Zeitung, dass er für eventuelle Verbindlichkeiten seines Sohnes aufkäme. Niemand meldete sich.
Ferdinand verwand diesen Schlag nicht: der Älteste im Krieg geblieben, der Zweitälteste durch eigene Hand gestorben. Im darauf folgenden Frühjahr schleifte der Ochsenpflug Ferdinand in den Hof. Ihm war auf dem Feld schlecht geworden, er hatte sich an den Zügeln festgebunden in der Hoffnung, das Tier würde den Weg allein nach Hause finden. Im Herbst brach er auf der Dorfstraße zusammen. Nur noch einmal, kurz vor seinem Tod im nächsten Frühjahr, verließ er das Bett und setzte sich an den Tisch.
Die Erde ist offen, sagte er, wir wollen pflügen. Dann verlangte er nach dem Frühstück. Doch er aß nichts, schaute nur aus dem Fenster über die weite hüglige Landschaft hinüber zum Milleschauer und sagte: In drei Tagen werd ich wohl gehen. Drei Tage später starb er, gerade siebenundfünfzig geworden. Einen Arzt hatte er während seiner einjährigen Krankheit nicht an sich herangelassen. Er wusste, dass bei einem gebrochenen Herzen jede menschliche Hilfe versagt.
Zwei Jahre danach erschossen Wilddiebe den dritten Sohn der Familie, den vierundzwanzigjährigen Richard. Er hinterließ eine Frau mit zwei kleinen Kindern, die dann auf dem Hof bei der vor Gram erstarrten Maria lebten. Die jüngste Tochter Albine hielt es in dem Unglückshaus nicht länger aus und verließ den elterlichen Hof. Sie besaß ausgezeichnete Zeugnisse, die Lehrer bescheinigten ihr Begabung und Fleiß. Vergeblich hatte sie die Mutter bestürmt, die Handelsschule besuchen zu dürfen, aber Maria wollte die Aussteuer für die Tochter nicht antasten, und anders wäre die Schule nicht zu finanzieren gewesen. Die Vierzehnjährige verdingte sich als Dienstmädchen in Eger und Teplitz und träumte von Bildung, Liebe, schönen Kleidern, einem freien Leben in der Stadt. Nur noch gelegentlich besuchte sie Mutter und Schwägerin in Kundratitz. Sie wollte nichts mehr zu tun haben mit dem tristen Leben auf dem Dorf, nichts mit der altmodischen Heilkunst ihrer Mutter, nichts mit den düsteren Schicksalen in der Nachbarschaft. Lieber nahm sie die niedrigsten Arbeiten in der Stadt an. Endlich fand sie eine Stelle als dentistische Helferin bei einem weithin anerkannten und beliebten Zahnarzt. Sie arbeitete sich schnell in die Buchhaltung ein und lernte zur Zufriedenheit ihres Chefs mit Instrumenten und Patienten umzugehen. Zwischen 1936 und 1945 erlebte sie, trotz der ungewollten Schwangerschaft, die wahrscheinlich glücklichste Zeit ihres Lebens.
Der verwöhnte Bürgersohn und das herumgestoßene Dorfkind, der Studierte und das Dienstmädchen, der Stadtmensch und die Landpomeranze, der alte Mann und die junge Frau – größere Gegensätze sind nicht denkbar. Und doch waren gerade sie es, die die Verbindung meiner Eltern so stark machten. Jeder besaß etwas, das dem anderen fehlte. Meine Mutter, eine lebenshungrige junge Frau, sehnte sich nach sozialem Aufstieg, nach Theater, Musik, Literatur. Wie ein trockener Schwamm sog sie alle Anregungen auf. Sie war belastbar und praktisch veranlagt, und sie wollte dem Elend ihrer dörflichen Herkunft entfliehen. Aber nie um jeden Preis. Sie hatte sehr genaue Vorstellungen davon, was sie sich und anderen zumuten durfte, um ein anständiger Mensch zu bleiben.
Mein Vater besaß die Gelassenheit des Bildungsbürgers und Lebemanns, aber ihm fehlte die Zähigkeit und Vitalität meiner Mutter. Er bewunderte, wie sie die Hürden des Lebens meisterte, und zehrte von ihrer Kraft. Doch nie fühlte er, der notorische Fremdgänger, sich ihrer sicher, und deshalb quälte er sie mit grundloser Eifersucht.
Das Ende des Krieges erlebten meine Eltern in Bodenbach. An jenem 13. Juli 1945, als Mutter und ich binnen weniger Stunden zur Sammelstelle getrieben, in Viehwaggons verladen und mit unbekanntem Ziel abtransportiert wurden, war mein Vater nach Prag gefahren, um Lebensmittel aufzutreiben. Bei seiner Rückkehr stand er fassungslos in der geplünderten Wohnung. In Prag hatte er gesehen, wie tschechischer Mob Deutsche aus Fenstern stürzte, Babys zerschmetterte, Frauen erschlug. Kurze Zeit darauf erlebte er in Aussig das Massaker an den Deutschen. Er verstand die Welt nicht mehr, und er wusste nicht, ob er uns unter den Lebenden oder den Toten suchen sollte.
Ohne die Findigkeit meiner Mutter wären sie nicht mehr zueinander gekommen, und ich hätte meinen Vater nie kennengelernt. In den ersten Wochen des Jahres 1946 erfuhr sie, dass die Elbschifffahrt wieder funktionierte und wahrscheinlich auch Kähne bis in die Tschechische Republik fuhren. Mutter ließ mich bei Alma in guter Obhut zurück und machte sich zu Fuß auf den Weg nach Torgau. Dort fragte sie so lange herum, bis sie tatsächlich an einen Schiffer mit einer Fracht nach Tschechien geriet. Sie bat ihn, einen Brief zu bestellen. Der Schiffer hielt Wort und traf meinen Vater auch unter der angegebenen Adresse an.
Als Tscheche hätte mein Vater in Bodenbach bleiben können, aber ihn hielt nichts mehr bei seinen Landsleuten. Die meisten seiner Freunde – Juden, Deutsche, Tschechen – waren in den letzten sieben Jahren vertrieben, erschlagen, vergast worden, ihre Wohnungen geplündert und zerstört. Er setzte bei den Behörden durch, seiner Frau, mit der er nicht verheiratet war, und seinem Kind nach Deutschland folgen zu dürfen, musste dafür aber seine tschechische Staatsbürgerschaft aufgeben. Wer eine Deutsche höher schätzte als sein tschechisches Vaterland, verdiente nicht, ein Tscheche zu sein. Immerhin gestattete man ihm, mitzunehmen, was er auf dem Rücken tragen konnte.
Für welche Gegenstände würde ich mich entscheiden, wenn ich innerhalb kürzester Zeit meine Wohnung verlassen müsste? Diese Frage hat mich in Krisenzeiten meines Lebens oft beschäftigt, aber ich kam zu keinem Ergebnis, denn die Gefahr hatte noch nicht wirklich an die Tür geklopft. Die Auswahl hätte mir viel über mich verraten können.
Mein Vater entschied sich für Federbett, Tischuhr und Geige. Das war er: wärmebedürftig, pünktlich und musikliebend.
So stand er in Dörstewitz plötzlich vor der Tür, ein achtundfünfzigjähriger, entwurzelter Mann; gezwungen, ganz von vorn anzufangen; bereit, sich nach zwei gescheiterten Ehen auf das Abenteuer einer dritten einzulassen. Er fand eine Stelle als Sachbearbeiter beim Landratsamt in Merseburg und bewältigte nun täglich den beschwerlichen Weg in die Stadt. Lange Fußmärsche zum Bahnhof in Knapendorf und zurück nach Dörstewitz, Züge fuhren selten und waren hoffnungslos überfüllt. Bei seiner Rückkehr am Abend pfiff er unter dem Fenster eine Erkennungsmelodie, damit jemand das Tor öffnete. Bei den Bauern machte er sich schnell beliebt, denn er besaß etwas, das die tauschwilligen Städter bisher nicht angeboten hatten: Talent zum Dichten. Für welchen Anlass auch immer – Hochzeiten, Geburtstage, Beerdigungen – er reimte ganze Geschichten, lustige, ernste oder traurige, ganz wie es gewünscht wurde, mit Namen und Adressen. Und er setzte Briefe für die Behörden auf, formvollendet und gewandt im Ausdruck. Die Bauern bezahlten mit einer Wurst oder einem geschlachteten Täubchen. Meine Mutter stieg ebenfalls im Ansehen. Dass sie auf dem Feld und im Stall kräftig zupacken konnte, verstand sich von selbst, aber dass sie einen so klugen, kein bisschen eingebildeten Mann hatte, bedeutete schon etwas Besonderes. So sah man es den zugelaufenen Flüchtlingen aus dem Osten nach, dass sie sonntags Spaziergänge in die Umgebung unternahmen, was kein Bauer je getan hätte.
Bei diesen sonntäglichen Unternehmungen langweilte ich mich unsäglich, denn meine Eltern unterhielten sich stundenlang. Ich verstand nicht, worüber, und kam selbst nicht zum Zuge. Einmal schlug ich mir den Bauch mit Holunderbeeren voll, während sie im Gras saßen und redeten. Die Beeren schmeckten nicht, aber ich hatte Hunger. Zurück in unserem Zimmerchen, erbrach ich mich unter Krämpfen, zwischen den Brechanfällen wurde ich immer wieder ohnmächtig. Vielleicht wussten meine Eltern nicht um die Giftigkeit roher Holunderbeeren, oder sie waren so mit sich beschäftigt gewesen, dass sie mein Tun nicht bemerkt hatten.
Dennoch müssen sie sich auch die Zeit genommen haben, mir Märchen zu erzählen, denn ich erinnere mich, dass ich jedes Wäldchen mit der größten Vorsicht und unbändiger Neugier betrat. Hinter jedem Busch vermutete ich das Hexenhaus von Hänsel und Gretel, den Wolf und das Rotkäppchen. Zuweilen lebte ich in einer Welt, in der es von Kobolden und Drachen, sprechenden Tieren, Königinnen und Prinzen nur so wimmelte. Doch dann rissen Gelächter und Rufe der spielenden Kinder auf der Dorfstraße mich aus meiner Märchenwelt. Meine Versuche, an ihren Spielen teilzunehmen, schlugen fehl, sei es, weil ich noch zu klein war oder weil sie meinten, eine Rechnung begleichen zu müssen. Sie hatten bemerkt, dass ich den Dorfteich mied, sogar den Bach, der in ihn mündete. Sobald auch nur eins der Kinder „Teich!“ rief und dabei auf mich zeigte, rannte ich heulend davon. Sofort heftete sich die Meute mit den Rufen „Teich! Teich!“ auf meine Fersen. Ich lief wie um mein Leben, bis ich die Verfolger abgeschüttelt hatte oder sie von mir abließen. Sogar manche Erwachsene machten sich einen Spaß daraus, mich mit dem Wort Teich in Panik zu versetzen. Mutter nannte mich ein Dummchen, als ich ihr mein Leid klagte.
Wie ich nur auf den Gedanken käme, dass die Kinder mich in den Teich stoßen würden? Wenn ich nicht mehr davonliefe, würden sie aufhören, mich zu hänseln.
Ich gab mir Mühe, diesen Ratschlag zu befolgen, hielt wohl auch eine Weile stand, aber wenn die Kinder Anstalten machten, nach mir zu greifen, stellten sich mir alle Haare zu Berge, und ich stürzte davon. Was ich auch versuchte, es gelang mir nicht, die Furcht zu überwinden; sie lauerte in mir, bereit, mich beim geringsten Anlass in namenlosen Schrecken zu versetzen. Längst hatte ich vergessen, was sich vor unserer Ankunft auf dem Bauernhof abgespielt hatte; geblieben waren nur eine diffuse Bangigkeit und Bruchstücke unverständlicher Bilder: ein Fluss, ein dunkler Teich, Kinder … Was bedeutete das? Mutter sagte, ich hätte schlecht geträumt, und es stimmte ja, oft konnte ich Träume und Wirklichkeit nicht auseinander halten. Ich schämte mich meiner Angst, über die alle lachten und die mich von den anderen trennte. Den Ruf „Teich! Teich!“ konnte ich erst abschütteln, als wir in die Stadt zogen; die Erinnerung daran nicht.
Es verstrich fast ein halbes Jahrhundert, bis mir die Ursache der damaligen Angst bewusst wurde. Immer hatte mich eine unerklärliche Scheu zurückgehalten, mit Mutter über jenen Oktoberabend 1945 zu sprechen. Als mir nach ihrem Tod die weit zurückliegenden Ereignisse am Fluss und am Teich plötzlich klar und unabweisbar vor Augen traten, war ich froh, sie nie gefragt zu haben. Wie hätte Mutter es mir erklären sollen, wie hätte ich es in jüngeren Jahren verstehen können?
Ein beliebtes Spiel der Dorfkinder bestand darin, auf einen von Ochsen gezogenen leeren Mistschlitten zu springen. Ich versuchte es ebenfalls, aber meine vierjährigen Beine sprangen zu kurz, ich schlug mit dem Gesicht auf die Kante des hölzernen Mistschlittens, und wenn ich es doch einmal schaffte, rutschte ich von der glitschigen Fläche ab. Die Kinder, die bereits auf dem fahrenden Schlitten standen, begleiteten meine immer neuen, missglückten Anläufe mit schadenfrohem Gelächter. Als mir das Blut von Kinn, Ellenbogen und Knien troff, gab ich endlich auf. Mutter schimpfte mit mir, während sie mich säuberte und verarztete. Schließlich habe mich niemand gezwungen, die anderen nachzuahmen. Ich konnte ihr nicht verständlich machen, dass es nicht um den Schlitten ging, sondern dass ich dazugehören wollte. Nichts erschien mir erstrebenswerter als die Anerkennung dieser johlenden, mitleidlosen Dorfkinder. Es dauerte Wochen, bis das verletzte Kinn abheilte, aber der Schmerz blieb. So oft ich mich später noch mühte, Zugang zu einem Kollektiv, wie es dann hieß, zu gewinnen und eine gute Figur abzugeben, es gelang mir nie auf Dauer, und jedes Mal trug ich Blessuren davon. Meiner Ungewandtheit verdankte ich es, dass ich zeitlebens vor falschen Freunden bewahrt blieb.
Ich zog mich wieder auf das vertraute Terrain des Bauernhofes zurück, immer auf der Suche nach Gesprächspartnern und Spielgefährten. Aber die Erwachsenen waren beschäftigt. Nur Lisbeth, die junge Nichte der Bauern, scherzte bei ihren Besuchen mit mir. Einmal schenkte sie mir einen winzigen Steiff-Teddy, den ich über alles liebte, weil er ein so lustiges Gesicht hatte, und den ich, wenn auch arg mitgenommen von meiner kindlichen Liebe, heute noch besitze.
Lisbeth war es auch, die meine Mutter auf den Husten ansprach, unter dem ich seit Monaten litt. Ich sei zu klein für mein Alter und geradezu ausgemergelt. Sie riet, mich von einem Arzt untersuchen zu lassen. Mutter, die bis zum Umfallen arbeitete und abends kaum noch die Augen offenhalten konnte, hielt meinen Zustand nicht für außergewöhnlich. Die meisten Kinder waren 1946 zu klein für ihr Alter und nur Gerippe aus Haut und Knochen. Aber Lisbeths Vorhaltungen beunruhigten sie doch. Also machte sie sich mit mir auf den Weg in die Universitätsklinik nach Halle. In einem qualvollen Gedränge warteten wir eine Ewigkeit, bis sich ein Arzt unserer annahm. Ohne auf meine Proteste zu achten, zog mir jemand die Kleider vom Leib, legte mich auf einen Tisch, dann senkte sich lautlos etwas Großes, Bedrohliches auf mich herab. Ich versuchte zu entkommen, aber harte Hände hielten mich fest. Endlich wieder frei, konnte ich mich lange nicht beruhigen. Seither hege ich tiefes Misstrauen gegen jeden Arzt, der mich Apparaten ausliefern will, und ich nehme rechtzeitig Reißaus.
Auf dem Rückweg gerieten wir zwischen Bad Lauchstädt und Dörstewitz in einen Sturm. Sand und Zweige peitschten ins Gesicht, Mutter zerrte mich hinter sich her, es war kaum ein Vorankommen. Ich jammerte, hustete, Mund und Augen voller Staub. Als ich drauf und dran war, keinen Schritt mehr zu tun und mich auf die Erde zu werfen, hielt ein Motorrad neben uns. Die Wahrscheinlichkeit, in jenen Zeiten auf ein solches Gefährt zu treffen, war äußerst gering. Ein Mann, der sich meiner Mutter mit Herr Niemand vorstellte, hob mich auf den Sozius, befahl mir, mich festzuhalten, dann brauste er los. Ich verschwendete keinen Gedanken daran, dass Mutter zurückblieb, aber auch sie wird erleichtert gewesen sein, den Weg allein fortsetzen zu können. Seit der Begegnung mit Herrn Niemand, von dem ich nichts weiß als diesen merkwürdigen Namen, vertraue ich dem Gefühl, dass in höchster Not die Hilfe am nächsten ist. Es hat mich nie getrogen.
Ähnliches Entsetzen wie unter dem Röntgenapparat erfasste mich zu dieser Zeit in der Kirche von Bad Lauchstädt. Wahrscheinlich fand in der ursprünglich rein protestantischen Gegend ein katholischer Gottesdienst statt. Eng gedrängt saßen, standen, knieten die Menschen, sangen und beteten. Die Stille, die der Wandlung von Brot und Wein vorausgeht, wuchs zu einem riesigen Schattengebilde. Ich begann zu schreien; nichts und niemand konnte mich beruhigen. Mutter brachte mich vor die Tür, von der Treppen zum Marktplatz hinunterführten. Im Freien wurde ich augenblicklich still, aber als Mutter wieder mit mir in die Kirche zurückkehren wollte, klammerte ich mich an das Geländer. Alles wollte ich tun: mich nicht vom Fleck rühren, lange auf meine Eltern warten, wenn ich nur nicht in der Kirche sein musste. Mutter ließ mir meinen Willen, und ich hielt mein Versprechen; beobachtete das Treiben auf dem Marktplatz, hörte die Gesänge durch die offene Tür und war tief erleichtert.
Ich weiß bis heute nicht, was die Vierjährige in der Kirche so erschreckt hat. Was sah sie vom Schoß der Mutter, vom Arm des Vaters aus? Den Dämon der Rebellion und des Verrats? Den Kelch des Leidens?
In der Universitätsklinik Halle hatten die Ärzte Tuberkulose diagnostiziert, damals eine Volkskrankheit. Als Therapie empfahlen sie viel Butter, viel Milch, viel frische Luft. An frischer Luft mangelte es nicht; an Butter und Milch fehlte es in den Hungerjahren 1946/47, als Erwachsene und vor allem Kinder an Unterernährung und Krankheiten wie die Fliegen starben. Das den Bauern auferlegte staatliche Abgabe-Soll war hoch. Die Kahles aßen selber kaum Butter. Fortan ließ sich meine Mutter ihre Arbeit auf dem Feld und im Stall nur mit Butter und Milch entgelten. Alma schüttete Stroh im Garten auf, und damit mir das Liegen dort nicht zu langweilig wurde, schaute sie ab und zu nach mir und brachte immer irgendetwas mit: eine Möhre, ein Stück Brot, einen Gegenstand zum Spielen. Ich genoss das Interesse an meiner kleinen Person. Vielleicht war ich überhaupt erst krank geworden, weil ich mehr nach Zuneigung hungerte als nach Butter und Milch. Denn wie viel Charme und Liebenswürdigkeit ich auch versprühte, die Erwachsenen waren so mit sich und dem Kampf ums Überleben beschäftigt, dass für Zuwendung zu einem Kind, das in der Welt heimisch werden wollte, kaum Zeit blieb. Nun aber, da mein Leben in Gefahr schien, fanden sie auch die Kraft, mein Lächeln mit einem Lächeln zu erwidern.
Weihnachten 1946 gestalteten sie zu einem prächtigen Fest für mich. In der guten Stube der Bauern stand ein geschmückter Christbaum. Ich hatte so etwas noch nie gesehen. Während ich noch den Baum bestaunte, klopfte es an die Tür. Mit einem Sack auf dem Rücken trat der Weihnachtsmann ein. Da bis auf Fritz alle in der Stube versammelt waren, erriet ich sofort, wer sich unter der roten Kutte und der Larve verbarg. Ich bemerkte auch die verkrüppelte Hand. Aber Kinder können noch alles zusammendenken. Der da eintrat, war Fritz, aber es war zugleich auch der Weihnachtsmann. Ich sagte klopfenden Herzens mein Sprüchlein auf, und dann schüttete der Weihnachtsmann seinen Sack auf dem Tisch aus. Es waren viele kleine Dinge, die ich vergessen habe, und es war eine unvergessliche große Seligkeit. So viel und alles für mich! Nur an ein Geschenk erinnere ich mich: eine Puppe mit einem Kopf aus Pappmache, bemalt mit blauen Augen, langen braunen Wimpern, braunem Haar, roten Wangen und Lippen; die Arme und Beine aus mit Lumpen gefüllten braunen Seidenstrümpfen, aus weißem Leinen der strohgefüllte Leib, bekleidet mit einem dunkelfarbig geblümten Kleidchen. Ich schloss Karline sofort ins Herz, und keine schöner ausgestattete Puppe mit Blinkeraugen und Tonkopf, wie ich sie ein paar Jahre später bekam, konnte ihr diesen Platz streitig machen. Als ich zwölf war, warf Mutter die zerliebte Puppe in die Mülltonne, ich rettete sie in letzter Minute. Das Ende ihres irdischen Daseins war besiegelt, als ich zum Studium nach Berlin ging und versäumte, sie mitzunehmen. Mutter warf alles weg, was sie für überflüssig hielt, auch die Geige und die Tischuhr meines Vaters, nachdem er gestorben war. Dabei hätten nur neue Saiten auf die Geige gezogen und die Uhr repariert werden müssen. Ihre wenigen persönlichen Sachen lagen immer griffbereit. Das Trauma jenes 13. Juli 1945, als sie von einer Stunde zur anderen hatte alles verlassen und aufgeben müssen, was bisher ihr Leben ausgemacht hatte, verlor sich bis zu ihrem Tod nicht.
Wenn ich auch kaum wuchs und wenig an Gewicht zunahm, wurde ich doch gesund. Nach wie vor fand ich keinen Zugang zu den Dorfkindern, aber die Erwachsenen waren nun freundlicher und ertrugen geduldig mein nur selten versiegendes Geplapper. Im Frühjahr 1947 traten der Bach und der Teich über die Ufer und überschwemmten das Dorf. Seltsamerweise erzeugte das in mir keine Panik, während die Erwachsenen Ach und Weh riefen. Das milchkaffeebraune Wasser erschien mir nicht gefährlich. Ich schaute vom sicheren Platz meines Fensters im oberen Stockwerk den Enten zu, wie sie im Garten und auf der Dorfstraße fröhlich schnatternd umherschwammen. Da waren unsere Tage in Dörstewitz schon gezählt. Vater hatte sich um eine Wohnung in Merseburg bemüht. An meinem fünften Geburtstag zogen wir um. Mit ein paar Kartons, die unsere gesamte Habe enthielten, liefen wir zum Bahnhof nach Knapendorf und fuhren von dort in die Stadt.
3
Merseburg, Thomas-Münzer-Straße 36, Müntzer ohne „t“. Mit der Rechtschreibung haperte es noch bei den neuen Behörden. Die Zweitausfertigung meiner Geburtsurkunde, ausgestellt im Standesamt Delitz am Berge am 11. April 1947, enthält in schwungvoller Schrift den Vermerk: „Durch Annerkenung der Vaterschaft hat dass Kind den Nahmen Hauf erhalten.“
Eben noch im fest umgrenzten schützenden Bauernhof, bewegte ich mich nun auf offenem Terrain. Die neue Wohnung befand sich in einem Zweifamilienhaus am westlichen Stadtrand, wo die Gärten hinter den Häusern an Felder grenzten. In den beiden Etagenwohnungen unseres Hauses lebten vier bis zeitweilig sechs Mietparteien. Wir bezogen zweieinhalb Zimmer in der unteren Etage – ein Luxusappartement gegen unsere vorherige Behausung. Das halbe Zimmer, einst wohl die Mädchenkammer, war zur Küche umfunktioniert, Bad und Toilette teilten wir mit den Hauptmietern. Da wir keine Möbel besaßen, übernahmen meine Eltern die Einrichtung und zahlten sie in kleinen monatlichen Raten ab, was mehr als zehn Jahre dauerte. Im gen Osten und zur Straße liegenden Schlafzimmer standen zwei Ehebetten, ein Gitterbett, eine weiße Kommode mit Marmorplatte, ein Schrank und ein Tisch. Im Wohnzimmer, dessen Fenster nach Süden wies, arbeitete mein Vater und schlief später auch dort, als ich, dem Gitterbett entwachsen, in eins der Ehebetten zog. Es war ausgestattet mit Bett, Schrank, Sofa, einem Schreibtisch mit Aufsatz, einer Konsole, auf der Vaters Tischuhr und ein antiquarisch erworbenes Brockhaus-Lexikon in zwei Bänden ihren Platz fanden, später auch das strohgefüllte Glas mit den beiden weißen Mäusen. Ein uralter Radioempfänger sorgte zischend, pfeifend und knackend für Information und Unterhaltung, ein Kanonenöfchen im Winter für Wärme. Ein schwerer Wohnzimmertisch vervollständigte die Einrichtung. Gern hockte ich auf den Streben, die die kunstvoll gedrechselten Tischbeine aus dunklem Holz miteinander verbanden und strich zärtlich über die glänzenden barocken Rundungen. Leider zogen sie den Staub geradezu magisch an, und ich hasste Staubwischen. Die dunkelrote Decke aus Cordsamt wurde nur selten aufgelegt, da sie als Unterlage zum Arbeiten und Essen nicht taugte. Zum Tisch gehörten vier Stühle mit ebenfalls gedrechselten Beinen und Rückenlehnen aus geflochtenem Leder. Mutter mochte das alte Mobiliar nicht, und als es abbezahlt war, verschwand es nach und nach aus der Wohnung, um modernen hellen Möbeln im Stil der Fünfzigerjahre Platz zu machen. Ich trauerte den Möbeln aus den edlen dunklen Hölzern ein wenig nach, wagte aber nicht Mutter zu widersprechen, weil ich – wie sie – mit der Zeit gehen wollte.
Das Haus war ursprünglich zentralbeheizt gewesen, jetzt rottete der Heizkessel im Keller vor sich hin, und die Heizkörper in den Zimmern blieben kalt. Seit Kriegsende fehlte der Koks für die Heizung. In einigen Zimmern standen Kanonenöfen, deren Abzüge über ein aus vielen Teilen zusammengestecktes Rohr an der Decke des langen Flurs zum zentralen Schornstein führten. Eine äußerst fragile Konstruktion. An den Verbindungsstellen tropfte in der Heizperiode ständig eine braune Brühe in Blechbüchsen, die mit Draht am Rohr befestigt waren. Wenn überhaupt, wurde mit minderwertiger Rohbraunkohle geheizt, erdbraunen krümligen Stücken, die beim Verbrennen übel riechende Rückstände produzierten. Auch im Sommer wich der Geruch von kaltem Rauch nicht aus der Wohnung. Der Kanonenofen im Wohnzimmer war unsere einzige Wärmequelle. Das Schlafzimmerfenster besaß ein Rollo, dessen Gurt schon mehrmals geflickt war und häufig riss. Immerhin schützte es ein wenig vor der Kälte, zumal in den ersten Jahren Pappe und Zeitungen die Fensterscheiben ersetzten. Der Küche genannte kleine Raum lag auf der Westseite. Als „Wasserleitung“ diente ein Eimer mit Wasser unter dem Tisch. Gekocht wurde auf einem einflammigen Petroleumkocher. Wenn das Petroleum im Kocher ausgebrannt war, die Kartoffeln aber noch einige Zeit zum Garwerden brauchten, hieß es warten, bis der Kocher sich abgekühlt hatte. Einmal goss Mutter zu früh Petroleum nach. Eine Stichflamme sprang auf und drohte auf die mit Petroleum gefüllte Glasflasche in ihrer Hand überzuspringen. Geistesgegenwärtig schüttete ich den Inhalt des nächststehenden Topfes in die Flamme. Zu meinem Entsetzen kullerten ein ausgekochter Schweinekopf und Knochen durch die Küche. Das Feuer war zwar gelöscht, aber mich dauerte die vergossene Brühe. Doch die erwarteten Vorwürfe blieben aus. Mutter sammelte den Schweinekopf und die Knochen ein, spülte sie mit Wasser ab und setzte sie erneut zum Kochen auf; es wurde dann doch noch eine wohlschmeckende Sülze.
Unterhalb des Küchenfensters verlief an der Außenwand eine Luftschutzmauer bis zum Fenster des Wohnzimmers, von dem aus man auf den Goldgraben schaute, eine kleine asphaltierte Straße. Ich benutzte das Küchenfenster gern und häufig statt der Tür, balancierte auf der Luftschutzmauer bis zum Wohnzimmerfenster, um möglichst ungesehen zu beobachten, was dort geschah, und sprang dann in den Garten. Auf der Spitze des gegenüberliegenden Hausgiebels hoben sich an klaren kühlen Frühlingsabenden gegen den noch hellen Westhimmel die Umrisse einer Amsel ab, die unermüdlich zwitscherte und tirilierte. Ich hätte sie gern einmal aus der Nähe gesehen, um ihr zu sagen, wie sehr mir ihr Gesang gefiel. Jahr um Jahr saß sie dort; ich lauschte ihr, überzeugt, dass sie unsterblich sei.
Die Hauptmieter unserer Etage bewohnten zwei große Zimmer und die richtige Küche im vorderen Bereich des Flurs. Generalmusikdirektor Knauth und seiner Tochter Margarete hatte einst die ganze Etage gehört. Die Frau Generalmusikdirektor war gestorben, und der einzige Sohn lebte im Westen. Ich hielt den alten Herrn für einen richtigen General, einen Soldaten eben, von denen ich schon viele in meinem jungen Leben gesehen hatte. Dafür sprach auch der äußere Eindruck: die grauen, kurz geschnittenen Haare, das schmale kantige Gesicht, die straffe Haltung und die Wortkargheit. Er flößte mir großen Respekt ein. Manchmal saß er in Vaters Zimmer auf dem Bänkchen vor dem kalten Zentralheizungskörper. Der alte Herr genoss es offensichtlich, dass die Zwangseinquartierung ihm diesmal freundliche und gebildete Untermieter beschert hatte. Hin und wieder zogen der Generalmusikdirektor und meine Mutter nachts mit Rucksäcken los. Am nächsten Morgen bewunderten wir ihre Beute: schwarz glänzende Briketts.
In den strengen Nachkriegswintern herrschte an allem Mangel, auch an Kohlen. Die rationierte Jahresmenge reichte kaum aus, für ein paar Wochen wenigstens stundenweise die Stube zu wärmen und das Essen zu kochen. Die hellbraunen Brocken bestanden mehr aus Erde und Wasser denn aus Kohle. Dabei saßen wir mitten im größten Braunkohleabbaugebiet Deutschlands. In den Gruben des nahen Geiseltals wurde natürlich auch Kohle besserer Qualität gefördert, zu Briketts gepresst und vom Merseburger Güterbahnhof aus in alle Himmelsrichtungen transportiert. Die besonders Mutigen oder besonders Verzweifelten, die nirgendwo mehr etwas Brennbares zum Heizen fanden, schlichen sich nachts auf den Güterbahnhof, um eine Tasche oder einen Rucksack mit Briketts zu füllen. Die Älteren suchten neben und unter den Waggons nach heruntergefallenen Kohlen, die Jüngeren kletterten auf die Waggons. Wer von der Bahnpolizei erwischt wurde, landete im Gefängnis, aus dem er unter Umständen nie mehr zurückkehrte. Andere wurden in der Dunkelheit von rangierenden Waggons zerquetscht oder überrollt. Als einmal ein Zug losfuhr, von dem meine Mutter Briketts herabwarf, konnte sie sich nur noch mit einem tollkühnen Sprung in die Arme des Generalmusikdirektors retten. Beide verletzten sich bei dem Fall und schleppten sich ohne Kohlen nach Hause. Vater taugte zu solchen Wagnissen ebensowenig wie Margarete, und sie erklärten nun in seltener Einmütigkeit, lieber frieren zu wollen, als zuzulassen, dass die beiden Kohlendiebe noch einmal Leben und Freiheit aufs Spiel setzten.
In meiner Erinnerung ist Margarete grauhaarig und verströmt einen leichten Geruch von Mottenkugeln. Dabei muss sie in Mutters Alter gewesen sein, also Mitte dreißig. Sie war verlobt gewesen, aber der Mann hatte das Verlöbnis gelöst. Diesen Schicksalsschlag und die durch ihn verursachten Krankheiten konnte Margarete, sehr zum Leidwesen meiner Eltern, unermüdlich erörtern. Sie war hypochondrisch veranlagt und zudem für eine Generalmusikdirektorstochter ziemlich unmusikalisch, was ihren Vater tief betrübte, ihrer gegenseitigen Liebe aber keinen Abbruch tat. Wenn sie ihn außer Hörweite glaubte, setzte sie sich an das schwarze Klavier mit der Beethoven-Büste obenauf und spielte immer wieder den Schlager: „Anneliese, ach Anneliese, warum bist du böse mit mir …“ Margarete war bei einer Behörde als Sachbearbeiterin beschäftigt und haderte ständig mit ihrem Schicksal. Vor dem Krieg hatte sie von einem Leben als Ehefrau eines gut situierten Mannes geträumt, doch im Nachkriegsdeutschland überwogen Knaben, Greise, Krüppel, Kriegstraumatisierte, und die wenigen wirklichen Männer, die für Margarete in Frage gekommen wären, interessierten sich nicht für sie. Herzensgüte allein stand nicht hoch im Kurs, und die Auswahl an lebenshungrigen Frauen war groß. Ihre verkümmerten Mutterinstinkte versuchte Margarete an mir auszuleben. Betulich, bittend, drängend redete sie gegen meine Wildheit an, wenn ich unbeaufsichtigt war, und das war ich oft. Aber sie scheiterte an meinem Widerstand gegen ihre gutbürgerlichen Vorstellungen von dem, was ein kleines Mädchen zu tun und zu lassen habe. Ich hielt mich zwar weitgehend an die von den Eltern eingeschärften Gebote der Höflichkeit, ich mochte Margarete auch, aber ich räumte ihr keine Erziehungsrechte über mich ein.
Mein Gitterbett stand an der verschlossenen Doppeltür zum Wohnzimmer des Generalmusikdirektors. Vor dem Einschlafen sang ich laut, ob aus Sangeslust oder aus Furcht vor der Dunkelheit weiß ich nicht mehr. Jedenfalls versetzte ich meine Eltern damit in nicht geringe Verlegenheit. Ich besaß eine kräftige Stimme, übertraf aber Margarete noch an Unmusikalität, und so muss mein Gesang schauerlich geklungen haben. Immer wieder verboten mir die Eltern, den alten Herrn zu stören. Doch sobald ich im Bett lag, vergaß ich die Ermahnungen und den Mann im Nebenzimmer. Als Mutter sich einmal in meiner Gegenwart bei ihm für die „Katzenmusik“ entschuldigte, verzog sich sein sonst so strenges Gesicht zu einem gütigen Lächeln. Lassen Sie das Kind doch, sagte er, Übung macht den Meister. Sie hat eine schöne Stimme, und sie wird noch lernen, richtig zu singen. Mit diesen Worten gewann er für immer meine Zuneigung, obwohl wir nur wenig Zeit hatten, miteinander vertraut zu werden.