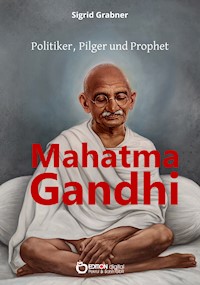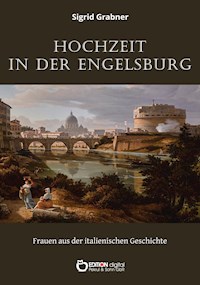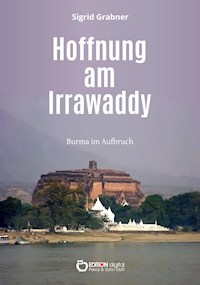8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Am 29. Oktober 2022 wird die heute in Potsdam lebende Schriftstellerin Sigrid Grabner 80 Jahre alt. Rechnet man nach, dann kommt man logischerweise auf den Jahrgang 42 – so auch der Haupttitel des ersten Bandes der Autobiografie der Autorin, Indonesienkundlerin und Katholikin. Über ihr Leben hat Sigrid Grabner in einer zweibändigen Autobiografie Auskunft gegeben. Unter dem Titel „Jahrgang 42. Mein Leben zwischen den Zeiten“ hatte sie über ihre ersten 47 Lebensjahre geschrieben – vom 29. Oktober 2022 bis zum 10. November 1989, nachdem sich wenige Tage nach ihrem 47. Geburtstag alles geändert hatte: Nach dem Erscheinen der Autobiografie „Jahrgang 42“, die mit den Ereignissen des Herbstes 1989 in der DDR endet, fragten mich Leser aus Ost und West, wie es denn nach dem Fall der Mauer weitergegangen sei, heißt es zu Beginn des Vorwortes zum zweiten Teil ihrer Autobiografie, der Sigrid Grabner den ebenso schönen wie nachdenklich stimmenden Titel „Im Zwielicht der Freiheit. Potsdam ist mehr als Sanssouci“ gegeben hat. Schließlich seien die ersten Jahre des vereinigten Deutschlands widersprüchlich, reich an Ereignissen und oft bis zum Zerreißen angespannt gewesen. Beim Mauerfall siebenundvierzig Jahre, hätte doch noch eine Reihe aktiver Jahre vor mir gelegen. Inzwischen sind fast dreißig Jahre seit den turbulenten Monaten und Wochen des Herbstes 1989 vergangen. Viel Wasser ist seither ins Meer geflossen und auch mein Lebensfluss nähert sich der Mündung ins Meer der Ewigkeit. So habe ich mich entschlossen, Zeugnis über mein Leben im wiedervereinigten Deutschland abzulegen und sie gleichsam als Flaschenpost dem Strom der Zeit anzuvertrauen. Wer sie findet, dem erzählt sie etwas über Glück, Enttäuschungen, Versagen und Hoffnung, vor allem aber viel über sich selbst. Die Zeiten ändern sich, die Menschen nicht. Teil 2 setzt noch einmal da ein, wo Teil 1 aufgehört hat, am 9. November 1989, als ein Wort alles veränderte – es lautete „sofort“. Dieses sofort bedeutete für viele Menschen der nun bald ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik und auch für die Autorin eine heftige Zäsur: Ich ging durch eine Stadt, in der ich seit vierundzwanzig Jahren lebte, und sah sie mit anderen Augen. Sie schien noch grauer und zerstörter als vor dem Mauerfall. Die Spuren der Einschüsse in den Mauerwänden aus den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs, der fünfundvierzig Jahre zurücklag, die schadhaften Straßen, die desolaten Dächer …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Sigrid Grabner
Im Zwielicht der Freiheit
Potsdam ist mehr als Sanssouci
ISBN 978-3-96521-657-0 (E-Book)
Umschlaggestaltung: Ernst Franta
Das Buch erschien 2019 bei: fe-medienverlags GmbH, Kißlegg.
2022 EDITION digital
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
„Jedoch, nimm dich in Acht, achte gut auf dich!
Vergiss nicht die Ereignisse, die du mit eigenen
Augen gesehen, und die Worte, die du gehört hast.
Lass sie dein ganzes Leben lang nicht aus dem Sinn!
Präge sie deinen Kindern und Kindeskindern ein!“
Deuteronomium 4,9
Vorwort
Nach dem Erscheinen der Autobiografie „Jahrgang 42“, die mit den Ereignissen des Herbstes 1989 in der DDR endet, fragten mich Leser aus Ost und West, wie es denn nach dem Fall der Mauer weitergegangen sei. Schließlich seien die ersten Jahre des vereinigten Deutschlands widersprüchlich, reich an Ereignissen und oft bis zum Zerreißen angespannt gewesen. Beim Mauerfall siebenundvierzig Jahre, hätte doch noch eine Reihe aktiver Jahre vor mir gelegen.
Inzwischen sind fast dreißig Jahre seit den turbulenten Monaten und Wochen des Herbstes 1989 vergangen. Viel Wasser ist seither ins Meer geflossen und auch mein Lebensfluss nähert sich der Mündung ins Meer der Ewigkeit. So habe ich mich entschlossen, Zeugnis über mein Leben im wiedervereinigten Deutschland abzulegen und sie gleichsam als Flaschenpost dem Strom der Zeit anzuvertrauen. Wer sie findet, dem erzählt sie etwas über Glück, Enttäuschungen, Versagen und Hoffnung, vor allem aber viel über sich selbst. Die Zeiten ändern sich, die Menschen nicht.
Ein Angebot aus Wuppertal
Ein unscheinbares, beiläufig hingeworfenes Wort löste die Explosion aus. Es hieß „sofort“ und war die Antwort auf die Frage eines Journalisten, ab wann die neue freizügige Reiseregelung gelten sollte. Der das Wort aussprach, wusste nicht, was er sagte. Er war nur das Medium. Sechs Buchstaben rasten an diesem späten Novemberabend 1989 durch den Äther – in Wohnzimmer, Redaktionen, Betriebe. Sie luden sich auf zu einem rotierenden riesigen Feuerball, der kurz vor Mitternacht barst und das ganze Land in gleißendes Licht tauchte.
Von diesem Augenblick an war nichts mehr, wie es gewesen war. Von einer ungeheuren Wucht ergriffen, wirbelten die Menschen durch unbekannte Räume, geblendet und benommen, mit vor Staunen weit aufgerissenen Augen und Mündern, schreiend, weinend, stammelnd.
Auch wer in dieser Nacht schlief, spürte das Beben in seinen Träumen, das Kind wie der Greis, und wurde beim Erwachen in den Sog des Lichtsturms hineingerissen. Es gab kein Vorher und kein Nachher, nur das sich ins Ewige weitende Jetzt. Nicht der klügste, kühlste Kopf hätte Worte für das gefunden, was jedem Einzelnen widerfuhr, und gleich ihm Millionen. Alle herkömmlichen Begriffe versagten, Argumente verstummten. Die Welt von gestern versank in einem Schwarzen Loch.
Wie lange dieser zeitlose Zustand nach irdischer Zeit andauerte, erlebte wohl jeder anders. Die einen schlugen bald auf dem harten Boden der Gegenwart auf, andere schwebten noch eine Weile, ehe sie abstürzten oder sanft landeten. Aber alle irrten durch ihnen unbekanntes Terrain. Dichter Nebel lag über Wasser und Land. Keiner wusste, was die Zukunft bringen würde, und viele wussten nicht einmal recht, was sie wollen sollten.
Das Land löste sich auf. Institutionen verschwanden, neue rätselhafte Firmenschilder klammerten sich an den bröckelnden Putz der Häuser. Menschen kamen, Menschen gingen auf Nimmerwiedersehen. Potsdam schien Stunde um Stunde mehr zu zerfallen. Einstige Luxusgüter wurden für Spottpreise verschleudert, mit ihnen konkurrierten Billigwaren, vor allem Autos, aus dem Westen. Die Leute kauften, was das Zeug hielt. Ihre Ersparnisse drohten sich durch die angekündigte Einführung der Deutschen Mark im Juli ohnehin auf die Hälfte zu verringern. Ost-Mark, West-Mark, ein Gewirr wie auf einem orientalischen Basar. Die Stadt war ein einziger Ramschladen. Gerüchte, Zukunftsängste, Enthüllungsgeschichten jagten durch die Straßen, sprangen die Menschen an, verunsicherten sie.
Mein Tagebuch vermeldet unter dem 7. Juli 1990: „Die psychische Anspannung und zugleich Verlorenheit in diesem Land ist schwer zu beschreiben. Die Erwartungshaltung ist seit dem Mauerfall ins Ungeheure gewachsen, sie produziert Unzufriedenheit, die nichts und niemanden ausspart: nicht die im Westen und die bei uns. Man möchte genießen und fürchtet die Arbeitslosigkeit, sieht ein endloses steiniges Feld von Verzicht und Mühen vor sich (die Preise verdoppeln sich, die Löhne bleiben gleich, die Ersparnisse sind halbiert), während gleich nebenan, in Westberlin, es den Leuten besser geht (sie leben in einer ihnen vertrauten Welt, sozial gesichert, in intakten Gemeinwesen). Man möchte alles auf einmal nachholen, was man in den vergangenen vierzig Jahren versäumt zu haben glaubt, und sieht sich dazu nicht imstande. Das Schlimmste aber ist die Entwurzelung. Hinausgeschleudert aus den alten Verhältnissen, bietet sich kein neuer Wurzelgrund. Eine gefährliche Situation für die seelische Gesundheit eines Volkes, die leicht zu persönlichen und gesellschaftlichen Katastrophen führen kann …"
Mich entsetzte der Literaturstreit in den Feuilletons der großen westdeutschen Zeitungen, die man jetzt überall kaufen konnte. Am 29. Juli 1990 notierte ich: „Nun wogt der Kampf zwischen ,hüben und drüben. Es ist viel Selbstgerechtigkeit auf beiden Seiten, auch Heuchelei, vor allem aber Unverständnis für die Lage des jeweils anderen. Auch mit bestem Willen kann sich ein westdeutscher Autor nicht vorstellen, mit welchem Einsatz von Leben ein ernsthafter Autor (kein staatlich hofierter) für die Wahrheit gestanden hat. Heute gelten die schlaflosen Nächte, die Herzattacken, die ständigen Auseinandersetzungen mit der Staatsmacht nichts mehr, sie sind unverständlich geworden. Aus einer Selbstbefreiung ist eine Niederlage geworden, aus dem Rausch der Freiheit der Katzenjammer der Besiegten. Ich kann jene Autoren, die Jahrzehnt um Jahrzehnt ihre seelischen Kräfte gegen die Diktatur aufrieben, nicht so rechthaberisch verurteilen wie einige angesehene westliche Schreiber. Nur ein Vorwurf trifft zu: dass die DDR-Intellektuellen nicht schnell und vorbehaltlos das Aufbegehren des Volkes und die neu gewonnene Freiheit bejaht haben; dass sie, skeptisch und müde geworden, der neuen Freiheit nicht trauten. Und es fällt ihnen schwer, ihre Schuld zu bekennen – vor einem Volk, dessen neue Ideologie das Auto ist, und gegenüber westdeutschen Kollegen, die vor 45 Jahren die Freiheit geschenkt bekamen und nun so tun, als sei die Unfreiheit in der DDR auf das Versagen der Intellektuellen hierzulande zurückzuführen … Keiner, der in einem westlichen Land gelebt hat, wird verstehen, was hier abgelaufen ist, und keiner der Nachgeborenen. Schlimmer noch: Wir verstehen es schon selber fast nicht mehr. Niemand kennt besser als die Ernsthaften unter uns, welche Schuld wir auf uns geladen haben. Aber es wird geradezu unerträglich, wenn Leute, die seit vierzig Jahren eine Fahrkarte, wohin auch immer, lösen konnten, ostdeutschen Autoren das ,Privileg' des Reisens vorwerfen; Leute, die ohne Gefahr für Leib und Leben überall ihre Meinungen publizieren konnten, uns für die in unseren Büchern geäußerten Halbwahrheiten, für die wir vom Volk als Propheten gefeiert wurden, verspotten oder anklagen …
Es ist der alte Hochmut der Intellektuellen – sie produzieren sich in Zeitungen und vor Fernsehkameras, statt miteinander zu reden. Sie verletzen einander wie Gladiatoren. Sie leben von den Honoraren ihrer selbstgefälligen Artikel und Interviews statt vom harten Brot der Wahrheit.
Ich ging durch eine Stadt, in der ich seit vierundzwanzig Jahren lebte, und sah sie mit anderen Augen. Sie schien noch grauer und zerstörter als vor dem Mauerfall. Die Spuren der Einschüsse in den Mauerwänden aus den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs, der fünfundvierzig Jahre zurücklag, die schadhaften Straßen, die desolaten Dächer … Im Vorübergehen hörte ich westliche Besucher, die endlich ungehindert die noch bestehende Grenze passieren durften, laut Erstaunen oder Missfallen über die allgemeine Verwahrlosung äußern.
Die Leute hatten ja recht, aber ihre Worte schmerzten mich, als sei ich schuld am Aussehen dieser geschundenen Stadt. Die Kritiker konnten nicht wissen, wie viel Kraft und Nerven es gekostet hatte, einen Sack Zement oder ein paar Ziegel zu beschaffen; wie idealistische Hobby-Handwerker in ihrer Freizeit versucht hatten, den Verfall zu stoppen. Aus, vorbei, das Gestern zählte nicht mehr. Das Licht der Explosion erhellte ein wüstes Land.
Besucher liefen über die mit hohem Arbeitsaufwand und geringen finanziellen Mitteln gepflegten Wiesen der Parks, grillten vor den Schlössern, woran ein Einheimischer zu DDR-Zeiten nicht einmal zu denken gewagt hätte. Alte Parkwächter, die freundlich darauf hinwiesen, dass dies nicht gestattet sei, lachte man aus oder beschimpfte sie als Stasi-Leute.
Man kam in diesem Sommer des „Nicht mehr“ und „Noch nicht“ auf den Straßen mit Wildfremden schnell ins Gespräch, redete aufeinander ein und aneinander vorbei. Auf dem Busbahnhof neben der katholischen Kirche begegnete ich einem Ehepaar aus Mannheim, beide Anfang Siebzig. Sie freuten sich, endlich Potsdam kennengelernt zu haben, und entsetzten sich über den Verfall der Häuser und die „Armut“ der Menschen. Sie erzählten, sie seien 1945 aus dem Sudetenland vertrieben worden, mit nichts als ihrer Kleidung auf dem Leib: „Wir haben hart arbeiten müssen, Deutschland aus den Trümmern aufgebaut, und es hat eine Weile gedauert, bis wir uns etwas leisten konnten. Inzwischen besitzen wir ein Haus, aus den Kindern ist etwas geworden und wir haben ein schönes Stück von der Welt gesehen. Die Leute hier müssen nun endlich auch richtig arbeiten, ehe sie sich etwas leisten können.“
An ihren Worten war nichts falsch und alles falsch.
„Meine Mutter“, erwiderte ich, „die etwa in Ihrem Alter ist, wurde mit mir als Kleinkind ebenfalls mit nichts als ihren Kleidern auf dem Leib aus dem Sudetenland vertrieben und landete in der Ostzone. Sie hat vierzig Jahre lang hart gearbeitet, auf den Feldern der Bauern, als Kellnerin, Buchhalterin und schließlich jahrzehntelang in Zwölf-Stunden-Schichten als Arbeiterin im Chemiewerk. Sie wohnt heute in einer Einzimmerwohnung einer Plattenbausiedlung, die Welt konnte sie nie bereisen, weil eine Mauer sie daran hinderte, aber sie hat alles dafür getan, dass aus mir ein anständiger Mensch wird. Was werfen Sie ihr vor?“
Ich war wütend und verletzt.
Besucher von fernher stellten sich ein. Alle wollten sie die ehemalige deutsch-deutsche Grenze zwischen Potsdam und Westberlin besichtigen. Marianne kam aus Rom, Rainer und Margret reisten aus Stockholm an, Bekannte aus Westdeutschland, Holland, Frankreich, England … Rainer rief beim Anblick der noch stehenden Wachtürme der Grenzanlagen an der Glienicker Brücke aus: „Mein Gott, das sieht ja aus wie Bilder vom KZ!“
Ich erschrak und zuckte dann mit den Schultern. Was sollte ich sagen? Ich hatte die Grenzanlagen ja nie von westlicher Seite aus gesehen. Größer als mein Erschrecken war das Schuldgefühl, mit dem ich Rainers Beobachtung zur Kenntnis nahm. Hätte ich als Gefangene, als die ich mich aber nicht achtundzwanzig Jahre lang vierundzwanzig Stunden täglich gefühlt hatte, mehr aufbegehren sollen und können? Das freie Europa hatte sich mit diesen Wachtürmen, Mauern, Sprengfallen und Stacheldraht abgefunden, ohne sich schuldig zu fühlen. Warum fühlte ich mich schuldig und nicht die aus dem Westen nach Potsdam strömenden Touristen und Freunde?
Im Chaos dieses Frühsommers 1990 bereitete ich meinen Umzug in eine kleinere Wohnung vor. Ich ahnte, dass es bald schwierig werden würde, die rasant steigenden Mieten zu bezahlen.
Es war einfach alles zu viel – die Freude über den Mauerfall, die Spannung, in welche Richtung sich die politische Situation entwickeln würde. Ich kränkelte. Ich spürte einen Schatten über mir, der mir den Atem nahm. Wie sollte es weitergehen? Mich peinigten keine materiellen Ängste. Ich war immer mit wenig und im Vertrauen auf meine Fähigkeiten ausgekommen. Nach Jakobs Tod hatte ich mir geschworen, alles zu ertragen und durchzuhalten, bis die Kinder für sich selber sorgen konnten. Nun waren sie längst erwachsen. Ich ging auf die Fünfzig zu. Was sollte, was konnte ich noch?
Auch meine Freundin Gerda in Wuppertal machte sich Sorgen. Sie sah die wirtschaftlichen Härten voraus, denen die Ostdeutschen in einem einheitlichen Deutschland ausgesetzt sein würden. Die Freiheit hat ihren Preis. Hatte ich, ihre ostdeutsche Schriftsteller-Freundin, von den Erträgen ihrer Arbeit in der DDR zwar karg, aber immerhin leben können, so hielt sie meine freischaffende Existenz unter den Bedingungen des freien Marktes für brotlos. Wer kaufte schon im Westen ein Buch einer unbekannten ostdeutschen Autorin, die sich ohnehin schlecht öffentlich darstellen konnte!
Also ersann Gerda mit ihrer Freundin Ingeborg einen kühnen Plan zu meiner Rettung. Ich sollte als Nachfolgerin von Ingeborg, die in Kürze die Altersgrenze erreichte, die Leitung des Kiefel-Verlags in Wuppertal-Barmen übernehmen, der zu Bertelsmann gehörte. Freilich musste Bertelsmann von einer Autorin aus dem Osten und ohne jegliche Ahnung vom Verlagsgeschäft erst überzeugt werden. Davon, dass ich das könne, waren die beiden Frauen überzeugter als ich. Ihr Vorschlag war für mich wie ein Rettungsboot auf stürmischer See. Ich stieg ein und fuhr Mitte August nach Wuppertal.
Hier war alles beim Alten geblieben: gepflegte Häuser und Straßen, von Waren überquellende Läden, die Menschen gingen gelassen ihren Geschäften nach. Ihr Leben hatte sich nicht verändert. Sie hatten die Erschütterung im Osten im Fernsehen verfolgt wie einen spannenden Film mit gutem Ausgang, aber was da wirklich geschehen war, wussten die meisten nicht und es interessierte sie auch nicht sonderlich. Nur ältere Menschen, die Deutschland noch vor dem Krieg erlebt und Beziehungen zu Verwandten und Freunden im Osten hatten wie Gerda, oder einstige DDR-Flüchtlinge verfolgten aufmerksam die Vorgänge im Osten.
Ich war immer gern in Wuppertal zu Besuch gewesen. Mir gefiel die Stadt an den Hängen des Bergischen Landes mit ihrer Schwebebahn, den freundlichen Menschen, als Geburtsort von Else Lasker-Schüler, vor allem aber war sie Gerdas Stadt und die ihrer Freunde. Doch diesmal erschien sie mir bei dem Gang durch die Straßen und hinauf auf die Brillerhöhe fremd. Was ich früher als geordnetes Gemeinwesen, gebaut auf hohem Bürgersinn, bewundert hatte, ließ mich jetzt nur an die chaotischen Zustände in Potsdam denken. Ein leiser Groll über vermeintliche Selbstzufriedenheit und Selbstgenügsamkeit in dieser durch die jüngsten Ereignisse unverletzten Stadt erfüllte mich. Lag sie nicht auf einem anderen Stern? Ich war ungerecht, ich wusste es und konnte doch nicht aus meiner ostdeutschen Haut.
Bei Gerda, die mich wie immer mit offenen Armen empfangen hatte, vergaß ich alle unguten Gefühle. Bei ihr war ich zu Hause. Der Verlust ihrer langjährigen Freundin Lily Simon und eine schwere Krebsoperation im vergangenen Jahr hatten sie schmal gemacht. Aber von ihr ging wie eh und je Zuversicht aus. Bald würden wir in einem vereinigten Deutschland, sogar in derselben Stadt, in Wuppertal, leben.
Ingeborg begleitete mich in das Gespräch mit dem seine Skepsis nicht verhehlenden Herrn vom Bertelsmann- Konzern. Ich muss einen guten Tag gehabt haben. Zu Hilfe kam mir, dass so kurz nach dem Mauerfall Worte wie: Das geht nicht! Unmöglich! nicht als Argumente taugten. Zu meinem Erstaunen sprühte ich vor Selbstbewusstsein, Tatendrang und Lernwilligkeit. Der smarte Mann mit den kühlen blauen Augen rüstete sichtbar ab. Seine Miene entspannte sich, seine Augen glänzten, als er zum Ende des Gesprächs meinte, nun müsse er erst einmal dieses Ereignis verdauen. Er nehme eine Bedenkzeit und werde die Angelegenheit dann in der Konzernleitung vortragen.
In Gerdas Elberfelder Wohnung feierten wir den Neuanfang. Ich hätte den Herrn beeindruckt, meinte Ingeborg, so etwas sei ihm noch nicht begegnet. Alles laufe nach Plan. Nur müsse ich nun bald schon wieder umziehen. Ich lachte. Die Welt steht kopf, warum sollte ich da nicht zweimal in einem Jahr umziehen! Tochter Johanna war Anfang Juli nach Nicaragua gereist, geradezu auf der Flucht vor dem unverständlichen Deutschland, um in der Karibik Entwicklungshilfe zu leisten. Sohn Gerrit würde in Kürze eine Arbeitsstelle in Hannover annehmen und der Weg zu meiner Mutter in Halle-Neustadt war von Wuppertal aus genauso weit wie von Potsdam.
Euphorisch kehrte ich nach Potsdam zurück. Bald würde ich das alles hinter mir lassen – die bösen Erfahrungen in der DDR, das Chaos, die Spitzel, die Funktionäre …
Ich besuchte meine Freundin Ruth im Krankenhaus. Nach ihrer Krebsoperation im Vorjahr war es ihr ständig schlechter gegangen. Nun erfuhr ich von den Ärzten, dass es für sie keine Hoffnung mehr gab. Sie würde bald sterben. Ich saß an ihrem Bett, bestellte Grüße von unseren gemeinsamen Freunden in Wuppertal und erzählte von meinen Plänen für einen Neuanfang.
„Nein“, sagte sie, „geh nicht in den Westen, das ist nichts für dich.“
Ruth war wie Gerda zwanzig Jahre älter als ich. Sie fürchtete, mich zu verlieren, und sie stand am Ende ihres Lebens. Ich wollte ihr nicht widersprechen und so tröstete ich sie, noch sei ja nichts endgültig entschieden, was der Wahrheit entsprach. Wenn überhaupt, beginne meine Arbeit in Wuppertal erst nächstes Jahr, und nun, da wir bald in einem Land ohne Grenzen lebten, könnten wir uns ohnehin so oft sehen, wie wir wollten. Sie lächelte nur traurig.
Lag es an Ruths Zustand oder an der schlechten Stimmung in der Stadt oder einfach an körperlicher und seelischer Erschöpfung nach einem Jahr äußerster Anspannung, dass meine Euphorie innerhalb weniger Tage zerbröselte wie ein vertrockneter Kuchen? Nun wollte ich nur noch weg. Ich sehnte mich nach einem Boden unter den Füßen, ohne auf das unbeschreibliche Gefühl jener lichtdurchfluteten schwebenden Novembertage von 1989 verzichten zu müssen.
Reise nach Südtirol und Rom
Mit dem Pass eines Staates, der nur noch pro forma und wenige Wochen existierte, brach ich Ende August in Richtung Süden auf, um in Rom meinen Roman über Christine von Schweden fertigzustellen und mich zuvor noch einige Tage in Südtirol zu erholen.
In Lichtenstern auf dem Ritten nahmen mich freundliche Wirtsleute gastlich auf. Den bedrückten Ostdeutschen war ich entkommen, um nun die fröhlichen Urlauber in der Herberge zu fliehen. Ihre Nähe tat mir weh und ich konnte nicht sagen, warum. Ich verkroch mich in meinem Zimmer, wenn ich nicht unterwegs war. Die in der Abendsonne glühenden Gipfel der Dolomiten, das mächtige Massiv des Schiern, die duftenden Heuwiesen, die weiß gekalkten Alpenhäuser mit den üppigen roten Geranienschleiern nahm ich wie einen vorbeiziehenden Film wahr. Stundenlang zwang ich mich zum Laufen, bis ich die schmerzenden Füße nur noch automatisch setzte. Ich dachte nicht an das, was gewesen war, nicht an das, was kommen würde. Ich betäubte mich durch Bewegung unter dem Himmel. Schwer wie ein Stein fiel ich abends ins Bett, manchmal zu müde, um etwas zu essen.
In den frühen Morgenstunden des dritten Tages überfiel mich ein Traum, aus dem ich mehrmals vergeblich zu erwachen versuchte:
Mit jungen Leuten, unter ihnen meine Kinder, befand ich mich auf einem bewaldeten Berg. Wir saßen in einem Kreis und plauderten. Fotos von Verstorbenen wurden herumgereicht, die auf den Bildern jung und fröhlich aussahen. Ein anschwellendes Dröhnen von schweren Motoren unterbrach unsere Gespräche. Auf der Straße unterhalb des Berges erblickten wir eine endlose Kette von Panzern und Militärfahrzeugen. Auf ihnen hohe breite Gerüste mit Netzen bespannt. Schlagartig wurde uns klar, dass sie anrückten, um wieder eine Mauer zu errichten.
Ein Priester versuchte das Vaterunser zu beten, doch er konnte den Text nicht. Da sank ich auf die Knie, hob die Arme zum Himmel und schrie: Herr im Himmel, nimm dich unser an. Verlass uns nicht. Gib uns Kraft, diese Prüfung zu bestehen … Der Priester giftete, ich sei nicht befugt, so zu beten, denn da kämen doch unsere Befreier. Zwei junge Burschen packten den Mann und schoben ihn sanft, aber bestimmt zu einem Tunnel, der zu der Militärkolonne führte.
Wir flohen bergauf. Johanna war plötzlich wieder ein kleines Mädchen an meiner Hand. Sie verletzte sich am Fuß und konnte nicht weiterlaufen. Ich kniete neben ihr nieder, küsste sie und dachte dabei verzweifelt: Du hattest dir geschworen, dich nicht noch einmal einsperren zu lassen. Aber wohin soll ich fliehen mit den Kindern? Ich kenne den Weg doch nicht.
Am Tag nach diesem Traum lief ich achteinhalb Stunden wie eine Besessene. Tausend Meter bergauf bis zum Rittner Horn, die letzten hundert Meter im dichten Nebel. Der Aussichtsberg gab den Blick nicht frei. Das störte mich nicht, denn nicht wegen der Aussicht hatte ich mich mit keuchenden Lungen und wild pochendem Herzen hinaufgequält. Auch beim Abstieg verschmähte ich den Lift, ließ keinen Umweg aus. Ich wollte meine Not, meine Angst, meine Fremdheit unter den Menschen ausatmen, wegschwitzen.
Nach einigen Tagen wurde mein Blick freier, meine Ohren begannen wieder zu hören. Hin und wieder vermochte ich sogar, mit den Wirtsleuten und dem einen oder anderen Gast zu plaudern. Ich besuchte Gottesdienste in der kleinen schlichten Kirche von Lichtenstern mit einer Keramik-Madonna und einem Keramik-Kreuzweg.
In dem Gotteshaus ist der junge Tiroler Josef Mayr-Nusser beigesetzt, der den Eid für die Waffen-SS aus Gewissensgründen abgelehnt hatte und auf dem Weg ins KZ Dachau im April 1945 in einem Viehwaggon bei Erlangen verstorben war.
Einmal predigte ein alter Priester, auf Jeremia und Paulus verweisend, man müsse das Kreuz auf sich nehmen, wie es Gottes Stimme befehle. Der uns die Last auferlege, gebe uns auch die Kraft, sie zu tragen. Es gehe nicht darum, sich an die Welt anzupassen, sondern uns und damit die Welt verändernd Christus nachzufolgen. Ich dachte an meinen Traum. Konnte Gott wollen, dass ich lebenslang eingesperrt blieb?
Manchmal saß ich auch nur ganz still in dem Kirchlein, ohne Gebet, ohne Fragen. In den Nächten suchten mich wilde Träume heim, die ich beim Aufwachen vergaß, nur jener aus der dritten Nacht begleitete mich ständig. Ich suchte ihn zu entschlüsseln, aber er sprach mir immer nur vom blanken Entsetzen über neuerliches Eingesperrtsein.
In Rom quartierte ich mich bei meiner Freundin Marianne ein. Wenn ich nicht für mein Buch recherchierte, unternahmen wir Ausflüge nach Tarquinia ins alte Etruskerland, nach Arezzo, Palestrina, in die Castelli Romani, in die Klöster Fossanova, wo der große Aquinate starb, und ins Zisterzienserkloster Casamari, dessen Schönheit und berauschender Duft von Salvien und Rosen mich verzauberte.
Im Kloster Casamari hatte um 1183/84 der Mönch Joachim von Fiore gelebt, damals so alt wie ich jetzt. Sein Geschichtsbild von den Drei Zeitaltern – dem des Vaters (Altes Testament), dem des Sohnes (Neues Testament) und dem des Heiligen Geistes – faszinierte über Jahrhunderte hinweg Dichter wie Dante, Revolutionäre wie Cola di Rienzo und Thomas Müntzer, Philosophen wie Hegel und Ernst Bloch. Immer mal wieder in der Geschichte schien das dritte, das glückliche Zeitalter des Heiligen Geistes bevorzustehen, in dem es keine Hierarchien und Stände, kein Oben und Unten mehr geben würde. Hatten nicht auch in unserer Zeit edle Geister vom Ende des Totalitarismus und vom Anbruch einer freiheitlichen Demokratie geträumt, die Gesetze und Polizei überflüssig machte, weil jedem Menschen das Gesetz selbstlosen Handelns ins Herz geschrieben war?
Joachim von Fiore hatte aus seinem Geschichtsbild keine praktischen Konsequenzen gezogen und recht daran getan. „Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr; sondern soviel der Himmel höher ist denn die Erde, so sind auch meine Wege höher denn eure Wege und meine Gedanken denn eure Gedanken.“
Stundenlang beobachtete ich die Pilger und Touristen auf dem Petersplatz. Tausende von Priestern aus aller Welt waren zu einer Tagung nach Rom gekommen. Während der Mittagspause bevölkerten sie das weite Rund – Männer aller Hautfarben und Nationen, Dicke, Dünne, Kleine, Große, in Soutanen, schwarzen Anzügen, in Kutten die Ordenspriester. Sie hockten auf den Stufen im Schatten der Kolonnaden und aßen aus Tüten ihre Mittagsmahlzeit, schwatzten, lachten, rauchten. Vor den beiden Brunnen ließen sich farbenprächtig gekleidete Afrikaner nieder und bleiche Nordeuropäer fotografierten. Kinder scheuchten die Tauben auf. Jugendgruppen zogen singend auf den Eingang der Kirche zu. Eine Leichtigkeit lag über dem Platz, die mir in den letzten Monaten abhandengekommen war und die ich nun begierig einsog.
Zum ersten Mal war ich ohne Ausreisevisum in Rom, und zum letzten Mal trug ich den Pass der Deutschen Demokratischen Republik in der Tasche. Ich musste nicht wie vor neun Jahren fürchten, nie wieder hierherkommen zu dürfen, aber im seelischen Ausnahmezustand befand ich mich dennoch. Das Land DDR existierte de facto nicht mehr und das Deutschland, das auf mich zukam, erschien mir wie eine Fata Morgana. Mir war, als setzte ich meine Füße auf schwankenden Boden, jederzeit in Gefahr, das Gleichgewicht zu verlieren.
Ich achtete auf alle Zeichen, die mir den Weg in die nächste Zeit zeigen konnten. In der Chiesa Nuova predigte ein Priester über Matthäus 18, wo Petrus seinen Meister fragt, wie oft er seinem Bruder vergeben müsse. Siebenmal oder siebzigmal? Der weißhaarige alte Priester erschien mir wie ein nachgeborener Bruder des heiligen Filippo Neri, der vor Jahrhunderten hier sein Oratorium gegründet hatte. „Wie sollte uns vergeben werden, wenn wir nicht vergeben!“, donnerte der Prediger. Dann verwies er auf das deutsche Sprichwort, man solle über jede Kränkung eine Nacht lang schlafen und nicht sofort zurückschlagen.
In einer Messe im Petersdom bohrten sich mir die Worte ins Gedächtnis: „Die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein.“ In seiner Auslegung sprach der Zelebrant vom notwendigen Mut des Christen, anders zu sein und auf Gottes Stimme zu hören, auch wenn ihn die Welt für verrückt erklärte. Meist gelte es ja nicht das Leben, sondern sei nur die Kraft gefordert, Missverständnisse auszuhalten und sich von den Massenmedien unabhängig ein Urteil zu bilden.
War ich gekränkt? Wem sollte ich vergeben? Ich empfand gegen niemanden Hass. Wie auch? Es ging mir ja alles in allem gut. Die Mächtigen waren gestürzt, die Niedrigen erhöht worden. „Meine Wege sind nicht eure Wege“, aber welcher Weg war dann der meine? Und wenn ich mich entschied, entschied ich mich für den richtigen?
Gerda rief in Rom an, ich solle meine Heimreise über Wuppertal nehmen, der Herr von Bertelsmann wolle mit mir über meine künftige Tätigkeit als Geschäftsführerin des Kiefel-Verlages sprechen. Also schien meine Anstellung sicher. Warum nur fühlte ich mich so beklommen?
Wenn die Römer hörten, ich käme aus der DDR und gar noch von der Berliner Mauer, gerieten sie aus dem Häuschen. Als ein Wunder erschien ihnen, was da gerade in Deutschland passierte, und die Ostdeutschen waren für sie Helden. Eine Germanistikstudentin fragte mich, warum sich die Deutschen so wenig über den Mauerfall freuten und vor der bevorstehenden Einheit warnten, wie beispielsweise der berühmte Schriftsteller Günter Grass.
„Den meisten Westdeutschen ging es mit Mauer und ohne Einheit sehr gut, wahrscheinlich viel besser, als es ihnen in Zukunft gehen wird, und die Ostdeutschen haben Angst, in einem vereinten Deutschland den Kürzeren zu ziehen“, erwiderte ich.
Die Angst der Ostdeutschen, von den Westdeutschen über den Tisch gezogen zu werden, konnte sie nachvollziehen und dennoch: Die Mauer ist weg, die Ostdeutschen sind frei! Auch frei, sich zu wehren! Und sie trällerte:
„Freiheit, die ich meine, die mein Herz erfüllt …“ Sie umfasste meine Taille und schwenkte mich durchs Zimmer. „Komm mit deinem Scheine, holdes Engelsbild …" Ihre dunklen Augen blitzten vor Freude.
Einige Tage später besuchten wir Mariannes Freunde Michele und Ninetta, er Philosoph, Anfang Siebzig, sie eine frühere Gewerkschaftsfunktionärin. Beide überzeugte Kommunisten, ohne der Kommunistischen Partei anzugehören. Ich kannte sie schon von meinem letzten Aufenthalt und war herzlich von ihnen aufgenommen worden.
Diesmal begegneten sie mir kühl, beinahe feindselig. In der Annahme, sie wollten etwas über die Vorgänge in Deutschland wissen, begann ich zu erzählen, doch sie ließen mich nicht ausreden. Deutschland sei nicht die Welt und das ganze Gerede über den Mauerfall Unsinn. Eine historische Chance auf dem Weg zum wahren Sozialismus sei vergeben worden, weil die Masse die Bedürfnisse des Bauches höher stellte als die Befreiung der Menschheit.
Gewiss, das eine oder andere sei in der DDR nicht in Ordnung gewesen, aber doch kein Grund, das große Experiment abzubrechen.
Mit wachsendem Befremden hörte ich zu. Die beiden Streiter für den wahren Sozialismus lebten in einer großen Wohnung, sie hatten sich zeit ihres Lebens frei bewegen können, gelesen, was sie wollten, ihre Meinung geäußert, ohne verfolgt zu werden. Mit welchem Recht verlangten sie von uns, um ihrer sozialistischen Ideale willen weiterhin eingesperrt zu bleiben? Was sprach da aus ihnen: Fantasielosigkeit, Fanatismus, Hartherzigkeit?
Was dagegen einzuwenden sei, dass sich ein ganzes Volk gewaltlos von seinen Unterdrückern befreit und in freien Wahlen eine Entscheidung mehrheitlich für den Anschluss an die Bundesrepublik Deutschland getroffen habe?, fragte ich.
Die Masse, ereiferte sich Michele, die Masse, verblendet von den oberflächlichen Verlockungen des Kapitalismus, sei dumpf und stumpf den Meinungsmachern aus dem Westen gefolgt. Nur ein gebildeter Mensch könne die richtigen Entscheidungen treffen. Dann dozierte er über Antonio Gramscis Begriff von den traditionellen und den organischen Intellektuellen. Die traditionellen Intellektuellen, wie Künstler, Philosophen, Schriftsteller, sähen sich fälschlicherweise als eine Klasse außerhalb der Gesellschaft, während die Arbeiterklasse auf dem Weg zur Hegemonie die traditionellen Intellektuellen assimiliere und zugleich aus ihren eigenen Reihen eine Gruppe organischer Intellektueller herausbilde. Das Ziel bestünde darin, dass in einer wahren sozialistischen Gesellschaft jeder die Funktion eines Intellektuellen einnehmen könne.
Michele verwies auf den Aufruf „Für unser Land“ von Ende November 1989, in dem sich ostdeutsche Künstler, Schriftsteller, Wissenschaftler, Kirchenleute gegen die Wiedervereinigung und für eine staatliche Eigenständigkeit der DDR als sozialistische Alternative zur Bundesrepublik eingesetzt hatten. Er habe ihn genau gelesen. Die Verfasser und Unterzeichner dieses Appells seien die wahren, die organischen Intellektuellen im Sinne Gramscis, die die Vorherrschaft des Kapitals brechen können. Aber das Volk der DDR habe nicht auf sie gehört. Nun werde es die Suppe auslöffeln müssen, die es sich eingebrockt habe. Das Votum für die Einheit Deutschlands beweise die Unreife und Unbildung der Wähler in Ostdeutschland.
Auch ich hatte aus guten Gründen den Aufruf nicht unterzeichnet. Mein Eingeständnis verdüsterte Micheles Miene noch mehr.
Um das Gespräch zu entkrampfen, zitierte ich eine Bemerkung von Friedrich Engels, wonach die Geschichte so verlaufe: Der eine will dies und der andere das und heraus kommt, was keiner von beiden gewollt habe. Die Geschichte, fügte ich an, kümmert sich herzlich wenig um unsere Prinzipien.
Michele war nicht bereit, das Gespräch auf eine versöhnliche Ebene zu heben. Verbissen dozierte er weiter: Es brauche ein Bildungssystem, das dem Prinzip einer zukünftigen sozialen Gesellschaft und den Einsichten der marxistischen Theorie folge. Die bereits bestehenden intellektuellen Tätigkeiten der Massen sollten durch dieses neue Bildungssystem kritisch hinterfragt und erneuert werden. Schließlich verstieg er sich zu der Behauptung, nur gebildete Menschen seien auch wirklich gute Menschen.
Nun war ich mit meiner Geduld am Ende. Meine Nerven lagen blank. Ich wurde scharf: Also sei ein Volk von Idioten gegen die sozialistische Staatsmacht aufgestanden und alle Italiener, die sich über den Mauerfall freuten, seien ebenfalls dumm.
In gewisser Weise, ja, erwiderte er kühl.
Hier war sie wieder, die menschenverachtende Arroganz von Intellektuellen, die sich nur um sich selber drehten, blind und taub waren für das Leben und unbarmherzig zu den Menschen. Es gab sie überall, in Italien ebenso wie in Deutschland.
Brüsk erhob ich mich. Micheles Bemerkung beim Abschied, wir seien alle verwundet, klang wie eine Entschuldigung, doch sie kam zu spät. Sie hätte am Anfang des Gesprächs stehen müssen.
Auf dem Heimweg versuchte Marianne, mich zu beruhigen. So kenne sie die alten Freunde Michele und Ninetta nicht, sie hätten es bestimmt nicht so gemeint. Aber am Ende ihres Lebens sähen sie durch den Gang der Ereignisse eben ihre Ideale verraten.
Bissig fragte ich zurück, warum sie dafür den Mauerfall verantwortlich machten und nicht ihre untauglichen Ideale.
Die deutsche Ausgabe von Michele und Ninetta sollte ich dann bei meiner Rückfahrt in München treffen, als ich bei einem von Freunden empfohlenen Ehepaar übernachtete. Geradezu hasserfüllt redeten sie gegen ein wiedervereinigtes Deutschland an, das wie schon einmal die ganze Welt bedrohen würde. Die desolate Lage der DDR sei nicht durch die sozialistische Planwirtschaft verursacht worden, sondern durch die Bundesrepublik Deutschland. Die gastfreundlichen, aber unfrohen Eheleute witterten hinter allem, was nun in Ost und West geschah, Heuchelei und bösen Willen. Sie warfen der Welt und den Menschen vor, ihre Blütenträume zerstört zu haben und nicht so edel zu sein wie sie selber.
Ich schied von Rom, das mich bisher immer geheilt hatte, mit einem fast fertigen Manuskript. Auch hier hatten mir Albträume zugesetzt. In ihnen begegnete mir Ruth, wie sie sich mit zwei Koffern aus dem Krankenhaus nach Hause schleppte. Ich nahm ihr die Koffer ab und begleitete sie. Doch anstelle ihres Hauses fanden wir nur ein frisch gepflügtes Feld vor, ohne Baum und Strauch. Aber sie nahm noch nicht wahr, was ich schon sah, und weinend dachte ich: Wie schwer wird sie der Verlust ihres Hauses treffen! In anderen Träumen war die Stelle in Wuppertal bereits vergeben und man bedeutete mir, meine Berufung sei ein Irrtum gewesen. Dann wieder stürzte ich von hohen Mauern in die Tiefe und wusste im Fallen, dies sei das Ende.
Nach dem Aufwachen notierte ich die Träume, aber ich konnte und wollte sie nicht als Prophezeiungen deuten. Ich akzeptierte sie einfach. Die Seele entledigte sich, wie schon immer in meinem Leben, auf diese Weise ihrer Lasten und Ängste. Und so waren mir die Albträume willkommen.
Als Fremde ging ich durch fremde Städte, unsicher und angespannt: durch München während des Oktoberfestes und durch Ulm. Ich besuchte alte Freunde in Kißlegg und fuhr schließlich mit dem Intercity „Gambrinus“ Richtung Wuppertal. Auf der schönen, für mich schönsten Strecke zwischen Mainz und Koblenz erinnerte ich mich an die gemeinsame Reise mit Jakob an Rhein, Main, Tauber und Mosel, ein Jahr vor seinem Tod. Beim Anblick des Loreley-Felsens hatte er, der immer Sangesfreudige, das Lied von der Loreley angestimmt. Nun, da ich fünfzehn Jahre und einen Atemzug der Geschichte später in der Abenddämmerung auf den Felsen schaute, verstand ich Heines Gedicht plötzlich ganz neu: „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin …" Ich hörte das Lied von der Freiheit, „eine wundersame gewaltige Melodei“.
Wir hatten so selbstvergessen gelauscht, dass wir die Felsenriffe nicht sahen. Den Traum von der Freiheit träumten wir mit einem wilden Weh im Herzen wie unzählige Generationen vor uns seit „uralten Zeiten“. Doch nun, da wir meinten, die Schöne errungen zu haben, verschlangen uns die Wellen. Das Paradies auf Erden gab es nicht, bestenfalls eine Ahnung davon.
Als es vor den Zugfenstern dunkelte, vertiefte ich mich in die Lektüre eines politischen Magazins. Die brutale Sprache stieß mich ab. Sie erinnerte mich an das Parteiorgan der SED, mit dem Unterschied, dass dort alles hochgejubelt wurde, was die DDR betraf, und alles verdammt wurde, was mit dem kapitalistischen Westen zu tun hatte, während in diesem Magazin einfach alles, worüber berichtet wurde, nach Fäkalien roch. Meinungsfreiheit bedeutete offensichtlich, in der Wahl seiner Worte nicht zimperlich zu sein und mit harten Bandagen zu kämpfen. Ich musste noch lernen, wie alle im Osten, dass es auch im freien politischen Meinungsstreit nicht um Wahrhaftigkeit ging, sondern darum, sich letztendlich durchzusetzen.
Im Magazin blätternd, erfuhr ich, in Holland berieten katholische Theologinnen über die Gründung einer Kirche der Frauen, in der das Männergeschwätz über Christi Tod und Auferstehung endlich aufhörte. Eine Autorin meinte, sie ginge ohnehin nur noch ab und zu aus „ethnologischem“ Interesse in die Messe. Mich beschlich die Ahnung, auch in der Welt des Glaubens ginge es mehr um ideologische Profilierung als um Wahrheit.
Ja, sagte der Herr vom Bertelsmann-Konzern in Wuppertal, man habe sich entschlossen, das Risiko mit mir einzugehen. Er bitte um Entschuldigung, wenn seine Worte hart klängen, er wolle mich nicht kränken. Es sei nun aber einmal eine Tatsache, dass ich aus dem Osten stamme, nicht mehr ganz jung sei und unerfahren im Verlagsgeschäft. Da müsse ich noch eine Menge lernen und sehr flexibel sein. Aber die jetzige Geschäftsführerin des Verlages habe ihm versichert, mir in dem Volontariatsjahr zur Seite zu stehen. Ingeborg lächelte mir ermutigend zu. Der Herr von Bertelsmann sagte mir nichts Neues und ich nickte zustimmend.
Meine Tätigkeit würde am 1. Januar 1991 beginnen. Zunächst stünden einige Lehrgänge auf dem Programm: Marketing, Stressbewältigung, Computer, Verkaufspsychologie, Werbung.
Heute, da ich dies niederschreibe, werfen schon Kinder mit diesen Begriffen um sich. Sie sitzen stundenlang vor dem Computer, sind ständig im Stress und deshalb bei Psychologen in Behandlung. Aber mir klangen sie damals so fremd wie nur irgendetwas in den Ohren. Das Wort Stress kannte ich nicht, einen Computer hatte ich noch nie gesehen und unter Marketing konnte ich mir absolut nichts vorstellen. Ich ließ mir mein Staunen nicht anmerken, sondern schaute drein, als hielte ich das alles für die selbstverständlichste Sache der Welt.
Mit einem knappen „gut“ schloss der Bertelsmann-Vertreter die Auflistung von Pflichten und Rechten. Anfang Dezember, also in zwei Monaten, würden wir uns noch einmal zur Vertragsunterzeichnung und zur Einführung in den Verlag treffen. Mit einem Handschlag trennten wir uns im besten Einvernehmen.
Ingeborg und Gerda jubelten: Geschafft! Wir feierten das gelungene Projekt mit einer Flasche Champagner und ich war wild entschlossen, eine gute Verlegerin zu werden.
Wie Potsdam die Einheit feierte
Am nächsten Morgen, dem 1. Oktober, reiste ich ab. Ich wollte unbedingt zum 3. Oktober 1990, am Tag der Vereinigung der beiden deutschen Staaten, wieder in Potsdam sein und erleben, wie sich das einmalige historische Ereignis anfühlte, wenn ein demokratisch gewähltes Parlament samt Regierung sich freiwillig entließ.
Der 2. Oktober war ein seltsamer Tag, früh neblig, nachmittags sonnig, abends sternenklar. Mit einer Kollegin durchstreifte ich die Stadt. Es war ein Mittwoch wie jeder andere. Den alltäglichen Betrieb auf den Straßen nahm ich als heitere Melodie wahr. Die leuchtenden Herbstfarben der Bäume verdeckten die grauen Häuserwände. Alles in mir verlangte nach Freude und Zustimmung.
In welch einer Anspannung hatten wir noch vor einem Jahr gelebt, die „chinesische Lösung“ vor Augen, der Verzweiflung näher als der Hoffnung und doch entschlossen, uns nicht länger mehr knechten zu lassen. Wir waren bereit gewesen, unser Leben zu wagen. Keiner von jenen, die am 7. Oktober 1989 auf der Brandenburger Straße, die damals noch den Namen eines tschechischen Stalinisten trug, gegen die Staatsmacht demonstrierte, hatte sich vorstellen können, dass diese waffenstarrende Diktatur wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen würde.
Eigentlich, dachte ich, müssten wir jetzt auf den Straßen tanzen, den Freiheitschor aus „Nabucco“ singen und Beethovens „Ode an die Freude“ wie während der Demonstration auf der Brandenburger Straße vor einem Jahr. Oder irgendetwas Verrücktes tun. Wann hatte es in Deutschland zuletzt ein so glückhaftes Ereignis gegeben! Aber nichts deutete darauf hin, dass hier etwas ganz Außergewöhnliches geschah.
Zum Abend wurde es geradezu auffällig still in der Stadt. Das Haus der Demokratie, bis vor einigen Monaten noch Untersuchungsgefängnis der Staatssicherheit, im Volksmund „Lindenhotel“ genannt, wirkte von außen wie ausgestorben. Hier trafen sich die Bürgerbewegten, denen ich mich zugehörig fühlte. In dem kleinen Saal, ehemals der Verhandlungsraum von Gestapo, sowjetischem Geheimdienst und schließlich Staatssicherheit, drängten sich die Menschen. Jemand sprach, war aber nicht zu verstehen, da es keine Mikrofone gab. Ich erkannte auf dem Podium Lea Rosh, Jens Reich, Ibrahim Böhme, Reinhard Meinel. Es herrschte eine gedrückte Stimmung, fast wirkte die Zusammenkunft wie eine Verschwörung. Was soll das, dachte ich. Vor einem Jahr haben wir zwar nicht an die Einheit Deutschlands gedacht, vielleicht nicht zu denken gewagt, aber nun fällt sie uns plötzlich zu, mit allen Möglichkeiten und Gefährdungen. Warum freuen wir uns nicht einfach? Wo ist unser Mut geblieben?
Im Klub der Kulturschaffenden am Lustgarten hatten sich Schriftsteller-Kollegen und Mitglieder der zur PDS gewendeten SED versammelt. Der Raum lag im Halbdunkel, ein stilles Publikum verfolgte ein Kulturprogramm, dessen Sinn sich uns nicht erschloss, wohl eine Art Trauerfeier für die verblichene DDR.
Am Denkmal für die Verfolgten des Naziregimes und am neuen Denkmal des Unbekannten Deserteurs, einem „Geschenk“ aus der Partnerstadt Bonn, flackerten Kerzen. In Grüppchen standen junge Leuten beisammen, um den Platz vor den „Rechten“ zu schützen, von denen aber weit und breit nichts zu sehen war. In Abständen skandierten sie lauthals: „Halts Maul, Deutschland!“ und „Scheiß auf einig Vaterland!“ Hier gehörten wir offensichtlich auch nicht hin.
Schließlich zwängten wir uns in eine überfüllte Straßenbahn Richtung Glienicker Brücke. Dorthin hatte die CDU zum Volksfest eingeladen. Am Ufer der Havel waren Buden und ein großes bayrisches Bierzelt aufgebaut. Man aß und trank, flanierte über die Brücke und den Fluss entlang. Ein Blasorchester schmetterte seine Weisen. Von ausgelassener Fröhlichkeit keine Spur.
Ich schaute auf das Treiben und fragte mich, warum die Deutschen und besonders die Ostdeutschen sich nicht freuen konnten. Lag es am schwerblütigen Temperament der Brandenburger? Lag ihnen nichts an der Freiheit?
Weder noch. Sie hatten einfach Angst. Sie litten unter jener „German Angst“, die wenig später in den Feuilletons der Weltpresse belächelt, verspottet, ergründet wurde.
Diese Angst hatte wenig mit Feigheit und viel mit der jüngeren Geschichte zu tun. Nach zwei furchtbaren Kriegen – schuldig geworden durch Völkermord, selber ausgeblutet, ein Drittel seines Staatsgebietes verloren, in einem Trümmerfeld aus Weltmachtsträumen erwacht, gedemütigt, vergewaltigt, geteilt, verachtet, seit fast einem halben Jahrhundert von fremden Armeen besetzt – trauten die Deutschen nicht mehr sich selbst und auch nicht den anderen. Sie hatten sich zwar aus ihrem Elend herausgearbeitet, aber sie wollten nicht für ihre Tüchtigkeit bewundert, sondern von der Welt geliebt werden. Wie ein Kind, das nach einem Vergehen um die Zuneigung der Eltern buhlt, gaben sie sich angepasst und moralisch untadlig. So wurden die Deutschen West und Ost die treuesten Verbündeten ihrer jeweiligen Supermächte, die bereitwilligsten Zahler von Verbindlichkeiten, die besten Vergangenheitsbewältiger, die schärfsten Verurteiler ihrer Väter und Vorväter. Mit Deutschland wollten viele Deutsche nichts mehr zu tun haben, weder mit seiner Geschichte noch mit seiner Zukunft. Lieber ein vereintes Europa als ein vereintes Deutschland. Und so beteuerten sie sich und der Welt fortwährend: Wir sind gut, wir sind lieb, wir nehmen die Teilung als gerechte Strafe für unsere Untaten an, denn wir haben für alle Zeiten aus der Vergangenheit gelernt.
Die Nachbarvölker registrierten die im Laufe der Jahre zum Ritual werdenden Schuldbekenntnisse mit zunehmendem Unverständnis und mutmaßten Heuchelei und moralische Überheblichkeit.
Nach dem Fall der Mauer hatten viele Ostdeutsche gemeint, nach Deutschland zu kommen wie ins Gelobte Land, und mussten feststellen, dass es dieses Deutschland gar nicht mehr gab. In vierzig Jahren der Teilung hatten sich die nachwachsenden Generationen westlich der Elbe an den USA, Frankreich, England orientiert, waren im Urlaub nach Spanien und Italien gereist. Ostdeutschland interessierte nicht. Grenzte es nicht direkt an Sibirien?
Die Westdeutschen fürchteten um ihren Wohlstand, wenn die armen Verwandten in ihr Haus kamen, und die Ostdeutschen, aus dem Gefängnis ausgebrochen, fühlten sich fremd in der neuen Realität. Und beide wussten nicht recht, wer sie denn waren und was dieses Deutschland sein sollte.
Eine Weile schauten wir uns das verhaltene Treiben an der Glienicker Brücke an. Waren das noch dieselben Menschen, die sich vor elf Monaten lachend, weinend, musizierend über die Brücke geschoben hatten, die den DDR-Grenzpolizisten Blumen an die Uniformen geheftet und am anderen Ufer völlig fremden Menschen jubelnd in die Arme gefallen waren? Gegen das gesetzte Treiben am Vorabend der deutschen Einheit mutete das kleinste Dorffest wie eine Freudenorgie an. Kurz vor Mitternacht war ich zu Hause. Im Fernsehen verfolgte ich, wie in Berlin nach den Schlägen der Freiheitsglocke zu Mitternacht vor dem Reichstag die schwarz-rot-goldene Fahne gehisst wurde. Da kamen mir dann doch die Tränen.
Von einem Tag auf den anderen änderte sich alles: die Uniformen der Polizisten und Soldaten, die Bezeichnung von Behörden, die Gesetze, selbst die Sprache. Es war, als sei man in einer anderen Welt aufgewacht. Es blieb keine Zeit, darüber nachzudenken, was uns geschah. Nach den Wahlen zur Volkskammer im März 1990, zu den Kommunalvertretungen im Mai, standen noch Wahlen für die neu zu schaffenden Landtage und für den Bundestag bevor.
Johanna kehrte von ihrem dreimonatigen Aufenthalt aus Nicaragua zurück, um mir zu eröffnen, sie reise in Kürze für ein halbes Jahr nach El Salvador, um dort Kinder zu unterrichten und mit Freunden als lebendige Schutzschilde für Gegner der Militärdiktatur zu dienen. Wenn ein Einheimischer erschossen würde, rege sich die Welt darüber nicht auf, wohl aber wenn es einen Ausländer aus Westeuropa treffe, erklärte sie. Auf diese Weise könne man der gerechten Sache der Latinos am besten dienen.
Ihre Eröffnung traf mich wie ein Schlag aufs offene Herz. Sie wollte einfach nicht in Deutschland ankommen. Das verstand ich noch einigermaßen, wenn ich auch der Meinung war, Menschen wie sie hätten hier jetzt genug zu tun. Aber hatte ich sie großgezogen, damit sie als Schutzschild für salvadorianische Oppositionelle ihr Leben riskierte? Noch zitterten in mir die Ängste nach, die ich um Johanna und Gerrit vor einem Jahr ausgestanden hatte. Für Che-Guevarra-Romantik mochte ich meine Tochter nicht hergeben. Sie sollte besser ihr Studium beenden und sich dann noch einmal neu entscheiden. Wir verstrickten uns in harte Auseinandersetzungen bis an die Grenze des Erträglichen. Schließlich verzichtete sie auf El Salvador, um ein dreiviertel Jahr später für viele Monate nach Guatemala aufzubrechen. Aber das wusste ich zum Glück noch nicht.
Von den Lesungen aus meinem Gandhibuch in jenen Oktobertagen 1990 ist mir die in Berlin-Zehlendorf besonders im Gedächtnis geblieben. Das Thema lautete: „Gandhi und die Ereignisse in Potsdam im Herbst 1989“. Es kamen nur wenige Zuhörer, vorwiegend junge Leute. Man schien erschöpft vom einigen Deutschland. Die Jugendlichen sprachen in der Diskussion von der kommenden Diktatur des Geldes, von Idealen und Utopien. Sie hatten sich eine reformierte DDR als Vorbild für die BRD gewünscht, und nun das. Ich verwies auf den Unterschied zwischen Illusion und Ideal. Man müsse sich der Diktatur des Geldes so wenig beugen wie der Diktatur einer totalitären Staatsmacht. Man solle seine Ideale leben und sie nicht von anderen fordern und der Welt übelnehmen, dass sie ist, wie sie ist. Eine intensive nachdenkliche Diskussion. Mittendrin erzählten drei junge Männer, sie hätten kurz nach dem Mauerfall in einem Wald bei Belzig den Nachbau des Platzes der Nationen in Potsdam samt Straßenbahn gesehen, auf dem die Staatssicherheit den Krieg gegen die Demonstranten vom 7. Oktober 1989 geprobt hatten. Auf meine Nachfragen beteuerten sie, das sei wirklich so gewesen. Ich spürte meine Knie weich werden. Wir hatten vor unserer geplanten Aktion am 7. Oktober zum 40. Jahrestag der DDR von diesem Übungsplatz gehört, es aber als Gerücht abgetan, ausgestreut von der Stasi, um uns Angst zu machen. Wir wollten uns einfach nicht vorstellen, dass man gegen ein Häuflein Demonstranten einen Krieg entfesseln würden und verdrängten unsere Ängste. Mut ist nicht nur, aber auch eine Frucht der Ahnungslosigkeit.
Die jungen Männer erboten sich, mir das Gelände zu zeigen, aber ich glaubte ihnen auch so. Heute tut es mir leid, dieses Zeugnis einer kranken Staatsmacht nicht in Fotos festgehalten zu haben. Aber mich beschäftigte wie alle in diesen Tagen die Zukunft mehr als die Vergangenheit.
Absage an Wuppertal
Für Bertelsmann stellte ich die Unterlagen für meine Tätigkeit als Geschäftsführerin des Kiefel Verlags in Wuppertal zusammen. Dazu gehörte auch ein Lebenslauf. Ich schrieb ihn, verwarf ihn, begann aufs Neue. Auf mein Leben zurückschauend, fragte ich mich, wie ich den ahnungslosen Bertelsmann-Leuten vierzig Jahre DDR erklären sollte, in denen ich geliebt, gelebt, versagt, gestritten hatte. Immer wieder fiel mir der Vers eines unbekannten Dichters aus dem Mittelalter ein: „Ich bin, ich weiß nicht, wer/ich komme, ich weiß nicht, woher/ich gehe, ich weiß nicht, wohin/mich wundert, dass ich so fröhlich bin.“ Das traf meine Situation, nur fröhlich war ich nicht so recht, obwohl ich das doch hätte sein müssen. Die Welt stand mir offen, eine gut bezahlte Stellung erwartete mich, die es mir erlauben würde, die Welt zu bereisen. Was also machte mich unruhig?
Ich blätterte in meinen Reisenotizen aus Italien, um mich abzulenken. Dabei stieß ich auf meine nächtlichen Albträume über vergebliche Flucht, Irrtum und Abstürze; auf notierte Bibelstellen und Predigten.
Beim Lesen fiel es mir plötzlich wie Schuppen von den Augen: Wenn du jetzt in ein Leben der Sicherheit im tiefen Westen gehst, wird die Mauer zwischen dem Neuen Garten und dem Jungfernsee, an der du dich mehr als ein Jahrzehnt wund gerieben hast, immer in deinem Herzen bleiben. Dort, wo dir die Wunden geschlagen wurden, liegt auch die Heilung: hier in diesem von Ängsten und Missmut geschütteltem Osten, hier in Potsdam.
„Halts Maul, Deutschland“ und „Scheiß auf einig Vaterland“ hatten die jungen Leute am Vorabend des 3. Oktober skandiert. Ein Jahr zuvor hatte ich mit jungen Leuten, von Polizei und Staatssicherheit eingekesselt, gerufen: „Wir bleiben hier, verändern wollen wir.“ Und jetzt wollte ich mich einfach davonstehlen? Würden denn Geld und eine gesicherte Position mich fröhlich machen? Immer war meine Devise gewesen, das Sicherste im Leben sei die Unsicherheit. Ich war gut damit gefahren. Wie hatte ich mich anstecken lassen können von der Sorge der Freunde um mein Auskommen! Nicht Sicherheit machte glücklich, sondern Freiheit. Meine innere Freiheit würde ich nicht in Kursen über Marketing, Stressbewältigung und Verkaufspsychologie gewinnen. Ich bliebe für den Rest meines Lebens eine Gefangene hinter der Mauer, wenn ich sie in Wuppertal hinter erfolgreicher Geschäftigkeit zu verbergen suchte.
Ich zerriss den letzten Entwurf meines Lebenslaufs für Bertelsmann. Um mir jeden Rückzug abzuschneiden, den ich als schmerzlich, aber richtig erkannt hatte, schrieb ich sofort an Gerda und an Ingeborg, ich könne die Stelle in Wuppertal nicht annehmen, dankte für ihre Sorge und bat um Verständnis. Die Nachricht fiel kurz aus, zu kurz. Wie sollten die beiden Frauen verstehen, was ich nur intuitiv wusste, aber noch nicht artikulieren konnte. Sie mussten sich brüskiert fühlen, dass ich eine einmalige Chance mit so dürren Worten ausschlug.
Vierzehn Tage später fand in Berlin die jährliche Tagung der Berliner Gespräche statt, eine Zusammenkunft von Frauen aus Ost und West seit 1949. Ich nahm seit 1982 daran teil. Bei den Treffen unter dem Dach der Golgotha-Gemeinde in der Tieckstraße hatte ich wunderbare Frauen kennengelernt, unter ihnen Gerda und Lily, Emmi Bonhoeffer, Ingeborg Drewitz, Lehrerinnen, Diakonissen, Wissenschaftlerinnen. Immer ging es bei den Tagungen um Themen der Zeit, die wir aus östlicher und westlicher Sicht beleuchteten, vor allem aber stärkten sie das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit von Ost- und Westdeutschland. Ein Jahr zuvor hatten die westlichen Teilnehmerinnen ihre geistige Konterbande in Form von Büchern noch durch die Mauer schmuggeln müssen. Die DDR lag in den letzten Zügen, aber wir wussten es noch nicht. Und nun waren wir alle Bürgerinnen eines Landes. Wir lagen uns in den Armen, das Erzählen nahm kein Ende. Manche der Älteren, die sich seit vierzig Jahren der deutschen Teilung widersetzt und oft unter Opfern an diesen illegalen Tagungen teilgenommen hatten, lächelten nur verklärt und die eine oder andere sagte: Dass ich das noch erleben durfte!
Die vierundachtzigjährige Emmi Bonhoeffer verstand sofort und ohne viele Worte, warum ich die lukrative Stelle in Wuppertal ablehnen und im Osten bleiben musste, auch andere Frauen zeigten sich erleichtert über meine Absage. Leute wie ich würden jetzt im Osten dringend gebraucht, meinten sie. Unter diesem Aspekt hatte ich meine Entscheidung noch gar nicht betrachtet und ich zweifelte auch daran, dass mich in Potsdam jemand brauchen könne.
Gerda, meine beste Freundin, sonst so temperamentvoll, begegnete mir wortkarg und kühl. Auf die Frage, ob sie meinen Brief erhalten habe, nickte sie nur kurz. Ich verstand, sie wollte nicht jetzt und hier darüber sprechen, zumal wir verabredet hatten, sie würde zu meinem Geburtstag einige Tage später mein Gast sein.
Wie im Vorjahr lag in den letzten Oktobertagen ein goldener Herbst über der Stadt. Des Abends ließ ein fast voller Mond sein Licht auf dem Heiligen See tanzen, die Eichen und Platanen trugen noch dichtes Laub. Beim Klang der Abendglocken von der nahen Pfingstkirche blieben die wenigen Spaziergänger stehen und schauten den laut rufenden Wildgänsen nach und dann hinüber zum Jungfernsee, wohin keine Mauer mehr den Blick versperrte. Mir war leicht und licht zumute. Ja, ich hatte recht getan mit meiner Absage nach Wuppertal, wenn ich auch nicht wusste, wie es weitergehen sollte.
Zum Geburtstag kamen viele Gäste. Gerrit verabschiedete sich nach Hannover, wo er am 1. November seine neue Stelle antrat. Auch Gerda genoss die fröhliche Gesellschaft im Jahr eins der deutschen Einheit.
Welch ungeheure Disziplin sie aufgebracht hatte, um mir den Tag nicht zu verderben, erfuhr ich am nächsten Morgen. Am Frühstückstisch brach es aus ihr heraus: Was ich mir bei dieser Absage denn gedacht hätte? Von enttäuschtem Vertrauen war die Rede, von Ungehörigkeit gegenüber Bertelsmann, von Arroganz, albernem Stolz, von Verletzungen, Schmerz. Manchmal klang ihre Stimme schneidend kalt, dann wieder versagte sie. So hatte ich Gerda noch nie erlebt.
Dass es schwer werden würde, mich zu erklären, hatte ich gewusst, aber nicht, wie schwer. Von der Freundin her gesehen, musste ich ihren Vorwürfen zustimmen. Ihr Schmerz war mein Schmerz. Sie und Ingeborg hatten sich mit so viel Hingabe, einem immensen Aufwand von Zeit und Kraft für mich eingesetzt, bei Bertelsmann gut Wetter gemacht und dann kam ich und sagte: Nein, danke, ich komme nicht, ich habe mich geirrt. Woher sollten sie wissen, was mich in den letzten Tagen und Wochen bewegt hatte.
Meine Bitte um Verzeihung lief ins Leere. Mit meiner Absage habe ich mich als undankbar und arrogant erwiesen. Obwohl mir Trauer die Kehle zuschnürte, suchte ich immer neu um Verständnis. Ich zog Beispiele heran, um zu erklären, wie vierzig Jahre DDR die Menschen hier geprägt hatten, auch mich. Mit der Einheit Deutschlands hörten ja die Schwierigkeiten nicht auf, sondern begännen erst; es würde noch eine lange Zeit, viel Liebe, Geduld und Kenntnisse voneinander brauchen, bevor Ost und West sich als ein Land begriffen. Ich könne vierzig Jahre Trennung nicht einfach mit einem Sprung von Potsdam nach Wuppertal überwinden, könne nicht einfach davonlaufen in die materielle Sicherheit und hier das Feld den Angstmachern und Ideologen überlassen.
Meine Worte waren tastend und ungelenk, Gerdas Verletzungen zu tief, um sich in mich hineinzuversetzen. Rede und Widerrede dauerten den ganzen Tag an, hartnäckig, verbissen gar, unterbrochen nur durch einen Besuch bei der kranken Freundin Ruth und einen Gang durch den Neuen Garten zur Glienicker Brücke. Alles war Tod, Abschied und die offene Glienicker Brücke wie eine Fata Morgana. Wir rangen miteinander wie Jakob mit dem Engel.
Als Gerda zu Bett gegangen war, weinte ich mir alles Versagen, allen Stolz, alle Enttäuschungen, alle Angst dieses Jahres aus dem Leibe. Nun würde ich auch noch meine beste Freundin verlieren, der ich Rom verdankte, geistige Anregungen, innere Freiheit. All die Jahre seit 1981 hatte die Mauer uns nicht trennen können; nun, da sie gefallen war, standen wir uns als Fremde gegenüber. Wie sollte ich ihr begreiflich machen, dass mein Entschluss nichts mit Undankbarkeit, Arroganz, Verrat zu tun hatte, sondern mit Dankbarkeit, Demut und Gehorsam gegenüber der inneren Stimme.
Ich weiß nicht, was in Gerda während dieser Nacht vorgegangen ist. Am nächsten Morgen war das Gewitter jedenfalls vorüber. Gerda nahm mich, die ich aufgelöst in Tränen und zersetzt vom Schmerz war, mitfühlend in die Arme. Nun, da sie die hiesige Atmosphäre erlebt habe, ahne sie, welch weiter Weg noch zur Einheit Deutschlands zurückzulegen sei, und sie wisse nun, dass ich meine Entscheidung nicht leichtfertig getroffen hätte, sondern einem höheren Gesetz folge.
An ein höheres Gesetz hatte ich nicht gedacht. Ich war eher einem unbestimmten Gefühl gefolgt, das ich mit Argumenten zu begründen versucht hatte.
Es war so gewesen wie immer in meinem Leben: Plötzlich standen da unsichtbare Gebotsschilder, die ich befolgen musste, ob ich wollte oder nicht. Sie rieten mir, was ich lassen, nie, was ich stattdessen tun sollte.
Einige Zeit später, als der Verlag, den ich als Geschäftsführerin hätte leiten sollen, von Bertelsmann aufgelöst und meine junge westdeutsche Nachfolgerin entlassen wurde, sollte Gerda erstaunt zu mir sagen, dass mein Daimonion mich mal wieder sicher geleitet hätte. Sie spielte dabei auf das berühmte Daimonion des Sokrates an: „Mir aber ist dieses von meiner Kindheit an geschehen: eine Stimme nämlich, welche jedes Mal, wenn sie sich hören lässt, mir von etwas abredet, was ich tun will – zugeredet aber hat sie mir nie.“
Jetzt aber nahm Gerda mich nur in die Arme und sagte, unser Missverständnis hätte nicht nur unserer Freundschaft keinen Abbruch getan, sondern sie eher noch befestigt.
Ich war zu erschöpft von unserer Auseinandersetzung, als dass sich bei ihren Worten Erleichterung einstellte.
Aber tiefe Dankbarkeit empfand ich und Staunen über den unerwarteten Sinneswandel. Hatte ich doch noch wenige Stunden zuvor bitterlich darüber geweint, eine kostbare Freundschaft opfern zu müssen, um mir selber treu zu bleiben.
Nicht meine Argumente hatten die Freundin letztlich umgestimmt, sondern die Augen, Ohren und der Verstand ihres Herzens. Ob Argumente überzeugen oder verworfen werden, hängt nicht von deren intellektueller Brillanz ab, sondern von dem Geist, in dem sie vorgebracht werden. Dem Geist der Liebe und der Wahrheit oder dem Geist der Selbstbezogenheit. Liebe nimmt Leiden um der Wahrheit willen auf sich, Selbstbezogenheit stößt ab und knüppelt nieder.
Auch bei ostdeutschen Freunden und Bekannten stieß mein Entschluss auf Unverständnis. Manche sagten offen, sie hielten mich für weltfremd. Wie ich so blöd sein könne, in einer Situation von wachsender Entwurzelung und Arbeitslosigkeit diese einmalige Chance auszuschlagen. Andere schüttelten nur missbilligend den Kopf. Ein Ostberliner Lyriker warf mir unsolidarisches Verhalten vor: Hier brächen die Verlage zusammen, in Wuppertal hätte ich ihn und weitere DDR-Autoren veröffentlichen können. Doch diese Vorwürfe trafen mich nicht wirklich.
Ich wusste jetzt zwar, was ich nicht tun sollte, aber irgendetwas musste ich tun. Ich legte letzte Hand an das Manuskript über Christine von Schweden, doch ich kam nicht mehr dazu, es im Verlag abzuliefern, denn der war über Nacht in Konkurs gegangen. Weitere Manuskripte, die ich schon vorher an andere Verlage geschickt hatte, erhielt ich mit „zu unserem Bedauern …“ zurück. Ich bewarb mich als Kulturamtsleiterin in meiner Stadt, vergeblich: zu alt mit meinen 48 Jahren, keine entsprechende Qualifikation … Wo ich auch auf der Suche nach einer Arbeitsstelle vorsprach, überall bedeutete man mir, für das neue Bundesland Brandenburg brauche man Leute mit Kenntnissen in Marketing, Betriebswirtschaft, Computertechnik, Jura, Verwaltungswissenschaft. Alle Bemühungen, Boden unter den Füßen zu gewinnen, schlugen fehl.
Als ich in einer örtlichen Buchhandlung bat, man möge doch auch meine Bücher zum Verkauf anbieten, maß mich die Verkäuferin mit einem langen Blick von oben bis unten und sagte dann spitz: „Ost-Autoren haben wir lange genug gehabt, jetzt wollen die Leute was anderes lesen.“
Mehr erstaunt als verärgert fragte ich mich, warum sich die Ostdeutschen mit ihrem Mangel an Unterscheidungsvermögen den Ast absägten, auf dem sie saßen.
Für Selbstmitleid blieb keine Zeit. Aus Hannover kam die Nachricht, Gerrit, der eben seine neue Arbeitsstelle als Gärtner angetreten hatte, sei mit einem Blinddarmdurchbruch gerade noch rechtzeitig operiert worden. Meine Freundin Ruth, wieder im Krankenhaus, lag im Sterben. Ich besuchte sie täglich. Sie hatte meine Freude über die Wiedervereinigung nicht geteilt. Die utopischen Seiten des Marxismus von einer gerechten und solidarischen Gesellschaft verbanden sich mit ihrem Christentum und sie traute den guten Absichten des sozialistischen Gesellschaftsentwurfs mehr als den Erfahrungen, die sie mit dem repressiven DDR-Regime gemacht hatte. Sie lehnte die Entwicklung, wie sie sich seit dem Mauerfall vollzog, ab und brachte gute Gründe gegen den Kapitalismus mit seinen Schattenseiten vor. Mein römischer Bekannter, der Philosoph Michele, hätte sie mit Gramsci eine traditionelle, durch die Arbeiterklasse assimilierte Intellektuelle genannt. Evangelisch, von bürgerlicher Herkunft, aber guten Willens, der Arbeiterklasse zu dienen. Ich sah dagegen die Sache mit dem Sozialismus und dem Kapitalismus pragmatischer. Wer sollte denn die ostdeutsche Bevölkerung gegen ihren Willen in den „guten Sozialismus“ führen, für den ostdeutsche Intellektuelle und Künstler in dem Aufruf „Für unser Land“ vor einem Jahr geworben hatten? Die Unterzeichner? Die Theoretiker, die regelmäßig an der Realität scheiterten? Mit all ihren guten Absichten fiel ihnen zum Schluss nichts anderes ein, als nach der Devise zu handeln: Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir den Schädel ein. Dafür gab es in der Geschichte genügend Beispiele.
Ruth mochte sich meiner Sicht nicht anschließen, aber sie war froh, dass ich nicht nach Wuppertal ging. Der Tod ist ein strenger Herr, unabweisbar scheidet er Wesentliches von Unwichtigem. In seiner Nähe zählen nur noch eine lindernde Berührung, ganz einfache Worte wie „danke“ und „schön“, Schweigen.