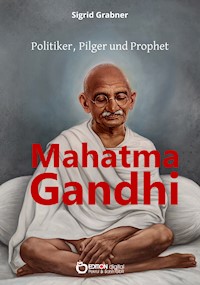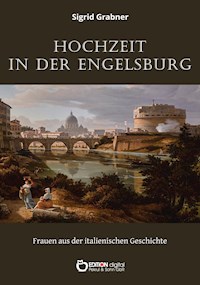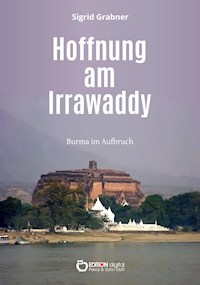6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Unschwer ist in dem niederländischen Namen „Zeven Pronvincien“ „Die Sieben Provinzen“ zu erkennen. Damit gemeint sind die sieben Provinzen Holland, Zeeland, Groningen, Utrecht, Friesland, Gelderland und Overijssel. Diese existieren heute noch in fast gleicher Form als Teil des Königreiches der Niederlande. „Zeven Pronvincien“ – so hießen aber auch mehrere niederländische Schiffe, darunter ein 1910 vom Stapel gelaufenes Panzerschiff, das größte Schiff der niederländischen Flotte. Dort kommt es im Februar 1933 zum Aufstand – erstmals kämpfen Angehörige einer unterdrückten Nation gemeinsam mit Angehörigen der sie unterdrückenden Nation gegen ihre gemeinsamen Feinde, also indonesische und holländische Matrosen zusammen … In ihrem Nachwort erklärt die Autorin, wie sie auf ihr Thema gestoßen war: Die Geschichte des vorliegenden Buches begann in den Februartagen des Jahres 1933. Damals verfolgte der einundzwanzigjährige Kommunist Hasso Grabner mit brennendem Interesse die Berichte über den Aufstand in der niederländischen Flotte. Auf ihrem größten Schiff, der „Zeven Provincien“ hatten indonesische und holländische Matrosen die Befehlsgewalt erobert, um ihren streikenden Kameraden in Surabaja zu Hilfe zu eilen. Fünf Tage lang schob sich der mächtige Bug des ersten freien Schiffes Indonesiens durch die Wellen des Indischen Ozeans der Java-See entgegen. In der Presse außerhalb Deutschlands verdrängte dieses Ereignis für einige Tage die Schlagzeilen über Hitlers Machtantritt am 30. Januar 1933. Den deutschen Kommunisten bedeutete der Aufstand auf der „Zeven Provincien“ mehr als eine gut aufgemachte Sensation. Er gab ihnen Hoffnung. Einer davon war Hasso Grabner, ihr späterer Mann – 1962 war sie Mitglied eines von ihm geleiteten Zirkels schreibender Arbeiter. Grabner hatte damals einen Traum – ein Buch über den Aufstand auf der „Zeven Provincien“. Dafür brauchte es jedoch ein umfangreiches Quellenstudium in holländischer, indonesischer und englischer Sprache. Als Grabner hörte, dass sie in Kürze Indonesienkunde studieren würde, konnte er sie für dieses Buch-Projekt begeistern. In den folgenden fünf Jahren lernte sie Indonesisch und Holländisch, sammelte Material, übersetzte Tausende von Seiten. Doch das Projekt wurde immer wieder hinausgeschoben. Als Hasso Grabner 1976 starb, entschloss sich Sigrid Grabner nach einigem Zögern, sein Buch an seiner Stelle zu schreiben. Träume dürfen nicht untergehen mit dem, der sie träumte, so die Autorin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Sigrid Grabner
Was geschah auf der Zeven Provincien?
Ereignisse, Tatsachen, Zusammenhänge
ISBN 978-3-96521-669-3 (E-Book)
Umschlaggestaltung: Ernst Franta
Das Buch erschien 1980 im Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik.
2022 EDITION digital
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
Mit uns marschiert die Kraft aus
tausend Klassenschlachten,
mit uns marschiert der beste
Teil auf dieser Welt,
zittern die Feinde, die uns
früher nur verlachten,
wir wissen, was stark macht
und zusammenhält.
Hasso Grabner
1. Kapitel
Samandjaja öffnete die Augen. Von der Veranda drangen Stimmen und das Klappern von Geschirr ins Zimmer. Eine helle Männerstimme rief: „Macht doch nicht solch einen Lärm, der Bapak schläft.“ – Samandjaja lächelte. Er fühlte sich heute Morgen viel besser. Das Fieber schien geschwunden, die Malariaanfälle der letzten Tage würden sich nicht wiederholen. Mit raschen Griffen rollte der junge Mann die Bastmatte zusammen, stellte sie in eine Ecke und stieß die Tür auf.
Farid sah ihm erstaunt entgegen. „Wie geht es, Bapak?“
„Gut, mein Junge.“ Samandjaja lachte fröhlich. „Ein wunderschöner Morgen ist das. Also, Schluss mit der Faulenzerei!“
Er frühstückte hastig, während Farid die letzten Neuigkeiten aus Surabaja berichtete. Samandjajas Gesicht verfinsterte sich. Plünderungen, Kämpfe mit den Japanern, Gerüchte, dass die Engländer bald landen würden …
Im August 1945 hatten die Japaner kapituliert. Inzwischen waren zweieinhalb Monate vergangen, aber die Japaner saßen nach wie vor in Indonesien. Wie es hieß, auf Anweisung von Admiral Mountbatten, dem Oberbefehlshaber der Alliierten im Südwestpazifik. Zu den Alliierten gehörten auch die Holländer. Die Ausrufung der indonesischen Republik am 17. August 1945 hatte sie in Angst und Schrecken versetzt. Sie bangten um ihr Kolonialreich, das sie im Frühjahr 1942 den Japanern nahezu kampflos überlassen hatten. Jetzt wollten sie es unter allen Umständen zurückgewinnen, mit Hilfe der Engländer. Der Fuchs Mountbatten, der vorläufig all seine Truppen brauchte, hatte ein Geschäft mit dem ehemaligen Gegner Japan gemacht. Er sollte in Indonesien die Stellung für die Alliierten halten, bis sie selbst in Indonesien landen konnten. Aber die Praxis entsprach nicht immer den Überlegungen am grünen Tisch. Manche japanischen Kommandeure wollten Indonesien eher unabhängig sehen, als es den Engländern und danach wieder den Holländern überlassen. Ihre Soldaten, demoralisiert von der schmählichen Kapitulation, pausenlos bedrängt von den indonesischen Widerstandskämpfern, träumten nur noch davon, endlich nach Hause zu kommen.
Armes Indonesien, dachte Samandjaja, seit dreihundert Jahren sind ausländische Mächte darüber hergefallen wie die Geier über ein verendendes Tier. Portugiesen, Holländer, Engländer und Japaner haben miteinander gewetteifert, das Land auszuplündern. Das Maß ist nun voll …
„Gestern hat es im Chinesenviertel gebrannt. Die Chinesen kamen wie die Ratten aus ihren Schlupflöchern. Viele Tote soll es gegeben haben.“
Samandjaja blickte erstaunt auf. Der triumphierende Ton in Farids Stimme gefiel ihm nicht. Chinesenpogrome waren nicht neu. Schon immer hatte das Volk seine Wut über die Fremdherrschaft an den geschäftstüchtigen, aber wehrlosen Chinesen ausgelassen. Die Holländer sahen das nicht ungern. Aber was sollte das jetzt? Wem nützte jetzt das Gemetzel? Samandjaja wusste, wer hinter diesen Pogromen stand: verantwortungslose Moslemführer, die von einem Darul Islam, einem islamischen Staat Indonesien, träumten. Den Darul-Islam-Anhängern ging es nicht in erster Linie um die Religion, sondern um die Macht der feudalen Grundbesitzer in der Republik Indonesien. Deshalb begannen sie den Krieg im Krieg. Dschihad nannten sie das, Kampf gegen die Ungläubigen. Ungläubig waren für sie alle, die ihre Macht hätten bedrohen können: Kommunisten, Chinesen, Europäer. Moslembanden durchstreiften in großer Zahl das Land, hetzten die Bevölkerung zu Plünderungen und Pogromen auf und setzten damit die Existenz der jungen Republik aufs Spiel, die eben keine islamische war, sondern in ihrer Verfassung Kirche und Staat voneinander trennte. Die Kräfte der regulären indonesischen Armee und der organisierten Guerillaverbände reichten nicht aus, Ordnung in das Chaos zu bringen.
Samandjaja seufzte. Japaner, Engländer, Holländer und jetzt noch die Moslembanden – das Leben der Republik Indonesia hing an einem seidenen Faden. „Die Darul-Islam-Geschichte wird uns noch viel Ärger machen“, prophezeite er düster.
Farid lächelte. Sein glattes, rundes Gesicht gab keinen seiner Gedanken preis.
Samandjaja hatte schon seit geraumer Zeit bemerkt, dass Farid politischen Gesprächen stets auswich. Bei solchen Gelegenheiten lächelte er und schwieg. Verdrossen drückte Samandjaja seine Zigarette aus und fragte, schon im Hinausgehen: „Hat Hartini angerufen?“ Im selben Augenblick bereute er, gefragt zu haben. Er spürte, wie ihm die Röte ins Gesicht stieg. Ohne Farids Antwort abzuwarten, verließ er den Raum.
Auf den Plätzen rund um die ehemaligen holländischen Wochenendvillen herrschte reges Treiben. Samandjaja ging von Gruppe zu Gruppe und sah den Jungen beim Schießen und Exerzieren zu. Manche waren noch halbe Kinder, kaum älter als fünfzehn, sechzehn Jahre. Einige trugen Leinenschuhe an den Füßen, die meisten liefen barfuß. Sie wandten sich kaum nach ihrem Kommandeur um, so eifrig waren sie bei der Sache. Alle dachten nur daran, so schnell wie möglich ihre Ausbildung hier zu beenden und für die Unabhängigkeit ihres Landes zu kämpfen. Während Samandjaja ihnen zusah, stieg ein bitteres Gefühl in ihm auf. Viele von diesen Jungen würden sterben müssen, damit die anderen das Ziel erreichten. Er dachte an die Toten an seinem Wege, und ihn schauderte plötzlich bei dem Gedanken, wie viele es noch sein würden. Diese verdammte Malaria, dachte er, schwächt nicht nur den Körper, sondern auch den Geist. Wir führen Krieg, damit der Krieg endlich ein Ende hat. Schluss! Er zündete sich eine Zigarette an und dachte wieder an Hartini. Mehr als eine Woche hatte er sie nicht gesehen, es erschien ihm wie eine Ewigkeit.
„Bapak!“, hörte er hinter sich eine keuchende Stimme. Subronto kam mit großen Sätzen auf ihn zugelaufen. Es fiel ihm offensichtlich schwer, seine Neuigkeit nicht sofort herauszusprudeln, sondern erst Haltung anzunehmen und vorschriftsmäßig zu melden. „Farid schickt mich. Sie sollen zum Quartier kommen. Ein Jeep vom Stab ist da.“
Samandjaja legte dem Jungen die Hand auf die Schulter und ging mit ihm zurück. Er kannte ihn erst seit drei Wochen und hatte ihn gern in seiner Nähe. Subronto erinnerte ihn an Halim. Damals, vor mehr als zwölf Jahren, war sein Freund Halim so alt gewesen wie jetzt der Junge neben ihm – siebzehn Jahre.
In dem Raum, in dem Samandjaja geschlafen hatte, erwarteten ihn sein Stellvertreter Farid und ein junger Soldat.
Der Kommandeur überflog das Schreiben vom Stab, reichte es an Farid weiter und sagte: „Wollen wir uns diese Mijnheers, die uns der Stab da zur Aufbewahrung geschickt hat, erst mal ansehen. Den Gefangenen bekommt wahrscheinlich die Luft in Surabaja nicht. Bringen Sie die Männer herein.“
Farid murrte. „Das hat uns gerade noch gefehlt, Gefangene zu bewachen. Schließlich sind wir eine Ausbildungseinheit und kein Gefängnis.“
Samandjaja winkte ab und las das Papier noch einmal. Kapitänleutnant Huyer, dieser Name sagte ihm nichts. Aber der zweite der Gefangenen, ein gewisser Vastenhouw … Ihm war, als drücke ihm jemand die Kehle zu. Ach was, beruhigte er sich dann, wie viele Holländer mochten Vastenhouw heißen!
Zwei Männer traten ein, begleitet von drei bewaffneten indonesischen Soldaten. Der eine Holländer war schlank und hochgewachsen. Der andere reichte ihm nur bis an die Schulter. Was ihm an Größe fehlte, glich er in der Breite aus. In einem schwammigen Gesicht saß eine blaurote Nase, die kleinen rot geäderten Augen blickten unruhig umher.
Samandjaja starrte den Mann an. Das Blut schoss ihm ins Gesicht und hämmerte schmerzhaft in den Schläfen und im Hinterkopf. Schweiß brach ihm aus allen Poren. Ein Malariaanfall, dachte er, oder ich träume wieder. Das war das Gesicht, das ihn seit zwölf Jahren verfolgte. Tag für Tag, Nacht für Nacht: diese boshaften kleinen Augen, der widerlich breite Mund, auf dem ein höhnisches Grinsen lag …
Unruhig sah Farid auf seinen Kommandeur. Warum sagte er nichts? Das Schweigen wurde unheimlich.
Die Tür öffnete sich, Subrontos lustige Augen spähten herein. „Bapak, eine Meldung …“
Samandjaja blickte ihn entgeistert an und stöhnte: „Halim.“ Dann sprang er mit einem Satz auf den kleinen dicken Holländer zu, seiner Kehle entrang sich ein heiserer Schrei: „Vastenhouw!“ Dann noch einmal: „Vastenhouw!“ Er hob die Arme, der Holländer wich zurück. Doch ehe Farid oder einer der Soldaten dazwischenspringen konnte, ließ Samandjaja die Hände sinken. Sein Gesicht verzerrte sich zu einer Grimasse des Ekels. Ein Zittern lief durch seinen Körper. Brechreiz würgte ihn. Er stürzte nach draußen und übergab sich.
Die Gefangenen und ihre Bewacher wechselten fragende, verständnislose Blicke. Auf einen Wink Farids brachten die Soldaten die Holländer weg.
Samandjaja hockte auf dem Boden der Veranda, den Kopf zwischen den Armen vergraben.
Farid trat zu ihm, rüttelte ihn behutsam an der Schulter und fragte: „Kennst du den Mann?“
Samandjaja blickte auf, in seinen Augen stand wilder Hass. „Ich bringe ihn um. Hörst du? Lass ihn gut bewachen, ich bringe ihn sonst um.“
So außer sich hatte Farid seinen Kommandeur noch nie gesehen. Aber wie sehr er auch in ihn drang, er bekam nichts anderes zu hören, als „Ich bringe ihn um“.
Plötzlich erhob sich Samandjaja, sein Gesicht verwandelte sich in eine leblose Maske. „Nein, ich habe kein Fieber. Es geht mir gut. Ich werde mit dem Jeep in die Stadt zurückfahren. Du kommst heute auch ohne mich zurecht.“
Farid zuckte mit den Schultern. Samandjaja musste wissen, was er tat. „Wirst du auch Hartini sehen?“, fragte er vorsichtig. Er atmete erleichtert auf, als sein Freund nickte. Hartini war eine kluge Frau. Sie würde Samandjaja sicherlich wieder zur Vernunft bringen.
In schneller Fahrt raste der Jeep die Straße zur Stadt hinunter. Die Soldaten schwiegen. Ab und zu warfen sie einen scheuen Blick auf den Kommandeur, der eine Zigarette nach der anderen rauchte. Als der Wagen die Stadtgrenze erreichte, fuhr er langsamer. Der Straßenbelag war von Geschossen aufgerissen. Die Betjakfahrer mussten auf der holprigen Straße kräftig in die Pedalen treten. Die dreirädrigen Karren hatten viel von ihrem bunten Glanz der Vorkriegszeit verloren. Wo sich einst chinesische Geschäftsleute oder holländische Kolonialbeamte gerekelt hatten, saßen jetzt auf zerschlissenen Sitzen müde Soldaten und ängstlich dreinblickende Frauen. Überfüllte Straßenbahnen fuhren quietschend auf verrosteten Gleisen. Menschenansammlungen verstopften die Straßen. Am Juliana-Boulevard stieg Samandjaja aus und ging wie ein Traumwandler auf ein großes altersgraues Gebäude zu, in dem früher die Redaktion der holländischen Zeitung „De Indische Courant“ untergebracht war. Jetzt diente es als Krankenhaus.
Samandjaja schritt durch lange Gänge. Überall lagen Menschen auf Tragen, auf Bambusmatten oder auf dem nackten Fußboden. Ein ekelerregender Geruch von schwitzenden Leibern, schwärenden Wunden und Desinfektionsmitteln erschwerte das Atmen.
Hartini war gerade dabei, einem Jungen von etwa zehn Jahren handtellergroße Brandwunden an den Schenkeln zu verbinden. Sein Wimmern und Schreien zerrte an Samandjajas Nerven. Er sagte Hartini, dass er auf der Straße auf sie warten wolle. Der verzweifelte Ton in seiner Stimme ließ die Frau aufhorchen. Bei der Begrüßung hatte sie ihm nur flüchtig zugenickt. Ihre müden Augen unterschieden keine Gesichter mehr. Sie wandte sich ihm zu und erschrak bei seinem Anblick. „Ich bin gleich fertig“, sagte sie, „geh schon in mein Zimmer und warte dort auf mich.“
Samandjaja wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, als Hartini endlich in das Zimmer trat.
„Was ist geschehen?“, fragte sie unruhig.
Er sah sie wortlos an. Der rasende Schmerz in den Schläfen ließ nach. Schon die Nähe dieser Frau beruhigte ihn. Immer wieder staunte er, wie sie es fertigbrachte, Tag für Tag in einer Hölle von Angst, Schmerz und Tod zu leben und ihr Lächeln und ihren leichten Schritt nicht zu verlieren. In dieser zarten Frau wohnte eine Kraft, um die sie viele Männer beneiden konnten. War sie stärker als er?
„Nun, was ist?“, wiederholte Hartini und setzte sich neben Samandjaja auf die schmale Pritsche.
Ihre körperliche Nähe verwirrte ihn. Er sprang auf und lief wie ein gefangenes Tier durch den Raum. „Vastenhouw ist da“, stieß er hervor.
Hartini sah ihn verständnislos an, dachte angestrengt nach. „Vastenhouw“, murmelte sie, „Vastenhouw, war das nicht euer Ausbilder auf dem Schiff?“
Samandjaja nickte grimmig. „Derselbe. Zwölf Jahre hat mich sein Bild verfolgt – im Gefängnis, auf der Kautschukplantage, im Bergwerk, wo ich auch immer war. Wenn das Grauen des Tages schwand, begann das Grauen der Nacht. Ich wachte auf, schreiend und in Schweiß gebadet. Tausendmal und mehr schwor ich mir, diesen Mann mit bloßen Händen zu erwürgen, wenn er mir einmal begegnen sollte. Und heute …“ Samandjaja versagte die Stimme, er setzte sich wieder und schluckte krampfig.
Hartini strich ihm beruhigend über das kurz geschnittene Haar und sagte: „Sprich weiter. Was war heute?“
Die Stimme des Mannes war nur noch ein heiseres Flüstern. „Dieser Mann ist in meiner Gewalt, seit heute. Und ich bin für seine Sicherheit verantwortlich. Als ich ihn sah, wollte ich ihn erwürgen. Dass ich dazu nicht fähig gewesen bin, macht mich wahnsinnig. Zwölf Jahre habe ich auf diesen Augenblick gewartet, um Halim zu rächen und mich von meinen Albträumen zu befreien. Und da verließ mich plötzlich alle Kraft. In mir war nur noch Ekel, grenzenloser Ekel vor diesem Kerl und vor mir selbst. Ich hätte ihn töten müssen. Ein Feigling bin ich, ein jämmerlicher Feigling!“, stieß Samandjaja hervor und schlug die Hände vors Gesicht.
Von draußen drang der monotone Gesang eines Sterbenden ins Zimmer. Es klang wie das Weinen eines Kindes, das seinen Kummer mit in den Schlaf hinübernimmt.
Hartini erhob sich und sah nachdenklich auf Samandjaja herab. „Du hast mir nicht viel erzählt von jenen Tagen auf dem Schiff. Jetzt ist die beste Gelegenheit, davon zu sprechen. Du schleppst eine Last mit dir herum, die du nicht länger allein tragen kannst. Sie wird dich erdrücken. Die anderen haben ein Recht zu erfahren, was damals geschehen ist. Und du wirst dich besser begreifen und wieder leben können.“
Samandjaja schüttelte den Kopf. „Ich kann nicht, Tini. Es sind zwölf Jahre her, aber ich erlebe alles immer wieder, als wäre es erst gestern gewesen. Das Entsetzen macht mich sprachlos. Seit ich diesen Vastenhouw gesehen habe, denke ich nur noch an den Tod. Und ich fühle mich sterbensmatt.“
„Hör auf!“, sagte die Frau hart. „Was soll das Geschwätz? Du musst an das Leben denken wie wir alle, die wir vom Tod umgeben und ständig von ihm bedroht sind. Du hast überlebt, du bist den Toten schuldig, dass man von ihnen erfährt, und den Lebenden, dass sie wissen, woher sie kommen und wohin sie gehen. Denk an die Jungen, für die du verantwortlich bist. Ihnen beizubringen, wie man Menschen erschlägt, ersticht oder erschießt, reicht nicht aus. Ihnen zu sagen, das alles diene der Unabhängigkeit, genügt auch nicht. Was ist das schon? Ein Wort, nichts als ein Wort, ein Schlachtruf, herausgebrüllt in jugendlicher Begeisterung. Sie werden töten und sterben, und wehe uns, wenn sie sich in ihrer Todesstunde fragen: Wozu das alles? Diese Schuld wird bedrückender sein als dein Entsetzen. Was wissen deine Jungen von den Träumen und Hoffnungen, dem Schrecken und der Verzweiflung unserer Vergangenheit? Woher sollen sie es wissen, wenn du es ihnen nicht sagst? Sprich zu ihnen. Das wird dir und ihnen helfen.“
Hartini war in Erregung geraten, ihre Wangen brannten. Samandjaja schaute sie selbstvergessen an. Wie sie so dastand, den Kopf mit dem dicken Haarknoten leicht gesenkt, die Augen fordernd auf ihn gerichtet, umstrahlt von den Lichtbündeln, die durch die Jalousien in den dämmrigen Raum fielen, war sie so unwirklich schön, dass Samandjaja aufstöhnte. Er erhob sich, griff nach ihren Händen und sagte beschämt: „Du hast recht, Hartini.“
Josef, sein Kampfgefährte in Blitar, kam ihm in den Sinn. Er war katholisch gewesen, ein heiterer, immer ausgeglichener Junge. Als ihm eine japanische Kugel den Bauch aufriss und er qualvoll starb, verließ ihn sein Lächeln bis zum Ende nicht. Nicht weinen, hatte er gesagt, ich sterbe reinen Gewissens und mit ruhigem Herzen. Durch ihn wusste Samandjaja von dem seltsamen religiösen Brauch der Beichte. Jeder Mensch braucht jemanden, zu dem er sprechen kann und der ihm zuhört, ob er sich Katholik, Mohammedaner oder Atheist nennt, hatte Josef ihm erklärt. Hartini meinte etwas Ähnliches. „Eine Bitte noch, Tini“, sagte Samandjaja und gab ihre Hände frei. „Ich werde es versuchen, wenn du unter den Zuhörern bist, sonst halte ich den Jungen nur eine patriotische Rede. Du wirst mir helfen, die ganze Wahrheit zu sagen.“
„Gut.“ Hartini lächelte. „In dieser Woche habe ich nachts frei. Ich werde heute zu euch kommen, sobald ich mit dem Dienst fertig bin.“
Samandjaja sah sie dankbar an. Mit einer ungestümen Bewegung zog er die Frau an sich, für den Bruchteil einer Sekunde waren sich ihre Augen ganz nah. Er spürte ihren weichen, biegsamen Körper, ihren schnellen Atem. Eine Woge von Lust stieg in ihm auf.
Hartini schob ihn sanft von sich. „Nicht jetzt und nicht heute.“ Sie nahm sein Gesicht in beide Hände und küsste ihn leicht auf den Mund.
Samandjaja taumelte in die Hitze des Nachmittags hinaus. Nicht jetzt und nicht heute, hatte sie gesagt. Das hieß soviel wie: Es wird sein. Unfassbar, Hartini! Seit er sie zum ersten Mal gesehen hatte, liebte er sie. Aber sie war Halims Freundin gewesen und Halim sein bester Freund. Ihm blieb nur die Rolle des treuen Bruders Lakshmana. All die Jahre an Bord der „Zeven Provincien“ und später hatte er an sie gedacht. Was mochte aus ihr geworden sein? Lebte sie noch, hatte sie inzwischen geheiratet, erinnerte sie sich noch an ihn? Vor einem Monat war er ihr durch Zufall in diesem Krankenhaus wiederbegegnet, nach zwölf langen Jahren. Sie war schöner als je, nur über ihren Augen lag ein feiner Schleier von Traurigkeit. Sie fanden wenig Zeit füreinander. Tini behandelte ihn wie ihren Bruder. Und er spielte noch immer die Rolle des treuen Lakshmana, obwohl Halim seit zwölf Jahren tot war. Samandjaja hatte nie gewagt, ihr seine Liebe zu gestehen, aus Angst, sie zu verlieren. Er wusste, wie sehr sie Halim geliebt hatte. Erst solch ein Tag wie dieser musste kommen und ihn aus seinem Gleichgewicht reißen. Er musste erst in einen Strudel von Trauer und Entsetzen geraten, um Hartini sein Gefühl zu zeigen. Und sie, sie hatte ihn nicht abgewiesen.
Samandjaja lief durch die staubigen Straßen, ohne seine Umwelt wahrzunehmen. Er hörte nicht das Geschrei der Bettler, die Rufe der Straßenhändler, das Klingeln der Betyakfahrer. Als er sich vor dem Haus wiederfand, in dem der Stab der Armee von Surabaja untergebracht war, erwachte er jäh aus seinen Träumen. Rasch lief er an den Wachen vorbei, die mühsam gegen die Versuchung ankämpften, in der Hitze des Nachmittags zu dösen. Er fragte einen Soldaten, wo Pak Amir zu finden sei. Der zuckte mit den Schultern. Amir war immer überall und nirgends.
Als sich Samandjaja nach langem Suchen zum Gehen wandte, stand Amir plötzlich vor ihm, zog ihn in sein Zimmer und umarmte ihn.
Samandjaja kam gleich zur Sache. „Sag, war es deine Idee, mir diese beiden Galgenvögel zu schicken? Was habt ihr euch dabei gedacht? Wir haben Wichtigeres zu tun, als diese Mijnheers zu verpflegen.“
Amir hob abwehrend die Hände. Doch sofort griff er an den Gürtel und zog die Hosen hoch. Er lächelte verlegen und steckte sich eine Zigarette an.
Samandjaja schüttelte leise den Kopf. Dieser Amir schien nur von Zigaretten zu leben, und so sah er auch aus: ein wandelndes Gerippe. Ohne Gürtel fielen ihm die Hosen vom Körper.
Amir atmete tief den Rauch seiner Nelkenzigarette ein und setzte sich auf einen Stuhl am Fenster. „Jetzt fängst du auch noch an herumzujammern. Und wir wissen hier nicht, wo uns der Kopf steht. Banden von fanatischen Moslems ziehen plündernd durch die Stadt und schießen auf alle, die wie Ausländer aussehen. Die Briten und die Holländer können jeden Tag landen. Die Republik ist in Gefahr. Und du kommst mir mit deinen Gefangenen. Aber wenn du es schon wissen willst, diese beiden Holländer sind ein wertvoller Fang, sie sind Handelsobjekte, wenn du so willst. Wir haben sie aus der Stadt gebracht, damit sie nicht diesen fanatischen Moslems in die Hand fallen, die sich auf alle stürzen, die eine weiße oder gelbe Hautfarbe haben. Das Leben dieser Holländer hilft uns vielleicht, Leben zu retten. Wir dachten, du verstehst das!“
„Ich denke nicht daran, Mörder zu schützen“, warf Samandjaja wütend ein.
„Ja, was bist du denn anderes als ein Mörder, wenn du sie umbringst oder umbringen lässt? Meinst du, ein Unrecht kann durch ein anderes aus der Welt geschafft werden?“
„Jetzt reicht es aber!“, schrie Samandjaja. „Sie haben uns geschunden, gejagt, umgebracht. Sollen immer wir die Opfer sein, und sie kommen davon? Ich hasse niemanden, weil er ein Holländer, Engländer oder Japaner ist. Aber ein Mörder, gleich, welcher Hautfarbe, darf nicht geschützt werden. Und Vastenhouw ist ein Mörder!“
„Vastenhouw?“, fragte Amir. „Heißt so nicht einer von den Holländern? Kennst du ihn?“
Samandjaja zwang sich zur Ruhe und antwortete mit einer Frage: „Wo habt ihr die beiden gefangen?“
Amir erzählte mit kurzen Worten, dass die Holländer vor etwa vier Wochen von einem britischen Boot abgesetzt worden wären und bei helllichtem Tage den Hafen inspiziert hätten. Dann wären sie verschwunden. Doch nach einigen Tagen wären sie bei der indonesischen Hafenverwaltung aufgetaucht und hätten die unverzügliche Übergabe des Hafens in holländische Hände gefordert. Der Krieg sei zu Ende, die Japaner seien besiegt, die holländische Regierung nähme ihre Rechte wieder wahr. Soviel Frechheit hätte die Männer im Hafen zuerst erstaunt, dann empört. Sie ließen die beiden kurzerhand verhaften. Sie zu erschießen, gab es keinen Grund. „Was hast du denn gegen diesen Vastenhouw vorzubringen?“
Samandjaja schwieg. Wie sollte er mit wenigen Worten dem Freund die Zusammenhänge erklären, hier, wo unablässig die Türen gingen, Telefone schrillten.
„Nun?“, drängte Amir ungeduldig.
„Kannst du nicht heute Abend zu uns herauskommen? Ich will meinen Jungen die Geschichte dieses Vastenhouw erzählen und die Ereignisse um das Schiff schildern, auf dem ich ihm begegnet bin. Da erhältst du auch deine Antwort“, erwiderte Samandjaja zögernd.
„Was für ein Schiff?“
„Das Panzerschiff ‚De Zeven Provincien‘“
Amir drückte seine Zigarette aus und sah seinen Freund groß an. „‚De Zeven Provincien‘? Da warst du drauf? Das kann doch nicht wahr sein!“ Er verschränkte seine Hände, dass die Gelenke knackten. Das tat er immer, wenn er aufgeregt war. Dieser Samandjaja! Zwei Jahre kannte er ihn. Sie hatten zusammen gegen die Japse gekämpft, sich in kühlen Nächten gegenseitig gewärmt, die letzte Kippe miteinander geteilt. Und dennoch wusste er nichts von ihm. Aber in der Hölle von Boven Digul, im fernen Neuguinea, hatte ihm vor sieben Jahren ein Mann von einem Samandjaja auf der „Zeven Provincien“ erzählt. Er besaß ein Papier von jenem Mann, die Zeilen waren kaum noch lesbar. Das sollte er diesem Samandjaja geben, wenn er ihn finden würde. Auf Java hießen viele Samandjaja, viele hatte er gefragt, ob sie auf dem legendären Schiff gedient hätten, nur diesen einen nicht. Denn der kam aus den Kohlengruben von Sawahlunto auf Sumatra. Amir war nie auf den Gedanken gekommen, dass Samandjaja ein Seemann gewesen sein könnte. Sein Freund, sein Genosse Samandjaja! Die Vergangenheit galt in diesen Zeiten nicht viel, wichtig war, was einer heute tat und wie. Im Kampf gegen die Japaner galt Samandjaja als einer der klügsten und kühnsten Kämpfer seiner Abteilung. Von sich selbst hatte er nie gesprochen.
Amir vermochte seiner Erregung kaum noch Herr zu werden. In seinen Augen glitzerten Tränen. „Du bist der Samandjaja von der ‚Zeven Provincien‘, du?“
Samandjaja schaute verlegen zu Boden und murmelte: „Ja, was ist denn schon dabei? Davon laufen noch genug Leute herum. Was regst du dich darüber auf?“ Ihm war peinlich, dass er Amir so aus der Fassung gebracht hatte und nicht einmal wusste, warum.
„Jetzt habe ich keine Zeit“, wehrte Amir seine Fragen ab. „Ich komme heute Abend zu euch. Deine Geschichte interessiert mich sehr.“ Er versprach, beim Krankenhaus vorbeizufahren und Hartini mitzubringen.
Nachdenklich machte sich Samandjaja auf den Rückweg. Was war das nur für ein Tag? Ein Tag wie ein ganzes Leben. Als er heute früh erwacht war, deutete nichts auf Außergewöhnliches hin. Jetzt, da die Sonne sich neigte und er auf die verwirrenden Ereignisse zurückschaute, schien ihm alles unwirklich. Er stand neben sich selbst und suchte zu begreifen, was ihm geschehen war. Hartini hatte recht, der Schlüssel für die Gegenwart lag in der Vergangenheit.
2. Kapitel
Der holländische Zuckerpflanzer, der einst diese Villa am Berghang gebaut hatte, um sich im Kreise seiner Familie und seiner Freunde beim Oude Genever von den anstrengenden Geschäften der Woche zu erholen, musste einen Blick für die Schönheiten der Natur gehabt haben. Das geschäftige Treiben Surabajas drang nicht bis hierher. In der Ferne glitzerte das Meer und hielt die Sehnsucht nach der Heimat auf eine angenehme Weise wach. Ein erfrischender Wind machte das Atmen leicht. Wenn die Dunkelheit hereinbrach, glaubte man sich zwischen zwei Himmeln. Von der Stadt schimmerten Tausende von Lichtpunkten herauf, und oben funkelte die südliche Nacht. Jetzt, nach dem Krieg, schien die Stadt da unten tot, als ob sie nach den Zuckungen und Fieberanfällen des Tages erschöpft zusammengebrochen wäre. Nur am Hafen tanzten einige Lichtpunkte.
Samandjaja stand auf der Veranda und schaute sinnend in die Dunkelheit. Die Unruhe der letzten Stunden fiel von ihm ab, versank in einem warmen, ruhigen Gefühl, hier zu stehen, zu atmen, den Geräuschen der Nacht zu lauschen und auf Hartini zu warten.
Im ehemaligen Empfangsraum der Villa hockten die Jungen beim Schein der Petroleumlampen auf dem Fußboden. Hier und dort stieg Gelächter auf. Fetzen eines Liedes erklangen. Subronto hatte ihnen mit geheimnisvoller Miene erzählt, der Bapak wolle von einem Schiff berichten. Und Besuch werde auch kommen, ein Mann vom Stab in Surabaja und eine Frau.
Die Jungen liebten Samandjaja. Er sprach wenig, aber er konnte zuhören, hatte für jeden ein gutes Wort und auf jede Frage eine Antwort. Man erzählte sich, der Bapak sei achtundzwanzig Jahre alt, doch das glaubten sie nicht. Er musste viel älter sein. Nur wenn er lachte, was selten genug vorkam, verschwanden die tiefen Falten um die Mundwinkel, und die Stirn glättete sich.
Subronto saß in der ersten Reihe. Der Auftritt von heute Morgen ging ihm nicht aus dem Sinn. Welche Beziehung bestand zwischen dem Kommandeur und dem dicken Holländer? Der Bapak hatte ihn angestarrt, als sei er der Leibhaftige persönlich. Subronto war mehrmals zu der Kellerluke geschlichen und hatte die Gefangenen betrachtet. Angenehm sah der Dicke nicht aus, aber er konnte nichts Teuflisches an ihm entdecken. Eben ein Holländer wie viele andere auch.
An der Tür entstand Bewegung. Die Gäste kamen. Bewundernde Rufe wurden laut, als Hartini eintrat. Sie trug eine zimtfarbene kurze Bluse und einen dunkelroten knöchellangen Wickelrock, der ihre schlanke Gestalt betonte. Das dichte Haar, durch ein Band im Nacken zusammengehalten, ließ ihr Gesicht mädchenhaft zart erscheinen.
Die Jungen betrachteten sie wie ein Wesen aus einer anderen Welt. Sehnsucht stieg in ihnen auf nach Sarinah oder Fatimah, die sie schon lange nicht mehr gesehen hatten und die irgendwo auf sie warteten. Auch Samandjaja wandte keinen Blick von Hartini. Sein Herz schlug wild. Sie war genauso gekleidet wie bei der ersten Begegnung. Wusste sie es noch? Hartini lächelte ihn an.
Samandjaja schlug die Augen nieder, um sich nicht in ihrem Anblick zu verlieren. Mit wenigen Worten stellte er die Gäste vor. Dann setzte er sich zu den Jungen, zündete sich an der flackernden Lampe eine Zigarette an und begann: „Ich habe euch zusammengerufen, um euch eine lange Geschichte zu erzählen. Sie ist ein Teil der Geschichte unseres Landes. Wer von euch hat schon einmal etwas von dem Panzerschiff ‚De Zeven Provincien‘ gehört?“
„Ich!“, rief es von allen Seiten. „Ich auch!“
Samandjaja sah in die vielen neugierigen Augen. Seltsam, dachte er, wir kamen uns so allein vor auf dem weiten Meer. Und diese Jungen, die damals gerade geboren wurden oder ihre ersten Schritte taten, wissen von dem Schiff. „Erzähl, Subronto“, sagte er, „erzähl von dem Schiff.“
Subronto sah sich stolz im Kreise um. „Das weiß doch jeder. Die Indonesier auf dem Schiff haben die Holländer davongejagt, die rot-weiße Fahne und die rote Fahne gehisst und die Kanonen gegen die Verfolger gerichtet. Da haben die weißen Herren das Schiff bombardiert. Viele Tote hat es gegeben. Aber das Schiff haben sie nicht besiegen können. Mein Vater hat erzählt, es kreuzt noch heute als Gespensterschiff durch die Java-See, und wenn ein holländisches Schiff in seine Nähe kommt, geht es unter.“
Einige Jungen lachten laut auf, auch Samandjaja schmunzelte. Doch er wurde schnell wieder ernst. „Ganz so, wie du meinst, war es nicht, Subronto. Aber irgendwie hast du doch recht. Die ‚Zeven Provincien‘ liegt auf dem Grund des Meeres, aber der revolutionäre Geist ist nicht mit untergegangen. Er lebt und erfüllt die Holländer noch heute mit tiefem Schrecken. Ich war damals auf dem Schiff.“
Für einen Augenblick herrschte atemlose Stille. Die Jungen sahen sich überrascht an. Dann hagelte ein Schwall von Fragen auf Samandjaja nieder, keiner verstand mehr den anderen.
Samandjaja hob die Hand und gebot Ruhe. „Ich will ganz von vorn anfangen, damit ihr versteht, was damals passiert ist und warum. Ihr müsst Geduld haben.“ Er schluckte, die Kehle war ihm plötzlich ganz trocken. Farid reichte ihm ein Glas Wasser.
„Ich bin in einem Dorf nahe Semarang geboren. An meinen Vater kann ich mich kaum erinnern. Ich war zehn Jahre, als er aus meinem Leben verschwand. Eine unruhige Zeit war damals. Die Angst ging um. Die Leute erzählten schreckliche Dinge von Mord und Totschlag. Später erfuhr ich, dass in Mitteljava Arbeiter und Bauern unter der Führung der Kommunisten gegen die holländischen Herren aufgestanden waren. Der Aufstand erstarb in Blut und Asche. Mein Vater muss bei jenen Ereignissen eine Rolle gespielt haben. Was aus ihm geworden ist, weiß ich nicht. Meine Mutter starb bald darauf. Kurz vor ihrem Tode sagte sie zu mir: ‚Was die Leute auch erzählen, mein Junge, glaub mir, dein Vater war vor allem ein guter Mensch.‘ Der Onkel, bei dem ich aufwuchs, sagte, Vater sei ein Kommunist gewesen, das bedeute soviel wie Satan. Er habe die Mutter verhext, deshalb sei sie gestorben. Und immer wieder hörte ich von ihm, ich sähe meinem Vater sehr ähnlich, und Allah möge sie und mich beschützen vor des Vaters Geist. Mein Onkel, der als Schneider ein ausreichendes Einkommen hatte, schickte mich in eine holländische Missionsschule. Er liebte mich nicht, aber er fühlte sich für den Sohn seiner Schwester verantwortlich. So erwarb ich eine recht gute Schulbildung. Als ich vierzehn war, stellte sich die Frage, was aus mir werden sollte. Ich hätte gern die Universität in Batavia besucht, ich schrieb Gedichte und träumte davon, Schriftsteller zu werden. Aber für ein Studium reichte das Geld nicht. Der Onkel schlug mir vor, ich solle mich für die Marineschule in Makassar bewerben. Ich sprach gut Holländisch und erfüllte damit die wichtigste Bedingung für die Aufnahme. Gewohnt zu gehorchen, fügte ich mich, obwohl ich wenig Lust hatte, in die niederländische Kriegsmarine einzutreten. Aber welche Möglichkeiten gab es schon für einen Jungen aus meinen Verhältnissen, etwas zu lernen? Musste ich nicht dankbar sein, die Schule in Makassar besuchen zu dürfen? Und vielleicht führte von dort auch ein Weg zur Handelsmarine und mit ihr in die Welt.
Mein Onkel kannte einige Leute, die sich für mich verwendeten, und so wurde ich in die Schule aufgenommen. Onkel und Tante waren froh, dass ich endlich aus dem Haus ging. Ich schied ohne Bedauern und mit dem festen Willen, es im Leben zu etwas zu bringen. Ich war jung, gesund, intelligent. Warum sollte ich nicht mein Glück machen?