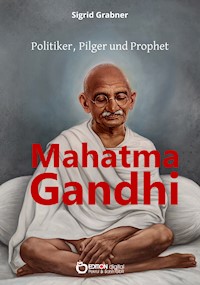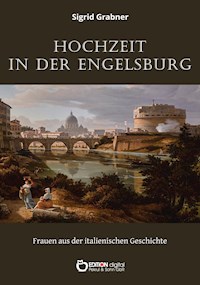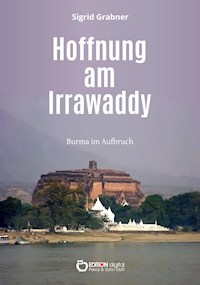6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vorworte zu Büchern sollen und können sehr nützlich sein, weil sie schon ein wenig die Richtung der Reise anzeigen, auf welche der jeweilige Autor oder die jeweilige Autorin Leserinnen und Leser mitnehmen wollen, was sie erwarten können und worauf sie neugierig sein dürfen. Das Vorwort von Hendrik Röder zu diesem Band, für den Sigrid Grabner all jene Essays, Porträts, Betrachtungen und literarischen Skizzen herausgesucht hat, in denen sie ihr Verhältnis zu den wenigen essenziellen Fragen dieser Welt offenlegt, erfüllt solche Erwartungen – es zeigt die Richtung der Lesereise an, deutet das Erwartbare an und es macht neugierig. Worauf? Laut Röder scheut sich Sigrid Grabner nicht, und das ganz unzeitgemäß und im besten Sinne des Wortes konservativ, die Frage nach Wahrheit, Glaube oder Macht zu stellen. Immer wieder geraten jene Frauen aus der Geschichte ins Blickfeld, die offenbar ein anderes Verhältnis zu der ihnen gegebenen Macht entwickelt haben als ihre männlichen Widerparts. Neben Christine von Schweden ist die Autorin gleichermaßen von Maria Theresia fasziniert, ihrer tapferen Gegenwehr gegenüber Friedrich dem Großen, der nicht müde wurde, die Habsburger in endlose Territorialkämpfe um Schlesien zu verstricken und dafür nicht zuletzt sein „lebhaftes Temperament“ verantwortlich machte. Sie machte Frieden, so der Titel, ist vielleicht das Kernstück dieses Bandes, weil hier ein zentrales Thema der Autorin berührt wird, der Frage nach männlichen und weiblichen Machtstrategien. Wie so oft gibt die Auswahl der Protagonisten ein Stück des Eigenen preis, lassen sich anhand der Prüfungen, denen sie ausgesetzt waren, eigene Vorstellungen, Tugenden und auch Versäumnisse ablesen. Um auf das Eigene zu kommen, sind Umwege nötig. Insofern ist dieses Buch eine Sammlung von Umwegen der Autorin bis heute. Folgerichtig schließt der Band mit einem persönlichen, offenen Brief an ihren Enkel Paul. Darin stellt sich die Frage nach dem Eigenen, den Irrtümern und der juvenilen Selbstgerechtigkeit, die man gern weit von sich schiebt. Was hat man gewusst? Was getan? Vielleicht empfiehlt es sich, die Lektüre mit diesem Brief am Schluss des Bandes zu beginnen. Zu den Protagonisten des Grabner-Buches gehören Mahatma Ghandi, Henning von Tresckow, Emmi Bonhoeffer und Christine von Schweden. Und wie gesagt, der letzte Text, der „Brief an meinen Enkel“, der ist unbedingt lesenswert. Vielleicht, wie von Vorwort-Verfasser Hendrik Röder vorgeschlagen, sogar als allererstes Lesestück.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Sigrid Grabner
Vertraute Fremde
Essays, Porträts, Betrachtungen
ISBN 978-3-96521-667-9 (E-Book)
Umschlaggestaltung: Ernst Franta
Das Buch erschien 2002 im vacat verlag, Potsdam.
2022 EDITION digital
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
„Ich glaube oft, die ganze Weltgeschichte besteht überhaupt nur aus falschen Gerüchten. Alles, was geschehen ist, ist ganz anders wahr, als es tatsächlich geschehen ist.“
Franz Werfel
Vorwort
Vor dem Schreiben kommt das Lesen. Sigrid Grabner gehört zu jenen Autoren, die viel lesen, manches mehrmals wie etwa die Romane von Dostojewski, Werfel oder Kertész. Vielleicht kann man aus dem Stand heraus, ohne Vorwissen, ohne einen persönlichen literarischen Kanon, einen unschuldig-schönen Roman schreiben. Aber kann ein guter Essay gelingen, wenn man es nicht vermag, historische und literarische Linien zu ziehen?
Mit Blick auf die fast vergessenen Arbeiten war die Autorin selbst überrascht, wie viel unterschiedliches in mehr als zehn Jahren zusammengekommen ist. Bereits das Inhaltsverzeichnis des vorliegenden Bandes verrät die Vielfalt der Themen und die großen Zeitsprünge, die Sigrid Grabner mal in das 17. Jahrhundert der schwedischen Regentin Christine von Schweden führt, deren resolute Briefe an Papst Clemens IX. sie im vatikanischen Geheimarchiv in den Händen hielt, mal ins 18. Jahrhundert zu Maria Theresia und ihrem Kampf gegen „den bösen Mann von Berlin“, oder zu solch gegensätzlichen Figuren des 20. Jahrhunderts wie Emmi Bonhoeffer, Henning von Tresckow oder Mahatma Gandhi, dessen erste deutschsprachige Biografin die Autorin ist.
Auffällig ist, sieht man von dem Exkurs über den Begriff Wohlfahrt unter dem Titel Der Mensch ist keine Insel ab, dass die unmittelbare Gegenwart kaum eine Rolle spielt. Aber die Autorin lässt keinen Zweifel aufkommen, in welchem Maß sie die heutige patronale Wohlfahrtsgesellschaft für entmündigt hält, eine Gesellschaft, deren Institutionen genau das Gegenteil von dem bewirken, was sie eigentlich befördern wollen: den mündigen Bürger. Nicht zuletzt, im Osten Deutschlands jedenfalls, ein Erbe des allgegenwärtigen Staates und des zerrütteten Verhältnisses von Geist und Macht, dem die Autorin einen klarsichtigen und auch bitteren Essay über die konkreten Verhältnisse in ihrer Heimatstadt Potsdam nach 1945 widmet. Erst preußische Residenz mit Toleranzedikt und Vernunftstaat, dann billige Kulisse für den „Tag von Potsdam“ am 21. März 1933. Jenem Tag, der für den Fortgang des nationalsozialistischen Regimes kaum Bedeutung hatte, im Bewusstsein vieler aber bis heute als Sinnbild des Unheils gilt. Nach 1948 war es nahezu folgerichtig, dass der Kleingeist und das Banausische der kommunistischen Funktionäre der Stadt den Rest gaben und dem ohnehin von Bomben verwüsteten Stadtbild ihren Stempel aufdrückten. Mit der Entsorgung von Kirchen und Residenzen und allem, was noch für preußisch gehalten wurde, glaubte man den ideologischen Vorläufer des Nationalsozialismus zu treffen. Dabei hatte Preußens politisches Erbe in Hitlers Reich keinen Platz. Der sozialistische Triumphzug war hingegen nur möglich, weil die bürgerlich-liberale Elite der Stadt, sofern sie die Nazizeit überstanden hatte, entweder in den Westen geflohen oder in den Verliesen des sowjetischen Geheimdienstes verschwunden war. In diesen Zusammenhang gehört die verschämte, späte Erinnerung der Stadtverwaltung an den ersten Nachkriegsbürgermeister Erwin Köhler, der zusammen mit seiner Frau 1951 in Moskau erschossen wurde. Der Autorin gebührt das Verdienst, über diese und weitere Schicksale in einem Sammelband mit dem Titel Widerstand in Potsdam. 1945 bis 1989 aufmerksam gemacht zu haben.
Andernorts ist kaum nachvollziehbar, wie der sogenannte Geist von Potsdam, den man im Jahr 1951 symbolisch in einem Sarg zu versenken suchte, die Gemüter erregt, welchen Lärm die Absicht des Wiederaufbaus von Garnisonkirche und Stadtschloss erzeugt. Bis heute ist eine infantile Abneigung gegen alles auszumachen, was irgendwie mit Herkunft und Tradition zusammenhängt, jedenfalls scheint es eine Lust zu geben, das dunkle, zerstörerische Bild der Geschichte in den Vordergrund zu stellen und diejenigen klein zu reden, die sich gegen Gewalt und ideologische Gleichschaltung zur Wehr gesetzt haben. Ein Grund mehr für die Autorin, sich derer zu erinnern, die diesen Weg gewählt haben. Henning von Tresckow ging, wie die Autorin betont, den Weg des Paradoxes, vom Soldaten zum erfolgreichen Banker, vom Hitlerschwärmer – „Wir wählen A.H.“ (November 1932) – zum Mitverschwörer des 20. Juli 1944. Ohne ihn wäre das Attentat wohl ausgeblieben, in endlosen Debatten zerredet worden. Er war, wie SS-Ermittler Kaltenbrunner feststellte, der „böse Geist“ des Unternehmens. Wie auch immer über den 20. Juli geurteilt werden mag, die Autorin lässt keinen Zweifel daran, dass die Tat nicht an ihrer Vergeblichkeit gemessen werden darf. Ihre Bedeutung liegt „außerhalb der prosaischen Erfolgsrechnungen“ (Joachim Fest), im Festhalten an der „humanitas nach dem Bilde Gottes und die unbeirrbare Entschlossenheit, sie zu verteidigen“, so die Autorin. Wie auch der Schriftsteller Jochen Klepper wählte Tresckow den Freitod: Klepper aus verzweifelter Furcht vor der Verschleppung seiner jüdischen Frau und Tochter ins Konzentrationslager, Tresckow aus Furcht vor Sippenhaft und dem möglichen, eigenen Verrat unter der Folter.
Wenn Sigrid Grabner von Potsdam spricht, ist Rom nicht weit. Die Ewige Stadt ist auch einer der geografischen und historischen Sehnsuchtsorte, dessen Ausstrahlung ihr Werk bis heute begleitet. Traum von Rom erzählt von der ersten Begegnung mit dieser Stadt zu Beginn der 80er Jahre, dem schweijkschen Versprechen an die Kulturfunktionäre daheim, einen Roman über den römischen Volkstribun und Humanisten Cola di Rienzo zu verfassen und sich so der Ortsbesichtigung als würdig zu erweisen. Der schale Beigeschmack, den jede sogenannte Westreise vor dem Mauerfall hatte, bleibt nicht unerwähnt. Im Gegenteil, der Preis, den die Autorin zu zahlen hatte, war nicht gering. Etwa zu dieser Zeit verschaffte sich die Staatssicherheit einen Nachschlüssel zu ihrer Wohnung, um die Räume zu verwanzen.
Jener Traum von Rom lebt bis heute fort. Davon zeugt sogleich der bewusst an den Anfang gestellte, bekenntnishafte Essay über die Vertraute Fremde. Eine melancholisch gefärbte Reise durch die brandenburgische Seelenlandschaft mit ihren untergründigen Verbindungslinien zu Italien, ihren mitunter verzweifelten Bemühungen, der eher düsteren Grundierung aus Sümpfen, Sand und Hemdsärmligkeit zu entfliehen. Rom, heißt es da, gab ihr das Gefühl, „auf vertrautem Boden zu gehen“, und während der für lange Zeit gültig befundenen Ummauerung des eigenen Landes schienen die „so absolut gesetzten Grenzen von Zeit und Raum“ für einen Moment zu verschwinden.
Im Vatikan, unterhalb des Turmes der Winde, führte sie ein Archivar zu den Schätzen des päpstlichen Geheimarchivs, wovon die Begegnung mit Christine erzählt. Im fiktiven Gespräch mit der Regentin „erlöst“ sich die Autorin von der jahrelangen Arbeit an ihrem größten, wohl wichtigsten Roman Christine von Schweden. Rebellin auf dem Thron. Mehr noch scheint es so, dass die brüchigen, Jahrhunderte alten Dokumente eine Dimension offenbart hatten, die die Autorin endgültig von den blutleeren Illusionen des Sozialismus befreiten, der sie eine Zeit lang anhing.
Gleichzeitig schien erst beim Anblick der zunächst fremden Obelisken, Kirchen und Palazzi ein Begriff Konturen zu bekommen, der manchem bis heute eher verschämt über die Lippen kommt: Heimat. Italien versus Brandenburg, Rom versus Potsdam; das klingt vermessen. Aber erst im Spiegel Italiens bekommen die Potsdamer Friedenskirche, das herrlich-besinnungslose Belvedere auf dem Pfingstberg oder das kürzlich wiedererstandene Bornstedter Krongut mit seinem zarten Altrosa ihren Hintergrund. Leidenschaftliche Bauten mit menschlichem Maß, da könnte man zufrieden leben. Doch in dem Jahrhundert, in das die Autorin hineingeboren wurde, verblasste jenes Maß zu Mittelmaß, öffnete sich ein Abgrund mit seinen Massenmorden, Vertreibungen und Demütigungen. 1942 im böhmischen Tetschen geboren und als Kind von dort vertrieben, sollte die Autorin dieses Programm in Teilen selbst erfahren, ein Kapitel, das sie bis heute ausgespart hat.
Sigrid Grabner hat für diesen Band all jene Essays, Porträts, Betrachtungen und literarischen Skizzen herausgesucht, in denen sie ihr Verhältnis zu den wenigen essenziellen Fragen dieser Welt offenlegt. Dabei scheut sie sich nicht, und das ganz unzeitgemäß und im besten Sinne des Wortes konservativ, die Frage nach Wahrheit, Glaube oder Macht zu stellen. Immer wieder geraten jene Frauen aus der Geschichte ins Blickfeld, die offenbar ein anderes Verhältnis zu der ihnen gegebenen Macht entwickelt haben als ihre männlichen Widerparts. Neben Christine von Schweden ist die Autorin gleichermaßen von Maria Theresia fasziniert, ihrer tapferen Gegenwehr gegenüber Friedrich dem Großen, der nicht müde wurde, die Habsburger in endlose Territorialkämpfe um Schlesien zu verstricken und dafür nicht zuletzt sein „lebhaftes Temperament“ verantwortlich machte. Sie machte Frieden, so der Titel, ist vielleicht das Kernstück dieses Bandes, weil hier ein zentrales Thema der Autorin berührt wird, der Frage nach männlichen und weiblichen Machtstrategien.
Wie so oft gibt die Auswahl der Protagonisten ein Stück des Eigenen preis, lassen sich anhand der Prüfungen, denen sie ausgesetzt waren, eigene Vorstellungen, Tugenden und auch Versäumnisse ablesen. Um auf das Eigene zu kommen, sind Umwege nötig. Insofern ist dieses Buch eine Sammlung von Umwegen der Autorin bis heute. Folgerichtig schließt der Band mit einem persönlichen, offenen Brief an ihren Enkel Paul. Darin stellt sich die Frage nach dem Eigenen, den Irrtümern und der juvenilen Selbstgerechtigkeit, die man gern weit von sich schiebt. Was hat man gewusst? Was getan? Vielleicht empfiehlt es sich, die Lektüre mit diesem Brief am Schluss des Bandes zu beginnen.
Hendrik Röder
Vertraute Fremde
Wer in die Mark Brandenburg kommt, hat angesichts stiller Dörfer, englischer Parks, italienischer Villen früher oder später ein Dájù-vu-Erlebnis. Erinnern nicht die Ufer umwaldeter Seen, sich im Horizont verlierende Wege an verträumte Sommernachmittage der Kindheit? Irgendwann, irgendwo haben wir das alles schon einmal erlebt und gesehen.
Viele Gesichter hat die Mark Brandenburg. In manchem Sommer lässt flirrende Hitze, in manchem Winter klirrender Frost an die Weiten des kontinentalen Ostens denken, während im nächsten Jahr nicht enden wollende Regenwolken die Landschaft mit nordatlantischer Melancholie überziehen. Russische und ungarische Steppenpflanzen sind hier ebenso zu Hause wie die Stechpalmen der britischen Inseln. Nicht wenige alteingesessene Brandenburger tragen flämische und wendische, französische und böhmische, polnische und russische Namen. Jahrhundertelang rangen ihre Vorfahren dem kargen Sandboden Kartoffeln, Roggen und Futterpflanzen ab, kultivierten ihn hier und dort sogar zu Obst- und Gemüseplantagen, denn nur in wenigen fruchtbaren Landstrichen gediehen profitable Kulturen wie Weizen, Zuckerrüben und Tabak.
Zisterzienser-Klöster öffnen unvermutet dunkle Wälder zu einem übersonnten Raum. Seen blitzen auf, von deren einem namens Stechlin Theodor Fontane erzählt, er zeige Erschütterungen in der Welt durch einen aufsteigenden Wasserstrahl oder gar durch einen aus der Tiefe steigenden roten Hahn an. Die Türme mittelalterlicher Feldsteinkirchen und aufstrebender Backsteingotik grüßen weithin über die Felder zur Autobahn, deren eilige Benutzer nichts von den Mühen der Erbauer ahnen. Barocke Herrenhäuser und von einstmals bescheidenem Wohlstand kündende Landstädtchen liegen an schnurgeraden Alleen, die alle nur ein Ziel zu haben scheinen – Berlin.
Die erste große Reise meines bewussten Lebens unternahm ich in die Mark Brandenburg. Ich war damals zehn Jahre alt und fuhr allein mit dem Zug zu Verwandten, die der Flüchtlingsstrom in der Uckermark angeschwemmt hatte, wie meine Eltern und mich im Raum Halle–Leipzig. Die sommerwarmen Wege zwischen Feldern, aus denen Lerchen in den weiten blauen Himmel aufstiegen, und die Ahnung des nahen Meeres prägten meinen Begriff von Landschaft, heute weiß ich es, für immer. Meine Eltern registrierten erstaunt meine Vorliebe für Kartoffeln und Sandböden, die so gar nicht meiner Herkunft entsprach. Sie mochten lieber Semmelknödel und sehnten sich in das liebliche Hügelland Böhmens zurück. Da ihnen die Heimat verschlossen blieb, lebten sie ihre Sehnsucht durch Ausflüge ins Saaletal und nach Thüringen aus und konnten nicht verstehen, was mich in den Ferien immer wieder in das weltabgeschiedene Dorf nahe der Oder zog. Eine Liebe auf den ersten Blick kann eben keine Gründe benennen. Später fügte es der Zufall, den es nicht gibt, dass ich mich in der Mark Brandenburg ansiedelte, dass meine Kinder hier geboren wurden und aufwuchsen. Durch Geburt wurde ihnen geschenkt, worum ich mich seit jener durch die Vertreibung für immer ins Vergessen versunkenen Kindheit in Böhmen vergeblich bemühte – Heimat. Geprägt sein von einer Landschaft und ihrer Geschichte, sie einatmen, selbstverständlich irgendwo zu Hause sein. Auch wenn die Regierenden dieses Zuhause durch Mauern und Stacheldraht für alle Zeiten unentrinnbar machen wollten. Überstieg nicht der Himmel spielerisch leicht die Mauern der Gegenwart, reichte die Geschichte der verfallenden Schlösser und Klöster nicht tiefer als die Fundamente der Grenzanlagen, entdeckten die durch Fernsehnsucht geschärften und sensibilisierten Sinne nicht im Wassertropfen die Wunder der Welt? Wo Kinder sich angenommen fühlen und nicht vorzeitig aus dem Paradies des Urvertrauens vertrieben werden, erfahren sie unverlierbar Heimat.
So wurde mir die Mark Brandenburg – wie schon seit Jahrhunderten vielen Flüchtlingen – zur vertrauten Fremde, weil sie die Heimat meiner Kinder war. Die in drei politische Verwaltungsbezirke aufgeteilte Mark Brandenburg war zwar nicht komfortabel, aber von einer eigentümlich wehmütigen Schönheit.
Anfang der Achtzigerjahre gestatteten mir die „Organe“ der DDR einen zweiwöchigen „Ausgang“ nach Italien, damit ich dort Recherchen für ein Buch betreiben konnte. Die Begegnung mit Rom elektrisierte mich. Konfrontiert mit den Zeugnissen einer zweieinhalbtausendjährigen Geschichte, hatte ich jeden Tag meines kurzen Aufenthalts ständig und unabweisbar das Gefühl, auf vertrautem Boden zu gehen, all diese Gebäude schon einmal gesehen zu haben. Die in meinem bisherigen Leben so absolut gesetzten Grenzen von Zeit und Raum schmolzen zu einem Nichts zusammen. Meine Seele lernte fliegen.
Obelisken und Pyramiden, von weither nach Rom gekommen, Kirchen, Palazzi und Parks – kannte ich sie nicht schon aus der Mark? Freilich verhaltener, dem nördlichen Temperament entsprechend, auch leichter daher kommend, weil Sandboden nicht so belastbar ist wie felsiger Untergrund.
Von der Villa Medici die Stadt überblickend, überkam es mich wie eine Erleuchtung: Wenn ich in Rom meine Heimat erkannte, hatte ich sie auch in Brandenburg gefunden. Italien und Deutschland, das es als politische Einheit nicht mehr und noch nicht gab, aber zu dem Brandenburg gehörte, waren seit Jahrhunderten, gar Jahrtausenden durch unterirdische Ströme miteinander verbunden. Die nördliche Landschaft, in der ich wohnte, war Teil von einem Europa, dessen politische Grenzen so wenig für die Ewigkeit geschaffen waren wie die Ideologien von Diktatoren. Was der Krieg mir genommen hatte, indem er mich aus dem Land meiner Vorfahren vertrieb, schenkte mir die Begegnung mit Rom aufs Neue: Heimat.
Nach jener ersten Romreise begann ich in der Mark Brandenburg Wurzeln zu schlagen und hatte doch die Vierzig schon überschritten. Die Grenzanlagen, die Seen, Flüsse, Wälder, Parks und Städte durchschnitten, schienen mir nun in dem Bewusstsein, dass alles mit allem verbunden ist, dem Leben auf Dauer so wenig standhalten zu können wie die Mauern in Herzen und Köpfen. Fortan musste ich mich nicht mehr in einer fruchtlosen Opposition gegen die Dummheit der alles beherrschenden Parteibürokratie abarbeiten, sondern konnte, mich verwurzelnd in diesem Landstrich und seiner Geschichte, einfach ich selber sein. Der Widerstand brauchte keine Rechtfertigung mehr, er wurde selbstverständlich. Wo man wirklich zu Hause ist, lässt man sich nicht ohne weiteres vorschreiben, was man zu tun und zu lassen hat. Man denkt und handelt, wie es einem das Gewissen und gesunder Menschenverstand vorschreiben.
Als müsste es so sein, lernte ich in jener Zeit Eva Foerster kennen und durch sie die Gedanken- und Gartenwelt ihres 1970 verstorbenen Mannes Karl Foerster. In unseren Gesprächen saß er ebenso mit am Tisch wie die vielen Künstler, Politiker und Wissenschaftler, die in dem Haus in Bornim aus und ein gegangen waren und zu ihrer Zeit Geschichte geschrieben hatten.
Die Schriftstellerin Helene von Nostitz schrieb in ihrem 1930 erschienenen Buch Potsdam über Karl Foersters Garten in Bornim: „Wir können die harte, sorgsame Arbeit nur ahnen, die hinter dieser leuchtenden, bunten, duftenden Welt steht. Der Kampf mit dem sandigen Boden der Mark erzeugt eine fortwährende Spannung und Beschwingtheit. Die Pflanzen werden hier nicht gemästet und gepflegt, sondern großgehungert und großgedürstet. Solch eine Blumenpflege ist ein Spiegelbild des altpreußisch-spartanischen Ideals, das nur im Verzicht sein Äußerstes zu leisten vermag und dann zu seinem eigenen Erstaunen bunte und herrliche Gebilde hervorbringt, wie auch das Fridericianische Barock.“
Diese Worte charakterisieren nicht nur den „Zauberer von Bornim“ und die großen Garten- und Landschaftsgestalter vor ihm, sondern jegliche zivilisatorische Bemühung in der „Streusandbüchse“ des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Wie kaum ein anderer im zwanzigsten Jahrhundert hat der Gärtner und Schriftsteller Karl Foerster in seinem Werk dem Wesen der Mark Brandenburg Ausdruck verliehen. Er hielt sich nicht bei Klagen über die Kargheit des Sandbodens auf, sondern sparte nicht Mühe noch Fantasie, ein Gartenparadies zu schaffen. Im Kleinen entdeckte er das Große, ohne spießerhaft selbstgenügsam zu sein.
Wer wie Karl Foerster im Garten ein Gleichnis auf den Kosmos sieht, in dem jedes seinen Platz und seine Berechtigung hat, wer Widerstände als Herausforderung für Wachsen und Reifen begreift, wer dem Neuen vorurteilslos aufgeschlossen begegnet, dem bleiben Hurra-Patriotismus ebenso fremd wie ein unverbindlicher Internationalismus. Deshalb verklingen die Rufe der Politiker und der PR-Agenturen nach einem gemeinsamen Europa scheinbar ohne Widerhall zwischen Kiefern, Seen und sandigen Hügeln. Warum auch sollten die Städte und Gemeinden der Mark Brandenburg nach Europa streben, da sie doch seit jeher Europa sind! Hier lernten Menschen vieler Völker und Religionen, sich dem preußischen Gesetz von Pflichterfüllung und Toleranz unterwerfend, miteinander zu leben. Italienische Leichtigkeit und böhmische Ernsthaftigkeit, französische Lebensart und belgische Fertigkeiten, holländischer Fleiß, schweizerische Präzision und durch Jahrtausende von Verfolgung geschärfte jüdische Intelligenz verbanden sich zu gemeinsamer Anstrengung, damit die Mark Brandenburg nicht nur eine notdürftige Zuflucht bliebe, sondern den nachfolgenden Generationen zur Heimat würde. Freilich zwangen der Mangel an natürlichen Ressourcen und die geopolitische Lage als Grenzland die Bevölkerung, Meister in der Kunst des Überlebens zu werden: durch beständige Anspannung, Verzicht, Askese, Zähigkeit und Härte. Auf dem scheinbaren Gipfelpunkt des Preußenstaates, als der politische Niedergang schon eingesetzt hatte, aber den meisten noch verborgen blieb, kamen endlich auch die Künste zu ihrem Recht. Den Dichter Heinrich von Kleist veranlasste dieser Zustand in seinen Betrachtungen über den Weltlauf allerdings zu der scharfsinnigen Bemerkung, man nehme gemeinhin an, die Völker stiegen aus tierischer Wildheit und Rohheit auf zur Tugend, von dieser zur Ästhetik und Kunst, und die Kunst schließlich würde das Volk zur höchsten Stufe der menschlichen Kultur hinaufführen. Genau das Umgekehrte sei der Fall, meinte Kleist und verwies auf das Beispiel der Griechen und Römer: „Diese Völker machten mit der heroischen Epoche, welches ohne Zweifel die höchste ist, die erschwungen werden kann, den Anfang; als sie in keinen menschlichen und bürgerlichen Tugenden mehr Helden hatten, dichteten sie welche, als sie keine mehr dichten konnten, erfanden sie dafür die Regeln; als sie sich in den Regeln verwirrten, abstrahierten sie die Weltweisheit selbst, und als sie damit fertig waren, wurden sie schlecht.“
Der Dichter behielt recht. Was die Mark Brandenburg als Kernland Preußens groß gemacht hatte, wurde ihr schließlich zum Verhängnis. Mit dem Erfolg drängten die unterdrückten Schattenseiten preußischer Tugenden mit Macht ans Licht. Anspannung mündete in Selbstgerechtigkeit, Verzicht wurde zur Gier, Askese zur Enthemmung, Härte und Zähigkeit zur Verhärtung. Die Loyalität gegenüber dem Gesetz mutierte zu vorauseilendem blinden Gehorsam.
Schwer haben die Bewohner der Mark Brandenburg für die Hybris der Herrschenden und eigene Blindheit in diesem Jahrhundert bezahlen müssen. Die Gedenkstätten der Konzentrationslager, riesige Soldatenfriedhöfe und die Reste der Mauer um Berlin künden davon.
Immer trafen in diesem Landstrich die Widersprüche heftig aufeinander, das Wohltemperierte ist hier nicht zu Hause, und es bedarf immer erneuter seelischer und geistiger Anspannung, scheinbar Unversöhnliches miteinander zu versöhnen. Es fehlt hier die Gelassenheit, die der Reichtum der Natur den Menschen schenkt. Berlin bietet dafür ein beredtes Beispiel. Der Stadtstaat, noch immer, nach dem Willen der Brandenburger, als Land mitten im Land gelegen, ist nicht ohne die Mark Brandenburg zu denken wie die Mark Brandenburg nicht ohne Berlin. Bis heute kann die Hauptstadt ihren Ursprung als eine Wucherung zusammengewachsener märkischer Dörfer nicht verleugnen. Hier steigerten sich die Vorzüge und die Schattenseiten der historischen Landschaft, aus der heraus sie gewachsen ist, bis zum Extrem. Die Stille entlädt sich in fieberhafter Geschäftigkeit, die Kargheit produziert eine Fülle wissenschaftlicher und kultureller Leistungen, und je mehr Berlin durch die Betonung seiner Größe und Einzigartigkeit seine ärmliche Herkunft vergessen machen möchte, umso mehr sehnt es sich nach seinem Ursprung.
„Potsdam verklärt dem Deutschen Berlin“, schrieb in den Dreißigerjahren Eugen Diesel, der in Bornstedt bei Potsdam lebende Sohn des bekannten Erfinders. Nicht nur in Potsdam, in der ganzen Mark Brandenburg findet der zivilisationsmüde Hauptstädter, ob zugezogen oder seit Generationen ansässig, was er im Grunewald, am Müggelsee oder am Wannsee von der Schönheit der umliegenden Kulturlandschaft schon erahnt. Der Erfolg solcher Bücher wie Rheinsberg von Kurt Tucholsky und Fontanes Wanderungen durch die Mark Brandenburg verdankt sich dieser Sehnsucht nach dem Ursprung.
Am Kleinen Wannsee liegt Heinrich von Kleist begraben, der sprachmächtigste Schriftsteller, den die Mark Brandenburg hervorgebracht hat. Sein Leben und sein Werk stehen für die fortwährende Spannung, die zugleich „bunte und fruchtbare Gebilde“ hervorbringen kann und der doch die Gefahr der Selbstzerstörung innewohnt. Auf den ersten und auch auf den zweiten Blick mag man diese Spannung in der anmutigen Landschaft und in der heute scheinbar befriedeten Geschichte der Mark Brandenburg nicht wahrnehmen. Wem aber dieser Landstrich zur Heimat oder wenigstens zur vertrauten Fremde geworden ist, lernt ihre Zeichen zu deuten.
Preußen und seine Frauen
Ich habe mich gefragt, warum dieses so formulierte Thema bei vielen spontan auf großes Interesse stößt und meine, der Grund liegt im Widerspruch. Denn Frauen und Preußen passen zusammen wie Feuer und Wasser. Das erklärt auch das Unbehagen, das sich beim weiteren Nachdenken über das Thema einstellt.
Gesetzt, es veranstaltete jemand eine Tagung Preußen und seine Männer, so erntete er nur Kopfschütteln. Warum nicht Preußen und sein Militär, Preußen und seine Wissenschaft, Technik, Literatur, würde man fragen. Bestimmt sich der Mann als Mensch nicht durch sein Tun in der Welt? Die Frau als Mensch aber scheint sich noch immer durch ihr Anderssein zum Mann zu definieren und nicht durch ihr Tun in der Welt.
Da es bei diesem Potsdamer Gespräch nicht um den Kampf und die Eintracht der Geschlechter geht, sondern um die Frau als gesellschaftliches Wesen, beinhaltet schon das Thema eine Diskriminierung, wie übrigens auch ähnliche Themen über Minderheiten, seien es Juden, Homosexuelle, Sinti und Roma. Laufen die Referenten doch Gefahr, eine ohnmächtige Gegenrechnung aufzumachen, eben über Frauen zu reden, die in Politik, Kunst, Wissenschaft „ihren Mann“ gestanden haben. Unausgesprochen steht dahinter immer der Satz: Seht mal an, obwohl sie Frauen sind, haben sie etwas geleistet. Ein solches Thema weist also ebenso auf ein Defizit hin, wie es dieses fortschreibt.
Dennoch: Themen wie dieses sind wohl zulässig und vielleicht sogar notwendig in einer Zeit, da der Anspruch auf Gleichberechtigung der Frauen in der Gesellschaft schmerzhaft mit der Wirklichkeit kollidiert. Und sei’s nur darum, den Frauen Mut zu machen und die Selbstgerechtigkeit von Männern Heil bringend zu beschädigen.
Auch das zweite Substantiv im Thema wirft Fragen auf: Preußen. Das Staatsgebilde Preußen, das seinen Namen von dem heidnischen Volk der Pruzzen nordöstlich der Weichsel bezieht und dessen Kernland die Mark Brandenburg war, erreichte 1866 seine größte Ausdehnung mit Ost-, West- und Südpreußen, Schlesien, Posen, Pommern, Schleswig-Holstein, Hannover, Westfalen, der Rheinprovinz, Hessen-Nassau, Hohenzollern und natürlich der Mark Brandenburg. Der Staat Preußen endete faktisch 1871 mit der Gründung des Deutschen Reiches und formal am 25. Februar 1947 mit dem Kontrollratsgesetz Nr. 46.
Fassen wir also Preußen und seine Frauen als historisches Thema? Bis 1871 oder bis 1947? Oder zwingt uns der Schatten des preußischen Geistes, was immer man darunter verstehen mag, das Thema auch als gegenwärtiges abzuhandeln?
Zweite Frage: Vorausgesetzt, wir beschränkten uns auf das Kernland des einstigen Preußen, berücksichtigen wir nur die Frauen, die dort geboren sind, oder beziehen wir auch die Frauen ein, die aus anderen Gegenden gekommen sind und in Preußen gewirkt haben? Eine Frau wie Bettina von Arnim zum Beispiel ist nur aus ihrer Frankfurter Herkunft und aus ihrem südlichen Temperament zu erklären. Eine Preußin ist sie nicht und wollte sie vielleicht auch nie sein. Noch viel mehr trifft das auf die Frauen aus allen Gegenden Deutschlands zu, die sich nach der Reichseinigung in der Frauenbewegung engagierten, deren Zentrum die Hauptstadt Berlin war.
Mit diesen Anmerkungen will ich nur zu bedenken geben, auf welch schwankendem Boden von Definitionen sich unser Thema bewegt.
Wir reden in Potsdam über Preußen und seine Frauen. Was liegt da näher, als die Stadt nach ihren Frauen in der Geschichte zu befragen? Auf Anhieb fällt einem da kaum mehr ein als eine Mätresse, eine gute Luise und ein Heldenmädchen. Und nur Königin Luise sicherte sich Aufmerksamkeit über die Grenzen Preußens hinaus, weil sie sich mit Napoleon anlegte und eine wohlschmeckende Birne ihren Namen trägt.
Ansonsten ahnt man nur vage, dass all die tapferen Generäle und die unbestechlichen Beamten Mütter, Frauen und Töchter gehabt haben müssen, aber man weiß wenig oder nichts von ihnen – den klugen Ehefrauen eines Scharnhorst, Wilhelm von Humboldt oder Bismarck. Wer kennt schon die mit Rodin befreundete Schriftstellerin Helene von Nostitz-Wallwitz (1878-1944), wer die Malerin und Zeitgenossin Friedrichs des Großen Anna Dorothea Therbusch (1721-1782), die leidenschaftliche Preußin und jüdische Bankiersfrau Fanny von Arnstein (1758-1818), die Frauenrechtlerin Lily von Braun (1865-1916), die Ärztin Agnes Bluhm (1862-1944), um nur einige zu nennen? Umso bedauerlicher, dass sie alle und noch bekanntere Frauen wie die Dichterin Karsch, Rahel Levin usw. nicht in der für das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg hergestellten Sammlung Brandenburgische Persönlichkeiten enthalten sind. Das 1992 vom Archiv-Buch Verlag Potsdam-Bornim herausgegebene Büchlein zählt 532 Personen auf, davon 13 Frauen. Wer da recherchiert hat, möchte ich gern wissen. Die Herausgeber des Buches Große Frauen der Weltgeschichte, 1987 in Klagenfurt erschienen, hielten die genannten Frauen und noch viele mehr aus diesem Landstrich durchaus für würdig, in das Kompendium aufgenommen zu werden.
Es ist deshalb besonders hervorzuheben, dass in den letzten Jahren einige kenntnisreiche Veröffentlichungen von Frauen über Frauen dieser Gegend erschienen sind, so von Hermynia von Zur Mühlen und von Dorothee von Meding (Mit dem Mut des Herzens) über die Frauen des 20. Juli 1944 und jüngst von Gabriele Schnell über Potsdamer Frauen. Alle diese Porträts erzählen präzise und einfühlsam von Frauen dieses Jahrhunderts.
Aber in der Darstellung der älteren Geschichte scheint sich, von Ausnahmen abgesehen, immer noch das Vorurteil zu halten, dass das Beste an Preußen die Männer waren. Die übermächtige Gestalt Friedrich Wilhelms I. wirft bis heute ihre Schatten. Der Soldatenkönig, dem wir die viel gepriesenen preußischen Tugenden verdanken, bezeichnete alle Frauen, mit Ausnahme seiner Gemahlin, kurz und einprägsam als Huren.
Dabei ließ sich die preußische Geschichte in dieser Hinsicht mit dem Großen Kurfürsten verheißungsvoll an. Der freite nämlich die kluge Luise Henriette von Oranien (1627-1667). Einem anderen versprochen, hatte die Holländerin keine Lust, dem von Christine von Schweden abgewiesenen Fürsten ihre Hand zu reichen, wozu sie dann doch der Befehl ihres Vaters zwang. Luise Henriette war zu klug, ihr Leben durch Aufbegehren gegen Unabänderliches zu verderben. So machte sie das Beste aus dem Gegebenen und stand ihrem tatkräftigen Mann beim Aufbau des durch den Dreißigjährigen Krieg zerstörten Landes nicht nach. Sie holte holländische Kolonisten ins Land, gründete Schulen, Waisenhäuser, holländische Mustermeiereien und sah wie eine Gutsherrin überall unermüdlich nach dem Rechten.
Auch ihre Schwiegertochter, die Kurfürstin und spätere Königin in Preußen, Sophie Charlotte aus dem Geschlecht der Welfen (1668-1705), spielte noch aus sich selbst heraus eine öffentliche Rolle. Leibniz hatte das glänzend begabte junge Mädchen einst unterwiesen. Sie, der man schmeichelte, eine „Philosophin auf dem Thron“ zu sein, rief den Gelehrten nach Berlin, damit er eine Akademie der Wissenschaften gründe.
Mit diesen beiden Fürstinnen hatte die Bedeutung preußischer Regentinnen aber auch schon den Höhepunkt und das Ende erreicht. Eine Zarin Katharina II. oder eine Kaiserin Maria Theresia wären im protestantischen Preußen undenkbar gewesen. Hier hatten Frauen weder als Heilige, noch als Mätressen, geschweige denn als Regentinnen eine Chance, historische Größe zu gewinnen.
Der Aufstieg Preußens begann nach der Reformation und dem Dreißigjährigen Krieg, in einer Zeit also, da in ganz Europa der Einfluss von Frauen auf das gesellschaftliche Leben rapide zurückging. Noch in unserem Jahrhundert war die Benachteiligung der Frau im Berufsleben größer als im Spätmittelalter. Es scheint ein unausrottbares Vorurteil zu sein, dass der Kampf um die Befreiung und Gleichstellung der Frau erst im vorigen Jahrhundert begann und zu nie dagewesenen Ergebnissen in Europa führte. Verantwortlich dafür ist wohl eine Geschichtsschreibung, die der amerikanische Journalist und Satiriker Ambrose Bierce so definiert: „eine meist falsche Darstellung von meist unwichtigen Ereignissen, herbeigeführt von Herrschern, die meist Knechte, und durch Soldaten, die meist Narren waren.“
Die religiöse Frauenbewegung des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts gewährte den Frauen in den Klöstern, aber auch in religiösen Gemeinschaften außerhalb der Klöster selbstständig verantwortetes Handeln bei gleichzeitiger sozialer Geborgenheit und eröffnete ihnen so das Feld für große Leistungen. Als zwei herausragende Beispiele in Deutschland seien nur Mechtild von Magdeburg und Hildegard von Bingen genannt. Diese Frauen sahen die Erfüllung ihres Lebens nicht in der Ehe und im Gebären und wurden dennoch ihres Charakters, ihrer Fähigkeiten und Verdienste wegen in der Gesellschaft hoch geachtet.
In der Politik bot das Spätmittelalter kein Gegenstück zu den großen Regentinnen der Ottonenzeit, den Kaiserinnen Adelheid und Theophanu, aber Lehnsherrinnen und Landesfürstinnen wussten sich auch gegenüber männlichen Politikern durchzusetzen wie die Gräfin Loretta von Sponheim und Anna von Nassau, die Herzogin von Braunschweig-Lüneburg. Die Frauen der Oberschicht waren oft gebildeter als die Männer. An der Universität von Bologna lehrten Professorinnen.
Die Berufstätigkeit der Frauen, noch erleichtert dadurch, dass es keine Trennung von Wohnung und Arbeitsplatz gab, war in der mittelalterlichen Stadt gang und gäbe. In Köln arbeiteten Frauen in fast allen Wirtschaftszweigen. Meisterinnen bildeten Lehrtöchter aus, Kauffrauen machten Geschäfte auf eigenverantwortlicher Gewinn- und Verlustbasis. Frauen waren Weinhändler, Gewürzimporteure, Messinghändler, Stahlimporteure, deren Marktanteile kaum denen der Männer nachstanden. Für Frankfurt am Main wurden fünfundvierzig von Frauen ausgeübte Berufe festgestellt, darunter weltliche Schulmeisterinnen, Zöllnerinnen, Geldwechslerinnen, Aufseherinnen der Stadtwaage. Zwischen 1387 und 1497 konnten in Frankfurt fünfzehn Ärztinnen namentlich nachgewiesen werden, darunter vier jüdische Ärztinnen.
Danach dauerte es fast vierhundert Jahre, bis 1754 wieder eine Frau in Deutschland den medizinischen Doktorgrad erwerben durfte, und das nach unbeschreiblichen Schwierigkeiten und mit königlicher Ausnahmegenehmigung. Die Frau hieß Dorothea Erxleben (1715-1762), der König, der die allergnädigste Genehmigung erteilte, Friedrich II. und die Stadt, wo dies geschah, Halle an der Saale. Dies muss zur Ehre Preußens gesagt werden. Es brauchte dann noch einmal rund einhundertzwanzig Jahre, bis sich 1877 mit Franziska Tiburtius in Berlin eine der ersten Frauenärztinnen Deutschlands niederlassen konnte.
Mit dem „Weiberunwesen“ des Spätmittelalters machten Protestantismus und Calvinismus erst einmal Schluss. Die religiöse Reformbewegung, die in der Neuzeit auf Europa und die Welt die unbestritten bedeutendste und nachhaltigste Wirkung ausübte, kehrte zum patriarchalischen Geist des Alten Testaments zurück. Die Mutter Gottes, die Jungfrau als Trösterin musste einem ernsten und strengen Gott weichen, der den Gehorsam völliger Unterwerfung und Sündlosigkeit forderte. Der Calvinismus mit seiner Prädestinationslehre legte besonderes Gewicht auf ein tugendhaftes Leben. Ständige Aktivität, die einen sittlichen Lebenswandel auszeichnen und Erfolge im Beruf bringen sollte, galt mehr oder weniger als deutliches Zeichen, dass man zu den Auserwählten gehörte. Leistung war Bestandteil der religiösen Lehre und wurde verinnerlicht zu einer Demut und einem Pflichtgefühl, deren Kehrseite Selbstgerechtigkeit und Verachtung für die nicht so Tüchtigen waren. Liebe und Erbarmen, seit jeher Attribute des Mütterlichen, galten nun eher als Schwäche denn als Tugend. „Der unwiderstehliche Zwang zu harter Arbeit“, bemerkte Erich Fromm, „wurde zu einer der grundlegenden Produktivkräfte und war von nicht geringerer Bedeutung für die Entwicklung unseres Industriesystems als Dampfkraft und Elektrizität.“
Der Calvinismus und die lutherische Lehre von Obrigkeit und Gnadenwahl standen Pate bei der Herausbildung des preußischen Staates durch den Soldatenkönig, einen frommen Mann, dem nichts schnell genug ging, der unablässig tätig war, sein gottgefälliges Werk zu vollbringen.