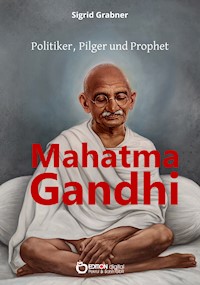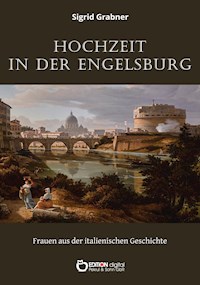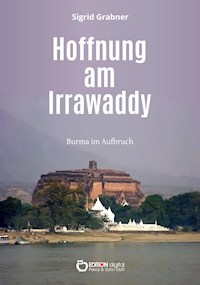7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die 1733 auf Befehl seines Vaters, des „Soldatenkönigs“, erfolgte Eheschließung des späteren preußischen Königs Friedrich II. mit Elisabeth Christine von Braunschweig-Bevern, einer Nichte des Kaisers in Wien, war nichts als eine Scheinehe. Nach dem Tode seines Vaters verbannte er Elisabeth für immer aus seiner Nähe. Stattdessen interessierte sich der König für junge, vorzugsweise großgewachsene „Lange Kerls“, für Flötenmusik und für Windspiele. Und so konnte die 1717 geborene Maria Theresia nur von Glück sprechen, dass ihre vor allem aus politischen Gründen geplante Hochzeit mit dem fünf Jahre älteren Kronprinz Friedrich nicht zustande kam. Die entsprechenden Verhandlungen zwischen dem Wiener und Berliner Hof hatten sich zerschlagen. Die Astrologen, wären sie zu Rate gezogen worden, hätten ohnehin abgeraten. Das Quadrat zwischen der Geburtssonne der Österreicherin und der des Preußen verhieß nichts Gutes für eine eheliche Verbindung: zu unterschiedliche, ja einander ausschließende Charaktere. Daran erinnert die Autorin zu Beginn der Erzählung über Maria Theresia und kommt dann auf die ewigen kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Österreich und Preußen zu sprechen, die mit einer für Maria Theresia überraschenden, geradezu schockierenden Antwort des Kronprinzen an seine Cousine begonnen hatten, als diese den jungen preußischen König um seine Zustimmung zur Kaiserkrönung ihres Gemahls in der Nachfolge Karls VI. bat. Er werde, ließ Friedrich sie wissen, der Cousine jeglichen Beistand leihen und dem geliebten Vetter seine Stimme bei der Kaiserwahl geben, wenn sie ihm dafür die Provinz Schlesien überließe. Gleichzeitig berichtete der österreichische Gesandte in Berlin von Truppenaufmärschen in Richtung Osten. Am 16. Dezember 1740, zwei Monate nach dem Tode Karls VI., marschierten preußische Truppen in Schlesien ein. Was konnte Maria Theresia tun? Wie konnte sie wieder für Frieden sorgen? Der Mut und die Kraft der weiteren hier vorgestellten Frauen aus vier Jahrhunderten erwachsen aus tiefer Not. Matilde von Tuszien bewegt den großen Papst Gregor VII. in den Tagen von Canossa, seinem Erzfeind zu vergeben. Caterina von Siena ermutigt nicht nur einen Papst, sondern auch die Nachwelt zu furchtlosem Handeln. Die als wahnsinnig geltende spanische Königin Johanna hält dem Jesuitenprovinzial Francisco Borja den Spiegel seines Lebens vor. Noch in der Todesstunde führt die Dichterin Vittoria Colonna Michelangelo aus seiner Verzweiflung zu neuer Schaffensfreude.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Sigrid Grabner
Sie machte Frieden
Maria Theresia und andere Erzählungen
ISBN 978-3-96521-665-5 (E-Book)
Umschlaggestaltung: Ernst Franta
Das Buch erschien 2018 bei: Fe-Medienverlags GmbH, Kißlegg.
2022 EDITION digital
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
Sie machte Frieden
Sie hätten ein schönes Paar abgeben und ein Reich des Friedens in Mitteleuropa begründen können: die 1717 geborene Maria Theresia und der fünf Jahre ältere Kronprinz Friedrich. Doch die Verhandlungen zwischen dem Wiener und Berliner Hof zerschlugen sich. Sei es, weil die Verbindung der bedeutendsten Erbtochter Europas mit einem Preußenprinzen den Stolz der Habsburger nicht befriedigt hätte, sei es, weil die vierzehnjährige Maria Theresia entschlossen an ihrer großen Liebe zu dem neun Jahre älteren Herzog Franz Stephan festhielt, der noch ärmer war als der Preußenprinz. Die Astrologen, wären sie zu Rate gezogen worden, hätten ohnehin abgeraten. Das Quadrat zwischen der Geburtssonne der Österreicherin und der des Preußen verhieß nichts Gutes für eine eheliche Verbindung: zu unterschiedliche, ja einander ausschließende Charaktere. Er war ruhmsüchtig, zynisch, von einer spekulativen Intellektualität, hochfahrend, asketisch; sie dagegen auf Bewahrung ausgerichtet, fromm katholisch, pragmatisch, jovial, sinnlich. Auch ihre Gemeinsamkeiten hätten sie gegeneinander aufgebracht. Beide waren unermüdliche Arbeiter, duldeten keine Einmischung in Staatsgeschäfte durch die Familie, führten die Zügel des Staates mit fester Hand. Der Weiberfeind Friedrich den Rat einer Frau auch nur bedenken, niemals! Die Erbin eines Reiches vom Atlantik bis zum Schwarzen Meer dem Diktat eines lieblosen Mannes folgen, ja, sich den Mund verbieten lassen, niemals!
So war es vom Menschlichen her gesehen für beide, vor allem aber für Maria Theresia, ein Segen, dass aus den Heiratsplänen nichts wurde. Friedrich unterwarf sich der Ordre des Vaters und heiratete 1733 Elisabeth Christine von Braunschweig-Bevern, eine Nichte des Kaisers in Wien, um sie nach dem Tode des Vaters für immer aus seiner Gegenwart zu verbannen. Er hielt nichts von Frauen und Fortpflanzung. Auf eine vorsichtig geäußerte Aufforderung, Vater zu werden, erwiderte er: „… wenn ich dieselbe Bestimmung habe wie die Hirsche – die gegenwärtig in der Brunstzeit sind –, so könnte jetzt in neun Monaten geschehen, was Sie mir wünschen. Ich weiß nicht, ob es ein Glück oder ein Unglück für unsere Neffen und Großneffen sein würde; die Königreiche finden immer Nachfolger und es ist ganz ohne Beispiel, dass ein Thron leer geblieben ist.“ Maria Theresias Vater unterwarf sich dem Wunsch seiner Tochter und ließ sie im Februar 1737 den Lothringer Franz Stephan heiraten, nunmehr Großherzog von der Toskana, einen liebenswürdigen, potenten, praktischen Mann, dem jegliche heroische Tugenden abgingen. Maria Theresia liebte ihn abgöttisch und gebar ihm sechzehn Kinder. Er nahm es mit der Treue nicht so genau wie sie. Erst im Alter lernte die temperamentvolle Frau, sich mit seinen Favoritinnen abzufinden, es fiel ihr schwer, aber sie verzieh ihm.
Mit dem Scheitern der offenbar nicht sehr nachdrücklich betriebenen Heiratspläne zwischen den Habsburgern und den Hohenzollern hätte es sein Bewenden haben können. Kein Stolz war verletzt, keine Wunden waren geschlagen worden. Einen Augenblick lang hatte der Traum von einem geeinten deutschen Reich aufgeleuchtet, nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal in der Geschichte, und war wie eine Sternschnuppe am dunklen Himmel verglüht. Maria Theresia genoss ihr Familienglück in Wien und Florenz und Friedrich die Rheinsberger Tage. Sie dankte der Jungfrau Maria für ihren Beistand bei den Geburten der Töchter; er korrespondierte mit Voltaire und schrieb den „Antimachiavell“. Bis 1740 verband sie nichts als ihre Zeitgenossenschaft.
Im Mai dieses Jahres starb im Potsdamer Stadtschloss König Friedrich Wilhelm, der Soldatenkönig, erst 52 Jahre alt. Schon einige Jahre zuvor hatte er bemerkt: „Es liegt mir nichts mehr am Leben, da ich meinen Sohn hinterlasse, der alle Fähigkeiten hat, gut zu regieren. Er hat mir versprochen, dass er die Armee beibehalten wird. Er hat Verstand und alles wird gut gehen.“ Genau ein Jahrhundert nach dem Regierungsantritt des Großen Kurfürsten schickte sich dessen Urenkel Friedrich II. an, Großes zu vollbringen. Durch die harte, ja brutale Schule des Vaters gegangen, von ihm eingewiesen in die Verwaltung und die Struktur des Heeres, bot sich dem ehrgeizigen Schüler endlich die Möglichkeit, seinen Lehrer in den Schatten zu stellen. Von einem Tag auf den anderen warf er die Toga des Friedensfürsten ab und legte für den Rest seines langen Lebens die Uniform an, die er eben noch abfällig als „Sterbekittel“ bezeichnet hatte. Als Cäsar träumte er sich, als Machiavell, den sein Gerede von gestern nicht kümmerte, als Philosoph der Pflicht und des unbedingten Gehorsams.
Wenige Monate nach dem Soldatenkönig starb in Wien der fünfundfünzigjährige Kaiser an einer Erkältung, die er sich bei der Jagd zugezogen hatte. Karl VI. und seiner Frau Elisabeth von Braunschweig-Wolfenbüttel waren Söhne versagt geblieben, nur Maria Theresia und eine jüngere Schwester hatten überlebt. Das Haus Habsburg erlosch in der männlichen Linie.
Von Frauen auf dem Thron hielt das 18. Jahrhundert nichts. Die Zeit der Herrscherinnen in Europa war lange vorbei. Eine Frau, fürchtete Kaiser Karl, würde keiner der Potentaten ernst nehmen, jeder würde versuchen, das Haus Habsburg zu plündern und seinen Ruin herbeizuführen. Und so hatte der besorgte Herrscher und Vater geglaubt, die meiste Zeit seiner Regierung damit zubringen zu müssen, der Tochter Maria Theresia das Erbe auf juristischem Wege zu sichern. In der „Pragmatischen Sanktion“ bestimmte er die Unteilbarkeit der habsburgischen Länder und legte die weibliche Erbfolge fest. Nach langen schwierigen Verhandlungen mit den europäischen Fürsten, die ihm Zugeständnisse, Gebiete, Privilegien abverlangten, erhielt er ihre Zustimmung für das Papier. Die Regelung der Erbfolge nahm ihn so in Anspruch, dass er darüber das Erbe vernachlässigte. Staat und Armee hinterließ er in einem maroden Zustand und die Erbin in vollkommener Ahnungslosigkeit politischer Geschäfte. Nur Unterschriften, die das Papier nicht wert waren, auf dem sie standen. Maria Theresia schrieb über ihre Situation beim Tod des Vaters: „Da sich der unvermutete betrübliche Todesfall meines Vatters höchstseliger Gedächtnüs ereignet und vor mich umb so viel mehr schmerzlich wäre, weilen nicht allein selben verehret und geliebet als einen Vattern, sondern als wie die mindeste Vasallin als meinen Herrn angesehen und also doppelten Verlust und Schmerzen empfunden und damahlen die zur Beherrschung so weit schichtiger und verteilter Länder erforderliche Erfahr- und Kenntnüs umb so weniger besitzen können, als meinem Herrn Vattern niemals gefällig wäre, mich zur Erledigung der auswärtigen noch inneren Geschäften beizuziehen noch zu informieren; so sähe mich auf einmal zusammen von Geld, Truppen und Rat entblößet.“
Die dreiundzwanzigjährige Maria Theresia verlor in diesem Jahr 1740 nicht nur den Vater, sondern auch die erste ihrer drei Töchter. Mit dem vierten Kind ging sie schwanger. Und sie übernahm ein Amt, auf das sie nicht vorbereitet war. Aber sie vertraute auf ihren Mut und Gottes Hilfe. In Friedrich hätte sie zuletzt einen Gegner vermutet. Hatte sich nicht ihr Vater für den Kronprinzen eingesetzt, als ihm in Küstrin die Todesstrafe drohte, ihn heimlich finanziell unterstützt? So bat sie den jungen Preußenkönig herzlich um seine Zustimmung zur Kaiserkrönung ihres Gemahls in der Nachfolge Karls VI. Zwar besagte der Kaisertitel nicht mehr viel, aber mit dem Glanz, der ihn von altersher umstrahlte, wollte Maria Theresia ihren geliebten Franzl für seine politische Bedeutungslosigkeit entschädigen. Denn so gut kannte sie ihn, dass er sich weder als Regent noch als Feldherr eignete, in die Regierung würde sie sich nicht von ihm hineinreden lassen.
Die Antwort aus Berlin schockierte sie. Er werde, ließ Friedrich sie wissen, der Cousine jeglichen Beistand leihen und dem geliebten Vetter seine Stimme bei der Kaiserwahl geben, wenn sie ihm dafür die Provinz Schlesien überließe. Gleichzeitig berichtete der österreichische Gesandte in Berlin von Truppenaufmärschen in Richtung Osten. Maria Theresia konnte und wollte nicht glauben, dass Friedrich sie angreifen könnte, wenn sie seine angebotene „Hilfe“ ausschlug.
Am 16. Dezember 1740, zwei Monate nach dem Tode Karls VI., marschierten preußische Truppen in Schlesien ein. Friedrich schrieb zwei Jahre später über seine Gründe: „Beim Tode meines Vaters fand ich ganz Europa in Frieden … Die Minderjährigkeit des jungen Zaren Iwan ließ mich hoffen, dass Russland sich mehr um seine inneren Angelegenheiten bekümmern würde als um die Garantie der Pragmatischen Sanktion. Außerdem war ich im Besitz schlagfertiger Truppen, eines gut gefüllten Staatsschatzes und von lebhaftem Temperament; das waren die Gründe, die mich zum Kriege mit Therese von Österreich, Königin von Böhmen und Ungarn bewogen … Der Ehrgeiz, mein Vorteil, der Wunsch, mir einen Namen zu machen, gaben den Ausschlag und der Krieg ward beschlossen.“ Beiseitegeschoben die Bitte des Vaters im Testament: „Mein lieber Succeßor bitte ich umb Gottes willen kein ungerechten krihg anzufangen und nicht ein agressör sein den Gott die ungerechte Kriege verboten.“ Friedrich dürstete nach Ruhm, der jungen Frau auf dem Thron traute er keine Herrscherqualitäten zu, von ihrem Mann, den er von einem Besuch in Potsdam kannte, erwartete er keinen großen Widerstand.
Auch nach dem Einmarsch in Schlesien blieb er bei seiner Rolle als Friedensretter und hilfreicher Freund. Als Maria Theresia die Verhandlungen mit dem hochmütigen preußischen Gesandten Gotter am 12. Januar 1741 durch Franz Stephan mit den Worten abbrechen ließ: „Kehren Sie zu Ihrem Herrn zurück und sagen Sie ihm: Solang er noch einen einzigen Mann in Schlesien stehen hat, werden wir lieber untergehen als mit ihm verhandeln“, schrieb Friedrich eigenhändig an ihren Gemahl, denn nur ihm traute er politische Sachkenntnis zu: „Mein Herr Vetter, ich habe mit wirklichem Ärger gesehen, dass Ihre Königliche Hoheit so schlecht meine Freundschaftsbezeugungen aufgenommen hat und trotz der Gerechtigkeit meiner Ansprüche auf Schlesien keine Rücksicht darauf nehmen wollte. Ich gestehe, ich bin verzweifelt, in die Notwendigkeit versetzt zu sein, gegen einen Prinzen, dessen festeste Stütze ich sein wollte, als Feind aufzutreten. Ich möchte unschuldig sein für die Folgen der schlechten Auslegung meiner Absichten. Aber ich werde verpflichtet sein, meine Maßnahmen zu ergreifen und gegen einen Prinzen vorzugehen, den ich liebe und den ich schätze und für den mein Herz immer schlagen wird, auch wenn ich gegen ihn agieren muss.“
Diese Haltung der verfolgten Unschuld behielt Friedrich ein Leben lang bei. Auf Worte verstand er sich trefflich. Sein Vater hatte ihn einmal in Bezug auf seine Geschwister gewarnt: „Wenn du Herr bist, wirst du sie alle betrügen, das kannst du nicht lassen. Du bist von Natur falsch und betrügerisch. Sieh dich vor, Friedrich! Betrüge sie beim ersten Mal gründlich, denn ein zweites Mal wird es dir nie gelingen.“ Friedrich beherzigte diesen Ratschlag.
König Ludwig XV. von Frankreich rief beim Eintreffen der Nachricht von Friedrichs Einmarsch in Schlesien aus: „Das ist ein Narr! Der Mensch ist verrückt!“ Auch das übrige Europa entsetzte sich über den jungen preußischen König, der mit einer Skrupellosigkeit ohnegleichen Verträge brach und seinen Ruf als aufgeklärter Friedensfürst ruinierte. Der Grundstein für ein die Jahrhunderte überdauerndes Misstrauen gegen Preußen war gelegt, bis man schließlich Hitler für einen Preußen und Beethoven für einen Österreicher hielt.
Achtzigtausend Soldaten hatte Friedrich Wilhelm hinterlassen, im selben Jahr vermehrte Friedrich, von dem man angenommen hatte, er würde sein überdimensioniertes Heer auf die Hälfte vermindern, es noch einmal um zehntausend, bis es die Zahl von hundertfünfunddreißigtausend Mann erreichte. Und das bei einer Bevölkerungszahl von zwei Millionen Menschen!
Im Jahrhundert der Erbfolgekriege, vorgeschobener Gründe für militärische Geplänkel, endlosen Taktierens um ein paar Quadratkilometer Land wogen gebrochene Versprechen und Heuchelei nicht allzu schwer, man nutzte seine Vorteile gern und geschickt. Aber was sich jetzt vor den Augen Europas abspielte, versetzte nicht nur Maria Theresia in Schrecken. Aus der märkischen Streusandbüchse erstand ein feuerspeiender Drache, bereit, alles in Brand zu stecken und sorgfältig austariertes politisches Gleichgewicht zu zerstören. Österreich, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Russland, das osmanische Sultanat, jeder dieser Staaten war Preußen an Bevölkerungszahl weit überlegen, aber keiner von ihnen unterhielt im Verhältnis dazu ein so großes Heer. Das weitaus größere Österreich konnte den neunzigtausend preußischen Soldaten höchstens achtzigtausend entgegenstellen und die meisten waren fernab von Schlesien stationiert.
Für Maria Theresia war Friedrich seit jenem Winter 1740/41 „der böse Mann von Berlin“, „das Ungeheuer“, dessen Worten man nicht trauen dürfe, sie warnte vor seiner Falschheit, seiner Macht, die sich nie mit dem Erreichten zufrieden geben würde. 1741 starb die zweite Tochter der jungen Königin, im Mai entband sie ihr viertes Kind, den Thronfolger Joseph. Vom Westen her drangen nun auch die Bayern zusammen mit den Franzosen in ihre Erblande ein. Friedrich hatte zur Jagd geblasen und nach dem ersten Schock schloss sich Europa der Hatz auf das verlockende Wild an. Nur von England konnte Österreich finanzielle Unterstützung erhoffen. Inmitten furchtsamer, noch vom Kaiser übernommener Berater, unentschlossener Generäle und des zu Kompromissen neigenden Gemahls erwies sich die bedrängte Maria Theresia als einziger Mann und nahm die Herausforderung an. Auf ihre Weise. Mit Charme, beseelter Rhetorik, mitreißender Tapferkeit, unter Tränen warb sie bei den ungarischen Adligen, bei den böhmischen Ständen, im Volk um Unterstützung. Sie ermutigte, forderte, versicherte sich der Hilfe fähiger Männer, arbeitete sich in die Regierungsgeschäfte und die Diplomatie ein; ihr größtes Kapital aber blieben ihr gesunder Menschenverstand, Menschenkenntnis, Gottvertrauen und Mut.
Ihr Gegner spottete. Maria Theresias kindlich festen Glauben an Gott hielt Friedrich für unzeitgemäß und dumm. Nach der gewonnenen Schlacht von Mollwitz im April 1741 wählte er für den Dankgottesdienst die Worte des Paulus an Timotheus aus: „Ein Weib lerne in der Stille in aller Untertänigkeit. Einem Weibe aber gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie des Mannes Herr sei, sondern stille sei.“
Friedrich bekam, was er wollte, auch ohne Gebet. Im Frieden von Breslau im Juni 1742 musste Österreich Schlesien an Preußen abtreten. Das Haus Habsburg war beraubt worden, aber es hielt stand. Mit einer Energie ohnegleichen ging Maria Theresia nun daran, ihr Haus in Ordnung zu bringen. Sie leitete Reformen des Heeres, der Wirtschaft, Finanzen, Verwaltung, Justiz, des Schulwesens nach preußischem Vorbild ein. Nichts entging ihrer Aufmerksamkeit. Was war das Gemeinwesen denn anderes als eine Familie, die nur prosperierte, wenn sich die Einzelnen wohlfühlten!
Nur zwei Jahre nach dem Frieden von Breslau fiel Friedrich ein zweites Mal in ihre Lande ein, diesmal in Böhmen. Österreich, wegen Lothringen in einen Krieg mit Preußens Verbündetem Frankreich verwickelt, bot im Osten eine freie Flanke. Doch die österreichischen Truppen erwiesen sich diesmal als unerwartet geschickt, England, Russland und Sachsen-Polen standen auf der Seite Habsburgs. Das böhmische Debakel ließ Friedrich den Wahnsinn eines Krieges beklagen, den er selbst angezettelt hatte. Nach dem Frieden von Dresden im Dezember 1745, der Friedrich den Besitz Schlesiens bestätigte und in dem er nachträglich der Wahl von Franz Stephan zum Kaiser zustimmte, rief Friedrich aus: „Künftig greife ich keine Katze mehr an, außer um mich zu verteidigen!“
Doch der homo novus, der Emporkömmling, fühlte sich seiner Sache niemals sicher. Selber im höchsten Grade misstrauisch, aggressiv, ruhmsüchtig, projizierte er diese Eigenschaften auf Maria Theresia. Er verzieh ihr nicht, dass er sie überfallen hatte. Bei seinen Tafelrunden, an denen wie einst beim Tabakkollegium seines Vaters nur Männer teilnahmen, zog er über die „drei ersten Huren Europas“ her, womit er Zarin Elisabeth, Madame Pompadour und Maria Theresia meinte. Einen französischen Besucher forschte er über das Herrscherpaar in Wien aus: „Möchte man nicht sagen, dass die Frau als Mann verkleidet ist und der Mann als Frau? Wenigstens hat der Kaiser das Benehmen eines guten ehrlichen Hausmeiers, der seiner Gattin alles überlässt.“ … „Sie muss eine eigenartige Frau sein und mehr männlich als frauenhaft. Macht sie einen vielbeschäftigten Eindruck?“
Der Franzose wunderte sich über die seltsame Vorstellung. Nein, Maria Theresia sei ganz Frau und lasse den Reiz ihres Geschlechts nicht ungenutzt, um zu bezaubern. Sie verfüge über Mut, Charakterstärke und eine ausgesuchte Höflichkeit gegen jedermann. Sie arbeite von früh bis spät und sie würde große Dinge vollbringen, wenn ihre Minister sie besser unterstützten.
Für Friedrich blieb Maria Theresia unverständlich wie ein Wesen von einem anderen Stern. Eine Regentin, die Kind auf Kind gebar, ein glückliches Familienleben führte, nicht mit dem Stock regierte, sondern mit Charme, Verstand und Fleiß, deren Frömmigkeit echt war und die sich doch nicht von der Kirche in ihre Geschäfte hineinreden ließ. Nur in einem glaubte er sie richtig einschätzen zu können: dass sie an nichts anderes dachte, als Schlesien wieder in ihren Besitz zu bringen.
Natürlich verlor Maria Theresia Schlesien nicht aus dem Auge. In Verein mit ihrem Berater Graf Kaunitz, einem Mann von ebenso schwierigem Charakter wie hoher diplomatischer Begabung, gelang ihr das Kunststück, ein Bündnis mit dem bisherigen Erzfeind Frankreich zu schmieden. Worauf Friedrich nichts anderes einfiel, als zum dritten Mal innerhalb von sechzehn Jahren einen Angriffskrieg zu wagen. Im August 1756 marschierten seine Truppen in das von ihm zum Feind erklärte Königreich Sachsen ein, um sich eine geeignete Ausgangsbasis für weitere Feldzüge gegen Österreich zu schaffen. Ein entsetzlicher, sieben Jahre währender Krieg begann, den Friedrich diesmal allein gegen die europäischen Großmächte Russland, Österreich, Frankreich und Schweden führte. Den 150 000 Soldaten eines Vier-Millionen-Volkes (einschließlich Schlesien) standen 300 000 Soldaten der Alliierten mit einer Bevölkerungszahl von mindestens achtzig Millionen gegenüber. Im Verlaufe dieses Krieges wurde Berlin kurzzeitig von den Österreichern und Russen besetzt, mehr als einmal hing Friedrichs Schicksal am seidenen Faden. In Preußen und Sachsen herrschten Zustände wie im Dreißigjährigen Krieg. Friedrich beklagte wortreich das Elend der vom Krieg betroffenen Menschen, ihn zu beenden, reichte sein Mitgefühl nicht. Er wollte siegen oder sterben. Schlesien würde er niemals zurückgeben, niemals!
„Hat man je gesehen“, schrieb er in Verkehrung aller Tatsachen seiner Schwester Wilhelmine, „wie drei mächtige Fürsten ein Komplott schmieden, um einen vierten zu vernichten, der ihnen nichts getan hat? Ich habe weder mit Frankreich noch mit Russland und am allerwenigsten mit Schweden Differenzen gehabt. Ich bin in der Lage eines Reisenden, der sich von einem Haufen Schurken umringt und im Begriff sieht, ermordet zu werden, weil die Räuber seinen Besitz unter sich verteilen wollen.“ Der Angreifer flüchtete sich in die Rolle des bedauernswerten Opfers.
Friedrich hetzte seine Truppen von einem Ort zum anderen, siegte hier, verlor dort. In den Kampfpausen entspannte er sich mit dem Verfassen giftiger Pamphlete über seine Gegner Ludwig XV., Maria Theresia und die Zarin Elisabeth, die er den Vielgeliebten, das apostolische Rabenaas und die griechische Hure nannte. „Solange ich atme, werde ich mich lustig machen über diese Leute, die so erbittert über mich sind. Wenn ich sie nicht schlagen kann, so will ich sie wenigstens verlästern und in Wut versetzen, so sehr ich es vermag. Diese zweibeinigen ungefiederten Geschöpfe … sind aus Torheiten und Lächerlichkeiten zusammengeknetet“, bemerkte er im Feldlager zu seinem Vorleser Henri de Catt. Dann wieder sprach er von Selbstmord. „Entweder lasse ich mich unter den Trümmern meines Vaterlandes begraben oder ich beende mein Unglück, wenn es nicht mehr möglich ist, es zu ertragen. Ich bin fest entschlossen, in diesem Feldzug alles zu wagen und die verzweifeltsten Dinge zu unternehmen, um zu siegen oder ein ehrenvolles Ende zu finden.“
Es war die Haltung eines Spielers, die Maria Theresia völlig fremd war. Von dieser Art Heroismus hielt sie nichts. Friedrich setzte alles auf eine Karte. Als Ende 1761 für ihn alles verloren schien, ereignete sich das „Mirakel des Hauses Brandenburg“. Zarin Elisabeth starb und ihr Nachfolger Peter III., ein Bewunderer Friedrichs, schloss sofort Frieden mit Preußen. Der Krieg schwelte noch eine Weile vor sich hin, bis im Februar 1763 auf dem sächsischen Jagdschloss Hubertusburg ein Erschöpfungsfrieden auf der Grundlage des Status quo ante geschlossen wurde. Kein Staat hatte Gebietsgewinne erzielt. Maria Theresia musste sich ein drittes Mal mit dem Verlust Schlesiens abfinden. Während die Kontinentalmächte einander zerfleischten, hatte England sich mit ein paar Hilfsgeldern für Preußen aus der Sache herausgehalten, derweilen Frankreich in Übersee Kolonien abgejagt und war zur ersten Kolonialmacht der Welt aufgestiegen. Preußen hingegen galt endgültig als europäische Großmacht.
Der Krieg hatte Friedrich erschöpft und vor der Zeit altern lassen. Als ein mürrischer, die Welt und die Menschen verachtender Mann kehrte er nach Berlin zurück. Misstrauisch nach wie vor, immer nach Gelegenheiten Ausschau haltend, seinen Besitz „abzurunden“, was ihm dann auch bei der Teilung Polens gelang, und im Übrigen sich der Verwaltung seines Landes und dem Flötenspiel widmend.
Auch Maria Theresia war erschöpft. Die dreiundzwanzig besten Jahre ihres Lebens hatte sie sich mit dem Preußenkönig kriegerisch auseinandersetzen müssen. Europas Jugend bewunderte ihn nun als Helden und vergaß darüber, was er angerichtet hatte. Ihr hingegen blieb nur die bittere Erkenntnis, vergeblich das Blut ihrer Untertanen geopfert zu haben. Schlesien war endgültig verloren, die Vormachtstellung Österreichs im Deutschen Reich dahin. Der schwerste Schlag traf sie anderthalb Jahre später. Während eines Aufenthaltes in Innsbruck starb plötzlich ihr geliebter „Franzl“. Franz Stephan war die ruhige Mitte ihres Lebens und der Familie gewesen, ihr engster Vertrauter, wenn auch nur aufs Zuhören beschränkt, ihr geschickter Vermögensverwalter, ein Mann von Takt, Würde und Noblesse. Von nun an legte die Achtundvierzigjährige ihre Witwentracht nicht mehr ab und wurde, was ihrem Wesen zutiefst entsprach – „ihrer Länder allgemeine und erste Mutter“. Der Wahlspruch der Habsburger „Bella gerant alii, tu felix Austria nube“ (Mögen andere Krieg führen, du glückliches Österreich heirate) schien ihr auf den Leib geschrieben. Heiraten sollten die Kinder, um das Ansehen und den Besitz der Monarchie zu mehren, nicht Kriege führen.
Maria Theresias Mitregent seit dem Tode von Franz Stephan, der Thronfolger Joseph, sah das anders. Der innerlich unsichere, hochfahrende und oft taktlose junge Mann bewunderte den Preußenkönig glühend, ein Aufklärer und Rationalist wie er wollte er sein. Vergeblich die Vorhaltungen der Mutter: „Hat dieser Heros, der so viel von sich reden macht, hat dieser Eroberer einen einzigen Freund? Muss er nicht aller Welt misstrauen? Welch ein Leben, aus dem Menschlichkeit verbannt ist!“ „So ist dieser große Mann, den man für einen Salomo ausgibt; wenn man ihn nur sorgfältig und ununterbrochen beobachtet, ist er recht klein und ein bloßer Scharlatan, den Gewalt und sein Glück schirmt.“ Sie redete ins Leere. Nun, da der „böse Mann“ in Berlin Ruhe gab, erwuchs ihr in dem nach politischen und militärischen Großtaten lechzenden Thronfolger das Kreuz der letzten anderthalb Jahrzehnte ihres Lebens. Friedrichs Schatten blieb über ihr. Bis zur Selbstverleugnung widerstand sie den Kriegsgelüsten des Sohnes. Zwei Jahre vor ihrem Tod verhinderte sie einen größeren Waffengang zwischen Österreich und dem erneut in Böhmen eingefallenen Friedrich, indem sie ohne Wissen Josephs einen geheimen Unterhändler zu Friedrich schickte, sich selber demütigte und den geliebten Sohn bloßstellte, allein um des Friedens willen.
Maria Theresia und Friedrich sind einander nie persönlich begegnet. Nie fand der Preußenkönig auch nur ein Wort des Bedauerns über den frechen Raub Schlesiens und seine furchtbaren Folgen. Und niemals konnte die sonst so großherzige Habsburgerin ihm diesen Raub verzeihen. „Nicht, dass ich etwa unversöhnlich gegen ihn wäre, aber die Abneigung wurzelt in den gemachten Erfahrungen. Ich besorge, und nicht ohne Grund, dass ich mich niemals sicher fühlen kann, solang dieser König so mächtig ist wie jetzt.“ Sie sprach ihm seine Fähigkeiten nicht ab, gestand ihm Scharfsinn, eine umfassende Begabung und unausgesetzte Beschäftigung mit den Regentenpflichten zu, aber die Leichtigkeit, mit der er ein gegebenes Wort brach, sein Zynismus und seine Menschenverachtung waren ihr tief zuwider.
Auch Friedrich versuchte, dem „apostolischen Rabenaas“ Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Zu seinem Vorleser Henri de Catt sagte er: „Trotz des Üblen, das sie mir zugefügt hat, muss ich zugeben, dass diese Fürstin sehr achtenswert ist durch ihre Sittenreinheit. Es gibt wenige Frauen, welche ihr in dieser Hinsicht gleichen; die meisten sind Huren und die Königin verabscheut Huren … Sie ist sehr strebsam und hat Talente auf mehr als einem Gebiet.“ Nach ihrem Tod am 29. November 1780 schrieb er sogar in einem Brief nach Frankreich: „Ich habe den Tod der Kaiserin-Königin bedauert; sie hat ihrem Thron und ihrem Geschlecht Ehre gemacht; ich habe mit ihr Krieg geführt, aber ich war nie ihr Feind.“
Es war ein Protestant aus dem hohen Norden, der Dichter Matthias Claudius, der Maria Theresia ein aufrichtiges und eigentlich das schönste Lob zollte, als er der katholischen Herrscherin in der Hamburgischen Neuen Zeitung die Worte nachrief:
Sie machte Frieden! Das ist mein Gedicht,
War ihres Volkes Lust und ihres Volkes Segen
Und ging getrost und voller Zuversicht
Dem Tod als ihrem Freund entgegen.
Ein Welteroberer kann das nicht.
Sie machte Frieden! Das ist mein Gedicht.
Gäste in Sanssouci
17. August 1991
In der Dämmerung unterscheiden meine schwachen Augen nur noch Umrisse. Bäume und Gebüsch sind vor den Fenstern zu einer Wildnis gewachsen, durch die kein Sonnenstrahl mehr dringt. Vom Kanal her höre ich es manchmal lärmen, wahrscheinlich keifen die Fischweiber. Dann wieder das Rumpeln eines Wagens. Aber meistens dringt kein Laut in meine Einsamkeit. Ich weiß nicht, wie lange ich schon in dieser Abgeschiedenheit zubringe – Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte? Das Zeitgefühl ist mir abhandengekommen. Irgendwo da draußen läuft das Leben vorbei, ohne bei mir einzutreten oder mich hinauszulocken. Das bekümmert mich nicht, denn ich habe alles, was ich brauche. Ich leide weder Hunger noch Durst noch verspüre ich Kälte oder Hitze. Wenn es denn ein Warten auf ich weiß nicht was sein sollte, das mich an diesen Raum fesselt, so ermüdet es nicht. Verloren in Erinnerungen, von denen ich oft nicht weiß, ob es meine eigenen oder angelesene sind, verschmelzen Tage und Nächte zu einer Dämmerung, auf die kein Licht folgt und kein Dunkel.
Seit dem Tod meiner geliebten Frau Ulrike habe ich keinen Fuß mehr vor die Tür gesetzt. Damals stand ich neben dem offenen Grab auf dem Bornstedter Friedhof, aber niemand kondolierte mir. Seit ich bei Hofe in Ungnade gefallen war, Überboten sich die Schranzen und ihr Anhang in der Kunst, durch mich hindurchzusehen. Das schmerzte, aber ich glaubte, mich daran gewöhnt zu haben. Dass nun selbst der Pfarrer und Ulrikes Verwandten so taten, als sei ich Luft, verstörte mich. Den Verdacht, ich sei längst gestorben und hatte es nur nicht bemerkt, verwarf ich sofort wieder. Konnte denn ein Geist solche Pein empfinden? Ich lief vom Friedhof durch die Felder hinüber zum Heiligen See und gedachte an seinem Ufer der glücklichen Zeiten mit Ulrike. Jeder Atemzug, jeder Seufzer entfachte meinen Schmerz heftiger. Da meine gestöhnten Klagen mich nicht erleichterten, flüchtete ich mich in Anklagen. Mit Ulrike hatte Gott mir den letzten Menschen genommen, dem ich vertrauen konnte. Alles hatte ich bisher ertragen, die Ungerechtigkeit, den Verlust von Freunden, Krankheiten, Verrat und Demütigungen. Doch wenn ich Ulrikes leichten Schritt vernahm, lösten sich meine Zweifel an Gottes Güte und Gerechtigkeit wie Nebel vor der Sonne auf. Ihretwegen hatte ich einst die heimischen Schweizer Berge gegen den märkischen Sand eingetauscht und mich hier so verwurzelt, dass selbst die Ungnade des Königs mich nicht mehr vertreiben konnte. Ulrikes Tod aber traf mich wie der Sturm einen altersmüden Baum, er riss mich aus dem Erdreich. Nun war ich nirgendwo mehr zu Hause.
Nie zuvor hatte ich mich so vergessen, dass ich Gott lästerte. In nahezu wilder Lust stieß ich eine Verwünschung nach der anderen aus, hoffend, dass die Erde sich auftun und mich verschlingen würde. Doch unbewegt spiegelte der See einen heiteren Sommerhimmel wider. Ich war so außer mir, dass ich beschloss, mich und mein Leid zu ertränken. Als ich ins Wasser lief, kräuselte eine Brise die Oberfläche des Sees. Doch das Schilfrohr, das sonst bei jedem Hauch erzittert, regte sich nicht und nur fahl noch zeigte sich die Sonnenscheibe zwischen grauen Wolken. Anstatt in der Tiefe zu versinken, schritt ich trockenen Fußes auf einer von offensichtlich unbewohnten Häusern gesäumten Straße dahin. Kein Baum spendete Schatten, keine Blume erfreute das Auge. Durch einen Säulengang gelangte ich schließlich zu einem Schloss. Da niemand mir den Zutritt verwehrte, stieg ich die grauen Marmortreppen empor, irrte durch menschenleere verwahrloste Räume, bis ich den Thronsaal erreichte. Unter dem mächtigen Baldachin hockte eine zusammengesunkene Gestalt. Während ich mich beklommen näherte, erkannte ich einen uralten Mann. Die Kleidung, die nur noch entfernt an vergangene Pracht erinnerte, hing in Fetzen an ihm herunter. In seinen Augen flackerte der Wahnsinn und das Grauen, ihm ausgeliefert zu sein.
Sein Anblick erfüllte mich mit Mitleid, doch als er den Arm nach mir ausstreckte, schüttelte mich blankes Entsetzen. Ich stürzte Hals über Kopf davon.
Am Ufer kam ich wieder zu mir. Reglos wie zuvor träumte der See unter dem weiten Himmel. Es muss mein eigenes Spiegelbild gewesen sein, das mich so erschreckt hatte. Wieder stieg in mir der Verdacht auf, ich sei tot, lange vor Ulrike gestorben. Aber warum traf ich sie nicht wieder, wo war sie?
Ein Schmetterling ließ sich an einem Schilfrohr nieder. Rhythmisch faltete und öffnete er die Flügel, als sende er Signale aus. Ein zweiter gesellte sich ihm zu. Sie umkreisten sich, flogen auf und nieder. Schneller und wilder wurde ihr Tanz, immer höher stiegen sie gen Himmel, bis sie meinem Auge entschwanden. Irgendwo hatte ich einmal das Jesuskind mit einem Schmetterling als Symbol der Auferstehung und Unsterblichkeit dargestellt gesehen. Die Vorstellung, die beiden Schmetterlinge wären Ulrikes und meine Seelen gewesen, beglückte mich. Ich dankte Gott für sein Zeichen.
Dem Heiligen See bewahre ich seither große Dankbarkeit, er hat mich von Hoffart und Selbstmitleid geheilt. In Gedanken sitze ich oft an seinem Ufer, betrachte den Flug der Schmetterlinge und das Spiel der Libellen im Schilf, verfolge den Tanz der Wellen, erfreue mich an aufgetürmten Wolkengebirgen, aber ich hüte mich, das Geheimnis seiner Tiefe erkunden zu wollen. Was soll mir die Sage, in seinen Fluten wäre einst eine Stadt versunken, und an seinen Ufern hätten die Heiden in feierlichen Riten ihre Toten bestattet? Kann sein, kann nicht sein, ich bin als reformierter Christ geboren und als solcher will ich in Gottes Herrlichkeit eingehen, wenn Er die Zeit endlich für gekommen hält.
Nach meinem Rückzug aus der Welt habe ich mich oft gefragt, warum Gott mich nicht zu sich nimmt und so tut, als habe er mich vergessen. Ich suchte nach dem Sinn eines langen Lebens, das doch in der Welt nichts mehr bewirken kann. Zuerst gab ich mich der Hoffnung hin, es sei mir bestimmt, für mein Werk über die Gespräche mit dem großen Friedrich noch schriftstellerischen Ruhm zu ernten. Aber das Manuskript lag verstaubt in irgendwelchen Regalen. Niemand hat mich all die Jahre je nach meinen Erfahrungen und Erinnerungen gefragt, geschweige denn nach meinem Werk.
Dann hoffte ich auf Rehabilitation meines Rufes durch den Hof. Doch keiner der Nachfolger des großen Friedrich, wer es auch sein mochte, erklärte öffentlich, dass ich zu Unrecht beschuldigt und verstoßen worden bin. Vergeblich wartete ich auf die Kutsche, die mich im Triumph ins Schloss zurückbringen würde.
Schließlich wartete ich nur noch auf die Rückkehr meines Sohnes aus Amerika. Allen Ernstes nahm ich an, Gott ließe mich so lange leben, damit ich meinen Sohn noch einmal umarmen könnte und dadurch für alle Enttäuschungen dieses Lebens entschädigt werden würde. Nach und nach starb eine Hoffnung nach der anderen. Ich hörte auf, nach dem Sinn meines Daseins zu fragen.
Das Geschrei der Fischweiber, die vorbeirumpelnden Kutschen, die Stimmen spielender Kinder verschmelzen zu einem Klangteppich, der mich immer wieder davonträgt – ins alte Griechenland, ins imperiale Rom und sogar auf den neuen Kontinent Amerika. Schneller als der Wind bin ich mal hier, mal dort, kein Gipfel ist mir zu hoch, kein Meer zu weit und gefährlich. Ich unterscheide nicht zwischen Wachen und Schlafen, zwischen Tag und Nacht, ich frage nicht mehr, was war und was sein wird.
Woher rührt der Schmerz, der mich so plötzlich anfällt? Gleißendes Licht blendet die an den ewigen Dämmer gewöhnten Augen. Wie eine Assel, der man plötzlich den Schutz des bergenden Steins nimmt, suche ich Zuflucht in einer dunklen Ecke. Allmählich erkenne ich die Konturen eines halbwüchsigen Burschen, der mitten im Zimmer steht, dann auch sein Gesicht. Für einen Moment glaube ich, mein Sohn Alexander sei endlich gekommen. Ich gehe auf ihn zu, er streckt mir die Hand entgegen, auf der ein Schmetterling seine Flügel entfaltet. „Er will fliegen“, ruft er, „öffne das Fenster!“
Ein ausnehmend schöner Jüngling, aber es ist nicht Alexander. Niemals hätte Ulrike ihn in so einem Aufzug herumlaufen lassen: mit geflickten Hosen, einem bunten Etwas als Hemd und kurzgeschorenen Haaren. Widerwillig begebe ich mich ans Fenster, das sich ohne mein Zutun öffnet. Bäume und Sträucher, die mich vor der Welt und die Welt vor mir verborgen hatten, sind verschwunden. Mein Blick folgt dem Schmetterling, der in einen Himmel von überwältigendem Blau aufsteigt. Die Helle und Weite machen mich schwindlig, als hätte ich Wein auf nüchternen Magen getrunken. Ich spüre etwas Bedrohliches auf mich zukommen, das meine so hart erkämpfte Ruhe zerstört. Während ich nach Vorhängen suche, mit denen ich das Licht abwehren kann, befehle ich dem ungebetenen Besucher, den Raum zu verlassen. Der Jüngling rührt sich nicht von der Stelle. Lächelnd sagt er: „Der König hat mich geschickt.“
Was soll das für ein König sein, der sich der Dienste eines hergelaufenen Straßenjungen versichert?
„Lass ab von deinem Hochmut“, tadelt der Jüngling, als könne er Gedanken lesen. „Der König, dem ich diene, macht sogar den Wind zu seinem Boten. Warum schaust du auf meine Kleider und nicht auf mein Herz?“
Was führt er für eine verwegene Sprache! Einem alten Mann wie mir sollte der Bursche mehr Respekt erweisen. Aber er weckt meine Neugier.
„Was will der König von mir?“, frage ich.
„Er wird heute beerdigt und möchte dich vorher noch sprechen.“
„Lebt er denn noch?“
Der Jüngling zuckt unbestimmt mit den Schultern.
Ich weiß nicht, was ich von der Sache halten soll. Ein König, der noch lebt, und er muss leben, wenn er mich zu sich ruft, aber er muss auch tot sein, wenn man ihn zu Grabe trägt. Ein Lebender, der zugleich tot ist? Ein Toter, der zugleich lebendig ist? Ich habe es geahnt, dass der Besucher mir Unannehmlichkeiten bringt. Am liebsten würde ich ihn vor die Tür setzen, aber meine schwachen Kräfte reichen dazu wohl nicht aus. Ich scheine ihm ausgeliefert zu sein und so füge ich mich in die Situation.
„Welcher König ruft mich denn?“, frage ich. „Etwa der dicke Friedrich Wilhelm, der Sohn des unglücklichen August Wilhelm, der Nachfolger Friedrichs? Es würde mich nicht wundern. Ich habe den Mann gemocht, obwohl er dem schönen Geschlecht und den okkulten Wissenschaften zu große Ehre erweist.“
„Lass Wilhelm in Frieden ruhen“, fällt mir der Jüngling ins Wort. „Friedrich, zu seiner Zeit und bis heute genannt der Große, wird zu Grabe getragen.“
Was spricht der Bursche nur für wirres Zeug! Ich bin höchstselbst dem Trauerzug für Friedrich, angeführt von seinem Thronerben Friedrich Wilhelm II., zur Garnisonkirche gefolgt. Das ist zwar eine Ewigkeit her, aber ich erinnere mich noch genau daran. Warum sollte man Friedrich ein zweites Mal begraben?
„Traurig sein hat keinen Zweck, Grieneisen schafft die Leiche weg“, lässt sich mein Besucher vernehmen. Was für ein seltsamer, makabrer Vers!
„Wer, bitte, ist Grieneisen?“, frage ich widerwillig.
„Der Leichenbestatter, der beauftragt ist, den König mit allem Pomp beizusetzen.“
Jetzt reicht es mir. „Halte mich nicht zum Narren! Friedrich der Große liegt schon lange neben seinem Vater in der Garnisonkirche, daran änderst auch du mit deinem Geschwätz nichts. Verschwinde!“
„Eine Garnisonkirche gibt es nicht“, erwidert er ungerührt. „Friedrich der Große wird heute auf dem Weinberg nahe seinem Schloss Sanssouci beigesetzt.“ Zu dieser bizarren, absolut unverständlichen Äußerung lächelt der Jüngling so liebenswürdig, dass mein Zorn einer unbegreiflichen Freude weicht. Er nimmt mich bei der Hand, die Berührung belebt mich und mit einer Leichtigkeit, die mich erstaunt, verlasse ich an seiner Seite mein Refugium. Kein Gedanke mehr daran, sich zu wehren oder wenigstens zu erklären, dass ich von der Welt nichts mehr wissen will und schon gar nichts von dieser Stadt!
Doch es ist nicht meine Stadt, die ich nun an der Seite des Jünglings durchquere. Wenn sie es je gewesen sein sollte, hat sich seit meinem letzten Ausgang alles verändert. Die Fischweiber muss ich in meiner Fantasie lärmen gehört haben. Weit und breit kein Kanal, an dem sie ihre Ware feilzuhalten pflegten. Überall nur hohe, hässliche Steinkästen, die wohl Häuser sein sollen, und schnelle stinkende Kutschen ohne Pferde. Wohin ich auch blicke, nirgendwo finde ich Vertrautes. An der Stelle des Stadtschlosses, durch das ich doch unzählige Male geschritten bin, tut sich eine öde Fläche auf, die teilweise von einer überdimensionierten Blechkiste eingenommen wird. Die Türme der Heiliggeist- und der Garnisonkirche sind wie die Kuppel des Waisenhauses verschwunden. Rathaus und Marstall stehen in fremder Umgebung.
Ich frage nach dem Stadtschloss und der Garnisonkirche.
Der Jüngling bekräftigt seine Worte von vorhin: „Eine Garnisonkirche gibt es hier nicht“ und fährt dann fort: „auch kein Stadtschloss. Sie werden erst noch gebaut, man ist dabei, die Baupläne auszuarbeiten.“
Ist der Kerl bei Sinnen? Warum soll erst gebaut werden, was doch schon lange existiert? Jede Einzelheit des Schlosses könnte ich beschreiben, den Weg zu den Gemächern des Königs im Ostflügel, die Ausstattung der Räume, die Uniformen der Wachsoldaten. Unzählige Male habe ich die Glocken der Garnisonkirche gehört, den eleganten Turm hinaufgeschaut und bin im Strom der Gottesdienstbesucher durch das Portal geschritten. Und jetzt nichts als Ödnis … Die rätselhafte Bemerkung meines Begleiters geht mir nicht aus dem Sinn. Vielleicht ist nicht er verrückt, sondern mich hat es verrückt – in eine andere Zeit. Aber in welche? In eine Zeit vor meiner Geburt oder in eine Zeit lange nach meinem Leben? Und wie kommt König Friedrich, tot oder lebendig, in eine Stadt ohne Garnisonkirche, in der er doch unter meinen Augen beigesetzt wurde? Schloss Sanssouci hinwiederum soll es nach Auskunft des Jünglings geben, denn wenn ich ihn richtig verstanden habe, sind wir auf dem Weg dorthin. Die Begriffe Vergangenheit und Zukunft scheinen nicht mehr zu gelten. Vielleicht existiert alles gleichzeitig: der leere Platz und das Stadtschloss, der tote und der lebendige König?
Nach Fassung ringend, suche ich nach einem Gebet und mir fallen die Worte des Psalmisten ein: „Der du die Menschen lässest sterben und sprichst: Kommt wieder, Menschenkinder. Denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache.“
So muss es sein: Ich bin aus Menschenzeit in Gotteszeit gefallen. Aber warum wird Friedrich auf dem Weinberg statt in der noch zu bauenden Garnisonkirche beigesetzt? Mag sein, weil er es sich einst so gewünscht hat und auch Wünsche Wirklichkeit sind.
Den Jüngling neben mir scheinen solche Gedanken nicht zu beschweren, meine Unruhe belustigt ihn eher. Er gleitet neben mir her, dirigiert mich mit leichter Hand hierhin und dorthin. Gottseidank hat sich des Königs Sanssouci nicht verändert. Wie einst lagert es anmutig auf dem Weinberg. Dennoch haftet auch ihm etwas Fremdes an, ohne dass ich es genau bezeichnen könnte. Es scheint mir auf wie ein Traum, anders und doch vertraut. Eine Vielzahl seltsam gekleideter Menschen drängt zur Auffahrt des Schlosses, als veranstalte der König eine Armenspeisung. Aber sie wirken nicht bedürftig oder halb verhungert, auch nicht wie Trauernde. Sie unterhalten sich, da und dort steigt Gelächter auf, während sie in langer Reihe auf den Ehrenhof zuhalten. Dort steht, in gebührender Entfernung von den vorbeidefilierenden Menschen, ein Sarg, bedeckt mit der preußischen Fahne. Soldaten in schmucklosen Uniformen halten die Ehrenwache.
Fragend wende ich mich dem Jüngling zu. „Der König erwartet dich auf der Terrasse“, sagt er, entzieht mir seine Hand und verschwindet so plötzlich, als habe er sich in Luft aufgelöst.
Kein Benehmen haben diese jungen Leute. Erst gibt er mir keine Antwort und nun lässt er mich hilflos unter all den fremden Menschen stehen. Liegt der König nun im Sarg oder erwartet er mich auf der Terrasse?
Inmitten der bunt gekleideten Menschen fällt mir ein alter Herr in schwarzer Kleidung auf. Sein Gesicht zeigt, wenn auch keine Trauer, so doch großen Ernst. Die weiße Rose in seiner Hand ist offensichtlich für den Sarg bestimmt.
Ich verbeuge mich höflich: „Entschuldigen Sie die Kühnheit, mein Herr, aber würden Sie mich bitte aufklären, welchen Zweck diese Veranstaltung verfolgt?“
Er schaut blicklos durch mich hindurch. Vielleicht ist er schwerhörig. Ich wiederhole meine Frage so laut, wie es die Situation gerade noch erlaubt. Ohne mich zu beachten, reicht er die Rose einem ebenfalls schwarz gekleideten Lakaien hinter der Absperrung, der die Blume feierlich zum Sarg trägt und sie dort ablegt. Der Herr verneigt sich tief, dann wendet er sich wortlos zum Gehen. Immer noch scheine ich bei Hofe persona non grata zu sein. Erbost über die Missachtung meiner Person, greife ich nach dem Arm des Alten und – ins Leere. Auch die in der Reihe Nachrückenden setzen mir keinen Widerstand entgegen, ich kann durch sie hindurchgehen, ohne dass sie es bemerken.