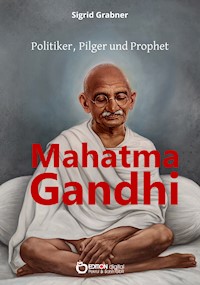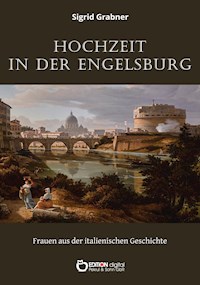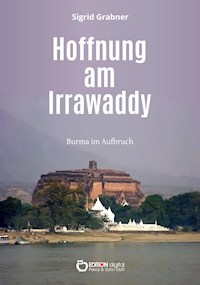7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Was können eigentlich Biografien, also Lebensbeschreibungen, leisten? Im besten Falle wohl vor allem zwei Dinge – Lesern einen Menschen näherbringen, von dem sie vielleicht außer seinem Namen (oder natürlich auch ihrem Namen) nichts kannten, und ein Bild der Zeit liefern, in der die oder der Dargestellte gelebt, gewirkt und auch geliebt hat. Manchmal allerdings ist die Entfernung zwischen dieser Lebens- und Wirkungszeit und der Gegenwart sehr groß und eine doppelte Herausforderung für den jeweiligen Biografen oder wie in diesem Falle die jeweilige Biografin. So muss man zum einen möglichst viel über die Person und seine Zeit herausfinden und zum anderen dieses Herausgefundene möglichst informativ und vergnüglich weitergeben. Bei „Gregor, dem Großen“ beträgt die eben angesprochene zeitliche Entfernung knapp anderthalb Jahrtausende oder exakt 1482 Jahre, wenn man von dem Jahr seiner Geburt 540 ausgeht, oder exakt 1418 Jahre, wenn man vom Jahr seines Todes 604 ausgeht. Dazwischen lagen Jahre, während der der Sohn eines uralten römischen Adelsgeschlechts, der nach einer gründlichen rhetorischen und juristischen Ausbildung bereits mit 30 Jahren auf den Posten des Stadtpräfekts von Rom (Praefectus urbi) und damit auf einen Gipfelpunkt seiner weltlichen Karriere gelangte, sich den Beinamen der Große verdiente. Zunächst jedoch vertauschte er sein voriges abenteuerliches Leben mit einer einfachen Klosterzelle. Schon bald darauf begann seine zweite, kirchliche Karriere, während der er sich seinen, bis heute von großem Respekt zeugenden Beinamen erwarb – als Papst Gregor I. (590 bis 604), der sich als „Mönchspapst“ Servus servorum dei also „Diener der Diener Gottes“ nannte – bis heute Bestandteil der päpstlichen Titulatur. Als ihre große Biografie erschien, war der Deutsche Benedikt Papst. Und Sigrid Grabner schrieb: Gregors jetziger Nachfolger auf dem Stuhl Petri, Papst Benedikt XVI., nimmt dessen oft verwendetes Bild vom Leben als einer Fahrt in einem löchrigen Boot auf wild bewegter See auf, wenn er in der Enzyklika „Spe salvi“ (Durch Hoffnung gerettet) schreibt: „Menschliches Leben bedeutet Unterwegssein. Zu welchem Ziel? Wie finden wir die Straße des Lebens? Es scheint wie eine Fahrt auf dem oft dunklen und stürmischen Meer der Geschichte, in der wir Ausschau halten nach den Gestirnen, die uns den Weg zeigen. Die wahren Sternbilder unseres Lebens sind die Menschen, die recht zu leben wussten. Sie sind Lichter der Hoffnung.“ Gregor gehört zu ihnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Sigrid Grabner
Im Auge des Sturms
Gregor, der Große – Eine Biografie
ISBN 978-3-96521-652-5 (E-Book)
Umschlaggestaltung: Ernst Franta
Das Buch erschien 2009 im Sankt Ulrich Verlag, Augsburg.
2022 EDITION digital
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
Für Johann und Paul
Begegnung
Jeder Tag ist ein Aufbruch ins Unbekannte. Auch wenn wir zu wissen meinen, was uns erwartet. An jenem Maientag vor mehr als zwanzig Jahren hatte ich mir vorgenommen, endlich den Monte Celio zu erkunden, einen der sieben Hügel des antiken Rom. Zwar kannte ich schon einzelne seiner frühchristlichen Bauten wie die Kirchen San Clemente, Santi Quattro Coronati bis hin zu San Giovanni e Paolo mit den unterirdischen altrömischen Mietshäusern, aber nun wollte ich sie in ihrer Gesamtheit begreifen. Zwischen Bauwerken entsteht wie zwischen Menschen, die einige Zeit miteinander verbringen, ein Klima von wechselseitigen Zuneigungen oder Aversionen. Die burgähnliche Kirche Santi Quattro Coronati schien mir überheblich auf San Clemente herunterzublicken, während San Clemente, bescheiden und sich doch seiner Schätze bewusst, nicht viel von der ewig in restauro befindlichen Kirche Santo Stefano mit den blutrünstigen Märtyrerbildern des Pomerancio hielt. San Giovanni e Paolo, in die Ruinen des Claudius-Tempels und über altrömischen Häusern gebaut, fühlte sich San Clemente verwandt. Santa Maria in Domnica scherte sich weder um die benachbarte Kirche Santo Stefano noch um die Eifersüchteleien ihrer Schwestern, sondern genoss einfach den Ausblick von der Kuppe des Hügels auf die Stadt. Alle aber wollten mit den nahe gelegenen, seit der Antike bestehenden Kasernen nichts zu tun haben, und alle beugten sich dem Anspruch von San Giovanni in Laterano als der Mutterkirche der Christenheit.
Als ich gegen Abend die bogenüberspannte, mittelalterlich anmutende Gasse, die seit der Antike Clivus Scauri heißt, den Monte Celio hinabging, fiel mein Blick auf die Kirche San Gregorio Magno. Über steiler Treppe ragt eine barocke Fassade hoch in den Himmel. Eigentlich hatte ich keine Lust auf eine Kirche aus dem siebzehnten Jahrhundert, im Vergleich zu dem, was ich bisher gesehen hatte, erst gestern erbaut. Außerdem stand Gregorio Magno nicht auf meinem Programm.
Aber dann reizte mich doch die Aussicht von oben auf die von der Abendsonne angestrahlten Ruinen der Kaiserpaläste des benachbarten Palatin. Mit schweren Beinen erstieg ich die Treppe. Die Aussicht hielt, was ich mir von ihr versprochen hatte. Mein Blick wanderte vom Zirkus Maximus zu dem von Pinien gesäumten Palatin, streifte im Tal zwischen Palatin und Monte Celio die verkehrsreiche Straße, auf der einst die siegreichen Heere von der Via Appia her zum Forum Romanum gezogen waren, erfasste die steinernen Reste des Aquädukts Claudia und ahnte neben der Kirche San Paolo e Giovanni die mächtigen Quadern des einstigen Claudius-Tempels – ein Panorama, das sich seit der Antike kaum verändert hat. Für die einstige marmorne Pracht entschädigte reichlich das belebende Grün der Bäume und Sträucher.
Da die Mühe des Treppensteigens belohnt worden war, entschloss ich mich zu weiterer Erkundung. Die verblichenen Fresken im Atrium der Kirche erzählten von Werken und Wundern Papst Gregors des Großen, dem Patron des Gotteshauses: Dämonenaustreibung, Visionen, Heilungen. Gregor zu Pferde, vor dem Altar, an der Spitze einer Prozession. Das Übliche eben, was wir uns schon lange angewöhnt haben, als fromme Legenden zu belächeln. Auf dem Areal der heutigen Kirche, lese ich im Reiseführer, habe vor fast anderthalbtausend Jahren sein Elternhaus gestanden, das der von Geburt römische Adlige in ein Kloster umgewandelt hatte. Ein Jahrtausend später baute man auf die Ruinen des Klosters eine Kirche ihm zu Ehren.
Während des Rundgangs durch den barocken Innenraum, wie es deren viele in Rom gibt, und später beim Ausruhen auf der Treppe gestand ich mir ein, dass mich an diesem Ort etwas unerwartet tief berührte, aber ich konnte es nicht benennen. Lag es an dem Ausblick, dem kleinen benediktinischen Friedhof mit den drei unzugänglichen Kapellen nebenan oder an den indischen Missionarinnen der Nächstenliebe vom Orden der Mutter Teresa und den weiß gekleideten Kamaldulenser-Mönchen, die auf dem Weg zu ihren der Kirche benachbarten Klöstern lautlos vorbeieilten? Lag es an der unwirklichen Stille, so nahe dem tosenden Stadtzentrum? An der leuchtenden Abendstimmung über der Stadt?
Noch einmal betrachtete ich die Fresken im Atrium, mit denen mehr als tausend Jahre nach Gregors Tod ein unbekannter Maler Szenen aus dessen Leben erzählte. Als Nacken und Augen vom Hinaufschauen schmerzten, gab ich den Versuch auf, sie zu verstehen. Was ging mich dieser Heilige aus der Zeit der Völkerwanderung an, einer Zeit, von der ich keinerlei Vorstellung besaß? Ich war müde von einem langen Tag mit mehr Eindrücken als ich verkraften konnte. Eine eindrucksvolle Person muss dieser Gregor aber schon gewesen sein, dachte ich, als ich die Treppe hinunterstieg. Wie sonst hätte sich die Erinnerung an ihn so lange halten können?
Bei folgenden Rom-Aufenthalten zog es mich immer wieder zum Clivus Scauri, und wenn ich auf den Stufen vor der Kirche ausruhte, überfiel mich jedes Mal eine seltsame Unruhe. Neugier und Trägheit stritten in mir bei dem Gedanken, ob es nicht an der Zeit sei, nähere Bekanntschaft mit diesem Gregor zu schließen. Doch jedes Mal siegte die Trägheit, indem ich vorgab, anderes zu tun zu haben.
Bei einem dieser Besuche mit einer Freundin entdeckten wir neben der rechten Seitenkapelle in der Kirche eine Art Rumpelkammer. Unter den dort abgestellten Baumaterialien fiel uns ein antiker marmorner Sessel auf. Wir wunderten uns, wie man ein so kostbares Möbel so pietätlos behandeln konnte. Verstohlen probierten wir den Sessel aus; der blanke Stein, so empfanden wir, schmeichelte sich geradezu dem Körper an.
Wieder ein paar Jahre später hatte man das mattgelb schimmernde Sitzmöbel mit den beiden tierköpfigen Armlehnen in der rechten Seitenkapelle platziert. Die „Rumpelkammer“, inzwischen aufgeräumt und renoviert, erwies sich nach einer alten lateinischen Inschrift an der Wand als die Zelle, in der Gregor als Mönch in seinem Kloster gelebt hatte: „Nocte dieque vigil longo hic defessa labore Gregorius modica membra quiete levat.“ (Wachend bei Tag und bei Nacht erholt nach mühsamer Arbeit Gregor in kurzer Ruh hier den ermüdeten Leib.)
Mich erstaunte, dass die Verfasser der Inschrift die grammatikalische Form des Präsens gewählt hatten. Da Gregor im Atrium der alten Peterskirche begraben worden war und seine sterblichen Überreste heute im Petersdom beigesetzt sind, konnte sich die Aussage nicht auf die ewige Ruhe beziehen. Sie bezeugt vielmehr eine immerwährende Gegenwart. Ein kranker Mann, erschöpft von seiner Arbeit, ruht sich hier aus. Jetzt!
Ein wenig irritiert kehrte ich durch den niedrigen Türbogen zur Seitenkapelle zurück. Mein Blick fiel auf den Marmorsessel. Er mag zum Mobiliar des väterlichen Hauses gehört und Gregor später vielleicht als Bischofsstuhl gedient haben. Die Löwen- oder Greifenköpfe am Ende der Armlehnen waren als solche kaum noch zu erkennen. Wie viele Hände mochten auf ihnen geruht, über sie gestrichen, sich um sie gekrampft haben, seit ein Handwerker sie vor zweitausend Jahren aus dem Marmor gemeißelt hatte. Prachtvolle Kissen zum Schutz der Benutzer vor der Kühle und Härte des Steins, schon lange zu Staub zerfallen, mochten den Sessel geziert haben. Glatt waren die Sitzfläche und die Armlehnen, so glatt wie ein Kiesel, den die ständig bewegten Fluten des Meeres über Jahrtausende bearbeitet haben.
Ich weiß nicht, wie lange ich mich in die Betrachtung des Stuhls vertiefte, aber ich könnte beschwören, dass ich dort plötzlich eine schmale Gestalt, bekleidet mit einer Mönchskutte, sitzen sah. Aus dem Halbdunkel, in das ein früher Herbstabend die Kirche getaucht hatte, schaute sie mich an – prüfend und ein bisschen erstaunt. Mir verschlug es den Atem, ich erstarrte wie das Kaninchen vor der Schlange. Irgendwann griff ich doch beherzt in Richtung Stuhl, aber da war nichts. Dieses Erlebnis erschreckte mich mehr, als dass es meine Neugier angestachelt hätte. Aber mir wurde bewusst: Es war der Geist des Ortes, der mich immer wieder hierherzog, der Geist Gregors. Er warb um mein Verständnis, mein Vertrauen, wie wir um einen Menschen werben, mit dem wir gern befreundet sein möchten. Doch zu schwierig, zu fremd und fern schien mir die Person Gregors, ich wollte mich nicht auf sie einlassen.
Während der nächsten Rom-Besuche machte ich um die Kirche San Gregorio Magno einen großen Bogen. Aber als die drei barocken Kapellen, benannt nach den heiligen Silvia, Andreas und Barbara, auf dem einstigen kleinen Friedhof neben der Kirche restauriert und endlich wieder der Öffentlichkeit zugänglich waren, konnte ich nicht länger widerstehen. Jeder Reiseführer empfahl sie als sehenswert.
Ich schaute mir die gepriesenen Fresken von Viviani, Guido Reni und Domenichino in den Oratorien an. Meine größte Aufmerksamkeit erregte jedoch ein imposanter Steintisch aus dem dritten nachchristlichen Jahrhundert – eine mächtige Platte, getragen von steinernen Löwen und in der Mitte gestützt durch einen Säulenstumpf. Er stand im Oratorium der heiligen Barbara, der ältesten der drei Kapellen, deren antikes Außengemäuer noch deutlich erkennbar ist. Hier, im einstigen Triclinium, dem Speiseraum, so verkündet eine Inschrift auf der Tischplatte, sollen Gregor und seine Mutter Silvia täglich zwölf Arme verköstigt und bedient haben. Ich versuchte mir das vorzustellen. Doch so sehr dieser Tisch mich auch faszinierte, ich konnte mir keine tafelnden Menschen an ihm vorstellen. Eine Weile beschäftigte mich die Frage, ob man zu Zeiten Gregors eine Decke über den Stein gebreitet hatte und wie sie ausgesehen haben mochte. Die Fresken von Antonio Viviani vom Anfang des siebzehnten Jahrhunderts mit Heiligenfiguren und Ereignissen aus der Geschichte des Klosters und die Skulptur des segnenden Papstes Gregor aus derselben Zeit sprachen nicht zu mir. Devotionen ferner Zeiten. Dennoch machte mich irgendetwas unruhig. Die schemenhafte Gestalt des Mönches, die mir vor Jahren in der Kirche nebenan begegnet war, stand mir wieder lebhaft vor Augen.
Bei jedem Blick vom Gianicolo auf Rom suchte ich unwillkürlich die hoch aufragende Kirche San Gregorio Magno. Ihre Fassade leuchtete weithin in der Abendsonne. Dort also war dieser Gregor aufgewachsen, im Schatten der Kaiserpaläste und nahe dem Forum Romanum, dort hatte er als Präfekt von Rom gewohnt und eben dort sein Adelsgewand abgelegt, um Mönch zu werden. Dorthin war das römische Volk in seiner Not gezogen, hatte ihn als Papst akklamiert und sich auch nicht abschrecken lassen durch verbarrikadierte Tore und das entschiedene Nein des Erwählten.
Eigenartig, wie sich dieser Ort neben dem dunklen Rot der Ruinen auf dem Palatin so hell abhob, als sei er in ein überirdisches Licht getaucht. Es gab ehrwürdigere Orte in dieser Stadt, ältere Kirchen, beeindruckendere Kunstwerke als in Gregorio Magno. Hatten nicht bedeutendere Menschen als Gregor diese Stadt durch die Zeiten hindurch geprägt? Warum ließ er mich nicht los?
Einige Zeit später schlenderte ich über die Piazza Navona. Neben den Staffeleien der Maler hatten Umweltgruppen ihre Stände aufgebaut. Ein junger Mann steuerte auf mich zu und drückte mir ein Pamphlet in die Hand. Zuerst wollte ich es in den nächsten Papierkorb entsorgen, aber es fand sich keiner in der Nähe. So begann ich zu lesen, bis ich auf folgende Worte stieß:
„Denn alles, was wir zum Lebensunterhalt empfingen, haben wir in schuldhafter Weise missbraucht; doch alles, womit wir Missbrauch getrieben haben, wendet sich zur Strafe gegen uns. Die Friedensruhe unter den Menschen haben wir in nichtige Sicherheit verkehrt; die Pilgerschaft auf Erden haben wir anstelle des Wohnens in der Heimat geliebt; die Gesundheit des Körpers haben wir den Lastern dienstbar gemacht; überströmenden Reichtum haben wir nicht für die Notwendigkeit des Leibes, sondern für die Verirrung sinnlicher Lust verfügbar gemacht; selbst die heitere Milde der Luft zwangen wir, unserer Liebe zu irdischen Vergnügen zu dienen. Mit Recht trifft uns schließlich also alles zugleich, was alles zugleich unseren Lastern in schlimmer Weise ergeben diente; so viele Freuden wir zunächst ungestört in der Welt hatten, so viele Qualen müssen wir später von dieser Welt erleiden.“
Als ich unter dem Text den Namen des Verfassers las, glaubte ich meinen Augen nicht zu trauen: „Gregor der Große (540-604)“.
Von Stund an begegnete Gregor mir nicht nur in Rom, sondern auch andernorts und zu Hause – auf Kalenderblättern des Tages und in uralten Gebeten der Kirche, in Büchern und auf Ansichtskarten. Ich konnte ihm nicht länger ausweichen. Nach und nach beschaffte ich mir seine Schriften, sammelte Informationen über ihn und seine Zeit. Das sechste Jahrhundert öffnete sich meiner Vorstellungskraft. Ich sah die durch Plünderungen und Seuchen verelendete Stadt, vernahm den Waffenlärm der Langobarden, die gegen die Mauern Roms andrängten. Gregors Klagen über den Zustand der Welt und das ihm auferlegte Geschick, als Hirte über die Christenheit wachen zu müssen, statt sich in Einsamkeit und Gebet zurückziehen zu dürfen, rührten mich. Ich bewunderte die Tatkraft, mit der sich der kranke Mann einer scheinbar wahnsinnig gewordenen Welt stellte und ihr widerstand. Allmählich wurde er mir vertraut, wenn auch immer eine gewisse Distanz blieb; eine Distanz, die nicht so sehr dem Abstand der Jahrhunderte geschuldet war, sondern unterschiedlichen Temperamenten und Aufgaben im Leben. Eine alte Weisheit besagt, dass Gegensätze sich anziehen. Das Verständnis für andere Sichtweisen auf die Welt und ihre Zumutungen erweitert den eigenen Horizont. Nur wenn wir uns immer wieder in Frage stellen lassen, bleiben wir lebendig. Ich spürte, dass Gregor zu mir sprach, und ich wollte ihn verstehen.
Von Mahatma Gandhi stammt das Wort: „Meine Schriften sollen mit meinem Körper verbrannt werden. Mein Leben ist meine Botschaft.“ Wie anders aber als durch Schriften und Bilder können wir uns einem vergangenen Leben annähern und es in uns wirken lassen? Unsere Zeit liebt Bilder. Das unbestechliche Auge der Kamera scheint uns die Wahrheit über Menschen und Ereignisse zu vermitteln. Nur das Sichtbare zählt. Vergegenwärtigung verlangt nach Fotos oder wenigstens Gemälden.
Es existieren keine zeitgenössischen Darstellungen Gregors mehr, des berühmten „Konsul Gottes“, als den ihn seine Grabinschrift bezeichnete. Erhalten hat sich aber die Beschreibung eines Freskos, das noch im neunten Jahrhundert das Kloster am Clivus Scauri schmückte und das Johannes der Diakon damals so beschrieb: „Seine Figur war von einer normalen Größe und gut gebaut. Sein Gesicht war nicht so schmal wie das seines Vaters und auch nicht so rund wie das seiner Mutter, so dass es bei einer gewissen Fülle von einer angenehmen Länge zu sein schien. Sein Bart, ähnlich wie der seines Vaters, war nur mäßig lang und hatte eine gelbbraune Farbe. Er war ziemlich kahl und hatte mitten auf der Stirn zwei kleine, nach rechts gedrehte Löckchen. Der Schädel war rund und groß, sein dunkles Haar war lockig und hing bis zur Mitte des Ohrs herunter; seine Stirn war hoch, seine Augenbrauen lang und gewölbt. Seine Augen hatten dunkle Pupillen und, obwohl nicht groß, hatten sie unter vollen Augenlidern einen offenen Blick. Seine Nase, vom Ansatz seiner gebogenen Augenbrauen dünn und gerade, war um die Mitte breiter, ein klein wenig Adlernase, und an den Nasenlöchern geweitet. Sein Mund war rot, die Lippen voll und unterteilt; seine Wangen waren gut geformt, und sein Kinn trat angenehm aus den Kiefern hervor. Seine Hautfarbe war dunkel und frisch, anders als sie später wurde, da sie ungesund aussah. Sein Gesichtsausdruck war gütig; er hatte schöne Hände, mit langen spitz zulaufenden Fingern, zum Schreiben gut geeignet.“
Trotz dieser detaillierten Beschreibung gewann ich keine rechte Vorstellung von Gregor, die an die Stelle jenes Schemen hätte treten können, das mir für den Bruchteil einer Sekunde beim Anblick des Marmorsessels aufgeschienen war. Auch die zahllosen Darstellungen des Papstes, meist aus dem sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert, angetan mit Mitra, ein Buch in der Hand und umflattert von der Taube des Heiligen Geistes, vernebelten eher mein inneres Bild als dass sie es schärften. Erst bei einem wiederholten Besuch im Triclinium mit dem beeindruckenden Tisch freundete ich mich mit dem Fresko des Malers Antonio Viviani an, das Gregor in der Haltung eines Schreibenden zeigt. Er sitzt seitlich an einem mit Schreibutensilien und Büchern bedeckten Tisch, gekleidet wie ein Papst im 16. Jahrhundert und so ähnlich wie die Päpste noch heute. Über einem weißen Gewand trägt er die Mozzetta, den roten Umhang, wieder darüber eine lange grüne Stola; auf dem Kopf den aus der Mode gekommenen Camauro, eine rote Samtmütze mit weißem Pelzrand. Hinter ihm in einer Lichtwolke die angedeuteten Umrisse einer Taube, den Heiligen Geist symbolisierend, der dem Schreibenden seine Weisheit diktiert.
In der Ikonografie des ausgehenden sechzehnten Jahrhunderts gemalt, verzichtet das Bild auf jegliche heroische Pose. Da sitzt ziemlich unbequem, den Kopf über das Manuskript geneigt, ein asketisch wirkender Mann, tief in seine Gedanken und das Schreiben versunken, fern der Welt und ganz bei sich. Eine Momentaufnahme, die Gregors Wesen, wie es sich mir aus seinen Schriften erschloss, nahezukommen schien.
Ich erlebte ihn auch anders, wenn ich seine Texte las: als entscheidungsfreudigen Mann und als kranken Greis; streng bis zur Fremdheit und Tränen vergießend aus Mitleid mit der geplagten Menschheit. Entschlossen, sarkastisch, gütig; aufrecht zu Pferde, schmerzverkrümmt im Stuhl, den Himmel mit seinen Gebeten bestürmend, verloren wie ein Kind im dunklen Wald. Welche Bilder sich im Laufe der Jahre bei den Begegnungen mit Gregor auch einstellten, so kehrte ich doch immer wieder gern zur Darstellung des Malers Viviani zurück. Gregors Körperhaltung vermittelt hier den Eindruck von Konzentration, Inspiration, Meditation, Liebe zur Zurückgezogenheit, zugleich aber auch von Tatkraft und Entschlossenheit. Das könnte, beschloss ich, die Gestalt gewesen sein, die ich einst schemenhaft erblickt hatte.
Mein Bild von Gregor wird unvollkommen bleiben wie das jedes Menschen, mit dem ich je befreundet war. Niemals können wir das Geheimnis eines anderen in seiner Tiefe ergründen. Wenn die Stimme des Römers Gregor aus dem sechsten Jahrhundert auf das Ohr eines Menschen im einundzwanzigsten Jahrhundert trifft, dann hängt es vom jeweiligen Gehör ab, wie deutlich oder wie verzerrt diese Stimme verstanden wird. Missverständnisse und Fehldeutungen sind unvermeidbar, nicht anders als im Umgang mit lebenden Zeitgenossen.
Gregor ist mir unvermutet begegnet, er hat sich in mein Leben eingemischt, und ich habe versucht, mich ihm anzunähern. Auf den ersten Blick mag er sich in der heutigen Zeit fremd ausnehmen, doch bei näherem Kennenlernen erleben wir einen erstaunlichen Menschen, der uns Wesentliches zu sagen hat. Gregor hat geliebt und gelitten, versagt und ist über sich selbst hinausgewachsen. Er lebte in keiner anderen Welt als wir. Die Geschichte ist ein Spiegel, in dem wir uns selbst wiederfinden, immer neu und immer anders, je nach Alter und Erfahrungen.
Seit der ersten Begegnung an jenem Maientag vor mehr als zwanzig Jahren ist Gregor mir zum Freund geworden, auch wenn ich sein Tun und seine Gedanken nicht bis in Einzelheiten nachvollziehen kann und Fantasie sein Bild belebt. Eine Freundschaft lebt von Zuneigung ebenso wie von gebotener Distanz, und in diesem Sinne will ich von Gregor erzählen.
Aufbruch in die Welt
Der Bischof der Kirche von Canusium pflegte zu dem Diener Gottes (Benedikt) zu kommen, und der Mann Gottes liebte ihn sehr, wie er es auch wegen seines heiligen Lebens verdiente. Da dieser mit ihm ein Gespräch führte über den Einzug des Königs Totila und die Zerstörung der Stadt Rom, sagte er: „Durch diesen König wird jene Stadt zerstört werden, so dass man sie nicht mehr bewohnt. “ Da erwiderte ihm der Mann Gottes: „Rom wird nicht von Kriegsvölkern zerstört werden, sondern, von Ungewittern, Blitzen, Stürmen und Erdbeben erschüttert, in sich selbst zusammensinken. “
Gregor, „Dialoge"
Östlich vom Palatin, durch eine Senke von ihm getrennt, erhebt sich der Caelius, einer der sieben Hügel des alten Rom. Einst hatte ihn dichter Eichenwald bedeckt. Zur Kaiserzeit ließen reiche Familien sich Wohnungen und Paläste mit weiträumigen Gärten auf der Anhöhe errichten. Geradezu zärtlich sprach der Philosophenkaiser Marc Aurel von „meinem Caelius“, denn auf diesem Hügel hatte er seine Kindheit und Jugend verbracht. Am Ausläufer des Caelius gegenüber dem Palatin, dem Clivus Scauri, wuchs vierhundert Jahre später Gregor aus dem altrömischen Geschlecht der Anicier auf.
Die Bewohner dieses Viertels hatten den Glanz und den Niedergang Roms aus nächster Nähe miterlebt. Sie sahen die Kaiserpaläste auf dem Palatin in den Himmel wachsen und auf der Straße die siegreichen Heere zum Forum Romanum ziehen. Vom benachbarten Zirkus Maximus lärmten die Anfeuerungsrufe Hunderttausender für die Wagenlenker, und im nahen Flavischen Amphitheater ergötzten sich alle Stände vom Senator bis zum Bettler an blutigen Gladiatorenkämpfen und Tierhetzen. Über den Caelius verliefen die eleganten, hoch aufstrebenden Bögen der Acqua Claudia, einer von zwölf Wasserleitungen, und versorgten die unersättlichen Kaiserresidenzen und Thermen mit frischem Wasser aus den Bergen. Nicht weit war es bis zum Stadthafen am Tiber, wo täglich Waren aus aller Welt eintrafen: Marmor aus Griechenland, Kleinasien und Ägypten, Wolle aus Spanien, Tonwaren aus Sagunt, Glaswaren aus Ägypten, Tuche aus Indien, Schmuck aus China, Feigen aus Syrien, Weine aus allen Teilen Italiens, Griechenlands, Kleinasiens, aus Spanien, Gallien und Arabien. Nur eine kurze Wegstrecke trennte die Bewohner des Caelius von den Tempeln und Basiliken des Forum Romanum und der Kaiserforen mit den unzähligen Skulpturen. Ein nicht abreißender Strom von Fußgängern, Reitern und Sänftenträgern wogte durch das politische Zentrum der Stadt: Soldaten, Abenteurer, Gelehrte, Handwerker, Händler, Künstler, Anwälte, die ihren Geschäften nachgingen oder zu den Märkten, in die Stadien, Theater, Thermen, Wirtshäuser, Bordelle drängten – Menschen aller Rassen und Völkerschaften der damals bekannten Welt von Britannien bis Nordafrika, von Kleinasien bis an die Ufer des Atlantik. Sie alle galten, so sie freie Bürger waren, seit dem Erlass des Kaisers Caracalla als Römer und standen unter römischem Gesetz. Aber auch ein freigelassener Sklave konnte es zum Senator oder gar Kaiser bringen wie Diokletian, der Sohn eines Freigelassenen. In die Hauptstadt des Imperiums floss der Reichtum aus Nord und Süd, Ost und West und mit ihm der Strom derer, die an dem Reichtum teilhaben wollten.
In die Paläste auf dem Caelius drang kaum etwas von dem aufgeregten Treiben. Hohe Mauern schirmten das Innere gegen Wind, Sommerhitze und Lärm ab. Wenn der Hausherr das an den Seiten überdachte Atrium, in dessen Mitte ein Becken den Regen auffing, durchschritten hatte und in das Peristyl mit seinem Garten gelangte, wenn er im Triclinium zu Tische lag, von Sklaven bedient und in angeregtem Gespräch mit seinen Gästen, in der Bibliothek Studien trieb oder seinen Geschäften nachging, dann konnte er sich dem Moloch Rom so fern fühlen wie in seiner Villa am Meer oder in den Bergen Latiums. Die Zeit rann zu einem Nichts zusammen, heute war wie gestern, und morgen würde wie heute sein, auch über Alter und Tod hinaus.
Doch als Kaiser Konstantin seine Residenz in das ferne Byzanz verlegte und seine Nachfolger es ebenfalls vermieden, von Rom aus zu regieren, zeigten sich Risse in dem einstmals ehern scheinenden Gefüge. Noch immer versetzten die Schönheit und der Prunk der öffentlichen Gebäude und Anlagen Besucher von weither in fassungslose Bewunderung, noch immer trugen Adlige und wohlhabende Freigelassene ihren Reichtum zur Schau und sorgten für Brot und Spiele, um nicht Opfer eines der Arbeit entwöhnten Pöbels zu werden. Noch konnte die Zeit den prächtigen Tempeln und luxuriösen Thermen wenig anhaben. Aber zunehmend fehlten die Mittel, sie zu pflegen und instandzuhalten. Die Kaiser residierten im fernen Konstantinopel, zu Zeiten auch in Mailand oder Ravenna, und setzten sich dort Denkmäler für die Ewigkeit. Rom sank Jahrzehnt um Jahrzehnt mehr auf das Niveau einer Provinzstadt am westlichen Rand des bröckelnden Imperiums. Langsam versiegten die Ströme von Gold und Waren, die der Stadt ein Leben im Überfluss ermöglicht hatten. Aber die Römer, verwöhnt und längst nicht mehr fähig, sich selbst zu ernähren und zu verteidigen, hielten an ihrem Lebensstil fest. Unbeeindruckt von den sich verändernden Zeitläuften sahen sie ihre Stadt weiterhin als das Haupt der Welt, dem alle Völker untertan sein mussten. Stimmen, die vor den Barbaren warnten und die Tugenden der Ahnen anmahnten, die Rom einst groß gemacht hatten – Gerechtigkeit, Fleiß, Sittenreinheit, Sparsamkeit –, fanden in der allgemeinen Sorglosigkeit kein Gehör. Mochten die Barbaren an fernen Grenzen auch Siege erringen, sie, die Römer waren ihnen an ausgefeilter Lebensart, an Baukunst und Wissenschaft hoch überlegen. Was sollten sie mit anstrengenden Tugenden, wenn es sich mit Lastern viel leichter leben ließ! Mehr denn je traf das Wort des Geschichtsschreibers Tacitus zu, der Rom als Herrin und als Gosse des Reiches bezeichnet hatte, „in der von überallher alles, was scheußlich und schändlich ist, zusammenströmte und sich einnistete“. Doch wen die Götter verderben wollen, den machen sie zuvor taub und blind. Rom tanzte und hurte seinem Untergang entgegen.
Zu jener Zeit, über die hier berichtet werden soll, war dem Haupt der Welt längst der Leib abhanden gekommen. Angezogen von dem sagenhaften Reichtum Roms und vertrauend auf seine verweichlichte Wehrlosigkeit waren Scharen von Völkern aus dem Osten wie Heuschreckenschwärme über Italien hergefallen. Sie wussten nicht, wie Nachtigallenzungen schmecken und wie man Fußbodenheizungen baut. Sie verehrten noch Steine und Bäume als Götter, der Glaube an den Christengott begann unter ihnen erst langsam Wurzeln zu schlagen. Auf ihren Gastmählern tanzten keine spärlich bekleideten Frauen, und sie verachteten die Knabenliebe; Puder, Schminke, ausgefallene Frisuren und Kleider, obszönes Theater, klingende Verse, geziertes Getue, gelehrtes Gehabe, Bibliotheken, Thermen, Bordelle waren ihnen fremd. Sie mochten es einfach und derb. Auf der Suche nach einer neuen Heimat diskutierten sie nicht, sondern hieben nieder, was sich ihnen in den Weg stellte, und nahmen was sie brauchten, ohne nach dem römischen Gesetzbuch zu fragen. Was ihnen an Bildung und der von den Römern so gepriesenen Zivilisation fehlte, ersetzten sie durch unverbrauchte Kraft und unbändigen Willen.
Zuerst kamen die Westgoten unter Alarich nach Rom. Im August 410 belagerten sie die Stadt, hungerten sie aus und plünderten sie dann drei Tage lang. Zusätzlich erpressten sie von den Römern ein Lösegeld von fünftausend Pfund Gold, dreißigtausend Pfund Silber, außerdem noch dreitausend Stück in Purpur getränkte Felle, viertausend seidene Wämser und dreitausend Pfund Pfeffer. Um die horrenden Summen aufbringen zu können, griff die Stadtregierung auf verschlossene Tempelschätze zurück und schmolz Bildsäulen aus Gold und Silber ein. Schlimmer noch als der Verlust an materiellen Werten traf die Stadt die Demütigung. Zum ersten Mal seit siebenhundert Jahren war die Stadt von Feinden eingenommen worden.
Nur dreißig Jahre später zog Papst Leo, der Bischof von Rom, mit seinem Gefolge unbewaffnet dem Hunnenkönig Attila entgegen, um ihm den Angriff auf die wehrlose Stadt auszureden. Sein kühnes Gottvertrauen zahlte sich aus. Attila verschonte die Stadt, wenn auch das Lösegeld nicht gering gewesen sein mag. Doch gegen den Vandalenkönig Geiserich verfingen Leos Überredungskünste nicht mehr. Im Juni 455 fielen die Vandalen vom Meer her in die Stadt ein, und was die Westgoten im Jahre 410 verschont oder die Römer wieder ersetzt hatten, trugen nun die Vandalen fort. Vierzehn Tage lang plünderten sie die Paläste auf dem Palatin, den Jupitertempel auf dem Kapitol, die Häuser vornehmer Römer auf dem Aventin, dem Esquilin und dem Caelius. Ganze Wagenladungen mit Skulpturen und vergoldeten Bronzeziegeln verließen Rom in Richtung Portus, von wo aus sie nach der afrikanischen Residenz Geiserichs verschifft wurden. Auch der Schatz des Tempels von Jerusalem, den einst Kaiser Titus nach Rom verschleppt hatte, nahm Geiserich mit sich. Zurück ließ er verödete Paläste, leere Tempel, Trümmer und Leichen. Kaum hatte sich die Stadt ein wenig erholt, fiel im Juni 472 der germanische Söldnerführer Rikimer mit seinen Mannen mordend und raubend über sie her.
Innerhalb eines Jahrhunderts war die einstige Herrscherin der Welt dreimal geplündert worden und hatte eine große Zahl ihrer Einwohner durch Mord, Verschleppung, Flucht, Hunger und Krankheiten verloren.
Aber Fortuna schien sich der Stadt noch einmal zuzuneigen. Als der Ostgotenkönig Theoderich mit Zustimmung des Kaisers in Konstantinopel von Ravenna aus seine Herrschaft über Italien errichtete, brachen für Rom bessere Zeiten an. Im Jahr 500 zog Theoderich unter großem Gepränge in Rom ein, und die seit einem Jahrhundert gedemütigten Römer jubelten dem Barbarenkönig zu. Er belohnte sie mit Spielen im Zirkus Maximus und im Flavischen Amphitheater, erwies dem Senat die Ehre und versicherte sich der Unterstützung reicher und kluger Römer.
Theoderich war als Geisel in Konstantinopel aufgewachsen, er verstand sich auf römische Lebensart und bewunderte die Aquädukte, Paläste und Thermen. So kam zum ersten Mal seit langem ein Herrscher nach Rom, der die Stadt nicht ausplündern und zerstören, sondern erhalten wollte. Doch was sich so glücklich anließ, sollte in eine neue Völkerwanderung münden, die an Schrecken alles Vorherige weit übertraf. Nur wenig mehr als ein Vierteljahrhundert währte der Frieden für die Stadt. Nach Theoderichs Tod entschied der oströmische Kaiser Justinian, den Vandalen ihre Eroberungen in Nordafrika zu entreißen und Italien wieder seiner unmittelbaren Herrschaft zu unterstellen. Er schickte die Feldherren Belisar und später Narses mit Truppen gen Westen, zusammengewürfelt aus allen Völkerschaften des Reiches. In Marsch setzten sich illyrische, awarische, bulgarische, sarmatische, gepidische Scharen, maurische und numidische Reiter, libysche Schleuderer, Bajuwaren von der Donau, Alemannen vom Rhein, Franken von der Maas, Burgunden von der Rhone, Anten vom Dnjestr, Abasgen, Sabiren, Lebanthen und Lykaonen aus Asien und Afrika und Langobarden aus Pannonien. Der geschickte Feldherr Belisar besiegte zuerst die Vandalen in Nordafrika und wandte sich dann nach Italien. Dort entbrannte ein mehr als zwanzigjähriger Krieg zwischen den Ostgoten unter der Führung von Theoderichs Nachfolgern und den Byzantinern. Rom wurde zum heiß umkämpften Siegespreis. Mehrmals wechselte die belagerte Stadt ihren Besitzer, und jeder Eroberer hielt sich an ihr schadlos. Als letzte plünderten die Mannen des Gotenkönigs Totila die verödete Stadt. Hatten hier Anfang des sechsten Jahrhunderts noch etwa fünfhunderttausend Menschen gelebt, vegetierten am Ende des Krieges innerhalb der Aurelianischen Mauer, die wie ein zu weit gewordenes Gewand Rom umgab, kaum dreißigtausend Bewohner.
Zu den Überlebenden gehörten der vornehme Römer Gordian und seine aus Sizilien stammende Frau Silvia, die ein Anwesen am Clivus Scauri bewohnten. Wir wissen nicht, auf welche Weise sie die Jahre des Gotischen Krieg überstanden, ob ihr Haus geplündert, Mitglieder der nahen Familie ermordet wurden.
Gordian stammte aus dem seit dem dritten Jahrhundert vor Christus bezeugten Geschlecht der Anicier. Ihre große Zeit erlebten sie in der Spätantike. Als eine der ersten Adelsfamilien bekannten sie sich zum Christentum. Im vierten Jahrhundert war Petronius Probus das Haupt der Familie, ein Mann von unermesslichem Reichtum und mit öffentlichen Ehren überhäuft: Konsul, viermaliger Präfekt und letzter großer Mäzen Roms. Mit Bischof Ambrosius von Mailand befreundet und von ihm getauft, fand er seine letzte Ruhestätte in einem eigens für ihn erbauten Tempel an der Peterskirche.
In der Abfolge der Generationen hatten sich die Anicier in viele Familien verzweigt. Gelehrte wie Boethius, der im Gefängnis Theoderichs vor der Hinrichtung sein unsterblich gewordenes Werk „Vom Trost der Philosophie“ schrieb, gehörten ebenso zu diesem Adelsgeschlecht wie Konsuln, Senatoren, Präfekten, Bischöfe und sogar zwei Kaiser.
Gordians Großvater war zu jener Zeit, als Theoderich Italien eroberte, unter dem Namen Felix III. neun Jahre Bischof von Rom gewesen und lag als einziger Papst in Sankt Paul vor den Mauern begraben. Dessen Neffe Agapetus, der ebenfalls auf dem Caelius gewohnt hatte, leitete zu Beginn des Gotenkrieges für ein knappes Jahr die römische Kirche. Dankbar und stolz gedachte die Familie dieser Vorfahren, die das Schifflein Petri und die Geschicke Roms in bewegter Zeit geführt hatten.
Es wäre Gordian nie in den Sinn gekommen, wie so viele seiner Standesgenossen zu den kaiserlichen Fleischtöpfen nach Konstantinopel zu ziehen, wo das Leben angenehmer war und marodierende Soldatenhorden sich an weit entfernten Grenzen austobten. Er fühlte sich tief mit seiner Heimatstadt verbunden. Dafür nahm er Härten und Entbehrungen in Kauf. Ein echter Römer hielt dem Kaiser die Treue und widerstand den Feinden, er floh nicht vor der Verantwortung. Trotz aller Plünderungen, die die Familie in den letzten hundert Jahren betroffen hatten, konnten Gordian und Silvia immer noch als reich gelten. Neben dem Familiensitz auf dem Caelius besaßen sie Latifundien auf Sizilien, in Kalabrien und Bauernhöfe vor den Toren Roms. Zwar hatte der langjährige Gotenkrieg die Verbindungen zu den Ländereien unterbrochen, die Besitzungen in Latium sogar zerstört und das Anwesen auf dem Caelius beschädigt, aber das verbliebene Vermögen überstieg noch immer weit ihre Bedürfnisse, und kein Hilfesuchender klopfte vergeblich an die Tür des Patriziers. Gordian und Silvia fühlten sich ohnehin mehr als Verwalter, denn als Eigentümer ihres Besitzes. Eines Tages würden sie vor dem himmlischen Richter Rechenschaft über ihr Tun und Lassen ablegen müssen, jenem Richter, der gesagt hatte: „Was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan.“ So lebten sie als fromme Christen, die die Heimsuchungen der Zeit mit dem stoischen Gleichmut ihrer römischen Ahnen ertrugen.
Um 540 wurde Gordian und Silvia ein Sohn geboren. Sie gaben ihm den griechischen Namen Gregor, was soviel wie „der Wachsame“ bedeutet. Ein damals in Rom unüblicher Name. Der Gotenkönig Vitiges hatte erst vor kurzem die Belagerung der Stadt aufgegeben, und sein Gegner, der kaiserliche Feldherr Belisar, den gotischen Regierungssitz in Ravenna erobert. Der Krieg mit den Goten schien zu Ende. Vielleicht wollten Gordian und Silvia mit der Namensgebung bessere Zeiten beschwören: Wachsamkeit sollte Rom und den christlichen Glauben vor weiteren Angriffen der Barbaren schützen. Keine Frage, dass Gregors Eltern aufseiten des Kaisers Justinian und seines Feldherrn Belisar standen. Schließlich hatte der Ostgotenkönig Theoderich den Anicier Boethius unter falschen Anschuldigungen hinrichten lassen und die Familie grausam verfolgt. Gordian und Silvia konnten nicht ahnen, dass die Ostgoten bald den kühnen Totila als König auf den Schild heben und Rom erneut erobern und plündern würden.
Man nimmt allgemein an, dass Anicius Gregorius in Rom geboren ist. Die Quellen geben über seine Kindheit und Jugend nur spärlich Auskunft. Tag, Stunde und sogar das genaue Jahr seiner Geburt sind unbekannt. Gregor blieb zeitlebens zurückhaltend mit Auskünften über sich. So spricht auch nichts gegen die hin und wieder geäußerte Vermutung, Gordian habe sich während der Gotenkriege zeitweise auf seinen Besitzungen in Sizilien aufgehalten, dort die Sizilianerin Silvia geheiratet, und ihr Sohn Gregor sei auf der Insel geboren worden. Von einem jüngeren Bruder ist da und dort die Rede, aber man kennt seinen Namen so wenig wie den Zeitpunkt seiner Geburt. Aus einem Brief Gregors wissen wir nur, dass fünfzig Jahre später auf Sizilien noch eine Schwester seiner Mutter namens Pateria in bedrängten Verhältnissen lebte. Verbürgt ist jedoch, dass der heranwachsende Knabe in Rom seine Ausbildung erhielt.
Wenn Gregor, wie die Historiker zu wissen meinen, in Rom geboren ist, dann kannte er bis zum Alter von sieben Jahren nur die Welt des Krieges. Krieg, das hieß, bei der Amme Zuflucht zu suchen, wenn Horden von Soldaten am Tor Einlass begehrten, still in Verstecken auszuharren, den unverhofften Anblick verstümmelter Leichen zu ertragen. Ob byzantinische oder gotische Soldaten durch die Straßen marschierten, immer redeten sie in unverständlichen Sprachen und immer war Vorsicht geboten, denn die Horden der Plünderer unterschieden nicht zwischen Freund und Feind. Wer in ihre Hände geriet, musste fürchten, das Leben zu verlieren oder als Sklave weggeführt und verkauft zu werden. Jenseits des nahen Tiber brannten die Häuser, von fern klang das Aufschlagen der Sturmböcke, mit deren Hilfe die abziehenden Goten einen Teil der mächtigen Aurelianischen Mauer niederlegten, an der so viele ihrer Krieger das Leben gelassen hatten.
Der Neunjährige erlebte, wie König Totila und sein Heer erneut Rom besetzten. Diesmal öffnete ihnen Verrat die Tore, denn die Habsucht der byzantinischen Beamten und Befehlshaber bedrückte die Einwohner noch mehr als die vorherige Herrschaft der Goten. Totila suchte der dringendsten Not abzuhelfen, und außerdem belohnte er die Römer mit einem Wagenrennen im schon verfallenden Zirkus Maximus. Die Zuschauer verloren sich in dem weiten Areal, in dem einst die Leidenschaft Hunderttausender aufgelodert war.
Wahrscheinlich versagte der geladene Patricius Gordian sich und seiner Familie dieses gespenstische Spektakel, so armselig, dass die Rufe der Zuschauer nicht einmal bis zum nahen Anwesen der Anicier drangen. So versäumte er das letzte Wagenrennen der römischen Antike, veranstaltet von einem Barbarenkönig, dessen Volk bereits dem Untergang geweiht war. Denn bald darauf nahm der betagte byzantinische Feldherr Narses, ein Eunuch, mit seinen Truppen die Stadt im Sturm. Damit erfüllte sich die Prophezeiung des wenige Jahre zuvor gestorbenen Mönchsvaters Benedikt, Rom werde nicht durch König Totila untergehen. Auch die Voraussage eines etrurischen Bauern traf ein, die der Geschichtsschreiber Procopius überliefert hat: Zu Zeiten von Theoderichs Enkel und Nachfolger Athalarich sei eines Tages eine Herde Ochsen über das Friedensforum in Rom getrieben worden; einer dieser verschnittenen Stiere habe plötzlich die Bronzefigur eines Rindes bestiegen, welche dort an einer Fontäne aufgestellt war. Der gerade vorübergehende Bauer meinte, dies bedeute, dass in nicht ferner Zeit ein Eunuch den gotischen Gebieter Roms überwältigen werde.
Auf ihrer Flucht vor den Truppen des Narses töteten die Goten alle Römer, auf die sie trafen. Sie ermordeten auch jene römischen Senatoren, die sie als Geiseln genommen und in Kampanien festgehalten hatten. Am Ende des Krieges waren die alten senatorischen Familien Roms ausgelöscht bis auf ganz wenige, die sich nach Konstantinopel oder Sizilien gerettet hatten oder in Rom hatten überleben können wie der Anicier Gordian.
Innerhalb von zwei Jahrzehnten war die Stadt fünfmal erobert worden. Die meisten Einwohner hatte sie durch Flucht und Tod verloren, aber auch neue waren hinzugekommen, Strandgut der jeweiligen Eroberer: Beamte, kranke oder kriegsmüde Soldaten, die nicht hatten fliehen können oder wollen, Goten vor allem, Griechen, aber auch Heruler, Gepiden, Hunnen, Sachsen … Sie fielen nicht weiter auf, denn schon seit Jahrhunderten lebte in Rom ein buntes Völkergemisch. Die Gestrandeten teilten das Los der verelendeten Bevölkerung, hausten wie sie inmitten von Ruinen, weideten Ziegen am Zirkus Maximus und bauten in ehemals kaiserlichen und patrizischen Gärten Gemüse an, von dem sie sich kärglich nährten. Es fehlte an allem, am schmerzhaftesten war der Mangel an gesundem Wasser. Die Aquädukte, die es noch vor einem halben Menschenalter von den Bergen in die Stadt gebracht hatten, waren zerstört. Die wenigen Quellen im Stadtgebiet reichten nicht aus, und das Wasser aus dem Tiber führte immer wieder zum Ausbruch von Krankheiten.
Als der über siebzigjährige Feldherr Narses die Goten in einer letzten Schlacht am Vesuv vernichtet, die eingedrungenen Franken aus Italien vertrieben hatte und sich als Befreier Roms und Italiens feiern ließ, war Gregor aus dem Hause der Anicier zu einem frühreifen und ernsten Knaben herangewachsen. Hauslehrer unterwiesen ihn in den Anfängen der Wissenschaften, der Vater lebte ihm die altrömischen Tugenden vor. Die fromme Mutter las mit ihm in der Bibel und lehrte ihn beten. Unerschöpflich war ihr Schatz an christlichen Legenden. Tiefen Eindruck machte auf den Knaben die Erzählung von der versuchten Flucht des Apostels Petrus aus Rom: Während der Christenverfolgungen unter Kaiser Nero verließ Petrus seine Freunde, um der drohenden Hinrichtung zu entgehen. Schon außerhalb der Mauern, begegnete ihm ein Mann, den er als Jesus Christus erkannte. Petrus fiel vor ihm nieder und fragte: „Domine, quo vadis, wohin gehst du, Herr?“ Jesus erwiderte: „Nach Rom, um mich erneut kreuzigen zu lassen.“ Beschämt über seine Schwäche in der Nachfolge des Herrn, kehrte Petrus um und erlitt wenig später den Märtyrertod.
Mit der Mutter pilgerte Gregor zu den Gräbern der christlichen Märtyrer und zu den Stätten ihres Martyriums. Noch erhob sich das Flavische Amphitheater in seinen ursprünglichen gewaltigen Ausmaßen, aber schon längst fanden dort keine Gladiatorenkämpfe und Tierhetzen mehr statt. In seinem Oval war, wie unzählige andere Christen, der heilige Bischof Ignatius von Antiochia von Löwen zerrissen worden.
Silvia erzählte dem begierig lauschenden Knaben, wie man den weithin angesehenen syrischen Bischof wegen seines Glaubens verhaftet und nach Rom vor Kaiser Trajan gebracht habe. Auf dessen Frage, warum er das Volk von Antiochia zum Christentum bekehre und damit zum Ungehorsam gegen den Kaiser aufhetze, erwiderte Ignatius nur: „Wie gern hätte ich auch dich bekehrt, damit du das ewige Königreich erlangtest.“
Trajan, vom Mut des greisen Mannes beeindruckt, schlug ihm vor: „Opfere unseren Göttern, und ich will dich zum Obersten Priester machen.“
Ignatius lehnte ab: „Tu mit mir, was du willst, aber meinen Sinn wirst du niemals ändern.“ Bevor die Löwen im Amphitheater sich auf ihn stürzten, rief er: „Weizen Gottes bin ich, die Zähne der wilden Tiere müssen mich zermahlen, damit ich zum Brot Christi werde.“
Als man dem Kaiser davon berichtete, meinte der: „Groß ist der Mut der Christen, wo wäre der Grieche, der solches litte für seinen Gott!“
Vom Amphitheater führte der Weg von Mutter und Sohn zum Grab des Ignatius in der nahen Kirche des heiligen Clemens, des vierten Bischofs von Rom, ebenfalls ein Märtyrer unter der Herrschaft des Kaisers Trajan. Mit einem Anker um den Hals hatte man ihn im Meer versenkt.
Bei nächster Gelegenheit beschwerte sich der kleine Gregor bei seinem Vater über den bösen Kaiser, der so viel unschuldiges Blut vergossen habe. Gordian mag das Wort des christlichen Schriftstellers Tertullian zitiert haben: „Das Blut der Märtyrer ist der Samen der Kirche.“ Und gewiss hat er den Imperator verteidigt. Ungleich anderen Kaisern habe sich Trajan durch Einfachheit der Sitten, Tapferkeit und Gerechtigkeit ausgezeichnet, für Bedürftige gesorgt, Verleumdern nicht getraut, an fremdem Gut sich nicht vergriffen und Unschuldige nicht hingerichtet.
„Aber er hat doch Unschuldige hinrichten lassen“, widersprach der Knabe.
„Nach damaligem Recht und Gesetz galten sie als schuldig“, erklärte Gordian. „Wer nachweislich den Kaiserkult verweigerte, musste wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt hingerichtet werden. Die Christen konnten ihr Leben nur retten, wenn sie den vergöttlichten Kaisern opferten. Jeder römische Bürger konnte Christen anzeigen, aber er musste es nicht. Es durfte nicht gezielt nach ihnen gesucht werden, und anonyme Anzeigen waren nicht zugelassen. Das verbot Kaiser Trajan. Leider hielten sich seine Nachfolger und die Behörden nicht immer an dieses im Grunde weise Gesetz. Außerdem lieben es viele Menschen, andere anzuschwärzen, zu verraten, anzuzeigen. So mussten noch viele Christen sterben, weil sie Gott über den Kaiser stellten und dennoch dem Kaiser gaben, was des Kaisers ist.“
Auf des Knaben Bemerkung, er sei froh, nicht unter diesen schändlichen Menschen gelebt zu haben, sagte der Vater: „Vorsicht! Du sprichst über deine Ahnen. Noch weißt du nicht, welche Schuld du einmal auf dich laden wirst. Dann brauchst auch du das Verständnis und die Vergebung deiner Nachkommen.“
Es ist schwer für ein Kind, sich seine Nachfahren vorzustellen. Noch schwerer ist es zu begreifen, dass der Verfolger gemäß dem Recht handelt und der Verfolgte dennoch im Recht sein kann und beide als gerecht gelten können.
Gregor fragte, hörte zu und versuchte, die Welt der Erwachsenen zu verstehen.
Die Lebensführung seiner Eltern prägte ihn: die Frömmigkeit und Freigebigkeit seiner Mutter gegenüber den Armen, die Männlichkeit und Sittlichkeit des Vater, die Verachtung jeglicher Form von Luxus. Ein Widerhall der elterlichen Zuneigung, die Gregor erfuhr, klingt noch in einem Brief nach, den er als Papst Jahrzehnte später an Theoktista schrieb, die Schwester des Kaisers in Konstantinopel, der die Erziehung der kaiserlichen Prinzen anvertraut war: „Ich bitte Euch, bei der Erziehung … vorzüglich die Bildung des Herzens ins Auge zu fassen … Das Wort der Erzieher ist ja entweder Milch, wenn es gut, oder Gift, wenn es schlimm ist.“ Und in einer seiner Schriften bemerkt er: „Manchen Kindern verschließen die Eltern die Himmelstür, indem sie dieselben schlecht erziehen.“
Von den drei Schwestern seines Vaters, Tarsilla, Aemiliana und Gordiana, ist bekannt, dass sie sich in ihrem Haus einem Leben für Christus weihten nach dem Vorbild jener vornehmen frommen Römerinnen, die schon vor mehr als zweihundert Jahren auf dem nahen Aventin ein Leben in Zurückgezogenheit geführt und so die Tradition eines klösterlichen Lebens in Rom begründet hatten. Allerdings fiel es der jüngsten der Schwestern, Gordiana, schwer, sich an das gemeinsam abgelegte Gelübde zu halten. Nach dem Tod der beiden älteren heiratete sie einen Pächter ihrer Güter und ging mit ihm auf und davon. Damit brach sie nicht nur ihr Gelübde, sondern verletzte auch die Standesehre der Familie, was eine nicht geringe Aufregung verursacht haben mag. Der spätere Papst Gregor kommentierte das Ereignis traurig und auch ein wenig bitter mit dem Bibelwort, dass viele berufen, aber nur wenige auserwählt seien.
Gern hörte der Knabe den Alten zu, wenn sie die Gastfreundschaft im Haus am Clivus Scauri genossen. Einige hatten noch den Gotenkönig Theoderich in Rom einziehen sehen. Dass der König dem Ketzerglauben des Arianismus angehangen hatte, verurteilten sie, meinten aber, Theoderich sei doch lange Zeit ein gerechter und wohlwollender Herrscher gewesen. Erst als er mehr auf Intriganten hörte als auf seine klugen Ratgeber, die römischen Senatoren Boethius und Symmachus, sie ins Gefängnis warf und hinrichten ließ, beschwor er den Untergang seines Volkes herauf.
Viel war auch von dem kürzlich verstorbenen Mönch Benedikt die Rede. Als junger Mann hatte er dem lockeren Treiben in Rom, das unter Theoderichs Herrschaft wieder aufzublühen begann, den Rücken gekehrt und in den Bergen das Leben eines Einsiedlers geführt. Er suchte die dauernden Schätze des Himmels, nicht die vergänglichen der Welt. Der Ruf von seinem gottgefälligen Leben und den Wundern, die er tat, erreichte bald auch Rom. Väter schickten ihre Söhne zu Benedikt, damit er sie lehre, nach dem Willen Gottes zu leben und nicht ihre Jugend in sinnlosem Tun zu vergeuden. Der eine und andere Gast im Haus am Clivus Scauri hatte Benedikt noch in seinem Kloster auf dem Monte Cassino besucht und lobte den Ernst und die Freundlichkeit der Mönche. Benedikts Nachfolger, die sich vor den marodierenden Soldaten in das nahe Kloster am Lateran gerettet hatten, suchten und schätzten den Rat Gordians und seiner Frau.
Immer wieder wollte der kleine Gregor die Geschichten von der Begegnung Benedikts mit dem Gotenkönig Totila hören, von dem vergifteten Brot und den Raben, die Benedikt das Leben gerettet hatten, von dem Wasser, das Benedikt aus dem Felsen hatte fließen lassen. Wie gern wäre auch er einer der Schüler des Mönchs gewesen, um von ihm zu lernen, Wunder zu wirken. Vater Gordian meinte dazu nur, auch böse Menschen könnten Wunder tun. Benedikt selbst sei das Wunder gewesen – mit seinem guten Herzen und seiner geisterfüllten Seele. Um zu werden wie er, müsse man nicht in den Bergen leben.
Die Alten erzählten auch Sagen und Legenden aus weit zurückliegenden Zeiten. Sie priesen Marcus Curtius, der sich in einen Spalt des Forums gestürzt hatte, um die Stadt vor dem Untergang zu bewahren; Römerinnen, die lieber gestorben waren als sich entehren zu lassen; gerechte Kaiser wie Trajan und Marc Aurel; tugendhafte Männer, die rechtschaffenes Handeln höher stellten als eigenen Vorteil.
In seiner Fantasie durchlebte der heranwachsende Gregor noch einmal jene Zeiten, da Senatoren Kaiser in ihre Schranken wiesen; da Römer zu sein nicht Reichtum und Luxus, sondern Selbstverleugnung und Selbstbeherrschung bedeutet hatte. Die Mannhaftigkeit seiner Vorfahren begeisterte ihn. Warum sollte er nicht ebenfalls große Taten vollbringen können! Zwar stand es um Rom nicht zum Besten, und die apokalyptischen Prophezeiungen der Apostel Petrus und Paulus, deren Blut den Boden der Hauptstadt der Welt getränkt hatte, schienen sich zu erfüllen. Aber brauchte es nicht gerade deshalb jetzt, bevor Feuer die Erde verschlang und Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schuf, tapfere und tüchtige Männer, die nicht zweifelten und verzweifelten, sondern Gott und dem Nächsten tatkräftig dienten? Der Knabe wollte ein guter Christ und ein guter Römer werden.
Viel Wasser war aus dem Tiber ins Meer geflossen, seit in Rom Wissenschaften und Künste geblüht hatten. Der Senator und Gelehrte Cassiodor hatte noch als Konsul unter der Herrschaft des Gotenkönigs Theoderich die Wissenschaften in Rom nach Kräften gefördert. Der Krieg hatte Schulen und Bibliotheken zerstört, Lehrer und Schüler in alle Winde zerstreut. Von den ehemals achtundzwanzig öffentlichen Bibliotheken existierten nur noch wenige, und ihr Bestand war dramatisch zusammengeschmolzen. Doch wie dunkel und ärmlich die Zeiten auch daherkommen, immer wieder finden sich Lehrer, die ihr aus den Trümmern der Vergangenheit gerettetes Wissen einer lernbegierigen Jugend mitteilen.
Als Gregor im Alter von vierzehn Jahren die Männertoga angelegt hatte, machte er sich wie einst seine Vorfahren täglich auf den Weg zu den Säulenhallen im Forum Romanum und im Trajansforum, wo Lehrer ihre Schüler in den sieben freien Künsten unterwiesen: Grammatik, Dialektik, Rhetorik, Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik. Der Grammatiker Donatus stand auf dem Lehrplan, ebenso das Studium der Autoren Vergil, Seneca, Cicero, Sallust und Juvenal. Auch die Griechen Homer, Euripides, Demosthenes lasen die Schüler, allerdings nur in der lateinischen Übersetzung. Das Griechische, einst die Sprache der gebildeten Römer, stand nicht mehr hoch im Kurs. Die Zeitumstände verlangten von jenen, die einmal als hohe Beamte die Geschicke der Stadt leiten sollten, vor allem praktische Fähigkeiten. Dazu gehörten die Kenntnis des römischen Rechts und seine Anwendung, Fertigkeiten in der Arithmetik, aber auch in der Heilkunst und im Kriegswesen. Gregors Wissbegier und schnelle Auffassungsgabe zeichneten ihn in allen Unterrichtsgegenständen aus, nur das Fach Rhetorik behagte ihm nicht. Schon Kaiser Marc Aurel hatte vierhundert Jahre zuvor bemerkt, die Rhetorik müsse um der Wirkung willen oft gegen die Wahrheit verstoßen, und sie benutze unlautere, auf schlechte Affekte zielende Mittel.
Welchen Wert sollte es haben, ein Nichts so aufzubauschen, dass es bedeutungsvoll daherkam, eine Lüge so lange im Mund herumzudrehen, bis sie sich als Wahrheit ausgab? Wichtiger als der kunstvolle und auf Überredung zielende Ausdruck war Gregor der Inhalt des Gesagten. Die Regeln des Donatus lernte er zu handhaben, doch fragte er sich, was das klassische Latein, das kaum noch gesprochen und verstanden wurde, für das tägliche Leben taugte. Wie Cicero sprechen zu können, mochte der eigenen Eitelkeit schmeicheln, aber seit Cicero seine Reden auf dem Forum Romanum gehalten hatte, waren mehr als fünfhundert Jahre vergangen. Die heutigen Römer setzten sich aus einer Vielzahl von Völkerschaften zusammen, die zwar Latein sprachen, aber nicht mehr das eines Cicero. Gregor wollte kein Gelehrter werden, der alte Schriften analysierte und verglich, ihm lag daran, die Welt um sich herum verstehen und in ihr handeln zu können. Der Gelehrte Cassiodor, den die Lehrer als Leuchte der Wissenschaft priesen, war dem jungen Gregor sicher kein Vorbild. Der einstige Konsul hatte den Goten gedient und war mit ihnen gescheitert. Nun träumte er auf seinem väterlichen Gut in Kalabrien, das er in ein Kloster umgewandelt hatte, von entschwundenen glanzvollen Zeiten. Seine Mönche beschäftigte er mit dem Abschreiben von alten griechischen Manuskripten, die er selbst gesammelt hatte. Das mochte lobenswert sein, aber gab es nichts Wichtigeres zu tun für einen Mann seines Schlages?
Schnell ist die Jugend mit ihrem Urteil. Später mag Gregor in Cassiodor, der 580 im Alter von fünfundneunzig Jahren starb, einen Bruder im Geiste erkannt haben. Denn auch er sollte an jenen Punkt kommen, den der einstige Kanzler unter Theoderich, gescheitert in seinen Bemühungen um Aussöhnung zwischen Römern und Goten, so beschrieb: „Nachdem ich in Ravenna die Beanspruchungen durch die politische Laufbahn zurückgewiesen hatte, die vom widerlichen Geschmack der weltlichen Sorgen gezeichnet war, nachdem ich in den Genuss des Psalters gekommen war, eines vom Himmel als wahrer Honig für die Seele gekommenen Buches, stürzte ich mich begierig wie ein Dürstender ohne Unterlass in die Arbeit, es auszuforschen, um mich gänzlich von jener heilsamen Süße durchdringen zu lassen, da ich der zahllosen Bitterkeiten des aktiven Lebens überdrüssig war.“
Vorerst sorgten die Eltern dafür, dass Gregor die beste Ausbildung erhielt, die damals nur möglich war. Seine Erfahrungen in der Schule fasste er als Papst so zusammen: „Die Klugheit dieser Welt deckt das Herz mit Ausflüchten zu, verbirgt, was man denkt, bezeichnet das Falsche als wahr und das Wahre als falsch. Und diese weltliche Schlauköpfigkeit bringt man den jungen Leuten für Bezahlung in der Schule bei, und das macht sie hochmütig und lässt sie andere verachten. Jene, die nicht so schlau sind, bewundern die anderen und ordnen sich ihrem Einfluss unter, weil auch sie diese unglückselige Doppelzüngigkeit bewundern und sie Kultur nennen, während es eine mentale Perversion ist.“ All das sei auf nur ein Ziel gerichtet: „Sie lernen, Karriere zu machen und sich damit zufriedenzugeben, zeitlichen Ruhm zu erreichen, mit dem Schlechten zu wuchern und nicht damit aufzuhören, bis sie stark sind, und, wenn sie schwach sind, als gute und friedfertige Menschen zu scheinen, die zu keiner Bosheit fähig sind.“
Verachtet würde hingegen von den Schlaumeiern die Klugheit der einfachen Menschen. Deren Klugheit „prahlt nicht, äußert ihre Gedanken mit eigenen Worten, liebt die Wahrheit, die in den Dingen liegt, vollbringt das Gute uneigennützig und ist eher bereit, das Böse zu erdulden als es zu tun, rächt sich niemals für empfangenes Unrecht und betrachtet es als einen Gewinn, wenn es für die Liebe zur Wahrheit verachtet wird.“
Wir wissen nicht, ob Gregor in seinen frühen Jahren von dieser intellektuellen Überheblichkeit, die er so treffend zu beschreiben weiß, angekränkelt war. Sicher aber ist, dass er wie ehrgeizige Jünglinge aller Zeiten gemeint hat, Rom warte nur auf ihn, damit er in Ordnung brächte, was in Unordnung geraten war. Und wenn die Welt wirklich vergreiste und sich dem Tode zuneigte, wofür vieles sprach, dann wollte er, Gregor, um so mehr tun, damit er im Jüngsten Gericht vor Gottes Angesicht bestehen konnte. So wie sein Vater Gordian, der, vom römischen Bischof zum Regionarius eingesetzt, aufopferungsvoll seinen Dienst an den Armen in der ihm unterstellten Stadtregion versah. Ein beträchtlicher Teil der Erträge aus den Landgütern der Familie floss in die Vorratshäuser der Kirche am Tiberhafen. Gordian erwartete von seinem Sohn, dass er einmal den Familienbesitz verwaltete, vor allem aber, dass er wie alle seine Vorfahren im Senatorenstand dem Gemeinwesen als Beamter diente.
Die Stadt brauchte dringend fähige und integre Beamte. Seit anderthalb Jahrhunderten tobten die Stürme der Völkerwanderung über Italien hinweg und hatten die einst so gut funktionierende Verwaltung des Römischen Reichs zerstört. Niemand wusste mehr, an wen er sich halten sollte, wo er sein Recht finden und wer es durchsetzen konnte. Was nützte das großartige Gesetzbuch des Kaisers Justinian, wenn sich keiner daran hielt! Der Kaiser residierte in Konstantinopel, seine Bevollmächtigten trieben die Steuern ein und machten sich mit ihrer Beute aus Rom davon, sobald die Lage gefährlich wurde. In der sich selbst überlassenen Stadt herrschte immer wieder das Recht des Stärkeren.
Die vor den Vandalen und Goten fliehenden begüterten Römer hatten Häuser und Latifundien, die sie selbst nicht mehr nutzen konnten, an die Kirche verschenkt. So hofften sie, wenn auch nicht ihren Besitz, doch wenigstens ihr Seelenheil zu retten. Auf diese Weise gelangte der römische Bischof unversehens und ungewollt zu wachsendem Grundbesitz, fortan Patrimonium Petri genannt, dem Apostel Petrus geweihtes Land, das er zum Wohle der Bedürftigen zu verteidigen und zu verwalten hatte. Dafür standen ihm aber weder militärische Mittel noch ein Verwaltungsapparat zur Verfügung.
Als der oströmische Kaiser Justinian Italien 562 wieder unter seine Herrschaft gebracht hatte, erwarteten die Römer, dass fortan das Recht regieren und die Stadt wieder aufgebaut würde. Doch als seien sie in Feindesland gekommen, führten sich die byzantinischen Beamten und Soldaten als Sieger auf. Mit leeren Taschen nisteten sie sich in der Stadt ein und zogen reich beladen davon. Immer neue Steuern erlegten sie den Römern und jenen auf, die nach dem Krieg Sicherheit und Frieden in der Stadt suchten. Die Menschen holten sich aus Tempeln und leer stehenden Häusern, was sie zum Überleben brauchten, und die Byzantiner nahmen es ihnen wieder ab.