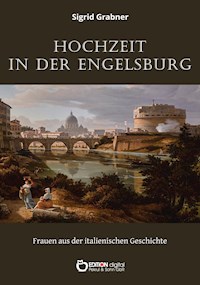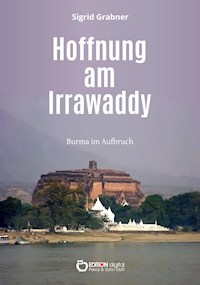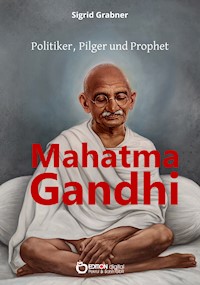
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer berühmte Menschen der Weltgeschichte und ihr Handeln verstehen will, der tut gut daran, sich mit deren Biografie zu beschäftigen. Das gilt auch für diesen Mann, dessen Namen noch immer einen fast heiligen Klang hat – Mahatma Ghandi. Aber wie ist der indische Freiheitskämpfer und Weltveränderer zu dem Menschen geworden, der er war und der eine völlig neue Sicht auf die politischen Auseinandersetzungen erfand und predigte – den gewaltlosen Kampf, eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit und zunächst nur schwer zu verstehen. Wo liegen die Wurzeln für seine Anschauungen und für seine Kraft, für diese Ansichten auch energisch einzutreten und viele Millionen Menschen mitzureißen, obwohl Ghandi noch während seines frühen England-Aufenthaltes etwas große Schwierigkeiten bereitete: Das Schreiben ging ihm leicht von der Hand, doch fiel es ihm schwer, vor vielen Menschen zu reden. Wenn er die Augen eines erwartungsvollen Auditoriums auf sich gerichtet sah, war ihm die Zunge wie gelähmt. Ein anderer musste die Rede für ihn verlesen. Doch dann macht der junge Mann eine entscheidende Entdeckung: Das Buch, welches sein weiteres Leben entscheidend bestimmen sollte, lernte er im zweiten Jahr seines Londoner Aufenthalts kennen. Eines Tages fragten ihn englische Freunde, ob er die Bhagavadgita kenne. Die Bhagavadgita – „Gesang vom Erhabenen“ – ist eine Episode aus dem indischen Heldenepos „Mahabharata“, das zwischen dem fünften und dem zweiten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung entstand. Als die Heere der Pandawas und Kaurawas aufeinandertrafen, zögerte der Held der Pandawas, Arjuna, den Kampf gegen seine Verwandten im Heer der Kaurawas aufzunehmen. Sein Wagenlenker gab sich ihm als Gott Krishna zu erkennen und überzeugte ihn, dass er ohne Rücksicht auf die Folgen pflichtgemäß handeln müsse. Dieses religionsphilosophische Gedicht in achtzehn Gesängen gilt als heiliges Buch der Hindus. Gandhi hatte den Vater manchmal daraus rezitieren hören, ohne viel vom Inhalt zu verstehen. Nun las er es in der englischen Übersetzung. Die Lektüre elektrisierte ihn geradezu. Das war es, wonach er so lange gesucht hatte – ein ethischer Leitfaden zum Handeln. Dieses Beispiel möge genügen, um auf diese Ghandi-Biographie von Sigrid Grabner neugierig zu machen, die besser verstehen lässt, wie dieser indische Freiheitskämpfer und Weltveränderer zu jenem Menschen geworden ist, dessen Namen noch immer eine fast heiligen Klang hat: Mahatma bedeutet übrigens „die große Seele“.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Sigrid Grabner
Mahatma Gandhi - Politiker, Pilger und Prophet
Biografie
ISBN 978-3-96521-663-1 (E-Book)
Umschlaggestaltung: Ernst Franta
Das Buch erschien 1983 im Verlag Neues Leben Berlin.
2022 EDITION digital
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
Sigrid Grabner • Mahatma Gandhi
Für Jeanne und Olaf
Kindheit und Jugend
„Eines schlug tiefe Wurzeln in mir: die Überzeugung, dass Moral die Grundlage aller Dinge und dass Wahrheit die Substanz aller Moralität ist.“
Die Zitate an den Kapitelanfängen stammen von Gandhi.
Die weiße Stadt am Meer
Im altindischen Epos Mahabharata wird erzählt, dass der Baumeister Visvakarma auf Geheiß des göttlichen Krishna in einer einzigen Nacht die Stadt Dvarika auf der Halbinsel Kathiawar im Nordwesten Indiens errichtete. Die Stadt am Meer wuchs und gedieh dank dem Fleiß der Bewohner und der Weisheit ihrer Herrscher. Doch es kam eine Zeit, da Reichtum und Macht die Herrscher verdarben. Der Luxus machte ihren Geist träge und ihre Begierden unersättlich. Sie zerstörten einander und das Land in trunkenem Streit. Etwa hundert Kilometer südlich des sagenumwobenen Dvarika liegt die Stadt Porbandar. In ihr lebten 1872 fünfzehntausend Einwohner – Hindus, Moslems, Parsen und Christen. Innerhalb der dicken hohen Stadtmauern drängten sich die meist einstöckigen Kalksteinhäuser um die Paläste und Gärten des herrschenden Prinzen. Von den grünen Hügeln im Osten wanderte die Sonne über die Stadt hinweg und ließ die Häuser wie weißen Marmor erstrahlen, ehe sie im Meer versank. In den Straßen wuchsen weder Bäume noch Büsche. Nur in den Häusern und Tempeln leuchteten in Töpfen die sattgrünen Blätter und lilafarbenen oder rotweißen Blüten des glückverheißenden Basilienkrautes. Die Hindus trugen Armbänder und Ketten aus seinem Samen und verrichteten ihre Gebete vor den würzig duftenden Pflanzen.
Seit Hunderten von Jahren bewegte sich das Leben in Porbandar in den vorgeschriebenen Bahnen uralter Traditionen. Selbst das Meer vor der Stadt, das Ideen und Waren aus aller Welt an die Küste trug, konnte nicht das in früher Vorzeit entstandene System gesellschaftlicher Verflechtung und gleichzeitiger Isolation unterspülen: das Kastenwesen.
Vor mehr als dreitausend Jahren aus Stammes- und Sippenüberlieferungen hervorgegangen, durch die fortschreitende Arbeitsteilung ständig ausgebaut, widerstand das Kastensystem allen Angriffen von innen und außen. Seine Hauptpfeiler – das Karma (der Glaube an die Wiedergeburt in höherer oder niederer Form) in Abhängigkeit von der Befolgung des Dharma (der Gesamtheit aller religiösen und ethischen Pflichten einer jeden Gruppe) – wiesen jedem Menschen von Geburt an einen festen Platz in der Gesellschaft zu. Die Kastenzugehörigkeit regelte das Leben des einzelnen bis ins Detail: die Geburts-, Heirats- und Totenzeremonien, wie man sich zu kleiden, was man zu essen hatte und was nicht, mit wem man Umgang pflegen durfte und auf welche Weise.
Jeder wusste von früher Kindheit an, dass er sein Dharma befolgen musste, wenn er den sozialen Schutz seiner Kaste nicht verlieren und im nächsten Leben nicht als Angehöriger einer niederen Kaste oder gar als Tier wiedergeboren werden wollte. Auflehnung gegen das Dharma gefährdete die eigene Existenz, seine bedingungslose Befolgung erhöhte die Aussicht auf eine vorteilhaftere Wiedergeburt. An diesem im Laufe der Jahrtausende erstarrten System änderten auch die vielen Einwanderer nichts. Ob sie als Flüchtlinge oder als Eroberer kamen, immer passten sie sich dem vorgefundenen Gesellschaftssystem an oder bedienten sich seiner, um zu herrschen: die aus Persien geflohenen Anhänger der Religion des Zarathustra – die Parsen, die islamischen Moguln, die christlichen Missionare und schließlich die Briten.
Die vier ursprünglichen Hauptkasten – Brahmanen (Priester), Kshatriya (Krieger), Vaishya (Händler und Bauern) und Shudra (Die Angehörigen dieser Kaste muss die niedrigsten Arbeiten verrichten und bildeten offenbar den Grundstock für die „Unberührbaren“.) – spalteten sich in eine Vielzahl von Unterkasten. Sie bildeten eine streng hierarchische Ordnung. Angehörige höherer Kasten durften nicht mit denen niederer Kasten verkehren. Die Arbeit war das einzige Bindeglied zwischen allen Kasten. Die Dienstleistung, die hergestellte Ware galten als „rein“.
Die Moslems und die Parsen von Porbandar betrieben vor allem Handel. Das Meer öffnete ihnen den Weg in die Welt. Sie kannten sich in den Häfen von Aden und Sansibar besser aus als auf dem indischen Festland, wohin man nur mühselig zu Fuß oder mit dem Ochsenkarren gelangte.
Den Hindus verbot ihr Glaube, die „schwarzen Wasser“ zu überqueren. Taten sie es dennoch, verhängten die Kastenältesten schwere Strafen über sie – bis zum Ausschluss aus der Kaste, was einem Todesurteil gleichkam; denn nun durften die Betroffenen nicht einmal mehr den gemeinsamen Brunnen benutzen. So gingen die Hindus zu Hause ihrem Handwerk nach. Sie webten die begehrten Seiden- und Baumwollstoffe, welche die geschäftstüchtigen Moslems und Parsen in arabischen und afrikanischen Häfen mit gutem Gewinn verkauften.
Die Familie Gandhi gehörte zur dritten der vier Hauptkasten, den Vaishyas und zur Unterkaste der Modh Bania, der Kaufleute. Der Name Gandhi bedeutet Kaufmann oder Krämer. Aber seit langer Zeit übte die Familie diesen Beruf nicht mehr aus. Irgendwann einmal hatte sich ein Gandhi dem Herrscherhaus von Porbandar unentbehrlich gemacht. Er vererbte seine Stellung bei Hofe seinem Sohn und dieser wieder dem seinen. 1777 konnte es sich ein Harijivan Gandhi als die rechte Hand des regierenden Ministers von Porbandar leisten, ein stattliches zweistöckiges Haus für seine Familie zu bauen. Harijivans Sohn Uttamchand brachte es durch Intelligenz und Geschick zum Premierminister des Zwergstaates Porbandar. Doch er behielt dieses Amt nicht lange. In einem Streit stellte Uttamchand die Gerechtigkeit höher als die Interessen der anstelle ihres minderjährigen Sohnes regierenden Herrscherin. Die erboste Rani ließ das Haus der Gandhis von Palastwachen umstellen und beschießen. Uttamchand entzog sich der Rache der Regentin durch die Flucht in den Nachbarstaat Junagadh. Als er dem dortigen Herrscher seine Reverenz erwies, grüßte er mit der bei den Hindus als unrein geltenden linken Hand. „Meine rechte Hand“, sagte er, „ist Porbandar verpflichtet.“ Der Prinz bestrafte Uttamchand für seine kühne Geste, indem er ihn zehn Minuten barfuß und barhäuptig in der brennenden Sonne stehen ließ. Doch die Loyalität des ehemaligen Premierministers gegenüber dem Fürstenhaus von Porbandar, das ihm so viel Unrecht angetan hatte, beeindruckte den Prinzen von Junagadh. Nur ungern ließ er den tüchtigen Mann wieder ziehen, als zehn Jahre später die Regentin von Porbandar starb und ihr Nachfolger Uttamchand zurückrief. Der folgte dem Ruf des Herrschers, doch das ihm erneut angetragene Amt des Dewan schlug er aus. Sein jüngster Sohn Karamchand übernahm das silberne Schreibbesteck und den Sandstreuer als Insignien des Dewan von Porbandar.
Karamchand Gandhi versah sein Amt mit Würde, Gerechtigkeitssinn und großem Fleiß. Wie sein Vater galt er als unbestechlich und mutig. Doch ein Kummer überschattete das Leben dieses angesehenen Mannes. Ihm blieb der Sohn versagt, der einmal seine Nachfolge antreten sollte. Dreimal heiratete er, aber die Frauen starben jung oder gebaren ihm nur Mädchen. Nach eingehenden Beratungen mit Priestern und der Familie entschloss sich Karamchand, es ein viertes Mal zu versuchen. Er nahm die um vierundzwanzig Jahre jüngere Putaliba zur Frau. Der Himmel erhörte Karamchands und Putalibas heiße Gebete. Nach dem Mädchen Raliat wurden ihnen die Söhne Lakshmidas und Karsandas geboren.
Am 2. Oktober 1869 kam Mohandas zur Welt. Als der stolze Vater den Neugeborenen im Arm hielt, wusste er, dass Mohandas der Jüngste bleiben würde. Für die zarte Putaliba konnte eine fünfte Schwangerschaft den Tod bedeuten. Karamchand Gandhi war mit seinen siebenundvierzig Jahren fast ein alter Mann. Er behandelte alle seine Kinder gleich, aber den letztgeborenen Sohn Mohandas liebte er am zärtlichsten.
Im Haus seiner Väter bewohnte er mit Putaliba und den vier Kindern das Erdgeschoss: einen vierundzwanzig Quadratmeter großen Raum, in dem es selbst mittags so dunkel war, dass man die Kerosinlampe brennen lassen musste. Zur Wohnung gehörten eine Küche, die nicht mehr als zwei Personen Platz bot, und eine kleine dunkle Kammer, in der Mohandas geboren wurde. In den darüberliegenden zwei Stockwerken wohnten Karamchands fünf Brüder mit ihren Familien. Der Innenhof und die beiden Tempel rechts und links vom Haus boten der großen Kinderschar genügend Raum zum Spielen. Zum Mittagessen fanden sich selten weniger als zwanzig Personen ein. Warumsollte jede Familie für sich kochen, wo es doch billiger und zweckmäßiger war, die Einkommen zusammenzulegen und gemeinsam zu wirtschaften? In der Großfamilie lernten die Kinder frühzeitig, sich in die Gemeinschaft einzufügen. Takt, Rücksicht und Geduld waren nötig, um Reibungen zu vermeiden.
Der Haushalt beanspruchte den größten Teil von Putalibas Zeit. Nicht selten ließ die Gemahlin des Herrschers von Porbandar Putaliba zu sich rufen, um ihren Rat in verschiedenen Angelegenheiten einzuholen. Man schätzte bei Hof den Charakter und die Intelligenz der jungen Frau.
Karamchand oblag neben seinen Pflichten als regierender Minister die Sorge um das Wohlergehen eines jeden Mitglieds der großen Familie. Hochzeiten mussten ausgerichtet, Arbeit vermittelt, Streit geschlichtet werden. Er hielt es auch nicht für unter seiner Würde, Putaliba bei der Hausarbeit zu helfen. Er putzte das Gemüse fürs Essen, während er sich mit Besuchern über Staatsangelegenheiten unterhielt. Der kleine Mohandas wuchs inmitten seiner Geschwister und Vettern auf. Da er der Jüngste war, mussten sich die Älteren um ihn kümmern. Als er sich beim Vollmondfest einmal den Magen verdarb, weil er die aus den Haaren der Mädchen herausgefallenen Blumen gegessen hatte, wurde für ihn das Kindermädchen Rambha angestellt.
Mohandas nutzte jede Gelegenheit, sich ihrer Aufsicht zu entziehen, um an den verlockenden Spielen der Älteren teilzunehmen. Am liebsten ahmten sie Hindufeste nach. Sie schmückten sich und vollzogen die Zeremonien, die sie bei den Erwachsenen gesehen hatten. Doch die aus Lehm nachgebildeten Götterstatuen befriedigten ihre Einbildungskraft nicht. Eines Tages schlug einer der Knaben vor, aus dem nahen Tempel echte Bronzestatuen zu holen. Als die Sonne hoch am Himmel stand und der Brahmane seine Mittagsruhe hielt, schlichen die Jungen in den Tempel. Auf dem Rückweg stolperte einer der Knaben und stieß mit seiner erbeuteten Figur an eine andere. Der helle Klang des Metalls weckte den Priester. Unverzüglich verfolgte er die Missetäter. Sie entwischten ihm auf flinken Beinen, aber er konnte noch sehen, wie sie im Haus der Gandhis verschwanden. Der Onkel befragte die Jungen. Alle leugneten standhaft, an der Sache beteiligt gewesen zu sein, bis die Reihe an Mohandas kam. Seine Lippen begannen zu zittern, stammelnd berichtete er, was sich abgespielt hatte. Er begriff nicht, warum ihn die anderen verächtlich anschauten und in den nächsten Tagen mieden. Lehrten Vater und Mutter nicht, dass man immer die Wahrheit sagen sollte?
So vieles verstand der Fünfjährige nicht. Warum fastete die Mutter? Putaliba gehörte einer besonders strengen Hindusekte an, deren Gebote sie durch Gebete und häufiges Fasten peinlich genau befolgte. Mohandas aß gern und viel und begriff nicht, wie man auf all die schmackhaften Speisen freiwillig verzichten konnte. Manchmal legte Putaliba das Gelübde ab, so lange zu fasten, bis die Sonne wieder schien. Dann stand Mohandas vor der Tür und hielt ungeduldig Ausschau nach der Sonne. Wenn sie endlich durch die dichten Monsunwolken brach, lief er eilends in die Küche und rief die Mutter. Sie folgte ihm ins Freie, doch da war die Sonne oft schon wieder verschwunden. „Macht nichts“, sagte Putaliba dann lächelnd und strich Mohandas tröstend über den Kopf, „Gott wollte nicht, dass ich heute etwas esse.“ Mohandas hatte Angst, die Mutter könnte verhungern.
Auch die Nächte erfüllten ihn mit Furcht. Die Mutter musste eine kleine Lampe in den Schlafraum stellen. Aber der flackernde Schein beruhigte ihn nicht. Lauerten in den Ecken nicht böse Geister oder Diebe, schlich in den zitternden Schatten nicht eine giftige Schlange an sein Lager? Das Kindermädchen Rambha kannte seine Ängste. Sie drückte ihn an sich und flüsterte: „Wenn du dich fürchtest, dann rufe laut ,Rama‘ (Inkarnation des Gottes Vishnu, d. Verf.), immer wieder. Das hilft.“ Mohan das sprach ihr nach. Darüber vergaß er seine Schreckensfantasien und schlief ein.
Doch es lag mehr Licht als Schatten auf den frühen Kindheitstagen des Mohandas Gandhi. Schön war es, morgens zum Waschen an den Brunnen zu laufen und übermütig mit Wasser zu planschen. Schön waren die Stunden im Garten und die Spiele mit den anderen Kindern, schön die religiösen Gesänge der Erwachsenen im Tempel. An Abenden, wenn der Mondschein silbern auf den Dächern der weißen Stadt lag, durften die Kinder noch eine Stunde nach dem Essen im Freien spielen. An Streichen beteiligten sie den kleinen Mohandas nicht mehr. Es hatte sich herumgesprochen, dass er vor den Erwachsenen nichts verheimlichen konnte. Aber wenn ein Streit ausbrach, wenn ein Schiedsrichter gebraucht wurde, dann erwies sich die Wahrheitsliebe des jüngsten Gandhi als hilfreich.
1876 wurde der Vater zum Dewan des Prinzen von Rajkot ernannt und siedelte mit seiner Familie in die fast zweihundert Kilometer nordöstlich von Porbandar gelegene Stadt um. Die Reise auf einem Ochsenkarren dauerte fünf Tage.
Die Briten hatten Rajkot zum Sitz ihrer Politischen Agentur bestimmt. Von hier aus überwachten sie aufmerksam das Geschehen in den mehr als zweihundert Zwergstaaten auf der Halbinsel Kathiawar. Diese Staaten waren oft nicht größer als eine Stadt oder ein Dorf. Die Macht ihrer Herrscher hing von deren Wohlverhalten gegenüber der Kolonialregierung von Britisch-Indien ab. Die Briten hatten Rajkot wie vielen anderen Städten in Indien ihren Stempel aufgedrückt. In überfüllten schmutzigen Mietshäusern wohnten die Inder, während die Kolonialbeamten in komfortablen Bungalows inmitten weiträumiger Gärten residierten.
Die Gandhi-Kinder sehnten sich nach dem frischen Atem der weißen Stadt am Meer, nach den vertrauten Spielgefährten und dem Guavenbaum mit den weißen Blüten und leuchtendgelben Früchten im Innenhof des alten Hauses. Für Mohandas begann der Ernst des Lebens. Er besuchte die Alfred-High-School, die ihre Schüler auf das Universitätsstudium vorbereitete. Obwohl er seinen schulischen Pflichten mit Ernst und Eifer nachkam, erzielte er nur mäßige Noten. Der Unterricht wurde in Englisch erteilt. Die fremde Sprache, die weder Vater noch Mutter beherrschten, fiel ihm schwer. Auch für Sanskrit, die Sprache der heiligen indischen Bücher, konnte er sich nicht begeistern. Mit der Multiplikation stand er auf Kriegsfuß, und vor dem Turnunterricht versuchte er sich zu drücken.
Vierzig Jahre zuvor hatten die Briten in Indien das westliche Bildungssystem eingeführt. Welche Ziele sie damit verfolgten, formulierte der damalige Gouverneur von Agra, Lord Macauly, so: „Wir müssen im Augenblick alles tun, um eine Klasse zu formieren, die zwischen uns und den Millionen von Menschen vermittelt, über die wir herrschen; eine Klasse von Personen, Inder in Blut und Farbe, aber Engländer im Geschmack, in den Meinungen, in den Moralvorstellungen und im Intellekt.“ Britische Bildung prägte seither in wachsendem Maße das geistige Antlitz der privilegierten Schicht Indiens.
Mohandas empfand die von außen kommenden Zwänge besonders schmerzhaft. Er klammerte sich an die Nabelschnur, die ihn mit seinem traditionell ausgerichteten Elternhaus verband, und wehrte sich unbewusst gegen die Schule mit ihren ganz anderen Wertmaßstäben. Obwohl mit einem lebhaften Verstand und einem guten Gedächtnis begabt, versagte er häufig gegenüber den schulischen Anforderungen, weil er sich trotz guten Willens nur schwer anpassen konnte. Sein Englischlehrer meinte gar, der Junge sei dumm. Während des Besuches eines englischen Schulinspektors sollten die Jungen fünf englische Wörter schreiben. Mohandas war der einzige, der das Wort „kettle“ falsch schrieb. Der Lehrer gab dem Jungen durch Zeichen zu verstehen, er möge das Wort richtig von seinem Nachbarn abschreiben. Mohandas dachte gar nicht daran und verdarb dem Lehrer seinen Triumph. Er blieb dabei, richtig gehandelt zu haben. Wenn Abschreiben Betrug war, wie der Lehrer so oft gesagt hatte, dann musste dieser Satz immer gelten. Mohandas wurde scheu, unsicher, fürchtete, sich lächerlich zu machen. Die Eltern verstanden seine Sorgen nicht. Sie lebten in einer anderen Welt. Zu ihrer Zeit machte man noch nicht so viel Aufhebens von der Schule. Karamchand Gandhi hatte drei oder vier Jahre eine Schule besucht und las und schrieb nur in der Landessprache Gujarati. Putaliba konnte weder lesen noch schreiben. Dennoch rühmte ein jeder Karamchands geistige und charakterliche Vorzüge und Putalibas Klugheit und Gerechtigkeitssinn. Was sagten Zensuren schon über einen jungen Menschen aus! Auf den Charakter kam es an. Der britische Schulinspektor war anderer Meinung. Ein guter Untertan brauchte keinen Charakter, nur ein gewisses Maß an Bildung. Menschen mit eigenen Ideen und dem Willen, sie in die Tat umzusetzen, erschwerten erfahrungsgemäß das Regieren.
Nicht nur in der Schule, auch zu Hause geriet Mohandas in Schwierigkeiten. Eines Tages unterhielt er sich mit Uka, einem Straßenkehrer, der Hof und Toilette reinigte. Solch eine Arbeit verrichten nur Kastenlose. Jeder Kastenhindu vermeidet es, Fäkalien oder Schmutz zu berühren. Auch der Umgang mit jenen, die das tun, macht unrein. Putaliba rief Mohandas zu sich, wies ihn an, sofort eine reinigende Waschung vorzunehmen und im Tempel zu beten, um auch seine Seele zu reinigen, die durch das Gespräch mit Uka beschmutzt worden sei. Der Junge schaute die Mutter erstaunt an. So erregt, ja böse hatte er sie noch nie erlebt. Er verstand ihren Zorn nicht.
„Wieso ist das, was ich getan habe, eine Sünde, wenn im ,Ramayana‘ einer, der heute als Unberührbarer gilt, den Gott Rama in seinem Boot über den Ganges fuhr?“, fragte er. Die Mutter ging nicht auf den Vergleich mit dem altindischen Epos ein, sie verbot ihm jeglichen Umgang mit Kastenlosen. Mohandas war traurig, dass sie ihm seine ppFrage nicht beantwortet hatte. Er verstand nicht, wie man Rama durch Gebete und Fasten ehren und ihn gleichzeitig der Sünde des Umgangs mit einem Kastenlosen zeihen konnte. Oder gab es auch hier verschiedene Maßstäbe? Mohandas wollte schnell erwachsen werden, um die Welt der Erwachsenen zu begreifen. Er kam auf die Idee, das Rauchen mache aus einem Knaben einen Mann. Gemeinsam mit einem Vetter sammelte er weggeworfene Zigarettenkippen und rauchte. Aber die kurzen Züge reichten nicht aus, elegante Rauchkringel in die Luft zu blasen, wie sie es bei den Erwachsenen gesehen hatten. Für ein paar gestohlene Kupfermünzen kauften sie sich billige Zigaretten. Doch wo sie verstecken? Es würde großen Ärger geben, wenn der Vater oder die Mutter sie fanden. Im Haushalt der Gandhis war es verpönt, zu rauchen, Alkohol zu trinken oder Fleisch zu essen. Also drehten die Knaben Zigaretten aus getrockneten Kräutern. Aber die brannten nicht. Verzweifelt, weil es ihnen nicht gelang, erwachsen zu werden, wollten die Jungen lieber sterben als Kinder bleiben. Sie sammelten im Wald den Samen einer Pflanze, von dem sie wussten, dass sein Genuss giftig ist. Eines Abends schlichen sie in einen Tempel, um an heiliger Stätte von der Welt Abschied zu nehmen. Doch dann verließ sie der Mut. Sie gelobten einander, mit dem Rauchen zu warten, bis ihnen niemand mehr Vorschriften machen konnte.
Ehe auf indisch
Für Mohandas rückte die Zeit des Erwachsenseins schneller heran, als er geahnt hatte. 1882 beschloss Karamchand Gandhi, den knapp dreizehnjährigen Mohandas und seinen älteren Bruder Karsandas zu verheiraten. Karamchand Gandhi war nun sechzig Jahre alt. Es dünkte ihn höchste Zeit, seine irdischen Angelegenheiten zu ordnen, wozu er auch die Verheiratung seiner beiden jüngsten Söhne zählte. Für Mohandas hatte er die gleichaltrige Kasturba zur Frau bestimmt. Sie war die Tochter von Gokuldas Makanji, einem Kaufmann aus Porbandar und guten Freund der Familie. Der Junge fügte sich in den Willen des Vaters nur allzugern, weil er so für einige Monate die Schule in Rajkot verlassen und nach Porbandar zurückkehren konnte.
Im Hause der Gandhis in Porbandar bereitete man eine dreifache Hochzeit vor – die der Gandhi-Brüder und eines ihrer Vettern. Die Gandhis waren keine reichen Leute und konnten es sich nicht leisten, jedem der Knaben eine kostspielige Hochzeitsfeier auszurichten.
Karamchand Gandhi hielten seine Amtspflichten bis zum letzten Augenblick in Rajkot fest. Die Tradition verlangte, dass der Vater auf der Hochzeit seiner Söhne anwesend war. Die Reise von Rajkot nach Porbandar dauerte gewöhnlich fünf Tage, Karamchand Gandhi aber trieb zur Eile, er musste die Strecke in drei Tagen zurücklegen. Kurz vor dem Ziel verunglückte der überstrapazierte Wagen. Rechtzeitig, aber mit schweren Verletzungen, erreichte Karamchand das Hochzeitshaus. Von diesem Unfall sollte er sich nie wieder erholen.
Am Hochzeitstag bestieg Mohandas zur festgesetzten Stunde ein mit Federbüscheln und vergoldetem Zaumzeug geschmücktes Pferd und ritt in feierlicher Prozession inmitten der Verwandten zum Haus seiner Braut. Dort erwartete ihn, auf einem Podest sitzend, die kleine Kasturba. Sie war ein hübsches Mädchen mit einem ovalen Gesicht, großen dunklen Augen, vollen Lippen und einem Kinn, das Willensstärke verriet. Mohandas setzte sich steif neben sie. Als die Kinder die vorgeschriebenen Gebete verrichtet hatten, erhoben sie sich, umrundeten mit sieben Schritten das heilige Feuer und sprachen dabei das Heiratsgelübde der Hindus:
„Tu den ersten Schritt“, begann Mohandas, „damit wir Willensstärke haben.“ – „Jedem deiner Schritte werde ich folgen.“ – „Tu den zweiten Schritt, damit Lebenskraft in uns einströmt.“ – „Jedem deiner Schritte werde ich folgen.“ – „Tu den dritten Schritt, damit wir in wachsendem Wohlstand leben.“ – „Deine Freuden und Sorgen werde ich teilen.“ – „Tu den vierten Schritt, damit wir immer voller Freude sind.“ – „Mein Leben soll dir geweiht sein. Ich werde Worte der Liebe zu dir sprechen und für dein Glück beten.“ – „Tu den fünften Schritt, damit wir dem Volk dienen.“ – „Ich werde dir immer folgen und dir helfen, dein Gelübde, dem Volk zu dienen, zu halten.“ – „Tu den sechsten Schritt, damit wir unseren religiösen Gelübden im Leben folgen.“ – „Ich werde dir folgen, unsere religiösen Gelübde und Pflichten zu erfüllen.“ – „Tu den siebenten Schritt, damit wir immer als Freunde leben.“ – „Es ist die Frucht meiner guten Taten, dich als Ehemann bekommen zu haben. Du bist mein bester Freund, mein religiöser Lehrer und mein unumschränkter Gebieter.“
Als sie so gesprochen hatten, schob Mohandas Kasturba ein Stück süßes Weizengebäck in den Mund und empfing ein ebensolches aus Kasturbas Händen. Nun waren beide nach dem Hinduritus Mann und Frau. Ungleich noch jüngeren Paaren, wo die Braut im Haus ihrer Eltern blieb, wurden Mohandas und Kasturba als reif genug angesehen, die Hochzeit auch körperlich zu vollziehen. Kasturba folgte Mohandas in das Haus der Gandhis, wo sie von nun an lebte. Vor der Hochzeitsnacht nahm die Frau des ältesten Bruders Lakshmidas Mohandas beiseite und klärte ihn in wenigen Worten über seine ehelichen Rechte und Pflichten auf.
So begann nach altem indischem Brauch eine der Ehen, die in vielen Fällen zu einem vorzeitigen körperlichen Verfall der jungen Inder führten. Zwei Kinder wurden in den Ozean des Lebens geworfen, ohne vorher die Fähigkeit erworben zu haben, sich in ihm zu behaupten. Sie kannten einander nicht. Niemand fragte danach, ob sie überhaupt zusammenpassten. Seit altersher suchten die Eltern für ihre Söhne die Bräute aus. Das Mädchen musste aus derselben Kaste stammen, eine gute Mitgift einbringen und gesund sein. Es war dazu erzogen worden, im Mann und in der Familie den Sinn seines Lebens zu sehen. Nach der Hochzeit folgte das Mädchen dem Ehemann in dessen elterliches Haus. Es stand auf der untersten Stufe der Familienhierarchie, und wenn es keinen Sohn gebar, wurde es oft schlechter behandelt als eine Dienstmagd. Eine Scheidung war unmöglich. Schutzlos lieferte das Gewohnheitsrecht die Braut dem Wohlwollen oder der Ungunst des Schwiegervaters aus. Er und nach seinem Tode ihr Mann bestimmten ihr Leben. Wenn der Mann starb, musste sie als Dienstmagd im Hause seiner Verwandten bleiben. Nach dem Hinduglauben hatte die Frau den frühen Tod ihres Mannes durch ihre Sünden in einem früheren Leben verursacht. Kehrte sie dennoch zu ihren eigenen Verwandten zurück, hörte sie dort dieselben Vorwürfe. Für eine kinderlose Frau oder eine Witwe konnte die Ehe zur Hölle werden.
Die familiären Beziehungen im Hause der Gandhis waren auf gegenseitige Rücksichtnahme, Achtung und Verehrung gegründet. Kasturba brauchte keinen tyrannischen Schwiegervater zu fürchten. Die Problematik der Ehe zwischen Mohandas und Kasturba wurde vor allem durch das kindliche Alter der Eheleute bestimmt. Ihre geistige und charakterliche Entwicklung lag noch weit hinter ihrer körperlichen Reife zurück. Mohandas war sehr verliebt in Kasturba und nahm seine neue Rolle als Ehemann ernst. Eifersüchtig verfolgte er jeden ihrer Schritte, machte ihr heftige Szenen, wenn sie ohne seine Erlaubnis das Haus verließ oder gar mit anderen Kindern spielte. Sie hatte nur ihm zu gehorchen. Kasturba, ein eigenwilliges Mädchen, dachte gar nicht daran. Je mehr er ihr seinen Willen aufzwingen wollte, desto zäher widersetzte sie sich. Sie schaute ihn aus ihren großen schönen Augen an, drehte sich um und ließ ihn einfach stehen. Dann sprachen sie tagelang kein Wort miteinander. Während der Schulstunden konnte Mohandas kaum an etwas anderes denken als an die Nächte mit Kasturba. Er hatte durch die Hochzeit ein Schuljahr verloren und lief nun Gefahr, ein weiteres Schuljahr zu verpassen. Zum Glück für das junge Paar holten Kasturbas Eltern das Mädchen oft für Wochen und Monate zu sich nach Hause, so dass dem ungebärdigen jungen Ehemann nichts anderes übrigblieb, als seufzend zu seinen Büchern zurückzukehren. Er widmete sich ihnen so intensiv, dass es ihm gelang, in kurzer Zeit das Versäumte aufzuholen.
Gandhis bester Freund in Rajkot war der gleichaltrige Moslem Sheikh Mehtab. Der starke athletische Junge zog Mohandas an wie ein Magnet. Mehtab lachte über seine Ängste vor Dieben, Geistern und Schlangen. Er fürchtete sich vor nichts und niemandem. Die Eltern, der Bruder und Kasturba warnten Mohandas vor der Freundschaft mit Mehtab, der als Taugenichts galt. Mohandas aber ließ sich nicht beirren. Obwohl er hohe moralische Anforderungen an sich selbst stellte und eigene Fehler ihn in Tränen ausbrechen ließen, faszinierte ihn an Mehtab gerade die Unbekümmertheit, mit der sich dieser über die gängigen Moralvorstellungen hinwegsetzte. Mehtab überredete Mohandas dazu, Fleisch zu essen. Diese Sitte fand unter den Jugendlichen von Rajkot immer mehr Anhänger. Sie argumentierten, dass die Engländer Indien nur beherrschen könnten, weil sie Fleisch aßen. Das mache sie stärker und klüger als die Inder, die nur vegetarisch lebten. Anders konnten sich die Jungen die Macht der weißen Sahibs nicht erklären. Auch den vierzehnjährigen Mohandas beeindruckte dieses Argument. In ihm wuchs die Überzeugung, dass Fleischessen gut war, dass es ihn stark und mutig machen würde und dass, wenn alle Inder zu Fleisch übergingen, die Engländer bezwungen werden könnten. So traf er sich denn klopfenden Herzens mit Mehtab am einsamen Flussufer des Aji, um sich dem verbotenen Fleischgenuss hinzugeben. Das schlecht zubereitete Ziegenfleisch schmeckte wie Leder. Nur mühsam überwand Mohandas den aufsteigenden Ekel. Doch gegen sein schlechtes Gewissen und die Albträume vermochte er nichts auszurichten. Nachts schreckte er aus dem Schlaf, weil er meinte, die Ziege in sich meckern zu hören.
Mohandas war von seinen Eltern als Vegetarier erzogen worden. Sie verehrten den Hindugott Vishnu, gehörten also zu der religiösen Gruppe der Vaishnavas. Wie die Religionsgemeinschaft der Jains lebten die Vaishnavas streng vegetarisch. Der Jainismus, im sechsten Jahrhundert vor der Zeitrechnung als eine Reformbewegung gegen den orthodoxen Hinduismus entstanden, ohne sich je von ihm zu lösen, spielte in der Gandhi-Familie eine große Rolle. Jainpriester gingen in ihrem Haus aus und ein. Die Jains glauben, dass alle Lebewesen, selbst die kleinsten und unsichtbaren, eine Seele haben. Ihre Priester binden sich deshalb ein weißes Tuch vor Mund und Nase, um auch nicht das kleinste Lebewesen einzuatmen. Sie vermeiden nächtliche Gänge, auf denen sie unbeabsichtigt Käfer und anderes Kleingetier zertreten könnten. Jegliche Tötung oder Gewalt gegen Leben gilt bei ihnen als Sünde. Ihre Doktrin der Gewaltlosigkeit (ahimsa) sollte in Gandhis Leben einmal eine entscheidende Rolle spielen.
Für Karamchand und Putaliba war der Genuss von tierischem Fleisch deshalb unvorstellbar. Mohandas kämpfte tapfer gegen seine Ängste und seinen Widerwillen an. Oft trafen sich die Jungen an geheimen Orten und hielten ausgiebige Fleischmahlzeiten. Zu Hause sorgte sich die Mutter um Mohandas, weil er nichts essen wollte. Er fühlte sich erbärmlich, wenn er sie so belog. Von klein auf geradezu besessen von dem Wunsch, die Wahrheit zu sagen, litt er darunter, seine Eltern zu betrügen. So schwor er sich endlich, kein Fleisch mehr zu essen, solange die Eltern lebten. Der Bruder Karsandas aber aß weiterhin Fleisch. Er machte Schulden, die Gläubiger drängten. Mohandas und er beschlossen, das geliehene Geld mit dem Glied eines goldenen Armbands zurückzuzahlen. Den Eltern blieb der Verlust nicht verborgen. Sie befragten die Brüder, und beide beteuerten, nicht zu wissen, wo das Kettenglied geblieben sei. Tagelang quälte sich Mohandas, dann ertrug er sein schlechtes Gewissen nicht länger. Er schrieb ein Geständnis nieder und gab es dem Vater. Die gefürchtete Bestrafung blieb aus, aber der Kummer und die Tränen des Vaters schmerzten ihn schlimmer als Schläge.
Auch das Bordell ersparte Mehtab Mohandas nicht. Stocksteif und halb bewusstlos vor Scham saß Mohandas neben einer Frau, bis man ihn zornig davonjagte. Ein zweites Mal betrat er ein solches Etablissement nicht mehr.
Viel Zeit verbrachte der junge Mohandas am Krankenbett seines Vaters. Nach dessen Unfall hatte sich eine Fistel im Körper gebildet, die das Gewebe zerstörte. Gegen eine Operation wehrte sich Karamchand aus religiösen Gründen. Bald konnte er sein Lager nicht mehr verlassen und musste gepflegt werden. Mohandas wusch den Vater, massierte ihn, las ihm vor. Er tat das alles gern und voller Hingabe. In ihm wurde der Wunsch wach, Arzt zu werden. Doch er behielt diesen Gedanken für sich, um den Vater nicht zu betrüben. Der Glaube seiner Eltern verbot „die Zerstücklung toter Körper“.
Karamchands Religiosität war von einer anderen Art als die seiner Frau. Putaliba lagen philosophische Gedanken fern. Sie hatte ihren Gott gefunden. Karamchand aber suchte seinen Gott. Um das Krankenbett des angesehenen Ministers scharten sich oft Freunde und Priester verschiedener Glaubensrichtungen. Mullahs lasen aus dem Koran, Parsen trugen die Lieder des Zarathustra vor, Jainpriester den „Heiligen See der Taten Ramas“, eine Bearbeitung des altindischen Epos „Ramayana“ aus dem sechzehnten Jahrhundert. Die Männer diskutierten über religiöse Fragen. Es ging ihnen nicht darum, ihren Glauben als den alleinseligmachenden hinzustellen, sondern die gemeinsame Wurzel ihrer Religionen zu finden. Mohandas hörte ihnen aufmerksam zu. Vieles verstand er noch nicht, aber einige Sätze gruben sich tief in sein Gedächtnis ein, so zum Beispiel die des Dichters Tulsidas: „Wenn du Licht in dir und um dich haben willst, dann nimm Ramas Namen auf deine Zunge, wie man eine Rubinlampe auf die Türschwelle stellt.“ Hatte das Kindermädchen Rambha nicht dasselbe gemeint? Der freie Geist, der Ernst und die Toleranz dieser Gespräche formten Mohandas nachhaltig. Aber er war auch ein Jüngling von sechzehn Jahren und ein Ehemann dazu. Es klang schön, wenn Tulsidas sagte: „Wer frei ist von jeder Begierde und in der Verehrung Ramas aufgeht, der hat sein Herz zu einem Fisch im Nektar-See der Liebe zum Namen Gottes gemacht.“ Das Verlangen nach Kasturba war stärker.
Eines Abends ließ er den Vater in der Obhut eines Onkels zurück und eilte zu seiner hochschwangeren Frau. Zehn Minuten später klopfte ein Diener an seine Tür. Der Vater war tot. Wenige Tage zuvor hatte Karamchand gesagt: „Manu (so nannte er seinen jüngsten Sohn, d. Verf.) wird der Stolz unserer Familie sein; er wird meinem Namen Ruhm bringen.“ Mohandas war untröstlich. Wie hatte er seinen Vater so enttäuschen können! Statt in der letzten Minute bei ihm zu sein, war er seinem sexuellen Trieb gefolgt. Verbot doch der Glaube ohnehin den Geschlechtsverkehr mit einer schwangeren Frau. Wenige Tage später gebar Kasturba ihr erstes Kind. Es lebte nur kurze Zeit. Mohandas machte sich zeit seines Lebens bittere Vorwürfe.
Nach dem Tod des Vaters geriet die Familie in finanzielle Schwierigkeiten. Karamchand Gandhi hatte während seiner Amtszeit keine Reichtümer erworben. Er hätte eher gebettelt, als auch nur einen Ana unrechtmäßig an sich zu nehmen. Seine Kinder waren ihm Reichtum genug.
Während der Krankheit des Vaters hatte Mohandas keine Zeit gefunden, sich für das Aufnahmeexamen in ein College vorzubereiten. Nur mühsam bestand er schließlich die Prüfung für das Samalda College in Bavnagar. Die Mühe erwies sich als vergeblich. Mohandas konnte sich in Bavnagar nicht eingewöhnen. Seine Englischkenntnisse waren schlecht, er kam mit dem Unterrichtsstoff nicht zurecht, Kopfschmerzen und Heimweh plagten ihn. Ein Freund der Familie, den die Mutter um Rat fragte, meinte, der Junge solle in England studieren. Wenn er einmal in die Fußtapfen seiner Väter treten wolle, reichten Intelligenz und Geschick nicht mehr aus, den Posten eines Dewan zu bekleiden. Englische Bildung und englisches Benehmen waren auch in den Fürstenstaaten zunehmend gefragt. Jedermann im Haus erinnerte sich, welche Aufregung geherrscht hatte, wenn Karamchand einmal zu einem Empfang beim britischen Gouverneur geladen war. Wie unbeholfen hatte der sonst so selbstbewusste Dewan in den engen Beinkleidern und den ungewohnten Schuhen gewirkt. Schon Tage zuvor war er nervös gewesen, weil er des Englischen nicht mächtig war und sich fürchtete, etwas falsch zu machen.
Die Mutter widersetzte sich der Absicht, Mohandas nach England zu schicken. Ihr Jüngster sollte nicht in dem „Sündenbabel“ London untergehen, wo, wie man hörte, alle Fleisch aßen, Alkohol tranken, rauchten und Bordelle besuchten. Doch Mohandas war von dem Gedanken, in London zu studieren, ganz besessen. London – das Zentrum der Welt und der Zivilisation! Dort würden ihm alle seine Fragen beantwortet werden.
Die Gandhis hielten Familienrat. Der älteste Bruder von Karamchand, nach dessen Tod das Oberhaupt der Familie, gab zu bedenken, dass eine Reise über die „schwarzen Wasser“ Ausschluss aus der Kaste bedeutete. Doch wenn die Mutter einverstanden sei, wolle er nicht im Wege stehen. Putaliba war dagegen, aber Mohandas blieb hartnäckig. Wenn er nur das Geld für das Studium beschaffen konnte, dann würde die Mutter sicher nachgeben. Die Regierungen von Porbandar und Rajkot hatten gegenüber seinem Vater noch finanzielle Verpflichtungen, groß genug, ihm ein Stipendium zu gewähren. Sorgfältig bereitete sich Mohandas auf einen Besuch bei Mister Lely, dem britischen Administrator, vor. Er lernte einige Sätze auswendig, übte tiefe und korrekte Verbeugungen und verwandte viel Zeit auf sein äußeres Erscheinungsbild. Hoffnungsvoll machte er sich auf den Weg, der schon an der Tür des Administrators endete. Mister Lely fertigte ihn kurz und unfreundlich ab. Der junge Mann, sagte er, solle erst einmal sein Staatsexamen in Indien ablegen, ehe er große Pläne schmiede. Dann könne man weitersehen.
Lakshmidas konnte den Kummer seines kleinen Bruders nicht länger ertragen. Irgendwie gelang es ihm, das Geld für die Reise und das Studium zusammenzuborgen. Wenn Mohandas mit einem akademischen Titel aus London zurückkehrte, würde er genug verdienen, um sie alle zu ernähren. Blieb die Frage des Studienfachs. Mohandas gab seinen geheimen Wunsch preis, Medizin zu studieren. Lakshmidas war entsetzt. Hatte Mohandas denn ganz vergessen, dass ihm der Glaube seiner Väter verbot, Arzt zu werden? Nein, er sollte Jura studieren, damit er einmal die Stelle des Vaters am Hof einnehmen konnte oder gar einen Platz in der britischen Verwaltung erhielt. Mohandas fügte sich, Hauptsache, er konnte nach England fahren. Aber die Mutter wollte sich nicht umstimmen lassen. Ein Jainmönch kam Mohandas zu Hilfe. Er ließ ihn im Beisein von Putaliba das feierliche Gelübde ablegen, in England keinen Alkohol, kein Fleisch und keine Frau anzurühren. Damit waren zwar ihre Bedenken zerstreut, aber nicht ihr Kummer aus der Welt geschafft, dass ihr Jüngster sie verließ. Unter Tränen legte sie ihm ein Halsband aus Samen des Basilienkrautes um, das ihn beschützen sollte. Die Reise war nun für Mohandas beschlossene Sache. Der Schwiegervater war außer sich, Kasturba weinte, Freunde und Bekannte warnten den jungen Mann. Der achtzehnjährige Mohandas durchlebte schwere Monate. In Bombay, wo er einige Zeit vor seiner Abreise weilte, trat der Kastenrat der Modh Bania zusammen und stellte ihn zur Rede. Mohandas verteidigte seinen Entschluss, in London zu studieren. Wenn noch kein Modh Bania im Ausland gewesen sei, dann würde er eben der erste sein, meinte er. Er verwies auf sein Gelübde. Die Kastenältesten ließen sich nicht überzeugen, sie verboten die Reise. Wenn der junge Gandhi sie trotzdem antrete, schließe man ihn aus der Kaste aus und jene, die mit ihm verkehrten, ebenfalls. Der Ausschluss aus der Kaste bedeutete für den Betroffenen die Lösung aller bisherigen gesellschaftlichen, ja sogar familiären Bindungen. Er musste fortan das rechtlose Leben eines Kastenlosen führen. Gandhi war bereit, diesen Preis zu zahlen.
An einem Septembertag des Jahres 1888 bestieg Mohandas Gandhi in Bombay die „S. S. Clyde“. Hinter ihm lag ein schwerer Abschied von der Mutter, die er nicht mehr wiedersehen sollte, von Kasturba und dem wenige Monate alten Sohn Harilal. Der Urteilsspruch des Kastenrates klang ihm noch in den Ohren: „Von heute an soll dieser Jüngling als Kastenloser behandelt werden. Wer immer ihm hilft oder ihn am Hafen verabschiedet, wird mit einer Strafe von einer Rupie und vier Anas belegt.“
Bombay versank hinter dem Horizont und mit ihm die Kindheit und Jugend von Mohandas. Die Grundmuster des Menschen, der einmal Mahatma – die große Seele – genannt werden sollte, waren geprägt. Doch niemand, am wenigsten er selbst, erkannte sie in diesem schüchternen, ein wenig schwerfälligen Jungen. Einzig der sterbende Vater hatte sie mit der Klarsichtigkeit des Leidenden erahnt.
Jahre in England
„Meine Schüchternheit ist in Wirklichkeit mein Schirm und Schild gewesen. Sie hat mir erlaubt zu wachsen.“
In der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts besaß Großbritannien das größte Kolonialreich der Weltgeschichte. Der Union Jack wehte auf allen Kontinenten. Englische Schiffe beherrschten die Meere. Im Zentrum der Macht, in London, stapelten sich Waren aus aller Herren Ländern in riesigen Lagerhäusern, lenkten die allmächtige Bank von England und Handelshäuser mit klingenden Namen den Welthandel. In den Fabriken von Manchester, Birmingham und Sheffield klapperten die Webstühle, dröhnten die Dampfhämmer. Schornsteine überzogen die Industriegebiete mit Ruß und Asche. England war die Werkstatt der Welt. Königin Victoria, seit 1876 nannte sie sich auch Kaiserin von Indien, sonnte sich im Glanz des einhundertsechskarätigen Kohinoors, einem „Geschenk“ aus Indien. Die Blütezeit des englischen Kapitalismus erhielt nach ihr den Namen Viktorianisches Zeitalter.
Doch die hektische Aktivität des Kapitals mehrte nicht nur die Macht und den Reichtum der Bourgeoisie, sie produzierte in dem besitzlosen Lohnarbeiter auch den Klassengegner der Bourgeoisie, das Proletariat. Zwölf Stunden am Tag und mehr schufteten Männer, Frauen und Kinder für einen Hungerlohn. Sie vegetierten in Elendsquartieren, starben in jungen Jahren an Unterernährung und Krankheiten. Aus dem Elend erwuchsen der Hass auf die Ausbeuter und die Sehnsucht nach einem menschenwürdigen Dasein. Während spontaner Aufstände und Streiks entstanden erste Klassenorganisationen. Die machtvolle Chartistenbewegung, in der auch Friedrich Engels mitarbeitete, stritt für politische Rechte. Eine Londoner Druckerei druckte das Kommunistische Manifest, in London schrieb Karl Marx das „Kapital“.
England entwickelte sich zum Zentrum der internationalen Arbeiterbewegung. Eine Periode geistigen Umbruchs erschütterte die Gesellschaft. Der Kapitalismus hatte die alten Normen der christlichen Moral zerstört und an ihre Stelle das erbarmungslose Recht des Stärkeren gesetzt. Das allgemeine Unbehagen an der menschenfeindlichen Natur einer auf Erfolg und Profit aufgebauten Gesellschaft brachte eine Vielzahl geistiger Strömungen hervor. 1864 wurde in London die I. Internationale gegründet, 1871 erschien Darwins Buch „Von der Entstehung der Arten“, 1889 veröffentlichte Bernard Shaw seine „Fabianischen Essays“, Kropotkin schrieb an seiner „Gegenseitigen Hilfe in der Menschen- und Tierwelt“.
Von alledem hatte Mohandas Gandhi noch nie etwas gehört. Den feudalen Zwergstaat Porbandar trennte von London nicht nur der halbe Erdball, sondern auch eine ganze historische Epoche. Die Lehrer in Rajkot hatten den Glanz und die Glorie Britanniens gepriesen, Shakespeare und Milton zitiert und Admiral Nelson gefeiert. Politische Ökonomie und gesellschaftskritische Schriften jedoch standen nicht auf dem Lehrplan.
Mohandas Gandhi beschäftigten näherliegende Dinge. Nun, da er dem Ziel seiner Sehnsucht nahe war, verließen ihn alle Energie und aller Mut. Der Achtzehnjährige fühlte sich auf dem Schiff nach England recht hilflos. Sein mangelhaftes Englisch erschwerte ihm den Umgang mit den Passagieren. Die Speisekarte war ihm ein Buch mit sieben Siegeln. Er hatte nicht gelernt, mit Messer und Gabel umzugehen. So blieb er tagelang in seiner Kabine und ernährte sich von den getrockneten Früchten und den Süßigkeiten, die ihm die Mutter reichlich mitgegeben hatte. Endlich lernte er einen jungen Inder kennen, der wie er nur fleischlose Kost aß. Mit seiner Hilfe drang er in die Geheimnisse der Speisekarte ein. Wieder ausreichend ernährt und einigermaßen sicher im Umgang mit dem Essbesteck, schwand Gandhis Scheu vor den anderen Passagieren. Doch was sie ihm über England und die dortigen Sitten erzählten, war nicht dazu angetan, sein Selbstvertrauen zu stärken. In England, so sagte man ihm, müsse er seine guten Vorsätze über Bord werfen. Bei einem solchen Klima ohne Alkohol und vor allem ohne Fleisch auskommen zu wollen bedeute glatten Selbstmord. Die Nordländer wüssten schon, warum sie keine Vegetarier seien. Und was die Frauen beträfe, so brauchten sie ihn wohl nicht aufzuklären. Mohandas spürte die Kette seiner Mutter auf der Haut. Ein einmal abgelegtes Gelübde war ihm heilig. Er würde es halten. Mit diesem Vorsatz ging er am 27. Oktober 1888 in Southampton an Land. Er fror in seinem so wenig der Jahreszeit angepassten weißen Flanellanzug. Irgendjemand in Indien hatte ihm gesagt, die Engländer trügen nur weiße Anzüge. In dem teuren Hotel, wo er die ersten Tage nach seiner Ankunft logierte, fühlte sich Gandhi wie ein gestrandeter Fisch. Die Fahrstühle und die livrierten Diener, die hohen Preise und das Selbstbewusstsein der Hotelgäste verwirrten ihn.
Er war froh, als ihm indische Bekannte bald ein billigeres Quartier bei einer Familie in Richmond und später in West-Kensington vermittelten.
Der angehende Student der Rechte schrieb sich am Inner Temple, einer alten Rechtsschule in London, ein. Vom zwölften bis vierzehnten Jahrhundert Ordenssitz der Tempelritter, hatte Jakob I. das reizvolle Gelände an der Themse 1608 zwei juristischen Vereinigungen als Eigentum überlassen. Nur wenige Meter von der Fleet Street in der geschäftigen City von London entfernt, genoss man hier die Stille und Abgeschiedenheit altertümlicher Gebäude und ineinander verschachtelter Höfe und Gärten. Doch das moderne London faszinierte Gandhi mehr. Er bewunderte seine Landsleute, die sich sicher und elegant in jeder Gesellschaft bewegten. Wenn er nicht zum Gespött der Leute werden wollte, musste er sich anpassen. Energisch ging er daran, „englischer als ein Engländer“ zu werden. In der Bond Street, dem Modezentrum von London, ließ er sich einen teuren Anzug schneidern, kaufte sich einen Zylinder, seidene Hemden, gestreifte Hosen und Krawatten. Von zu Hause erbat er sich eine schwere goldene Uhrkette, wie man sie hierzulande trug. Er verbrachte viel Zeit vor dem Spiegel, übte Gesten und Bewegungen, frisierte sein volles Haar, mühte sich, die Krawatte modisch zu binden. Mit Hilfe eines Lehrers übte er sich in der Kunst der englischen Konversation. Er nahm Tanzunterricht. Doch es gelang ihm nicht, die Füße nach dem Rhythmus der ihm ungewohnten Musik zu bewegen. Also kaufte er eine Violine und versuchte während teurer Privatstunden, in die Geheimnisse der europäischen Musik einzudringen. Die Ergebnisse standen in keinem Verhältnis zum Aufwand. Zwar verbesserte sich sein Englisch, und seine Kleidung ließ nichts mehr zu wünschen übrig, aber ein Salonlöwe wurde trotzdem nicht aus ihm.
Noch größere Sorgen bereitete ihm seine Ernährung. Die Marmeladenbrote, das Obst und Gemüse regten seinen Appetit mehr an, als dass sie ihn stillten. Er hatte ständig Hunger. Die duftenden Fleischgerichte auf den Tischen, an denen er saß, reizten seine Magennerven. Längst war sein anfänglicher Widerwille gegen Fleisch geschwunden. Er hielt es für ganz natürlich, dass die anderen Fleisch aßen, und er hätte es ihnen gleichgetan, wäre da nicht das Versprechen gegenüber seiner Mutter gewesen. Tapfer widerstand er allen Versuchungen. Die Freunde warnten ihn, er ruiniere seine Gesundheit, wenn er nicht endlich Steaks esse wie jeder hier in England, der es sich leisten könne.
Eines Tages lud ihn ein Freund in ein vornehmes Restaurant ein. Er bestellte ein kräftiges Mahl für zwei und rechnete damit, dass Gandhi aus Höflichkeit nicht ablehnen würde. Als der Kellner die Suppe brachte, fragte Gandhi ihn, ob sie aus Fleischbrühe gemacht sei. Der Kellner bejahte. Gandhi schob den Teller von sich.
„Wenn du dich nicht benehmen kannst, iss woanders oder warte draußen“, sagte der Freund, aufgebracht über so viel Starrsinn. Wortlos erhob sich Gandhi und verließ das Lokal. Eine Stunde später trat der Freund gesättigt und wieder guter Laune auf die Straße, um, wie verabredet, mit Gandhi ins Theater zu gehen. Vor der Tür erwartete ihn der hungrige, ein wenig durchfrorene Gandhi, freundlich, ohne Groll, als sei nichts geschehen.
Von diesem Zeitpunkt an versuchte ihn niemand mehr zu einer Fleischmahlzeit zu überreden.
Gandhi lief durch die Straßen von London. Hunger und Heimweh quälten ihn. Er fühlte sich einsam in dieser großen verwirrenden Stadt. Sollte alles zu Ende sein, noch ehe es richtig begonnen hatte? Ohne die entsprechende Ernährung waren seine Tage in London gezählt. Auf einem seiner langen Spaziergänge entdeckte er in der Farringdon Street ein vegetarisches Restaurant, das nicht nur schmackhafte Speisen anbot, sondern auch Schriften über vegetarische Diät. Als sich Gandhi zum ersten Mal in London satt gegessen hatte, las er das „Plädoyer für den Vegetarismus“ von Henry Salt. Dieses Buch machte ihn zum überzeugten Vegetarier. Er erfuhr, dass es in England eine vegetarische Bewegung gab. Ihre Anhänger vertraten die Meinung, dass es für die Zivilisation und den einzelnen Menschen sinnvoll sei, im Einklang mit der Natur zu leben, anstatt sie gedankenlos auszubeuten und sich selbst durch übersteigerte Bedürfnisse und falsche Ernährung zugrunde zu richten. Sie beriefen sich auf Pythagoras, Sokrates, Leonardo da Vinci und Schopenhauer, die alle Vegetarier gewesen waren.
Die englische vegetarische Bewegung artikulierte das Unbehagen an den gesellschaftlichen Missständen. Sie begegnete dem menschenverachtenden, die Natur zerstörenden Kapital mit der Aufforderung: Zurück zur Natur! Ungleich der amerikanischen Bewegung, die von Emerson, Thoreau und Walt Whitman ausging, trug der englische Vegetarismus einen sozialökonomischen Charakter und vereinte ein weites Spektrum von Gesellschaftsreformern in seinen Reihen. Den jungen Gandhi überzeugten vor allem die ethischen Argumente der Vegetarier. Das Studium ihrer Schriften ließ ihn sein gesamtes bisheriges Tun in einem anderen Licht erscheinen. Es kam ihm albern, nutzlos und verschwenderisch vor. Warum schämte er sich eigentlich, ein Inder zu sein? Gandhi verkaufte seine Violine, bestellte die Privatlehrer ab und mietete sich eine eigene billige Wohnung. Hier bereitete er sich seine Mahlzeiten nach Rezepten selbst zu. Ernsthafter als zuvor widmete er sich dem Studium. Wenn er sich nicht mit Latein und römischem Recht herumschlug, traf er sich mit seinen neuen Freunden von der Vegetarischen Gesellschaft. Er zog mit ihnen von Haus zu Haus und pries die vegetarische Lebensweise als ein universelles Heilmittel gegen alle Krankheiten der Zivilisation. In der Zeitschrift „The Vegetarian“ erschienen Artikel von ihm über die Lebens- und Essgewohnheiten in Indien.
Das Schreiben ging ihm leicht von der Hand, doch fiel es ihm schwer, vor vielen Menschen zu reden. Wenn er die Augen eines erwartungsvollen Auditoriums auf sich gerichtet sah, war ihm die Zunge wie gelähmt. Ein anderer musste die Rede für ihn verlesen.
Gandhis Freunde in London waren Christen. In Kathiawar hatten ihn der dogmatische Eifer und die Intoleranz der christlichen Missionare abgestoßen, erst hier lernte er Anhänger dieser Religion kennen, die seine Sympathie erweckten. Vom Elternhaus brachte er ein lebhaftes Interesse für religiöse Fragen mit, ohne dass er sich selbst als Gläubigen ansah. Er las also die Bibel. Außer der Bergpredigt im Neuen Testament beeindruckte sie ihn nicht sonderlich.
Das Buch, welches sein weiteres Leben entscheidend bestimmen sollte, lernte er im zweiten Jahr seines Londoner Aufenthalts kennen. Eines Tages fragten ihn englische Freunde, ob er die Bhagavadgita kenne. Die Bhagavadgita – „Gesang vom Erhabenen“ – ist eine Episode aus dem indischen Heldenepos „Mahabharata“, das zwischen dem fünften und dem zweiten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung entstand.
Als die Heere der Pandawas und Kaurawas aufeinandertrafen, zögerte der Held der Pandawas, Arjuna, den Kampf gegen seine Verwandten im Heer der Kaurawas aufzunehmen. Sein Wagenlenker gab sich ihm als Gott Krishna zu erkennen und überzeugte ihn, dass er ohne Rücksicht auf die Folgen pflichtgemäß handeln müsse. Dieses religionsphilosophische Gedicht in achtzehn Gesängen gilt als heiliges Buch der Hindus. Gandhi hatte den Vater manchmal daraus rezitieren hören, ohne viel vom Inhalt zu verstehen. Nun las er es in der englischen Übersetzung. Die Lektüre elektrisierte ihn geradezu. Das war es, wonach er so lange gesucht hatte – ein ethischer Leitfaden zum Handeln. Die Bhagavadgita wurde für Gandhi „ein Buch par excellence für die Erkenntnis der Wahrheit“, ein „geistliches Nachschlagewerk“. Er sah darin eine Allegorie auf das Schlachtfeld der menschlichen Seele, in der Böses und Gutes beständig miteinander ringen.
Viele Jahre nach der ersten Lektüre schrieb Gandhi: „Wenn Zweifel mich quälen, wenn die Enttäuschung mir ins Gesicht sieht und ich keinen Hoffnungsstrahl am Horizont entdecken kann, greife ich zur Bhagavadgita, und dort finde ich einen Vers, der mich tröstet, und ich beginne mitten im tiefsten Leid zu lächeln.“
Durch die Lektüre der Bhagavadgita angeregt, beschäftigte sich Gandhi nun intensiv mit den Religionen und Philosophien Asiens. Edwin Arnolds „Light of Asia“ erschloss ihm das Leben und die Lehre Buddhas, Carlyles „Das Leben Mahomets“ begeisterte ihn für den arabischen Religionsstifter. Von Kindheit an zur religiösen Toleranz erzogen, überzeugte Gandhi der Gedanke, dass die Religionen nur verschiedene Ausdrucksformen derselben grundlegenden Wahrheit seien. Der Glaube, wenn er gelebt wird, trennt nicht, sondern verbindet Hindus, Christen, Moslems und Juden. Die Worte, die Lessing seinen Nathan sagen lässt: „Es eifre jeder seiner unbestochnen, von Vorurteilen freien Liebe nach! Es strebe von euch jeder um die Wette, die Kraft des Steins in seinem Ring an Tag zu legen!“, treffen die Erkenntnis, die Gandhi in jener Zeit gewann.
Er war nach England gekommen, um die Quellen zu finden, aus denen die Engländer ihre Macht schöpften, und fand – die Bhagavadgita. Es mutet wie eine Ironie an, dass Gandhi in der Hochburg des Kapitalismus auf die uralten Weisheiten Asiens stieß. Zufällig war es nicht. Während die Briten in Indien alles daransetzten, die privilegierte Schicht des Landes ihrer eigenen Kultur zu entfremden, entdeckten englische Gelehrte den Reichtum des indischen Kulturgutes. Eine Reihe von hervorragenden Übersetzungen brachte interessierten Lesern die Werke der alten indischen Literatur nahe. Indische Studenten in England gewannen durch sie ein neues Selbstverständnis. Die Renaissance der indischen Kultur verband sich in ihnen mit progressivem europäischem Gedankengut, beförderte Indiens Erwachen und mündete in den breiten Strom der nationalen Befreiungsbewegung des zwanzigsten Jahrhunderts.
Aus Mohandas Gandhi war ein disziplinierter Student geworden. Doch er gab sich auch den bescheidenen Freuden des Studentenlebens hin. Er hatte einen großen Bekanntenkreis, genoss die Ferien an der See. Es blieb nicht aus, dass die Mütter heiratsfähiger Töchter in dem hübschen jungen Mann einen geeigneten Ehekandidaten sahen. Wie die anderen indischen Studenten verschwieg Gandhi, dass er bereits verheiratet war. Zwar dachte er oft an Kasturba, aber ihr Bild verblasste in London. Insgeheim verglich er seine Frau mit den englischen jungen Mädchen, die er kennenlernte. Die Vergleiche fielen selten zugunsten Kasturbas aus. Die Engländerinnen waren gebildet, bewegten sich ungezwungen in der Gesellschaft, sprachen über Literatur und Philosophie wie ihre männlichen Altersgefährten. Kasturba konnte weder lesen noch schreiben, der Haushalt war ihre Welt. So blieben die Briefe, die Gandhi an sie schrieb, unbeantwortet. Nur Grüße ließ sie ihm durch die Brüder bestellen. Er wusste nicht, was sie dachte und fühlte. Gandhi war verheiratet und doch kein Ehemann. Viele Sonntage verlebte er in der Gesellschaft eines jungen Mädchens, dessen Mutter die beiden oft allein ließ. Es dauerte eine Weile, bis Gandhi begriff, was man von ihm erwartete. Verwirrt und beschämt, dass er den Frauen so lange seine Ehe verheimlicht hatte, schrieb er der Mutter einen langen Brief. Die freundliche Frau nahm ihm ihre enttäuschte Hoffnung nicht weiter übel, aber von nun an war Gandhi im Umgang mit jungen Mädchen zurückhaltender.
1890 fuhr er zur Weltausstellung nach Paris. Es war dies sein einziger Ausflug über die Grenzen Englands hinaus. Er bestieg den vielgerühmten, vielgeschmähten Eiffelturm. Seine Größe imponierte ihm, doch fand er ihn kalt und seelenlos. Die alten Kirchen von Paris zogen ihn mehr an.
Im Dezember 1890 legte Gandhi am Inner Temple sein juristisches Examen ab. Indisches Recht war nicht gelehrt worden, und wenn er daran dachte, wie er in Indien seinen Beruf ausüben sollte, beschlich ihn ein leises Unbehagen. Er hatte das Gefühl, dass er mit seinen so mühsam erworbenen Kenntnissen über römisches Recht nicht viel würde anfangen können. Über seine Befürchtungen sprach er mit einem Rechtsanwalt und Parlamentsmitglied, bei dem sich indische Studenten gern einen Rat holten. Der Mann beruhigte ihn. Ein ehrlicher und fleißiger Rechtsanwalt werde seinen Platz in Indien finden, meinte er. Das sei alles nur eine Frage der Erfahrung.
Vor der Abreise gab Gandhi für seine Freunde ein vegetarisches Abschiedsessen im „Holborn“, jenem Restaurant, in dem er vor fast drei Jahren die Einladung zu einer Fleischmahlzeit abgelehnt hatte. Zu einem solchen Essen gehörte auch eine Tischrede. Sorgfältig hatte Gandhi sich vorher die Worte zurechtgelegt, doch seine Schüchternheit machte ihm wieder einmal einen Strich durch die Rechnung. Er brachte nur einen einzigen Satz heraus: „Ich danke Ihnen, meine Herren, dass sie meiner Einladung gefolgt sind.“ Es dauerte einige peinliche Sekunden, bis die Gäste begriffen, dass keine weiteren Worte folgen würden.