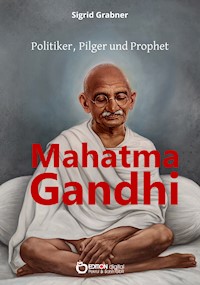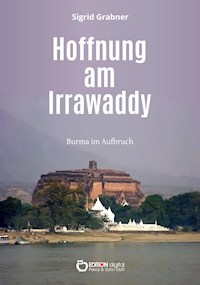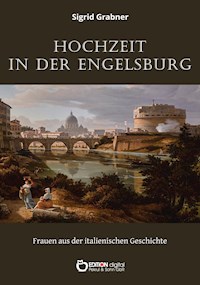
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Manchmal ist es ein Buch, das andere Bücher produziert, zumindest schreibende Leute dazu anregt, sich einem spannenden Stoff zuzuwenden. Genauso ist es in diesem Falle gewesen – wobei sich die Autorin, die bei Studien in italienischen Archiven, Klöstern und Bibliotheken in Ferrara auf ein Buch aus dem Jahr 1497 über 183 ausgewählte und berühmte Frauen gestoßen war, sich hiervon zu dem Thema Frauen in der Geschichte anregen ließ. Oft und noch immer wird Geschichte aus männlicher Sicht oder zumindest so erzählt, als hätten nur Männer als Helden und große Männer gewirkt. Es gab (und gibt) jedoch auch Heldinnen und große Frauen. Für Italien stellt uns Sigrid Grabner acht davon vor: die Auswahl reicht von Marozia von Tusculum (gest. 932) und Matilde von Tuscien (1046–1115) über Johanna von Neapel (1326–1382), Caterina von Siena (1347–1380) und Caterina Sforza (1463–1509) sowie Giulia Gonzaga (1513–1566) bis zu Vittoria Colonna (1492–1547) und Olympia Morata (1526–1555). Mit ihren lebendigen Beschreibungen lädt uns die Autorin zu einer Reise in das oft noch unbekannte Land weiblichen Lebens, Strebens und Kämpfens ein, dargestellt zumeist an einer Situation, in der sich diese acht Frauen über die Schranken ihrer Umwelt und ihrer eigenen Gewohnheiten hinwegsetzen. Sie begehren auf, kämpfen, werden schuldig, wachsen über sich hinaus. So vermittelte Markgräfin Matilde von Tuscien, die „Braut Gottes“, die aus der Ehe des mächtigen Langobardenfürsten Bonifatius mit Beatrix von Oberlothringen und durch ihre Mutter mit dem deutschen Kaiserhaus verwandt und eine der mächtigsten Adligen in Italien in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts war, im Investiturstreit zwischen weltlicher und geistlicher Macht, zwischen König Heinrich IV. und Papst Gregor VII. – landläufig bekannt durch den berühmten „Gang nach Canossa“. Der Nachwelt blieb vor allem ihre Rolle bei der Begegnung zwischen Papst Gregor VII. und König Heinrich IV. in den späten Januartagen des Jahres 1077 in Erinnerung. Nach ihrem Tode wurde Matilde übrigens als erste Frau in Sankt Peter in Rom bestattet. Die Gelehrte Olympia Morata, die auf der Flucht vor der Inquisition in Deutschland Zuflucht findet, ahnt hinter Enttäuschungen und Niederlagen eine neue Zeit mit einer freieren Lebensauffassung, die nicht mehr überschattet wird von den politischen Auseinandersetzungen zwischen Päpsten und weltlichen Herrschern, den widerstreitenden Machtinteressen der Adelsfamilien, von Intoleranz und Ketzerverfolgungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Sigrid Grabner
Hochzeit in der Engelsburg
Frauen aus der italienischen Geschichte
ISBN 978-3-96521-650-1 (E-Book)
Umschlaggestaltung: Ernst Franta
Das Buch erschien 1988 im Buchverlag Der Morgen, Berlin.
2022 EDITION digital
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
Meiner Mutter
Marozia von Tusculum (gest. 932)
Als von der Antike nur noch gewaltige Trümmer kündeten, herrschte in Rom die Senatorin Marozia, Tochter des Teophylakt und der Teodora. Die Macht der Karolinger über Rom war erloschen, und der Sachse Otto, der ein neues Reich errichten sollte, wuchs erst zum Manne heran. Im Vatikan regierten Päpste, die, der Stütze der Karolinger beraubt, sich ohnmächtig gegen Byzanz, die Sarazenen, die Magyaren und den römischen Stadtadel wehrten und schließlich zur Bedeutungslosigkeit verkamen. Sie wurden zu Werkzeugen und Opfern der Adelsfamilien. Marozia ließ Papst Johannes X., als er 928 gegen sie aufstand, in den Kerker werfen. 931 setzte sie ihren Sohn Johann, der aus einer Liebesbeziehung mit Papst Sergius III. (gest. 911) hervorgegangen war, auf den Stuhl Petri.
Aus der Ehe mit einem Langobardenfürsten stammte Marozias zweiter Sohn Alberich. Der Fürst hatte sich große Verdienste bei der Verteidigung Roms gegen die Sarazenen erworben. Als er nach dem Tode von Marozias Vater Teophylakt das Regiment in Rom an sich reißen wollte, vertrieben ihn die Römer und huldigten Marozia; er fiel im Kampf.
Die Senatorin Marozia verband sich nun mit dem Markgrafen Guido von Tuscien. Ihre Herrschaft über Rom war unumstritten. Feindlichen Anschlägen begegnete sie mit Klugheit und List. Wenn friedliche Mittel versagten, vernichtete sie ihre Gegner ohne Zaudern.
Im Herbst 931 genügte es Marozia nicht mehr, Senatorin von Rom zu sein. Nun, da sie über ihren Sohn Johann auch die Kirche beherrschte, richtete sich ihr Ehrgeiz auf die Krone Italiens und den Purpur der Kaiserwürde. Sie träumte von einem geeinten italienischen Reich, das unabhängig von den oströmischen Kaisern in Byzanz zu neuer Größe aufsteigen sollte. Um dieses Ziel zu erreichen, trug sie nach Guidos Tod seinem Stiefbruder Hugo ihre Hand an. Hugo von der Provence war 926 in Pavia zum König von Italien gekrönt worden.
Marozias Absicht, König Hugo zu ehelichen, stieß auf den Widerstand der römischen Barone. Sie kannten keine höheren Interessen als ihre eigenen. Darin unterschieden sie sich nicht von den Adligen in Tuscien, in der Lombardei und in Unteritalien. Auch Kaiser Berengar, der zehn Jahre zuvor in Verona durch Mörderhand gefallen war, hatte sich nicht gegen die eifersüchtig auf ihre Rechte bedachten Adelsfamilien durchsetzen können. Marozia aber hielt die Zeit für ein neues Kaisertum für gekommen und vertraute auf ihr politisches Geschick.
HOCHZEIT IN DER ENGELSBURG
Ist’s Liebe nicht, was ist dann mein Empfinden?
Ist’s aber Liebe, Gott, was tut sie hier?
Kommt aus der Güte solches Leid von ihr?
Und kann ein Übel solche Lust entzünden?
Petrarca
Vor dem Gemach seiner Mutter verhielt der junge Papst den Schritt. Er hörte Frauenstimmen, dann Gelächter, hell und melodisch wie Lerchengesang. So lachte nur Marozia.
Seit Tagen hielt sich das Gerücht von einer bevorstehenden Hochzeit zwischen ihr und König Hugo. Johann hatte ihm keinen Glauben geschenkt. Die Römer erzählten viel, und nur weniges traf zu. Doch auf dem Weg vom Vatikan zum Palast seiner Mutter auf dem Aventin war er den Abgesandten des Königs begegnet. Ihre zufriedenen Mienen und die Zurufe gestatteten keinen Zweifel mehr.
Entschlossen öffnete Johann die Tür. Die Frauen blickten auf, ohne ihre Gespräche zu unterbrechen. Er kannte die scharfen Zungen von Marozias Hofdamen und wartete schweigend, dass die Mutter das Wort an ihn richten würde. Mit einer Handbewegung entließ Marozia ihr Gefolge und forderte Johann auf, sich zu setzen. Sie selbst lag nach altrömischer Art auf einem Ruhelager.
Sie ist schön, dachte Johann, wie jedes Mal, wenn er sie sah. Der Goldreif bändigte kaum die Fülle des dunklen Haars. Ihr Körper verriet Geschmeidigkeit und Freude am Genuss. Wenn sie ihre blitzenden Augen auf ihn richtete, verließ ihn die Kraft, und er wusste, er würde alles tun, was sie von ihm verlangte.
Jedermann war ihr zu Willen, die Edlen Roms ebenso wie die Schmiede in den verfallenen Thermen, die Fleischer am Marcellustheater wie die Tiberfischer. Aber wie lange noch? Wenn sie Hugo wirklich zum Gemahl nahm, würden die Römer gegen sie aufstehen, denn einen fremden König duldeten sie nicht in ihren Mauern. Johann sprach es aus, als Marozia ihm die Vermählung zum kommenden Osterfest ankündigte. Kein Vorwurf war in seiner Stimme, dass sie ihn erst jetzt einweihte, nur Sorge um sie. Er warnte, er bat, von diesem Plan abzusehen.
Marozia zog Johann an ihr Lager und strich ihm über den Arm. Sie liebte ihren Erstgeborenen sehr, obwohl er weder seinem Vater, dem tatkräftigen Sergius, noch ihr glich. Er war sanft und fromm, ohne jedoch schwächlich zu sein. Als sie ihn gegen den Protest der Bischöfe zum Papst machte, hatte er sich nur widerstrebend ihrem Willen gefügt. Ihm fehlte der Ehrgeiz zur Macht. Zwar wusste er die Waffen so gut zu gebrauchen wie jeder römische Ritter, doch fühlte er sich Gott näher als der Welt.
Wie anders war sein jüngerer Bruder Alberich, der Sohn des Langobarden – misstrauisch, ungebärdig, verschlossen. Unter der Jugend Roms genoss er hohes Ansehen.
Marozia wusste, dass die Freunde Alberichs verächtlich über das Weiberregiment sprachen. Eines Tages würden sie ihre Herrschaft bedrohen, denn auf die jungen Männer wirkte ihr Zauber nicht mehr. Keinen schlimmeren Feind gab es als das Alter. Es widerstand dem Schwert ebenso wie der List. Der ehrgeizige Alberich ließ sie spüren, dass sie alt wurde.
In Johanns Gegenwart aber fühlte sie sich jung und schön. Deshalb liebte sie ihn.
Es erstaunte Marozia, dass er prophezeite, der ränkevolle Hugo würde die Macht über Rom an sich reißen und einen Bürgerkrieg heraufbeschwören. „Glaubst du, ich ließe mir die Zügel aus der Hand nehmen?“, fragte sie ärgerlich.
Johann bewunderte die Willensstärke seiner Mutter. Doch Hugo war zehn Jahre jünger als sie und verfügte über ein stattliches Heer. Auf den römischen Adel konnte sie dann nicht mehr zählen.
Marozia lachte. Johann, der Papst, war ein Knabe geblieben. Die Welt wurde von Männern regiert, die Männer aber von Frauen. Sie behielt es für sich, sagte nur: „Als Hugos Gemahlin werde ich Senatorin von Rom bleiben, Königin von Italien sein und Kaiserin eines Reiches werden, das sich von Sizilien bis in die Länder nördlich der Alpen erstreckt. Du, Papst Johann, wirst die Vermählung und die Kaiserkrönung vornehmen. Die geistliche und weltliche Gewalt über das Abendland wird in den Händen unseres Geschlechts liegen und den Namen der Grafen von Tusculum für alle Zeiten berühmt machen.“
Johann nickte gehorsam. Er teilte die Begeisterung seiner Mutter nicht, ihre Pläne ängstigten ihn. Was bedeuteten schon Sizilien und die Alpen! Es gab nichts Größeres als Rom, die Stadt der Apostel Petrus und Paulus, die urbs mundi. Die leidenschaftlichen Worte Marozias verursachten ihm Übelkeit, ihn verlangte nach seiner stillen Wohnung im Vatikan. Mochte die Mutter doch Kaiserin werden, wenn sie ihn nur in Ruhe ließ.
„Was du befiehlst, wird geschehen“, sagte er leise.
In diesem Augenblick flog die Tür auf, und Alberich stürmte herein. „Stimmt es, was mein Freund Demetrius behauptet: Du willst König Hugo heiraten?“
Unwillig wandte sich Marozia nach ihm um. „Ich habe dich nicht gerufen. Jetzt rede ich mit deinem Bruder.“
„Und ich mit dir“, entgegnete Alberich. Die Augen des Siebzehnjährigen funkelten zornig. Marozia spürte, dass sie ihn nicht reizen durfte. Sie wies auf einen Stuhl neben ihrem Lager, doch Alberich stieß ihn beiseite und fuhr wütend fort: „Welcher Teufel reitet dich, Hugo heiraten zu wollen? Hast du nicht endlich genug von den Männern? Und wenn du ohne Mann nicht leben kannst, dann nimm einen von den Römern, der im Alter zu dir passt, und nicht diesen jungen Hahn!“
Marozia erhob sich auf den Ellbogen. Sie wusste, dass sie in dieser Stellung besonders reizvoll wirkte. Das gelöste Haar fiel über die blendendweißen Schultern und die halb entblößte Brust. Lächelnd erwiderte sie: „Was verstehst du schon davon, Alberich.“ Ihr Spott trieb ihm das Blut ins Gesicht. „Was soll ich mit einem Greis, der meiner Liebe nicht mehr gewachsen ist, was mit einem Greis, dem der Ehrgeiz nicht mehr Flügel verleiht? Hugo ist König von Italien, er wird Kaiser sein und Rom wieder die Hauptstadt eines mächtigen Reiches.“ Die letzten Worte richtete sie an Johann, der widerwillig nickte.
„Ihn hast du natürlich überredet. Dieses Zerrbild eines Oberhauptes der Christenheit sagt zu allem ja und amen, was von dir kommt“, entgegnete Alberich boshaft.
Johann sprang auf, doch ehe er die Waffe ziehen konnte, hielt ihm Alberich schon den Dolch unters Kinn. Beide starrten sich hasserfüllt an. Da riss Johann blitzschnell den Kopf zurück, duckte sich und richtete das Stilett gegen Alberich.
Marozia trennte sie. „Hört auf! Beide seid ihr meine Söhne und meinem Herzen gleich nah.“
„Der da wohl ein ganzes Stück näher“, knurrte Alberich und stieß den Dolch in die Scheide.
Zum ersten Mal kam Marozia der Gedanke, dass Alberichs grobes Betragen gegen sie der Eifersucht entsprang. Bis jetzt hatte sie in ihm immer nur den widerspenstigen Knaben gesehen. Sie streckte die Hand nach Alberich aus. Er zuckte vor ihrer Berührung zurück.
„Lass mich mit deinem Bruder allein“, sagte sie leise zu Johann, doch mit einer Stimme, die keinen Widerspruch duldete.
„Alberich“, fragte Marozia, „bin ich verachtenswert, weil ich mein Glück mit dem Wohl Roms verbinden will? Du solltest mich verstehen, ich bin deine Mutter.“
Alberich konnte sich nicht erinnern, mit Marozia je allein gewesen zu sein. Als Kind hatte er manchmal nachts geweint, weil ihn immer die Amme zu Bett brachte, niemals seine bewunderte Mutter. Jetzt stand sie vor ihm und streckte die Arme nach ihm aus. Wie oft hatte er davon geträumt, in diese Arme zu laufen und von ihnen umfangen zu werden! Immer vergeblich. Die unerfüllten Träume seiner Kindheit schmerzten wie schlecht verheilte Wunden.
„Was soll das Getue“, murmelte er. „Spiel mir nicht Mutterliebe vor, die du nie für mich empfunden hast. Deine Liebe reichte gerade für Johann.“ Abweisend stand er vor ihr.
Marozia ging zu ihrem Lager zurück. Jede ihrer Bewegungen war auf Wirkung bedacht. „Du tust mir unrecht, Alberich. Dich liebte ich immer am meisten. Aber du warst anders als Johann. Wo er freundlich war, fauchtest du wie eine Wildkatze. Warum hasst du mich so?“ Bei den letzten Worten begann sie zu weinen.
Alberich wusste nicht, wie ihm geschah, als er vor ihr niederfiel. „So ist es nicht. Was redest du da, Mutter! Ein Wort von dir hätte genügt, um mich wie jetzt vor deine Füße zu stürzen!“
Beschämt über sein ungewolltes Geständnis, sprang er sofort wieder auf.
Nun erhob sich auch Marozia. „Wir sind einander wohl zu ähnlich. Unser Stolz steht uns immer im Wege, und so verletzen wir, was wir am meisten lieben.“
„Mag sein, wie es will“, erwiderte Alberich rau, „aber wenn du meinst, was du sagst, dann verzichte auf diese Heirat. Sie verletzt nicht nur mich, sie bringt uns allen Unglück. Hugo ist ein Fremder. Rom wird gegen ihn aufstehen – und gegen dich!“
Marozia hörte die Drohung. Sie wollte ihren Sohn zurechtweisen, doch sie bezwang sich. „Ich bin eine Frau. Ein starker Gemahl an meiner Seite würde mir mein Amt erleichtern.“
Alberich richtete sich auf und sagte stolz: „Ich bin noch jung, aber bald schon der Mann, dem die Römer gehorchen werden.“
Seine Anmaßung ließ Marozia ihre Rolle vergessen. „Die Römer wollen nicht, dass ich Hugo von der Provence zum Gemahl nehme, weil er ein Fremder ist. Bist du nicht auch ein Fremder in dieser Stadt, du, der Sohn eines Langobarden?“
Der Jüngling wurde bleich. „Ich bin dein Sohn, Teophylakts und Teodoras Enkel, ein Römer von Geburt! Jedermann weiß das.“
Marozia empfand Genugtuung, Alberich getroffen zu haben. Sie hasste den Mann, seinen Vater, noch immer. Ehe ein Alberich Rom regierte, wollte sie lieber sterben. Doch es war unklug von ihr, den Sohn zu reizen. Sie lenkte ein. „Natürlich wirst du Rom regieren, wenn es an der Zeit ist. Aber warum sprichst du von einer Erhebung gegen mich, ohne gleichzeitig zu sagen, dass du mir beistehen wirst?“
„Nicht, wenn du König Hugo heiratest“, beharrte Alberich.
Er gleicht einem Raubtier, dachte Marozia, was er gepackt hat, hält er fest. Sie wusste nicht, wem er darin mehr glich – ihr oder seinem Vater.
„Im Ehevertrag wird festgeschrieben, dass du der künftige Senator von Rom bist“, suchte sie ihn zu beschwichtigen.
Alberich lachte verächtlich. „Diese Versicherung ist nicht die Tinte wert, mit der sie geschrieben wird. Wenn du es auch ernst meinen magst, Hugo hält sich an keine Abmachung.“
Marozia wollte scharf erwidern, aber sie besann sich. Alberich war ein ernst zu nehmender Gegner. Sie musste ihn hinhalten, Zeit gewinnen.
Mit dem Versprechen, alles noch einmal zu überdenken, entließ sie ihren Sohn.
An diesem Tage gönnte sich Marozia keine Ruhe mehr. Sie kannte nun die Gefahr und machte sich bereit, ihr zu begegnen. Die ausgeschickten Späher berichteten, dass Alberich zu allem entschlossene Männer um sich geschart hatte und auch der einflussreiche Adlige Teodosius nicht abgeneigt war, dessen Herrschaft in Rom anzuerkennen, wenn Marozia König Hugo heiraten sollte.
Marozia schickte eine Botschaft an König Hugo, er möge eilen, nach Rom zu kommen. Sie versicherte sich der Ergebenheit ihrer Hauptleute, ermahnte die Spione zur Wachsamkeit. Zuletzt schrieb sie einen Brief an Teodosius, den Vater von Alberichs Freund Demetrius. Er sollte, ohne es zu wissen, ihr helfen, das Misstrauen des Sohnes einzuschläfern, bis sie mit König Hugos Beistand den Stolz des Jünglings brechen konnte.
Am Morgen des nächsten Tages setzte sie das Gespräch mit Alberich fort. Die Gründe gegen eine Verbindung mit Hugo erschienen ihr nun so schwerwiegend, erklärte sie, dass sie sich entschlossen habe, diesen Plan fallenzulassen und einem vornehmen Römer die Hand zum Ehebund zu reichen.
Der Jüngling sah sie ungläubig an. „Ist das dein Ernst?“
Marozia nickte. Noch heute werde ein Bote mit der Absage zu Hugo nach Pavia reiten.
„An welchen Römer denkst du?“, fragte Alberich.
Marozia lächelte verlegen. In ihrer Jugend hatte sie eine tiefe Zuneigung mit Teodosius verbunden, doch ihr Vater gab sie dem Langobarden zur Frau. Jetzt wollte sie Teodosius bitten, ihr beizustehen. Alberich wandte keinen Blick von ihr. Was sie sagte, klang überzeugend. Eine große Erleichterung überkam ihn. Teodosius war ein alter Mann, und er liebte Alberich nicht weniger als seinen eigenen Sohn Demetrius. Niemals würde er die Senatorenwürde an sich reißen.
Alberichs Misstrauen wich. „Nun wird alles gut.“
Der Freund Demetrius, dem Alberich sofort die Neuigkeit berichtete, traute Marozia nicht. Sie beschlossen, den Boten nach Pavia abzufangen.
Marozia hatte einem ihrer Leibwächter einen Brief an König Hugo übergeben, in dem sie von dem Heiratsplan zurücktrat, und den Mann gebeten, das Schreiben zu vernichten, sobald er die Grenzen Roms überschritten habe. Ihm schickte sie einen Häscher nach mit dem Auftrag, den Leibwächter zu ermorden. Sie wollte sichergehen, dass kein Mitwisser ihre Absichten durchkreuzte.
Demetrius und Alberich lauerten Marozias Boten an der Porta Flaminia auf. Was sie in dem Brief lasen, überzeugte sie von Marozias Ehrlichkeit. Sie entließen den Mann mit einem guten Handgeld. Nur wenige Meilen nördlich von Rom starb er an einem Dolchstoß.
Während Alberich und Demetrius den Freunden von Marozias Sinneswandel berichteten, empfing die Senatorin Teodosius. Er stand im fünften Lebensjahrzehnt und gehörte zum ersten Adel Roms. Sein Palast in der Via Lata übertraf an Größe den der Marozia auf dem Aventin. Vor Jahren hatte er Marozia leidenschaftlich geliebt. Als Teophylakt seine Tochter dem Langobarden zur Frau gab, war er vor Schmerz wie von Sinnen gewesen. Eine Zeit lang bekriegte er den Senator. Da er eine große Anzahl der Adelsgeschlechter auf seine Seite brachte, bedrohte er mehr als einmal ernsthaft die Herrschaft von Teophylakt. Teodora beendete den mörderischen Kampf, indem sie Teodosius ihre Nichte Stephania zuführte. Die Ehe linderte seinen Schmerz. Vor einem halben Jahr war Stephania gestorben, tief betrauert von ihrem Mann, dem Sohn Demetrius und den sechs Töchtern.
Auch Marozia hatte Teodosius geliebt, und er war ihr jetzt, da er vor ihr stand, noch immer nicht gleichgültig. Für einen Augenblick dauerte es sie, ihn als Werkzeug zu gebrauchen. Doch es blieb ihr keine andere Wahl.
„Wir sind beide alt geworden, seit das Feuer der Liebe uns zu verbrennen drohte“, eröffnete sie das Gespräch.
„Nicht du, Marozia“, fiel er ihr ins Wort und verbeugte sich. Er hatte Marozia seit Jahren nicht mehr gesehen. Die meiste Zeit verbrachte er auf seinen Besitztümern in den Albanerbergen. Wenn er sich in Rom aufhielt, ging er Marozia aus dem Wege, um nicht alte Wunden aufzureißen. Den Gerüchten über das ausschweifende Leben der Senatorin schenkte er keine Beachtung. Sie war eine kluge Frau, hielt die Zügel der Regierung fest in der Hand. Solange sie die Vorrechte des römischen Adels unangetastet ließ, mochte sie tun, was sie wollte.
Es erstaunte ihn, wie wenig sie sich verändert hatte. Sie schien ihm begehrenswert wie damals, als er sie an den Langobarden Alberich verlor. Bei diesem Gedanken verspürte er ein Stechen in der Brust. Wie sehr er Stephania auch zugetan gewesen war, er hatte Marozia nie vergessen können.
Nur mit großer Mühe unterdrückte Teodosius sein Verlangen, aufzuspringen und zu gehen. Warum hatte er sich nicht verleugnen lassen, war nicht aus Rom fortgeritten, als ihn Marozias Ruf erreichte?
„Du hörtest von meiner Absicht, König Hugo zu heiraten?“
Teodosius nickte nur. Da er nicht wusste, was sie von ihm wollte, hielt er es für ratsam zu schweigen.
Marozia zog einen Ring von der Hand, drehte ihn zwischen den Fingern, bis er zu Boden fiel. Als Teodosius ihn aufhob, erkannte er ihn. Er hatte ihn ihr damals zum Abschied geschenkt. Als wäre es gestern gewesen, dachte er, von Erinnerungen überwältigt.
Marozia beobachtete ihn. Er gefiel ihr: schlank und doch kraftvoll in den Schultern, volles Haar, ein edel geformtes Gesicht. In den Jahren seit ihrer Trennung war er reifer geworden, ohne sichtlich zu altern. Als Teodosius sie fragend anblickte, seufzte sie tief. Den Plan einer Vermählung mit König Hugo, begann sie, habe sie gefasst, als Stephania noch lebte. Jetzt aber dränge ihr Sohn Alberich sie, der Stimme ihres Herzens zu folgen und sich endlich dem Freund von einst zu offenbaren. „Zu schwer drückt mich die Last der Regierung, als dass ich sie länger allein tragen könnte. Steh mir zur Seite, Teodosius, noch ist es nicht zu spät.“
Teodosius wollte gern glauben, was seinen geheimsten Wünschen entgegenkam. Aber warum hatte Marozia in all den Jahren ihm niemals ein Zeichen ihrer unveränderten Zuneigung gegeben? Täuschte sie ihn jetzt, oder hatte sie aus Rücksicht auf Stephania ihre Gefühle verborgen?
Marozia ahnte, was in ihm vorging, und fuhr eindringlicher fort: „Ich verlange von dir nicht, dass du Stephania vergisst. Wir vermögen die Jahre, die seit unserer Jugend vergangen sind, nicht auszulöschen. Aber wir können unsere Hände ineinanderlegen. Ich brauche deine Kraft, bis Alberich stark genug ist, die Herrschaft in Rom zu übernehmen.“
War das die Senatorin, die Rom kannte, eine Frau, gewohnt zu befehlen, nicht, zu bitten? Teodosius atmete auf. Das war die Marozia von einst, stolz, aufrichtig, verletzbar. Er ging auf sie zu und umarmte sie.
Marozia, von ihrem leichten Sieg überrascht, wusste nicht, wie ihr geschah. Alles hatte sie bedacht, nur nicht, dass die Sehnsucht nach dem Mann, den sie als einzigen wirklich geliebt und niemals besessen hatte, noch immer in ihr brannte. Diese Erkenntnis überfiel sie unerwartet und machte sie hilflos. Teodosius’ Zärtlichkeiten erhitzten ihr Blut. Sie vergaß die Königskrone und den Kaiserpurpur, vergaß, dass sie Teodosius hatte hinhalten wollen. Sie verlor sich an ihn.
Später lagen sie nebeneinander und führten das uralte Gespräch aller Liebenden: Weißt du noch, damals … Die letzte Stunde ließ sie die Vergangenheit in einem anderen Licht sehen. Sie hatten aufeinander gewartet, ohne es zu wissen.
Als Teodosius eingeschlafen war, weinte Marozia. Seit sie gegen ihren Willen mit dem Langobarden verheiratet worden war, hatte sie sich an den Männern gerächt. Sie benutzte sie, aber liebte sie nicht. Niemand sollte sie schwach sehen. In der Liebe wie im Leben kam es nur darauf an, zu siegen. Und nun überwand Teodosius, von ihr selbst gerufen, die Dämme, die sie um ihr Herz gebaut hatte. Nicht sie hatte ihn, er hatte sie besiegt. Sie war nicht mehr jung genug, diese Niederlage als eine Befreiung zu empfinden.
Sie verwünschte Teodosius und wusste doch, dass sie nie mehr von ihm lassen konnte.
Die Tiberwiesen prangten im ersten Blütenschmuck, von den Hügeln fielen laue Winde in die Stadt, in den Ruinen der Kaiserpaläste auf dem Palatin sonnten sich Eidechsen. Zum bevorstehenden Osterfest zogen die ersten Pilger durch die Tore. Es war alles wie in jedem Jahr, und doch erinnerte sich Marozia nicht, jemals solch einen Frühling erlebt zu haben. Sie genoss jeden Tag, der ihr bis zur Ankunft König Hugos blieb, wie den ersten und den letzten Tag ihres Lebens. Teodosius bemerkte, wie sich manchmal ihr Gesicht verschattete. Auf seine Fragen sprach sie von König Hugo, dessen Rache für ihren Wortbruch sie zu fürchten vorgab. Teodosius beruhigte sie: Der römische Adel würde zu kämpfen wissen.
In manchen Stunden erschienen Marozia alle Macht und aller Reichtum dieser Welt bedeutungslos gegenüber dem Glück, das sie bei Teodosius empfand. Um Zeit zu gewinnen und ihre Pläne durchsetzen zu können, hatte sie dem Jugendfreund ihre Hand angeboten, und nun war sie die Gefangene ihres eigenen Herzens geworden. Die Liebe begegnete ihr so spät und unerwartet, dass sie ihr nicht zu trauen wagte. Wie lange würde dieser Rausch, der die Sinne aufpeitschte und den Verstand benebelte, vorhalten? Dann aber kam die Ernüchterung, die Kaiserkrone war verloren, und die Herrschaft über Rom hatte Alberich an sich gerissen. Vielleicht schon in einem Jahr würde sie die alternde Gemahlin eines römischen Adligen sein, nichts weiter. Verzweifelt hoffte sie auf ein Wunder, das ihr den Geliebten nicht nahm und den Traum von der Kaiserkrone dennoch erfüllte.
Ende März berichteten Späher, dass sich König Hugo mit einer Streitmacht Rom nähere. Teodosius drang in Marozia, die Vermählung nicht erst zu Ostern, sondern gleich zu vollziehen, um den König vor vollendete Tatsachen zu stellen. Marozia erwiderte gereizt, sie wolle eine Hochzeit feiern, von der ganz Italien sprechen sollte. Der Regentin Roms zieme kein überstürztes Handeln.
Am letzten Tag des März, Hugo stand schon bei Orte, verließ Marozia den Palast auf dem Aventin und begab sich in den Schutz der Engelsburg. Die Festung am Tiber hatte noch jedem feindlichen Angriff widerstanden. Während Marozia über die Brücke auf das schwere Mauerrund zuritt, dachte sie flüchtig daran, dass es einst einem römischen Kaiser als Grabmal gedient hatte. Sie hob den Blick zum Erzengel Michael, der über den Zinnen zu schweben schien. Teophylakt hatte die Statue von den besten Handwerkern Roms gießen und statt einer kleineren aufstellen lassen. Damals hörte Marozia zum ersten Mal Geschichten von Papst Gregor dem Großen. Jetzt erinnerte sie sich nur noch an den Engel, der über den Zinnen der Burg erschienen sein sollte, um den Römern das Ende der Pest und glücklichere Zeiten zu verheißen. Der Vater hatte sie gemahnt, dem Bildnis Ehrfurcht zu erweisen, verbürgte es doch den Schutz Roms und ihrer Familie vor inneren und äußeren Feinden.
Marozia zügelte ihr Pferd und verrichtete ein kurzes Gebet. Als sie wieder emporschaute, erschrak sie. Anstelle des Engels sah sie eine Gestalt, die drohend die Faust gegen sie ausstreckte. Sie meinte den frechen Priester zu erkennen, der ihr die Herrschaft über Rom streitig gemacht und sie noch als Besiegter Hure Babylon, Teufelsgeist und apokalyptisches Tier genannt hatte. Er war in einem Verlies der Engelsburg gestorben. Irrte sein Geist ruhelos durch die Festung, wartete auf die Stunde der Rache? Marozia schloss die Augen und strich sich über die schweißnasse Stirn.
Alberich, der sie im Sattel schwanken sah, ritt an ihre Seite. Seit sie ihm versprochen hatte, König Hugo nicht zu heiraten, schien er von Grund auf verwandelt. Er erwies ihr höchste Ehrerbietung, vermied jedes böse Wort gegen Johann und bezauberte alle durch seine Fröhlichkeit. Manchmal, wenn die Liebe sie weich und verwundbar machte, ahnte Marozia, wie sehr der Sohn unter ihrer Abneigung gelitten haben musste.
Sie zwang sich zu einem Lächeln. Nein, sie liebte diesen Sohn trotz allem nicht. Sie hatte ihn widerwillig empfangen und unfroh geboren. Sie beneidete ihn um seine Jugend und Tatkraft, sie hasste ihn, weil er sie in den Zwiespalt von Liebe und Macht getrieben hatte.
Von Alberich gerufen, sprengte Teodosius heran. Er griff nach Marozias Hand. In diesem Augenblick drängte es sie, sich Teodosius rückhaltlos anzuvertrauen, von ihren Ängsten und ihrem doppelten Spiel zu sprechen. Sie wünschte sich, er nähme sie auf sein Pferd und ritte mit ihr hinaus in die Campagna, nach Süden, weit weg von Rom. Denn wenn sich das Tor der Engelsburg hinter ihr schloss, würde sie das Glück unwiederbringlich hinter sich lassen.
Teodosius spürte die Schwäche der Frau. Sie war in der vergangenen Nacht unersättlich gewesen. Zärtlich flüsterte er ihr zu: „Marozia, Liebste, ich bete dich an.“ Marozia riss an den Zügeln, dass das Pferd sich aufbäumte. Teodosius warf Schlingen nach ihr aus, um sie zu fesseln, und nannte das Liebe. Ich bete dich an … Sollte er doch in die Kirche gehen. Sie wollte nicht angebetet, sondern verstanden werden.
Aber wie all die anderen Ritter sah Teodosius nicht über Rom hinaus. Ihre Andeutungen, wie erstrebenswert ein italienisches Kaiserreich von den Alpen bis nach Sizilien wäre, hatte er lachend abgewehrt: Wer sollte dieses gewaltige Werk vollbringen, und um welchen Preis? Rom hätte mit sich selbst genug zu tun. Mochten die anderen für sich selber sorgen. Es fehlte Teodosius nicht an Mut und Energie, wohl aber an Vorstellungskraft. Wer Großes will, muss kühn träumen können.
Mit finsterem Gesicht passierte Marozia das Tor der Burg. Als der Kommandant Giorgio ihr meldete, dass die Festung mit Soldaten, Waffen und Vorräten wohl versehen sei, hellte sich ihre Miene auf. Wer die Engelsburg besaß, widerstand nicht nur äußeren Feinden, er beherrschte auch Rom und das Apostelgrab in der nahen Peterskirche. War es nicht gleichgültig, wen sie liebte – oder nicht liebte? Es kam allein darauf an, die Macht nicht aus den Händen zu geben. Von Giorgio begleitet, stieg sie auf die oberste Plattform.
In der Frühlingssonne wand sich der Tiber wie ein silberner Gürtel um die Stadt. Die Hügel leuchteten grün, über den Bergen im Norden und Osten lag ein blauer Schimmer. Die mächtigen Ruinen und die Häuser auf der anderen Seite des Flusses schienen um diese Mittagsstunde von Menschen verlassen. Nur die Engelsbrücke war belebt. Schwerbeladene Karren hielten auf die Burg zu, Pilgergruppen zogen singend zum Apostelgrab.
Marozia empfand wieder die quälende Unruhe, die sie seit Tagen peinigte. Konnte sie sich auf Giorgio verlassen? Sie schaute den Mann prüfend an, bis er die Augen niederschlug. Giorgio liebte ihre Schwester Leonora, er war Marozia treu ergeben. Aber was würde er tun, wenn sie König Hugo heiratete? Sie nahm ihm den Schwur ab, allein ihre Befehle auszuführen, sollte es ihn auch das Leben kosten.
Am Abend erhellten Fackeln den großen Saal der Burg, Marozia gab ein Fest. Alle römischen Edlen waren geladen. Man zechte und spielte, tanzende Mädchen und Knaben erregten die Sinne der Gäste. Auf den Lagern in den Nebenräumen stillten Paare ihre Lust.
Die Senatorin erschien allen verführerischer denn je. Sie saß neben Teodosius an der Stirnseite der Tafel, trank Alberich zu und auch Johann, scherzte mit den Frauen über die Schwächen der Männer, wechselte verstohlene Blicke mit jenen, die ihre Gunst genossen hatten, pries Teodosius als das Urbild eines Römers und prophezeite Rom noch glänzende Zeiten unter ihrer Herrschaft.
Teodosius fühlte sich unbehaglich. Seit sie die Burg betreten hatten, kannte er Marozia nicht wieder. Ihre Stimmungen wechselten wie der Frühlingshimmel über Rom, ihr Lachen klang unnatürlich, ihre Scherze waren geschmacklos. Teodosius konnte nicht wissen, dass Marozia am Nachmittag die Botschaft erhalten hatte, Hugo werde am nächsten Morgen in Rom sein. Ihn widerten plötzlich die rohen Späße und das trunkene Gelächter der Gäste an. Er bat Marozia, sich Schlaf zu gönnen und die Tafel aufzuheben.
Marozia schaute ihn an wie einen Fremden. „Das ist mein Fest, und ich bestimme, wann es zu Ende ist.“ Der Schein der niederbrennenden Kerzen beleuchtete ihr übermüdetes Gesicht.
Mit einer Ruhe, zu der in höchster Erregung nur beherrschte Naturen fähig sind, sagte Teodosius: „So sprich nie wieder zu mir.“ Und ging. Als er die Festung verlassen wollte, hielten ihn die Wachen zurück. Man brachte ihn in einen wohnlich eingerichteten kleinen Raum und verschloss die Tür hinter ihm. Die Gäste, die bald darauf lärmend in die Stadt zurückzogen, glaubten Teodosius in Marozias Schlafgemach. Niemand schöpfte Verdacht.
Die Wache am Stadttor ließ König Hugo und sein Gefolge ungehindert passieren. Es hieß, die Senatorin erwarte ihn zu Verhandlungen.
Noch schliefen die römischen Ritter in ihren Palästen und Türmen. Gähnend krochen die Bettler aus den Schlupfwinkeln. Sie hielten die vorbeijagenden Reiter für einen Nachtspuk. Als sie mit der Nachricht von Haus zu Haus gingen, sich ihr Morgenmahl zu erbetteln, lachten die ihr Tagwerk beginnenden Handwerker sie aus. Seit wann standen die Herren früher auf als die Arbeitsleute? Nur die Fischer auf dem Tiber folgten dem Zug mit wachen Augen.
Marozia empfing Hugo in einem nach Osten liegenden Gemach. Das Morgenlicht schien ihm ins Gesicht, während die Senatorin, auf einem mit schweren byzantinischen Stoffen ausgeschlagenen Stuhl sitzend, im Halbdämmer verblieb. Sie trug ein perlgraues, eng anliegendes Untergewand, darüber einen weiten blauen Mantel, der von einer kostbaren Schließe über der Brust zusammengehalten wurde. Marozia hatte nur wenige Stunden geschlafen, die Blässe ihres Gesichtes ließ sie leidend erscheinen.
Der junge Liutprand, ein Günstling des Königs, verzog beim Anblick der Senatorin geringschätzig das Gesicht. Er kannte den Geschmack seines Herrn. Hugo liebte junge, aufreizende Frauen, möglichst jeden Tag eine andere. Diese alt gewordene Dirne würde seine Sinne nicht erregen. Aber wenn sie ihm die Kaiserkrone verschaffte, war das schon ein Opfer wert. Unverständlich, dass sich die Römer einem Weib wie diesem beugten. Wahrscheinlich trieb sie es mit allen Edlen der Stadt, so jedenfalls war ihr Ruf.
Marozia musterte Hugo. Sie sah ihren Schwager und künftigen Gemahl zum ersten Mal. Er war jünger als sie, galt als berechnend und skrupellos. Sie würde ihre Kräfte aufs äußerste anspannen müssen, um ihn an sich zu binden. Doch ein von Leidenschaften besessener Mann ließ sich leichter lenken als ein tugendsamer. Schatten um Hugos Mund und Augen verrieten noch die nächtlichen Exzesse.
Hugo und Marozia belauerten einander, jeder die Stärken und Schwächen des anderen abschätzend. Die Senatorin verlangte, am Tage nach der Hochzeit zur Königin gekrönt zu werden. Die Herrschaft über Rom müsse ihr verbleiben. Als Kaiserin beanspruchte Marozia die gleichen Rechte wie Hugo. Der König ging auf alle Forderungen ein. Er stellte nur die Bedingung, dass die Thronfolge auf seine Familie übergehe, falls Marozia ihm keine Kinder gebären würde. Nach einigem Zögern fand sich Marozia dazu bereit. Sie verabredeten, noch heute die Hochzeit zu feiern.
Als die Verhandlungen zu beider Zufriedenheit abgeschlossen waren, trat Hugo zu Marozia. Sie zuckte vor seiner Berührung zurück. Alles an diesem Mann erregte ihren Widerwillen: die Stimme, der Gang, das verlebte Gesicht … Lohnte die Kaiserkrone dieses Opfer? Sie schloss die Augen, um die aufsteigende Übelkeit niederzuringen. Hugo schaute sie befremdet an. Doch schon hatte sie die Schwäche überwunden. Lächelnd sagte sie: „Später, mein Freund, nach der Hochzeit.“
Der König unterdrückte die anzügliche Frage, seit wann Marozia so peinlich auf Anstand und Sitte hielt. Er deutete eine Verbeugung an und verließ mit seinem Gefolge den Raum.
Um diese Stunde erwachte Alberich aus schwerem Schlaf und erfuhr, dass König Hugo und Marozia in wenigen Stunden Hochzeit halten würden. Er stürzte zum Ausgang, um in die Stadt zu reiten. Die Wachen legten die Lanzen quer und trieben ihn zurück. Vor der Tür zogen Posten auf.
Voller Wut und Schmerz warf sich Alberich auf sein Lager. Er hätte wissen müssen, dass eine Schlange sich nicht in eine Taube verwandeln kann. Marozia liebte nur sich selbst – und die Macht. Ein verworfenes Weib war sie, eine Hure. Seine Liebe hatte sie schamlos ausgenutzt, um ihn in die Falle zu locken!
Alberich weinte wie ein Kind. Er verfluchte den Tag seiner Geburt und wünschte Marozia den Tod.
Allmählich wich seine Raserei ruhigen Überlegungen. Was bedeutete schon die Liebe eines Weibes. Die Macht wollte er, nur noch die Macht. Nichts war verloren, wenn er einen klaren Verstand behielt. Marozia konnte ihn nicht töten lassen, solange sie einen Aufstand der Römer befürchten musste. Er, der Sohn einer Schlange, beherrschte die Kunst der Verstellung nicht weniger gut als sie. Auch die Mutter sollte den Tag verfluchen, da sie ihn geboren hatte.
Als Marozia Alberich aufsuchte, war sie überrascht, ihn gelassen zu finden. Sie hatte Vorwürfe erwartet, Schmähungen. Stattdessen hörte er ihr ruhig zu, äußerte Verständnis für ihre Lage und versprach, in allem auf ihrer Seite zu stehen, wenn sie nur bei Hugo durchsetzte, dass er, Alberich, die Kaiserwürde erbe. Marozias anfängliches Misstrauen schwand. Was gab es Verlockenderes als die Macht? Auch für ihren Sohn. Erleichtert gestattete sie Alberich, sich frei in der Festung zu bewegen. Sie bat ihn sogar, mit Teodosius zu sprechen. Selbst vor Teodosius hinzutreten, wagte sie nicht. Sie fürchtete, dass der Zorn ihn zu Worten hinreißen würde, die sie als Herrscherin Roms nicht dulden durfte. „Sag ihm, dass alles nur seinetwegen geschieht. Ich werde ihn reich belohnen, wenn die Stunde gekommen ist“, beschwor Marozia den Sohn. Alberich versprach es.
Vor Teodosius wiederholte er die Worte Marozias nicht. Er erzählte nur, was für ein verwerfliches Spiel Marozia getrieben hatte. „Sie hat dich, uns alle verraten“, schloss er.
Teodosius lief wie ein gefangenes Tier durch den halbdunklen Raum. Endlich blieb er vor Alberich stehen und sagte mit einer vor Müdigkeit heiseren Stimme: „Arme Marozia!“
Verständnislos schaute ihn der Jüngling an. „Sie soll dir nicht leid tun! Hassen musst du die, diese Ausgeburt einer Schlange!“
Teodosius schwieg. Es wäre zu viel von Alberich verlangt, seine Mutter zu verstehen. Er glaubte sich in seiner Sohnesliebe enttäuscht, doch er liebte Marozia genauso wenig wie sie ihn. Aus ihm sprach nur verletzte Eigenliebe. Er würde es nicht wahrhaben wollen, wenn Teodosius es ihm sagte.
Hinter Teodosius lag die schwerste Nacht seines Lebens. Wieder und wieder hatte er sich die Stunden mit Marozia ins Gedächtnis gerufen. Konnte sich Marozia so verstellen, dass ihr Körper, ihre Hände, ihre Stimme logen? Er erinnerte sich an ihre Unruhe, ihre ihm unerklärliche Trauer. Was war in ihr vorgegangen? Die Frage, ob sie ihn wirklich geliebt oder nur für ihre Pläne benutzt hatte, peinigte ihn.
Als Teodosius hartnäckig schwieg, verließ Alberich ihn missgelaunt. Was hatte Marozia aus diesem Mann gemacht! Einen weinerlichen Schwächling.
Alberich schlenderte durch die Burg. Überall herrschte emsige Geschäftigkeit. Es roch nach Gebratenem und Gesottenem. Mägde und Dienerinnen huschten durch die Gänge, über die Treppen und kreischten auf, wenn einer der Knechte sie zu fassen bekam. In allen Ecken lungerten Männer aus Hugos Gefolge und spielten sich als die Herren auf. Endlich fand Alberich den Kommandanten Giorgio. Von der Plattform der Burg schaute er mit düsterem Blick zum Neronischen Feld außerhalb der Stadtmauern hinüber, wo Hugos Soldaten lagerten. Alberich setzte sich auf einen Haufen Steine, die als Geschosse dienen sollten.
„Wer hätte das für möglich gehalten – durch die List eines Weibes fällt Rom unter die Herrschaft des Provencalen“, sagte er halblaut. Da Giorgio nicht antwortete, fuhr er lauernd fort: „Bist du so wenig Römer, dass dich das kaltlässt?“
Der Kommandant erwiderte: „An dieser Stelle gelobte ich erst gestern Marozia Gehorsam bis in den Tod.“
„Wusstest du, als du ihr den Eid gabst, dass sie heute nicht Teodosius, sondern König Hugo heiraten würde?“
Giorgio schüttelte den Kopf. Alberich sprang auf, fasste ihn bei den Schultern und sagte eindringlich: „Unter anderen Voraussetzungen versprachest du ihr Gehorsam. Sie hielt ihr Wort nicht, also wird auch das deine ungültig.“
Zweifelnd sah Giorgio Alberich an, nahm dessen Hände von seinen Schultern und murmelte: „Wenn das so einfach wäre.“ Alberich war mit der Antwort zufrieden. Sich zum Gehen wendend, sprach er: „Rom braucht tapfere Männer. Ich zähle auf dich.“
In der Michaelskapelle der Engelsburg standen die Ritter aus Hugos Gefolge und einige Römer. Einst waren in diesem Raum die sterblichen Überreste des Kaisers Hadrian beigesetzt worden. In den Jahrhunderten, da das Grabmal als Festung und Gefängnis diente, hatte sich das Wissen darum verloren. Dennoch konnten sich die Römer banger Ahnungen nicht erwehren, während sie der Hochzeitszeremonie beiwohnten.
Johann, der junge Papst, eilig herbeigeholt, las die Messe stockend und mit unglücklichem Gesicht. Als er die Frage stellte, ob Marozia König Hugo zum Gemahl nehmen wolle, verstummte er mitten im Satz. Ungeduldig rief Hugo in die Stille: „Voran, Priester, bring’s zum Ende!“
Flehend schaute Johann auf Marozia. Zum ersten Mal empfand Alberich Mitleid mit dem Bruder. Auch ihn hatte die Mutter hintergangen.
Marozia starrte auf das Fenster der Kapelle. Bleich, gleichsam entrückt, saß sie in ihrem Stuhl. Sie antwortete nicht, als Johann seinen Satz beendet hatte. Was ging sie der Mann neben ihr an? Ein Wort an Giorgio, und der König und sein Gefolge wären ihre Gefangenen. Mit Hugo als Geisel könnte sie das Heer zum Abzug zwingen. Was aber, wenn es trotzdem die Mauern berannte und überwand? Die Römer würden ihr niemals verzeihen. Sie verlor die zum Greifen nahe Kaiserkrone, die Herrschaft über Rom.
Um ihre Macht fest zu gründen, um ihre kühnen Pläne zu verfolgen, brauchte sie Hugo. Doch ohne Teodosius schwanden Glanz und Wärme aus ihrem Leben. Seine Enttäuschung würde in tödlichen Hass umschlagen, der sie zwang, ihn zu vernichten. Ihr schauderte vor der Zukunft. Sie fühlte sich einer Ohnmacht nahe.
Hugo legte seine Hand auf die ihre und flüsterte ihr zu: „Man wartet auf deine Antwort.“ Nun hörte sie das Füßescharren und Räuspern der Hochzeitsgäste, gewahrte Johanns verstörten, Alberichs lauernden Blick. Sie besann sich. Wer herrschen will, darf nicht rückwärts schauen, darf nicht an sich zweifeln, muss das Schicksal zwingen. Eine Frau wie sie konnte man besiegen, aber nicht unterwerfen. Marozia warf den Kopf zurück, dass der seidene Schleier von ihrem Haar glitt. Ihr Ja klang wie eine Kampfansage.
Nach dem Segen des Papstes führten die Neuvermählten den Zug der Gäste an. Sie schritten durch fackelerhellte Gänge, über Treppen und Höfe, stiegen hinauf auf die Rundterrasse der Burg. Stolz wies Hugo zu den Neronischen Feldern hinüber, wo sein Heer Aufstellung genommen hatte und das Paar mit Fanfarenklängen grüßte. Er umarmte Marozia. Sie versuchte ihn zurückzustoßen, doch er hielt sie fest. Seine Lippen waren heiß und gierig. Unter dem Beifall der Umstehenden küssten sie sich. Nur Johann und Alberich hielten die Arme verschränkt.
Wie eine Dirne führt sie sich auf, dachte Alberich. Er wandte den Kopf ab und begegnete dem Blick Giorgios. Der Mann schlug die Augen nieder. Alberich trat zu ihm. „Hast du es dir überlegt?“, flüsterte er. Ehe Giorgio antworten konnte, ließ sich Hugo vernehmen: „Wir vermissen noch immer die Huldigung des jungen Alberich!“
Dem Jüngling verschwammen für einen Augenblick die Gesichter ringsum, er sah nur rote Nebel. Taumelnd trat er vor Marozia und Hugo hin. Nach einer Verbeugung und ein paar undeutlichen Worten wollte er sich zurückziehen. Breitbeinig dastehend, schaute Hugo auf den um einen Kopf kleineren Alberich hinab und sagte herausfordernd: „Auf die Knie! Wer herrschen will, muss zuerst dienen.“ Alberich griff nach dem Dolch im Gürtel, ließ aber sogleich die Hand sinken. Der König stemmte die Arme in die Hüften, hinter seinem Lächeln blitzte Feindseligkeit auf. Alberich erkannte, dass Hugo ihn töten würde, sobald sich Gelegenheit dazu bot. Widerwillig beugte er das Knie. Als er sich erhob, rief es vom Tiber her: „Heil Alberich! Heil Alberich!“ Freunde grüßten den Eingeschlossenen.
Auf einen Wink Hugos schrien dessen Gefolgsleute: „Es lebe der König! Es lebe die Königin!“ Die Männer liefen an die Brüstung, warfen Steine hinunter und verspotteten den kleinen Haufen Berittener. Alberich nutzte das Geschrei und Durcheinander, sich zu entfernen.
Marozia war zufrieden, den Sohn so gedemütigt zu sehen. Noch einmal befahl sie Giorgio, alle Ausgänge der Burg streng zu bewachen und niemanden ohne ihr Wissen passieren zu lassen. Sie fühlte sein Widerstreben. Es war ihr nicht entgangen, wie er vorhin mit Alberich geflüstert hatte. „Hab Vertrauen, Giorgio. Es geschieht alles zum Besten der Römer. Sie werden es mir noch danken“, sagte sie.
Giorgio dachte an Leonora, die Schwester der Senatorin. Wäre sie hier, könnte er sie fragen, was er tun sollte. Doch sie war mit ihrem Mann in die Gegend von Viterbo gereist, wo der Alte Linderung für seine Gicht suchte. Die Senatorin hatte zwar einen Boten nach ihr geschickt, aber vor morgen konnte Leonora nicht in Rom sein. Sie hätte die Demütigung Alberichs nicht widerspruchslos hingenommen, hätte vielleicht sogar die Hochzeit mit Hugo verhindert.
Giorgio seufzte. Er war Soldat. In den Ränken eines Weibes kannte er sich nicht aus. Wem sollte er gehorchen? Sein Herz sprach für Alberich. Der Eid aber band ihn an die Senatorin. Leonora würde jetzt lachen. Wie oft neckte sie ihn wegen seiner strengen Auffassung von Pflicht und Ehre, wo doch alle logen und betrogen um ihres Vorteils willen. Er dagegen brachte es nicht einmal fertig, sich zu verheiraten, weil er dann die eine Frau mit der anderen betrügen müsste.
Schon längst war die Hochzeitsgesellschaft wieder in die Burg hinabgestiegen, da stand Giorgio noch immer gedankenverloren an der Brüstung. Er schrak auf, als jemand neben ihm sagte: „Mein Herr, der jetzt auch deiner ist, befiehlt dir, für die Sicherheit der Burg Sorge zu tragen, statt tatenlos zu träumen.“ Sich umwendend, erblickte er einen Edelmann aus dem Gefolge Hugos. Zu der männlichen Stimme wollte das weiche, fast weibische Gesicht des Jünglings nicht passen. Das musste Liutprand sein, der Günstling des Königs. Giorgio sagte beherrscht: „Lass deinen Herrn wissen, dass ich meine Aufgaben kenne, aber von Kindern keine Befehle entgegennehme.“
Liutprand grinste, was seinen Zügen etwas Verschlagenes gab, und stichelte: „Besser noch als von einem Weibe, von dem man sich allerlei erzählt.“
Giorgio legte seine Hände schwer auf die Schultern des Jünglings und fragte drohend: „Was erzählt man sich?“
Liutprand entzog sich seinem Zugriff, sprang zur Tür, lachte und verspottete Giorgio mit einer unmissverständlichen Geste.
Während Giorgio seinen Gedanken nachhing, Alberich ruhelos durch die Burg irrte, Teodosius im Dunkel seines Kerkers um Fassung rang, Marozia und Hugo im Burghof den Kampfspielen der Ritter beiwohnten, schürte Demetrius in der Stadt die Empörung über den Verrat der Marozia. Aber zum Kampf wollten sich nur die Jünglinge bereitfinden. Die Älteren verwiesen auf das königliche Heer vor den Toren und rieten, nichts zu überstürzen, solange nicht Alberich und Teodosius zum Widerstand gegen den König aufriefen, Demetrius musste ihnen recht geben. Ohne eine von der Autorität Alberichs und der Erfahrung des Teodosius getragene Führung war jedes Aufbegehren sinnlos. Es galt, auf die rechte Stunde zu warten. Alberich würde einen Weg aus der Burg finden.
Demetrius ließ den Eingang zur Engelsburg beobachten. Am Tiberufer unterhalb der Brücke lagerte eine Gruppe von Jünglingen, bereit, beim ersten Signal Alberichs zum Aufstand zu rufen. An den Stadttoren warteten Demetrius’ Freunde auf den Befehl, die Zugänge zu schließen.
Das schwere Rund der Burg versank in nächtliches Dunkel. Über die Brücke zogen einzelne Reiter mit ihrem Gefolge, Adlige, die sich entschlossen hatten, die Einladung zum Hochzeitsmahl anzunehmen und dem königlichen Paar zu huldigen. Teils trieb sie die Neugier, teils der Wunsch, es mit Marozia nicht zu verderben. Im großen Saal unter der Michaelskapelle, wo sie am Vorabend mit der Senatrix und Teodosius getafelt hatten, fanden sie nun auf dem Platz neben Marozia König Hugo. Er grüßte von oben herab die römischen Edlen, und in seinem Gefolge fiel manches spöttische Wort über die Römer.
Marozia, die am Nachmittag einige Stunden geruht hatte, war schöner denn je, selbst der junge Liutprand fand sie jetzt verführerisch. Nur wenn sie an Teodosius dachte, verfiel ihr Gesicht, für Augenblicke sah sie alt und müde aus. Aber dann klang ihr Lachen noch lauter und aufreizender.
Aufmerksam glitten ihre Blicke durch den Saal. Den Wein rührte sie nicht an, sie aß kaum. Nichts entging ihr: nicht das herausfordernde Auftreten von Hugos Gefolgsleuten, nicht die bedrückten Mienen der Römer, nicht die Qual Alberichs. Sie hatte den Sohn angewiesen, dem Stiefvater Pagendienste zu leisten, damit er das Misstrauen Hugos gegen sich überwinde. Mit unbewegtem Gesicht hatte der Jüngling diese Erklärung der Mutter hingenommen. Fast enttäuschte sein Gehorsam Marozia. War dies noch ihr ungebärdiger stolzer Sohn?
Von den Gewölben hallte der Lärm der Zechenden wider, wild spielten die Musikanten auf. Marozia glaubte den Gang der Ereignisse zu beherrschen.
Alberich stand hinter Hugo und füllte dessen Becher nach. „Wasser!“, verlangte der König. Er schob den Teller mit der abgenagten Hammelkeule von sich und hielt die Finger hoch. Aufreizend langsam kam Alberich mit der Schüssel, stellte sie dann heftig auf den Tisch, dass Wasser überschwappte. Ohne den Blick zu heben, rief Hugo laut in den Saal: „Weißt du nicht, wie man einen König bedient? Auf die Knie!“