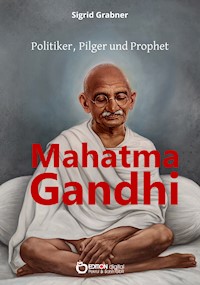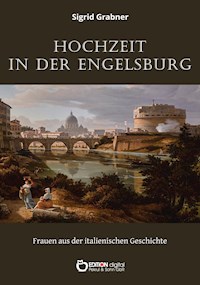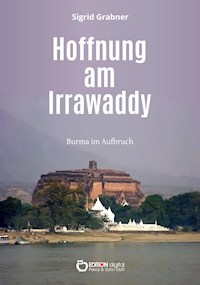7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Noch bis heute hat sich im Namen dieses asiatischen Landes, das zu wenigen katholischen Regionen dieses Kontinents gehört, die einstige koloniale Abhängigkeit erhalten, die 1565 – also großzügig betrachtet vor rund 500 Jahren begann. Gemeint ist der koloniale Besitzanspruch Spaniens. Denn ihren Namen verdanken die Philippinen ihrem (europäischen) Entdecker Ruy López de Villalobos (1500 bis 1546), der nach den Gewürzinseln suchte und die 1543 erreichten Inseln zu Ehren des damaligen spanischen Königs Philipp II. „Las Islas Filipinas“ nannte. Allerdings gab es bereits von Anfang an Feinseligkeiten zwischen den Einheimischen und ihren spanischen Entdeckern, die sowohl deswegen als auch wegen Hungers und des Verlustes eines Schiffs eine eben erst dort aufgebaute Siedlung aufgeben und ihre Expeditionsreise beenden mussten. Nebenbei bemerkt suchten die Spanier auf den Molukken Schutz, die damals von den Portugiesen beherrscht wurden, was einen weiteren Kampf verursachte, in dem López de Villalobos starb. Der Rest der Besatzung konnte allerdings entkommen und nach Neuspanien zurückkehren. Das Vizekönigreich Neuspanien „Virreinato de Nueva España“ bestand von 1535 bis 1822, war das erste der vier administrativen Verwaltungsgebiete in Lateinamerika, dem jeweils ein Vizekönig vorstand und umfasste zur Zeit seiner größten Ausdehnung die heutigen Staaten Mexiko, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela sowie die Karibischen Inseln, in Asien die Philippinen, die Marianen, die Karolinen, Palau, Guam und Nordborneo. Und damit zurück nach Luzon. Thema des spannenden Buches von Sigrid Grabner ist der Befreiungskampf des philippinischen Volkes – zunächst gegen die Spanier, die dort wie auch in Lateinamerika (wie von zu Hause gewöhnt) mit dem Schwert in der einen Hand und mit der Bibel in der anderen Hand sich nahmen, was sie sich nehmen zu dürften glaubten, und die Filipinos höchst brutal unterdrückten, und dann gegen die Nordamerikaner, die 1898 das koloniale Erbe der Spanier antraten. Für die meisten Einheimischen änderte sich nichts, es wurde eher noch schlimmer. Diese Unterdrückung erzeugte jedoch Gegendruck und den starken Wunsch der Befreiung von den Unterdrückern, der in der philippinischen Revolution von 1896 gipfelte. In ihrem Buch erzählt Sigrid Grabner von Heldenmut und Vaterlandsliebe, aber auch von Verrat und menschlicher Schwäche, von Verzweiflung und großer Sehnsucht nach Freiheit und Unabhängigkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Sigrid Grabner
Flammen über Luzón
Über die philippinische Revolution von 1896
ISBN 978-3-96521-646-4 (E-Book)
Umschlaggestaltung: Ernst Franta
Das Buch erschien 1976 im Verlag Neues Leben, Berlin.
2022 EDITION digital
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
Für H.
Geleitwort
Vor vielen tausend Jahren, so erzählt man sich in den Bergen von Luzón die Entstehungsgeschichte der Philippinen, hatten Himmel und Meer einen Streit. Das Meer brodelte und schäumte und warf voll ohnmächtiger Wut weiße Gischt hinauf zu den Wolken. Darüber geriet der Himmel mehr und mehr in Zorn und schleuderte große und kleine Felsen herab, damit sich die wütenden Wellen daran brächen. So sollen die 7107 Inseln des philippinischen Archipels entstanden sein. Eine andere Sage meint, dass einst eine Göttin von großem Kummer erfasst wurde. Ihre Tränen fielen in das Meer, erstarrten und bildeten Inseln von einzigartiger Schönheit.
Heute leben auf den Philippinen fast 45 Millionen Menschen. Die Filipinos wurden einst von den Spaniern und später von den Amerikanern unterdrückt. Sigrid Grabner berichtet in ihrem Buch von jener Zeit, als die Spanier mit dem Schwert in der einen und der Bibel in der anderen Hand das philippinische Volk kolonialisierten und so brutal unterdrückten, dass sich die Filipinos schließlich machtvoll zur Wehr setzten. Es war die Zeit der ersten bürgerlich-demokratischen Revolution auf den Philippinen. „Flammen über Luzón“ bringt uns jene Menschen näher, die ihr Leben der Befreiung ihres Landes gewidmet haben. Das Buch erzählt von Heldenmut und Vaterlandsliebe, aber auch von Verrat und menschlicher Schwäche, von Verzweiflung und großer Sehnsucht.
Als 1898 der USA-Imperialismus auf den Philippinen das koloniale Erbe Spaniens antrat, veränderte sich nichts für das philippinische Volk. Die USA brachten den Philippinen weder die ersehnte politische Unabhängigkeit noch wirtschaftlichen Fortschritt. Sie konservierten die halbfeudalen Produktions- und Abhängigkeitsverhältnisse und entwickelten lediglich begrenzt die Wirtschaftszweige, an denen der amerikanische Markt interessiert war. Neben der Vertiefung der politischen und wirtschaftlichen Abhängigkeit setzte eine starke Amerikanisierung des gesellschaftlichen Lebens der Philippinen ein. Die sich herausbildende Kompradorenbourgeoisie wurde zusammen mit den halbfeudalen Großgrundbesitzern die wichtigste politische Stütze der neuen Kolonialmacht.
Aber ebenso wenig wie die Spanier vermochten es die Amerikaner, den Wunsch des Volkes nach nationaler Befreiung zu unterdrücken. Bis zur Erringung der Unabhängigkeit war es noch ein weiter Weg, ein Weg voller Opfer.
Am 7. November 1930 wurde die „Kommunistische Partei der Philippinischen Inseln“ (KPdPhI) gegründet. Sie knüpfte an die revolutionäre Tradition der bürgerlich-demokratischen Revolution an und begann den massenpolitischen Kampf um nationale Befreiung zu organisieren. Am 24. März 1934 musste schließlich der amerikanische Präsident F. D. Roosevelt den Philippinen eine formelle innere Teilautonomie gewähren, die jedoch in keiner Weise die Herrschaft der USA antastete, sondern lediglich auf eine Übergangsetappe bis zur Unabhängigkeit orientierte. Die Kommunistische Partei schätzte bereits zu jener Zeit richtig ein, dass der USA-Imperialismus gezwungen werden muss, seine Versprechen einzuhalten.
Am 29. und 30. Oktober 1938 vereinigten sich auf marxistisch-leninistischer Grundlage die „Kommunistische Partei der Philippinischen Inseln“ mit der „Sozialistischen Partei“ zur „Kommunistischen Partei der Philippinen“ (KPdPh). In dieser Zeit zeigten sich bereits immer unverhüllter die Expansionsabsichten der japanischen Militaristen. Die Kommunistische Partei erkannte diese Gefahr und begann 1941, Partisaneneinheiten aufzustellen.
Am 7. Dezember 1941 überfielen die Japaner Pearl Harbor, den Hauptstützpunkt der US-Pazifikflotte, und bombardierten noch am gleichen Tag philippinisches Territorium.
Drei Tage später landeten die ersten japanischen Truppen auf Luzón. Während sich die Besitzenden den Japanern beugten und auch das Kleinbürgertum beträchtliche Illusionen über eine „japanische Befreiung“ von den Amerikanern hegte, nahm das philippinische Volk den Kampf gegen die japanischen Invasoren auf. Grausam wüteten die Japaner unter der Bevölkerung, doch sie konnten den Kampf des Volkes nach echter Freiheit nicht unterdrücken. Neben dem Aufbau einer Einheitsfront (am 6. Februar 1942 wurde die Nationale Antijapanische Einheitsfront gegründet) verstärkte die Partei die Reihen der Partisaneneinheiten. Diese wurden schließlich zur „Antijapanischen Volksarmee“, der „Hukbong Bayan Laban Sa Hapon“ (Hukbalahap) zusammengefasst. Die japanischen Aggressoren mussten bald zur Kenntnis nehmen, dass sie einer schlagkräftigen und gut organisierten Partisanenarmee gegenüberstanden. Trotz massiven militärischen Einsatzes der Japaner befreiten die „Huks“ große Gebiete und gründeten dort demokratische Selbstverwaltungsorgane. Die unter Führung der Kommunistischen Partei stehenden „Huks“ genossen unter der Bevölkerung hohes Ansehen.
Die Amerikaner, die am 20. Oktober 1944 Truppen auf den Philippinen landeten, nutzten die Kraft und den Einfluss der „Huks“ aus, um den Widerstand der Japaner zu brechen. Als im Juni 1945 der Kampf auf Luzón, im Juli auf den anderen Inseln endete und am 2. September 1945 die bedingungslose Kapitulation Japans unterzeichnet wurde, hatten die „Huks“ daran einen entscheidenden Anteil. Mit großer Besorgnis verfolgte nunmehr Washington den wachsenden Einfluss der Partisanen.
Kaum waren die Philippinen von den japanischen Militaristen befreit, da geriet das Land erneut in die Umklammerung der USA. Es dauerte gar nicht lange, und die amerikanischen Monopole hatten wieder ihre uneingeschränkte Herrschaft errichtet. Im Juni 1945 wurde die „Demokratische Allianz“, der die KPdPh, die Hukbalahap, der „Nationale Bauernbund“, das Komitee der Arbeiterorganisation und verschiedene andere demokratische Organisationen angehörten, gegründet. Die „Demokratische Allianz“ wurde zum Zentrum jener Kräfte, die politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit forderten. Die USA, die nunmehr nicht länger die Forderung nach Unabhängigkeit ignorieren konnten, begannen ihren Einfluss langfristig auch für die Zukunft abzusichern. Die Philippinen mussten ihre Verfassung von 1935 ändern und darin einen Passus aufnehmen, der den Amerikanern gleiche Rechte wie den Filipinos bei der Ausbeutung der nationalen Ressourcen zusicherte. Diese „Parity Rights“, die 1955 durch das sogenannte Laurel-Langley-Abkommen unwesentlich modifiziert wurden, ermöglichten es den Amerikanern, Schlüsselpositionen in der philippinischen Wirtschaft zu besetzen. Nur unter diesen Bedingungen hatte Washington zugestimmt, den Philippinen die Unabhängigkeit zu gewähren.
Als am 4. Juli 1946 in Manila die amerikanische Flagge eingeholt wurde und die dreifarbene Fahne der Philippinen mit der goldenen Sonne und den drei Sternen, unter der bereits die Helden von 1896 ihr Blut vergossen hatten, als Symbol der staatlichen Unabhängigkeit am Mast emporstieg, hatten die demokratischen Kräfte einen wichtigen Erfolg errungen. Doch noch am gleichen Tag musste die philippinische Regierung den „Vertrag zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika mit den Philippinen zum Handel und zu anderen Fragen“ unterzeichnen, der die berüchtigten „Parity Rights“ beinhaltete und die philippinische Wirtschaft eng an die Marktbedürfnisse der USA band. Wenige Monate später, am 14. März 1947, wurde dann ein Abkommen über Militärstützpunkte abgeschlossen, das den USA das Recht gab, für 99 Jahre 23 Gebiete der Philippinen als Militärbasen zu nutzen.
Während sich die Kompradorenbourgeoisie mit diesen neokolonialistischen Verträgen abfand, setzten die demokratischen Kräfte ihren Kampf um echte Unabhängigkeit fort. Unterstützt von den USA, begann die philippinische Reaktion mit Flugzeugen, Artillerie und Panzern einen grausamen Feldzug gegen jene Filipinos, die einst unter Einsatz ihres Lebens das Land von den japanischen Invasoren mit befreit hatten. Tausende der besten Filipinos wurden ermordet, die demokratischen Organisationen verboten, und die Kommunistische Partei musste sich erneut in die Illegalität zurückziehen. Außenpolitisch wurden die Philippinen zum engsten Verbündeten des USA-Imperialismus in Asien. Sie wurden Mitglied des aggressiven SEATO-Bündnisses, nahmen an dem Krieg gegen das koreanische Volk und später auch gegen das vietnamesische Volk teil.
Ende der fünfziger und besonders in den sechziger Jahren erstarkte die demokratische Volksbewegung auf den Philippinen. Es war eine Arbeiterklasse herangewachsen, die zusammen mit den anderen ausgebeuteten Klassen und Schichten immer nachdrücklicher soziale und politische Veränderungen forderte. Auch innerhalb der Bourgeoisie hatte sich das Kräfteverhältnis verschoben. Die junge Industriebourgeoisie drängte danach, einen größeren Anteil am nationalen Reichtum zu erhalten, und wandte sich besonders gegen die Übermacht und die Sonderprivilegien der Amerikaner. Anfang der Siebzigerjahre wurden die Philippinen von einer Welle sozialer Erschütterungen erfasst. Erzreaktionäre und ultralinke Kräfte nutzten diese Situation aus und schufen eine Lage, in der Terrorakte und Bombenanschläge an der Tagesordnung waren. Der philippinische Präsident verhängte deshalb im September 1972 den Ausnahmezustand über das Land und begann gleichzeitig gegen den heftigen Widerstand der Großgrundbesitzer Reformen, u. a. eine Bodenreform, einzuleiten. Auch in der Außenpolitik dieses südostasiatischen Staates zeichneten sich wesentliche Veränderungen ab. Manila folgte nicht mehr bedingungslos dem Diktat Washingtons, sondern war bestrebt, sich den Realitäten anzupassen. Die philippinische Regierung erneuerte trotz Drängens der USA das 1974 abgelaufene diskriminierende Handelsabkommen mit den Sonderprivilegien für die Amerikaner nicht. Sie setzte sich stattdessen für die Auflösung des SEATO-Militärpaktes ein und forderte von den USA Verhandlungen über die amerikanischen Basen auf philippinischem Territorium, deren Pachtzeit 1966 auf 25 Jahre begrenzt worden war. Schrittweise wurden die Beziehungen zu den einst brüskierten sozialistischen Staaten entwickelt und mit der Mehrheit von ihnen, so auch mit der DDR, diplomatische Beziehungen aufgenommen. Wenngleich diese Entwicklung noch von vielen Widersprüchen behaftet ist, so schätzen die herrschenden Kreise auf den Philippinen heute das internationale Kräfteverhältnis realer ein.
Die Kommunistische Partei, die seit ihrer Gründung im Jahre 1930 fast ununterbrochen in der Illegalität kämpfen musste, erhielt im Oktober 1974 durch ein Dekret des philippinischen Präsidenten die Möglichkeit, in Zukunft legal zu arbeiten. Unter den Bedingungen des Ausnahmezustandes ist zwar gegenwärtig die legale Arbeit der Kommunistischen Partei wie auch die aller anderen Parteien sehr begrenzt, dennoch war es ein wichtiges Ereignis in der Geschichte des Landes, das den demokratischen Kräften neue Möglichkeiten eröffnet, die positiven innen- und außenpolitischen Veränderungen zu vertiefen.
Mit diesem Buch erhält vor allem die Jugend in der DDR erstmalig eine lebendige und spannende Lektüre über eine entscheidende Phase in der Geschichte des philippinischen Volkes. Sigrid Grabner gebührt Anerkennung dafür.
Berlin, im März 1976
Dr. Bernd Sander
Andres Bonifacio – der große Plebejer
Im Schatten von Intramuros
In dem stattlichen Gebäude des „Diario de Manila“ herrschte Ruhe. Die Ausgabe vom nächsten Tag, dem 20. August 1896, war ausgedruckt und versandfertig. Ein von der weltlichen und geistlichen Obrigkeit wohlgelittenes Blatt. Zufrieden konnte Don Ramon Montes auf sein Tagwerk zurückblicken und sich zur verdienten Ruhe begeben.
Harte Schläge an der Tür rissen ihn aus dem ersten Schlaf. Unwillig erhob er sich und fand zu seinem größten Erstaunen den frommen Pater Mariano Gil vor der Tür. Aufgeregt erklärte Ehrwürden, hier, im Unternehmen des Don Ramon Montes, geschähen hochverräterische und gotteslästerliche Dinge. Don Ramon Montes wagte nicht zu widersprechen, die Patres waren die Herren der Stadt. So bat er den späten Besucher höflich ins Haus und erklärte diensteifrig, Ehrwürden beim Suchen nach den erschrecklichen Dingen helfen zu wollen.
Der Pater ging erstaunlich zielstrebig zu Werke. Er steuerte direkt in die Lithografie und fing an, die schweren Lithografie-Steine einen nach dem anderen aus den Regalen zu wuchten. Plötzlich schrie Mariano Gil triumphierend auf. Mit zitternden Händen hob er einen Druckstein ins Licht, dann Aufnahmeformulare der Katipunan, die von diesem Stein stammten. Gils Augen brannten in irrem Feuer. Was jahrelang vermutet, aber nie bewiesen worden war, was jeder munkelte, aber nie einer gesehen hatte – nun war es bewiesen: Es gab eine Geheimorganisation. Die Katipunan war kein Gebilde überängstlicher Fantasie, sondern schreckliche Wirklichkeit. Und ihn, Pater Mariano Gil, hatte Gott der Allmächtige dazu ausersehen, diesen Frevel an Kirche und Thron aufzudecken.
Pater Gil hastete zur nächsten Polizeistation. Dort würde man ob der nächtlichen Ruhestörung nicht ungehalten sein. Endlich konnten Krone und Klerisei mit Feuer und Schwert auf die Rebellen niederfahren.
Während der mehr als dreihundertjährigen Herrschaft der Spanier auf den Philippinen waren Feuer und Schwert immer die wichtigsten Mittel der Regierungskunst gewesen. Pater Gil war überzeugt, sie würden auch diesmal die „gottgewollte Ordnung“ schützen. Was er in dieser Stunde, da ihn die Geschichte zu ihrem Werkzeug erkor, nicht wissen konnte, war, dass das Schwert zerbrechen und das Feuer die spanische Herrschaft auf den Philippinen verschlingen würde.
Der Polizeipräfekt schickte noch in den Morgenstunden des 20. August seine Häscher aus. Aber die geheimen Verbindungen der Katipunan hatten präziser gearbeitet. Alle Führer waren gewarnt und hatten die Stadt verlassen. Unter ihnen Andres Bonifacio, der Schöpfer und Organisator der Geheimgesellschaft. Pater Gil hatte das Rad der Ereignisse beschleunigt. Was er verhindern wollte, setzte er in Gang – die Revolution.
Pater Gil stand am Ende einer langen blutigen Geschichte. Begonnen hatte sie im Jahre 1571, als Miguel Lopez de Legazpi die Eroberung der Philippinen mit der Unterwerfung Manilas krönte. Der spanische Konquistador erkannte sofort die strategische Position der Stadt an der Bucht von Manila und beschloss, sie zum Zentrum der spanischen Macht auf den Philippinen auszubauen. Ungleich den Besitzungen in Amerika versprachen die Philippinen keine reiche Ausbeute an Gold, Gewürzen und anderen in Europa begehrten Kolonialwaren. Ihr Wert bestand in ihrer günstigen Lage als Stützpunkt im Chinahandel und als äußerster Vorposten des spanischen Kolonialreiches. Die Philippinen wurden nicht direkt von der spanischen Krone verwaltet, sondern vom spanischen Vizekönigreich Mexiko. Zweimal jährlich pendelte zwischen Acapulco und Manila ein spanisches Schiff, das die aus China und anderen Ländern Asiens in Manila eingelaufenen Waren nach Mexiko brachte, von wo aus sie nach Europa gelangten. 1591 legten die Spanier den Grundstein zum Fort Santiago an der Bucht von Manila. In den folgenden Jahrzehnten umgaben sie ihre Ansiedlung mit dicken Festungsmauern und nannten sie Intramuros, „innerhalb der Mauern“. Hier saßen die Herren der Kolonie – spanische Beamte, Offiziere, Missionare. Von hier aus knüpften sie ein Netz brutaler Unterdrückung über das Inselreich, das auch die zahlreichen Aufstände der Eingeborenen nicht mehr zu zerreißen vermochten.
Besonderes Geschick bei der Ausbeutung des Landes zeigte die katholische Kirche. Sie entwickelte einen fanatischen Missionseifer. Wie in keinem anderen Land Asiens gelang es ihr, die Einwohner zu christianisieren. Der Islam war bis zur Kolonialisierung nur in die südlichen Teile des Archipels vorgedrungen. Die Naturreligionen in den übrigen Gebieten konnten dem Christentum als Ideologie der Kolonisatoren nicht standhalten. Schon zu Beginn des 17. Jahrhunderts trat die katholische Kirche neben der weltlichen Kolonialverwaltung als unabhängige politische Kraft auf.
Spanien brachte den Einwohnern der Philippinen die Bibel und das Schwert. Es nahm ihnen alles, was sie besaßen: den Boden, ihre Arbeitskraft, ihre Freiheit und oft genug auch ihr Leben. Dem Namen nach gehörten die Inseln der spanischen Krone. Unterworfen, ausgebeutet und beherrscht aber wurden sie von den reichen Orden der Dominikaner, der Augustiner, der Franziskaner und der Jesuiten. Eine Vielzahl von Pfarreien und Klöstern überzog das Land. Ihr, der alles durchdringenden, allgegenwärtigen, alles beherrschenden Kirche, gehörte nahezu der gesamte Grundbesitz des Landes. Durch List, Betrug und nackte Gewalt vermehrte sie ihn ständig.
Die Bauern stöhnten unter der Last der Abgaben. Ihre Felder verwahrlosten, während sie auf den Klostergütern unentgeltlich arbeiten mussten. Für die Demütigen hielt die Kirche das Kreuz bereit, für jene, die die Verzweiflung zur Empörung trieb, das erbarmungslose Schwert. Und es gab viele, die an der schier unbegrenzten Macht der Klöster verzweifelten. Der Schriftsteller José Rizal, von dem später noch die Rede sein wird, berichtete in seinem Buch „Noli me tangere“ von einem Dorf, in dem drei Mönche erschlagen aufgefunden wurden. Bauern, denen das Kloster ihr letztes Stück Land geraubt hatte, hatten die Mönche getötet und ihnen die Münder mit Erde vollgestopft, mit der Erde, nach der sie so gierten. Die Bauern, die nichts mehr besaßen als das, was sie am Leibe trugen, flüchteten in die Berge und führten dort das Leben von Parias. Sie stritten auf ihre Weise für Gerechtigkeit, nahmen von den Reichen und gaben den Armen. Wie der Schinderhannes in Deutschland kämpften sie gegen die feudalen Missstände auf den Philippinen. Die Spanier verfolgten sie als Räuber und Banditen. Wenn einer von ihnen in ihre Hände fiel, marterten sie ihn grausam zu Tode und stellten seine Leiche tagelang den verängstigten Dorfbewohnern zur Schau.
In den Schulen, die alle der Kirche gehörten, von den Kanzeln und in den Beichtstühlen lehrten die Priester den bedingungslosen Gehorsam gegenüber der geistlichen und weltlichen Obrigkeit und schürten die Furcht vor der Strafe Gottes. Mochten in Europa auch Könige gestürzt werden, Reiche zusammenbrechen, Revolutionen toben, auf den Philippinen schien die Zeit stillzustehen. In seiner Politik stützte sich der Klerus auf die mächtige Kirche im Mutterland. Er machte sich die Erfahrungen der Inquisition zunutze und die ausgeklügelten Unterdrückungsmethoden seines Apparates. Niemand kannte das Land und seine Bewohner so gut wie er. Die spanischen Mönche und Priester verbrachten meist ihr ganzes Leben auf den Philippinen. Sie bekehrten die Einwohner zum Christentum, trieben die Abgaben ein, studierten die Sprachen und Gebräuche des Landes. Die Klöster und Pfarreien bildeten die politischen, ökonomischen und kulturellen Zentren in den jeweiligen Gebieten. Hier geschah nichts, was der Kirche verborgen geblieben wäre. Die Beamten der Krone hingegen hielten sich nur so lange im Lande auf, bis sie genügend Reichtümer zusammengeraubt hatten, um in Spanien ein sorgloses Leben führen zu können. Von dem Lande, das sie verwalteten, verstanden sie nichts, sie waren kaum mehr als Abenteurer und Glücksritter.
Im 19. Jahrhundert änderte sich das Bild. In Lateinamerika versetzten die Unabhängigkeitskämpfe von 1810 bis 1824 dem feudalen spanischen Kolonialismus den Todesstoß. Spanien verblieben nur noch Kuba, Puerto Rico und die Philippinen. Der kapitalistische Weltmarkt entwickelte sich und zwang Spanien, sich seinen Erfordernissen anzupassen. 1837 wurde Manila zum Freihafen erklärt und damit die jahrhundertelange Isolierung des Landes aufgehoben. Fortan strömten neben Gütern aus aller Welt auch neue Ideen in das Land. Der Handel zwischen Europa und Asien nahm zu. Die Eröffnung des Suezkanals im Jahre 1869 tat ein übriges, um die Philippinen mit der Welt zu verbinden. In Manila entstand ein rasch wachsendes Handelsbürgertum und auf dem Lande eine Schicht liberaler Grundbesitzer. Mit Zucker, Tabak und Hanf ließen sich gute Gewinne erzielen. Erstmals erhob eine einheimische Intelligenz ihre Stimme. Ihre Forderungen nach bürgerlich-demokratischen Freiheiten nahmen auf Grund der feudal-klerikalen Struktur der Kolonie kirchenfeindlichen Charakter an.
Gleichzeitig drängte die junge spanische Bourgeoisie in Madrid darauf, die verbliebenen Kolonien effektiver zu verwalten. Immer häufiger kamen spanische Generalgouverneure nach Manila, die eine kapitalistische Kolonialpolitik durchzusetzen versuchten. Gestützt auf bürgerlich-liberale Kreise in Madrid, suchten sie nach Mitteln und Wegen, den kirchlichen Einfluss auf die Verwaltung der Kolonie zurückzudrängen und modernere Methoden zur Ausbeutung des Landes zu praktizieren – so wie es die Holländer in Indonesien und die Engländer in Indien schon lange taten.
Es war fast symbolisch, als die höchsten Beamten der spanischen Krone nach dem Erdbeben von 1863 ihren Regierungssitz aus den Mauern der alten spanischen Stadt weiter östlich in die ehemalige Sommerresidenz, den Malacanang, verlegten – weg aus dem Bannkreis des erzbischöflichen Palastes an der Calle Arzobispo in Intramuros. Aber die Kirche wachte argwöhnisch darüber, dass die Verwaltung ihrer Kontrolle nicht entglitt. Wenn die Generalgouverneure zu weit von der Politik der Kirche abwichen, waren ihre Tage auf den Philippinen gezählt.
Das Zentrum der spanischen Macht blieb Intramuros.
Nur wenige Kilometer trennten die alte spanische Festung und die Wohnviertel der Einheimischen nördlich des Pasig-Flusses, doch es lag eine ganze Welt zwischen ihnen. In Tondo und Trozo schufteten sich die Hafenarbeiter, Fabrikkulis und Dienstmädchen ihrem frühen Tod entgegen. Wenn die Kraft ihrer Körper aufgezehrt war, bettelten sie in den Straßen. Sie trugen nicht nur das Kainsmal einer unentrinnbaren Armut, sie mussten dazu auch noch die Verachtung und den Hohn derer erdulden, die an ihrer Armut schuld waren.
Hier, im Schatten von Intramuros, in Tondo, begann die Geschichte des Organisators der philippinischen Revolution, Andres Bonifacio. Damals wie heute gehörte Tondo zu den ärmlichsten Bezirken von Manila. In der Regenzeit stand knöcheltiefer Schlamm in den engen Straßen, in der Trockenheit machte aufwirbelnder Staub das Atmen schwer. Die Häuschen der Bewohner, der Feuchtigkeit wegen auf Bambuspfählen stehend, aus nackten Brettern oder Bambus und Palmenblättern roh zusammengefügt, waren dunkel, eng und schmutzig. Hier lebten die Zigarrenarbeiterinnen und Dienstmädchen, die Boten der Handelshäuser nahe des Hafens, die Lastenträger und Bettler. In einer der armseligsten Straßen von Tondo, in der Calle Azcarraga, wohnten das Dienstmädchen Catalina de Castro und der Seemann Santiago Bonifacio. Diese Straße markierte die Südgrenze von Tondo. In einem weiten Bogen wand sie sich vom Leuchtturm an der Pasigmündung nach dem Norden, überquerte eine Reihe größerer und kleinerer Kanäle, die Esteros, denen zur Ebbe ein übler Geruch von Fäkalien, Tierkadavern und Abfällen entströmte, und endete in der Nähe des Bilbid-Gefängnisses, wo die zum Tode Verurteilten mit dem Halseisen erdrosselt wurden. Das kleine Häuschen der Bonifacios stand gegenüber der Stelle, wo heute lärmende Züge in den Tutuban-Bahnhof einfahren.
Das Paar besaß kaum mehr als seine Hände und seine Jugend. Kinder sind der Reichtum der armen Leute, mögen sie sich gesagt haben. Am 30. November 1863, im Kirchenkalender der Tag des heiligen Andreas, wurde ihnen ihr erster Sohn geboren. Schon drei Tage später begaben sich die Eltern mit dem Neugeborenen in die Kirche von Tondo.
Die Festgesellschaft bestand aus einem einzigen Freund, dem Taufpaten. Die beiden Männer mussten ihren raschen Gang immer wieder zügeln, um die junge Frau in ihrer Mitte nicht zurückzulassen. Catalina de Castro fühlte sich noch schwach. Dennoch hatte sie ihren Mann gedrängt, bei Pater Saturnino Buntan die Taufe für den kleinen Jungen zu bestellen. Als gute Katholikin wusste sie, dass die Seele eines neugeborenen Kindes dem Teufel verfiel, wenn es starb, bevor es getauft wurde. Und als Bewohnerin von Tondo wusste sie, wie schnell die Neugeborenen starben.
Sie seufzte erleichtert auf, als sie in das Halbdunkel der Kirche trat. Nun würde ihrem kleinen Andres nichts mehr passieren. Reglos hörte sie dem unverständlichen lateinischen Singsang des Paters zu. Auf seinen Wink übergab sie das Bündel mit dem Säugling dem Paten. Der Priester ließ das Weihwasser auf die Stirn des Kindes tröpfeln. Catalina de Castro beugte den Kopf und betete inbrünstig, wie man es sie gelehrt hatte: „Bewahre ihn vor dem Bösen, sei ihm Schutz in allen Gefahren und hilf ihm, dass er in froher Unschuld vor dir wandelt. Lass ihn nicht in die Irre gehen, gib ihm Festigkeit im Glauben, Sicherheit in der Hoffnung und Frieden in der Liebe.“
Die schmucklose Zeremonie war vorüber, schon löschten die Sakristane die Kerzen, räumten die Bücher und Requisiten weg. Auch der Priester verbarg seine Eile nicht. Für die paar Centavos konnten die Leute nicht mehr erwarten. Die drei Menschen neigten sich noch einmal demutsvoll über die weiße Hand des Priesters und verließen die Kirche.
In schneller Folge bekam Andres Bonifacio noch fünf Geschwister, drei Brüder und zwei Schwestern. Andres Bonifacios Eltern fanden sich mit ihrer Armut ab, wie sich auch die anderen Armen mit ihr abzufinden hatten. Gott hatte die Welt, ihre Welt, eben so eingerichtet, dass südlich des Pasig die Reichen wohnten und sie, die Armen, auf der anderen Seite. Sie hatten keine Zeit und noch weniger das Wissen, darüber nachzudenken, warum das so war. Die Kirche hatte sie zeitig gelehrt, dass ihre Hoffnungen und Sehnsüchte nicht für diese Welt bestimmt waren. Santiago Bonifacio war ein Traum von den Träumen seiner Kindheit geblieben: Seine Kinder sollten die Schule besuchen. Aber in den Schulen von Intramuros und auf der berühmten Universität Santo Tomas war für seine Kinder kein Platz. Dort studierte die reiche Jugend des Landes. Der karge Verdienst Bonifacios reichte kaum aus, dem Ältesten in einer kleinen bescheidenen Schule in Tondo das Lesen und Schreiben beibringen zu lassen.
Die ersten Signale
Als Andres Bonifacio mit ungelenker Hand seine ersten Worte schrieb, lag über Manila eine seltsame Unruhe. In diesen bewegten Tagen des Jahres 1869 kündigte sich auf den Philippinen das Ende des Mittelalters an.
Ein Jahr zuvor hatten die Volksmassen in Spanien die Abdankung der Königin Isabella II. erzwungen. Das Kolonialministerium in Madrid passte sich der neuen Situation an und schickte den Liberalen Carlos Maria de la Torre als Generalgouverneur nach Manila. Enthusiastisch begrüßte ihn das philippinische Bürgertum. Bisher hatte es vergeblich ökonomische und politische Freiheiten für sich gefordert. Jetzt endlich schien seine Stunde gekommen. Carlos Maria de la Torre zögerte nicht, alle Kritiker des kirchlichen Regimes auf den Philippinen um sich zu sammeln, ihnen Reformen und größere ökonomische Freiheiten zu versprechen. Die Pressezensur wurde aufgehoben. Auf zahllosen festlichen Empfängen und Bällen versicherten sich der neue Generalgouverneur und die Vertreter der jungen Bourgeoisie gegenseitig ihrer Freundschaft und gaben sich euphorischen Zukunftshoffnungen hin.
Die Philippinen aber waren nicht Spanien, und Carlos Maria de la Torre hatte seine Kräfte wohl überschätzt. In dem geheimen erbitterten Kampf zwischen dem Herrn des Malacanang und den geistlichen Würdenträgern in Intramuros zog der Generalgouverneur den Kürzeren. Sang- und klanglos reiste er 1871 nach Madrid zurück. An seine Stelle trat General Rafael de Izquierdo. Er versprach den misstrauischen Mönchen, das Land wieder mit Kreuz und Schwert zu regieren. Er hielt Wort. Als im folgenden Jahr im Militärarsenal von Cavite, fünf Kilometer von Manila entfernt, ein Aufstand von zweihundert philippinischen Soldaten ausbrach, ließ er ihn blutig niederschlagen und benutzte ihn gleichzeitig als Vorwand, um die Parteigänger de la Torres unter der philippinischen Intelligenz zu ermorden, zu verbannen oder in die Emigration zu treiben.
Am 17. Februar des Jahres 1872 – Andres Bonifacio war gerade acht Jahre alt – trugen das Bürgertum von Manila und die philippinische Priesterschaft ihre Hoffnungen zu Grabe. Eine schweigende Menschenmenge säumte den Weg vom Fort Santiago, dem finsteren Gefängnis der Spanier in Intramuros, bis zum Luneta-Park südlich der Festungsmauern. Unter dumpfem Trommelschlag, umgeben von einer dichten Eskorte von Soldaten, schritten drei philippinische Priester zur Hinrichtungsstätte: der 73-jährige Pater Mariano Gomez, der 37-jährige Pater Jacinto Zamora und der zwei Jahre jüngere Pater José Burgos. Die Spanier hatten sie zum Tode durch das Würgeisen verurteilt, weil sie die Meuterei in Cavite inspiriert und geführt haben sollten. Eine lächerliche Beschuldigung, von der jeder wusste, dass sie nicht stimmte. Der wahre Grund für das Urteil lag woanders. In den verheißungsvollen Tagen des Jahres 1869 hatten die drei Priester von der Kirche gefordert, philippinischen Priestern endlich zu gestatten, Pfarreien zu übernehmen. Schon seit langem fühlten sich die philippinischen Geistlichen gegenüber ihren spanischen Amtsbrüdern benachteiligt. In der kirchlichen Hierarchie durften sie nur die untersten Positionen einnehmen. Es war ihnen nicht gestattet, Pfarreien oder gar Klöster zu leiten. Das war ein Vorrecht der spanischen Priester. Weiße und braune Priester sind vor Gott gleich, argumentierten die Vertreter der philippinischen Geistlichkeit. De la Torre hatte die Priester unterstützt und vor allem seinem Freund José Burgos den Rücken gestärkt.
Die Kirche wusste, dass eine Philippinisierung der Pfarreien ihre ökonomischen und politischen Positionen auf dem Lande schwächen würde. Sie wusste auch, dass die Priester nicht für sich allein sprachen. Hinter ihnen stand die philippinische Priesterschaft und das junge Bürgertum. Die Hinrichtung der drei Priester war die Rache der spanischen Mönche für das Jahr 1869. Sie sollte auch allen anderen Reformbestrebungen ein für alle Mal ein Ende bereiten.
Als der letzte der drei Männer leblos auf dem Schafott lag, bemächtigte sich der Zuschauer ein grausiges Entsetzen. Sie fluteten hastig zurück in die Stadt.
Der Tod der Priester wurde nicht zum Fanal, wie einige Reformer vielleicht verzweifelt gehofft hatten, er wurde zum Symbol der Ohnmacht der fortschrittlichen Kräfte in der spanischen Kolonie. Die Zeit der hoch gespannten Hoffnungen wich einer politischen Friedhofsstille. In den Barrios in den weiten Ebenen von Zentral-Luzón, auf den Tabakfeldern des Cagayan-Tales, auf der Zuckerinsel Negros litten die Bauern wie eh und je unter der schamlosen Ausbeutung. Sie waren von der politischen Bewegung des Jahres 1869 nicht berührt worden, aber an ihnen hielt sich die Kirche schadlos für die Demütigungen, die sie in Manila erfahren hatte.
Der letzte Funke des Aufruhrs schien ausgetreten, das Dunkel des Mittelalters senkte sich wieder über die Kolonie. José Rizal, der sein Volk das Sehen lehren sollte, war gerade elf Jahre alt. Unter der Anleitung der Jesuiten machte er sich im Ateneo, dem besten Gymnasium des Landes, in Intramuros die Grundbegriffe des Wissens zu eigen. Der achtjährige Andres Bonifacio, vor dem die Spanier einst zittern sollten, trieb sich barfüßig in den schmutzigen Straßen von Tondo herum und träumte von der nächsten Mahlzeit oder einem Buch, das ihm selbst gehörte.
Von spanischen Reformern hatte die Kirche auf den Philippinen nichts mehr zu befürchten. Die reaktionären Kräfte hatten in Spanien Schritt für Schritt wieder an Boden gewonnen und 1870 den italienischen Prinzen Amadeus von Aosta als Amadeo I. auf den verwaisten spanischen Thron gesetzt. Auf Amadeo I. folgte nach vielen Machtkämpfen im Jahre 1874 Alfons XII., der Sohn Isabellas II. Die wenigen bürgerlich-demokratischen Errungenschaften der spanischen Revolution von 1868 versanken im Nichts. Im Konkordat von 1875 endlich einigten sich Kirche und Staat, das Land wieder gemeinsam zu regieren. Unter dem Mantel eines Pseudoparlamentarismus vollzog sich zwischen Großgrundbesitz und Bourgeoisie, den Gegenspielern der Revolution, eine ständige Annäherung. Der preußische Weg zum Kapitalismus stieß in der herrschenden Klasse Spaniens auf große Sympathie. Dieser Prozess personifizierte sich nach 1875 in Antonio Canovas del Castillo, dem Exponenten des Großgrundbesitzes, und Praxedes Mateo Sagasta, dem Vertreter der spanischen Bourgeoisie. In den folgenden zwanzig Jahren wechselten sie sich mehrmals in der Regierung ab. Man bezeichnete sie treffend als das Janusgesicht der Restauration. In der Kolonialfrage unterschieden sich ihre Auffassungen kaum. Canovas erklärte, dass Spanien bereit sei, „den letzten Mann und den letzten Peso“ aufzubieten, um seine Kolonien zu halten. Sagasta sagte: „Spanien ist bereit, zur Verteidigung seiner Rechte und seines Territoriums die letzte Peseta und den letzten Tropfen Blut seiner Söhne herzugeben.“ Die Geschichte sollte sie bald beim Wort nehmen.
Außenpolitisch verlor Spanien gegenüber den fortgeschritteneren Industriestaaten Europas und Amerikas an Boden. Anfang des 19. Jahrhunderts hatte Spanien seine Kolonien in Lateinamerika, mit Ausnahme von Kuba und Puerto Rico, eingebüßt. Die einstige Weltmacht, in deren Reich die Sonne nie unterging, siechte dahin. Die jungen kapitalistischen Riesen USA, Deutschland, Japan, beobachteten sie lauernd, um ihr im geeigneten Moment auch die letzten Kolonien zu entreißen. Kolonien, die auf Grund der herkömmlichen feudal-absolutistischen, klerikalen Verwaltung immer mehr verfielen.
Spaniens feudale Kräfte sahen nur einen Weg, einen weiteren Schwund an Prestige und Macht in der Welt zu verhindern – den Weg, der ihm zu Glanz und Glorie verholfen hatte: brutale, rücksichtslose Gewalt. Unter dem Druck der feudalen Kräfte und der Kirche erstarben selbst die zaghaftesten Versuche der spanischen Bourgeoisie, die Verwaltung der Kolonien zu reformieren.
Als Andres Bonifacio vierzehn Jahre alt war, starb seine Mutter, kurz darauf der Vater. Sein Traum, weiter zur Schule zu gehen, fand ein jähes Ende. Der schmächtige Halbwüchsige sah sich plötzlich in der Rolle von Vater und Mutter gegenüber fünf kleineren Geschwistern. Aufgewachsen unter den Ärmsten der Armen, wo jeder sich selbst helfen musste, so gut er es vermochte, und schon Kinder die Lasten von Erwachsenen trugen, fand auch Andres bald einen Weg, sich und seine Geschwister zu ernähren. Er hatte geschickte, flinke Hände, eine schöne Schrift und Talent zum Malen. Seine Tage und die halben Nächte verbrachte der Junge damit, aus Bambusrohr kunstvolle Spazierstöcke und Papierfahnen herzustellen und sie zu verkaufen. Der Erlös für diese mühevolle Arbeit wird niedrig genug gewesen sein, doch er reichte aus, sechs Personen zu ernähren. In seinen wenigen freien Stunden las Andres alle Bücher, die ihm in die Hände fielen. Wie alle einfachen Menschen in Manila sprach er nur seine Landessprache: Tagalisch. Die spanische Sprache blieb den Gebildeten vorbehalten. Andres Bonifacio fehlten zwar die Mittel, weiter die Schule zu besuchen, aber sein Hunger nach Wissen hielt an. Und dieses Wissen konnte er nur in spanischen Büchern finden. Nur über sie konnte er die Welt des Geistes erobern und neue Erkenntnisse gewinnen. Deshalb lernte Andres Bonifacio die Sprache der Unterdrücker seines Landes mit Eifer und Erfolg.
Die fast unerträgliche Härte des Lebens beugte ihn nicht, sie stählte seinen Charakter und schulte seinen wachen Geist. Anfang der Achtzigerjahre gelang es ihm, eine Anstellung bei der Handelsfirma „Fleming & Co.“ zu bekommen. Der wortkarge junge Mann, der so aufopferungsvoll für seine Familie sorgte, war bei seinen Arbeitgebern angesehen. Das verhalf ihm bald zu einer besser bezahlten Stelle bei der deutschen Handelsfirma „Fressel & Co.“ in der Calle Nueva 450. Dort verdiente er 12 Peso im Monat, eine sagenhafte Summe für den Jungen aus Tondo. Langsam ließ der schwere wirtschaftliche Druck nach, die Geschwister wurden größer und standen auf ihren eigenen Füßen. Dem nachdenklichen Andres Bonifacio blieb mehr Zeit für seine Lieblingsbeschäftigung – das Lesen. Er hungerte sich eine bescheidene Bibliothek ab, und nur wenige wussten, dass er allnächtlich über Büchern saß, die seinen suchenden Geist durch die Welt trieben. Er las Bücher von Dumas und Hugo. Die Geschichte des Galeerensträflings Jean Valjean beeindruckte ihn nachhaltig. Er bewunderte die Reden des französischen Revolutionärs Camille Desmoulins und trennte sich auch unter den schwierigsten Umständen nicht mehr von diesem Büchlein. Der Verlauf der Französischen Revolution war ihm vertraut wie sein eigenes Leben. Washington, Jefferson und Lincoln blieben ihm keine Unbekannten. Der Priester von Tondo hätte die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, wenn er von dieser Lektüre seines Pfarrkindes gewusst hätte. Stärker als sein Zorn wäre dabei sicher seine Fassungslosigkeit gewesen: Ein Indio aus Tondo und solche Bücher …?
Der junge Andres wettete nicht bei Hahnenkämpfen, versuchte sich nicht in Glücksspielen. Ihn zog mit magischer Kraft das Theater an. In Manila gab es Gruppen von jungen Leuten, die begeistert spanische Ritterromanzen und Geschichten aus der Bibel inszenierten und spielten. Das war ein Weg, aus dem Alltag auszubrechen, sich selbst und die Umgebung in einem anderen Licht zu sehen. Andres Bonifacio schloss sich einer solchen Gruppe an. In seinen freien Abendstunden und an den Sonntagen lernte er Rollen, diskutierte er mit seinen Freunden, wie man die spanischen Stücke den philippinischen Verhältnissen anpassen konnte, ersann neue Varianten und versuchte sich selber im Stückeschreiben. Mit der gleichen Hartnäckigkeit, mit der er Spanisch gelernt hatte, drang er jetzt tiefer in das Gefüge seiner eigenen Muttersprache, das Tagalische, ein. Die Heldengeschichten, die sie spielten, regten den jungen Bonifacio an. Er träumte wie jeder junge Mensch von großen Taten, die er vollbringen wollte. Seine Fantasie verband sich mit einer hochgradigen Sensibilität für seine Umgebung. Er begann intensiver als bisher über sein Leben nachzudenken, über die sozialen Bedingungen, unter denen er und seinesgleichen lebten. Dass Andres kein feuriger Schwärmer wurde wie viele seiner patriotisch gesinnten Altersgenossen aus den besitzenden Klassen, lag an seinen Lebensumständen. Die Sorge um die tägliche Mahlzeit, die harte Arbeit und das Elend, das er um sich herum sah, waren schwere Gewichte an den Flügeln seiner Fantasie und seiner jugendlichen Begeisterungsfähigkeit.
1887 gründete Andres Bonifacio mit seinen Freunden in Tondo das Teatro Porvenir (Theater der Zukunft). Er wollte nicht nur träumen, er wollte auch etwas für die Allgemeinheit tun. Die Leitung einer kleinen Theatergruppe war ein Anfang. Noch ahnte niemand, dass in dem Vierundzwanzigjährigen die Kraft heranreifte, ein ganzes Volk zum Sturm gegen die schwarzen Bastionen seiner Unterdrücker zu führen.
Ein Augenarzt lehrt sein Volk sehen
Während Andres Bonifacio in Manila sein Teatro Porvenir gründete, saß in einem kleinen Zimmer in der Berliner Jägerstraße ein halb verhungerter junger Mann von 26 Jahren und schrieb an den letzten Seiten seines Romans „Noli me tangere“ („Rühr mich nicht an“). Es war der Augenarzt Dr. José Rizal, der fünf Jahre zuvor aus Manila hatte fliehen müssen.
Man schrieb das Jahr 1887. Berlin lebte im Rausch der Gründerjahre. Wissenschaft und Kunst standen in hoher Blüte. Rizal war hierhergekommen, um seine Kenntnisse als Augenarzt zu vervollkommnen. Der kluge junge Mann fand schnell Zugang zu den deutschen Gelehrten. Er diskutierte mit dem Philippinologen Feodor Jagor. Der mächtige Virchow zeigte sich sehr angetan von Rizal. Schon im Februar 1887, nur drei Monate nach seiner Ankunft in Berlin, wurde José Rizal Mitglied der Berliner Ethnografischen Gesellschaft und der Berliner Anthropologischen Gesellschaft. Trotz aller gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Erfolge lebte der Flüchtling in sehr beschränkten materiellen Verhältnissen. Er arbeitete in einer Berliner Augenklinik und als Lehrer an einem Gymnasium, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Die meisten Mittel brauchte er für den Druck seines Buches, das ihn mit einem Schlag berühmt machen sollte.
Wer war José Rizal? Der junge Augenarzt stammte aus wohlhabenden Kreisen. Seine Eltern lebten als kleine Grundbesitzer in Calamba an der Laguna de Bay, einem der fruchtbarsten Gebiete von Luzón. Sein älterer Bruder Paciano war ein Schüler und Freund des hingerichteten Pater Burgos gewesen. Nach 1872 musste die Familie mancherlei Verfolgungen durch die spanischen Behörden erdulden. Paciano Rizal durfte nicht mehr studieren. Die Mutter wurde unter fadenscheinigen Begründungen ins Gefängnis geworfen, wo sie fast erblindete. Dennoch konnte der glänzend begabte José Rizal die besten Schulen des spanischen Kolonialreiches besuchen – das Ateneo und die Universität Santo Tomas in Manila. Dort zog er den Hass der Mönche auf sich. Sie sahen in dem kritischen, unerschrockenen Studenten eine Gefahr für sich heranwachsen. Knapp zwanzigjährig verließ José Rizal Manila und setzte seine Studien in Spanien, Frankreich und Deutschland fort. Er traf philippinische Emigranten, die gleich ihm aus der Heimat geflohen waren, viele schon 1872, und schloss sich ihnen an. Ihr großes Vorbild war die französische Aufklärung – die Schriften eines Diderot, Voltaire und Rousseau. Nicht gegen Spanien oder gar gegen die Religion wollten sie kämpfen, sondern gegen die feudale Ausbeutung und Unterdrückung ihres Landes durch die reichen Orden der Mönche. Sie forderten geistige Freiheit.
Während das philippinische Volk unter der Last der spanischen Herrschaft litt, gewann in Spanien die bürgerliche Reformbewegung der Philippinen an Kraft und Profil. In unzähligen Artikeln und Schriften wiesen die Emigranten auf die unerträgliche Lage ihrer Landsleute hin. Sie hofften, die spanische Regierung auf diese Weise zu einer Änderung ihrer Kolonialpolitik veranlassen zu können.
José Rizal war das zu wenig. Er wollte zu seinem Volk sprechen. So schrieb er „Noli me tangere“, das Buch von dem Studenten Ibarra, der nach seinem Studium aus dem Ausland in die Heimat zurückkehrt, um dort seine Ideen zu verwirklichen. Ibarra erlebt das Elend seiner Landsleute, ergreift Partei für sie und wird erbittert verfolgt. Es gelingt ihm nicht, seine Reformvorstellungen zu verwirklichen.
Über die politischen Absichten, die Rizal mit diesem Buch verfolgte, schrieb er an seinen Freund, den Philippinologen Ferdinand Blumentritt, in Leitmeritz: „Friedlicher Kampf muss ein Traum bleiben, bis Spanien die Lektion lernt, die ihm seine früheren Kolonien in Südamerika beigebracht haben. Spanien begreift nicht, was England in Nordamerika gelernt hat. Aber unter den gegenwärtigen Umständen streben wir nicht die Loslösung von Spanien an; alles, was wir wollen, ist mehr Aufmerksamkeit, bessere Bildung, bessere Regierungsbeamten, ein oder zwei Abgeordnete im Cortes, mehr Sicherheit für uns selbst und unsere Zukunft. Spanien würde die Philippinen für immer behalten, wenn es sich nur vernünftig verhalten würde. Wir werden von ihnen allen missverstanden. Aber quos vult perdere Jupiter, prius dementat (Wen Jupiter zerstören will, den macht er zuvor wahnsinnig).“
José Rizal plädierte in diesem Buch nicht für die Unabhängigkeit von Spanien. Das Volk, glaubte er, war dafür noch nicht reif. Er kannte die Unwissenheit seiner Landsleute, ihr noch im Mittelalter befangenes Denken. Das Volk brauchte Bildung und die Gewissheit, dass es an Intelligenz und Moral seinen spanischen Herren ebenbürtig, ja sogar überlegen war. In seinem Buch beschrieb José Rizal schonungslos die Grausamkeit, den Dünkel und die Ungerechtigkeit der Spanier gegenüber den Filipinos. Er sprach aus, was andere vor ihm nicht auszusprechen gewagt hatten. Er hob ins Licht, was bisher im Dunkel verborgen gewesen war. Die Zeit dafür war reif.
Das Buch erschien im Frühjahr 1887 in Berlin. Als es wenige Monate später in Manila auftauchte, schlug es wie eine Bombe ein. Eine Gutachterkommission, zusammengesetzt aus dominikanischen Mönchen, schrieb an den derzeitigen Generalgouverneur Emilio Terrero: Das Buch ist, „was die Religion betrifft, hetärisch, gottlos und skandalös, es ist unpatriotisch und gefährdet die öffentliche Ordnung“. Kategorisch verlangte sie, das Buch sofort zu verbieten. Terrero zögerte. Die kirchlichen Behörden handelten selbst. Die spanische Geheimpolizei durchsuchte jedes Schiff, das im Hafen von Manila anlegte, sie drang nachts in die Häuser der Intellektuellen ein, von denen sie wusste, dass sie mit der Reformbewegung sympathisierten. Dennoch kursierten Exemplare von Rizals Buch in der Stadt, zum Teil mit verschleiernden Titeln und Umschlägen versehen. Die Herren der Philippinen wussten genau, welch aufrührerische Kraft das Wort haben konnte, umso mehr, wenn es in gedruckter Form Hunderte und Tausende von Menschen erreichte. Der Index der katholischen Kirche, die Zensur und die Bücherverbrennungen faschistischer Regimes zeugen davon, dass die Feinde des Volkes das Wort der Wahrheit mindestens ebenso fürchten wie gegen sie erhobene Waffen. Aber die Geschichte des Kampfes der Völker gegen ihre Unterdrücker bewies immer wieder, dass keine Macht der Welt imstande ist, das freie Wort zu unterdrücken, dass seine Saat, wie verborgen sie auch immer liegt, aufgeht und Früchte trägt. So geschah es auch auf den Philippinen.
Wie viele Exemplare in Manila beschlagnahmt wurden, es drangen immer noch genug in die Hände junger Filipinos, die sie begeistert lasen – die Studenten im Ateneo und in der Universität Santo Tomas, Ärzte und Rechtsanwälte, philippinische Beamte in den spanischen Verwaltungen, und jeder gab sie an Freunde und Bekannte weiter.
So muss Rizals Buch auch in die Hände von Andres Bonifacio gelangt sein. Er las es, und eine neue Welt tat sich ihm auf. Abwägend und kritisch verglich er die in diesem Buch geäußerten Gedanken über die Situation in seinem Lande mit seinen eigenen Erfahrungen. Den wissbegierigen Autodidakten Bonifacio überzeugte der Gedanke, dass der erste Schritt zur politischen Befreiung seines Landes darin bestehen musste, allen Schichten der Bevölkerung Bildung zu vermitteln. Der Kampf um Reformen schien ihm ein gangbarer Weg. Er schloss sich der Freimaurerloge Taliba an. Das war seine erste politische Entscheidung.
Um diese Zeit begannen in den Philippinen Freimaurerlogen wie Pilze aus dem Boden zu schießen. Sie boten sich als Organisationsformen zum Kampf gegen die verhasste Mönchsherrschaft geradezu an. In ihrem schützenden Dunkel machten sich ihre Mitglieder mit den Ideen der bürgerlichen Aufklärung bekannt, hielten Verbindung zur Reformbewegung in Spanien und entwickelten eigene politische Vorstellungen. Nahezu alle namhaften Vertreter der Befreiungsbewegung begannen so ihre Laufbahn. Die katholische Kirche bekämpfte die Freimaurerei mit aller Schärfe und brandmarkte ihre Anhänger von den Kanzeln als Kreaturen der Hölle, als Ausgeburten des Teufels.
Rizals Buch war ein erster Lichtstrahl in dem Dunkel, das sich nach 1872 über das Land gelegt hatte. Bald wurde der Lichtstrahl zum Wetterleuchten.
Am 1. März 1888 drängten sich in den Straßen von Manila die Menschen. Angeführt von Doroteo Cortez, einem reichen Rechtsanwalt der Stadt, bewegte sich eine Demonstration vor die Residenz des Zivilgouverneurs von Manila, um eine Petition mit achthundert Unterschriften zu überreichen. Sie richtete sich gegen den verhassten Erzbischof Pedro Payo, gegen die Schreckensherrschaft der Mönche und forderte deren Vertreibung von den Philippinen. Die Petition begann mit den Worten: „Lang lebe Spanien! Lang lebe die Königin! Lang lebe die Armee! Nieder mit den Mönchen!“
Bereits zwei Monate früher, am 8. Januar 1888, hatten die Bauern von Calamba eine Schrift an die Regierung in Manila gerichtet. Sie protestierten gegen die Praktiken der Dominikaner in ihrem Gebiet, sich widerrechtlich Land anzueignen und zusätzliche Abgaben zu erpressen. Es war kein Zufall, dass dieser Ruf nach sozialer Gerechtigkeit aus Calamba kam. Hier war José Rizal zu Hause. Sein Buch und sein Auftreten ermutigten die Bauern. Sie beauftragten Rizal, der inzwischen in die Heimat zurückgekehrt war und in Calamba eine Praxis als Augenarzt eröffnet hatte, den Bericht an die Kolonialregierung zu verfassen.
Die Mönche antworteten mit einem Aufschrei der Wut. José Rizal musste Hals über Kopf zum zweiten Mal das Land verlassen, wollte er dem sicheren Tod entgehen. Auf Druck des Erzbischofs von Manila beeilte sich das Kolonialministerium in Madrid, Generalgouverneur Terrero abzulösen.
Im Mai 1888 traf der neue Generalgouverneur der Philippinen ein, General Valeriano Weyler, ein brutaler, rücksichtsloser Mann, so recht nach dem Herzen des Klerus. Dieser Mann, der einige Jahre später als „Henker von Kuba“ eine traurige Berühmtheit erlangen sollte, räumte mit deutscher Gründlichkeit und spanischem Fanatismus unter den Unruhestiftern auf, verhaftete, verbannte, machte Häuser dem Erdboden gleich. Die Petitionen, die ein Bekenntnis zu Spanien gewesen waren und eine Bitte, den Würgegriff zu lockern, wurden als Aufrufe zur Loslösung von Spanien gebrandmarkt.
Und wieder beugte sich das Volk, Verwünschungen und Flüche erstarben in der Angst, aber der Funke des Hasses glomm weiter.
1888 war nicht mehr 1872. In Barcelona gründeten die philippinischen Emigranten unter der Leitung von Rizal die Organisation „La Solidaridad“. Ihr politisches Programm forderte von Spanien bürgerlich-demokratische Rechte für die Philippinen – Rede-, Versammlungs- und Pressefreiheit, Gleichheit vor dem Gesetz, Beteiligung an der Regierung der Inseln und immer wieder: Ausweisung der religiösen Orden aus den Philippinen. In ihrer Zeitung „La Solidaridad“ propagierten die Reformer ihre Ideen und versuchten, die spanische Öffentlichkeit für sie zu gewinnen.
Der Ruf der philippinischen Aufklärer nach Reformen verfehlte jene, die er erreichen sollte. Ihre streitbaren Schriften bewogen die Herren im Ultramar, dem spanischen Kolonialministerium, nicht zur Einsicht, aber sie revolutionierten das radikale Kleinbürgertum und die Intelligenz auf den Philippinen.
Mit brennendem Interesse verfolgten Andres Bonifacio und seine Freunde die Reformbewegung in Spanien. Verbindungen entstanden zwischen den Freimaurern in Manila und „La Solidaridad“. Informationen und Spenden für die Zeitung gelangten von Manila nach Barcelona. Trotz eifriger Bespitzelung konnten die Mönche die geheimen Kanäle nicht zustopfen.
So reifte langsam und fast unmerklich die Saat, welche die machthungrige Kirche in das philippinische Volk säte. Doch noch fehlten die Menschen, die die Ideen der Aufklärer in das leidende, unzufriedene und sporadisch aufbegehrende Volk trugen.
Der rastlose, in der Welt umhergetriebene José Rizal schrieb ein zweites Buch: „El Filibusterismo“. In ihm setzt er die Handlung von „Noli me tangere“ fort. Rizal sah keine Alternative mehr zur Revolution. In seinem Roman erhebt sich das gepeinigte Volk, weil es anders sein Recht nicht mehr finden kann. José Rizal selbst glaubte nicht an den Erfolg einer Revolution. Seine Erfahrungen und sein Nachdenken darüber sagten ihm, dass die Entwicklung zwangsläufig zu einem Zusammenstoß zwischen Filipinos und der mittelalterlichen Kolonialmacht Spanien führen würde. Aber ein Aufstand der Massen war Rizal in tiefster Seele unsympathisch. Er stand ihm mit dem Schaudern der Klasse, der er angehörte, gegenüber. Er wollte das Volk mit Hilfe der Spanier durch Bildung und Reformen befreien, Gewalt verabscheute er, von welcher Seite sie auch kam. Als intellektueller Vertreter des jungen aufstrebenden Bürgertums sah er im Volk nur das Objekt seiner Bemühungen; dass es selbst die Gesetze des Handelns bestimmen könnte, schien ihm undenkbar. Er wollte sein Buch als eine unmissverständliche Warnung vor der Revolution und ihrer zerstörerischen Kraft verstanden wissen, als eine eindringliche Mahnung an die Spanier, den Bogen nicht zu überspannen.
Als das Buch den Weg nach Manila gefunden hatte, begann eine wilde Hetzjagd der Kirche und der Behörden. Die Spanier hörten die Kassandrarufe nicht, sie blieben taub. Unvorstellbar, dass Glanz und Glorie des spanischen Weltreiches einmal zu Ende gehen sollten.
José Rizal hielt es im Ausland nicht mehr aus. Er wollte nach Hause, um an Ort und Stelle für seine Ideen zu werben. Er war der endlosen Diskussionen in den Emigrantenkreisen müde, müde der zahllosen Petitionen an die spanische Regierung, die ohne Antwort blieben. Eine Organisation musste her, die alle reformwilligen Filipinos um sich sammelte und sie zu einer politischen Kraft im Lande werden ließ. Rizals Freunde und Verwandte rieten ihm dringend ab, nach Manila zurückzukehren, wo ihn der sichere Tod erwartete.
Rizal schlug alle Warnungen in den Wind. Die Sehnsucht nach seinem Lande war stärker als alle Furcht – die Sehnsucht nach den engen Gassen von Intramuros, nach den klaren Wassern der Laguna de Bay und dem bunten Leben auf dem Pasig. Er konnte nicht mehr in der Fremde leben. In seiner Heimat würde er wieder Kraft gewinnen, Kraft zum Leben, zum Kämpfen und – wenn es sein musste – auch zum Sterben.
Am 21. Juni 1892 bestieg er in Hongkong das Schiff nach Manila. Am gleichen Tage kabelte der spanische Konsul in Hongkong an den Generalgouverneur Despujol in Manila: „Die Ratte ist in der Falle“. Die Mönche rieben sich die Hände. Ein drittes Mal sollte ihnen Rizal nicht entwischen.