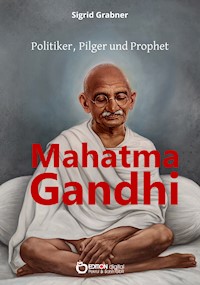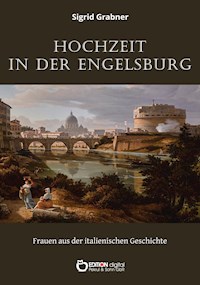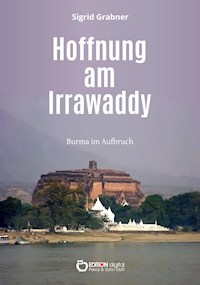8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sehr, sehr umfangreich ist das Personenverzeichnis zu diesem Buch, es umfasst ganze elf Seiten und reicht von A wie Accoromboni, Vittoria und Albizzi, Kardinal über F wie Franz v. Assisi, [1181–1226] und G wie Galilei, Galileo [1564–1642] Gardie, Jakob de la bis zu Z wie Zewi, Sabbatai [1626?–1676] und Zucchi, Jesuit. Sie hatte eben in ihrem Leben mit vielen Leuten zu tun, diese königliche Rebellin. Aber was war eigentlich das Rebellische an dieser am 7. Dezemberjul. / 17. Dezember 1626greg. in Stockholm geborenen und am 19. April 1689 in Rom gestorbenen Tochter des schwedischen Königs Gustav II. Adolf (1594–1632) und dessen Gemahlin Maria Eleonora von Brandenburg (1599–1655), die von 1632 bis 1654 selber schwedische Königin war. Und damit sind wir schon beim Thema: Denn Christine von Schweden traf zwei für ihre Zeitgenossen und Zeitgenossinnen eher unverständliche Entscheidungen, die entscheidende Änderungen im Leben dieser Frau bewirkten, die auf ausdrücklichen Wunsch ihres Vaters, des bereits 1632, als sie erst fünf war, in der Schlacht bei Lützen gefallenen Vaters eine ausdrücklich „männliche Erziehung“ erhielt, wie ein Kronprinz ausgebildet und ab 1635 auf das Königsamt vorbereitet wurde. So lernte sie zum Beispiel reiten und jagen und – regieren. Im Alter von nur 28 Jahren dankte die erst am 20. Oktober 1650 offiziell gekrönte Monarchin überraschend ab. Zweite Überraschung war ihre Konversion. Am 16. Juni 1654 wurde auf dem Reichstag im Schloss Uppsala die Abdankungsurkunde verlesen und ihr Nachfolger bestimmt. Die Krone Schwedens überließ sie ihrem Cousin, dem neuen König Karl X. Gustav – auch ein berühmter Name. Über ihre Gründe zu konvertieren ist viel spekuliert worden. Politisch gesehen jedoch war der Übertritt der Tochter des protestantischen Helden des Dreißigjährigen Krieges zum Katholizismus ein großer Triumpf für die Gegenreformation. Für ihren großen historischen Roman hat Sigrid Grabner einen schönen literarischen Einstieg gefunden. Erzählt wird das Leben der Heldin aus Sicht von David Eriksson, königlicher Sekretär und enger Vertrauter. Die Handlung setzt ein, als kurz nach dem Tod der Königin in Rom auch der Kardinal stirbt. Mehr als ein Vierteljahrhundert waren die Königin und der Kardinal die geheimen Herrscher Roms gewesen. Erikson erzählt seine eigene Geschichte, vor allem aber die fesselnde Lebensgeschichte dieser ebenso faszinierenden wie widersprüchlichen Frau, die Goethe „gleich geheimnisvoll für Weise wie für Toren“ nannte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 555
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Sigrid Grabner
Die Rebellin
Königin Christine von Schweden
ISBN 978-3-96521-644-0 (E-Book)
Umschlaggestaltung: Ernst Franta
Das Buch erschien 1992 im Verlag Ullstein GmbH, Frankfurt/M – Berlin.
Ungekürzte Ausgabe der gebundenen Erstausgabe: Christine. Rebellin auf Schwedens Thron
2022 EDITION digital
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
Für Gerda Wilmanns
PROLOG
Der Kardinal ist tot. Vor dem Palazzo im Borgo drängen sich die Schaulustigen. Geschoben von der Menge, konnte ich nur einen kurzen Blick auf den Toten werfen. Sein Gesicht wirkte beinahe heiter. Der Tod muss als Freund zu ihm gekommen sein.
Mit dem heutigen Tag geht ein Zeitalter zu Ende. Mehr als ein Vierteljahrhundert waren die Königin und der Kardinal die geheimen Herrscher Roms. Vor sieben Wochen starb die Königin. Obwohl ihr Verlust den Kardinal schwer traf, hätte niemand vermutet, dass er ihr so schnell ins Schattenreich folgen würde.
Nach der Beisetzung der Königin hatte mich der Kardinal rufen lassen. Als ich das Arbeitskabinett betrat, stand er vor einem Gemälde, das die selige Königin darstellte. Er stützte sich schwer auf einen Stock, seine Hand zitterte. Da mein Gruß ohne Antwort blieb, wollte ich mich wieder zurückziehen.
„Wie lange kennen wir uns, David?“, fragte er, ohne die Augen von dem Bild zu wenden. Er fuhr sich mit einem Tuch über Mund und Stirn, die Perücke verrutschte, der noch kräftige Haaransatz wurde sichtbar.
Die Königin mochte Perücken nicht. In ihrer Gesellschaft hatte ich den Kardinal zuweilen ohne eines dieser Lockenungetüme angetroffen. Jetzt war sein braunes Haar weiß.
Der Kardinal atmete schwer, der Stock entglitt seiner Hand. Ich führte ihn zu einem Stuhl und wollte den Arzt rufen. Ärgerlich winkte er ab und wiederholte seine Frage.
„Im vergangenen Winter waren es dreiunddreißig Jahre, Eminenz.“
Der Kardinal schien über diese Antwort ebenso verwundert wie ich. „Was werden Sie jetzt tun?“
Ich wusste es nicht. Bisher hatte die Königin für mich gesorgt, denn die Päpstliche Universität zahlt ihren Professoren ein kärgliches Salär. Während ich noch nach den rechten Worten suchte, meine Lage zu schildern, fuhr der Kardinal fort: „Treten Sie in meine Dienste. Ich werde Sie nicht über Gebühr beanspruchen. Sie sind zwar etliche Jahre jünger als ich, doch auch schon in einem Alter, da man der Schonung bedarf. Der schriftliche Nachlass der Königin ist zu ordnen. Wer könnte das besser als Sie.“
Mehr als das Angebot überraschte mich der bittende Ton, in dem es vorgetragen wurde. Bei aller Verbindlichkeit war der Kardinal ein befehlsgewohnter Mann. Wir schätzten einander, aber achteten auf Abstand.
Ich nahm die Stellung mit Freuden an, enthob sie mich doch der Sorgen um das tägliche Brot und erlaubte mir, mich noch einige Zeit in den Räumen der Königin aufhalten zu können.
Zum Abschied übergab mir der Kardinal einen Brief der Königin. „Lesen Sie ihn, wenn Sie allein sind.“ Als ich das Knie beugte, zog er mich zu sich empor und umarmte mich.
Ich ritt zum Palazzo an der Lungara zurück, um im Garten ungestört den Brief der Königin lesen zu können. Lange zögerte ich, das Siegel zu erbrechen.
„Caro amico …“, lieber Freund. So hatte mich die Königin oft genannt. Der Brief war Mitte März datiert. In jenen Tagen genas Christine von ihrer schweren Krankheit. Jeden Vormittag saß ich eine Stunde an ihrem Lager. Wir unterhielten uns über vergangene Zeiten. Ich glaubte, dass sie bald wieder ihr gewohntes Leben aufnehmen würde. Nur einmal beschlichen mich dunkle Ahnungen, als sie sagte: „Wenn ich dich gekränkt habe, David, verzeih mir.“ Das war nicht ihre Art. Ich beteuerte, ich würde immer die Stunde preisen, da ich in ihre Dienste hatte treten dürfen. Sie drohte mir mit dem Finger, grundlos, denn sie wusste, dass ich Schmeicheleien verabscheute, lachte dann und entließ mich mit den Worten, für ihre Freunde sei sie nicht die Königin, sondern einfach: Christine.
„Caro amico, wenn Du diese Worte liest, weile ich nicht mehr unter den Lebenden. Mir bleiben nur noch wenige Tage, wie sehr der Anschein auch dagegen spricht … Du gehörst zu den Wenigen, die mir durch Jahrzehnte treu gedient haben. Vielleicht kennt mich nicht einmal der Kardinal so gut wie Du. Nirgendwo erkannte ich mich deutlicher als in Deinen dunklen jüdischen Augen. Sie waren ein Spiegel meiner Seele. Sie verbargen nicht Trauer, wenn ich litt, nicht Widerstand, wenn Du mir nicht zustimmen konntest, nicht Freude, wenn ich glücklich war. Dass Du mir niemals geschmeichelt hast wie so viele andere, sondern bis zum Schmerz aufrichtig gewesen bist, war mir in all den Jahren ein Geschenk.
Weder Titel noch Reichtümer, womit ich so viele Unwürdige versah, hast Du in meinem Dienst erworben. Ich habe nicht gewagt, Deinen Stolz durch Almosen zu beleidigen. So bist Du immer ein freier Mann geblieben und mir ein wahrhafter Freund geworden. Damit Du es bleiben kannst, setze ich Dir eine Rente aus, von der Du bis ans Lebensende, das noch weit entfernt sein möge, sorgenfrei leben kannst. Der Kardinal als mein Haupterbe wird alles Notwendige veranlassen. Bist Du doch einer der Wenigen, die vor seinen gestrengen Augen stets Gnade gefunden haben. Gott schütze dich. Christina Alexandra.“
Ich alter Mann saß auf der Bank und weinte wie ein Kind. Später lief ich durch die Stadt, um meiner Herr zu werden. Ich folgte dem Strom der Pilger über die Engelsbrücke und fand mich vor dem Grab der Königin in Sankt Peter wieder. Wie lange ich dort blieb, weiß ich nicht, ich weiß nur, dass mich irgendwann das verzweifelte Gefühl überkam, nirgendwo Christine ferner zu sein als an ihrem Grab.
Was gäbe ich darum, wenn die Königin entsprechend ihrem Wunsch im Pantheon bestattet worden wäre – unter der großen Kuppelöffnung, durch die Tag und Nacht der römische Himmel eintritt, in dem Mauerrund zwischen edlen korinthischen Säulen. Jenes Bauwerk, das die Römer einst zur Ehre aller Götter erbauten, wäre die angemessene Ruhestätte für die Königin gewesen. Aber der Papst hat anders entschieden. Einer Monarchin, die der Ketzerei abgeschworen und um des rechten Glaubens willen auf einen Thron verzichtet habe, so ließ er wissen, gebühre ein Platz in der Nähe des Petrusgrabes. Dass Christine niemals eine demütige Tochter der Kirche gewesen ist und sie den Nachfolgern Petri, vor allem dem jetzigen elften Innozenz, so oft die Stirn geboten hat, ist vergessen. Die Tote kündet nur noch vom Triumph des katholischen Glaubens.
Wieder im Garten der Königin, schenkte mir die Natur den Trost, den ich in Sankt Peter vergeblich gesucht hatte. Die Sonne versank hinter dem Gianicolo, mit den Fledermäusen kam die Nacht.
Was bleibt von der Königin, fragte ich mich. Handschriften, Bücher, die sie gelesen, Kunstwerke, die sie betrachtet hat? Die Zeit wird sie zerstreuen. Christines tiefe Stimme, der rasche Gang, das Feuer ihrer Augen, der scharfe Verstand? Wenn der letzte stirbt, der sie gekannt hat, werden sich auch diese Erinnerungen verlieren. Was bleibt?
Auf dieser Welt vergeht nichts, es wandelt sich nur eins ins andere. Der Leib wird zu Erde. Die Erde nährt die Pflanzen. Pflanzen dienen Mensch und Tier als Nahrung. Ein unendlicher Kreislauf. Man könnte auch sagen, wer sich heute an der Hammelkeule delektiert, wird übermorgen vom Hammel gefressen. Was aber wird aus der spirituellen Energie, die jedem Menschen sein unverwechselbares Gepräge gibt? Sie kann sich doch ebensowenig wie die Materie in nichts auflösen. Ist die Verheißung des ewigen Lebens nur ein Trost der Religion oder gründet sie sich auf jahrtausendealte Erkenntnis jenseits aller Beweisbarkeit? Die Königin pflegte zu sagen, Ewigkeit sei der gelebte Augenblick und nicht die ins Endlose verlängerte Zeit.
An jenem Abend nahm ich mir vor, meine Erinnerungen an die Königin niederzuschreiben. Auf Drängen des Kardinals hatte Christine vor etlichen Jahren mit ihren Memoiren begonnen, doch gab sie es bald wieder auf, weil sie meinte, heutzutage befriedige fast jeder, kaum den Kinderschuhen entwachsen, seine Eitelkeit durch die Niederschrift angeblich unsterblicher Werke. Statt zu leben, verbrächten solche Menschen ihre Zeit damit, sich selbst und andere zu täuschen. Es war ihr immer herzlich gleichgültig, was man von ihr dachte oder denken würde. Spöttisch bemerkte sie, jedes Lästermaul richte sich selber, und ihr mache es nun einmal Spaß, dafür zu sorgen, dass niemand ihr etwas Gutes nachsagen könne. Aber sie hätte nichts dagegen, wenn ich über sie schriebe. Sie hatte im Scherz gesprochen, denn sie fügte hinzu, da ihr das Geld fehle, mir den Weihrauch zu liefern, käme bei meiner Schreiberei vielleicht etwas Ordentliches heraus.
Nun, da ich mich dieser Worte entsann, erschienen sie mir wie ein Vermächtnis. Ich sichtete die Briefe und Dokumente im Nachlass der Königin, verglich ihre handschriftlichen Aufzeichnungen mit meinen eigenen. Das Jahrhundert zog an mir vorüber – Päpste, Könige, Fürsten, Künstler, Gelehrte … Mir sank der Mut vor der Aufgabe, die ich mir gestellt hatte. Wie sollte ich über eine Frau schreiben, die so widersprüchlich wie dieses Jahrhundert war, die man als Hure verteufelte und als Heldin feierte? Durfte ich meine Vermutungen über sie als Wahrheiten ausgeben?
Vor zwei Wochen rief mich der Kardinal wieder zu sich. Obwohl schon frühsommerlich warm in Rom, loderte Feuer im Kamin. Der Kardinal verbrannte Papiere. Auf meine unausgesprochene Frage sagte er: „Es sind meine Briefe an die Königin, sie gehen niemanden etwas an.“ Es klang wie eine Rechtfertigung.
„Aber diese da“, er wies auf ein Bündel neben sich, „bringe ich nicht übers Herz zu vernichten. Die Königin schrieb sie mir vor mehr als zwanzig Jahren. Sie zu verbrennen hieße, die Königin ein zweites Mal sterben zu sehen. Das geht über meine Kraft. Ich bitte Sie als Freund, dieses Bündel sorgfältig aufzubewahren, es nicht zu meinen Lebzeiten zu öffnen und es dem Zugriff der Inquisition zu entziehen. Nach meinem Tode werden die Beamten des heiligen Offiziums hier das Unterste zuoberst kehren. Mein Neffe und Erbe Pompeo ist einfältig und charakterschwach. Er würde die Briefe verbrennen oder, schlimmer noch, den Inquisitoren aushändigen.“
Ich versicherte den Kardinal meiner Diskretion und bedauerte insgeheim den Verlust seiner eigenen Briefe. Das war unser letztes Gespräch.
Nun ist der Kardinal tot. Ich habe das Bündel geöffnet und bis spät in die Nacht gelesen. Die Kerze auf dem Tisch ist fast niedergebrannt. Sie mahnt mich, dass auch meine Zeit bemessen ist.
Ich stehe im Herbst des Lebens. Seit jeher ist mir der Herbst die liebste Jahreszeit gewesen. Unruhe des Frühlings, Schwüle des Sommers, Betriebsamkeit der Ernte weichen einem stillen, nahezu transzendenten Licht, in dem Menschen und Ereignisse an Kontur gewinnen und sich zugleich entfernen. In Momenten eines wunderbaren Wachseins sehe ich mein Leben wie einen Teppich vor mir ausgebreitet und erkenne das Muster in den verschlungenen Linien. Christines Bild ist darin unauflösbar verwoben.
Ich muss nach bestem Wissen und Gewissen die Geschichte meines Lebens erzählen. Die ganze Wahrheit kennt ohnehin nur Gott. Seinen Beistand erflehend, beginne ich heute meine Aufzeichnungen.
Rom, im Jahre des Herrn 1689, der 8. Juni nach dem Gregorianischen Kalender.
1
Irgendwo zwischen Nürnberg und Magdeburg bin ich geboren. Von der Mutter her Jude, vom Vater Schwede, seit dreißig Jahren Römer, habe ich mich doch immer als Deutscher gefühlt.
Ein Zigeuner erzählte mir einmal, dass jeder Mensch mit der Erde, in der seine Nachgeburt vergraben ist, verbunden bleibt. Vielleicht erklärt das meine trotz aller bösen Erfahrungen unbeirrbare Liebe zu Deutschland.
Die Königin bewunderte die deutschen Gelehrten, aber sie hasste das Land. In Hamburg sagte sie einmal: „Ein gräuliches Land. Alles, was man hier sieht, missfällt und langweilt. Anderswo braucht es nur vierundzwanzig Stunden für einen Tag und eine Nacht, hier dagegen dauert eine Stunde vierundzwanzig Tage, und die gleichen Tage, die in Rom nur einen Augenblick währen, dauern hier jahrhundertelang. Es ist besser, ein Ketzer zu sein als ein Deutscher, denn ein Ketzer kann katholisch werden, aber eine Bestie niemals vernünftig. Verflucht seien das Land und die dummen Bestien, die es hervorbringt.“ Statt zu schweigen – ich wusste ja, wie unglücklich die Königin war –, ergriff ich die Partei der „Bestien“ und überwarf mich mit Christine. Doch davon wird noch zu reden sein.
Mehr als vierzig Jahre sind seit dem Ende des großen Krieges vergangen, der so viele Menschen dahinraffte und dem ich mein Leben verdanke. Die damals die Geschicke der Völker bestimmten, sind längst gestorben – König Gustav Adolf und sein Kanzler Oxenstierna, die Feldherren Horn, Banér, Torstensson, die Kardinäle Richelieu und Mazarin, der Große Condé, Marschall Turenne, Wallenstein, Piccolomini, Tilly … Die Namen der Herrscher haben sich geändert, nicht aber ihre Absichten.
Mehr als vierzig Jahre nach dem schrecklichsten aller Kriege steht die ganze Welt gerüstet. In ihren Maximen schrieb die Königin: „Es ist weder Krieg noch Friede. Man bedroht, man fürchtet einander. Niemand tut, was er will oder kann. Man übersieht nicht, wer gewonnen und wer verloren hat. Man weiß, dass sich jedermann fürchtet, nur nicht, vor wem oder warum.“ Viele Menschen denken heute so, und mich erschreckt, wie wenig sie mit dieser Erkenntnis anzufangen wissen.
Meine Großeltern mütterlicherseits betrieben in der Judengasse von Fürth einen Trödlerladen. Ihre einzige Tochter Miriam zählte achtzehn Jahre, als der Alexander des Nordens, Gustav II. Adolf aus dem Hause Wasa, unter dem Jubel des Volkes in Nürnberg einzog. Wie ein Frühlingssturm war er mit seiner Armee durch die deutschen Lande gebraust. Die schwedischen Soldaten plünderten damals noch nicht wie die verhassten Kaiserlichen. In ihren Reihen herrschte Manneszucht. Wo Gustav Adolf das Sagen hatte, durfte jedermann, ob Lutheraner, Calvinist, Katholik oder Jude, frei seinem Glauben leben.
Zu den Offizieren des Königs gehörte Erik Eriksson. Ob er meine Mutter Miriam zum ersten Mal unter den Jubelnden am Straßenrand oder in der Judengasse erblickte, weiß ich nicht. Aber ihre erste Begegnung entschied über ihr Schicksal. Weder Bitten noch Drohungen der Großeltern vermochten etwas gegen die Liebe, die Miriam zu dem blonden Schweden erfasste. Als sie das Mädchen einsperrten, verweigerte es die Nahrung. Unterdessen stand Erik Eriksson vor der Tür. Er hätte sie einschlagen und sich Miriam wie eine Kriegsbeute holen können. Aber er drohte nicht einmal, er wartete. Nach einigen Tagen erbarmten sich die Großeltern der Liebeskranken. Als sie Erik einließen, bat er sie um die Hand ihrer Tochter, und sie willigten schweren Herzens ein. Sie wussten, dass sie Miriam so oder so verlieren würden.
Im März 1632 war Gustav Adolf nach Nürnberg gekommen.
Im selben Monat heirateten Miriam und Erik. Auf der Hochzeit tanzte der König mit der Braut. Meine Großeltern konnten sich nicht recht freuen. Ein Isaak oder Levi wäre ihnen lieber gewesen als der Fremde aus dem Norden, für den Miriam den Glauben ihrer Väter aufgab. Großvater machte sich zeitlebens Vorwürfe, dass er der Ehe zugestimmt und damit, wie er meinte, drei Menschen – meine Eltern und mich – ins Unglück gestürzt hatte.
In jenem Frühling ahnten Miriam und Erik nicht, wie wenig Zeit ihrem Glück zugemessen war. Jung und verliebt, glaubten sie, dass die Siege des Schwedenkönigs Europa bald den Frieden bringen würden, träumten von klirrendkalten Wintern und hellen Mittsommernächten in Norrköping, der Heimat meines Vaters, von einem eigenen Gehöft, Kindern, Ausritten, Schlittenfahrten …
Im Sommer 1632 standen sich Gustav Adolfs und Wallensteins Heere sieben lange Wochen bei Nürnberg gegenüber. Die Angriffe der Schweden auf die Verschanzungen des Friedländers wurden immer wieder abgeschlagen. Schließlich wandte sich Wallenstein gegen das wehrlose Sachsen, während der Schwedenkönig in südliche Richtung vorstieß.
Meine Mutter, im fünften Monat guter Hoffnung, folgte trotz der Bitten meiner Großeltern, die Niederkunft in Fürth abzuwarten, ihrem geliebten Erik. Eher wollte sie sterben, als von ihm getrennt zu sein. Damals nahmen Frauen und Kinder noch an den Feldzügen teil. Im schwedischen Lager wachte man streng über die Sitten, nur verheiratete Soldatenfrauen durften sich dort aufhalten. Die Kinder lernten in Feldschulen, regelmäßig wurden Gottesdienste gefeiert. Um nichts in der Welt hätte Vater seine Miriam in Fürth zurückgelassen.
Auf die Hilferufe des von Wallenstein bedrängten Kurfürsten von Sachsen zog Gustav Adolfs Heer in Eilmärschen von der Donau nach Norden. Am sechzehnten November trafen die Schweden und die Kaiserlichen bei Lützen aufeinander.
Am Morgen vor der Schlacht lag dichter Nebel über der Ebene zwischen Leipzig und Weißenfels. Nur durch ein Lederkoller geschützt – den Harnisch konnte er wegen einer früheren Verwundung nicht mehr tragen –, trat der König vor die Soldaten und sprach ein Gebet. Dann schwang er sich aufs Pferd, ritt durch die Reihen und sprach den Männern Mut zu. Sie, die Tilly vernichtend geschlagen hatten, bangten vor Wallenstein, dem man Zauberkräfte nachsagte.
Gegen Mittag hob sich der Nebel. „Gott mit uns!“, riefen die Schweden, „Jesus Maria!“ die Kaiserlichen. Die schwedische Reiterei preschte nach vorn, das Fußvolk setzte sich in Marsch. Den rechten Flügel führte der König. Unter den Hieben seiner finnländischen Kürassiere wichen die leicht berittenen Polen und Kroaten. Aber das schwedische Fußvolk hielt dem Anprall des Feindes nicht stand. Auch der linke Flügel begann zu wanken. Gustav Adolf befahl General Horn, die schon geschlagenen Polen und Kroaten zu verfolgen, und sprengte zum linken Flügel. Mein Vater gehörte zu den Offizieren in seiner Begleitung. Doch der König ritt so schnell, dass außer Franz Albert, Herzog von Sachsen-Lauenburg, verwandt mit den Wasa und nach der Schlacht zum Verräter an ihnen geworden, keiner ihm folgen konnte. Plötzlich senkte sich wieder dichter Nebel über das Schlachtfeld und entzog den König den Blicken seiner Offiziere.
Erst das herrenlose Pferd des Königs entdeckte der schwedischen Reiterei Gustav Adolfs Fall. Für einen Augenblick schien eine Zauberhand Männer, Pferde und Geschütze zu lähmen. Selbst die Kaiserlichen waren verwirrt. Doch schnell fassten sich die Schweden. Sie schlossen die Reihen, die eben noch Zurückweichenden stürmten nach vorn, als sei der Geist des Königs in sie gefahren. Am Abend hatten sie Wallensteins Heer in die Flucht geschlagen. Aber um welchen Preis! Tausende von Verwundeten, Sterbenden und Toten lagen auf den morastigen Äckern. Den König fand man erst nach langem Suchen, seiner Kleider und Waffen beraubt. Pferdehufe, Schmutz und Blut hatten ihn bis zur Unkenntlichkeit entstellt.
Über den Tod des Königs wurden viele Vermutungen geäußert. Hatte ihn seine Kurzsichtigkeit mitten in die feindlichen Reihen geführt? Hartnäckig hielt sich der Verdacht, der Herzog von Sachsen-Lauenburg habe ihn ermordet. Mein Vater, beileibe kein Freund des Lauenburgers, meinte aber, wo so viele gestorben waren, konnte auch ein Gustav Adolf ganz natürlich getroffen worden sein. Verrat oder nicht, man wird nie erfahren, wie der König zu Tode gekommen ist.
Gustaf Adolf ereilte das Schicksal auf dem Gipfel seines Ruhmes. Wer weiß, ob man zehn Jahre später noch seinen Edelmut gerühmt, so viele Tränen um ihn vergossen hätte. Was wäre aus ihm geworden? Ein Augustus? Ein Tiberius, gequält von Zweifeln und Verfolgungswahn? Ein dem Irrsinn verfallender Caligula? Die Schweden ein Volk von Soldaten, Stockholm ein neues Rom?
Die Lutheraner in Schweden und Deutschland feiern Gustav Adolf als Glaubenshelden. Welch eine Verblendung! Von Gustav Adolfs Kanzler und Freund Axel Oxenstierna, dem man gewiss keinen Mangel an Frömmigkeit vorwerfen kann, stammt die zutreffende Bemerkung, Gustav Adolf habe zu viel von einem Alexander oder Caesar gehabt, um als protestantischer Heiliger gelten zu können.
Mein Vater geleitete den Leichnam des Königs nach Weißenfels, wo sich die Königinwitwe Maria Eleanora von Brandenburg hemmungslos ihrem Schmerz hingab. Miriam war überglücklich, Erik lebendig wiederzusehen. Auf seinen Vorwurf, Freude zieme der schweren Stunde nicht, erwiderte sie, dass Tränen und Wehklagen Gustav Adolf nicht vom Tode erweckten. In der Freude aber würde er, der so gern gelacht hatte, weiterleben. Erik empfand Miriams Worte als Sakrileg, ist es doch in Schweden üblich, die Toten ein Jahr und länger in düsteren Zeremonien zu betrauern.
An jenem Tag, da Christine, Gustav Adolfs Tochter und seit drei Wochen schwedische Königin, sechs Jahre alt wurde, am 8. Dezember 1632, kam ich in einem schwedischen Feldlager mitten in Deutschland zur Welt. Meine Mutter nannte mich David und nicht Gustav, wie es meinem Vater lieber gewesen wäre.
„David“, soll sie gesagt haben, „besiegte den Riesen Goliath, in ihm war die Kraft der Schwachen, die ich auch meinem Sohn wünsche.“
Ich wuchs unter Pferdeknechten und Marketenderinnen auf, schlief unter dem Donner der Geschütze und spielte in aufgeworfenen Gräben.
Seit Gustav Adolfs Tod floh das Glück die schwedischen Waffen. Die Soldaten meuterten um den ausstehenden Sold. Wallensteins Heer errang Sieg um Sieg. Kreuz und quer zogen die Schweden durch das verwüstete Land und plünderten ebenso wie die Kaiserlichen, um nicht zu verhungern. Im September 1634 erlitten sie bei Nördlingen ihre schwerste Niederlage.
Meine Mutter wurde von einer Kugel getroffen. Soldaten fanden mich neben der Toten. Als sie mich meinem Vater übergaben, mussten ihn mehrere Männer festhalten, damit er nicht ins Lager der siegreichen Feinde stürmte. Sie fesselten ihn, legten ihn auf einen Karren und brachten sich und uns in Sicherheit. Zwei Tage lag Erik Eriksson wie ein Toter. Dann übernahm er das Kommando der kleinen Gruppe.
Feldmarschall Horn war in Gefangenschaft geraten. Herzog Bernhard von Weimar hatte sich nach Frankfurt gerettet und sammelte dort die Reste der schwedischen Truppen unter seiner Fahne. Vater beschloss, sich mit seinen Leuten nach Frankfurt durchzuschlagen, doch zuvor brachte er mich nach Fürth zu den Großeltern. Er hätte schon damals gern von der Armee Abschied genommen. Seit Gustav Adolfs Tod erschien ihm der Krieg sinnlos. Er hegte den Verdacht, das schwedische Heer diene Kardinal Richelieu nur als Waffe, den spanisch-österreichischen Feind Frankreichs niederzuhalten. Erik Eriksson fühlte sich betrogen, denn er war Gustav Adolf gefolgt, um den deutschen Glaubensbrüdern in ihrem Kampf gegen die Papisten beizustehen. Vor den Großeltern verfluchte er den Krieg, die Papisten, sich selber, weil er Miriam nicht hatte beschützen können.
Mein Großvater, selbst von Miriams Tod ins Herz getroffen, wies ihn streng zurecht. Er sprach jene Worte, die ich später oft von meinem Vater hörte und die mich durchs Leben begleiteten: „Der Geborenen harrt der Tod, und des Todes die Auferstehung, und der Auferstehung das Gericht vor dem, der Schöpfer und Bildner, Kläger, Zeuge und Richter ist, vor dem es weder Unrecht noch Vergessen, weder Begünstigung noch Bestechung gibt. Und lass dich nicht vom bösen Trieb beschwichtigen, dass das Grab eine Zufluchtsstätte für dich sei. Gegen deinen Willen wurdest du erschaffen, gegen deinen Willen lebst du, gegen deinen Willen wirst du sterben, und gegen deinen Willen wirst du Rechenschaft ablegen müssen vor dem König, dem Heiligen, gelobt sei er.“
Mein Vater bat die Alten, für mich zu sorgen, bis er mich holen würde. Er gab ihnen alles Geld, das er besaß, dann ging er.
*
Meine ersten Erinnerungen verbinden sich mit Fürth: der kleinen dunklen Stube, in der wir schliefen, dem muffigen Raum mit dem Trödel, wo ich am liebsten spielte. Die Worte Vater und Mutter vergaß ich. Bevor ich lesen und schreiben konnte, wusste ich schon, dass ich ein Jude war, der einen Jesus von Nazareth umgebracht haben sollte. Sonntags und nach Einbruch der Dunkelheit wurden die Tore an beiden Enden der Judengasse verschlossen. Auf meine Fragen seufzte die Großmutter nur und sagte, das sei eben so, und ich müsse mich daran gewöhnen. Großvater widersprach: „Fügen ja, aber nicht gewöhnen. Wer andere einsperrt, fürchtet sich. Wer Menschen fürchtet, vertraut Gott nicht. Wer Gott nicht vertraut, ist unfrei. Nicht uns sperren sie ein, sondern sich selbst.“ Dann erzählte er mir die Geschichte von den Leiden und Prüfungen Hiobs. „Wie den Hiob hat Gott unser Volk auserwählt, durch Leiden den Glauben zu stärken und dadurch die höchsten Güter des Lebens zu erlangen: Wahrheit, Gerechtigkeit und Freiheit.“ Mich erschreckte die Strenge dieser Worte, aber ich bewahrte sie in meinem Herzen.
Ich war getauft, wurde jüdisch erzogen, aber nicht beschnitten.
Vater und die Großeltern hatten einander versprochen, mich über mein Glaubensbekenntnis selbst entscheiden zu lassen, wenn ich alt genug dazu sei. Nach dem, was ich inzwischen von der Welt gesehen habe, kann ich den Mut dieser drei Menschen nicht genug bewundern. In einer Zeit, da nicht nur Katholische und Lutherische einander bis aufs Blut bekämpften, sondern auch Lutherische und Calvinisten, Jesuiten und die ebenfalls katholischen Jansenisten einander befehdeten, gingen zwei Juden und ein Lutheraner das Wagnis der Toleranz ein.
Da ich in Gottesfurcht erzogen werden sollte, ließen mich die Großeltern vorerst im jüdischen Glauben unterweisen. Sie mussten viel Ungemach von den Ihrigen erdulden, und auch ich erfuhr zeitig Hohn und Verachtung. Den Juden war ich Christ, den Christen Jude. Ich lernte, mich zu wehren. Meine Fäuste waren kräftig, meine Beine flink, mein wacher Verstand erfasste schnell jede Situation. Ich hatte keine Freunde. Die Eltern verboten ihren Söhnen den Umgang mit einem Unbeschnittenen, der obendrein ein Raufbold war. Man duldete, aber man liebte mich nicht. Der alte Rabbi, der uns Hebräisch und die Kenntnis der heiligen Bücher lehrte, strafte mich für das geringste Vergehen härter als andere. Ohne Hoffnung auf Freundlichkeit setzte ich nun erst recht alles daran, meinem schlechten Ruf Ehre zu machen. Als der Rabbi plötzlich starb, behaupteten viele, ich hätte ihn zu Tode geärgert.
Der ewigen Klagen über mich und seiner eigenen Ermahnungen müde, sagte der Großvater: „Getauft bist du, aber kein Christ, von jüdischem Blut, aber kein Jude. Was soll aus dir werden, wenn du immer nur rebellierst und nicht weißt, wo du hingehörst?“ Der alte Mann liebte mich auf seine Weise, und er fühlte sich schuldig an meinem Schicksal. Aber das half mir nichts. Ich war ein Kind von elf Jahren. In den Nächten weinte ich und nahm mir vor, bei nächster Gelegenheit wegzulaufen und meinen Vater zu suchen.
Zu jener Zeit kam ein junger Rabbi aus Hamburg in die Judengemeinde von Fürth. Während des Unterrichts schnitt ich Grimassen und störte durch Zwischenrufe. Der Rabbi lächelte nur, strich mir über den Kopf und sagte: „Was für schöne blonde Haare du hast.“ Meine Mitschüler klärten den Rabbi auf, dass ich ein Schwedenbastard sei. Ich ballte die Fäuste. „Na und! Ein Schwedenbastard ist auch ein Mensch.“ Der Rabbi nickte. „Gut geantwortet. Nun zeig mal, was du kannst.“ Worin er mich auch prüfte, meine Antworten stellten ihn zufrieden. Plötzlich wechselte er in eine andere Sprache. Nach wenigen Sätzen begann ich ihn zu verstehen. „Wer hat dich Französisch gelehrt?“, fragte der Rabbi erstaunt.
Er fasste mich bei der Schulter und schob mich vor sich her zur Wohnung meiner Großeltern. Das schadenfrohe Gelächter der anderen ließ mich nichts Gutes erwarten. Mehr als den Zorn des Großvaters fürchtete ich seine Trauer und die Tränen der Großmutter. In der Hoffnung, das Unheil noch abwenden zu können, versprach ich hoch und heilig, niemals mehr den Unterricht zu stören. Es half nichts. Damals habe ich begriffen, was der Ausdruck, ein Lamm zur Schlachtbank führen, bedeutet, zumal der Rabbi bemerkte, ich sei ein Schaf.
Großvater begrüßte den Rabbi ehrerbietig. Dann sagte er, ich sei kein schlechter Junge, er selbst trage Schuld an allem, was ich anstellte. Nicht die härtesten Schläge hatten mich je so geschmerzt wie diese Worte. Inbrünstig flehte ich zu Gott, er möge ein Wunder geschehen lassen, damit Großvater getröstet würde.
Rabbi Levi beruhigte den Großvater. Er sei nicht gekommen, sich über mich zu beschweren, sondern ihm zu seinem Enkel zu gratulieren. Ich traute meinen Ohren nicht. Großvater schaute verlegen zu Boden und meinte dann zu mir, Großmutter müsse doch längst von ihrer Besorgung zurück sein. Gar zu gern ging ich sie suchen. Ich schwebte auf Engelsflügeln. Gott hatte mein Flehen erhört und das Wunder geschehen lassen, wenn ich auch nicht wusste, worin es bestand. Als ich mit Großmutter in die Stube trat, fragte mich der Rabbi auf Schwedisch, ob ich mich an meinen Vater erinnern könne. Dann redete er spanisch, was ich ebenfalls verstand. Mit Leichtigkeit sprach ich seine Worte nach.
Großvater und der Rabbi wechselten einen bedeutungsvollen Blick, und einer von beiden meinte, Gott hätte seine Hand auf mich gelegt.
Seither haben viele meine Sprachkenntnisse bestaunt und vermutet, ich verbrächte Tage und Nächte mit dem Studium fremder Sprachen. Wie soll ich erklären, warum sich mir der Sinn eines einmal gehörten Wortes sofort erschließt und unverlierbar einprägt? Ich weiß es selbst nicht. Andere besitzen eben andere Talente, die mir abgehen.
Die Bitte des Rabbi, mich außerhalb der Schule unterrichten zu dürfen, gewährte Großvater bereitwillig. Dem Drängen, mich zur Ausbildung nach Holland zu schicken, widersetzte er sich. Er schulde meinem Vater Rechenschaft, wenn der eines Tages vor der Tür stünde, mich zu holen.
Rabbi Levi machte aus mir, einem kleinen Wilden, der wahllos um sich schlug, einen sanften nachdenklichen Jungen. Er führte mich in die Welt Don Quichottes und Gargantuas, Tyl Ulenspiegels und des Königs Artus. Wir lasen Erasmus von Rotterdams „Lob der Torheit“ und die Bücher des Alten Testaments. Meine Fragen ermüdeten den Rabbi nicht. Er antwortete mit Gegenfragen und ließ mich die Antworten selber finden. „Gott“, sagte er oft, „ist ein Rätsel, in dir liegt die Lösung.“ Bald sprach ich Latein und Hebräisch, Spanisch, Französisch und Portugiesisch so gut wie mein Lehrer. Spott und Schimpf der Mitschüler verstummten allmählich, aber ein Fremder blieb ich – wie Rabbi Levi.
Er war in Portugal geboren. Seine Eltern hatten ihn und sich taufen lassen, um der Verfolgung durch die Inquisition zu entgehen. Insgeheim blieben sie ihrem jüdischen Glauben treu. Die Eltern des Rabbi handelten mit Rohrzucker und Tabak. Als ihnen ihr Verwandter Diego Texeira aus Hamburg schrieb, dass man in der Hansestadt leben könne, ohne den jüdischen Glauben verleugnen zu müssen, verließen sie ihre Heimat. Die Texeiras halfen den Verwandten, und bald waren aus den Flüchtlingen wohlhabende Hamburger Geschäftsleute geworden.
Dem jungen Levi missfiel die Arroganz der jüdischen Kaufleute portugiesischer Herkunft gegenüber den deutschen Juden, die nicht einmal Wohnrecht in Hamburg erhielten. In Altona drängten sie sich in armseligen Behausungen. Um der Gerechtigkeit auf die Sprünge zu helfen, verteilte Levi seines Vaters Geld an die Bedürftigen der Altonaer Gemeinde. Der alte Levi schickte den missratenen Sohn zum Studium nach Amsterdam. Wenn er schon nicht zum Kaufmann taugte, da er das Geld verschleuderte, anstatt es zu mehren, sollte er wenigstens Wissen anhäufen. Die jüdische Gemeinde in Amsterdam hätte den begabten jungen Mann auch nach Beendigung seiner Studien gern bei sich behalten, aber Levi zog es wieder nach Altona. Dort erklärten ihm die Gemeindeältesten, dass sie auf seine Hilfe verzichten müssten, wollten sie nicht mit seinem Vater und den mächtigen Texeiras im Streit leben. So abgewiesen, schnürte Rabbi Levi sein Bündel und ging auf Wanderschaft. Mehrmals entging er mit knapper Mühe dem Tod. Man warf mit Steinen nach ihm, hetzte ihn mit Hunden, doch die armen Juden verehrten ihn. Er war furchtlos, wo andere die Angst schüttelte; dem Hass begegnete er mit Güte, er sprach von Gottes Wort, das für alle Völker gelte und Frieden heiße. „Die Menschheit“, sagte er, „ist ein Leib. Wenn aber die Glieder gegeneinander kämpfen, zerstören sie den Leib.“
Da Rabbi Levi sich auch auf Heilkünste verstand, rief ihn mancher hohe Herr zu Hilfe und fand, wenn er von seinen Beschwerden geheilt war, Gefallen an den Worten des Rabbi. Niemals nahm Rabbi Levi Lohn für seine Dienste, er ging so arm, wie er gekommen war. Doch gewann er Schätze, die nicht von Motten und Rost zerfressen werden.
„Alle Religionen“, lehrte mich der Rabbi, „sind von einem Gott, in welcher Form die Menschen ihn auch anbeten. Gott ist Frieden, Barmherzigkeit, Liebe, Wahrheit. Nicht das Schwert öffnet den Weg zu Gott, sondern Leiden um der Gerechtigkeit willen. Glaube niemals einem Prediger, der zu Hass und Gewalt aufruft. Er predigt Irrlehre. Juden, Muselmanen, Katholiken, Calvinisten, Lutheraner, oder wie immer Menschen sich nennen, sind nicht Feinde, sondern Glieder eines Leibes. Nicht in den anderen sitzt das Böse, in uns selbst lauert es.“
Die Worte des Rabbi fielen zu einer Zeit in meine Seele, da sie für die Wahrheiten des Glaubens empfänglich war und noch nicht verhärtet von den Vorurteilen des Verstandes. Wäre ich dem Rabbi nicht begegnet, gehörte ich heute vielleicht zu jenen, die ihren Verstand zur Dirne der Mächtigen und des eigenen Vorteils gemacht haben.
Zwei Jahre blieb der Rabbi in Fürth. Eines Tages sagte er: „Ich habe dich alles gelehrt, was ich weiß und du verstehen kannst, du wirst auf jeder Universität Ehre einlegen. Ich kann nicht länger bleiben. Nur in der Fremde bin ich daheim.“
Mir war zumute, als hätte er mein Todesurteil gesprochen. Alles wollte ich für ihn tun, auf nackter Erde schlafen, hungern, wenn ich ihn nur begleiten dürfe. Der Rabbi ließ sich von meinem Flehen nicht erweichen. „Dein Vater wird kommen und dich nach Schweden mitnehmen. Du wirst viel sehen und lernen. Und wenn du ein Mann geworden bist, vergiss Rabbi Levi und seine Brüder nicht.“
„Was kümmert mich mein Vater! Ein Jude bin ich wie du!“, widersprach ich.
Rabbi Levi schüttelte den Kopf. „Vor zwei Jahren warst du klüger als heute. Ein Mensch bin ich, hast du damals gesagt. Heute nennst du dich Jude. Dein Vater kümmert dich nicht? Was er auch ist und wo er auch ist, du schuldest ihm das Leben und damit Liebe wie deiner Mutter. Wenn du ihn verleugnest, bist du nur so frei wie ein welkes Blatt, das vom Baume fällt.“
Der Rabbi ging, ohne sich noch einmal umzudrehen. Ich fühlte mich wie ein herrenloser Hund. Die Welt erschien mir kalt und bedrohlich. Großvater war oft krank, Großmutter weinte sich die Augen blind und jammerte, was aus mir werden solle.
*
Zu der Zeit, da Rabbi Levi Fürth verließ, nahm Erik Eriksson in Tabor von General Torstensson seinen Abschied. Wenige Tage später stand er vor unserer Tür, ein hochgewachsener blonder Mann, das Gesicht grau und gefurcht wie ein reifbedeckter Acker. Ich ertrug widerwillig seine Umarmung. Soldaten, hieß es, raubten, steckten Häuser in Brand, schlachteten Kinder, und die Schweden sollten sich am schlimmsten aufführen. Bänkelsänger berichteten grausige Moritaten von eingefleischten Teufeln in der Gestalt von Landsknechten. Man sang damals den Reim: „Bet Kinder, bet, morge kommt der Schwed, morge kommt der Oxestern, der wird die Kinder bete lern.“
Aus sicherer Entfernung betrachtete ich den Fremden, der an Großvaters Lager kniete und leise mit ihm sprach. Wie ein eingefleischter Teufel sah er nicht aus, und mein anfänglicher Schrecken wich der Neugier. Mein Vater erzählte, wie ihn Verwundungen, immer neue Feldzüge zwischen Dänemark und Böhmen daran gehindert hatten, sein Wort früher einzulösen. Nach dem Sieg der Schweden über die Kaiserlichen bei Tabor hatte General Torstensson endlich eingewilligt, einen seiner fähigsten Offiziere zu entlassen. Hol deinen Sohn, wenn er noch lebt, soll er gesagt haben, in Schweden sehen wir uns wieder, so Gott will und dieser verfluchte Krieg zu Ende ist.
Auf der Straße waren die Nachbarn zusammengelaufen und bestaunten Soldaten und Pferde. Jeder wollte sich an den prächtigen Zug erinnern, der vor dreizehn Jahren die schöne Miriam aus dem Hause der Eltern geholt hatte. Man pries die Ritterlichkeit der Schweden und vor allem Erik Eriksson, der sich der Eltern der armen Miriam und seines Sohnes annahm. Eben noch als Schwedenbastard geächtet, war ich nun ein Held. Schulkameraden baten, auf der braunen Stute reiten zu dürfen, die mir mein Vater mitgebracht hatte. Die Erwachsenen grüßten mich. Ich gnoss den Sinneswandel der Nachbarn, ohne nach seinen Gründen zu fragen.
Langsam gewöhnte ich mich an meinen Vater. Er lehrte mich reiten, Degen und Pistole gebrauchen. Die Reise nach Schweden, sagte er, würde kein Spazierritt werden, nur Männer könnten sie bestehen. Ich bewunderte ihn, wenn er von seinen Erlebnissen mit Gustav Adolf erzählte. Jetzt wollte ich nicht mehr die Welt des Geistes erobern, mich verlangte nach ruhmvollen Taten. War David nicht ein Kriegsheld gewesen, vom armen Hirten aufgestiegen zum König Israels? Der große Alexander, der Hannibalbezwinger Scipio, der alles niederstampfende Caesar, der Löwe aus Mitternacht, Gustav Adolf, sie alle bestätigten doch das Wort Heraklits, dass der Krieg der Vater aller Dinge sei. Ich überschüttete meinen Vater mit angelesenem Wissen. Er sagte nur „So so“ und „Wirst schon sehen“. Seine Augen waren trübe wie die eines Blinden. Wenn er getrunken hatte, sagte er Sätze, die ich nicht verstand. „Man muss verzweifelt sein, um nicht zu verzweifeln“ oder „Gott hat den Menschen geschaffen, damit sie ihn umbringen“. Auf meine Fragen lachte er nur bitter. Manchmal sprach er von der jungen Königin Christina, der Tochter Gustav Adolfs. Er habe gehört, sie sei klug wie Athene und werde Europa den Frieden bringen.
Zu Beginn des Sommers reisten wir ab. Großvater segnete mich mit den Worten: „Die Tränen, die um dich geflossen, das Blut, das für dich vergossen, mögen den Boden deines Herzens fruchtbar machen.“ Als ich mich noch einmal umwandte, sah ich die beiden Alten nebeneinanderstehen, klein, zerbrechlich und verloren, dem Tode näher als dem Leben. Ich winkte zurück, voller Stolz, auf eigenem Pferd in die Welt hinauszureiten. Mein Gruß galt mehr den Schaulustigen und den Kameraden als den Großeltern. Dieser Abschied muss ihnen das Herz gebrochen haben. Nun hielt sie nichts mehr auf dieser Welt.
Je älter ich werde, um so mehr bedrängt mich das Bild der beiden, und ich werfe dem Dreizehnjährigen, der ich damals war, vor, dass er so gleichgültig ging und für die Alten kein Trostwort fand. Aber ich erreiche diesen Knaben nicht mehr und kann die Trauer der Großeltern nicht ungeschehen machen. Ein Leben lang laden wir bewusst oder unbewusst Schuld auf uns. Nur unserer Vergesslichkeit verdanken wir, dass wir unter dieser Last nicht zusammenbrechen.
Begleitet von drei Soldaten, ritten wir nordwärts. Wohin wir auch kamen – nach Franken, an den Rhein, nach Westfalen –, überall entvölkerte Dörfer, in den Städten Krüppel und Bettler ohne Zahl. Wir übernachteten in verlassenen Gehöften, wenn wir die nächste Stadt nicht vor Einbruch der Dunkelheit erreichen konnten. Dann hielten wir reihum Wache. Eines Nachts schossen wir ins Dunkel, weil wir Geräusche hörten und niemand auf unseren Anruf antwortete. Am Morgen fanden wir ein zum Skelett abgemagertes Mädchen, kaum älter als ich. Ratten hatten sich schon über die Leiche hergemacht. Ich wollte weglaufen, aber mein Vater hielt mich fest. „Schau sie dir genau an. Was siehst du?“ Mir war übel, meine Zähne schlugen aufeinander. „Wir haben ein kleines, hungriges Mädchen erschossen“, fuhr mein Vater erbarmungslos fort.
„Es war ein Irrtum!“, schrie ich. „Sie hätte doch nur einen Ton zu sagen brauchen, und wir hätten ihr Brot gegeben.“
Mein Vater ersparte mir nichts. „Sie hat geschwiegen, weil sie Angst hatte – wie wir. Das nächste Mal schießen wir vielleicht nicht, aber dann ist es ein Haufen Bauern mit Dreschflegeln und Sensen, die uns die Kehlen durchschneiden. Ist dir das lieber?“ Er legte mir den Arm um die Schulter und zog mich an sich. „Und schenkten wir unsere bescheidenen Vorräte her, man würde uns doch nicht am Leben lassen, weil man uns für die Ursache allen Unglücks hält. Der Krieg, mein Junge, den du den Vater aller Dinge nanntest, hat das Gesicht dieses Mädchens.“
Als wir endlich Hamburg erreichten, dachte ich wieder an Rabbi Levi. Er fehlte mir sehr, denn ich konnte mit niemandem über meine Erlebnisse sprechen. Mein Vater trank Tage und Nächte hindurch und war, wieder bei Verstand, wortkarger denn je. Ich glaube, dass ihn nur die Sorge um mich nach Schweden zurücktrieb. In Wahrheit wusste er nicht, was er dort oder irgendwo sonst auf der Welt noch sollte. Nur die Nachricht vom Friedensschluss zwischen Schweden und Dänemark hellte sein Gemüt für Stunden auf. Kaum regiere die junge Königin, schließe sie Frieden, erzählte er jedem, der es hören wollte. Der eiserne Oxenstierna habe ausgespielt.
Vater hielt den starken Mann Schwedens zu Unrecht für den eigentlich Schuldigen am Krieg. Axel Oxenstierna hatte Gustav Adolf abgeraten, sich in die deutschen Streitigkeiten einzumischen.
Im September 1645 betraten wir schwedischen Boden. Der Hof, den meines Vaters ältester Bruder bewirtschaftete, war klein und ernährte kaum die vielköpfige Familie. Mein Vater fand nicht in das bäuerliche Leben zurück, das er mir unterwegs gepriesen hatte. Mit seinen dunklen Reden konnte niemand etwas anfangen. Und wie es auf dem Kontinent zuging, wollte keiner wissen, man hatte selber Sorgen genug: immer neue Steuern und Abgaben und nun auch noch zwei zusätzliche Esser. Eines Tages warf der Onkel meinem Vater vor, dass er nicht wie andere Offiziere mit Reichtümern aus Deutschland heimgekehrt sei, sondern nur mit einem Judenbastard. Mein Vater packte unverzüglich unsere wenigen Sachen und verließ mit mir grußlos den Hof. Ich habe meine schwedischen Verwandten niemals wiedergesehen.
Es war bitterkalt, der Atem gefror in der Luft. Die Augen schmerzten vom Widerschein der Sonne auf dem Schnee. Nach den Zänkereien der letzten Wochen genoss ich die Schlittenfahrt. Ich freute mich, wieder mit Vater allein zu sein. Er schwieg die meiste Zeit. Irgendwann sagte er: „Bruder, Schwägerin und all die anderen haben recht – ich tauge nichts. Hab nichts gelernt als Krieg. Aber dass sie das Kind meiner Miriam, meinen Sohn, ihren Verwandten, getauft wie sie, einen Judenbastard nennen, werde ich ihnen nie verzeihen.“ Er klammerte sich an mich und keuchte: „Nicht wahr, du wirst ihnen zeigen, dass du mehr wert bist als alle Reichtümer, die man in Deutschland zusammengeraubt hat? König sollst du werden, Kaiser …“ Er fieberte. Als wir in Stockholm einfuhren, war er nicht mehr bei Sinnen. Der Kutscher brachte uns zu General Torstenssons Haus am Norrström, wo uns dessen Schwester freundlich aufnahm.
Wenige Tage später starb mein Vater. Unter seinen Papieren fand sich ein Brief an Lennart Torstensson. Darin bat er den Feldmarschall, für mich zu sorgen. Alles, was ihm fünfzehn Jahre Krieg in Deutschland gebracht hätten, sei dieser Sohn. Er dürfe nicht zuschanden gehen wie seine Eltern. „Lehrt ihn die Tugenden des Friedens, nicht die Künste des Krieges, im Namen des allmächtigen Gottes“, schloss der Brief.
*
Innerhalb eines Jahres hatte ich Rabbi Levi, die Großeltern, den Vater, die Heimat verloren. Ich wusste nicht, was aus mir werden sollte und wurde krank. Krankheit, pflegte Rabbi Levi zu sagen, habe ihre Ursache nicht in einer Schwäche des Körpers, sondern in der Unordnung der Seele. Zuerst erkranke die Seele, dann der Körper. Im Laufe meines Lebens konnte ich häufig die Richtigkeit dieser Erkenntnis überprüfen.
Ich lag im Hause Torstensson, aber in meinen Fieberträumen irrte ich durch die Ruinen, verfolgt von Bauern mit Dreschflegeln. Das von Ratten angefressene Mädchen stellte sich mir in den Weg. Und wenn ich endlich meinen Vater fand, stieß er mich den Verfolgern entgegen. Manchmal rissen mich meine Schreie in die noch fremdere Welt zurück, aus der ich mich eilig wieder davonstahl. Ich wollte nicht gesund sein.
Bis Anna erschien, blond, rotwangig, lächelnd. Ich beobachtete sie verstohlen. Wenn sie den Raum verließ, quälte mich die Angst, sie nie wiederzusehen. Als sie sich eines Tages über mich beugte, hielt ich sie fest. Ihre Liebkosungen erweckten meinen Lebensmut in einer mir bis dahin unbekannten und nicht zu verbergenden Weise. Die Dienstmagd Anna wurde meine erste Liebe. Sie schenkte sich mir, und ich nahm so selbstverständlich, wie sie gab. Wir waren zwei Kinder, die mit dem Feuer spielten.
Die Feldmarschallin überraschte uns. Unbewegten Gesichts schickte sie Anna aus dem Zimmer und kündigte mir den Besuch von Bischof Johan Matthiae an. Er werde mich examinieren. Fiele das Ergebnis positiv für mich aus, würde ich der Königin vorgestellt.
Anna blieb seit dieser Stunde unauffindbar. Man sagte mir, sie habe einen Soldaten geheiratet und sei mit ihm nach Deutschland gezogen, verschwieg mir freilich, dass sie durch Überredung und Geld dazu gezwungen worden war.
Vielleicht hätten Kummer und Enttäuschung mich wieder auf das Krankenlager geworfen, wäre nicht Johan Matthiae gewesen. Ich fasste sofort Zutrauen zu ihm. Der einstige Lehrer der Königin gehörte zu den Menschen, die man schon lange zu kennen glaubt, wenn man ihnen zum ersten Mal begegnet. Ihm erzählte ich von meinen Erlebnissen, Träumen und Ängsten. Er hörte aufmerksam zu, und ich fühlte mich von ihm verstanden. Johan Matthiae erinnerte mich an Rabbi Levi, auch in Äußerlichkeiten: wie er die Fingerspitzen beim Sprechen aneinander legte, die Augen beim Zuhören schloss, dann wieder der forschende, hellwache Blick. Am Ende des langen Gesprächs meinte er, dass meine Sprachkenntnisse die jedes Gleichaltrigen überträfen, ich gut bewandert sei in Arithmetik, Geschichte, den alten und neuen Schriftstellern. Nicht zufrieden war er mit meinem Wissen in Geografie und Religion.
Die Feldmarschallin bestellte Lehrer, die mich in lateinischer Eloquenz, also in Grammatik, Dialektik und Rhetorik, unterrichteten. Auch Geometrie, Arithmetik, Musik, Astronomie, Logik und Philosophie trieb ich mit Vergnügen. Nur die Unterweisung in Religion langweilte mich. Ich musste sowohl den schwedischen wie den lateinischen Text von Luthers Katechismus verbo ad verbum auswendig lernen. Wenn ich mir auch redliche Mühe gab, ein guter Schwede und Lutheraner zu werden, erwachte doch mein alter Widerspruchsgeist, der schon dem alten Rabbi in Fürth das Leben vergällt hatte. Ich wollte wissen, warum Gustav Adolf und später sein Kanzler Axel Oxenstierna ein Bündnis mit dem katholischen Kardinal Richelieu geschlossen hatten, wo doch die Papisten Höllenfürsten seien. Solche und ähnliche Fragen trugen mir Maulschellen und Beschwerden bei der Feldmarschallin ein. Niemand sprach mehr davon, dass ich der Königin vorgestellt würde, auch Johan Matthiae nicht, wenn er meine Fortschritte in den Wissenschaften lobte.
Oft stand ich an der Schlossbrücke und versuchte die Königin zu sehen, wenn sie mit ihren Kavalieren ausritt. Aber die langen Kerle verdeckten ihre Gestalt, und ich musste mich mit Geschichten begnügen, die mir der Stallbursche Sven über Christine erzählte. Da ihm nur wenige Worte zur Verfügung standen, erfuhr ich nicht viel mehr, als dass sie wie ein Engel regiere und wie ein Teufel reite.
Die ganze Stadt war auf den Beinen, als Feldmarschall Torstensson nach Stockholm heimkehrte. Mein Vater hatte ihn mir oft beschrieben, und ich erwartete einen Recken hoch zu Pferde. Stattdessen trug man ihn in einer Sänfte durch die Straßen.
Mit seinen dreiundvierzig Jahren glich Lennart Torstensson einem Greis am Rande des Grabes. Bleich und aufgeschwemmt, zeitweise fast bewegungsunfähig durch die Podagra, gequält von Steinleiden. Es ist mir bis heute rätselhaft, wie dieser kranke Mann es fertiggebracht hat, vier Jahre lang von einem Schlachtfeld zum nächsten zu hetzen.
Am Tag nach seiner Ankunft ließ Torstensson mich rufen. Er musterte mich lange und sagte dann: „Vom ersten Tag des Krieges war ich mit deinem Vater zusammen. Ich kannte Miriam, ein schönes und kluges Mädchen …“ Nach einer von Schmerzen erzwungenen Pause fuhr er fort, Erik sei einer seiner besten Offiziere gewesen, ein Freund. Wieder schwieg er. Er verfiel zusehends und ähnelte jetzt meinem Vater, wenn er aus einem Rausch erwachte. Nur deshalb fasste ich Mut, die Frage zu stellen, die mir mein Vater nie beantwortet hatte: „Warum, Exzellenz, hören die Schweden nicht einfach auf? Wenn die anderen keinen Feind mehr haben, ist der Krieg zu Ende.“ Torstensson lächelte nicht über meine naive Frage, er sparte sich auch die Worte, die ich schon so oft gehört hatte: Kampf für den rechten Glauben, Papistengefahr, Verteidigung … Er sagte nur: „Wenn das so einfach wäre. Der Krieg, einmal begonnen, gebiert immer wieder Krieg.“ Dann wechselte er das Thema. Von Bischof Matthiae habe er Wunderdinge über meine Begabung gehört. Er werde sich bei der Königin dafür verwenden, dass ich in Uppsala studieren dürfe. Damit war ich entlassen.
Über dem Mälar lag schon die Ahnung des Sommers, als mich Feldmarschall Torstensson hieß, ihn ins Schloss zu begleiten. Wir durchschritten ein beängstigendes Labyrinth von Treppen und Gängen, ehe wir das Arbeitskabinett der Königin betraten. Bücher in den Regalen, ein Globus, Karten … Am Tisch saß ein junges Mädchen, ein anderes stand am Fenster und blätterte in einem Buch. Vier oder fünf Männer unterbrachen bei unserem Eintritt ihr Gespräch. Ich kannte nur Johan Matthiae. Torstensson hielt mich zurück, als ich den Bischof begrüßen wollte. „Zuerst die Königin“, flüsterte er. Also musste eines der beiden Mädchen die Königin sein, aber welche? Torstensson wich meinem fragenden Blick aus, die anderen beobachteten mich gespannt.
Das Mädchen am Tisch, blond und zart, trug ein spitzenbesetztes Gewand, an seinem Mittelfinger blitzte ein großer Rubin. Das Fräulein am Fenster, schmucklos gekleidet, ebenso blond wie die andere, aber ohne deren Liebreiz, nahm keine Notiz von mir. Schon ging ich auf das Fräulein am Tisch zu, um mein Knie zu beugen, als ich bemerkte, wie jenes am Fenster ihr Buch nahe an die Augen führte. Also war sie kurzsichtig. Mein Vater hatte erzählt, die Kurzsichtigkeit Gustav Adolfs habe dessen Tod bei Lützen verschuldet. Konnte die Tochter dieses Übel nicht geerbt haben? Entschlossen änderte ich meine Richtung und erwies dem Fräulein am Fenster meine Reverenz. Sie reichte mir die Hand und führte mich zu der anderen. Ob diese, vollkommen an Leib und Seele, mir nicht besser als Königin gefiele?
„Majestät“, bat die zarte Blonde. Ich atmete hörbar auf, und alle lachten.
„Nachdem du mich und nicht meine schöne Freundin Ebba Sparre zur Königin erwählt hast, lass hören, ob dein Verstand deinem Gefühl ebenbürtig ist. Du kannst Hebräisch?“
Ich sprach einige Verse aus dem Buch Esther. Nach den Worten „Denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist, du allein von den Juden“, unterbrach mich die Königin und fuhr auf Latein fort: „Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so wird Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen, du aber und deines Vaters Haus werden umkommen.“ Dann wechselte sie ins Französische. Ob ich Jude oder Christ sei?
Antwortete ich: ein Jude, verleugnete ich meinen Vater; antwortete ich: ein Christ, verleugnete ich Rabbi Levi. Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und erwiderte: „Mit Verlaub, Majestät, ich bin ein schwedischer Bürger.“
Die Königin trat nahe an mich heran. Ich hielt ihrem starren Blick stand, obwohl mir vor Anstrengung fast übel wurde. Erst als sie fragte, ob es zutreffe, dass meine Mutter Jüdin gewesen sei, senkte ich die Lider.
„Liebtest du sie?“
„Ich kann mich nicht an sie erinnern.“
„Glücklicher“, sagte die Königin. Ich verstand nicht, doch sie fragte schon weiter, wie es mit Latein und Griechisch bestellt sei. Sie examinierte schnell, von einer in die andere Sprache übergehend. Ich verlor meine Befangenheit. Der Eifer der nur sechs Jahre Älteren ließ mich vergessen, dass sie Königin war. Wir tollten durch den Garten der Wissenschaften, spielten Versteck in seinen Labyrinthen, bis wir uns mit glühenden Wangen wiederfanden. Christine erschien mir plötzlich wunderschön, und so antwortete ich auf ihre Frage, was mir in Schweden am besten gefiele, wahrheitsgemäß: „Sie, Majestät.“
„Und was missfällt dir?“
„Der Religionsunterricht“, entfuhr es mir. Ich erwartete eine Zurechtweisung, aber die Königin lachte laut auf. Sie wandte sich zu den anderen: „Da hört ihr’s, Narren und Kinder sagen die Wahrheit.“ Das war schlimmer als eine Zurechtweisung.
Als wir das Schloss verließen, bemerkte der Feldmarschall, mein loses Mundwerk habe der Königin gefallen. Wenn ich nur wolle, stünden mir nach dem Studium in Uppsala alle Wege offen, denn mehr als den Adel der Geburt schätze Christina den Adel des Verdienstes.
2
Königin Christina stand im zwanzigsten, ich im vierzehnten Jahr, als wir einander begegneten. Ich hielt sie für ein Wesen aus einer anderen Welt. Doch wir sind alle Wellen im selben Meer, Blätter desselben Baumes. Wir beneiden Reiche oder Mächtige nur, solange wir um ihr Unglück nicht wissen. Erst später erfuhr ich aus Christines Aufzeichnungen, dass der Krieg Königskindern wie Soldatenkindern eine viel zu schwere Last aufgebürdet hatte.
Nach Ansicht der Jesuiten bildet sich ein Charakter in den ersten sieben Lebensjahren. Das menschliche Wesen sei dann einer noch feuchten Wachsplatte vergleichbar, in das die Umgebung unauslöschbare Zeichen einpräge. Die Patres mühen sich denn auch nach Kräften, ihre Zeichen in die Wachstafeln zu ritzen. Nur tun sie sich dabei selber zu viel Ehre an und Gott zu wenig. Unbestritten sind frühe Kindheitserlebnisse von bleibender Wirkung. Aber sie erklären nicht alles. Auch Gott ist im Menschen am Werk und durchkreuzt oft die Absichten der Erzieher zum Guten oder zum Bösen.
Christine, von deren ersten zwanzig Jahren ich nun berichten will, verlebte eine bedauernswerte Kindheit.
Am 8. Dezember 1626 strebten Venus, Merkur und Mars dem Regulus im Sternbild Löwen zu. Eine seltene und glückverheißende Konstellation. Maria Eleanora von Brandenburg, Gustav Adolfs Gemahlin, lag in den Wehen. Die Hofastrologen prophezeiten die Geburt eines Knaben, zu Großem berufen wie sein Vater. Ohne einen Blick an das Neugeborene verschwendet zu haben, meldeten sie dem König die Geburt des von allen erhofften Thronfolgers.
In Stockholm läuteten alle Glocken. Gustav Adolf dankte Gott in einem langen Gebet. Maria Eleanora weinte vor Freude.
Als die Hebamme das Kind badete, erkannte sie den Irrtum. Der Thronfolger war ein Mädchen. Keiner wollte dem König die Hiobsbotschaft überbringen. Prinzessin Katharina, Halbschwester des Königs, verheiratet mit dem Pfalzgrafen Johan Casimir und selbst Mutter von vier Kindern, fasste sich ein Herz. Sie trug das Neugeborene zum Bruder. In der Furcht, nicht die rechten Worte zu finden, wickelte sie das Kind kurzerhand aus den Windeln. Gustav Adolfs Miene blieb hell. Er sei zufrieden, sagte er, und bitte Gott nur, dass er ihm die Tochter erhalte. Man möge sie nach seiner Mutter Christina nennen.
Der Mann, den man wenige Jahre später in Europa als den Löwen aus Mitternacht, den nordischen Alexander feierte, offenbarte in dieser Stunde wirkliche Größe. Er entschied, dass Christina sein Nachfolger werden solle, und befahl, das Tedeum singen zu lassen. Prophetisch fügte er hinzu, dass dieses Kind sehr klug werden dürfte, da es alle getäuscht habe.
Maria Eleanora verzieh der Tochter die Täuschung nicht. Sie vergötterte ihren Gemahl so, wie sie Schweden hasste. Kein Wunder, dass die Früchte ihrer Liebe nicht reiften. Dreimal schon war sie schwanger gewesen – zuerst eine Fehlgeburt, dann eine Tochter, die im ersten Lebensjahr starb, schließlich eine männliche Totgeburt. Und nun sollte der Mannesstamm der Wasa in diesem Mädchen enden?
Gustav Adolf liebte seine Tochter zärtlich. Maria Eleanora liebte nur ihn, um das Kind kümmerte sie sich nicht. Ein Balken fiel auf die Wiege der kleinen Christine. Wie durch ein Wunder blieb sie unverletzt. Die Kinderfrauen vernachlässigten sie. Durch ihr Ungeschick brach die linke Schulter des Kindes und wuchs schief wieder zusammen. Unerklärliche Unfälle häuften sich. Niemand außer dem König schien dieses Kind zu wollen. Nicht die Mutter, nicht die schwedischen Adligen, die von einer Wahlmonarchie träumten, sollte der König ohne Erben sterben, nicht die katholischen Verwandten Gustav Adolfs, die in Polen regierten und einem kinderlosen Schwedenkönig auf den Thron zu folgen hofften.
Gustav Adolf traf Vorsorge für seine Tochter. Er ließ die Einjährige durch Reichstagsbeschluss zur Reichserbfürstin erklären, falls ihm männliche Erben versagt blieben.
An Christines Wiege stand das Verhängnis gleich in dreierlei Gestalt Pate: Ein Mädchen. Die Tochter des großen Gustav Adolf. Zukünftige Königin. Die Krone würde sie niederlegen, mit ihrem Geschlecht auf Kriegsfuß leben. Gustav Adolfs Tochter blieb sie.
Der König verbrachte die meiste Zeit bei der Armee, die König Sigismund von Polen bekriegte. Er inspizierte Bergwerke, Waffenschmieden, Werkstätten. Unermüdlich baute er an Schwedens Größe. Dabei immer die Sorge um das Kind, das sein Werk fortführen sollte. Als die zweijährige Christine lebensgefährlich erkrankte, ritt er aus dem hohen Norden so eilends nach Stockholm, dass niemand ihm zu folgen vermochte. Die Ärzte hatten das Kind bereits aufgegeben. Gustav Adolf nahm es in die Arme, trug es durchs Zimmer und bestürmte den Himmel mit seinen Gebeten. Christine wurde gesund. Jetzt rang der König tagelang mit dem Tod. Ein weiterer Grund für Maria Eleanora, die Tochter zu hassen.
Gustav Adolf war vernarrt in das Kind. Es versprach ihm ähnlich zu werden, im Aussehen und im Temperament. Jauchzend saß es vor ihm im Sattel, Kanonenschläge erschreckten es nicht.
Bevor Gustav Adolf nach Deutschland aufbrach, wählte er sorgfältig die Lehrer für Christine aus. Sie sollten das Mädchen alles lehren, was ein junger Prinz wissen musste, um gut regieren zu können: Wissenschaften, Sprachen, Leibesübungen. Weibliche Tugenden, außer Ehrbarkeit und Zurückhaltung, waren nicht erwünscht. Von der Mutter möge man Christine trennen, sobald sie ein verständiges Alter erreicht habe.
Mit dem dreieinhalbjährigen Kind auf dem Arm trat Gustav Adolf vor die Stände des Reiches und hielt seine Abschiedsrede. Darin verglich er sich mit einem Krug, der so lange zu Wasser geht, bis er bricht, was nun wohl auch ihm beschieden sei. Er beteuerte, dass er in den großen Krieg auf dem Kontinent nicht aus eigenem Antrieb oder aus Lust am Kämpfen eingreife, sondern nur, um die deutschen Glaubensbrüder vom papistischen Joch zu befreien.
Die Rede soll den Zuhörern, harten, unsentimentalen Männern, Tränen in die Augen getrieben haben. Aber sie enthielt nur die halbe Wahrheit. Nicht um des rechten Glaubens willen wagte der schwedische Löwe den Sprung über die Ostsee. Obwohl der Krieg auf dem Kontinent nun schon zwölf Jahre dauerte, war es den Schweden bisher nicht eingefallen, ihren bedrängten Glaubensbrüdern zu Hilfe zu eilen. 1630 aber standen die Heere Wallensteins in Pommern und bedrohten die Freiheit der schwedischen Schifffahrt. Außerdem unterstützte Kaiser Ferdinand in Wien den Anspruch der katholischen Wasa in Polen auf die Herrschaft über Schweden. Schon glaubten sich die Habsburger ihres Sieges über den Protestantismus und die katholischen Bourbonen sicher. Doch Kardinal Richelieu gab den Kampf nicht verloren. Im Namen seines allerchristlichsten Königs Ludwig XIII. ermutigte er die deutschen Protestanten zum Widerstand und versprach Gustav Adolf großzügige französische Hilfe, falls er gegen Wallenstein zu Felde ziehe.
Gustav Adolfs Lehrer, der weise Johan Skytte, riet ab, der Freund und Kanzler Axel Oxenstierna warnte. Der König schlug Rat und Warnung in den Wind, er vertraute seinem guten Stern. Im Sommer 1630 stach er mit seinem Heer in See.
Nach dem Abschied vom Vater weinte Christine drei Tage lang. Das war nicht ihre Art. Ein unheilvolles Zeichen. Prinzessin Katharina nahm das Kind in ihre Familie auf, wie Gustav Adolf es gewünscht hatte. Maria Eleanora folgte ihrem Gemahl. Christine vermisste sie nicht. Die Vierjährige schrieb dem Vater kleine Briefe in deutscher Sprache: Es geht mir gut, bleibt gesund, kommt bald zurück und bringt mir etwas Schönes mit.
Den König freuten die kindlichen Wünsche, erfüllen konnte er sie nicht. Er machte Geschichte.
Da haben wir halt noch ein Kriegl mehr, soll Kaiser Ferdinand gesagt haben, als er von Gustav Adolfs Landung auf Usedom erfuhr. Am Wiener Hof spottete man über den Schneekönig, der in der Sonne des Südens schmelzen würde. Die Höflinge und Generäle spotteten nicht lange. Als Gustav Adolf bei Breitenfeld nahe Leipzig den gefürchteten kaiserlichen Feldherrn Tilly besiegte und für die Eroberung Deutschlands nicht länger brauchte als für eine Reise, hing die Macht der Habsburger nur noch an einem seidenen Faden.
Die schwedischen Siege erregten Bewunderung, bald aber auch das Misstrauen ihrer katholischen wie protestantischen Verbündeten. Diese argwöhnten, Gustav Adolf wolle sich zum Herrn über alle machen, und sie hatten ihn doch nur als ihren Diener gerufen. Man brach Zusagen, hielt Truppen zurück, wechselte gar die Front. Wien fast in Reichweite seiner Artillerie, hetzte Gustav Adolf sein Heer wieder gen Norden, um sich den Rücken freizuhalten und Sachsen dem Zugriff Wallensteins zu entziehen. Bei Lützen ereilte ihn sein Schicksal.
In der allgemeinen Trauer um den größten Feldherrn des Jahrhunderts fragte kaum jemand, ob der Preis für diese Größe nicht zu hoch gewesen war. Die Eroberungen verrannen wie gewonnen. Schweden war in einen Krieg verstrickt, der schon zu viele Opfer gekostet hatte, um ihn sieglos beenden zu können. Auf dem Thron ein sechsjähriges Mädchen.
Christine erfuhr vom Tode des Vaters in Nyköping. Ihr Onkel Pfalzgraf Johan Casimir sagte: „Majestät, Euer Vater gab sein Leben für Schweden, nun seid Ihr Königin.“
Das Kind wunderte sich über die feierlichen Worte und das seltsame Benehmen des Onkels und begann zu lachen. Man tadelte Christines Gefühllosigkeit, ohne zu bedenken, dass sie sich an ihren Vater gar nicht mehr erinnern konnte. Vor zwei Jahren hatte sie ihn beweint wie niemand in Schweden und war wegen ihrer Tränen gescholten worden.
Während es unter den Erwachsenen üblich ist, die Folgen eines Unglücks zu beklagen und nicht seine Ursachen, bekennt sich ein Kind noch zu der einfachen Wahrheit: Wer in den Krieg zieht, kommt darin um. Es weint, wenn der Vater zum Schwert greift und nicht erst bei der Todesnachricht.
Christine gewöhnte sich an die Ehrfurchtsbezeugungen und daran, dass sie nun durch Gottes Gnaden Königin der Schweden, Goten und Vandalen, Großfürstin von Finnland, Herzogin von Estland, Herrin von Ingermanland war. Der Regentschaftsrat beeilte sich, sie gemäß Gustav Adolfs Willen von den Ständen zur Königin erklären zu lassen, forderte doch der polnische König Sigismund, einst König von Schweden und wegen seines Übertritts zum Katholizismus entthront, mit dem Recht der älteren Linie den Thron für sich und seine Nachkommen zurück.
Als der Reichsmarschall die Stände bat, Christine als Königin zu bestätigen, fragte ein Bauer: „Wo ist diese Tochter Gustav Adolfs? Ich kenne sie nicht und habe sie nie gesehen.“
Man holte die Sechsjährige. Der Bauer musterte sie eingehend und rief dann in den Saal: „Sie ist es wirklich. Ich sehe Gustav Adolfs Nase, Augen und Stirn. Sie soll unsere Königin sein.“
Kurz darauf kamen russische Abgesandte nach Stockholm, um die Königin zu beglückwünschen und Beileidsbezeugungen des Zaren zum Hinscheiden Gustav Adolfs zu überbringen. Reichsmarschall und Reichsadmiral übten mit der Sechsjährigen tagelang das Zeremoniell und ermahnten sie, keine Furcht zu zeigen.
Wovor sie sich denn fürchten solle?
Nun, die Russen seien große Männer in fremdartiger Kleidung, vor allem trügen sie lange Bärte.
Christine lachte und konnte sich lange nicht beruhigen. Der Reichsmarschall und der Reichsadmiral trugen doch auch Bärte. Die Vorhaltungen langweilten sie. Ungeduldig fuhr sie die Männer an: „Sagt mir nur, was ich tun muss und überlasst alles weitere mir.“ Sie empfing die russischen Gesandten mit fehlerlosem Zeremoniell. Reichte ihnen die Hand zum Kuss. Zuckte nur vor dem scharfen Branntweingeruch zurück. Bedankte sich artig für die Geschenke, bestellte Grüße an den Zaren.
Die Russen waren von der kleinen Königin begeistert, der Hof applaudierte ihr. Der Reichsrat hatte Europa eine handlungsfähige schwedische Monarchie vorgeführt.
Im Juni 1633 kehrte Maria Eleanora mit dem königlichen Leichnam aus Deutschland zurück. Das Herz des Toten ruhte in einer Kapsel, von der sich Maria Eleanora keinen Augenblick trennte. Spätestens jetzt hätte jedem offenbar werden müssen, dass Gustav Adolfs Tod seiner Witwe den ohnehin schwachen Verstand verwirrt hatte. Die einst ungeliebte Tochter behandelte sie als lebendes Abbild des Verstorbenen. In ihren Memoiren schrieb Christine: „Sie ertränkte mich fast mit ihren Tränen und erstickte mich fast in ihrer Umarmung … Ihre maßlose Liebe brachte mich zur Verzweiflung. Ich musste bei ihr schlafen, und sie ließ mich keinen Moment aus den Augen.“
Im Schloss von Nyköping hauste Maria Eleanora mit ihrer Tochter in schwarz verhängten Räumen, die von Kerzenschein nur dürftig erhellt wurden. Über dem Bett von Mutter und Tochter hing die goldene Kapsel mit Gustav Adolfs Herz. Ein paar Treppen tiefer stand der unbestattete Sarg. Maria Eleanoras Wehklagen begleitete Christine in den Schlaf, es weckte sie. In den düsteren Räumen tummelten sich Narren und Zwerge, auf deren Unterhaltung die Königinmutter trotz der Trauer nicht verzichten wollte. Sie flößten dem Kind Widerwillen ein, geisterten durch seine Träume.
Christine verstand zeitlebens nicht, warum sich ansonsten vernünftige Menschen mit solchen Geschöpfen die Zeit vertreiben. Ich erinnere mich, wie sie einmal sagte, diese Unglückswesen würden zu Unglücksvögeln für ehrenwerte Menschen, wenn man sie an Fürstenhöfe bringe. Obwohl sie manchmal Wahrheiten aussprächen, die andere nicht zu sagen wagten, könne man sie auch reden heißen, was man wolle.
Nur Prinzessin Katharina fand den Mut, gegen Maria Eleanoras Schreckensregiment aufzubegehren. Es sei unmenschlich, ein sechsjähriges Kind lebendig zu begraben, hielt sie ihr vor. Nach erregten Auseinandersetzungen wies die Königinmutter Katharina und ihre Familie aus dem Schloss. Der Reichsrat ließ es geschehen. Ein Dutzend kampferprobter Männer handelte lieber dem Willen des verstorbenen Königs zuwider, als der trauernden Witwe entgegenzutreten. Sie opferten das Kind.
Christine spürte, dass die Umarmungen der Mutter nicht ihr galten, sondern dem Mann im Sarg. Die Kapsel über dem Bett verursachte ihr Kopfweh. Nachts meinte sie, das Herz des Toten schlagen zu hören, und weinte, weil es so eingesperrt war wie sie. Sie fieberte, litt unter Geschwüren. Die Ärzte wussten sich keinen Rat, dabei fehlten ihr nur Bewegung im Freien und frisches Wasser. Man zwang sie, Bier zu trinken, das sie nicht vertrug. Wie ein gefangenes Tier hockte sie in den lichtlosen Räumen. Es grenzt an ein Wunder, dass sie diese Hölle überlebte.
Zwischen Warschau und Paris, Rom und Stockholm haben Zeitungsschreiber Königin Christine der Vergnügungssucht und der Kälte gegenüber ihrer Mutter geziehen, doch keiner hat in seinem Urteil das Jahr von Nyköping erwähnt. Was ihr dort widerfuhr, verfolgte sie ein Leben lang. Wunden der Kindheit heilen nie. Aber das zu verstehen, übersteigt den Verstand hurtiger Schreiberlinge.
Im Sommer 1634 wurde der Leichnam Gustav Adolfs in feierlichem Zug nach Stockholm überführt. Die Witwe zeigte sich untröstlich. Weil ihr Schmerz aufrichtig war, übertraf er alles, was man in solchen Fällen aufbietet, um die Zuschauer von der eigenen Trauer zu überzeugen. Christines Verzweiflung war noch größer, denn sie litt unter den endlosen Zeremonien und den atemabschnürenden Kleidern.
Endlich fand der Sarg seinen Platz in der Riddarholmskirche. Von der Kapsel mit dem Herzen trennte sich Maria Eleanora erst zwei Jahre später, als Axel Oxenstierna ihr eindringlich vorstellte, ein unbestattetes Herz beleidige Gottes Willen.
*
Die Beisetzung des Königs rettete Christine aus höchster Not. In den letzten Lebensjahren, da sie sich oft an ihre Kindheit erinnerte, meinte sie, es habe nicht viel gefehlt, und sie wäre in Nyköping unheilbar schwermütig geworden. Als das Schloss ein Jahr nach Christines Thronverzicht und kurz nach Maria Eleanoras Tod bis auf die Grundmauern abbrannte, nannte sie das einen Akt himmlischer Gerechtigkeit.
Maria Eleanora bezog nun das Stockholmer Schloss, um den Gebeinen des geliebten Gemahls nahe zu sein. Die Reichsräte befanden, Christine sei alt genug, sich in regelmäßigen Studien auf ihr Herrscheramt vorzubereiten. Noch immer wagten sie nicht, das Kind von der Mutter zu trennen, wie sehr Axel Oxenstierna in seinen Briefen aus Deutschland, auf Gustav Adolfs Testament verweisend, auch darauf drängte.
Christine fieberte den Unterrichtsstunden entgegen wie ein Gefangener der Freiheit. Männer waren ihre Lehrer, und wie ein Prinz wurde sie erzogen. Mit Axel Banér, Oberhofmeister und Bruder des berühmten Feldmarschalls Johan Banér, ritt sie oft aus. Er lehrte sie, das Pferd mit dem Körper zu verstehen und es so zu führen, dass sie mit dem Tier gleichsam zu einem Wesen verschmolz. Sie bevorzugte den Männersitz, worüber sich Mutter und Hofdamen empörten. Das Pferd wurde dem Mädchen zum Inbegriff der Freiheit. Mit dem Wind um die Wette jagen, alle und alles hinter sich lassen, die erste sein, vor sich nur den weiten Horizont, unbekanntes Land, Stunde um Stunde. Sie ermüdete nicht. Axel Banér soll von der Neunjährigen gesagt haben, sie besitze das unruhige Blut, das aufbrausende Gemüt und das ungestüme Herz der Wasa.