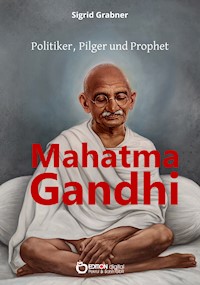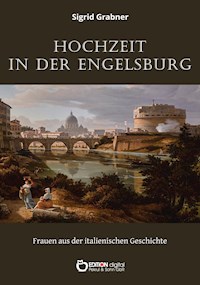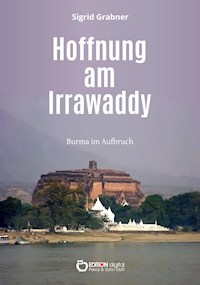7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer war Cola di Rienzo? Jene Zeiten, in denen er gelebt, gekämpft und gelitten hat, sind von der Gegenwart ziemlich weit entfernt. Es war das 14. Jahrhundert, und sein Leben spielte sich hauptsächlich in Rom ab. Im Internet-Lexikon Wikipedia heißt es eingangs eines längeren Eintrages über ihn: „Cola di Rienzo (* Frühjahr 1313 in Rom; † 8. Oktober 1354 ebenda) war ein römischer Politiker und Volkstribun. Er wurde der Nachwelt besonders bekannt durch das dreibändige Romanwerk Rienzi, or the Last of the Tribunes (Rienzi, der letzte Tribun, 1835) von Edward Bulwer-Lytton und die davon inspirierte Oper Rienzi (1842) von Richard Wagner. Cola di Rienzo ist bis heute eine umstrittene Figur: Für die einen ist er ein Humanist und Fixstern der Renaissance, für die anderen ein größenwahnsinniger Tyrann.“ In ihrem historischen Roman „Der Traum von Rom“ überwindet Sigrid Grabner die erwähnte große Entfernung zwischen heute und Rienzos Lebzeiten nahezu mühelos: Die schwere Tür schlägt zu. Cola hört, wie man den Riegel vorlegt. „Nein“, flüstert er, schreit dann: „Lasst mich heraus!“ Er donnert gegen das Holz, bis er, aufweinend vor Schmerz, zu Boden sinkt. Durch eine Mauerluke fällt Licht in das enge Verließ. Ein roher Holztisch, ein Schemel, eine Bettstatt aus Stroh. Cola widersteht dem Verlangen, sich auf dem Lager auszustrecken. Er stellt den Schemel vor die Luke und zieht sich an der Mauer hoch. Die Öffnung ist zu schmal, als dass er sich hindurchzwängen könnte. Gelänge es ihm dennoch, stürzte er in eine tödliche Tiefe. Voller Hoffnung und Vertrauen kam er im Juli 1350 nach Prag, um Karl IV. zu bitten, Rom nicht länger dem Verderben preiszugeben. In Rückblicken wird nachvollziehbar, um welche Kämpfe es damals eigentlich ging und welche Rolle jeweils Papst Clemens IV., König Karl IV. und Rienzo selbst spielten, der in Erinnerung an das untergegangene Römische Reich seinen „Traum von Rom“ träumte – von Aufschwung und Volkssouveränität. Das aber war zu viel für den König und Kaiserkandidaten, und er ließ Rienzo an den Papst ausliefern. Clemens aber starb bald und sein Nachfolger erlaubte ihm die Rückkehr nach Rom. Doch dort zeigte Rienzo vor allem seine tyrannische Seite und brachte das Volk gegen sich auf. Eine Zeittafel am Ende des spannenden Romans erleichtert die historische Orientierung und Einordnung des Lebens von Cola di Rienzo, der am 8. Oktober 1354 mit nur 41 Jahren in Rom erschlagen wurde. Zu Ostern 1355 wurde ebenfalls in Rom Karl IV. zum Kaiser gekrönt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Sigrid Grabner
Traum von Rom
Historischer Roman um Cola di Rienzo
ISBN 978-3-96521-671-6 (E-Book)
Umschlaggestaltung: Ernst Franta
Das Buch erschien 1985 im Buchverlag Der Morgen, Berlin.
2022 EDITION digital
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
I
Die schwere Tür schlägt zu. Cola hört, wie man den Riegel vorlegt. „Nein“, flüstert er, schreit dann: „Lasst mich heraus!“ Er donnert gegen das Holz, bis er, aufweinend vor Schmerz, zu Boden sinkt.
Durch eine Mauerluke fällt Licht in das enge Verließ. Ein roher Holztisch, ein Schemel, eine Bettstatt aus Stroh. Cola widersteht dem Verlangen, sich auf dem Lager auszustrecken. Er stellt den Schemel vor die Luke und zieht sich an der Mauer hoch. Die Öffnung ist zu schmal, als dass er sich hindurchzwängen könnte. Gelänge es ihm dennoch, stürzte er in eine tödliche Tiefe.
Wohin haben sie ihn gebracht?
Fünf Schritte zur Tür, fünf Schritte zurück – auf und ab gehend beruhigt sich Cola. Heute Morgen glaubte er, König Karl entließe ihn in die Freiheit, man holte ihn aus dem Gefängnis der Prager Burg und hieß ihn, ein Pferd zu besteigen. Doch dann umringten ihn bewaffnete Reitknechte, die Hände wurden ihm gebunden. Der Weg führte nicht nach Süden, sondern in dieses Burgverlies.
Warum? Will ihn der König entgegen seinem Wort nach Avignon ausliefern? Ist der Prager Erzbischof Ernst von Pardubitz ein Lakai des Papstes und nicht der tolerante Kirchenfürst, als den man ihn preist?
Hoffend und vertrauensvoll kam Cola di Rienzo im Juli 1350 nach Prag, um König Karl zu bitten, seine Pflichten als römischer König zu erfüllen und Rom nicht länger dem Verderben preiszugeben. Aber ehe ein Monat verstrichen war, sperrte man Cola in ein Gefängnis der Prager Burg. Das focht ihn nicht an, denn er durfte Besuche empfangen und litt keinen Mangel. Außerdem hatte das Orakel des Cyrill ihm diese Prüfung verheißen.
Cola schreitet schneller aus. Das Orakel des Cyrill …! Seit einem halben Jahr bestimmen die Prophezeiungen des Mönchs Cyrill vom heiligen Berg Karmel sein Tun und Denken. Wie eine Erleuchtung war es damals über ihn gekommen, als er in der Schriftrolle von den Schrecken las, die über die Stadt am Tiber hereinbrechen würden, weil der Antichrist die Welt beherrsche und das Imperium sinke. Rettung erstünde der Welt in dem kühnen Sol, der nach triumphalem Aufstieg, nach Fall, Buße und Gefängnis einem Kaiser aus dem Norden den Weg nach Rom öffnen würde. Dann stiege ein neues Imperium auf, in dessen Licht sich die Schrecken der Gegenwart gleich Schatten verflüchtigten.
Das Orakel sprach wahr: Das römische Reich ist zerfallen, in Avignon regiert der Papst als Antichrist. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass Karl der verheißene neue Herrscher ist und er, Cola di Rienzo, der kühne Sol. Dies zu verkünden, war er nach Prag gekommen. Hier glaubt man nicht an Prophezeiungen, man hält sie für Teufelswerk. Karl ist ein frommer Mann, doch seiner Frömmigkeit fehlt es an Mut.
Ein Geräusch an der Tür reißt Cola aus seinen Gedanken. Jäh springt Hoffnung in ihm auf. Sie kommen ihn holen, er wird frei sein. Doch es ist nur der Wärter, der eine Schüssel Suppe bringt. Cola kann das Gesicht im verdämmernden Licht nicht erkennen. Der Gestalt und dem Gang nach muss es ein alter Mann sein. Er schleift das rechte Bein ein wenig nach, die Schultern krümmen sich nach vorn.
Colas Frage, wo er sich befinde, bleibt unbeantwortet. Mühsam besinnt er sich auf ein paar böhmische Worte. Als er sich in Prag noch frei bewegen durfte, war er durch die Straßen gestreift und hatte mit den Händlern auf dem Markt und mit den Handwerkern auf der Burg zu sprechen versucht. Eine konsonantenreiche Sprache, bedächtig und schwerfällig wie die Menschen hier.
Der Wärter stellt schweigend die Suppe auf den Tisch. Erst an der Tür sagt er, und es klingt wie das Bellen eines Hundes: „Raudnitz“.
Cola ist wieder allein. Ruhelos geht er auf und ab, dreht und wendet das fremde Wort, spricht es laut aus, um hinter seinen Sinn zu kommen. Raud - nitz, so muss dieser Ort heißen. Raud - nitz, das klingt dunkel, hart und gnadenlos.
Das Licht in der Maueröffnung verlischt. Es ist September. Die Tage werden kürzer. Wenn in den Kirchen das Fest der Kreuzerhöhung gefeiert wird, hat er wieder in Rom sein wollen. Die Freunde werden vergeblich warten. Die Stadt wird weiter das Joch der Barone tragen, weil ein kleinmütiger, engherziger König nicht wagt, dem Willen des Papstes zuwiderzuhandeln, und ihn, Cola di Rienzo, einsperrt wie einen Verbrecher.
Ist Karl wirklich der Mann, der Europa das Heil bringen kann? Hat ihn je eine Idee begeistert, ein Traum ihn getragen, eine göttliche Berufung ihn geführt? Wo sind der Edelmut seines Großvaters Heinrich des Siebenten, das Draufgängertum seines Vaters Johann von Böhmen geblieben? Hat sich die Kraft der Luxemburger in diesen beiden verzehrt? List, Verschlagenheit und Berechnung ziemen dem Kaufmann, nicht einem König. Karl besitzt vielleicht die Klugheit des Politikers, aber nicht die Kühnheit des Denkers, welche die Welt verändert. Die Spinne in Avignon saugt ihm die Manneskraft aus den Adern.
Von dorther kommt alles Unglück. Seit fast einem halben Jahrhundert residieren die Päpste am Ufer der Rhone, während der Sitz Petri am Tiber verfällt. Beschränkte sich das Papsttum auf seinen geistlichen Auftrag und gäbe es, wie das Evangelium es gebietet, dem Kaiser, was des Kaisers, und Gott, was Gottes ist, dann säße der Oberhirte der Christenheit noch im geheiligten Rom. Aber den Päpsten sind Geld und Macht wichtiger als das Seelenheil der Gläubigen. Die Gefangenschaft, in die sie die Kirche geführt haben, macht sie nicht einsichtiger. Ihr Anspruch auf die Universalgewalt stürzt Rom und die christliche Welt ins Verderben.
1302 hatte der letzte Papst in Rom, Bonifaz der Achte, verkündet, dass der römische Papst aus Notwendigkeit des Heils über jede menschliche Kreatur herrsche, ihm sei absolute Machtfülle über Könige und Königreiche gegeben. Er wies den französischen Klerus an, König Philipp keine Steuern mehr zu zahlen. Der selbstbewusste französische König zeigte Bonifaz alsbald die Grenzen päpstlicher Macht. Philipps Verbündete unter dem römischen Adel nahmen den Papst in seinem eigenen Palast nahe Roms gefangen. Als der widerspenstige Greis kurz darauf starb, erzwang Philipp, dass Kardinäle seiner Wahl zu Päpsten gekrönt wurden. Keiner von ihnen betrat jemals mehr italienischen Boden. Clemens der Fünfte, Johannes der Zweiundzwanzigste, Benedict der Zwölfte – alle waren sie Franzosen wie der jetzt regierende Papst Clemens der Sechste und willige Werkzeuge des französischen Königshauses. Aber noch immer verkündet man in Avignon, dass dem Papsttum die weltliche Macht ebenso zustehe wie die geistliche. Wer diesem Satz widerspricht, gilt als Ketzer.
Zornig stampft Cola mit dem Fuß auf. Ich bin kein Ketzer! Der dumpfe Widerhall von den Wänden bringt ihm seine Lage zu Bewusstsein. Ein gefangener Ketzer …
Aber was ist denn Clemens im Papstpalast von Avignon anderes als ein Gefangener? Und Karl, der sich nicht am Petrusgrab in Rom krönen lassen darf? Wie unterschiedliche Ziele der Papst in Avignon, der König in Prag, der Gefangene in Raudnitz auch verfolgen mögen – der Altar ihrer Hoffnungen steht in Rom. Nur er heiligt das Amt des Papstes, verleiht den Titel des Kaisers, rechtfertigt das Tun Rienzos.
Cola setzt sich an den Tisch und rührt mit dem Löffel in der kalten Suppe. Der Geruch widert ihn an. Er schiebt die Schüssel von sich. Kraut und Bier, etwas anderes scheinen sie hier nicht zu kennen. Sehnsüchtig denkt er an den sonnenheißen sizilianischen Wein, der das Blut durch die Adern jagt, die Rede entflammt und nicht träge macht wie das Bier, das sie hierzulande trinken.
„Barbaren“, murmelt Cola verächtlich. Er steht auf und tastet sich durch das Dunkel zur Maueröffnung, wo der Schein des Mondes auf den grauen Steinen liegt. In der Tiefe schimmert der Fluss, den sie Elbe nennen. Unter dem mondhellen Himmel strecken sich Wälder, bis sie am Horizont zu einer undurchdringlichen Wand verschmelzen. Das Verlangen, in Rom zu sein, überfällt ihn so schmerzhaft, dass er aufstöhnt. In der Franziskanerkirche Aracoeli auf dem Kapitol beten. Mit dem Sohn Lorenzo an der Hand auf den Aventin hinaufsteigen. Eintreten in eine der Schenken, in denen das Leben über die Hoffnungslosigkeit triumphiert. Zwischen den Trümmern versunkener Zeiten das Ohr an den Boden pressen und den Fieberatem der Stadt hören …
Das Klagen eines Nachtvogels unterbricht Colas Gedanken. Der langgezogene Schrei stürzt unerwidert in die Nacht und erhebt sich flehentlich aufs neue. Cola presst die Hände auf die Ohren. Die heiße Stirn gegen die Mauer gelehnt, murmelt er ein Gebet, doch unaufhaltsam kriecht die Angst zu seinem Herzen. Warum verfolgt ihn dieser Totenvogel bis in die böhmischen Wälder? Verkündet er ihm ein ähnliches Schicksal wie damals auf dem Kapitol?
„Herr, mein Gott“, flüstert Cola, „für meine Sünden habe ich schwer gebüßt, nimm mir nun nicht noch die Hoffnung.“
Der Schrei des Vogels verstummt nicht. Er ist ihm ausgeliefert, ob er sich die Ohren zuhält oder nicht. Er spürt einen leichten Druck auf den Schläfen, der schnell anwächst, bis er glaubt, die Augen müssten ihm aus dem Kopf springen. Das ist der Vorbote jener Anfälle, die ihn seit sieben Jahren heimsuchen. Cola taumelt. Vor der Lagerstatt bricht er in die Knie. Wie ein rotierender, sich vergrößernder Feuerball rast der Schmerz auf ihn zu, schlägt in seine Brust ein und setzt den Körper in Brand. Cola ringt nach Luft, die Glut zu kühlen, doch jeder Atemstoß entflammt sie nur noch stärker.
„Erbarmen, Herr!“, schreit er in höchster Not. Und Gott erbarmt sich seiner. Er nimmt ihm das Bewusstsein.
Als Cola wieder zu sich kommt, kann er sich nicht erinnern, wo er ist. Eine bleierne Müdigkeit umklammert seinen Körper und zieht ihn in den Schlaf hinüber.
Cola läuft durch enge Gassen, klopft an Türen, die sich nicht öffnen. Jede Gasse endet an einer hohen Mauer. Er muss zurück zum Marktplatz, wo ein aufgeschichteter Scheiterhaufen auf ihn wartet. Doch immer wieder gelingt es ihm, in eine neue Gasse zu entkommen. Er bittet und weint vor verschlossenen Türen. Hinter den Fenstern grinsen schadenfrohe Gesichter, halb entblößte Frauen zeigen mit obszönen Gebärden auf ihn. Seine Füße werden schwer, doch er zwingt sich weiterzulaufen. Er will nicht als Ketzer verbrannt werden. Ein Mann tritt ihm in den Weg. Francesco, denkt er erleichtert, Francesco Petrarca. Der Mann schiebt die Kapuze aus dem Gesicht. Es ist Giovanni Colonna, der Kardinal, beinern sein Schädel, ein Gerippe sein Körper. Er flieht voller Grauen. Dann steht er endlich auf der Mauer. Sie ist glatt wie Marmor und hoch wie die Mauern des Papstpalastes. Schon hört er die Verfolger hinter sich. Herunterspringen bedeutet den sicheren Tod. Schwindel erfasst ihn und dann eine verzweifelte Angst, die ihn erwachen lässt.
Cola setzt sich auf. Ihm ist übel, Schweiß nässt ihm Hals und Brust. Dieses verfluchte Avignon. Petrarca hat recht, wenn er die Stadt eine Hure nennt. Für Gold spricht sie von jeglicher Sünde frei, für Gold erklärt sie den Gerechten zum Ketzer. –
Stolz und hoffnungsfroh war Cola im Januar 1343 von Rom nach Avignon gereist. Damals hatte die Bevölkerung von Rom den adligen Senat gestürzt und die Regierung in die Hände der Vorsteher der dreizehn Stadtbezirke gelegt. Die Volksregenten beauftragten den jungen Notar Cola di Rienzo, dem neuen Papst Clemens das Vorgehen der Römer zu erklären, ihm die Herrschaft über die Stadt zu bestätigen und ihm die Klagen des römischen Volkes vorzutragen.
Als er auf Avignon zuritt, sah er vor einem flammenden Abendhimmel die zinnengekrönten Mauern des Papstpalastes. Beim Anblick dieses Schattens über der Landschaft sank ihm der Mut, so unzugänglich und finster wirkte dieser gewaltige Bau. Erst im Gewirr der Gassen schüttelte er die Beklemmung ab. An Händlern ritt er vorbei, die nicht anders als in Rom ihre Waren feilboten, und aus mancher Taverne klangen italienische Worte.
Im beruhigenden Halbdunkel der Kirche des heiligen Agricola, wo er ein Dankgebet für die Reise verrichtete, gewann er neue Zuversicht. Er war so fest von seiner Mission überzeugt, dass ihn sein Glaube Berge von Widerständen und Abgründe von Intrigen überwinden ließ.
Einige Wochen zuvor war eine Gesandtschaft von achtzehn Römern in Avignon eingetroffen. Der adelsstolze greise Stefano Colonna, der ungekrönte König Roms, führte sie an. Sein ältester Sohn, Giovanni Colonna, lebte als einflussreicher Kardinal bei der Kurie. Als der alte Stefano nun von dem Umsturz in Rom erfuhr, verfolgte er dessen Boten und Anwalt Cola di Rienzo mit erbittertem Hass. Cola fand kaum eine Herberge, die Tore des Papstpalastes blieben ihm verschlossen.
Der alte Stefano kehrte eilends nach Rom zurück, die Macht seiner Familie zu befestigen, während sein Sohn, der Kardinal, alle Bittgesuche Colas um eine Audienz beim Heiligen Vater hintertrieb. Erst als der französische Kardinal Guido di Boulogne dem Papst dringlich riet, sein Urteil über die Zustände in Rom nicht allein auf die Ansichten von Vater und Sohn Colonna zu gründen, lud Clemens den hartnäckigen jungen Römer vor das Konsistorium. –
Cola erinnert sich lächelnd an seinen Triumph. Man muss jung und von sich selbst und seiner Sache überzeugt sein, wenn man Großes erreichen will, denkt er. –
Nur einen Augenblick verhielt er den Schritt, als er die weite Halle des Konsistoriums betrat und die kostbaren Teppiche an den Wänden, die prächtigen Kleider der Kardinäle und Bischöfe sah. Da blitzten goldene Ketten auf Seide und Damast, da funkelten Brillanten und Rubine auf Kreuzen und an Händen. Kaum unterschied er die ihm zugewandten Gesichter, nur eines fiel ihm auf. Unter buschigen, schon grauen Brauen blickten ihn zwei feindselige Augen an, die Nase, gekrümmt wie der Schnabel eines Raubvogels, schien bereit zuzuschlagen. Kardinal Giovanni Colonna war ganz das Ebenbild seines Vaters. Doch während der greise Stefano sich eine hagere, fast jünglingshafte Gestalt bewahrt hatte, neigte Giovanni, ein Mann in den Fünfzigern, zur Fülle.
Ihre Blicke kreuzten sich wie zwei feindliche Schwerter, doch dann riss sich Cola los und kniete nach einer schwungvollen Verbeugung vor dem Papstthron an der Stirnseite der Halle nieder. Mit einer Handbewegung gebot ihm Clemens, sich zu erheben. Aufschauend blickte er zum ersten Mal voll in das Gesicht des Papstes – eine hohe gewölbte Stirn, lebhafte dunkle Augen, eine fein geschnittene Nase, nur die vollen sinnlichen Lippen wollten nicht recht zu dem durchgeistigten Gesicht passen.
In den Straßen und Kanzleien Avignons hatte Cola die Klugheit und die Großzügigkeit des ehemaligen Benediktinerabtes Pierre Roger und nunmehrigen Papstes Clemens rühmen gehört. Da er ihn leibhaftig vor sich sah, im Glanz seines Amtes, das dennoch nicht den Menschen verbarg, glaubte er fest daran, dass dieser Mann ein Ohr für die Klagen Roms haben würde.
Cola verlor seine Befangenheit und begann zu sprechen. Ihm war, als hätte er sein ganzes bisheriges Leben auf diese Stunde hin gelebt. Jetzt galt es, das Vertrauen, das die Römer in ihn setzten, zu rechtfertigen. Er vergaß die feindseligen Blicke des Kardinals Giovanni Colonna, die Pracht, die ihn geblendet hatte, ja selbst den Mann auf dem Papstthron.
Leidenschaftlich schilderte Cola die Not Roms, versicherte die unwandelbare Treue der Römer zu ihrem päpstlichen Oberhaupt und bat Clemens, der Stadt endlich eine gerechte Regierung zu geben. Seine Rede fand den Beifall der Kardinäle. Ermutigt fuhr er fort: „Seht auf diese unvergleichliche Stadt, die schon im Altertum die Ewige genannt wurde. Petrus und Paulus beherbergte sie in ihren Mauern, von Kaisern ward sie geliebt, den Päpsten vermählt. Stolz und schön war sie einst. Nun führt sie ein elendes Witwendasein. Sie, die Königin des Abendlandes, gehört jedem, der sie mit harter Hand nimmt – beutegierigen Kaisern aus dem Norden, adligen Abenteurern, Wegelagerern. Des Nachts hallen die Mauern von Verzweiflungsschreien wider: Ist’s noch nicht genug? Die Menschen verbergen sich in den Ruinen. Sie schlafen unruhig und wachen schweißgebadet auf. Es geht zu Ende mit der Welt, flüstern die Alten. Die sieben Engel gießen die Schalen des göttlichen Zorns über die Stadt und den Erdkreis aus. Durch die Straßen jagen die apokalyptischen Reiter. Ihre Namen sind Colonna und Orsini, Savelli und Gaetani, sie bringen die Pest, den Hunger, den Krieg und den Tod. Feuersbrünste erhellen die Nächte, es bebt die Erde. Ein Friedhof ist die Stadt. Aus dem Tibersumpf kriechen Krankheiten. Durch den einstigen Sitz der Päpste, den Lateran, geht der Wind. Über dem Grab des Apostels Petrus weiden die Ziegen. In verfallenen Kirchen liegen Büßer in härenen Gewändern, doch Gott antwortet ihnen nicht. Vergebens suchen Pilger Erlösung von ihren Sünden. Banditen rauben ihnen ihre Habe und oft genug auch das Leben. Die Hirten fürchten die Räuber mehr als die Wölfe, der Bauer schreitet bewaffnet hinter seinem Pflug.
Die Stadt Rom bittet den Papst, ihren rechtmäßigen Gemahl, zu ihr zurückzukehren und sie wieder auf den Thron zu setzen, der ihr als Mutter der Christenheit ziemt.
Unter Tränen bittet das Volk von Rom den Papst, die Bürger vor den ungerechten Senatoren zu schützen.
Welch ein Glanz umstrahlte die heiligen Stätten, und wie glücklich priesen sich die Römer, als im Heiligen Jahr 1300 Pilger aus dem ganzen Abendland nach Rom strömten, um den Segen des Papstes Bonifaz des Achten zu empfangen. Verkündet, so bittet das Volk von Rom, wiederum ein Heiliges Jahr. Trocknet die Tränen der Stadt durch Eure Weisheit und Eure Güte.“
Erschöpft verneigte sich Cola tief vor dem Papst. Clemens erhob sich von seinem Sitz, die Augen von Tränen gerötet. Er reichte Cola die Hand und erwiderte mit Worten, die verheißungsvoll klangen wie die Glocken am Ostermorgen. Er versprach, das Jahr 1350 zum Heiligen Jahr zu erklären, und so Gott wolle, würde er selbst den Gläubigen aus aller Welt von der Loggia des Lateran den Segen spenden. Die Klagen Roms sollten geprüft, eine gerechte Regierung würde eingesetzt werden. Wenn die Jugend Roms solche Männer wie Cola di Rienzo in ihrer Mitte habe, sei ihm um die Zukunft der Stadt nicht bange. –
Wie naiv ich doch war, denkt Cola. Ich glaubte, das Schicksal Roms hätte das Herz des Papstes gerührt, dabei überwältigte ihn nur meine Redekunst.
Er lässt sich auf das Lager zurücksinken und folgt mit seinen Augen den Fugen im Mauerwerk, das im Mondlicht matt aufschimmert. Mauern, überall Mauern! Die Reichen mauern sich in Paläste ein, und jene, die aufbegehren, darben im Kerker. Eingesperrt sind die einen wie die anderen. Dabei lehren die Ruinen Roms die Vergänglichkeit einer Macht, die, in Steinen erstarrend, den lebendigen Geist begräbt. Aber diese Erkenntnis war ihm in Avignon noch nicht gekommen. –
Als er freudetrunken dem Ausgang des Papstpalastes zuschritt, überbrachte ihm schon ein Priester die Einladung zur päpstlichen Tafel. In die Herberge zurückgekehrt, schrieb Cola überschwänglich an die Freunde in Rom: „Roma soll ihr Witwenkleid ablegen, ein purpurnes Brautgewand antun, ihr Haupt mit dem Diadem schmücken und das Zepter der Gerechtigkeit von neuem in die Hand nehmen.“ Er pries Clemens nicht nur in blumenreichen Wendungen, weil er wusste, dass die den Boten anvertrauten Briefe geöffnet wurden, sondern weil er dem Versprechen des Papstes glaubte. Die Schatten der Papstburg, die ihn zuerst geängstigt hatten, zerstoben im Glanz seines Triumphes.
Cola nutzte die Stunden, da er Clemens die Nöte Roms schildern und auf dessen kluge Fragen Bescheid geben konnte. Er sonnte sich im Licht der päpstlichen Gnade. Die Mächtigen der Stadt luden ihn an ihre Tische. Die Herzen der Männer gewann er durch sein gewandtes Auftreten, die der Frauen durch seine Schönheit.
Gelehrte und Abenteurer, fromme Männer und käufliche Frauen zog es zum Papstsitz wie die Ameisen zum Honig. Festlichkeiten wurden zelebriert, und Gottesdienste gerieten zu Jahrmärkten. Die Fantasie der kirchlichen Herren, neue Vergnügungen zu ersinnen, schien unerschöpflich. Auch Cola, jung und lebenshungrig, genoss den Sinnenrausch in vollen Zügen. Wie anders lebte man hier als in Rom, das in seinen Trümmern vor sich hin trauerte.
Freimütig sprach er über die Verderber Roms, das Geschlecht der Colonna vor allem. So unerfahren war er, dass er annahm, der Hass des Kardinals Giovanni Colonna könnte ihm nun, da er die Gunst des Papstes besaß, nicht mehr schaden. Sein Glück machte ihn blind, er übersah die Zeichen, durch die Gott ihn warnte. Da war dieser Priester im Hause des Kardinals Guido di Boulogne, der ihn nach einer lebhaften Disputation über die Rückkehr der Päpste nach Rom in einen Winkel zog und ihm zuflüsterte: „Große Gefahr geht von denen aus, die die Gewalt haben. Reise ab, Cola, ehe es zu spät ist.“ Cola lachte nur. Erst viel später hat er den traurigen wissenden Blick dieses Mannes verstanden.
Cola, der Plebejer aus einer armseligen Schenke am Tiberufer, glaubte sich geliebt und war doch nur als geistreicher Unterhalter geduldet. Jugendliche Kühnheit und Beredsamkeit sind nur willkommen, solange sie den verwelkenden Kranz der Alten mit frischen Blüten schmücken. Wehe, wenn sie ihn herunterreißen!
Während Cola kaum verhüllte Anklagen gegen den Adel Roms führte, intrigierte Kardinal Giovanni Colonna beim Papst gegen ihn. Vor die Wahl gestellt, sich mit dem Kardinal Colonna das mächtigste römische Adelsgeschlecht zum Feind zu machen oder dem Plebejer Cola di Rienzo die Gunst zu entziehen, entschied sich Clemens schweren Herzens, dem Kardinal nachzugeben. Von einem Tag auf den anderen schlossen sich vor Cola wieder die Tore des Papstpalastes. Seine Fragen blieben ohne Antwort. Selbst die Lakaien seiner mächtigen Gönner erwiderten seinen Gruß nicht mehr. Man jagte ihn von den Türen wie einen herrenlosen Hund. Bald fehlte ihm das Geld für ein Stück Brot oder für einen Becher Wein. Als er halb verhungert in der schmutzigsten Herberge Avignons lag, suchten ihn zum ersten Mal diese rätselhaften Anfälle heim. –
Sein Herz war klüger gewesen als sein Verstand. Gefangen im tödlichen Netz der Eitelkeit und Hoffart, schlug es so angstvoll und schmerzhaft, dass er darüber das Bewusstsein verlor. Damals glaubte er, Gott strafe ihn für die Sünde des Fleisches. Heute, hier in Raudnitz, weiß er: Wer hoch hinauf will, wird durch den Schmerz daran erinnert, dass er ein Kind der Erde ist.
Die Hand auf das Herz gepresst, wälzt sich Cola unruhig auf seinem Lager. Um den bedrängenden Bildern zu entfliehen, steht er auf und tritt an die Mauerluke. Der Schrei des Käuzchens ist verstummt. Cola sucht mit seinen Blicken die Sterne. Noch niemals, seit er hier oben im Norden ist, hat er sich so tief in den Anblick des nächtlichen Himmels versenkt. Unendlich fern sind die Gestirne, während sie in Rom gleichsam aus dem Horizont aufsteigen. Wie er mit brennenden Augen in die Höhe starrt, jagt plötzlich ein Stern durch das Dunkel, gleich darauf ein zweiter, die Bahn des ersten kreuzend. Ein Kreuz, denkt Cola erschauernd, ein Kreuz aus verglühenden Sternen. Ist dies ein Zeichen, Herr, und was besagt es? Cola drückt die heiße Stirn gegen die Mauer und spürt wohltuende Kühle. –
Wie ein Stern in dunkler Nacht ist ihm damals Petrarca erschienen, als er an sein elendes Lager trat und sich über ihn beugte. In seiner Verzweiflung hatte Cola, der Ausgestoßene, einen Brief an den berühmten Landsmann geschrieben. Aus seiner Dichtereinsamkeit in Vaucluse eilte Petrarca nach Avignon. Er fragte nicht viel, er schien alles zu wissen, alles zu verstehen.
Cola merkte nicht mehr, wie man ihn in das Haus eines italienischen Handwerkers im Norden der Stadt trug. Als er aus der Bewusstlosigkeit erwachte, übergab man ihm einen Brief des Dichters: „Mut! Den sicheren Freund erkennt man in der unsicheren Lage. Wenn du wieder gesund bist, vergiss nicht: Die Schlange lauert im Grase. Ich aber ziehe mich wieder nach Vaucluse zurück, die Luft in Avignon ist mir zu stickig, Francesco.“
Petrarca sorgte nicht nur dafür, dass Cola gesund gepflegt wurde. Erst Wochen später erfuhr Cola, welch unschätzbaren Dienst der gefeierte Dichter ihm, dem unbekannten Römer, erwiesen hatte.
Seit seiner Jugend mit Giovanni Colonna durch freundschaftliche Bande verbunden, suchte Petrarca den Kardinal auf und stellte ihm in lebhaften Worten vor, dass dem jungen Römer Unrecht geschehen sei. Dieser Hitzkopf Cola di Rienzo meine nicht alles so, wie er es sage. Aber er besitze einen kunstverständigen Sinn und eine ausgezeichnete Kenntnis der Altertümer. Er sei ein Gelehrter, kein Politiker. Der Kardinal möge sich selbst davon überzeugen. Petrarca rief die Großmut des Kardinals an, bat ihn, Cola zu verzeihen und ihm die Gnade des Papstes zurückzugewinnen.
Der Kardinal zauderte, als er an die strengen Weisungen seines Vaters Stefano in Rom dachte: Kein Erbarmen mit Cola di Rienzo! Schließlich versprach er Petrarca, den jungen Römer zu prüfen und diesem, sollte er aus Unbedachtsamkeit gehandelt haben, zu verzeihen.
Noch als Cola durch die Pforte des Hauses von Kardinal Colonna schritt, hielt er die Einladung für einen Irrtum. Mit angespannten Sinnen erwartete er, im nächsten Augenblick von einem der prächtig gekleideten Wächter gepackt und hinausgeworfen zu werden. Aber sie blickten nur gleichgültig an ihm vorbei. Durch einen langen dunklen Gang schritt er auf eine lichtüberflutete Türöffnung zu. Sie führte zu einem Innenhof, wie er ihn schöner noch nirgends gesehen hatte. Anmutige Säulen rahmten von vier Seiten einen Garten ein. Zwischen blühenden Orangenbäumen, tiefgrünem Lorbeer und sonnenfarbenem Ginster leuchteten Marmorfiguren, über deren glatte Körper Sonnenreflexe aus dem Wasserspiel eines nahen Brunnens zitterten und sie auf geheimnisvolle Weise belebten. Auf Säulenfragmenten ruhten die Büsten ernster Männer, und zwischen Blumen und Gräsern hingestreckt, lag ein bärtiger Flussgott, dessen erhobene Hand verlangend nach dem Brunnen wies.
Cola entfuhr ein Ausruf des Erstaunens. Er beugte sich über ein Trümmerstück, auf dem noch Reste einer alten Inschrift zu sehen waren. Mit den Fingern zeichnete er behutsam die Linien der Buchstaben nach, um so ihre vollständige Form und Bedeutung ahnungsvoll zu ertasten. Als ein Schatten auf seine Hand fiel, fuhr er erschrocken auf. Vor ihm stand Kardinal Colonna. Cola unterdrückte seine Verwirrung und sagte: „Die Heimat habt Ihr Euch ans Ufer der Rhone geholt, ein Traum von Rom ist dieser Garten.“
Der Kardinal nickte, über sein strenges Gesicht glitt der Anflug eines Lächelns. Sie gingen über die kiesbestreuten Wege, verweilten an Plastiken und Inschriften. Hingerissen von den Kunstschätzen, vergaß Cola die Feindschaft des Kardinals. Er sprach von den Altertümern Roms, zitierte die Geschichtsschreiber der Kaiserzeit, berichtete von Funden, die er selbst gemacht hatte.
„Mein Freund Petrarca übertrieb nicht, als er deine Kenntnisse des Altertums rühmte“, sagte Giovanni Colonna schließlich. Cola senkte bescheiden den Kopf, das Lob des um zwanzig Jahre Älteren freute ihn. Nun wusste er, wem er die Einladung verdankte.
Von diesem Tag an zog ihn der Kardinal gern und oft an seine Tafel. Den Gästen stellte er ihn als Kenner der römischen Geschichte vor, dessen Temperament nicht immer gottgewollte Grenzen erkenne, was man aber seiner Jugend zugute halten müsse. Cola fügte sich in seine Rolle, eingedenk der Worte Petrarcas: Die Schlange lauert im Grase. Seine Vorsicht wurde belohnt. Alle Türen Avignons öffneten sich ihm wieder. Papst Clemens überhäufte ihn mit Gunstbeweisen. Ein Sekretär des Papstes vertraute Cola an, der Heilige Vater hätte Colas schwungvolle Rede bei Tisch schmerzlich vermisst, über die Sinnesänderung Kardinal Colonnas wäre er sehr froh. –
Wie naiv ich doch war, denkt Cola wieder, während er sich zu seinem Lager zurücktastet und schwer darauf niederfällt. Ich vertraute diesem Franzosen auf dem Stuhl Petri grenzenlos, und selbst von Kardinal Colonna glaubte ich, dass seine Liebe zu Rom stärker war als seine Familienbande. Ich Narr! Aber hatte ich denn nicht Gründe genug, anzunehmen, ein befriedetes blühendes Rom diene den Interessen der Kurie ebenso wie denen der Römer?
Cola seufzt tief auf. Die Jugend hält Vernunft und Gerechtigkeit für die einfachsten Dinge der Welt und weiß noch nicht, dass es die schwierigsten sind. Zu spät begriff ich, dass jene, die ich für Freunde hielt, meine ärgsten Feinde waren. Und dennoch – es hatte alles seinen Sinn. Der Frühling des Jahres 1347 wäre nicht möglich gewesen, wenn Clemens nicht seine Hand über mich gehalten, wenn er mir in Avignon nicht den Titel eines päpstlichen Notars mit auf den Weg nach Rom gegeben hätte. Warteten die römischen Barone und ihre Spitzel in Avignon doch nur darauf, mich meine Anklagen mit Blut und Leben büßen zu lassen. Aber was sie einem Schankwirtssohn hätten ungestraft antun können, verbot sich bei einem päpstlichen Notar!
Ein Kratzen an der Tür lässt Cola aufhorchen. Noch immer hofft er, man käme, ihm zu sagen, er sei ein freier Mann. Angestrengt lauscht er, doch nun ist es wieder still. Eine Katze oder eine Ratte mag da ihr Unwesen getrieben haben. Cola schüttelt ärgerlich den Kopf.
Als er in Prag vor König Karl und seinem Hofe sprach, spürte er keine Feindschaft. Ist er wieder zu vertrauensvoll gewesen? Er ruft sich Karls Gesichtszüge ins Gedächtnis, um in ihnen Antwort auf seine Fragen zu finden. Aber es gelingt ihm nicht, sie festzuhalten. Stattdessen drängen sich ihm Bilder von Clemens auf. Hochaufgerichtet im Sattel, in kostbaren Gewändern, galant mit den Damen plaudernd, inmitten eines großen Gefolges auf der Jagd … Stolz sind seine Bewegungen und zugleich anmutig durch die Kraft seines Geistes. Er fasziniert seine Zuhörer durch ein vollendetes Zusammenspiel von Gestik, Mimik und Rhetorik. Verschwenderisch hat die Natur diesen Mann mit Gaben ausgezeichnet, nur eine versagte sie ihm: die Frömmigkeit. Mehr weltlicher Fürst als geistlicher Hirte, kennt er nur eine wirkliche Leidenschaft – die Macht um der Macht willen. Sie allein bestimmt sein Denken und Tun, sie treibt ihn, einen Cola di Rienzo bis in den entlegensten Winkel der Welt zu verfolgen.
Wird Clemens König Karl bewegen können, ihn nach Avignon auszuliefern? Wessen Gefangener ist er – der des Königs oder der des Papstes? Und welchen Unterschied macht das? Wird er noch einmal dem Kerker entkommen?
Dunkel wie diese Nacht ist die Zukunft. Sie gibt keines ihrer Geheimnisse preis, wie eindringlich Cola sie auch befragt.
Cola erhebt sich auf die Knie und versinkt in ein langes Gebet. Als er geendet hat, fühlt er sich zuversichtlich. Er ist in Gottes Gnade. Das wird ihm Kraft geben, diese neuerliche Prüfung zu bestehen. Mit siebenunddreißig Jahren hat er das Leben noch vor sich. Gott kann nicht wollen, dass sein Streiter hier vermodert oder auf dem Scheiterhaufen verbrennt, während Rom von den adligen Wölfen zerrissen wird. Morgen wird Cola Papier und Feder verlangen. Sein Wort hat ihm schon viele Türen geöffnet. Warum sollte es bei den böhmischen Herren versagen.
Cola hüllt sich in seinen Mantel und fällt in einen tiefen traumlosen Schlaf.
II
Sein Lebtag hat Bolko noch keinen solchen Gefangenen gesehen. Sooft er den Raum betritt, sitzt Cola am Tisch und schreibt. Wozu soll das gut sein? Kaum rührt er die Suppe an, die Bolko ihm auf den Tisch stellt. Lange macht der das nicht so weiter, denkt der Alte. Er trägt die Briefe zum Schlossverwalter, der sie durch Boten nach Prag bringen lässt. Die Reitknechte haben erzählt, dass der Gefangene aus dem Welschland kommt, wo er wider den Papst als König regiert haben soll. Ein Mörder ist er jedenfalls nicht, und wie ein Ketzer sieht er auch nicht aus. Eher wie ein unglücklicher Prinz. Bolko kennt zwar keinen Prinzen von Angesicht, aber in den Märchen, die ihm die Mutter in seiner Kindheit erzählt hat, kamen Prinzen vor, schön und traurig wie dieser Gefangene.
Aus Mitleid mit dem jungen Mann, der so einsam ist wie er selbst, aber auch aus Neugier spricht Bolko ein paar welsche Worte, die er während des Feldzuges Johanns des Böhmen in der Lombardei gelernt hat. Der Gefangene schaut ihn zuerst ungläubig an, dann lacht er und ist außer sich vor Freude. Seine Dankbarkeit rührt Bolko. Nun unterhalten sie sich jeden Tag miteinander, und es wird nicht mehr lange dauern, da kann dieser Cola so gut Böhmisch wie er selbst.
Bolko öffnet die schwere Tür. Erwartungsvoll sieht ihm Cola entgegen. „Eine Nachricht?“
Bolko schüttelt den Kopf. „Du musst Geduld haben.“
„Welcher Tag ist heute?“
Bolko überlegt. „Das Fest der Kreuzerhöhung“, sagt er endlich. Ungewiss, dass der Gefangene das schwierige Wort verstanden hat, fügt er hinzu: „Der vierzehnte September.“
„O allmächtiger Gott“, seufzt Cola und schlägt die Hände vors Gesicht.
Er weint, denkt Bolko verwundert, er weint ja. Das hat er nicht einmal getan, als er ihn auf Befehl des Schlossverwalters in Ketten legen musste. Bolko erträgt es nicht, wenn ein Mann weint. Er rüttelt den Gefangenen an der Schulter und sagt mehr vorwurfsvoll als neugierig: „Und du sollst ein König sein?“
Cola schaut auf. „Wer redet so?“
Bolko antwortet nicht, er blickt ihn nur lauernd an.
„Ein König? Nein. Jetzt bin ich der Elendeste unter allen Menschen. Und früher war ich ein Bauer.“
„Ein Bauer?“ Bolko mustert die Hände des Gefangenen, seine schmale jünglingshafte Gestalt. Nein, der ist niemals ein Bauer gewesen. Ein Betrüger ist er, der sich über mich lustig machen will.
Gekränkt schlurft der Alte zur Tür und schlägt sie hinter sich zu. Er hört nicht mehr, wie Cola ruft: „Bolko! So warte doch, Bolko!“
Cola steht hochaufgerichtet in der Mitte des Raumes. Er vergisst den gekränkten Bolko und die Kette an seinem Fuß. Kreuzerhöhung! An diesem Tag hat er wieder in Rom sein wollen. Vergeblich warten die Römer auf sein Zeichen zum Aufstand. König Karl wird nicht in Rom einziehen und Recht und Ordnung wiederherstellen.
Er sieht die Freunde vor sich, die Enttäuschung, vielleicht auch Verachtung auf ihren Gesichtern. Nicolo, der Sohn des Lorenzo, hat versagt. Warnten sie ihn nicht, alle Hoffnung für Rom auf den König zu setzen wie vordem auf den Papst?
Sagte nicht der greise Angelo Malabranca: Du jagst einer Illusion nach? Der kluge Pandolfuccio verhehlte nicht seine Zweifel. Der Abt Bartholomäus wollte ihn lieber im Kloster verstecken, als ihn nach Prag ziehen zu lassen. Karl ist ein Schüler von Clemens, er wird dich ihm sogleich ausliefern, prophezeite er.
Was hätte er, Cola, denn tun sollen? Verfolgt von den römischen Baronen und den Handlangern der Kurie von Avignon, blieb ihm keine andere Wahl, als beim König in Prag Hilfe zu suchen. Mit dem römischen Adel konnten er und seine Freunde vielleicht allein fertig werden, mit der Kirche nicht. Mochte das Volk ihnen auch begeistert folgen; wenn der Papst die Stadt mit dem Interdikt belegte, fiele es von ihnen ab. Keine Gottesdienste mehr in der Stadt, keine Taufen, keine Sterbesakramente, keine Pilger – das würde den endgültigen Untergang Roms bedeuten.
Cola hatte an das Schicksal Arnold von Brescias erinnert. Zweihundert Jahre ist es her, da die Römer den asketischen Propheten im Priesterrock, den Lombarden Arnold von Brescia, davonjagten, um die Aufhebung des Interdikts zu erlangen. Seit den Tagen der antiken römischen Republik hatte keiner so wie er den Mannesmut der Römer entflammt. Auf dem Kapitol predigte er wider den goldgierigen Klerus, für apostolische Armut und Sittenreinheit. Er nannte den Papst einen Brandstifter und Mörder, einen Henker der Kirchen und der Unschuld, dem weder Gehorsam noch Verehrung zukomme.
Arnold von Brescia sprach aus, was das Volk fühlte, und stärkte seinen Widerstand gegen die Kardinäle. Neun Jahre lang schleuderte er den Päpsten seine Wahrheit ins Gesicht. Der Senat schützte, das Volk vergötterte ihn.
Der angelsächsische Papst Hadrian der Vierte belegte die widerspenstige Stadt mit dem Interdikt. Nur wenige Wochen widerstand der Bürgerstolz der geistlichen Auszehrung, dann gab das Volk Arnold aus Furcht vor der Strafe Gottes preis. Denn was sollte aus den Kindern werden, die ungetauft starben, aus den Alten, denen man die Sterbesakramente verweigerte? Die Beichtstühle blieben leer, die Glocken schwiegen – und das ausgerechnet zum Fest der Auferstehung des Herrn. Auf Kaiser und Papst konnten die Römer verzichten, nicht aber auf die Tröstungen der Kirche. Arnold von Brescia büßte seinen Mut auf dem Scheiterhaufen, seine Asche schwemmte der Tiber ins Meer.
Der deutsche Kaiser Barbarossa lieferte Arnold von Brescia an den Papst aus, hört Cola den Freund Pandolfuccio sagen. Die Knie beginnen ihm zu zittern, er stützt sich haltsuchend auf den Tisch. Die Sonne malt einen blassen Lichtstreifen auf das Holz. Cola schaut zur Maueröffnung. Nicht lange mehr, und der Winter macht den Raum zu einem kalten, dunklen Grab.
Jetzt in Rom sein können! Im September ist es noch sommerlich warm, an den Hängen des Palatins blüht der letzte Oleander. Vom Meer her weht gegen Abend eine frische Brise und kühlt die Glut des Tages. Noch einmal durch die Gassen laufen, atmen, leben! In die Menge eintauchen, umhüllt von Stimmen und menschlicher Wärme – wie damals, als Venturino von Bergamo kam. Gleich Arnold von Brescia war er ein Prediger wider den Sittenverfall und die blutigen Fehden der Adligen allerorten. Sein Wort hatte Gewalt über die Herzen der Menschen. Überall, wo er predigte, gewann er Anhänger, die seinem Ruf folgten, durch Buße das Land zum Frieden zu rufen.
Von der Lombardei zog Venturino über Florenz und Perugia nach Rom. Unterwegs schlossen sich ihm Tausende an. In der Fastenzeit des Jahres 1534 marschierte durch die Porta Flaminia im Norden der Stadt ein Heer von zehntausend Pilgern ein. Die Männer trugen lange weiße Gewänder mit einem blauen Überwurf nach der Art der Dominikaner. Weithin sichtbar leuchtete auf ihrer Brust das Bild einer weißen Taube mit dem Olivenzweig im Schnabel. In der rechten Hand den Pilgerstab, in der linken den Rosenkranz, schritten sie barfüßig durch die Gassen der Ewigen Stadt, militärisch in Gruppen und Kolonnen geordnet. Da gab es kein Drängen und Schreien, kein Durcheinander, wie man es von Pilgerzügen gewohnt war. Alle schienen einem unsichtbaren Willen zu gehorchen. Das Halleluja der Pilger brachte den Waffenlärm zum Schweigen.
„Friede!“, „Barmherzigkeit!“, riefen die Schaulustigen und sanken auf die Knie.
Die Römer bestaunten Venturino von Bergamo, den feurigen Redner, dessen Worte Wunder bewirkten. Von den Rätischen Alpen bis zum Apenin sprach man von seiner Kraft: Dirnen in Büßerinnen zu verwandeln, Feinde zu Freunden zu machen, Wucherer und Räuber ihr unrechtes Gut zurückgeben zu lassen, kaltblütigen Mördern Tränen der Reue zu entlocken.
Das Volk drängte in die Kirchen. Über allen Hügeln der Stadt schwebte die Taube mit dem Friedenszweig.
Am Grabe des Apostels Petrus, in Santa Maria Maggiore und im Lateran erscholl die Stimme Venturinos: „Wendet euch vom Bösen ab! Tut Gutes! Der Heilige Geist ist nahe. Es gebührt euch nicht zu wissen Tag und Stunde, doch er wird auf euch kommen bis ans Ende aller Tage. Tut Buße und seid bereit, ihn zu empfangen. Und der Friede wird mit euch sein.“
Geißeln brannten auf dem Fleisch der Pilger, die Menschen stöhnten: Friede, ja endlich Friede. Tagelang lebte die Stadt im Taumel religiöser Ekstase. Hoffnung blühte auf allen Gesichtern.
Doch die Römer konnten nicht lange in der dünnen Luft von Buße und Vergebung leben, sie wurden nicht satt davon. Die hochgeschossenen Erwartungen verwelkten, ehe sich Früchte zeigten.
Zwei Wochen vor dem Osterfest sprach Venturino auf dem Kapitol. Bis aus Tivoli waren Neugierige gekommen, den wortgewaltigen Prediger zu hören. Einschmeichelnd klang seine Rede, voll von dunklen und aufregenden Prophezeiungen. „Heilig ist der Boden, auf dem ihr steht, er ist es wert, ihn nur mit gelösten Schuhen zu betreten“, rief er der Menge zu. Kein Papst sei seines Amtes würdig, der im fernen Avignon und nicht in Rom residiert.
Diese Worte gefielen den Zuhörern, aber sie belächelten den Dialekt des Bergamasken. Ihre aufgestaute Unzufriedenheit entlud sich in Pfiffen, als Venturino sie aufforderte, den bevorstehenden Karnevalsfreuden auf dem Monte Testaccio zu entsagen und Geld für das Pilgerheer zu spenden, dass es zur Osterzeit die Ausstellung des Schweißtuches der heiligen Veronika erleben könne. Jeder Gläubige träumte davon, wenigstens einmal im Leben jenen Schleier zu sehen, den die Heilige Jesus auf dem Weg nach Golgatha gereicht hatte, damit er seinen Schweiß an ihm trockne. Jedes Jahr zu Ostern wurde im Lateran die kostbare Reliquie gezeigt, auf der sich das Antlitz Jesu eingeprägt hatte.
Die Macht des Predigers erstarb im Unmut der Römer. Wenn die Pilger noch länger in Rom bleiben und das Schweißtuch sehen wollten, dann sollten sie dafür auch bezahlen. Um dieser Faulpelze willen auf den Karneval verzichten? Hatte Jesus nicht gesagt: Eure Freude soll euch niemand nehmen? Bislang war es immer so gewesen, dass die Pilger Geld in die Stadt gebracht hatten, diese aber forderten welches von ihr. Ein schönes Wunder, das Venturino da vollbringen wollte! Zorn und Spott wurden zum Gelächter, in dem Venturinos Stimme unterging.
Die Reihen der Pilger begannen zu wanken. Durch halb Italien waren sie gezogen, den Namen Roms wie ein Gebet auf den Lippen. Nun standen sie auf dem heiligen Boden der Stadt, und er öffnete sich nicht, die Ungerechten zu verschlingen. Wohin sollten sie sich noch wenden, damit Gott ihren Friedensruf erhörte?
Ruhmlos zerstreute sich das Pilgerheer, die Taube floh die Stadt. Wieder bekriegten sich die Adelsgeschlechter, die Banditen trieben ihr ruchloses Handwerk ärger als zuvor. Durch die Straßen tanzten die Masken des Todes. Trunkene Weiber und lüsterne Männer wälzten sich mit ihnen im Staub. Was war das elende Leben gegen eine Stunde der Lust und des Vergessens!
Ein letztes Mal sprach Venturino in der Kirche Sant’ Angelo nahe dem Kapitol: „Blind bist du, Volk von Rom! Deine Stadt wird untergehen wie einst Babylon.“ Nur wenige hörten ihm zu. Und auch diese hatten ihn schon vergessen, ehe er noch das Stadttor erreichte.
Cola spürt wieder die Erregung jener Februartage des Jahres 1334. Er hat damals nicht gezweifelt. Venturino sprach ihm aus dem Herzen. Heilig ist der Boden Roms, und nur er heiligt das Amt des Papstes. Während Cola dem Prediger in Sant’ Angelo zuhörte, bedachte er Erfolg und Misserfolg des Bergamasken. Mochten die Römer den Dominikanermönch, dem sie zuerst blind gefolgt waren, nun auch aus enttäuschten Hoffnungen verspotten, so blieb doch wahr, dass Venturino kraft seines Geistes und seines Willens Macht über Menschen besaß. Dass er diese Macht nicht festhalten konnte, wurde ihm zum Verhängnis. Er predigte ein Reich nicht von dieser Welt. Die Römer lebten aber in dieser Welt. Sie wollten nicht nur Worte hören, sondern auch Taten sehen, Taten, die Venturino und sein Pilgerheer nicht vollbringen konnten. Fromme Gesänge brachten den Papst nicht nach Rom zurück, schlugen dem Adel nicht das Schwert aus der Hand, befreiten nicht von den drückenden Steuern.
Cola traf Venturino neun Jahre später in Avignon wieder. Gealtert um mehr Jahre als vergangen, seitdem der Bußprediger Rom verlassen hatte, leuchtete sein durchscheinendes Gesicht von einem Feuer, das Krankheiten, Prozesse und Verbote nur noch heller entfacht zu haben schienen.
Papst Benedict der Zwölfte hatte Venturino wegen seiner aufrührerischen Reden vor das Kirchengericht nach Avignon befohlen. Es sprach ihn zwar vom Verdacht der Ketzerei frei, verbannte ihn aber nach einem abgelegenen Ordenskonvent in der Provence. Benedicts Nachfolger, Papst Clemens, selbst ein gefeierter Redner, gehörte zu den Bewunderern der Rhetorik Venturinos. Er hob das Urteil des Kirchengerichts auf und gestattete dem Dominikaner, öffentlich zu predigen und die Beichte abzunehmen.
Im März des Jahres 1343 hörte Cola Venturino in der überfüllten Dominikanerkirche von Avignon. Wieder faszinierte ihn dieser Mann. Nach der Messe sprach Cola mit Venturino im Kreuzgang des Klosters. Die Stimme des Mönchs sank zu einem Flüstern herab, als er sagte: „Ich ging von Rom aus nach Avignon, den Papst für mein Friedenswerk zu gewinnen.
Aus den Banditen und Landsknechten, die Italien in Unfrieden stürzen, wollte ich ein Heer von Kreuzfahrern machen, die den Orient für das Christentum zurückerobern. So wäre Italien von der Geißel des Krieges befreit worden. Benedict verwarf diesen Plan. Um seiner weltlichen Herrschaft willen fürchtete er die Macht, die von Gott kommt – die Macht des Geistes. Clemens erlaubt mir zwar jetzt, für den Kreuzzug zu predigen, jedoch nur, um seine eigenen Pläne zu verwirklichen, nicht aber, Italien den Frieden zu geben.“
Cola widersprach leidenschaftlich. „Clemens leiht Rom seinen Beistand. Der Tag ist nicht mehr fern, da wir mit der Hilfe des Heiligen Geistes die Stadt und Italien befrieden.“
Venturino schaute ihn lange an und sagte schließlich: „Was du als Berufung in dir fühlst, dem folge unbekümmert um Lob und Tadel der Welt. Wenn du die göttliche Liebe in deiner Seele spürst, dann wirst du stark in den Niederlagen und demütig in den Erfolgen sein.“
Cola vernahm nur die Ermutigung, nicht die Warnung. Sie schieden als Freunde. Wenige Jahre später starb Venturino während eines Kreuzzuges im fernen Smyrna, wo man ihn den Engel Gottes nannte. –
„Nun sind wir Brüder, Venturino“, sagt Cola, „Brüder in der Niederlage.“ Er sieht wieder das durchgeistigte gütige Gesicht des Dominikaners, und ein jäher Schmerz in der Brust treibt ihm Tränen in die Augen. Übermenschliche Anstrengungen, verwelkte Träume, zerstörte Hoffnungen … Und wofür das alles? Für Rom? Ist die große Vergangenheit dieser Stadt nicht auch ihr Fluch? Sie nährt sich vom Blut der Lebenden, bis diese, ausgesogen und zum Tode müde, ins Nichts fallen. Ihre Lockspeise ist der Ruhm, ihr Lohn das Verderben.
Der Lichtstreifen auf dem Tisch verlischt, die Dunkelheit gleitet in den Raum. Fröstelnd zieht Cola den Mantel fester um die Schultern. Ihm scheint, als höre er Venturinos Stimme: O glücklich die Seele, der Jesus im Ohr ein süßer Gesang ist und Jubel im Herzen.
Cola lächelt wehmütig und flüstert: „Wie recht du hast, Bruder Venturino. Nach ihrer Tugend und nicht nach ihrem Glück, das sie gehabt haben, werden die Menschen mit ihren Taten gemessen. Und wenn die ganze Welt gegen mich ist, so kann mich das nicht erschrecken, denn meine Mission wurde mir nicht von Sterblichen, sondern von Gott aufgetragen.“
Er denkt an die ungläubige und dann gekränkte Miene Bolkos. Wenn er Bolkos Sprache besser beherrschte, würde er ihm von Anagni erzählen.
Dort lebte Cola nach dem frühen Tod der Mutter bis zu seinem zwanzigsten Jahr als Bauer unter Bauern. Im Osten die schroffen Gipfel der Abruzzen, im Westen und Norden weite Täler mit Kornfeldern, Olivenhainen, Weiden. Klar und frisch weht die Luft vom Volskergebirge über die Weinhügel und Kastanienfelder.
Über den Häusern der Handwerker und Bauern erhebt sich das graue Schloss Bonifaz’ des Achten, zu dem Cola manchmal aufschaute, wenn er auf dem Felde arbeitete. Nachmittags lernte er bei dem Franziskanerbruder Onofrio Latein, und abends saß er oft bei den Alten und lauschte ihren Geschichten über Benedict Gaetani, der dem zum Papst gewählten Eremiten Peter von Morrone die Tiara vom Haupte riss, um sie sich als Bonifaz der Achte selbst aufzusetzen; Gaetani, der die Könige und Kaiser des Abendlandes beherrschen wollte wie einst die Cäsaren und der in Gefangenschaft starb, weil der französische König Philipp stärker war als er. Philipp widersetzte sich dem Anspruch des Bonifaz, auch im Weltlichen über dem König zu stehen, und ermutigte den römischen Adel, vor allem die Erzfeinde des Bonifaz, die Colonna, den anmaßenden Papst zu stürzen.
Cola meinte die Bäume seufzen und die Mauern stöhnen zu hören, wenn die Alten von der Tragödie erzählten, die sich anno 1305, zehn Jahre vor Colas Geburt, hier abgespielt hatte: Ein Trupp von Landsknechten, geführt von dem Franzosen Nogaret und den Brüdern Stefano und Sciarra Colonna, stürmte im Morgengrauen das Schloss. Keine Hand rührte sich, dem bedrängten Papst zu helfen, denn herrschsüchtig bis zum Verbrechen war er. Aber auch kühn über alle Maßen. Im prunkvollen Papstornat auf seinem Thron sitzend, erwartete er die frechen Eindringlinge und zuckte nicht zusammen, als Sciarra Colonna das Schwert wider ihn zog. Der sechsundachtzigjährige Greis weigerte sich, die Tiara abzulegen und sich dem französischen König zu unterwerfen. Erst nach drei Tagen besannen sich die Bürger von Anagni, was sie ihrem Papst schuldig waren, und befreiten ihn. Bonifaz dankte es ihnen nicht. Er verfluchte die Stadt, die diesen Frevel zugelassen hatte. Der unbeugsame Greis beschloss sein Leben drei Wochen später als Gefangener im Lateran. Im darauffolgenden Frühjahr erfroren in Anagni die Blüten. Was dennoch zur Ernte reifte, verdorrte auf dem Halm.
Der Nachfolger des Bonifaz, Benedict der Elfte, starb nach einer nur halbjährigen Regierung als letzter italienischer Papst in Perugia, man sagte, an vergifteten Feigen. Der französische König drängte nun auf einen willfährigen Papst, und seine Anhänger im Kardinalskollegium wählten auf den Stuhl Petri einen Franzosen. Clemens der Fünfte ließ sich in Lyon krönen. Während der Prozession, an der der französische König und viele Große Frankreichs teilnahmen, stürzte eine Mauer ein. Clemens fiel vom Pferd, seine Krone sank in den Staub und verlor ihren prächtigsten Edelstein. Zwölf Barone seines Gefolges wurden von den Trümmern erschlagen, ein Herzog starb an seinen Verletzungen.
Diese Kunde versetzte Europa in Schrecken. Man prophezeite der Kirche Unheil.
Seit 1305 regieren die Päpste in Südfrankreich nach dem Wohlgefallen des französischen Königshauses. Ihre Statthalter in Rom und im Kirchenstaat lassen den angestammten Sitz der Päpste verfallen. Sie plündern das Land aus und schleppen die Reichtümer nach Avignon, wo die Kurie prächtige Paläste baut und im Sinnenrausch lebt.
So erzählten die Alten und behaupteten, der Fluch des Bonifaz ruhe noch immer auf Anagni. Früher sei alles anders gewesen, die Ernten reicher, die Menschen fröhlicher. Jetzt verwüsteten Banden das Land, es gelte kein Recht und Gesetz als das des Stärkeren. „Mag von den Herren auch nichts Gutes kommen, so ist es immer noch besser, von einem Römer regiert zu werden als von diesen Franzosen“, meinte ein Weißbärtiger, der die Demütigung von Papst Bonifaz dem Achten noch miterlebt hatte.