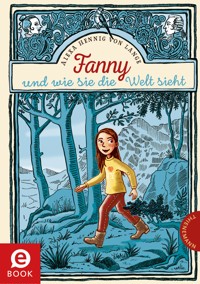6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Was, wenn wir feststellen, dass unsere Ängste überflüssig sind?« (Alexa Hennig von Lange, Marcus Jauer)
Alexa Hennig von Lange und Marcus Jauer ergründen Ängste, die jeder kennt, indem sie sich ihren eigenen Ängsten stellen: Nichts Besonderes zu sein, gefeuert, verlassen oder kritisiert zu werden. Zu versagen oder sich selbst zu verlieren. Flugangst, Hypochondrie, Zukunftsangst – auf der Suche nach Ursachen durchforsten die Autoren in abwechselnden Kapiteln ihre Kindheit und nehmen Schlüsselmomente ihres Lebens in den Blick. Charmant und selbstironisch fördert das Ehepaar universale Ängste, soziale Phobien und hartnäckige Sorgen zutage, um zu verstehen, wie Angst unseren Alltag, unser Handeln, unsere Beziehungen bestimmt, und um davon frei zu werden. In ihren Geschichten steckt die optimistische Überzeugung, dass wir unseren Gefühlen nicht hilflos ausgeliefert sind. Wenn einem die eigene Paranoia das Leben ruiniert - warum nicht entscheiden, dass es reicht? Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zu mehr Vertrauen und Mut. Und vor allem zu mehr Humor. Ein Buch für Frauen und für Männer, denen die eigenen Ängste und die des anderen bisher ein Rätsel waren.
- Das Mutmachbuch für die Generation Angst
- Große Medienpräsenz der Autoren
- Aktuelle Beispiele und persönliche Geschichten
- Im Wechsel erzählt aus Männer- und Frauenperspektive
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Alexa Hennig von Lange
Marcus Jauer
Keine Angst!
… ist auch eine Lösung
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.
Copyright © 2018 Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
Umschlaggestaltung: Gute Botschafter GmbH, Haltern am See
Umschlagmotiv: © Blueguy/shutterstock
ISBN 978-3-641-22537-7V001
www.gtvh.de
INHALT
VORWORT
Von Julia Schaaf
1. LASST MICH NICHT ALLEIN
Alexa entwirft eine mögliche Theorie, warum sie ab frühster Kindheit Verlustangst hatte.
2. DIE ANGST, KEIN ANFÜHRER ZU SEIN
Marcus erzählt davon, dass er schon im Kindergarten eine Führungsposition einnehmen wollte, und warum er Angst bekam, als er sie hatte.
3. BIN ICH WIRKLICH IN GEFAHR?
Alexa erzählt davon, dass ihre Mutter vorsichtig war und ihr Vater ein Abenteurer – trotzdem haben ihr beide Angst gemacht.
4. ICH BIN KEIN HASE!
Marcus erzählt davon, wie einmal gehörte Sätze einen jahrelang verfolgen können und wie einfach es wäre, ihrem Bann zu entkommen.
5. ANGST ODER VERNUNFT?
Alexa erzählt von ihrer kindlichen Prägung, dass überall gefährliche Keime lauern – und wie überraschend es war, dass das nicht jeder so sieht.
6. JETZT IST ALLES RUINIERT!
Marcus erzählt davon, wie der Hunger nach Anerkennung die Angst schürt, Leute zu enttäuschen, und wie schön es ist, unabhängig von der Bestätigung anderer zu sein.
7. PAPAS ANGST TUT MIR SO GUT!
Alexa erzählt davon, dass ihr Vater auch einmal Angst hatte und dass das ein ganz inspirierendes Erlebnis war.
8. BIN ICH TRÖDELIG?
Marcus erzählt davon, wie durch das panische Einhalten von Plänen die Verbundenheit verloren geht.
9. BLEIB STEHEN! ICH TU DIR DOCH NICHTS!
Alexa erzählt davon, wie sich die seltsamsten Angstreflexe weitervererben – ohne dass man es überhaupt merkt.
10. DIE ANGST, SICH VOR EINEM MÄDCHEN DIE BLÖSSE ZU GEBEN
Marcus erzählt davon, wie der Versuch, alles richtig zu machen, dazu geführt hat, dass alles falsch lief.
11. WER BIN ICH?
Alexa erzählt davon, dass man sich nur selbst findet, wenn man nicht mehr glaubt, dass die anderen besser wissen, wer man ist.
12. WENN DIE WELT ZUSAMMENBRICHT
Marcus erzählt davon, wie beängstigend es ist, wenn sich alles verändert, und worauf man dann vertrauen kann.
13. ICH ERTRAGE DAS NICHT!
Alexa erzählt davon, wie ihre Verlustangst ihr mehrere Urlaube verdorben hat, weil sie dachte, sie muss sich im Kopf für den Ernstfall vorbereiten.
14. UND WAS SOLL DARAN SCHÖN SEIN?
Marcus erzählt davon, wie viel Kraft es kostet, sein Selbstbild aufrecht zu erhalten, und wie viel Kraft es bringt, kein Selbstbild mehr zu haben.
15. GLAUBT MIR DOCH! ICH BIN UNSCHULDIG!
Alexa erzählt davon, wie sie unschuldig verurteilt wurde, aus Angst, sich wie eine Erwachsene zu verhalten.
16. ICH WILL WAS BESONDERES SEIN!
Marcus erzählt davon, wie er glaubte, dass besondere Leistungen nur durch Selbstkasteiung zu erreichen sind, und wie schön alles wurde, als er mal ganz kurz locker ließ.
17. FREI VON KONTROLLE – ROCK’N’ROLL!
Alexa erzählt davon, dass sie Angst davor hatte, von den anderen nicht gemocht zu werden, und wie unwichtig das ist.
18. ICH BIN DOCH NICHT EMPFINDLICH!
Marcus erzählt davon, dass er seinen Freunden nie etwas abschlagen wollte, bis das auf seine Kosten ging.
19. NUR ICH BIN IN GEFAHR!
Alexa erzählt davon, wie ihre Angst vor der ungewissen Zukunft dazu geführt hat, dass sie lieber gar keinen Schritt mehr tun wollte.
20. BITTE NICHT HELFEN, ICH BIN KRANK!
Marcus erzählt davon, warum er immer für andere da sein wollte, aber die anderen nicht für ihn da sein durften.
21. MEINST DU, DIE FEUERN MICH?
Alexa erzählt davon, dass Angst manchmal ein Zeichen dafür ist, dass man sich gerade verbiegt.
22. ICH TRÄUME, ICH BIN HERZCHIRURG
Marcus erzählt davon, dass an unseren Albträumen abzulesen ist, wie groß unsere Angst tatsächlich ist und dass sie – genau wie der Albtraum – nur eine Illusion ist.
23. ICH WERDE STERBEN!
Alexa erzählt von quälenden Hypochondrie-Attacken und wie wunderbar die bei genauerem Hinsehen sind.
24. DIE ANGST, NICHT MEHR JUNG UND SCHÖN ZU SEIN
Marcus erzählt davon, dass man sich nicht selbst verliert, nur weil einem die Haare ausgehen.
25. ICH NEHME JETZT DROGEN!
Alexa erzählt vom angstfreien Zustand und wie der zu erreichen ist – auch ohne Drogen.
26. DER KÖNIG VOM SCHIMPFLAND
Marcus erzählt davon, wie die Sorge, kein guter Vater zu sein, beinahe dazu geführt hätte, dass er kein guter Vater war.
27. ANGST VOR DEM FLIEGEN – LEARNING TO FLY!
Alexa erzählt von ihrem leben als Passagier und warum es nicht lohnt, da oben in zehntausend Meter Höhe Panik zu schieben.
28. DIE ANGST, SICH ZU BINDEN
Marcus erzählt davon, warum das Abenteuer, sich auf einen anderen Menschen einzulassen, viele Ängste wecken kann, aber gleichzeitig auch die beste Möglichkeit ist, über sich selbst hinauszugehen.
29. GUTEN MORGEN – ANGST IST GUT
Alexa erzählt davon, warum sie dankbar für ihre Angst ist und trotzdem kein Problem damit hat, sie für immer und ewig zu verabschieden.
30. KING KONG IST EIN NETTER, KLEINER AFFE
Marcus erzählt davon, dass man sich die schlimmsten Dämonen oft selbst erschafft und diese zahmer werden, wenn man sich ihnen in Frieden nähert.
31. DER TOD IST NICHT DAS ENDE
Alexa erzählt davon, wie sie plötzlich den Sinn des Lebens entdeckte.
32. WILDNIS
Marcus erzählt davon, dass einem die Natur oft mehr Fragen beantwortet als jahrelanges Grübeln.
VORWORT
VON JULIA SCHAAF
Ängste gehören zur emotionalen Grundausstattung des Menschen, und eigentlich handelt es sich dabei um einen großartigen Mechanismus, der uns vor akuten Gefahren retten und in Sicherheit bringen soll. Sobald wir uns bedroht fühlen, spult unser Stammhirn ein archaisches Programm ab, das alle unsere Kräfte für den Kampf oder die Flucht mobilisiert, Schnappatmung und Herzrasen inklusive. So jedenfalls erklärt die Evolutionsbiologie, was für den Steinzeitmenschen äußerst praktisch war. Schließlich konnte jedes Knacken im Unterholz bedeuten, dass sich dort gerade ein ausgehungerter Säbelzahntiger anschlich. »Leider knackt es bei den meisten von uns Menschen ziemlich oft im Unterholz«, wie Alexa Hennig von Lange schreibt: »Und zwar regelrecht grundlos.« In der bundesdeutschen Zivilisation des 21. Jahrhunderts, in der es deutlich weniger Säbelzahntiger gibt als Zahnzusatz-, Handy-Glasbruch- und Reiserücktrittsversicherungen, hat sich die Funktion der Angst in ihr Gegenteil verkehrt: Anstatt uns zu beschützen, macht sie uns das Leben schwer.
Bei Flugangst und Klaustrophobie sind wir uns im Klaren, dass wir Angst haben, im Zweifelsfall lassen wir uns verhaltenstherapeutisch behandeln. Die meisten Ängste sind weniger konkret. Verlustangst. Existenzangst. Versagensangst. Wie ein innerer Kompass beeinflussen sie unseren Alltag, obwohl die zu vermeidende Katastrophe nur in unserem Kopf existiert. Manche Ängste sind uns so peinlich, dass wir nicht einmal darüber reden. Andere sind uns gar nicht erst bewusst.
Wie prägt es das Sicherheitsgefühl eines Kindes, wenn der Vater so besessen seinem Selbstbild als Abenteurer frönt, dass die Mutter ihm regelmäßig das Leben retten muss, und er immer noch findet, sie schiebe zu viel Panik? Wann wird Angst zum hilfreichen Impuls, um Herausforderungen zu meistern, und wann blockiert sie einen? Haben Männer und Frauen eigentlich vor denselben Dingen Angst?
Alexa Hennig von Lange und Marcus Jauer ergründen Ängste, die jeder kennt, indem sie sich ihren eigenen Ängsten stellen. Auf der Suche nach Ursachen durchforsten sie ihre Kindheit und nehmen Schlüsselmomente ihres Lebens in den Blick. Sie fördern universale Ängste und individuellen Irrsinn zutage, berechtigte Furcht und krankhaften Wahn, soziale Phobien und hartnäckige Sorgen. Weil sie genau verstehen wollen, wie Angst ihr Handeln und ihre Beziehungen bestimmt, sprechen sie aus, was man normalerweise lieber für sich behält. Dabei erzählen sie abwechselnd, jeder aus seiner Perspektive, und schon daraus entstehen überraschende Erkenntnisse über das jeweils eigene und andere Geschlecht. Selten hat ein Mann anrührender gebeichtet, wie er sich in einen desinteressierten Kotzbrocken verwandelt hat aus Angst, das Mädchen seines Herzens könnte ihn verschmähen. Selten hat sich eine Frau so unterhaltsam über die eigene Hypochondrie lustig gemacht. Wer das gemeinsam liest, als Paar, kann aufhören, sich voreinander zu verstellen.
Ganz nebenbei erfährt man, dass es Ängste gibt, die objektiven Argumenten zugänglich sind, während andere sich durch keinen Fakt der Welt bekämpfen lassen. Alexa Hennig von Lange und Marcus Jauer haben keinen Ratgeber geschrieben, ihr Buch ist keine Anleitung zur Konfrontationstherapie. Angesichts des verbreiteten Selbstoptimierungswahns ist es vielmehr tröstlich, wie auch die Autoren sich im Laufe ihres Lebens immer wieder selbst im Weg stehen. Weil es einem die schönsten Toskana-Ferien verdirbt, wenn man sich als Jugendliche in die Panik hineinsteigert, der Freund könne einen verlassen. Weil es jeden Spaß an der Arbeit raubt, wenn Perfektionismus einen lähmt. Trotzdem steckt in ihren Geschichten die optimistische Überzeugung, dass wir unseren Gefühlen nicht hilflos ausgeliefert sind. Nicht, dass sie ein komplett angstfreies Dasein propagierten. Aber wenn einem die eigene Paranoia das Leben ruiniert – warum nicht entscheiden, dass es reicht? Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zu mehr Vertrauen und Mut. Und vor allem zu mehr Humor. Denn es ist nie zu spät, über die eigenen Spleens zu lachen. Dann kann die Angst einpacken.
Die Autorin arbeitet im Ressort Leben der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.
1. LASST MICH NICHT ALLEIN
ALEXA ENTWIRFT EINE MÖGLICHE THEORIE, WARUM SIE AB FRÜHSTER KINDHEIT VERLUSTANGST HATTE.
In meinem Leben habe ich schon sehr viel Angst gehabt. Um ehrlich zu sein: mehr oder weniger ununterbrochen. Ich hatte Angst vor Monstern, Hexen, Einbrechern und Kometen. Vor unheilbaren Krankheiten. Einsamkeit. Armut und Krieg. Ich hatte Angst, dumm, dick, unbeliebt, ein Opfer zu sein. Und vor unendlich vielen anderen Dingen hatte ich Angst, von denen ich gerade nicht akut bedroht wurde. Trotzdem fühlte es sich so an! Und das war schrecklich!
Als kleines Mädchen hatte ich zum Beispiel extrem große Angst, irgendwann durch ein Unglück von meinen Eltern getrennt zu werden. Dass ich sie nie wiederfinde und von da an alleine durchs Leben wandeln muss. Ohne zu wissen, wer ich bin und wohin ich soll. Ohne Liebe. Ohne Schutz. Ohne Identität. Vielleicht kam meine Angst daher, dass mein Vater meiner Schwester und mir abends mit eindrucksvoller Stimme die Märchen der Brüder Grimm vorlas. So eindrucksvoll, dass sich die bedrohlichen Bilder förmlich in unser Kinderzimmer projizierten. Ich sah Hänsel und Gretel direkt vor mir, wie sie sich im dunklen Wald ängstlich aneinanderklammerten und dachten, dass sie gleich von wilden Tieren zerfleischt werden! Ganz zu schweigen von all den anderen Märchen, die leichtfüßig mit der kindlichen Urangst spielten. Lauter Kinder, die von ihren Eltern verstoßen oder verlassen wurden und ab jetzt allein mit ein paar trockenen Brotrinden klarkommen mussten. Diese Urangst, von seinen Eltern allein gelassen zu werden, »um dann selbst hilflos einer feindlichen Umwelt und damit dem Tod, der Natur und den Unvorhersehbarkeiten des Lebens gegenüberzustehen«1, erwischte mich mit ziemlicher Wucht und sägte an meinem Urvertrauen.
Zu allem Überfluss erzählte meine Mutter auch noch beim Frühstück von ihrem schlimmen Albtraum, den sie nachts zuvor gehabt hatte. Nämlich, dass wir alle im Zoo gewesen waren, und plötzlich sei eine furchtbare, alles verschlingende Sintflut losgebrochen, die mich augenblicklich am Eisbärengehege von ihrer Hand gerissen und hinfort gespült hätte. »Du warst einfach weg!«, sagte meine Mutter mit dieser gewissen Panik in der Stimme, so, als würde sie irgendwie befürchten, dass so etwas tatsächlich passieren könnte. »Nur dein einsamer, kleiner Schuh stand noch auf einer Eisscholle.« Ich sah die Szenerie bildlich vor mir. Ich dachte: »Alles klar! Verstanden! Es ist offenbar nur noch eine Frage der Zeit, wann ich durch eine allgewaltige Macht von meiner restlichen Familie getrennt und einsam zu Grunde gehen werde.«
Die Lage wurde auch nicht besser, als meine zwei Jahre ältere Schwester mir im Sandkasten plötzlich erzählte: »Lexi, weißt du noch, als dich mal diese Frau entführen wollte?« In meinem Kopf fing es an zu rauschen. Mich entführen? Ich hörte meinen eigenen Herzschlag. Ba-bam. Ba-bam. Über mir wogten die blätterbepackten Äste unserer Akazie. Die Sonne warf kleine Lichtreflexe. Ich piepste: »Wann denn?« Und meine große Schwester berichtete mit dramatischer Miene, dass mich im letzten Sommer eine Frau hatte mitnehmen wollen, als wir zu zweit einkaufen waren. Nur die Straße runter. Meine Schwester fasste um mein sandiges Handgelenk und fixierte mich mit ihren Augen. »Die Frau meinte, ihr Mann kauft dir im Spielzeuggeschäft gerade eine Babypuppe. Aber ich habe gebrüllt und dich am Arm gezogen.«
Ich konnte mich beim besten Willen nicht daran erinnern. Aber allein die Vorstellung, dass mich fremde Menschen hatten mitnehmen wollen, um mich vielleicht in ihren Kofferraum zu sperren, gab mir den Rest.
Hinzu kam noch, dass ich an einem regnerischen Nachmittag an der Hand meiner Mutter durch die Innenstadt lief, an einer Buchhandlung vorbei, in deren Schaufenster eine große Schwarzweiß-Fotografie hing, auf dem ein kleines Mädchen in meinem Alter in einem verdreckten Kleidchen auf dem Kopfsteinpflaster lag und wahrscheinlich tot war. Wir liefen weiter, aber das Bild vergaß ich nicht mehr. Ich dachte nur: »So schnell sterben also kleine Mädchen in meinem Alter.«
Obendrauf kam dann noch das nächste literarische Meisterwerk, das uns Kindern abends vorgelesen wurde: die Geschichte vom armen David Copperfield, der als kleiner Junge von seinem kaltherzigen Stiefvater in eine weit entfernte Privatschule verfrachtet wird, während seine geliebte Mutter zu Hause immer schwächer wird und schließlich stirbt.
Ist es da nicht fast logisch, dass bei all diesen Geschichten und Bildern das Verlassenwerden eine meiner schlimmsten Ängste wurde? Oder waren es ganz andere Geschichten und Bilder, die in mir diese Urangst geweckt haben? Wäre meine Urangst sowieso geweckt worden? Weil eben jeden Tag Dinge in meinem Leben passierten, die für mich uneinschätzbar bis furchteinflößend waren? Meine Welt wurde immer größer und größer, und genau wie jedes andere Kind musste ich erst ein Gespür dafür entwickeln, wann ich in Sicherheit bin und wovor ich mich besser in Acht nehmen sollte. Zu diesem Zweck beobachtete ich mein Umfeld. Meine Eltern. Wovor fürchteten sie sich? Wovor warnten sie mich? Was passierte, wenn ich nicht aufpasste? So, wie ein entspannt grasendes Rehkitz bei der Reh-Mama beobachtet, dass es durchstarten muss, wenn es im Unterholz knackt.
Nur leider knackt es bei den meisten von uns Menschen ziemlich oft im Unterholz. Und zwar teilweise regelrecht grundlos. Das heißt, wir wittern häufig Gefahr, ohne tatsächlich bedroht zu sein. Rein prophylaktisch. Automatisch wechseln wir in den Fight-Flight-Freeze-Überlebensmodus.2 Als ginge es gerade wirklich um Leben und Tod.
Lernen wir als Kinder von unseren Eltern also gar nicht alles über Sicherheit? Sondern eher: sicherheitshalber vor allem Möglichen Angst zu haben – ohne dass wahrhaftig gerade unsere Existenz ausgelöscht werden soll? Eine Reh-Mama, die den lieben langen Tag panisch kreuz und quer über die Lichtung jagt und sich in ihrer natürlichen Umgebung nicht mehr entspannen kann, würde man vermutlich als psychisch hochgradig auffällig bezeichnen. Was ist dann mit uns?
Jagen wir nicht den lieben langen Tag kreuz und quer über unsere innere Lichtung, ohne mit dem zwitschernden Wald in friedlicher Verbundenheit zu sein – sondern nehmen ihn nur als dunkle Bedrohung wahr? Woher sollen wir denn bitte wissen, wovor wir nun wirklich Angst haben müssen, was uns Menschen wirklich bedroht, wann wir in Sicherheit sind und getrost »grasen« können – um mal in der Reh-Analogie zu bleiben? Darüber herrscht unter uns Menschen ziemlich große Verwirrung, wie mir scheint. Vor allem aber auch zwischen Männern und Frauen, die sich ja erfahrungsgemäß oft kaum einigen können, wovor man sich nun fürchten sollte und wovor nicht …
1 Karen Horney , deutsch-amerikanische Psychoanalytikerin (1885-1952).
2 In Gefahrensituationen reagieren wir Menschen mit einem Notprogramm, um unser Überleben zu sichern. Im Fachjargon heißt es: Fight-Flight-Freeze. Allerdings kommt der Modus auch bei eingebildeten Gefahren zum Einsatz. Der Betroffene kämpft, flüchtet oder erstarrt.
2. DIE ANGST, KEIN ANFÜHRER ZU SEIN
MARCUS ERZÄHLT DAVON, DASS ER SCHON IM KINDERGARTEN EINE FÜHRUNGSPOSITION EINNEHMEN WOLLTE, UND WARUM ER ANGST BEKAM, ALS ER SIE HATTE.
Als ich ein kleiner Junge war, gab es in meinem Kinderzimmer eine Tapete, die tagsüber wie eine Blumenwiese aussah. Aber sobald es dunkel wurde und ich ins Bett musste, verwandelte sich ihr Muster vor meinen Augen in einen Wolf, der mich fressen wollte. Er schien aus einem Wald herauszutreten, und je länger ich hinsah, umso näher kam er. Das war eine der Sachen, vor denen ich Angst hatte.
Ich hatte Angst vor dem Keller des Plattenbaus, in dem wir lebten, weil sich da unten der schwerkranke Herr Drechsler erhängt hatte. Ich fürchtete mich vor der Kreissäge, die bei meinem Opa im Schuppen stand, weil deren Sägeblatt, wenn er sie anwarf, so kreischte, als würde es sich gleich aus der Verankerung lösen und auf mich zurasen. Außerdem hatte ich wie die meisten kleinen Jungen Angst davor, von großen Jungs verkloppt zu werden.
Aber das waren alles Ängste, denen ich ausweichen konnte. Ich konnte mich umdrehen und sah die Tapete nicht, ich konnte den Keller meiden, mich aus dem Schuppen verdrücken und einen Bogen um den Sportplatz machen, auf dem die großen Jungs nachmittags Fußball spielten. Der mächtigsten Angst aber, die ich zu dieser Zeit hatte, schien ich nicht entkommen zu können, was daran lag, dass ich sie viel wichtiger nahm als alle anderen. Ich konnte ihr gar nicht ausweichen, ich musste mich ihr stellen. Denn sie hatte direkt mit mir zu tun. Es war die Angst, kein Anführer zu sein.
Ich war fünf Jahre alt und wechselte gerade in die Vorschulgruppe meines Kindergartens, als ich dieser Angst zum ersten Mal begegnete. Damals hörte sie auf den Namen Torsten Reich. Aber das war nur der erste Name in einer langen Kette, die vom Kindergarten über die Schule, den Sportverein und das Studium bis zu meiner ersten festen Stelle reichte. Überall, wohin ich kam, gab es einen neuen Torsten Reich, und jedes Mal quälten mich seinetwegen dieselben Fragen.
Bin ich ein Anführer? Bin ich dafür hart genug? Kann ich mich durchsetzen? Bin ich einer von den Starken oder einer von den Schwachen? Bin ich mutig, oder bin ich feige?
Als ich meinen ersten Torsten Reich traf, war er ebenfalls erst fünf Jahre alt, aber einen halben Kopf größer als ich. Er sah aus wie Gojko Mitić, der bei uns im Fernsehen immer die Indianerhäuptlinge spielte. Er hatte die gleichen dichten, braunen Haare, die ihm wie ein Helm auf dem Kopf saßen. Er war der beliebteste Junge der Gruppe und damit Anführer einer Bande, die fast alle anderen Jungen umfasste. Sie wetteiferten darum, wer ihm das schönste Spielzeug mitbrachte, sie wollten beim Mittagsschlaf neben ihm liegen, und wenn wir im Garten spielten, rannten sie ihm zum Klettergerüst nach, wo er die oberste Sprosse besetzte, ohne dass sie ihm einer streitig machte. Nur ich konnte ihn von Anfang an nicht leiden.
Was mich gegen Torsten Reich so aufbrachte, hatte nichts damit zu tun, wie er sich mir gegenüber verhielt. Denn ehrlich gesagt war er anfangs sogar ganz nett zu mir. Es lag einzig und allein daran, was er für mich darstellte. Er war der Anführer, und das ließ mir damals offenbar nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich schloss mich der Herde seiner Bewunderer an. Oder ich verbrachte meine Tage als Einzelgänger, womöglich mit den Mädchen. Beides erschien mir unvorstellbar. So kam ich schließlich auf die Lösung, ihm die Herrschaft über die Kindergartengruppe zu entreißen.
Nachdem die ersten Rangeleien zwischen uns unentschieden ausgegangen waren – die Kindergärtnerin trennte uns, manchmal gerade noch rechtzeitig, bevor ich verlor, denn Torsten Reich war tatsächlich stärker als ich –, gründete ich eine eigene Bande. Jeder kleine Junge kennt dieses erhebende Gefühl, wenn man losstürmt und sich vorstellt, dass hundert Männer hinter einem reiten.
So sollte es auch bei mir sein, in echt.
Ich umwarb zwei Jungen, die wie ich keinen richtigen Platz in der Kindergartengruppe gefunden hatten oder mit ihrem nicht zufrieden waren, und spannte sie für meine Zwecke ein. Als die Erzieherinnen uns das nächste Mal in den Garten hinausließen, stürmten wir das Hauptquartier der Torsten-Reich-Bande, wo eine riesige Rhabarberpflanze stand, die sie aus irgendeinem Aberglauben heraus verehrten, und zerstörten sie. Von da an gab es zwischen meiner und seiner Bande jeden Tag Krieg. Endlich hatte ich erreicht, woran ich bisher gezweifelt hatte, ich war tatsächlich ein Anführer geworden. Da meldete sich schon die Angst, die Position wieder zu verlieren.
Meine Eltern haben mir später erzählt, dass ich während meiner Kindergartenzeit mit nichts so sehr beschäftigt war wie mit dem Stand meiner Auseinandersetzung mit Torsten Reich. Der Ausgang dieses Kampfes schien Tag für Tag tatsächlich über mein Leben zu entscheiden – und von dieser schweren Aufgabe verständlicherweise schwer gebeugt, nahm ich jeden Morgen all meinen Mut zusammen und betrat kampfbereit unseren Gruppenraum.
Wenn ich hier unterliege, dachte ich, dann ...
Ja, was dann? Was war es, wovor ich mich so fürchtete?
Jedes Kind hat, wenn es geboren wird, naturgemäß seinen Platz in der Welt. Es ist der Platz an der Seite seiner Eltern. Aber irgendwann wird es größer, tritt ins Leben hinaus – sei es nur für ein paar Stunden in einen Kindergarten – und auf einmal sind die Eltern nicht da, und es sieht so aus, als gebe es keinen Platz mehr, der ihm für immer sicher ist. Als Junge hatte ich das Gefühl, als müsse ich mir diesen Platz erst erkämpfen und jeden Tag aufs Neue gegen die anderen verteidigen. So ging es mir, als ich fünf Jahre alt war, aber wenn ich ehrlich bin, auch noch zehn, zwanzig oder dreißig Jahre später. Ich fürchtete, meinen so hart erkämpften Platz jederzeit wieder verlieren zu können. Sonst hätten die Torsten Reichs, auf die ich noch traf, nicht immer wieder denselben Kampfmodus in mir ausgelöst.
Ich sah die Welt in Hierarchien unterteilt. Kam ich in eine neue Gruppe, fragte ich mich, welchen Platz ich darin besetzten konnte. Ich wollte eine Rolle spielen, im Kindergarten, in der Schule, der Uni, meinem ersten Job. Ich wollte ein Faktor sein, meine Umgebung prägen, den Abdruck meiner Existenz in meiner Umwelt erkennen, weil ich glaubte, nur so darin enthalten zu sein. Das mag sich stark nach dem Größenwahn eines immer noch kleinen Jungen anhören, aber dann ist es vermutlich der Größenwahn aller kleinen und großen Jungs oder eine der zentralen Fragen im Leben eines Mannes. Ich wollte, dass die anderen spürten, dass ich da war, weil das sonst so gewesen wäre, als wäre ich überhaupt nicht auf der Welt. Als würde ich, wenn ich nicht in der Mitte einer Gruppe stand, im Nichts stehen, in der Leere, in einem dunklen, konturlosen Raum ohne Echo. In etwa so, wie man sich das Weltall vorstellt, nur ohne Sterne.
Aber natürlich ließ sich meine Angst auf diesem Weg nicht besiegen. Es kam immer wieder ein neuer Torsten Reich, der meine Position zu bedrohen schien, von der offenbar alles abhing, meine Bedeutung, mein Glück, mein Leben. Nie fühlte ich mich sicher. Wo war der Ort, an dem das aufhörte?
3. BIN ICH WIRKLICH IN GEFAHR?
ALEXA ERZÄHLT DAVON, DASS IHRE MUTTER VORSICHTIG WAR UND IHR VATER EIN ABENTEURER – TROTZDEM HABEN IHR BEIDE ANGST GEMACHT.
Mein Vater hätte früher, als junger Mann, gesagt: »Angst ist was für Weicheier.« Er schien überhaupt nie Angst zu haben. Im Gegenteil! Mein Vater war extrem risikofreudig. Ständig hat er irgendwelche spannenden Sachen geplant, wie zum Beispiel eine Wattwanderung mit der ganzen Familie, ohne zu wissen, wann die Flut einsetzt. Sein enormer Drang nach Nervenkitzel bedeutete für den Rest unserer Familie, die Sommerferien in Angst und Schrecken zu verbringen. Besonders meine Mutter kam aus den Befürchtungen gar nicht wieder raus, weswegen sie bei meinem Vater als totale Spaßbremse galt. Ständig brachte sie – seinem Geschmack nach – irgendwelche überflüssigen Bedenken an. Wie zum Beispiel: »Die Kinder sind noch zu klein, um zurück zum Strand zu schwimmen, wenn die Flut kommt!«
Mein Vater verdrehte dazu nur die Augen. Um ihn also bei Laune zu halten, machten wir besagte Wattwanderung mit und versuchten, unser Unwohlsein so gut wie möglich zu verstecken. Schließlich verabscheute mein Vater Angst und ängstliche Menschen! Ich erinnere mich noch genau, wie meine Geschwister, meine Mutter und ich uns während der Wattwanderung ständig heimlich umdrehten, um zu prüfen, ob das Wasser schon kommt. Der Strand war weit weg, über uns spannte sich der wolkenlose Himmel, und plötzlich füllten sich um uns herum die Priele. Das ansteigende Wasser glitzerte lieblich in der Sonne. Ich fiepste: »Ich glaube, die Flut kommt!«
Mein Vater schüttelte nur unwillig den Kopf und meinte: »Mach doch nicht so eine Panik!« Er nahm meinen kleinen Bruder auf die Schultern und latschte einfach quer über das schlickige Watt zu einer winzigen, mit etwas Dünengras bewachsenen Sandbank, während meine Mutter plötzlich schrie: »Lauft, so schnell ihr könnt!«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: