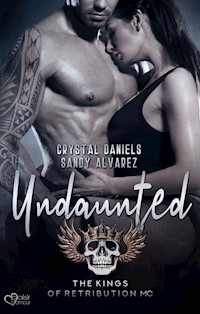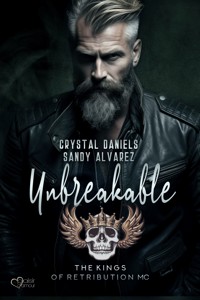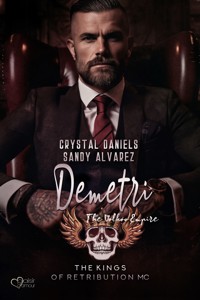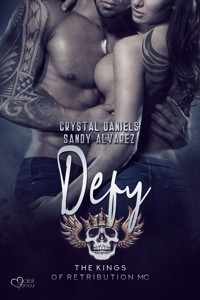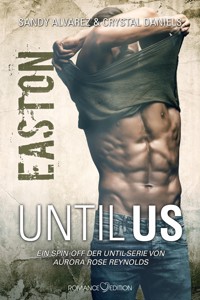Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Plaisir d'Amour Verlag
- Kategorie: Erotik
- Serie: Kings of Retribution MC
- Sprache: Deutsch
Abel "Riggs" LeBlanc ist der Präsident des Louisiana Chapters des Kings of Retribution MC. Als ehemaliges Mitglied einer Luftlande-Spezialeinheit des Militärs leitet er den Club mit der gleichen Präzision und Entschlossenheit, mit der er seinem Land diente. Jahrelang widmete er sein Leben verschiedenen Söldnermissionen und seinem Club. Sich niederzulassen und eine Familie zu gründen kam Riggs nie in den Sinn. Bis er auf Luna trifft. Einem Anruf von Jake, dem Präsidenten und Gründer des Kings of Retribution MC, folgend, machen sich Riggs und seine Männer auf den Weg nach Montana. Ihre Mission: Eine junge Frau namens Luna davor zu bewahren, in die Hände eines kriminellen MC zu fallen. Als Riggs die bezaubernde Frau mit den violetten Augen erblickt, wird sie sein Leben für immer verändern. Ohne Familie im Pflegesystem aufzuwachsen ist für jedes Kind schwer. Für Luna Novak war das Überleben in diesem System die schrecklichste und einsamste Erfahrung ihres Lebens, weil sie die Welt um sich herum nicht hören kann. Voller Hoffnung auf eine bessere Zukunft begeht sie den Fehler, ihr Vertrauen und ihr Herz dem falschen Mann zu schenken - was Luna fast das Leben kostet. Um zu überleben, muss Luna ihre Heimat hinter sich lassen und ein neues Leben in Polson beginnen. Als ihre Vergangenheit sie auch dort einholt und das Leben der Menschen um sie herum bedroht, findet sich Luna unter dem Schutz des Kings of Retribution MC wieder. Riggs möchte, dass Luna, die schnell das Wichtigste in seinem Leben wird, ihm vertraut und sich ihm öffnet. Obwohl Lunas Herz spürt, dass Riggs sie beschützen wird, sind ihre Schuldgefühle, dass sie die Menschen, die ihr beistehen, in Gefahr bringt, zu groß. Ihre einzige Überlebenschance ist nun, gemeinsam mit Riggs nach Louisiana zurückzukehren. Teil 11 der packenden Reihe rund um den Kings of Retribution Motorcycle Club der USA Today-Bestsellerautorinnen Sandy Alvarez und Crystal Daniels.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Crystal Daniels & Sandy Alvarez
Kings of Retribution MC Teil 11: Riggs (Louisiana Chapter)
Aus dem Amerikanischen ins Deutsche übertragen von Sandra Martin
© 2019 by Crystal Daniels & Sandy Alvarez unter dem Originaltitel „Riggs (Kings of Retribution Louisiana Book 1)“
© 2024 der deutschsprachigen Ausgabe und Übersetzung by Plaisir d’Amour Verlag, D-64678 Lindenfels
www.plaisirdamour.de
© Covergestaltung: Sabrina Dahlenburg
(www.art-for-your-book.de)
ISBN Print: 978-3-86495-702-4
ISBN eBook: 978-3-86495-703-1
Alle Rechte vorbehalten. Dieses Buch oder Ausschnitte davon dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herausgebers nicht vervielfältigt oder in irgendeiner Weise verwendet werden, außer für kurze Zitate in einer Buchbesprechung.
Dieses Werk ist frei erfunden. Die Personen, Orte und Handlungen in diesem Buch sind fiktiv und entspringen der Fantasie des Autors. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen ist rein zufällig.
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Autorinnen
Kapitel 1
Riggs
Scheiße, hier ist es heißer als in der Hölle. Mit dem Handrücken wische ich mir den Schweiß von der Stirn und spähe durch den Sucher meines Gewehrs. Mehrere Männer befinden sich in dem Lager, das wir gestern mithilfe unserer Drohnen ausspioniert haben. Es liegt mitten im Nirgendwo im Dschungel Mittelamerikas, aber ich befinde mich voll und ganz in meinem Element. Seit fast zehn Jahren erledige ich Aufträge für die Regierung meines Landes und gelegentlich auch für zivile Kunden. Einmal Soldat, immer Soldat. Ich bin verdammt gut in meinem Job. Also nutze ich meine Fähigkeiten, um den Menschen beizustehen, die meine Hilfe brauchen.
Ich werfe einen Blick über meine linke Schulter und sehe, wie mein Bruder Wick ein paar Proteinriegel und zwei Flaschen Wasser aus seinem Rucksack fischt. Während ich die Waffe weiterhin auf das Ziel richte, ducke ich mich hinter den umgestürzten Baum, der mir als Deckung dient. Wick wirft mir mein Abendessen zu. „Wie sieht der Plan aus?“, fragt er, als ich die Packung aufreiße und in den Proteinriegel beiße.
Seit zwei Wochen sind wir diesen Mistkerlen auf den Fersen und warten darauf, dass sie uns endlich zu den Mädchen führen, die sie an den Höchstbietenden verkaufen wollen. Ihre Kunden sind reiche Arschlöcher, die sich an Minderjährigen aufgeilen oder Sexhandelsringe betreiben.
Wick und ich haben Dinge gesehen und erlebt, die sich die meisten Menschen in ihren schlimmsten Albträumen nicht ausmalen können. Teilweise haben wir die Opfer der Menschenhändler in einem verheerenden Zustand aufgefunden, den man mit Worten kaum beschreiben kann. Derartige Einsätze machen mir am meisten zu schaffen. Die Bilder suchen mich immer noch heim. Jedes Mal, wenn ich einen dieser kranken Wichser seiner gerechten Strafe zuführe, durchströmt mich eine tiefe Befriedigung. Ich empfinde keinerlei Reue, wenn ich ihre Seelen auf direktem Weg ins Fegefeuer schicke.
Ich esse einen weiteren Bissen von meinem Eiweißriegel und blicke hinauf in den Himmel. Die Sonne ist fast hinter dem Horizont verschwunden. „Nimm Kontakt mit Tequila auf. Richte ihr aus, dass wir unser Ziel gefunden haben und gib ihr die Koordinaten für den Treffpunkt durch.“
Wick dreht den Verschluss seiner Wasserflasche auf und nimmt einen Schluck, dann gießt er sich etwas davon ins Gesicht, um sich in der schwülen Abendluft etwas abzukühlen. „Da ist eine Lichtung auf der anderen Seite des Flusses, die sich als Treffpunkt eignen würde. Was denkst du?“, fragt er und schlingt hungrig seinen Snack hinunter. Ich ziehe meine Karte hervor und breite sie auf dem Waldboden aus.
„Gute Wahl, Bruder. Schick ihr die Koordinaten. Wir setzen uns erst in Bewegung, wenn wir die exakte Ankunftszeit kennen.“ Auf meine Worte hin zieht Wick das Satellitentelefon aus der Halterung.
Seit unserer Ausbildung bei den Spezialkräften sind Malik Dawson und ich ein Team. Ich vertraue ihm blind. Im Gegensatz zu mir hat Dawson seinen Spitznamen vor ein paar Jahren erhalten, nachdem wir den Club in Louisiana gegründet hatten. Unsere Brüder nannten ihn John Wick, wie den Actionhelden aus der Filmreihe, nachdem sie einige der Geschichten über seine Kampfeinsätze gehört und ihn ein paar Mal in Aktion erlebt hatten.
Malik ist ein fast zwei Meter großer Hüne und fährt eine nachtblaue Fat Bob Harley. Er ist ein wahrer Waffenexperte, verfügt über unübertroffene Fähigkeiten im Nahkampf und ist der beste und schnellste Schütze, den ich kenne. Zudem spricht er drei Fremdsprachen und ist ein mathematisches Genie. Vor allem ist er jedoch mein Bruder und Freund. Ich würde mein Leben für ihn geben. Und er ist der beste Vizepräsident, den ein Club sich nur wünschen kann.
„Der Hubschrauber wird auf der anderen Seite des Flusses um ein Uhr landen“, informiert Wick mich. „Sind die Sprengladungen bereit?“, fragt er, woraufhin ich die Lippen zu einem Lächeln verziehe und den Rucksack neben mir tätschle. Immer wenn sich mir die Gelegenheit bietet, etwas in die Luft zu jagen, gerät mein Blut in Wallung. Wick wirf einen Blick auf seine Armbanduhr. „Wir haben noch sechs Stunden, bis wir am Treffpunkt sein müssen.“
Ich öffne meine Flasche und trinke etwa die Hälfte des Wassers mit gierigen Zügen. Dann ziehe ich ein Halstuch aus einer kleinen Seitentasche meines Rucksacks, befeuchte es mit der Flüssigkeit und wische mir damit über Gesicht und Nacken. „Wir werden mindestens zwei Stunden brauchen, um in das Gebäude zu gelangen, in dem die Frauen untergebracht sind, und sie danach zu der Lichtung zu bringen.“ Mein Blick fällt auf Wick, der mit seinem Fernglas über den Baumstamm in Richtung des Lagers späht.
„Zwei der Männer sind am Tor postiert. Sie scheinen abwechselnd um den Zaun zu patrouillieren, der das Grundstück umgibt. Ich habe beobachtet, wie die anderen drei in das kleinere Gebäude auf der anderen Seite des Lagers gegangen sind.“ Wick wendet sich mir zu. „Der Zeitplan ist verdammt knapp bemessen. Später soll ein weiterer Konvoi eintreffen, um die Frauen abzuholen. Vor dessen Ankunft müssen wir wieder draußen sein.“
„Kein Problem, Bruder“, erwidere ich. „Wir brechen in vier Stunden auf. Sobald es dunkel wird, machen wir uns auf den Weg zu der anderen Straße, die zu dem Lager führt. Ich werde dort einen Sprengsatz platzieren. Wir müssen die Frauen über den Fluss bringen. Die Brücke ist alt und extrem instabil, aber sie ist der einzig sichere Ausweg.“
Wick nickt mir zu. „Freiheit den Unterdrückten.“ Wir stoßen unsere Fäuste gegeneinander.
Einige Stunden später machen wir uns mit unseren Waffen im Anschlag auf den Weg zu der unbefestigten Straße, die ins Lager führt. Ich platziere einen der drei Sprengsätze aus meinem Rucksack direkt unter der behelfsmäßigen Brücke, die die Kerle gebaut haben, um mit ihren Fahrzeugen den schmalen Bach überqueren zu können, der ihren Weg kreuzt. Sollte der Konvoi früher als erwartet eintreffen, werden wir sie damit zwar nicht aufhalten können, aber es wird uns etwas Zeit verschaffen. Im Schutze der Nacht bewegen Wick und ich uns durch die Bäume entlang der Straße und verschmelzen hinter dem dichten Gebüsch mit den Schatten.
Im Lager ist es ruhig. Die beiden Wachmänner stehen mittlerweile vor dem Tor. Perfekt. Indem ich eine Faust hebe, gebe ich Wick das Signal anzuhalten. „Schalten wir die Kerle aus. Wir treffen uns an der Nordseite des Gebäudes, in dem die Frauen untergebracht sind“, flüstere ich.
Wir trennen uns und ich visiere den Kerl an, der sich gerade an den Rand der Lichtung gestellt hat, um auszutreten. Beim Pinkeln zu sterben ist zwar kein schöner Tod, aber … Ich schleiche mich an den ahnungslosen Mann heran und presse meine behandschuhte Hand auf seinen Mund. Mühelos ramme ich ihm mit der anderen Hand ein Messer zwischen die Rippen. Dann ziehe ich es lautlos wieder heraus. Eine Kugel wäre schneller gewesen, aber auch die leiseste Pistole ist noch zu laut, und wir dürfen kein Risiko eingehen. Ich halte den Mann fest, bis ich spüre, wie das Leben aus ihm weicht und er zusammensinkt. Daraufhin schleife ich den leblosen Körper ein Stückchen in den Wald hinein und verberge ihn im dichten Farn.
Als ich die Nordseite des Gebäudes erreiche, das aus Schlackensteinen und einem Blechdach besteht, hockt Wick bereits dort und wartet auf mich. „Die Tür ist verschlossen und wird von einer hellen Lampe beleuchtet. Wenn wir versuchen, das Schloss zu knacken, riskieren wir, entdeckt zu werden. Aber auf der anderen Seite befindet sich ein Fenster“, erklärt Wick und zeigt mit dem Kinn in besagte Richtung. „Mit meinen breiten Schultern passe ich nicht durch die Öffnung, aber wenn du einen Teil deiner Ausrüstung ablegst, wirst du dich hindurchquetschen können.“
Verdammt. Das wird uns Zeit kosten, aber er hat recht. Wir können uns unmöglich durch die Tür Zutritt verschaffen. Ich lege also meine Ausrüstung ab und lehne sie gegen die Außenwand des Gebäudes. „Mach mir eine Räuberleiter, Bruder.“ Ich trete mit meinem gestiefelten Fuß in seine verschränkten Hände und greife nach dem Sims. Dann ziehe ich mich hoch, während Wick mich nach oben stemmt. Vorsichtig spähe ich durch das Fenster. Bis auf den schwachen Schein des Mondes, der durch die Öffnung fällt, ist es im Inneren stockdunkel. Als ich mich mit dem Kopf voran hineinhieve, steigt mir sofort der Gestank von Urin in die Nase. Ich suche nach etwas, an dem ich mich hineinziehen kann und entdecke die behelfsmäßigen Dachbalken aus billigem Holz, an denen die Wellblechplatten befestigt sind. In einem unbequemen Winkel strecke ich einen Arm über den Kopf und bin in der Lage, mich mit den Fingerspitzen an einem der Balken festzuhalten. Mit der anderen Hand stemme ich mich unterhalb meiner Taille gegen die Wand und schaffe es, mich durchs Fenster zu schieben, ohne kopfüber auf den Boden zu prallen.
Ich lasse mich auf die Füße fallen und warte einen Moment, bis sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben. Im ersten Moment scheint der Raum leer zu sein, doch dann nehme ich eine Bewegung rechts von mir wahr. Ich ziehe eine kleine Taschenlampe hervor und schalte sie an. Zusammengekauert in der hintersten Ecke starren mich mehrere schmutzige, verängstigte und tränenverschmierte Gesichter an. Beschwichtigend strecke ich eine Hand vor mir aus und spreche leise und mit Bedacht, um die Mädchen nicht zu erschrecken. „Ich will euch helfen.“ Als ich einen Schritt vortrete, öffnet eine der jungen Frauen den Mund, um zu schreien, doch sofort presst eine andere ihr eine Hand auf die Lippen. Ich nicke dem beherzten Mädchen anerkennend zu. „Wie viele seid ihr?“, frage ich.
„Zwölf“, antwortet es. Ihre Stimme ist kaum lauter als ein Flüstern.
„Ich werde eine nach der anderen aus dem Fenster heben. Mein Kamerad wartet draußen und wird euch auffangen. Wenn ihr am Leben bleiben wollt, stellt ihr keine Fragen und gebt keinen Ton von euch. Tut, was wir euch sagen. Verstanden?“ Langsam nicken die Mädchen und durchqueren dann leise den Raum. Die beherzte junge Frau übernimmt die Führung und drängt das erste Mädchen unter das Fenster. Mir rutscht das Herz in die Hose, als ich sehe, wie jung es aussieht. Die Kleine kann nicht älter als zwölf sein. „Bist du bereit?“, flüstere ich ihr zu. Sie hat Tränen in ihren strahlend blauen Augen, als sie zu mir aufblickt. Ich schiebe ihren zierlichen Körper durch die Öffnung. Sobald ihre Füße verschwunden sind, hebe ich das nächste Mädchen hoch. Eines nach dem anderen krabbelt durch die Öffnung, bis ich allein im Raum zurückbleibe. Ich nehme Anlauf und springe an der Wand empor, sodass ich den Sims ergreifen kann. Dann ziehe ich mich hoch und werfe einen Blick nach draußen. Die Mädchen sitzen entlang der Außenwand in der Hocke, während Wick Wache hält.
Er weiß, dass ich Hilfe brauche, also schiebt er sein Gewehr auf den Rücken, streckt die Arme nach mir aus und zieht mich durch das Fenster. Sobald ich mit beiden Beinen wieder fest auf dem Boden stehe, lege ich meine Ausrüstung wieder an. Dann wende ich mich den Frauen zu. „Wisst ihr noch, was ich gesagt habe?“
Sie nicken und tun wie geheißen. Jedes Mal, wenn wir vorwärtsschleichen, setzen sie sich in Bewegung und wenn wir in Deckung gehen, ducken sie sich ebenfalls.
Der Sicherheitszaun stellt kein Problem für uns dar. Nachdem Wick und ich den Maschendraht in Rekordzeit durchtrennt haben, ziehen wir die beiden Enden auseinander, sodass die Frauen hindurchschlüpfen können, bevor wir ihnen auf die andere Seite folgen. Eigentlich hätte die Wanderung zum Fluss nicht länger als dreißig Minuten gedauert. Aber mit zwölf jungen, mutigen Frauen, die aufgrund der körperlichen Misshandlungen und des Nahrungsentzugs geschwächt sind, brauchen wir deutlich länger. Bereits nach fünfzehn Minuten sind zwei der Frauen, darunter das jüngste der Mädchen, nicht mehr in der Lage, selbstständig weiterzugehen, also müssen Wick und ich sie den Rest des Weges tragen.
Als die Brücke über den Fluss in Sicht kommt, beginnt es zu regnen. Die Konstruktion ist zwar alt, aber zu Fuß durchaus begehbar, also setzen wir unseren Weg fort. Sobald wir auf der anderen Seite sind, versammle ich die Frauen um einen großen Baum und hole ein paar Notfall-Wärmedecken aus meinem Rucksack, um sie vor dem Unwetter zu schützen. „Wie lange dauert es bis der Hubschrauber eintrifft?“, frage ich Wick.
Er wirft einen Blick auf seine Uhr. „Noch eine Stunde.“
„Ich gehe noch einmal zurück. Da die Frauen jetzt in Sicherheit sind, will ich diese Mistkerle ein bisschen aufrütteln.“ Ich drücke ihm einen kleinen Fernzünder in die Hand. „Ich bringe eine dritte Sprengladung an die Brücke an. Falls du in Schwierigkeiten gerätst, bevor ich zurück bin, jagst du die Brücke in die Luft und holst sie hier raus.“ Mit einem Nicken zeige ich auf die Mädchen. „Verstanden?“, frage ich Wick, der die Zähne so fest zusammenbeißt, dass die Muskeln in seinem Kiefer zu zucken beginnen. Er weiß, dass wir bei jedem Einsatz willentlich unser Leben aufs Spiel setzen.
„Verstanden“, presst er schließlich hervor.
Verdammt. Mittlerweile schüttet es wie aus Eimern, sodass meine Sicht stark eingeschränkt ist. Nichtsdestotrotz schaffe ich es, durch das Loch im Zaun zurück zum Lager zu gelangen. Von den anderen Männern ist weit und breit nichts zu sehen, also laufe ich hinter das kleine Gebäude, in dem sie sich vermutlich aufhalten. Ich ziehe meinen Rucksack vom Rücken und fische den letzten Sprengsatz heraus. Im Gegensatz zu dem Schuppen, in dem sie die Frauen untergebracht hatten, steht dieses Haus auf etwa sechzig Zentimeter hohen Stelzen – hoch genug, damit ich darunter hindurchkriechen kann. Ungefähr in der Mitte platziere ich den Sprengstoff zwischen zwei Holzbalken. Als ich wieder hinauskrabbele, höre ich, wie die Tür zugeschlagen wird und erblicke den Strahl einer Taschenlampe, der den Boden erleuchtet. Geduckt beobachte ich, wie ein Kerl mit einem Rucksack über der Schulter über den Hof läuft und den Zaun absucht. Wahrscheinlich ist er auf der Suche nach den beiden Männern, die zuvor dort Wache gehalten haben.
Um unbemerkt zum Zaun zu gelangen, warte ich, bis er sich ein paar Meter entfernt hat, bevor ich loslaufe. Etwa auf halbem Weg höre ich Schüsse. Kugeln fliegen mir um die Ohren und schlagen auf dem Boden vor meinen Füßen ein. In der Ferne sind Scheinwerfer durch die Bäume zu sehen. Offenbar ist der Konvoi tatsächlich früher dran. Aber darauf bin ich vorbereitet. Ich hechte hinter das Gebäude, in dem die Frauen gefangen gehalten wurden, ziehe den Fernzünder aus der Tasche, klappe die Abdeckung auf und drücke den Knopf. Der Sprengsatz an der kleinen Brücke explodiert und ein Feuerball erleuchtet den Nachthimmel. Mir ist klar, dass die verbliebenen Männer aus dem anderen Haus flüchten werden, also zünde ich auch den anderen Sprengsatz unter den Bodendielen. Trümmer und Splitter fliegen in alle Richtungen.
Ich raffe mich auf, haste zum Zaun und werfe meinen Rucksack auf die andere Seite, bevor ich durch das Loch im Maschendraht krieche. Ohne mich umzudrehen, laufe ich durch das Dickicht. Schon bald werden die Kerle feststellen, dass die Mädchen nicht mehr da sind, daher muss ich so viel Abstand wie möglich zwischen mich und das Lager bringen. Der Waldrand kommt gerade in Sicht, als hinter mir Gewehrsalven ertönen. Um mich herum schlagen Kugeln in die Bäume ein und lässt die Rinden splittern.
Ich beschleunige mein Tempo.
In dem Moment, in dem mein Fuß die erste Brückenplanke berührt, durchzuckt ein stechender Schmerz meinen linken Oberschenkel. Ich weiß, dass ich getroffen wurde, aber ich kämpfe mich vorwärts, als Wick das Feuer erwidert. Mit jedem Schritt schießt ein brennender Schmerz durch mein Bein. Um mich herum fliegen Schüsse durch die Luft, schlagen auf der Wasseroberfläche ein und prallen auf den Boden. Dann stürze ich von der Brücke.
Ich kann die Explosion hören, bevor ich sie fühle.
Dann spüre ich die Hitze an meinem Rücken.
Die Druckwelle schleudert mich zu Boden und presst mir die Luft aus der Lunge. Mit den Händen schütze ich meinen Kopf vor herabfallenden Trümmern. Nachdem ich einmal tief durchgeatmet habe, stemme ich mich auf die Knie. Für einen Moment verharre ich in dieser Position und warte, bis ich wieder Herr meiner Sinne bin. Ich spüre, wie jemand einen Arm um meine Taille schlingt und mich auf die Füße zieht. Mit Wicks Hilfe schaffe ich es auf die andere Seite der Lichtung.
Dort angekommen, setzt er mich auf dem Boden ab und begutachtet meinen Oberschenkel. Er reißt mein Hosenbein auf und legt die Wunde frei. „Der Blutverlust ist minimal. Sieht nach einem sauberen Durchschuss aus.“ Er setzt seinen Rucksack ab, holt den Erste-Hilfe-Kasten heraus und drückt Mull auf die Eintritts- und Austrittswunde, bevor er einen Druckverband anlegt. Es tut verdammt weh, aber der Schmerz erinnert mich daran, dass ich noch am Leben bin und dem Tod heute ein Schnippchen geschlagen habe.
„Du bist ein verdammter Glückspilz“, sagt Wick und lässt sich neben mir auf den Boden fallen.
„Danke, dass du mir den Rücken freigehalten hast, Mann.“ Für einen Moment sitzen wir schweigend da und sehen dabei zu, wie die Brücke niederbrennt.
Es dauert nicht lange, bis in der Ferne das Dröhnen des Transporthubschraubers zu hören ist. Nachdem die Maschine gelandet ist, helfen wir den Frauen beim Einsteigen. Sobald wir ebenfalls an Bord sind, wirft das jüngste Mädchen ihre Arme um meinen Hals. Sie sagt kein Wort, doch das ist auch nicht nötig. Nachdem sie ihren Platz neben den anderen eingenommen hat, vergewissert Wick sich noch einmal, dass alle anwesend sind, bevor wir uns anschnallen. Ich stülpe mir die Kopfhörer über die Ohren, damit ich mit der Pilotin kommunizieren kann.
Ohne sich umzusehen, hebt Tequila ab. „Gute Arbeit, Sir“, lobt sie mich.
„Verstanden.“ Ich lehne meinen Kopf zurück, schließe die Augen und versuche, den Druck in meinem Schädel zu lindern. „Bring uns nach Hause.“
Kapitel 2
Luna
Die Welt um mich herum ist lautlos. Ich höre nichts, aber ich spüre alles. Und in diesem Moment tut mir alles weh. Mein ganzer Körper schmerzt, als ich durch die ruckartigen Bewegungen des Wagens hin und her gerüttelt werde.
Ich befinde mich im Kofferraum.
Nach ein paar Minuten kommt das Fahrzeug zum Stehen und ich spüre die Vibrationen der Türen, die geöffnet und zugeschlagen werden. Einen Moment später schlägt mir die kühle Nachtluft ins Gesicht und jemand hebt mich aus dem Kofferraum.
Ich liege schlaff in seinen Armen, während ich die Schritte zähle – eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn.
Dann lässt er mich wie eine Stoffpuppe einfach fallen. Als ich auf den Boden pralle, habe ich das Gefühl, als würde mein Körper von tausend Nadelstichen malträtiert. Ich bekomme kaum noch Luft und bin zu schwach, um die Augen zu öffnen. Mir entfährt ein Stöhnen. Obwohl ich es nicht hören kann, weiß ich, dass ich mit dem Laut auf mich aufmerksam gemacht habe. Ich hebe die Lider an und erblicke Pike, den Bruder meines Lebensgefährten. Er starrt mich an und ich lese von seinen Lippen ab.
„Scheiße, Mann. Sie ist noch am Leben.“
Mein Blick wandert zum Wagen, als Rex auf der Beifahrerseite aussteigt und mit energischen Schritten und verärgerter Miene auf mich zuschreitet. Mir schlägt das Herz bis zum Hals, während ich seinen Mund fixiere.
„Nicht mehr lange“, sagt er. Auf seinem Gesicht spiegelt sich ein Ausdruck wider, den ich noch nie zuvor bei ihm gesehen habe. Er mustert mich, als sei ich ein Insekt, das es zu zerquetschen gilt. Dies ist nicht derselbe Mann, der mich in den letzten Monaten zärtlich umsorgt hat. Der Mann, der mir jeden Wunsch von den Augen abgelesen hat, während er mir das Gefühl gab, etwas Besonderes zu sein. „Du hättest dich um deine eigenen Angelegenheiten kümmern sollen, Luna. Was für eine Schande.“ Rex verzieht die Lippen zu einem höhnischen Grinsen und geht vor mir in die Hocke, um sicherzustellen, dass ich jedes Wort verstehen kann. Im nächsten Augenblick baut er sich wieder zu seiner vollen Größe auf und tritt mir gegen den Kopf. Brennende Schmerzen schießen durch meinen Schädel, bevor ich von Dunkelheit umhüllt werde.
Ich fühle mich, als wäre ich in einem dunklen Tunnel gefangen, aus dem es keinen Ausweg gibt. Mit aller Kraft öffne ich die Augen und werde von einem grellen Licht geblendet. Schnell schließe ich die Lider wieder, bevor ich sie erneut anhebe. Diesmal klärt sich meine Sicht. Ich erkenne einen Infusionsbeutel, der rechts über meinem Kopf hängt, und bin mir ziemlich sicher, dass ich mich in einem fahrenden Wagen befinde. Plötzlich erscheint ein Mann über mir. Ich konzentriere mich auf sein Gesicht, als er beginnt, die Lippen zu bewegen. „Ma’am, wie heißen Sie?“ Meine Hände fühlen sich jedoch an wie Blei. Ich habe einfach nicht die Kraft, um sie zu heben und dem Fremden zu antworten. Die Schmerzen sind unerträglich und ich bin dankbar, als die Dunkelheit mich erneut in ihre Arme schließt.
Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit verstrichen ist, als ich ruckartig erwache. Panik erfasst mich und ich versuche vergeblich, mich zu bewegen. Mir tut alles weh. Ein Mann presst seine Hände an meine Schultern, um mich vom Aufsetzen abzuhalten, während er beruhigend auf mich einredet. „Miss, Sie befinden sich im Krankenhaus. Alles wird gut.“ Ich konzentriere mich auf seinen Mund und blinzle wiederholt. Langsam wird das Bild schärfer und der Nebel um meinen Verstand lichtet sich, während ich versuche zu begreifen, was vor sich geht.
Der Mann trägt einen weißen Kittel. Offenbar ist er Arzt. Neben ihm steht eine Krankenschwester mit grauen Haaren, die ihr bis zum Kinn reichen. Sie trägt einen blauen Kittel. Ich entspanne mich ein wenig und der Arzt löst seinen Griff. Plötzlich überkommt mich eine Woge der Übelkeit und ich beginne zu würgen. Die Krankenschwester rollt mich schnell auf die Seite und ich entleere meinen Mageninhalt auf dem Boden. Durch die Anstrengung zerspringt mein Schädel fast vor Schmerzen. Wieder verschwimmt mir die Sicht vor Augen und ich werde in einen dunklen Tunnel zurückgestoßen.
Als ich die Augen wieder öffne, weiß ich im ersten Moment nicht, wo ich bin. Dann lasse ich den Blick durch das Krankenzimmer schweifen und meine Erinnerung kehrt zurück.
Mitten in der Nacht wache ich auf. Die andere Seite des Bettes ist leer. Ich setze mich auf und warte einen Moment, bis meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt haben. Dann schlage ich die Decke zurück, steige aus dem Bett und schnappe mir meine Schlafshorts und mein T-Shirt vom Boden. Ich ziehe beides an, reibe mir den Schlaf aus den Augen und trotte zur Tür. Ich spähe in den Flur hinaus und sehe, dass alles ruhig ist. Zuweilen sind die Partys hier bis in die frühen Morgenstunden im Gange, doch heute scheint es so, als schliefen schon alle. Als ich den Gemeinschaftsraum betrete, fällt mein Blick auf einige der Clubmitglieder. Einer liegt auf dem Sofa, ein anderer auf dem Billardtisch und eine Handvoll Männer und Frauen auf dem Boden. Ich umrunde sie, gehe an der Bar vorbei und weiter den Flur entlang. Gerade als ich die Küche betreten will, sehe ich, dass in Rex’ Büro am Ende des Gangs noch Licht brennt. Mit einem Lächeln schlendere ich darauf zu. Die Tür steht einen Spaltbreit offen und ich spähe hinein. Augenblicklich erstirbt mein Lächeln. Vor meinem Lebensgefährten kniet ein Mann in einem Anzug, dessen Hände auf den Rücken gefesselt sind.
Seine Lippen bewegen sich, doch aus diesem Winkel kann ich nicht erkennen, was er sagt. Währenddessen hält Rex eine Waffe auf seinen Kopf gerichtet. Ohne Vorwarnung verzieht er die Lippen zu einem Lächeln und drückt ab. Noch nie in meinem Leben habe ich so viel Blut gesehen. Oh mein Gott! Mein Freund hat gerade einen Mann getötet. Ich schlage mir eine Hand vor den Mund, aber mir entfährt dennoch ein Schluchzen. Rex blickt in meine Richtung und sieht, dass ich in der Tür stehe. Für einen Moment stehe ich wie angewurzelt da, doch als Rex sich in Bewegung setzt, wirble ich herum und ergreife die Flucht. Ich komme allerdings nicht weit. Nach wenigen Schritten hat Rex mich eingeholt, packt mich an den Haaren und schleudert mich zu Boden. Er tritt mir wiederholt in den Bauch und in die Rippen. Ich blicke zu ihm auf und sehe den wütenden Ausdruck in seinen Augen, bevor er mir seine Faust ins Gesicht rammt. Wieder und wieder schlägt er zu, bis ich schließlich ohnmächtig werde.
Ich reiße mich aus meinen Gedanken, als eine Krankenschwester in mein Zimmer kommt. Die Frau ist etwa Mitte dreißig, hat braunes Haar und ein freundliches Lächeln. Ich mustere sie, als sie die Lippen bewegt. „Schön, dass Sie wach sind“, sagt sie.
Ich hebe die Hände und antworte ihr in Gebärdensprache. Sie starrt mich schockiert an, woraufhin ich mit einer Geste um Papier und einen Stift bitte. Die Krankenschwester tritt eilig an den Tisch neben meinem Bett, öffnet die Schublade, zieht einen Notizblock mit dem Krankenhauslogo heraus und reicht mir einen Stift. Ich bin taub, kann aber von den Lippen lesen, kritzle ich auf das Papier und drehe der Krankenschwester den Block zu.
Während sie liest, verzieht sie die Lippen zu einem Lächeln. „Wir haben hier eine Dolmetscherin im Haus, die momentan im Dienst ist. Wie wäre es, wenn ich sie rufe? Der Arzt würde gern mit Ihnen über Ihre Verletzungen sprechen“, erklärt sie, woraufhin ich zustimmend nicke.
Etwa zehn Minuten später kommt die Krankenschwester in Begleitung eines Arztes mit grauen Haaren und einer zierlichen rothaarigen Frau zurück. Letztere beginnt sofort, in Gebärdensprache mit mir zu kommunizieren. „Hallo. Ich heiße Marie und werde für die Dauer Ihres Aufenthalts Ihre Dolmetscherin sein.“
„Danke, Marie. Mein Name ist Luna Novak", erwidere ich.
„Okay, Luna. Wenn es Ihnen recht ist, wird Dr. Cates jetzt mit Ihnen über Ihre Verletzungen sprechen. Außerdem wartet eine Kriminalbeamtin draußen auf dem Flur und würde Ihnen gern ein paar Fragen stellen.“
Ich schließe die Augen und atme tief durch. Will ich mit der Polizei sprechen? Rex hat einen Mann ermordet und mich fast zu Tode geprügelt. Ich beschließe, dass er es nicht verdient hat, damit davonzukommen, also öffne ich die Augen und nicke.
In den nächsten fünfzehn Minuten erklärt Dr. Cates mir, was in den letzten vierundzwanzig Stunden geschehen ist. Ich wurde mit dem Krankenwagen eingeliefert. Zu meinem Glück entdeckte mich ein Passant, als ich bewusstlos am Straßenrand lag, und rief den Notruf. Überraschenderweise habe ich nur eine Gehirnerschütterung, ein blaues Auge und eine aufgeplatzte Lippe. „Ich würde Sie gerne noch mindestens einen Tag zur Beobachtung hierbehalten, Miss Novak“, sagt Dr. Cates.
In Gebärdensprache antworte ich. „Einverstanden.“ Ich bin viel zu erschöpft, um mit dem Arzt zu diskutieren. Vielleicht ist es ohnehin besser, dass ich noch eine Weile hierbleibe, bis Rex gefasst ist.
Nachdem die Krankenschwester meine Vitalwerte überprüft hat, verlässt sie gemeinsam mit dem Arzt das Krankenzimmer. Kaum sind sie gegangen, betritt eine Frau den Raum und deutet auf den Stuhl neben dem Bett. Sie trägt einen Hosenanzug und einen Ausweis am Gürtel. Als ich nicke, nimmt sie Platz, wirft der Dolmetscherin einen Blick zu und beginnt, zu sprechen. „Hallo, Miss Novak. Ich bin Detective Brooks. Fühlen Sie sich stark genug, um mir ein paar Fragen zu beantworten?“
„Ja“, gebärde ich.
„Können Sie mir sagen, wie sie an den Straßenrand gekommen sind? Wissen Sie, wer Sie verletzt hat?“
Ich atme tief durch. „Es war mein Freund.“
„Wie heißt er?“, fragt sie und kritzelt etwas in ihr Notizbuch.
„Rex Sullivan.“
Detective Brooks blickt ruckartig auf. „Rex Sullivan? Sie meinen den Präsidenten der Savage Outlaws?“ Ihrer finsteren Miene nach zu urteilen, ist ihr der Name wohlbekannt.
„Ja“, antworte ich.
„Ich verstehe.“ Sie schürzt die Lippen. „Und ist Ihnen bewusst, was für eine Art Mensch ihr Freund ist, Miss Novak?“
Offensichtlich hat die Beamtin bereits ein Urteil über mich gefällt. „Nein, Detective. Bis vor vierundzwanzig Stunden hatte ich keine Ahnung, dass Rex zu so etwas fähig ist.“ Ich schließe die Lider und eine Träne rinnt mir über die Wange. Plötzlich komme ich mir so dumm vor. Ich war so verzweifelt auf der Suche nach Zuneigung, dass ich die Augen vor seinem wahren Wesen verschlossen habe. Zwar hat Rex mir nie seine kriminelle Seite gezeigt, aber ich hätte es besser wissen müssen. Als Detective Brooks wieder das Wort ergreift, hat ihre Miene sich ein wenig entspannt.
„Könnten Sie noch einmal ganz von vorn anfangen? Was hat dazu geführt, dass Sie im Krankenhaus gelandet sind?“
Ich wische mir die Tränen aus den Augen und gebärde hastig: „Wie schon häufiger in den letzten Monaten hatte ich im Clubhaus übernachtet. Mitten in der Nacht wurde ich wach und stellte fest, dass er nicht neben mir lag. Also machte ich mich auf die Suche nach ihm. Als ich mich seinem Büro näherte, sah ich, dass die Tür nur angelehnt war und im Inneren Licht brannte. Ich späte hinein und erblickte einen Mann, der vor Rex auf dem Boden kniete. Sie sprachen miteinander, aber ich konnte nicht erkennen, was sie sagten. Im nächsten Moment schoss Rex dem Mann in den Kopf. Ich habe wohl einen Laut von mir gegeben, denn Rex blickte zur Tür und entdeckte mich. Sofort ergriff ich die Flucht, aber er packte mich und schlug an Ort und Stelle auf mich ein, bis ich das Bewusstsein verlor. Im Kofferraum eines Wagens wachte ich wieder auf. Dann luden Rex und sein Bruder Pike mich am Straßenrand ab. Wo, weiß ich nicht. Ich erinnere mich noch, wie Rex mir sagte, ich hätte mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern sollen. Dann trat er mir gegen den Kopf, sodass ich erneut ohnmächtig wurde. Das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich im Krankenhaus aufwachte“, komme ich zum Schluss, während ich am ganzen Leib zittere.
„Wie lange waren Sie und Rex ein Paar?“
„Ungefähr drei Monate.“
„Und in den ganzen drei Monaten, in denen Sie mit dem Präsidenten von Savage Outlaw zusammen waren, haben Sie kein einziges Mal diese Seite an ihm gesehen, die er Ihnen gestern Abend gezeigt hat? Sind Sie denn nie Zeugin von illegalen Aktivitäten geworden?“, fragt die Beamtin und zieht skeptisch eine Augenbraue in die Höhe.
Ich schüttele den Kopf und antworte: „Nein. Ich weiß, es ist schwer, das zu glauben, aber Rex hat mir zuvor nie sein wahres Gesicht gezeigt. Er war immer nett und fürsorglich. Zumindest dachte ich das, bis ich Zeugin wurde, wie er den Mann in seinem Büro erschossen hat.“ Völlig erschöpft lasse ich die Arme schlaff auf das Bett fallen und stoße einen Seufzer aus.
Detective Brooks erhebt sich. „Ich werde jetzt gehen, damit Sie sich etwas ausruhen können. Die Informationen, die Sie mir gegeben haben, reichen aus, um Rex Sullivan zu verhaften. Ich werde Sie morgen früh wieder besuchen und Sie auf den neuesten Stand bringen. Außerdem werde ich einen Beamten vor Ihrer Tür postieren. Es ist möglich, dass die Mitglieder des Clubs Vergeltung üben wollen, nachdem wir Rex verhaftet haben.“
Augenblicklich werde ich von Angst gepackt und ich setze mich mühsam auf. „Glauben Sie wirklich, dass das notwendig sein wird?“, gebärde ich panisch.
„Ja, Miss Novak, das glaube ich. Ihr Lebensgefährte ist seit fünf Jahren unser Hauptverdächtiger in mindestens einem Dutzend Mordfällen. Bisher hat es jedoch nie zu einer Anklage gereicht. Entweder hatten wir nicht genügend Beweise oder die Zeugen sind plötzlich verschwunden.“ Detective Brooks lässt ihre Worte in der Luft hängen, um ihnen Nachdruck zu verleihen. Meine Atmung beschleunigt sich, während mir die Panik zweifellos ins Gesicht geschrieben steht. Detective Brooks tritt einen Schritt auf das Bett zu und begegnet meinem Blick. „Keiner seiner Männer wird Ihnen ein Haar krümmen, das versichere ich Ihnen. Im Moment ist das Krankenhaus der sicherste Ort für Sie, denn hier können wir Sie rund um die Uhr bewachen. Sobald Rex in Gewahrsam ist, komme ich zurück und wir überlegen uns, wie es weitergeht. Im Moment sollten Sie sich darauf konzentrieren, gesund zu werden, Miss Novak.“ Mit diesen Worten verlässt Detective Brooks das Krankenzimmer. Ich habe keine andere Wahl, als ihr zu vertrauen. Mein Leben liegt buchstäblich in ihren Händen.
Die Dolmetscherin wirft mir noch einen besorgten und traurigen Blick zu, dann verabschiedet sie sich ebenfalls. Bevor sie geht, versichert sie mir noch, dass sie in Bereitschaft bleiben wird. Sobald ich mit meinen Gedanken allein bin, überlege ich mir, wie ich in diese Lage geraten konnte.
Mein ganzes Leben habe ich in Arizona verbracht. Ich wurde mit einer genetischen Störung geboren, die nach und nach zu einem dauerhaften Hörverlust führte. Mit vier Jahren war ich bereits vollständig taub. Das Erlernen der Gebärdensprache war zwar frustrierend, aber ich war begierig darauf, mit anderen zu kommunizieren. Kein einziges Mal habe ich mich selbst bemitleidet oder aufgegeben. Das liegt einfach nicht in meiner Natur. Ich selbst betrachte mich nicht als behindert, sondern spreche einfach eine andere Sprache.
Ich wanderte von einer Pflegefamilie zur nächsten. Es dauerte nie lange, bis den Pflegeeltern klar wurde, dass ein Kind mit besonderen Bedürfnissen zu viel Aufwand bedeutete und sie sich nicht die Mühe machen wollten, die Gebärdensprache zu erlernen.
Als ich zehn Jahre alt war, lebte ich bereits in meiner fünften Pflegefamilie. Ich begriff, dass es einfacher war, ein Notizbuch und einen Stift zu benutzen, um mich verständlich zu machen, aber früher oder später wurden sie meiner überdrüssig. Während meiner Kindheit war ich für andere immer nur ein Klotz am Bein. Dabei war es völlig egal, dass ich in der Schule gute Noten schrieb und nie in Schwierigkeiten geriet. Letztendlich hatten die Pflegefamilien immer ein Problem mit meiner Taubheit.
Als ich ein Teenager war, lernte ich, anderen von den Lippen abzulesen und benutzte nur noch selten Papier und Stift. Es war einfacher, nicht aufzufallen und nicht bedürftig zu wirken. Dadurch schaffte ich es, etwas länger in einer Pflegefamilie zu bleiben. Ich glaube, manchmal vergaßen sie einfach, dass ich existierte. Wahrscheinlich habe ich mich deshalb wie ausgehungert auf die Aufmerksamkeit gestürzt, die Rex mir zuteilwerden ließ.
Ich hatte nie viel Zuneigung erfahren. Es war ein gutes Gefühl, als mich schließlich jemand wahrnahm und mich behandelte, als sei ich der wichtigste Mensch auf Erden. Ich habe Rex vor drei Monaten an einer Tankstelle kennengelernt. Alle Zapfsäulen waren besetzt, während ich gerade den Tank meines Wagens füllte und er mit seinem Motorrad hinter mir anhielt. Ich spürte, wie er mich beim Warten beobachtete. Schließlich kam er auf mich zu und mir fiel sofort auf, wie gut er aussah. Zugegebenermaßen war ich ziemlich nervös, als er mich zum ersten Mal in sein Clubhaus mitnahm und mir seine Brüder vorstellte. Einige Mitglieder begafften mich mit anzüglichen Blicken, die Rex jedoch gar nicht zu bemerken schien. Da ich mittlerweile sein wahres Gesicht kenne, glaube ich im Nachhinein, dass er es zwar bemerkt hat, sich jedoch nicht darum scherte.
Mit geschlossenen Augen atme ich tief durch. Ich kann kaum glauben, dass ich so dumm war, auf den ersten Mann hereinzufallen, der mit mir ausgehen wollte. Ich bin sechsundzwanzig Jahre alt und hatte bisher einen einzigen Freund. Mein ganzes Leben lang habe ich mich vor anderen verschlossen und mich in meine Blase zurückgezogen. Als Rex mich ansprach, habe ich jedoch alle Bedenken über Bord geworfen und mich auf ihn eingelassen. Dabei wäre ich fast gestorben. Nie wieder werde ich einem Mann vertrauen. Allein bin ich besser dran.
Kapitel 3
Riggs
Die rhythmischen Klänge stimmungsvoller Jazzmusik wecken mich aus dem Schlaf, als die geschmeidige Stimme von Nina Simone mein Zimmer erfüllt. Einen Moment bleibe ich ausgestreckt in meinem großen Doppelbett liegen, schließe die Augen und lausche ihrem Gesang, bevor ich die Decke zurückschlage. Ich schwinge meine Füße über die Kante, greife nach der Fernbedienung des Fernsehers und schalte die Lokalnachrichten ein, wobei ich auf den Ton verzichte. Lieber genieße ich die Musik, als etwas über die letzte Schießerei in New Orleans zu hören. Für gewöhnlich halte ich mich über die Geschehnisse in meiner Heimatstadt auf dem Laufenden, aber nach den letzten Wochen brauche ich eine Pause.
Seit unserem Einsatz war die letzte Nacht die erste, die ich in meinem eigenen Bett geschlafen habe. Nachdem wir die geretteten Frauen den Behörden übergeben hatten und ich wusste, dass sie identifiziert und die Angehörigen benachrichtigt werden, gestattete ich dem Arzt endlich, mein Bein zu versorgen. Zum Glück musste die Wunde nur gründlich gesäubert und mit ein paar Stichen genäht werden. Für eine Weile werde ich noch Antibiotika nehmen müssen.
Ich stehe auf, verlasse mein Schlafzimmer und gehe durch mein Wohnzimmer in die Küche. Dort angekommen, hole ich eine Tasse aus dem Schrank, schalte die Kaffeemaschine ein, gebe eine Kapsel hinein und drücke auf den Knopf. Während ich darauf warte, dass mein Kaffee fertig wird, fülle ich ein Glas mit Wasser. Ich nehme die Medikamentenpackung von der Anrichte, stecke mir eine Tablette in den Mund und spüle sie herunter.
Dann schnappe ich mir meinen Kaffee und gehe damit nach draußen auf den Balkon. Die warme, schwüle Morgenluft Louisianas schlägt mir sofort entgegen. Ich lehne mich ans Geländer und blicke auf New Orleans hinaus. Hier wurde ich geboren und hier bin ich aufgewachsen. Meine Wurzeln reichen tiefer als der Mississippi.
Es ist noch früh, daher ist noch nicht viel los auf den Straßen. Ich beobachte ein paar Vögel, die sich um ein Stück Müll zanken, das im Rinnstein liegt. Ich wohne in der Bourbon Street im French Quarter in einer kleinen Wohnung über dem Twisted Throttle. Die Bar gehört Wick und mir. Wir haben das historische Gebäude ein paar Jahre nach unserem Ausscheiden aus dem Militärdienst gekauft. Damals fühlte ich mich ein wenig verloren und wusste nicht so recht, wo ich hingehörte. Als Soldat war ich immer Teil einer Einheit und kannte nichts anderes als das Leben in einem Team. Während meiner Zeit beim Militär bin ich viel herumgekommen und nahm an so vielen Missionen wie möglich teil. Als es für mich an der Zeit war, meine Stiefel an den Nagel zu hängen und etwas Ruhe einkehren zu lassen, war ich nach wie vor ruhelos. Also fuhr ich auf meiner Harley quer durchs Land. Eines Tages tuckerte ich durch North Montana und erinnerte mich an einen ehemaligen Kameraden, der mir erzählt hatte, dass er in der Gegend wohnte. Während meiner Einsätze war ich ihm mehrere Male in Übersee begegnet, und als ich ihn in Polson ausfindig machte, erzählte er mir von dem Motorradclub, dem er beigetreten war. Er sprach auf so eindringliche Weise von der Bruderschaft, dass es mich tief beeindruckte. Da ich immer noch nicht wusste, was ich mit mir anfangen sollte, erinnerte ich mich an meine Unterhaltung mit ihm und besuchte ihn abermals für längere Zeit in Polson, Montana.
Der Cluballtag war so wie Jake ihn mir beschrieben hatte und genau das, was ich wollte. Ich stand kurz davor, mich den Kings of Retribution anzuschließen, als das Schicksal andere Pläne mit mir hatte. Mein Großvater wurde krank. Der wichtigste Mann in meinem Leben brauchte mich und ich wollte ihn auf keinen Fall im Stich lassen. Er kam zwar wieder auf die Beine, aber ich wusste, dass ich zu Hause bleiben und mich um ihn kümmern musste. Nichtsdestotrotz sehnte ich mich nach einem Gefüge, wie ich es in Montana erlebt hatte. Nachdem ich einige Male mit Jake telefoniert hatte, schlug er mir vor, ein zweites Chapter zu gründen, von dem ich der Präsident werden sollte. Damit wurde die Anwerbung von Mitgliedern zu einer meiner Aufgaben. Schon bald erwarb ich ein Gebäude, das ich in ein Clubhaus verwandelte, und innerhalb von zwei Jahren hatten wir drei Mitglieder: Wick, meinen Bruder Cain und mich. Außerdem waren ein paar Jungs an unserem Club interessiert. Sie schienen anständig zu sein und hatten das Potenzial zum Prospect, doch nach einer Weile mussten wir uns von ihnen trennen. Irgendwann begannen sie, krumme Geschäfte zu machen, mit denen wir nichts zu tun haben wollten. Ich duldete keine Süchtigen, die versuchten, Drogen auf der Straße zu verkaufen und dabei vorgaben, unter dem Schutz des Clubs zu stehen. Das brachte nur Probleme, also wurden wir sie los und haben seitdem nie wieder etwas von ihnen gehört.
Irgendwann stieß Fender, unser Sergeant-at-Arms, zu uns. Wir kannten ihn schon eine ganze Weile, bevor er ein Interesse an unserer Bruderschaft bekundete. Er war aus Nashville hierhergezogen und verdiente seinen Lebensunterhalt als Gitarrist und Sänger in den örtlichen Bars sowie als Straßenmusiker. Kiwi ist mit Mitte zwanzig unser jüngstes Mitglied. Wir lernten ihn auf einer Reise nach Vegas kennen. Er lebte dort schon seit etwas mehr als einem Jahr und sehnte sich nach einem Tapetenwechsel. Also fragte er, ob er mit uns zurück nach Louisiana fahren könne. Der Rest ist Geschichte. Mittlerweile haben wir zwölf Mitglieder und zwei Prospects. Das Chapter ist zwar klein, aber wir sind zu einer festen Größe in der Gemeinde geworden.
Als mein Handy klingelt, drehe ich mich um und gehe zurück ins Schlafzimmer. Auf dem Display meines Telefons ist das Bild meines Großvaters zu sehen, der einen riesigen Wels im Arm hält. Ich streiche mit dem Daumen über den Bildschirm und nehme den Anruf entgegen. „Hey, Pop.“
„Hallo, mein Junge. Was macht dein Bein?“
„Ich kann mich nicht beklagen. Wie ist dein Arzttermin gelaufen?“ Ich weiß, dass er gestern seine halbjährliche Kontrolluntersuchung bei dem Herzspezialisten hatte.
„Die Pumpe funktioniert gut und der Herzschrittmacher tut was er soll.“
Ich nicke. „Was hast du heute vor?“
„Oh, ich denke, Buck und ich werden an den See zum Angeln fahren, bevor der Sturm aufzieht.“ Mit anderen Worten würden er und sein bester Freund sich ein paar Bier genehmigen und sich darüber auslassen, wer wohl in der kommenden Saison dem Kader des örtlichen Football-Teams beitreten wird. „Komm doch heute Abend zum Essen vorbei. Die Frauen aus der Kirche haben mir genügend Essen mitgebracht, um eine ganze Armee zu ernähren“, lacht er. „Warum lädst du nicht auch die Jungs ein?“
„Gern.“
„Wunderbar. Dann sehen wir uns später.“ Er hält kurz inne, bevor er hinzufügt: „Ich hab’ dich lieb, mein Junge. Ich bin froh, dass du zu Hause bist.“
Ich räuspere mich und erwidere: „Ich hab’ dich auch lieb, Pop.“ Mit diesen Worten beende ich den Anruf.
Abraham LeBlanc wurde 1933 hier in Louisiana geboren. Meine Urgroßeltern lebten von der Fischerei und mein Großvater wuchs an den Gewässern des Mississippi und den Bayous auf. Dort zog er auch mich und meinen Bruder Cain groß. Das Leben war nicht gerade einfach, aber er hat uns zu den Männern gemacht, die wir heute sind. An Liebe hat es uns nie gemangelt. Unsere Mutter Eve verließ uns zwei Jahre nach unserer Geburt. Wir wurden als Zwillinge Abel und Cain LeBlanc an einem Sonntagmorgen geboren. Auf ihre Art hat unsere Mutter uns sicher geliebt, aber sie war schon immer rastlos und reist noch immer wie eine Zigeunerin umher. Wahrscheinlich wären Cain und ich als Nomaden aufgewachsen, wenn unsere Großeltern nicht eingegriffen und uns aufgezogen hätten. Heute könnte ich mir kein anderes Leben vorstellen. Hin und wieder taucht Eve aus heiterem Himmel auf und verschwindet dann wieder. Wir wussten immer, dass sie unsere Mutter ist, aber wir hatten nie eine wirkliche Bindung zu ihr. Sie hat uns auf die Welt gebracht, aber das war letztendlich das einzige Geschenk, das sie meinem Bruder und mir gemacht hat.