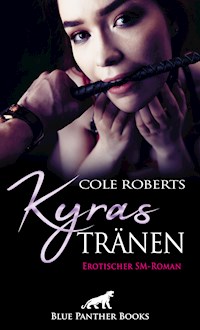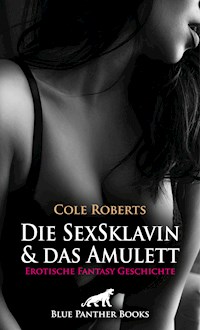Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: blue panther books
- Kategorie: Erotik
- Serie: Erotik Geschichten
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Dieses E-Book entspricht 216 Taschenbuchseiten ... Was haben eine namenlose Nymphe, die an Seilen gequält wird, ein von den Amazonen als Sexsklave entführter Jüngling, eine schwarze Sklavin mit einem geheimnisvollen Amulett im Körper und eine kriegsgefangene Barbarenprinzessin gemeinsam? Sie bieten Stoff für fantastische erotische Geschichten! Lassen Sie sich entführen in unbekannte, zum Teil gewalttätige Welten, kommen Sie mit auf eine Reise der Lust und Leidenschaft, bei der kaum ein Tabu ausgelassen wird ... Diese Ausgabe ist vollständig, unzensiert und enthält keine gekürzten erotischen Szenen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum:
Kult, Sex und Sklaverei | fantastisch erotische Geschichten
von Cole Roberts
Cole Roberts, geboren 1962 in Stirling, Schottland, arbeitete nach einem Biologiestudium hauptsächlich im Bereich DNA-Analyse und -Forschung und ist Autor mehrerer naturwissenschaftlicher Fachbücher. Vor dreißig Jahren hat er einmal „Die Geschichte der O“ gelesen, ansonsten bestand bisher nie eine Verbindung zur Prosa im Allgemeinen und zur SM- oder Sex-Szene im Besonderen. Seine Protagonistin Kyra hat sich irgendwann in seine Gedanken gedrängt und ihn quasi zum Schreiben aufgefordert. Das hat ihm so viel Freude bereitet, dass er diesen Weg weitergehen und auch künftig erotische Literatur schreiben möchte.
Lektorat: A. K. Frank
Originalausgabe
© 2020 by blue panther books, Hamburg
All rights reserved
Cover: Guryanov Andrey @ shutterstock.com
Umschlaggestaltung: MT Design
ISBN 9783966410137
www.blue-panther-books.de
Die SexSklavin und das Amulett
1
Sie kamen in der Nacht. Kurz vor der Morgendämmerung rissen mich laute, knallende Geräusche aus dem Schlaf. So etwas hatte ich noch nie gehört! Ich war verwirrt. Mein Venushügel brannte etwas. Der Schnitt war noch recht frisch und begann so kurz nach meiner Initiation gerade erst zu verheilen. Die Narbe würde später unter meinem Schamhaar praktisch nicht zu sehen sein. Aber das focht mich im Moment wenig an. Draußen hörte ich laute Rufe und einige panische Schreie. Ich war mir jetzt schon sicher: Da waren auch die Schreie von Sterbenden dabei! Mir fröstelte. Um mich herum regten sich mehrere Mädchen, die mit mir in der Hütte der Jungfrauen schliefen. Es war stockdunkel, kein Lichtschein drang herein. Das einzige Feuer in unserem Kral war ein Stück weit entfernt und wir sorgten immer dafür, dass die Hütten möglichst gut geschlossen waren, schon allein wegen der verschiedenen krabbelnden und sich windenden Tiere, die sonst hereinkommen konnten. Viele davon waren sehr gefährlich. Ein Grund, warum unsere Hütten nicht nur gut geschlossen werden konnten, sondern zusätzlich auch noch auf hüfthohen Holzstämmen standen.
Plötzlich wurde die Eingangsmatte weggerissen. Geblendet fuhr ich zurück und kniff meine Augen zusammen. Jemand leuchtete mit einer Fackel in die Hütte und ich hörte einige laute Rufe in einer mir völlig unbekannten Sprache. Vorsichtig blinzelte ich und konnte an der Fackel vorbei eine Gestalt erkennen. Ganz offensichtlich ein Mann. Nicht nur seine Sprache war mir unverständlich, er sah auch sehr seltsam aus. Sein Körper war fast überall mit Lappen bedeckt. Nur sein Gesicht und sein Hals blieben frei. Und seine Haut. Ganz hell und blass! Wie ein Höhlenwurm! Was waren das für Wesen? Ich presste mich mit dem Rücken an die hintere Wand unserer Hütte. Eine grässliche Angst fuhr mir durch alle Glieder. Hier und heute passierte etwas Schreckliches, dessen war ich mir sicher. Hinter dem blasshäutigen Mann sah ich Flammen. Einige unserer Hütten schienen zu brennen. Wieder hörte ich laute Rufe, gepaart mit Schreien der Todesangst. Wieder rief er etwas nach hinten über seine Schulter und wenige Augenblicke später flog unsere Hütte förmlich auseinander. Die Seitenwände sprangen aus ihren Verankerungen. Auch hinter mir gab die Wand plötzlich nach und ich stürzte auf den Boden. Unmittelbar darauf wurde ich von kräftigen Händen hochgerissen und spürte, immer noch wie paralysiert, wie mir die Hände zusammengebunden wurden. Dann bekam ich einen Strick um den Hals und wurde daran grob nach vorne gezogen. Immer noch konnte ich nicht viel erkennen und stolperte auf meinen bloßen Füßen ein paar Schritte nach vorne. Meine Hände wurden mit den Fesseln nach oben gezogen und ich gewahrte eine Art langen Stock, an dem sie festgebunden wurden. Auch mein Halsstrick wurde daran festgezurrt. So stand ich dann dort. Stumm und vor Angst zitternd. Vor mir sah ich die kräftige Gestalt eines unserer jungen Männer, die mich um einen Kopf überragte. Er war genauso gebunden wie ich. Und vor ihm stand ein weiterer und hinter mir spürte ich auch Bewegung. Langsam kroch die Dämmerung in unser Lager und ich erkannte eine lange Reihe dunkler Leiber vor mir, alle gebunden wie ich. Und ich brauchte den Kopf nicht zu drehen, um zu wissen, dass es hinter mir genauso war. Und unser Lager. Es war kein Lager mehr. Einige Hütten brannten, einige waren komplett zerstört und überall lagen Tote. Frauen, Männer, Kleinkinder. Im ganzen Lager rannten die Höhlenwurmmänner hin und her. Sie riefen laut in ihrer seltsamen Sprache und sie hielten Stöcke in ihren Händen, die laut knallten. Und immer, wenn solch ein Stock knallte, fiel ein alter Mann oder eine alte Frau zu Boden und rührte sich nicht mehr. Ich war so von Entsetzen gelähmt, dass ich nicht einmal weinen konnte.
Es dauerte nicht lange und der Stock, an dem ich gefesselt war, ruckte nach vorne. Zwangsläufig machte ich einen Schritt; und noch einen; und dann wieder einen. Ich konnte nichts tun. Wieder hörte ich es knallen. Es war ein anderes Knallen als das von vorhin. Und als ich einen heftigen Schmerz auf dem Rücken spürte, wusste ich auch, um was für ein Knallen es sich handelte. Es war das Geräusch, wenn Peitschen auf nackte Rücken treffen. Und so setzte sich ein wankender Zug dunkler Gestalten, langsam in Bewegung. Wir gingen einem ungewissen Schicksal entgegen und als ich über die Schulter einen letzten Blick auf das verwüstete Lager erhaschte, wurde mir eines klar: Unser Stamm existierte nicht mehr. Überall lagen Tote. Die Alten und die ganz Jungen. Das Lager brannte; meine Heimat brannte. Eine Heimat die ich, das wurde mir schmerzlich bewusst, nie wiedersehen würde. Und so stolperte, taumelte und strauchelte ein Zug gebundener junger und kräftiger Menschen unter Peitschenhieben einer ungewissen Zukunft entgegen.
2
Den ganzen Tag waren wir von den Peitschen getrieben durch den Dschungel gehetzt. Nur gegen Mittag gab eine kurze Pause in der wir alle einen Becher mit warmem, muffig schmeckendem Wasser eingeflößt bekamen. Selbst trinken konnten wir nicht, gefesselt, wie wir waren. Dann ging es wieder weiter bis wir, vielleicht eine knappe Stunde vor der kurzen Dämmerung, eine Art freien Platz zwischen den Bäumen erreichten, der ganz offensichtlich nicht zum ersten Mal als Lagerplatz für solche Transporte genutzt wurde, wie wir einen darstellten. Wir durften uns, erschöpft und angebunden, wie wir waren, hinsetzen. Sofern man den Versuch als sitzen bezeichnen kann, wenn zwei Hände voll Menschen an einen Stock gebunden versuchen, sich irgendwie zu Boden zu lassen. Ich hörte leises Jammern und lautes Schluchzen. Viel sehen konnte ich nicht und mir fehlte sogar die Luft und der Mut, mit meinem Vorder- oder Hintermann ein paar Worte zu wechseln. Worüber sollten wir auch reden? Unsere Situation war eindeutig und es gab keinen Ausweg, keine Hilfe. Nichts, was uns auch nur einen Funken Hoffnung hätte geben können. Niemand von uns wusste, was auf uns zukam, aber wir alle ahnten, dass es schrecklich werden würde.
Wieder bekamen wir etwas Wasser zu trinken, zu essen gab es nichts und niemand machte sich die Mühe, uns loszubinden. So lagen wir da und einige dämmerten von den Strapazen gezeichnet ein, als ich gewahrte, dass doch einzelne von uns losgebunden und ein Stück weit weggeführt wurden. Nach kurzer Zeit näherte sich auch mir einer der Wurmmänner und schaute grinsend auf mich herab. Dann bückte er sich und griff mir grob an die Brust. Was er dort fühlte, schien ihm zu gefallen, denn er band mich vom Stock los und zog mich zielstrebig zum Rand des Dschungels. Dort warf er mich vorwärts über einen großen liegenden Baumstamm und nur Sekunden später spürte ich, während mir an Bauch und Brust die Haut auf der rauen Baumrinde aufgerissen wurde, wie ein pralles, großes Glied in meine Scheide eindrang. Jetzt wusste ich, was mit all denen geschah, die losgebunden worden waren. Ich presste meine Augen zusammen und versuchte, den Schmerz zu ignorieren. Dennoch drangen Tränen durch meine geschlossenen Lider. Nicht einmal drei Hände an Sommern zählte mein Leben. Erst vor ein paar Tagen hatten wir meine Initiation gefeiert. Ich war einem Jungen versprochen. Einem Jungen, der vermutlich auch irgendwo im langen Zug der Verzweiflung angebunden war. Natürlich wusste ich, was Liebe und was körperlicher Sex war. Auch ich hatte schon einmal mit einem Jungen gespielt. Mehr nicht. Und jetzt lag ich hier und wurde brutal von hinten gerammelt. Jeden Stoß spürte ich mit schmerzhafter Präsenz in mir. Entjungferung auf brutal. Glücklicherweise dauerte es nicht lange, bis ich ein zufriedenes Grunzen hörte und das blasshäutige Schwein sich aus mir zurückzog. Er riss an meinem Arm, brachte mich wieder zurück an meinen Platz und band mich fest. Ich zog die Beine an und glitt wimmernd in einen unruhigen Halbschlaf. Was ich nicht ganz verstand, war die Tatsache, dass ich auch ein paar kleinere Jungs gesehen hatte, die zum Dschungelrand geführt worden waren. Aber ich wollte mir gar nicht vorstellen, was mit denen geschehen war.
3
Die nächsten Tage verliefen nach dem gleichen Muster. Morgens gab es etwas zu trinken, dann wurden wir von den Peitschen in Richtung eines uns unbekannten Ziels getrieben. Mittags eine kurze Trinkpause und abends Wasser, ein unruhiger Schlaf und vorher Vergewaltigungen. Ich war jeden Abend dabei. Als wir nach drei Tagen den Dschungel verließen und in eine Savanne kamen, konnten die ersten nicht mehr. Wir konnten nicht helfen und den Wurmmännern waren sie egal. Man hörte wieder das laute Knallen der Stöcke, ein Toter wurde von unserem Knüppel abgeknüpft und schlicht dort liegen gelassen, wo er zu Boden gefallen war. Sicher würden sich die Hyänen dankbar darum kümmern.
Als wir nach sechs Tagen in der Ferne große Hütten erspähten, gab es schon einige Lücken in unserer Karawane. Meine Füße schmerzten, meine Scheide nicht minder, nur mein Schnitt im oberen Bereich der Schamhaare begann zu jucken, was mir signalisierte, dass er heilte. Völlig erschöpft, hungrig, durstig und verzweifelt stolperten wir voran und erreichten einen gewaltigen Kral mit riesigen Hütten, die aus Stein gebaut waren. Trotz unseres erbärmlichen Zustandes schauten wir uns diesen seltsamen Ort mit Erstaunen an. Dann kamen wir an eine Art steinernes Ufer, das an ein Wasser grenzte, das gar nicht mehr aufhörte und sich in der Ferne verlor. Das war kein Fluss! So einen breiten Fluss konnte es nicht geben. Doch unser Erstaunen sollte noch weiter gehen und sich sogar steigern. An der steinernen Mauer war ein Etwas mit Seilen verzurrt, das ich überhaupt nicht verstand. Als wir eine lange schräge Holzplanke hinauf getrieben wurden, erkannte ich, dass es ein Boot sein musste. Es war aus Holz gefertigt und schwamm auf dem Wasser. Aber so ein enormes Boot hatte ich noch nie gesehen. Es war größer, als drei Hände von unseren Einbäumen lang waren, viel größer. Zwei große Bäume ragten bis in schwindelerregende Höhen aus diesem Bootskörper hinauf. Wir liefen über Holzplanken und wurden dann durch eine Tür in den Bauch dieses Ungetüms getrieben. Bevor sie die Tür verschlossen wurde der Letzte in unserer langen Schlange losgebunden. Das war’s.
Vollkommen erschöpft sanken wir alle im Bauch dieses Dings zu Boden. Licht gab es keins und wir konnten zunächst überhaupt nichts sehen. Irgendwann machte sich jemand an meinen Fesseln zu schaffen und band mich schließlich los. Der eine junge Mann, dem sie die Fesseln gelöst hatten, musste wohl einen zweiten davon befreit haben und so weiter. Da sich die Zahl der Befreiten jedes Mal verdoppelte, ging es verhältnismäßig schnell. Befreiten. Ha. Eingesperrt waren wir! Die Tür war verschlossen und ließ sich nicht öffnen. Ich hörte, wie die etwas älteren Männer miteinander sprachen, hörte aber nicht zu. Das hier war hoffnungslos. Selbst wenn wir irgendwie hier rauskommen würden, wären da wieder die Blassmänner mit ihren Todesstöcken.
Durch Ritzen drang ein klein wenig Licht herein. Nach geraumer Zeit hatten sich unsere Augen so an dieses fast schwarze Zwielicht gewöhnt, dass wir schemenhaft etwas sehen konnten. So fanden wir ein paar große Holztröge, in denen Wasser war. Daneben lagen halbe Kokosschalen. Wir tranken uns erst einmal satt. In weiteren Holztrögen war etwas zu essen. Auch wenn wir diese seltsamen Fladen nicht kannten, so trieb der Hunger sie hinein. Schnell waren etliche Bissen mit dem Wasser hinuntergespült, das sogar einigermaßen frisch zu sein schien. Dreckig und von unseren eigenen Exkrementen verschmutzt, wie wir waren, die Blassmänner hatten sich nicht die Mühe gemacht, für unsere Notdurft anzuhalten, sodass alles, während des Laufens geschehen war, roch es in dem mit sicher zwei Händen mal zwei Händen voll an Menschen gefüllten dunklen Loch nicht sehr angenehm. Wir fanden auch hier nirgends eine Möglichkeit, unser Geschäft zu verrichten, sodass durch die Männer schlicht eine Stelle des Raumes zur Fäkalienecke erklärt wurde. Was blieb uns anderes übrig?
Es dauerte nicht lange, bis wir draußen laute Rufe hörten und kurze Zeit später ein ständiges, an- und abschwellendes Wackeln des Bodens unter uns wahrnahmen. Ähnlich einem schwankenden Einbaum, nur viel heftiger und gleichmäßiger. Diese Bewegungen waren für die meisten von uns so ungewohnt, dass die Fäkalienecke schon nach wenigen Stunden mit Erbrochenem gefüllt war, was die Luft in unserem Verlies nicht gerade verbesserte.
Es war seltsam still bei uns. Ich hörte nur einige wenige, leise und gedämpfte Stimmen und das eine oder andere Schluchzen. Worüber hätten wir auch reden sollen? Die unausgesprochene Frage: »Was passiert mit uns?«, hing schwer in der Luft. Aber niemand hätte sie beantworten können. Ausbruchspläne? Allein der Gedanke war schon lachhaft. Wir mussten uns auf diesem großen Wasser befinden. Selbst wenn wir uns gegen die mit diesen Knallstöcken bewaffneten Blasshäuter hätten durchsetzen können: Was hätten wir dann tun sollen? Die Stimmung war bleiern drückend. Wir waren ihnen rettungslos ausgeliefert, wir waren verloren.
So ging das tagelang. Niemand kümmerte sich um uns, sie schauten nicht ein einziges Mal zu der verschlossenen Tür herein. Da keiner wusste, wie lange unser Aufenthalt in diesem dunklen Loch andauern würde, entschieden die Männer, dass Wasser und diese seltsamen Fladen sparsamer verbraucht werden sollten. Mir war das egal. Ich nahm, was man mir reichte und schlang oder würgte es hinunter. Das anfangs halbwegs frische Wasser schmeckte Tag für Tag schlechter und nach etwa zwei bis drei Handvoll an Tagen, das konnten wir anhand des schwindenden Lichts, das nachts nicht durch die Ritzen kroch, einigermaßen nachvollziehen, wurden die ersten krank. Kein Wunder bei dieser Ernährung und in dieser Umgebung. Wir nahmen es aufgrund der Gewöhnung zwar nur annähernd wahr, aber die Fäkalienecke musste bestialisch stinken. Und so das gesamte Loch. Das konnte gar nicht gesund sein. Sie bekamen Fieber und wurden immer schwächer. Irgendwann war es soweit und das erste Mädchen wachte morgens nicht mehr auf. Wir nahmen es apathisch zur Kenntnis und ich spürte, dass auch ich immer schwächer wurde. Nicht einfach nur schwach, wegen der Mangelernährung, nein, richtig schwach. Mein Kopf glühte.
Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war mir klar: Diesen Tag würde ich nicht überleben. Ich schaute im Halbdunkel auf diesen komischen Fladen, den mir irgendwer gereicht hatte. Ich war nicht mehr in der Lage, ein Stück hinunter zu würgen und das immer fader schmeckende Wasser fand auch kaum noch den Weg in meinen Magen. Ich fühlte mich nicht in der Lage aufzustehen und in die Fäkalienecke zu gehen. Ausgezehrt und halb verdurstet, wie ich war, lohnte das den Aufwand auch kaum. Irgendwann suchten sich die wenigen Tropfen allein ihren Weg. Wie ich wusste, war ich nicht die Einzige, der dieses Malheur passiert war und irgendwie war es mir auch gleichgültig. Den Tag über wälzte ich mich einige Male von der einen auf die andere Seite, zu mehr war ich nicht mehr fähig und irgendwann, es war schon gänzlich dunkel, dämmerte ich in einen bleiernen Schlaf hinein.
4
Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war mir klar: Diesen Tag würde ich nicht überleben. Ich schaute im Halbdunkel auf diesen komischen Fladen, den mir irgendwer gereicht hatte. Den hatte ich doch schon gestern nicht hinunter bekommen. Wo lag denn das Stück von gestern? Ich fand es nicht. In Todesverachtung führte ich den Fladen dennoch zum Mund, aber… Das war komisch. Irgendwie war es ganz genau wie gestern, und doch seltsam anders. Ich spürte ein kribbelndes Pochen unter meiner Schambehaarung. Ich war nackt, wie alle hier. Den Fladen immer noch in der Hand haltend, schaute ich zu meiner Scham hinunter. Unterhalb der Stelle, wo man mir bei meiner Initiation einen sicher drei, vier Finger langen Schnitt zugefügt hatte, der mittlerweile fast völlig verheilt war, glühte meine dunkle Haut von innen purpurrot leuchtend. Ich erkannte das komplizierte Muster des Amuletts aus Elefantenstoßzahn, das man mir eingesetzt hatte. Dieses Amulett, das schon meine Mutter an derselben Stelle getragen hatte, und ihre Mutter. Und deren Mutter. Und so weiter. Eine lange Reihe von Medizinfrauen. Immer am Tag der Initiation ihrer erstgeborenen Tochter wurde das Amulett der Trägerin entnommen und der Tochter eingesetzt. Es war uralt. Und jetzt glühte es. Es glühte durch meine tiefbraune, fast schwarze Haut hindurch. Schnell legte ich meine Hand auf meine Scham. In der hier herrschenden Dunkelheit musste das Glühen im gesamten Verlies zu sehen sein.
Was geschah mit mir? Was hatte das zu bedeuten? Die Zeit meiner Lehre als Medizinfrau hatte noch nicht begonnen, meine Mutter hatte mir noch nichts erklärt. Das hätte erst jetzt anfangen sollen. Nach der Initiation. Ich wusste nur einige Dinge, die ich bei meiner Mutter beobachtet hatte. Heilende Pflanzen erkennen und Ähnliches. Ich hatte mir keinerlei Gedanken über das Amulett gemacht. Es wurde von Mutter zur Tochter weitergegeben. Mehr wusste ich nicht. Nur dass die Medizinfrauen immer als erstes eine Tochter bekamen. Das war so und das war schon immer so gewesen. Wegen des Amuletts? Warum wurde das Amulett ausgerechnet an dieser Stelle eingesetzt? Bisher hatte ich mir keine Gedanken darüber gemacht. Ich hob meine Hand leicht an und sah, dass das Leuchten etwas nachgelassen hatte. Ganz langsam wurde es immer dunkler, schließlich schien es nicht mehr durch meine Haut hindurch. Auch das Pulsieren und Pochen ließ mehr und mehr nach. Schließlich konnte ich meine Hand zurückziehen und mich wieder mit meinem Fladen beschäftigen. Wenn ich überleben wollte, dann musste ich etwas essen. Und trinken. Vorsichtig nahm ich einen Schluck aus meiner Kokosschale. Das war zu wenig. Und es war sicher nicht mehr frei von Krankheiten. Ich war ohnehin zu schwach, um in die Exkrementenecke zu gehen, also füllte ich die Schale mit dem wenigen Wasser auf, das meine Blase hergab. Dann biss ich ein Stück von dem Fladen ab, feuchtete ihn mit dem Wasser-Urin-Gemisch an und würgte das Ganze dann schließlich hinunter. Bis zum letzten Stück, bis zum letzten Schluck. Nach einiger Zeit ging es mir ein ganz klein wenig besser. Gut genug, um mich mit meinen an das Dunkel gewöhnten Augen ein wenig umzuschauen. Ich sah Verzweiflung, ich hörte Verzweiflung. Und ich roch Tod. Tod und Fäkalien. Plötzlich wurde mir der infernalische Gestank klar bewusst. Ich schüttelte mich. Irgendwie überstand ich den Tag lebend und döste die Nacht hindurch vor mich hin. Und am nächsten Tag hatte das wochenlange Dahinsiechen in diesem stinkenden Loch des Todes tatsächlich ein Ende. Wir waren angekommen. Wo auch immer und mit welchem Endziel auch immer. Aber wir waren angekommen. Der Boden unter unseren Leibern bewegte sich nicht mehr, wir hörten laute Rufe und schließlich wurde diese Tür geöffnet. Ein Schwall frischer Luft quoll hinein und wieder einmal musste ich, so wie die anderen auch, geblendet die Augen schließen.
5
Die Tür war so eng, dass jede Idee, unsere Peiniger anzugreifen, von vorneherein ausgeschlossen war. Einzeln mussten wir durch die enge Pforte gehen und wurden sofort wieder an Hals und Händen gebunden. Ohne Stöcke zwar, aber eine lange Reihe verschmutzter, teilweise kranker, verzweifelt weinender und schwacher Menschen, die am Seil geführt über eine Planke dieses Ding verließen, mit dem man so viele Menschen über ein großes Wasser transportieren konnte. Ich wusste nicht mehr, was ich denken sollte. So wurden wir über diesen steinernen Pfad am Wasser geführt und kamen, aufgereiht wie wir waren, zu einem Bereich, wo gut zwei Hände voll von dunkelhäutigen Frauen standen. Sie hatten Lappen in den Händen. Jede stand bei einem hölzernen Bottich, der mit Wasser gefüllt war. Als die ersten aus unserer Reihe bei ihnen ankamen, sah ich, dass sie mit den Lappen grob abgewaschen wurden. Mit viel Wasser und den Lappen wurde im Schnelldurchgang versucht, den verkrusteten Schmutz und die hart gewordenen Fäkalien von den Körpern meiner Leidensgenossen abzuwaschen. Ich konnte mir gar nicht erklären, was diese plötzliche Reinlichkeit bedeuten sollte. Man hatte sich bisher nicht um unser Wohlergehen gekümmert, diese ungewohnte Zuwendung konnte sicher nicht mit positiven Waschungen in unserem Sinne verknüpft sein. Ich sah, dass die Frauen fast jedem etwas zuflüsterten. Als ich an die Reihe kam und das kalte Wasser und den groben Lappen auf meiner Haut spürte, sagte die Frau in einer Sprache, die der unseren ähnelte und die ich einigermaßen verstehen konnte zu mir: »Lass alles mit dir geschehen, sonst töten sie dich. Wehr dich nicht. Ihr werdet verkauft. Dann müsst ihr irgendwo arbeiten oder ihnen sonst wie dienen. Junge hübsche Mädchen wie du gehen meist in ein Bordell, dort müssen sie Männern zu Willen sein. Hör viel zu, lern ihre Sprache. Und sei duldsam! Nur so kannst du hier überleben.«
Und schon wurde ich wieder weitergeschoben. Mir schwirrte der Kopf. Was ist »verkauft«? Was ist ein »Bordell«? »Männern zu Willen sein?« Ja, das konnte ich mir nach unserem Fußmarsch durch den Dschungel und die Savanne vorstellen. Wir gelangten zu einer Art Platz in der Mitte dieser Anhäufung von übergroßen Hütten. Da waren Menschen. Viele Menschen. Die meisten blasshäutig wie unsere Peiniger. Und dann ging es los. Da war ein Podest. Da wurde immer eine Handvoll von uns drauf gestellt und dann hörte man Rufe aus der Menge. Es wurde gezeigt und gewunken. Einige kletterten auf das Podest und packten den Männern an die Oberarme, oder auch ans Geschlecht. Sie mussten die Münder öffnen und ihnen wurde in den Rachen geschaut. Den Mädchen packte man an die Brüste, an den Hintern und in den Schritt. Es war widerlich! Es war eine unfassbare Vor- und Aufführung. Was waren das nur für Bestien? Wie wurden wir hier behandelt? Es dauerte nicht lange, bis auch ich dran war. Vom Podest aus hatte man einen guten Überblick über die Menge. Schnell erkannte ich, dass ein Großteil der Anwesenden nur aus Sensationslust dabei war. Die meisten wollten keinen Menschen kaufen. Mir drehte sich der Magen um bei diesem Gedanken. Einen Menschen kaufen. Die meisten wollten nur sehen, wie wir behandelt wurden. Sie lachten sich kaputt, wenn an uns herumgefingert wurde und wir uns nicht wehren konnten, oder besser gesagt durften. Die Peitschen waren allgegenwärtig. Und sie wurden auch eingesetzt. Mehrfach hatte ich die Peitschen knallen hören und gesehen, wie sie auf dem Rücken eines unserer Männer nieder gingen, wenn er sich auch nur durch geringe Bewegungen gegen allzu erniedrigendes Betatschen wehrte. Ich beschloss, absolut still zu halten.
Ziemlich in vorderer Reihe stand eine ältere Frau, die in lächerlich bunte Tücher gewickelt war und sich aufführte, als wäre sie etwas Besseres. Sie kam auf das Podest geklettert und betatschte zwei Mädchen und mich. Sie packte uns an die Brüste und in die Scham und schien uns regelrecht zu begutachten. ›Bordell‹, dachte ich. Das war wohl der Name für die Hütte der Begattungen, dem diese Dame offensichtlich vorstand und in dem ich zukünftig irgendwelchen Männern »zu Willen sein« musste.
Dann hörte ich eine laute Stimme etwas rufen. Ein Mann, der in einem seltsamen Ding saß, das in etwa wie eine eckige Kokosschale aussah und vier runde Dinger an jeder Ecke hatte, rief etwas zu der Frau und zu dem Mann, der hier bei uns wohl das Sagen hatte, denn er hatte alle meine Stammesbrüder »verkauft«. Neben dem Mann, der laut gerufen hatte, saß ein alter Mann, der bei uns sicher im Rat der Ältesten gesessen hätte. Der sagte etwas zu dem anderen Mann und deutete dann auf mich. Wieder rief der andere Blasshäuter etwas und die Frau rief etwas zurück. Dann sagte der andere Mann hier bei uns etwas. Die Frau guckte böse und zog dann mit meinen beiden Leidensgenossinnen ab. Der Höhlenwurmhäutige stieg aus der Schüssel, kam zu mir, reichte dem Mann hier eine Handvoll blattähnliche Dinge, packte das Seil, das an meinem Hals verknotet war und zog mich zu dieser Schüssel. Dort angekommen packte er mich, hob mich einfach hoch, so als hätte ich kein Gewicht und warf mich in den hinteren Teil der Schüssel, wo Seile, irgendwelche mir unbekannte Gerätschaften und Pakete lagen. Ich wagte es nicht, irgendetwas zu sagen, sondern lag still in dem Durcheinander und lugte vorsichtig nach hinten über den Rand der Schüssel. Es prasselten derart viele Eindrücke auf mich ein, dass ich irgendwie völlig vergaß zu weinen oder zu jammern. Auch bei meinen Leidensgenossinnen und Leidensgenossen hatte ich nur wenige Tränen gesehen. Entweder waren sie in den langen Wochen der Tortur schlicht versiegt oder sie hatten keine Tränen mehr. Das Erlebte schwirrte so durch ihre Köpfe, dass sie das Weinen schlicht vergaßen. Ich konnte es nicht sagen. Ich merkte, wie das Ding, in dem ich lag, gewendet wurde und sich dann durch die Menge einen Weg bahnte. Zwei Tiere waren vorne angebunden und zogen es. Grinsende Gesichter schauten hinter uns her, ich meinte auch einige mitleidige Mienen wahrgenommen zu haben. Die wussten wohl, was mich erwartete. Eins war mir jetzt schon klar, ohne dass es mir jemand gesagt hätte: Unsere Männer waren hierhergebracht worden, um zu arbeiten. Wo, oder was auch immer, davon hatte ich keine Vorstellung. Aber wir jungen und hübschen Mädchen und Frauen… Wir waren Freiwild für die geilen, höhlenwurmhäutigen Männer!
6
Wir verließen den Ort mit den großen Hütten, das Ding wurde immer schneller und schließlich huschten wir mit der Geschwindigkeit der vorn angebundenen Lauftiere über die Ebene. Es rüttelte und schüttelte etwas, war aber ansonsten ganz angenehm. Ein klein wenig genoss ich sogar die Entspanntheit und die gute Luft hier hinten in der Ablage dieses seltsamen Etwas nach den vielen Tagen in dem stinkenden Loch. Schließlich begann ich ein wenig dahinzudämmern. Es dauerte geraume Zeit, bis wir langsamer wurden und auf einen freien Platz zwischen mehreren, sehr großen Hütten kamen, die aus Holz waren. Die Hütte, vor der wir hielten, war die Größte und irgendwie anders gebaut als die anderen. Die waren schlicht kantig. Hier waren Ecken und Kanten dran, Vorbauten, eine Art Steg und Öffnungen, durch die man hindurchschauen konnte. Ich hatte mich etwas aufgerichtet und schaute mich neugierig um. Mir war klar, dass dies meine neue Heimstatt war. Das Wort Heimat erschien mir irgendwie nicht passend. Meine Heimat war tot und sehr, sehr weit weg. Wieder hörte ich die Stimme des Mannes und dann erschien eine dunkelhäutige Frau in einer der Hausöffnungen. Auch sie war in diese vielfarbigen Tücher gewickelt, sie war alt und unglaublich dick. So eine dicke Frau hatte ich bei uns noch nie gesehen. Sie kam zu der Schale gelaufen und schaute mich mit freundlichen Augen an. Irgendwie wirkte sie gutmütig und ich beschloss spontan, sie zu mögen und ihr zu vertrauen.
»Na, mein Kleines?«, fragte sie, wohl ohne eine Antwort zu erwarten, und griff nach meiner Halsfessel. »Dann wollen wir dich mal von diesem Ding hier befreien.«
Ihre Sprache klang für mich fremdartig, aber ich konnte sie verstehen. Womöglich stammte sie von einem Stamm in der Nähe meiner Heimat. Anhand meiner Erfahrungen der letzten Wochen konnte ich erahnen, wie sie hierher gelangt war.
Sie löste meine Halsfessel und befreite auch meine Hände. Dann hob sie mich aus der Schale, fast ebenso mühelos, wie mich der Mann vorhin hinein gehoben hatte, und stellte mich auf meine Füße.
»Komm mit«, sagte sie, »wir wollen dich erst mal vernünftig herrichten. Du verstehst doch meine Sprache?«
Ich nickte. »Ja«, ergänzte ich überflüssigerweise. »So ziemlich.«
»Ah«, sagte sie. »Ja, ich verstehe. Du sprichst einen etwas anderen Dialekt, als ich, scheinst aber aus derselben Gegend zu stammen. Das ist gut. Das wird uns einiges erleichtern.«
Der alte Mann stieg auch aus der Schale und sprach in seiner Sprache zu der Frau. Sie neigte den Kopf und sagte etwas, das wie »ja, Paddrohn« klang. Dann schaute sie mich mit einem langen Blick seltsam an, schnaufte etwas, packte mich am Handgelenk und zog mich auf die große Hütte zu.
»Zuerst werden wir dich einmal ordentlich waschen«, plapperte sie weiter. »Dann bekommst du etwas anzuziehen. Du kannst hier nicht ständig splitternackt herumlaufen! Und dabei werde ich dir die wichtigsten Dinge erzählen, die du hier wissen musst.«
Sie schien sehr gesprächig zu sein, aber ihr Wesen erleichterte mir ganz spontan das Gemüt, sodass ich ihren Wortschwall sogar mit einem leichten Grinsen auf mich herniederprasseln ließ. Wir betraten einen Raum, in dem ein großer Bottich stand. Ich konnte mir gar nicht erklären, wie groß ein Baum sein musste, aus dem man so ein großes Gefäß schneiden konnte. Der Bottich war über die Hälfte mit Wasser gefüllt. Dann kam die Frau mit einem Eimer dampfend heißen Wassers und schüttete ihn dazu.
»Ich hab schon alles vorbereitet«, erzählte sie. »Ich wusste ja, wo der Patron hingefahren ist. Da war mir klar, dass ich Badewasser brauche. Steig da mal rein, dann tu ich noch ein wenig warmes Wasser dazu. Und dann wirst du erst mal richtig abgeschrubbt. Ich heiße übrigens Malobina Mosambo. Du kannst mich wie alle hier Mama Mo nennen. Das hier ist Seife. Pass auf, wenn du dir das Gesicht wäschst. Du musst die Augen zu machen, sonst brennt es fürchterlich. Aber schön sauber wirst du davon.«
So ging es eine geraume Zeit. Sie schrubbte meinen Körper mit dieser Seife und einem Tuch kräftig von oben bis unten ab und erklärte mir, was Schaum ist, dass die Schale Kutsche hieß und von Pferden gezogen wird, dass man diese Hütte Haus nannte und die anderen großen Hütten Ställe oder Scheune. Ich erfuhr, dass dem Patron alles hier gehörte, dass er seine Frau vor drei Jahren verloren hatte und bei der Gelegenheit erklärte sie mir sogleich, dass ein Jahr mit einem Sommer oder einer Regenzeit bei uns gleichzusetzen war und aus zwölf Monden bestand, so wie bei uns. Ich war also vierzehn Jahre alt. Mir schwirrte der Kopf. In ihrem Redeschwall hatte sie mir auch die wichtigsten ersten Worte, sie sagte Befehle, der Sprache dieser hellhäutigen Wesen beigebracht, damit ich Anweisungen sogleich Folge leisten konnte. Ich wusste jetzt, dass ich den alten Mann nur als »Patron« ansprechen durfte und das eigentlich nur, wenn ich gefragt worden war. Alle anderen »weißen« Männer hatte ich als »Herr« anzureden. Wir würden als »Schwarze«, »Neger« oder schlicht »Nigger« angesprochen, wären Sklaven und hätten alles zu befolgen, was uns gesagt würde. Ich würde hier nicht angebunden, aber jeder Fluchtversuch würde ausnahmslos mit dem Tode bestraft. Das hätte schon einige ereilt, es gäbe hier ohnehin nichts, wohin man hätte flüchten können. Unser Zuhause wäre so weit entfernt, dass ich mir das überhaupt nicht vorstellen könnte und läge jenseits des großen Meeres.
»So. Und jetzt kommt der unangenehme Teil meiner Ansprache«, sagte sie schließlich. »Du bist jung, du bist hübsch und du bist jetzt Eigentum des Patrons. Alle weißen Männer können jederzeit über dich verfügen. Du darfst dich nicht widersetzen, egal, wann und wo sich dich haben wollen. Du weißt schon, was ich meine.«
Ich nickte. »Bordell?«, fragte ich.
»Nein, du bist hier nicht im Bordell. Dort sind die anderen Mädchen, von denen du mir erzählt hast. Im Bordell kommen Männer zu den Mädchen, die bezahlen dafür, dass sie die Mädchen haben dürfen. Die Mädchen müssen dann mit dem Mann schlafen, der für sie bezahlt hat. Jeden Tag. Meistens mehrere Male am Tag. Tagein, tagaus. Du gehörst dem Patron. Er hat mir aufgetragen, dich heute Abend in sein Zimmer zu führen. Dort wird er sich heute Nacht mit dir vergnügen. Und vermutlich auch die nächsten Nächte. Auch tagsüber wirst du ihm deinen Körper zur Verfügung stellen müssen, je nachdem, worauf er gerade Lust hat und wenn er dich auch nur streicheln will. Sei froh, dass er keinen Spaß daran hat, Frauen beim Sex zu schlagen! So lange der Patron über dich verfügt, wird sich keiner der anderen Männer an dich herantrauen. Wenn er aber den Spaß an dir verloren hat, oder auch nur ein paar Tage weg ist, dann werden auch die anderen weißen Männer zu dir kommen, oder dich zu sich befehlen. So viel besser als im Bordell ist es hier also auch nicht. Glaub mir, ich weiß wovon ich rede, auch ich war einmal jung, hübsch und schlank.«
»Wie lange bist du hier?«, fragte ich.
»Über vierzig Jahre«, antwortete sie. »Ich habe unsere Männer kommen, arbeiten und sterben sehen. Ich bin tausend Mal vergewaltigt worden. Ich habe mich zwar nie gewehrt, aber das ändert für mich nichts. Seit ich älter geworden bin und so dick, lassen sie mich in Ruhe. Ich kann leben. Ich kümmere mich um die Küche und dort wirst du mir helfen, wenn du von den Männern nicht gebraucht wirst. Wir sind Sklaven. Vom Leben haben wir nichts mehr zu erwarten.«
Ich sah die Tränen in ihren Augen und erkannte, dass ihre fröhliche Art, ihre Redewut und ihr aufgeräumtes Wesen nur Fassade waren. Eine Fassade, die ihre Verzweiflung verdecken sollte. Sie drehte sich um und versuchte, ihre Tränen zu verbergen und unauffällig wegzuwischen. »Komm«, rief sie. »Wir suchen ein schönes Kleid für dich.«
Wir gingen die Treppe hinauf in ein sehr kleines Zimmer. »Das dort ist dein Bett, darin wirst du schlafen, wenn dich niemand braucht. Und hier im Schrank«, sie öffnete die Klappe eines Holzverschlags, »finden wir sicher etwas für dich zum Anziehen.«
Schließlich trug auch ich so einen Lappen um meinen Körper, der Kleid genannt wurde. Nicht ganz so bunt wie der von Mama Mo, aber für mich doch sehr ungewohnt. Unter dem Kleid war ich nackt. »Die Männer haben es nicht gerne, wenn ihren Gelüsten etwas im Weg steht«, hatte Mama Mo gesagt. »Unterwäsche brauchst du nicht.« Wenn man bedenkt, dass ich nicht einmal wusste, was Unterwäsche war…
7
Im Laufe des Tages erfuhr ich noch eine Menge Dinge, die für mich alle absolut neu waren. Mama Mo sorgte dafür, dass ich etwas zu essen und zu trinken bekam und führte mich ganz allgemein in meine neue Rolle als Hofsklavin ein. Sie erzählte mir, dass unsere Männer auf den Feldern arbeiten mussten und es deutlich weniger komfortabel hätten. Weder von der Unterkunft, noch von den Peitschenhieben her. Die Ernährung war aber angeblich auch dort in Ordnung. Klar, die Männer mussten arbeiten können! Immerhin wurden sie nicht vergewaltigt.
Das stand mir also heute noch bevor. Und nicht nur heute. Immer. Immer wieder. Großartige Perspektive. Wie Mama Mo schon gesagt hatte: Nur weil man sich körperlich aktiv nicht zur Wehr setzt, ist das noch lange kein »Ja«. Ich hatte ja schon meine Erfahrungen im Dschungel gemacht. Aber das war irgendwie anders. Hier wurde ich geplant und angekündigt als Eigentum schlicht benutzt. Ich kann das Gefühl nicht beschreiben, das ich den ganzen Tag in Erwartung des abendlichen Erlebnisses in mir trug.
Schließlich war es so weit. Mo brachte mich in das Schlafzimmer des Patrons. Das verschlug mir erst einmal die Sprache. Ein riesiges Zimmer, in dem ein ebenso riesiges Bett stand. Dicke Decken und Kissen, die schneeweiß bezogen waren. Über dem Bett war eine Art Decke angebracht. Völlig überflüssig, befand sich doch wenige Handbreit darüber die normale Zimmerdecke. Neben dem Bett befanden sich noch Schränke, ein Schreibtisch, eine Konsole und mehrere Stühle in dem Zimmer und über der Konsole war ein großer Spiegel angebracht. Etwas, das ich bis heute nicht gekannt und bei meinem Bad am heutigen Tage erstmals gesehen hatte.
»Manchmal verlangt er, dass die Sklavin auf dem Fell vor dem Bett kniet, wenn er kommt. Egal wie lange und egal, wann er kommt. Er hat mir aber nichts Entsprechendes aufgetragen, also solltest du dein Kleid ausziehen und dich ins Bett legen«, meinte sie und schlug die dicke Decke zurück. Dann zog sie eine Lade an dem Schränkchen neben dem Bett auf, nahm ein kleines Tüchlein von einem Stapel und legte es auf das Schränkchen. »Damit musst du ihm hinterher sein Ding sauber machen. Da legt er großen Wert drauf. Er will sich nicht darum kümmern oder gar dafür noch einmal aufstehen müssen. Sollte er dich bei sich behalten, wischst du dich bitte auch eben sauber, es kann sein, dass er nach einiger Zeit noch einmal zu dir kommt. Wenn er dich wegschickt, kannst du in dein Zimmer gehen. Ich wecke dich rechtzeitig, damit du ihm seinen Kaffee ans Bett bringen kannst.« Sie zündete zwei Kerzen an, die sich in Wandhaltern befanden. Da noch ausreichend Licht durch das Fenster hereinfiel, konnten sie nur für den Abend gedacht sein. Dann strich sie mir leicht über den Kopf, drückte mich kurz an sich und verließ dann leise seufzend den Raum, die Tür vorsichtig hinter sich schließend.
Ich zog mein Kleid aus und legte es ordentlich über einen der Stühle. Dann setzte mich auf das Bett und wippte ein paarmal leicht auf und ab. So weich hatte ich noch nie in meinem Leben gesessen, geschweige denn gelegen. Bis heute hatte ich mir so etwas, so ein Zimmer, überhaupt nicht vorstellen können. Mir fiel meine Bestimmung wieder ein. Ich ahmte Mos Seufzen nach, legte mich zurück ins Bett und zog mir die Decke bis an die Nasenspitze hoch.