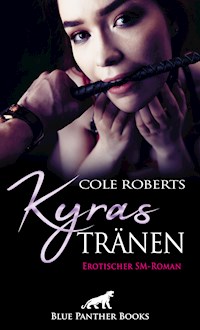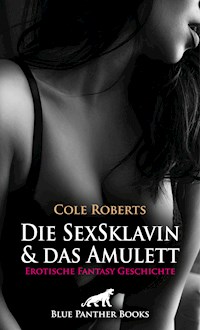Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: blue panther books
- Kategorie: Erotik
- Serie: BDSM-Romane
- Sprache: Deutsch
Dieses E-Book entspricht 240 Taschenbuchseiten ... Loriana di Loreno ist zwanzig Jahre alt und könnte die Welt erobern, wäre sie nicht hoffnungslos dick. Als sie von einer schlanken jungen Frau eine Telefonnummer erhält und diese anruft, verändert sich ihre Welt radikal. Eingesperrt in einer strengen Einrichtung für dicke Frauen, erlernt Loriana die vollkommene Unterwerfung. Ab sofort besteht ihre Aufgabe darin, die Sexlust fremder Männer zu befriedigen. Diäten und ein hartes Training reduzieren ihr Gewicht und machen ihren Körper zu einem perfekten Instrument harter Sadomaso-Praktiken. Gibt es einen Weg aus diesem Albtraum? Oder bleibt sie eine Gefangene der Hurenschule? Diese Ausgabe ist vollständig, unzensiert und enthält keine gekürzten erotischen Szenen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum:
Die HurenSchule | Erotischer SM-Roman
von Cole Roberts
Cole Roberts, geboren 1962 in Stirling, Schottland, arbeitete nach einem Biologiestudium hauptsächlich im Bereich DNA-Analyse und -Forschung und ist Autor mehrerer naturwissenschaftlicher Fachbücher. Vor dreißig Jahren hat er einmal „Die Geschichte der O“ gelesen, ansonsten bestand bisher nie eine Verbindung zur Prosa im Allgemeinen und zur SM- oder Sex-Szene im Besonderen. Seine Protagonistin Kyra hat sich irgendwann in seine Gedanken gedrängt und ihn quasi zum Schreiben aufgefordert. Das hat ihm so viel Freude bereitet, dass er diesen Weg weitergehen und auch künftig erotische Literatur schreiben möchte.
Lektorat: Ulrike Maria Berlik
Originalausgabe
© 2021 by blue panther books, Hamburg
All rights reserved
Cover: © staras @ shutterstock.com © Prostock-studio @ shutterstock.com
Umschlaggestaltung: MT Design
ISBN 9783750703087
www.blue-panther-books.de
Kapitel 1
Ich war verzweifelt! Meine Verzweiflung wurde von Tag zu Tag schlimmer und nahm Ausmaße an, die mir Selbstmordgedanken in den Sinn trieb. Was sollte ich, was konnte ich noch tun? Sicher ein halbes Dutzend Ärzte hatte ich aufgesucht. Pillen geschluckt, Diäten gemacht, es mit Sport versucht. Machen Sie mal Sport mit 145 Kilo, wenn Sie gerade einmal eins siebenundsechzig messen!
Klar hätte man sich in einem Fitnessstudio anmelden oder einen Personal Trainer buchen können. Klar. »Man« vielleicht. Aber ich doch nicht.
Die Tränen drangen durch meine halb geschlossenen Augenlider. Ein Weinkrampf schüttelte mich, während ich im Bus saß und auf die nächste Haltestelle wartete. Zwei Sitze brauchte ich, während andere stehen mussten. Ich fühlte mich schäbig. Zwanzig Jahre alt, praktisch mittellos und hoffnungslos übergewichtig. So bekam man keinen Job, keine Lehrstelle und schon gar keinen Freund. Von dem edlen Ritter, der einen errettet, einmal ganz zu schweigen. Ich konnte schon von Glück reden, dass ich in der kleinen Wohnung von Erika untergekommen war. Sie ließ mich auf ihrer Chaiselongue schlafen und gab mir sogar etwas von ihrem Essen ab. Echt nobel.
Erika war schon in der Schule meine einzige Freundin. Vielleicht aus Mitleid, ich wusste es nicht. Wenn, dann ließ sie es sich nicht anmerken. Sie war immer die Einzige gewesen, die mich in Schutz genommen und getröstet hatte, wenn ich gehänselt wurde. Besonders wenn mich ein paar Jungs wieder einmal umgestoßen hatten und sich belachten, wenn ich mit meiner Körperfülle nicht mehr auf die Füße kam. Sie hatten das getan, damit sie meine Unterwäsche begutachten konnten, die sie als »Dreimannzelte« titulierten.
Ja, Erika war ein Schatz. Der einzige Lichtblick in meinem Leben. Ich versuchte, mich bei ihr zu revanchieren, so gut ich konnte, mit Spülen, Staubsaugen und Bügeln. Mehr vermochte ich nicht zu leisten.
Wieder schüttelten mich Weinkrämpfe. Die Leute guckten schon. Das war normal. Die meisten schauten mitleidig, eine ganze Menge angewidert. »Fette Schlampe!«
Die Haltestelle war nicht mehr weit. Ich musste aufstehen. Wenn ich wartete, bis der Bus hielt, schaffte ich es meist nicht bis zur Tür, wenn der Fahrer nicht aufmerksam war. Darauf wagte ich nicht zu setzen. Langsam, und von einem heftigen Zug meiner Arme unterstützt, wuchtete ich mich hoch. Meine kurz geschnittenen und knallrot gefärbten Haare leuchteten weit. Vielleicht lenkten sie wenigstens den einen oder anderen Blick von meiner Leibesfülle ab. In der Schule hatten sie mich deswegen »die rote Lora« genannt. In Abwandlung meines Vornamens Loriana. Keine Ahnung wie meine Mutter damals auf diesen Namen gekommen war. Möglicherweise war solch ein Name verpflichtend, wenn man »di Loreno« hieß.
Langsam und unsicher ging ich in dem wackelnden Gefährt voran und hielt mich an jeder Stange fest. Den »Halten«-Knopf hatte ich schon beim Aufstehen gedrückt. Als der Bus hielt, hatte ich die Ausgangstür erreicht. Glücklicherweise. Ich trat hinaus. Gut, dass sie vor ein paar Jahren den Ausstieg bei den Bussen höhengleich gemacht hatten. Das war viel einfacher für mich! Langsam ging ich, an einem Energieriegel knabbernd, weiter. Körner. Die sollten gesund sein und beim Abnehmen helfen. Bullshit! Ich hatte Hunger!
Endlich erreichte ich das Ärztehaus und fuhr mit dem Fahrstuhl in die dritte Etage. Dr. Leibnitz. Meine letzte Hoffnung. Irgendwie musste ich eine Magenverkleinerung und eine Reha bewilligt bekommen. Wenigstens einmal zwanzig Kilo weniger würden schon helfen. Neidisch schaute ich die Arzthelferin an. Etwa eins sechzig groß, hübsch und höchstens zweiundfünfzig Kilo. Wahrscheinlich genetisch bevorzugt. Die brauchte bestimmt nicht zu hungern! Allerdings konnte ich mir nicht erklären, warum sie einen so hässlichen Eisenring am Finger trug, der an einigen Stellen kleine braune Stellen zeigte, so, als würde er zu rosten beginnen. Na ja, das würde ich wohl nie erfahren, fragen konnte ich sie sicher nicht.
Im Wartezimmer fühlte ich mich fast wie unter meinesgleichen. Ich sah sehr viel Fett, aber niemand kam an meine Pfunde heran. So ziemlich die einzige Disziplin, in der ich führend war. Schließlich kam ich dran. Das Erste, was ich gewahrte, war ein überdimensionierter Patientenstuhl. Hier war alles auf mich eingestellt!
Dann kam die übliche Tortur: »Seit wann sind Sie übergewichtig? Was essen Sie denn so? Wann? Was trinken Sie? Treiben Sie Sport?« Und so weiter. Sicher eine Viertelstunde lang. Er maß noch meinen Blutdruck und den Puls, hörte mich ab und meinte zum Schluss, dass mir die Schwester noch Blut abnehmen würde. Damit war ich entlassen. Kein Wort über eine OP. Keine Aufmunterung, nichts.
»In ein, zwei Wochen sehen wir uns wieder.« Das war alles.
Eine ältere Schwester nahm mir noch ein paar Röhrchen Blut ab.
Nehmen Sie reichlich, ich habe genug davon. Wieder vierzig Gramm abgenommen. Hurraaa!, dachte ich bei mir und ging zum Empfang, wo mir die kleine Schwester mit dem Eisenring einen neuen Termin geben sollte.
»Vormittags oder nachmittags?«, fragte sie.
»Egal, ich bin nicht berufstätig.«
Sie füllte einen kleinen Zettel aus. Als wir einen Augenblick allein waren, fragte sie: »Ihr Übergewicht belastet Sie sehr?«
»Nein, ich versuche, ständig noch mehr zuzulegen«, raunzte ich.
Sie lächelte und wirkte gar nicht beleidigt. »Sie würden einiges dafür geben, wirklich abzunehmen!«, vermutete sie nicht zu Unrecht.
Wieder stiegen mir die Tränen in die Augen. »Alles«, sagte ich. »Alles, wirklich alles würde ich dafür tun, auch nur zwanzig oder fünfundzwanzig Kilo abzunehmen!« Ich konnte meinen Tränenfluss nicht mehr halten. Glücklicherweise waren wir immer noch allein.
»Können Sie sich vorstellen, dass auch ich einmal mehr als hundert Kilo gewogen habe?«, fragte die Kleine.
»Nein«, sagte ich ungläubig. »Wie …«
Sie schob mir einen zweiten Zettel zu, auf dem eine Telefonnummer stand. »Wenn Sie wirklich bereit sind, alles dafür zu tun, dann rufen Sie diese Nummer an. Sagen Sie, dass Sie die Nummer von der Trägerin eines Eisenringes erhalten haben. Mehr kann und mehr darf ich Ihnen nicht sagen!«, meinte sie bestimmt und wandte sich der nächsten Patientin zu.
Ungläubig schaute ich ihr hinterher, wollte ihr nachgehen, aber sie war mit anderen Patienten beschäftigt. Schließlich raffte ich die beiden Zettel zusammen und verließ die Praxis.
Kapitel 2
Unschlüssig starrte ich auf den Zettel. Drei Tage waren vergangen und ich hatte mich nicht dazu aufraffen können anzurufen. Das wirkte alles so geheimnisvoll. Andererseits, was sollte mir passieren? Ein Anruf konnte nichts kaputtmachen. Das ist es, sagte ich zu mir. Diese Trägheit, diese Unentschlossenheit. Das hat auch etwas mit meiner Figur zu tun. Nie kann ich mich zu etwas entschließen.
Ich wählte die Nummer.
»Ja?« Der Ruf war gerade durchgegangen, schon meldete sich jemand.
»Ich, ich rufe an …« Ich schluckte. »Ich rufe an, ein Mädchen hat mir diese Nummer gegeben.«
»Was für ein Mädchen?«
»Sie hat mir aufgetragen, zu sagen, dass sie einen Eisenring trägt.«
»Ah. Ja. Sie haben Übergewicht!«
»Woher wissen Sie das?«
»Das haben Sie mir gerade verraten.« Die männliche Stimme lachte. »Also Sie möchten abnehmen.«
»Ja. Viel!«
»Wie viel wiegen Sie?«
»Einhundertfünfundvierzig Kilo bei eins siebenundsechzig.«
»Und Sie möchten etwas dagegen tun?«
»Ja.«
»Wir können Ihnen helfen, es wird nicht leicht werden für Sie.«
»Das ist mir egal, ich würde alles tun, um abzunehmen!«
»Alles?«
»Alles!«
»Wirklich alles?«
»Alles, was in meiner Macht steht.«
»Wie alt sind Sie?«
»Zwanzig.«
»Das ist gut. Da ist die Haut noch regenerationsfähig. Hören Sie: Ich benötige ihre Adresse. Wir werden Ihnen in den nächsten Tagen einen Vertrag zusenden. Lesen Sie sich den sehr gut durch. Wenn er einmal unterschrieben ist und Sie die Maßnahme begonnen haben, sind Sie verpflichtet, sie bis zum Ende durchzustehen! Sollten Sie sich entscheiden, den Vertrag zu unterschreiben, schicken Sie ihn uns zu. Alles weitere klärt sich dann telefonisch.«
Ich diktierte ihm meine Adresse, dann kam die logische Frage: »Was kostet mich das alles?«
»Diese Maßnahme ist für Sie kostenfrei. Fragen Sie nicht, warum!« Damit beendete er das Gespräch.
Verdammt! Ich hätte noch tausend Fragen gehabt. Wieder wählte ich die Nummer. Es wurde nicht abgehoben. Was sollte das?
Die nächsten zwei Tage vergingen für mich wie in Zeitlupe. Ständig lief ich zur Tür, um zu schauen, ob die Post schon da war. Als am zweiten Tag noch kein Brief kam, glaubte ich schon, ich wäre einem üblen Scherz aufgesessen. Am dritten Tag war er kurz vor Mittag da. Ich stand nervös im Hausflur und riss dem Postboten den Brief fast aus der Hand. Mit der vollen Wucht meiner 145 Kilo stürmte ich in Erikas Wohnung, nachdem ich mich die zwei Etagen hochgequält hatte. Dann ließ ich mich auf mein Bett fallen, das beleidigt quietschte, und riss den Brief auf.
Ein nettes Anschreiben fiel mir in die Hand, ohne Absender. »Wir freuen uns, dass Sie unser Angebot in Erwägung ziehen … blablabla.« Ein Bogen zum Ausfüllen mit Größe, Gewicht, welche Medikamente man nahm, ob Allergien vorhanden waren und vieles mehr. Dann ein Vertrag mit vielen Artikeln, der über mehrere Seiten ging. Jede Seite hatte eine Unterschriftszeile. Ich würde jede Seite einzeln unterschreiben müssen. So etwas kannte ich nicht, das wirkte wichtig!
»Ziel der Maßnahme ist eine bemerkenswerte Gewichtsabnahme … mit der eine bestimmte Ausbildung einhergeht …«
Über die Art und die Sparte der Ausbildung stand da nichts geschrieben.
»Ernährungstraining …«
Na ja, eine Ernährungsberatung hatte ich schon mehrfach »genossen«.
»Die Maßnahme ist auf ein Jahr angesetzt, bei besonderer Erschwernis kann eine Verlängerung um bis zu einem halben Jahr notwendig sein …«
Also plante ich schon einmal anderthalb Jahre ein. Sicher! Ah, hier stand es: »Eine besondere Erschwernis kann vorliegen, wenn das Übergewicht mehr als 100 % des Normalgewichts beträgt.«
Völlig klar. Mein Normalgewicht betrug siebenundsechzig Kilo, plus 100 % macht 134 Kilo. Da lag ich locker drüber.
»Bitte verabschieden Sie sich von Familie, Bekannten und Freunden, Besuche und Kontaktaufnahmen sind nicht erlaubt!«
Ja, spinnen die denn? War das ein Knast? Selbst dort gab es Besuchszeiten. Mir wurde mulmig. Worauf war ich im Begriff, mich hier einzulassen? »Kein Kontakt«, das klang sehr seltsam. Obwohl: Essen war eine Sucht. Ich hatte schon gehört, dass Suchtkranke aus ihrer gewohnten Umgebung herausgeholt werden mussten. Ob das hier griff?
Dann kamen noch weitere Hinweise: Nur ein kleiner Koffer mit persönlichen Sachen, Rücktritt nicht möglich, Unterkunft und Verpflegung wären frei, bisherige Erfolgsquote 100 % … 100 Prozent? Dass ich nicht lache. Wer glaubte denn so etwas? Wenn jemand keine Lust mehr hatte? Was dann? Rücktritt nicht möglich. Rücktritt nicht möglich? Was sollte das jetzt wieder? Keine Besuche, Rücktritt nicht möglich, alles umsonst. Wie finanzieren die das? War das ein Arbeitslager? Oder ein Puff? Puff? Geht nicht. An so eine fette Kuh wie mich würde niemand drangehen. Schon gar nicht für Geld. Ausgeschlossen!
Mir schwirrte der Kopf. Was sollte ich tun? Zwei Tage schlug ich mich jetzt schon mit diesem Vertrag herum. Konnte nicht schlafen. Die Rücksendeadresse war postlagernd. Rücktritt nicht möglich! Keine Besuche.
Gut, außer Erika würde mich ohnehin niemand besuchen wollen. Und je nachdem wo das war, konnte auch sie nicht. Für längere Fahrten hatte sie kein Geld. Das war also eher unwesentlich. Am Abend zeigte ich Erika den Vertrag.
»Was hältst du davon?«, fragte ich.
Sie überflog die Seiten und schüttelte den Kopf.
»Wie bist du daran gekommen?«, fragte sie. »Das wirkt sehr seltsam. Ich wäre da vorsichtig. Wer weiß, worauf du dich einlässt!«
»Genau das habe ich auch gedacht«, antwortete ich. »Aber was können die mir antun? Mir, einer übermäßig fetten Zwanzigjährigen?«
»Ich weiß es nicht. Irgendwie muss diese … Maßnahme … doch finanziert werden. Das ist kein Wohltätigkeitsverein. Dann hätte das Schreiben auch bestimmt einen vernünftigen Absender mit Adresse, Telefonnummer, Mailadresse, Spendenkonto, Vereinsnummer oder so ähnlich. Das ist alles sehr seltsam!«, wiederholte sie.
»Ja, aber das Mädchen beim Arzt war superschlank und behauptete, auch einmal über hundert Kilo gewogen zu haben.«
»Was weiß ich? Vielleicht ist sie ein Köder? Frag sie doch noch mal.«
Kapitel 3
Am nächsten Morgen unternahm ich wieder die Tortur, mich in den Bus zu wuchten und fuhr zu der Praxis. Als ich in den Vorraum kam, suchte ich vergeblich nach der Kleinen.
»Sie wünschen?«, fragte mich eine Frau mittleren Alters, die ich vor ein paar Tagen auch schon gesehen hatte. »Haben Sie einen Termin?«
»Nein«, antwortete ich. »Ich suche die kleine schlanke Sprechstundenhilfe, die mich am Montag hier betreut hat.«
»Die ist nicht mehr bei uns. Letzten Mittwoch kam sie ohne Entschuldigung nicht zur Arbeit. Sie hat sich nicht gemeldet, nicht angerufen, nichts. Ist nicht mehr hier aufgetaucht und hat sich auch nicht verabschiedet. Einfach nicht gekommen. Wenn wir versuchen, sie telefonisch zu erreichen, heißt es, der Anschluss sei vorübergehend nicht erreichbar. Wir haben keine Ahnung, was mit ihr ist. Unhöflich! Die Nächste bitte!«
Unschlüssig starrte ich die Frau einen Augenblick an. Nein. Eine Privatadresse würde sie mir niemals herausgeben. Also drehte ich mich um und schlich geknickt von dannen.
Am nächsten Morgen hatte ich wieder diesen Vertrag in den Händen und starrte ihn an. Vor lauter Frust hatte ich mir gestern eine Tüte Chips in den Kopf geschoben. Und mich dabei selbst verachtet. Gedankenverloren stieg ich nach dem Waschen auf die Waage. Einhundertsechsundvierzig Kilo. Eine halbe Stunde später war der Vertrag unterschrieben und im Briefkasten!
Wieder dauerte es drei Tage. Drei Tage, in denen ich fast wahnsinnig wurde. Nicht einmal etwas essen konnte ich! Vor lauter Aufregung bekam ich keinen Bissen runter. Eine für mich eher ungewöhnliche Situation. Ergebnis am dritten Morgen: 144 Kilo. Hurra! Ich hatte abgenommen. Haha. Dann klingelte mein Handy. Vor lauter Aufregung drückte ich den Anruf weg. Verdammt! Der Anruf war anonym; Rückruf nicht möglich. Schon wenige Sekunden später klingelte es erneut.
»Hallo?« Meine Stimme zitterte. Verfluchte Aufregung!
»Nervös?« Die Stimme klang belustigt.
»Ja, nein, natürlich, ist … ist doch eine seltsame Situation«, stammelte ich.
»Das kann ich verstehen«, meinte der Mann beruhigend. »Sie sind nicht die erste junge Dame, die sich mit dem Gedanken trägt, sich in unsere Obhut zu begeben.«
»Obhut« klang gut. Aber irgendwie auch nicht beruhigend.
»Sie haben es sich gut überlegt? Sie haben den Vertrag aufmerksam durchgelesen?«
»Ja, das hab ich. Aber da sind noch eine Menge Fragen offen …«
»… die ich nicht beantworten werde …«, fiel er mir ins Wort.
Ich stockte. Er wollte mir keine Fragen beantworten. Warum nicht? Meine Unterlippe begann zu zucken und ich begann unkontrolliert zu weinen.
»Ich kann nicht mehr«, schluchzte ich. »Ich will so nicht mehr weiterleben. Es muss etwas passieren, egal wie …«
»Das ist die richtige Einstellung«, hörte ich an meinem Ohr, »und die beste Voraussetzung für einen erfolgreichen Aufenthalt bei uns.«
»Ich bin so unsicher«, meinte ich mit zitternder Stimme.
»Das ist normal. Sie haben die Vorgaben sicher noch im Kopf. Ein kleiner Koffer, verabschieden Sie sich, Sie sind länger weg. Sie brauchen keine Toilettenartikel mitbringen, keine Schminke, nichts. Was erforderlich ist, bekommen Sie von uns.«
Ich nickte, dann fiel mir ein, dass er das nicht sehen konnte. Ich denke, meine Bestätigung interessierte ihn auch nicht, denn er sprach schon weiter.
»Sie gehen zum Bahnhof. Um Punkt zwölf wird dort ein brauner Kleintransporter stehen. Das sind noch drei Stunden, Sie brauchen sich nicht zu eilen. Er wartet maximal eine halbe Stunde, also versuchen Sie, einigermaßen pünktlich zu sein. Sie werden niemanden treffen, der Fahrer hält sich woanders auf. Die hintere Tür ist nicht verschlossen. Sie steigen ein, verschließen die Tür, setzen sich auf den dortigen Sitz und schnallen sich an. Mehr brauchen Sie nicht zu tun. Seien Sie geduldig, die Fahrt wird mehrere Stunden dauern. Nach dem Eintreffen wird sich die Tür wieder öffnen lassen. Dort erwarte ich Sie und erkläre Ihnen alles weitere.«
Kapitel 4
Selbstverständlich war ich schon um halb zwölf am Bahnhof! Ich hatte mich nicht einmal von Erika verabschieden können. Nur einen Zettel hatte ich ihr hinterlassen, dass ich das Wagnis eingegangen war, und wir uns in ein bis anderthalb Jahren wiedersehen würden. Gegessen hatte ich auch noch nichts. Wer weiß, ob ich heute noch etwas bekommen würde, seltsamerweise hatte ich kaum Hunger.
Nervös schaute ich mir die geparkten Autos an und gewahrte in einiger Entfernung einen Wagen, auf den die Beschreibung passte. Er parkte am Straßenrand. Also auch sie waren schon hier. Unsicher näherte ich mich dem kleinen Transporter. Ja, er musste es sein. Recht klein, braun mit einem Aufbau hinten. Zum Kennzeichen hatte er mir nichts gesagt, es interessierte mich auch nicht.
Verstohlen schaute ich mich um, konnte aber keine Person erkennen, die sich irgendwie für dieses Auto zu interessieren schien. Also stellte ich meinen Koffer ab, griff zum Türöffner, holte noch einmal tief Luft und zog die Tür auf. Ein kleiner Innenraum tat sich auf, deutlich kleiner als der Aufbau. Aber ausreichend groß für einen einzelnen Passagiersitz, der in Fahrtrichtung eingebaut war. Noch einmal suchte ich die Umgebung ab, gewahrte jedoch nichts Auffälliges. Meinen Koffer schob ich rechts neben den Sitz, dann fasste ich mir ein Herz und wollte einsteigen.
Der erste Versuch schlug fehl! Ich kam diesen einen, für mich schon fast unglaublich hohen Schritt nicht hoch. Nicht einmal mein Bein kriegte ich so weit angehoben. Wie sollte ich meine 144 Kilo über einen halben Meter hochwuchten?
Ich guckte, ob mich irgendwer beobachtete. Immer noch schien sich kein Mensch für mich zu interessieren. Unsicher umherspähend setzte ich mich rückwärts auf die Ladefläche und rutschte, so weit ich konnte, nach hinten. Dann schwang ich meine Beine seitwärts und saß knapp hinter dem Sitz auf der Ladefläche. Mit etwas Mühe erreichte ich eine Schlaufe und zog die Laderaumtür mit einem heftigen Ruck zu.
Hoffentlich hatte mich bei diesem Manöver niemand beobachtet!
Wieder musste ich rückwärts und seitlich über die Ladefläche rutschen, ehe ich in eine Position gelangte, in der ich mich an der Lehne festhalten und hochziehen konnte. Erleichtert ließ ich mich in den Sitz fallen, der empört quietschte, während das Auto heftig schaukelte. Es dauerte mehrere Minuten, bis ich mich von der Anstrengung erholt hatte. Am Auto hatte sich in dieser Zeit nichts getan.
Ach, ich sollte mich ja anschnallen. Der Sitz schien für solch propere Personen wir mich gebaut worden zu sein. Er war deutlich breiter als ein normaler Stuhl und der Gurt ließ sich auch gut erreichen, da er an einer längeren Stange geführt wurde. Da hätten sie eigentlich auch an eine Treppe denken können! Ich ließ das Schloss des Gurtes einschnappen. Im selben Moment hörte ich, wie sich die Laderaumtür verriegelte. Die beiden Schlösser waren wohl zusammengeschaltet.
Das wars, jetzt war es geschehen. Ich war eingesperrt.
Wenige Augenblicke später hörte ich die Fahrertür. Sie wurde geöffnet und dann zugeschlagen. Niemand sprach. Der Motor wurde gestartet und die Fahrt begann.
Wieder erfasste mich eine beklemmende Furcht. Worauf hatte ich mich hier eingelassen? Die Angst schnürte mir das Herz ein und ich begann zu schwitzen. Der Passagierraum war belüftet, aber mir wurde heiß. Und dann kalt. Wo wurde ich hingebracht? Was erwartete mich dort? Wie konnte ich so leichtsinnig sein? Das Mädchen hatte gesagt, dass sie auch einmal über hundert Kilo gewogen hatte. Sie sah gut aus und schien sich wohlzufühlen. Hatte sie mich belogen? Und warum war sie so plötzlich verschwunden, nachdem sie mir die Telefonnummer gegeben hatte? Mir wurde immer mulmiger.
Nach zwei Stunden fühlte sich der kleine Innenraum an wie eine Sauna. Entsprechend nass war ich. Mein Handy sagte nichts. Kein Empfang. Weder Internet noch Telefon. So konnte ich unsere Fahrtstrecke auch nicht nachvollziehen. Mist! Da hatte ich viel Hoffnung drauf gelegt. Nach gut drei Stunden schien die Fahrt zu Ende zu gehen. Der Wagen rangierte etwas und dann hörte ich deutlich das Schnappen des Schlosses der Laderaumtür. Also schnallte ich mich ab, stand auf und öffnete die Tür. Die aufschwingende Ladeklappe gab den Blick in einen kleinen Vorraum frei, aus dem nur eine Tür hinaus führte. Ladung angekommen, resümierte ich. Ladung irgendwie aussteigen. Seufzend ließ ich mich wieder auf den Boden rutschen, schwang die Beine aus dem Laderaum, stand auf, griff nach meinem Koffer und ging in Richtung der Tür.
»Herzlich willkommen«, schallte plötzlich eine Stimme durch den Raum, die von überall her zu kommen schien. Ich erschrak, erkannte aber sogleich die Stimme, die mir vom Telefon her bekannt war. »Gehen Sie ruhig durch diese Tür, sie führt in einen Vorraum. Den durchqueren Sie und gehen durch die zweite Tür, dort kommen Sie in einen Flur, von dem in regelmäßigen Abständen nach rechts Türen abgehen. Sie gehen so weit, bis Sie an eine Tür kommen, die weit offen steht. Sie führt in Ihr Appartement. Ihrem Reich, das Sie in den nächsten Monaten bewohnen werden.«
Langsam ging ich den Flur entlang. Er war lang. Nach mindestens fünfzig Metern zweigte ein Gang nach links ab, ich ging weiter. Nach weiteren dreißig Metern kam ich an die Tür, die tatsächlich weit geöffnet war. Das Ende des Flurs konnte ich in dem Halbdunkel, das hier herrschte, noch nicht sehen. Zögernd betrat ich das Appartement. Es wirkte hell und freundlich. Links eine Garderobe, daneben ein Schrank, nach rechts führte eine Tür ins Duschbad, wie ich sehen konnte, da auch diese Tür geöffnet war. Langsamen Schrittes weiter gehend registrierte ich linker Hand eine kleine Küchenzeile, rechts einen Tisch mit einem einzigen Stuhl und sogar ein kleines Sofa mit Couchtisch, auf dem einige Broschüren zu liegen schienen. Durch ein großes Fenster fiel Tageslicht hinein. Ich stellte meinen Koffer ab und trat ans Fenster. Es war massiv vergittert, obwohl es ebenerdig lag, und gab den Blick auf einen kleinen Park frei. Ein paar Bäume, Wiesenflächen, einige Blumenbeete, keinerlei Bewegung. Hier schien es tatsächlich nur durch die Eingangstür wieder hinauszugehen.
Hinter einer weiteren Tür fand ich ein Schlafzimmer, das spärlich möbliert war. Ein üppig dimensioniertes Bett, ein Stuhl und ein kleines, ebenfalls vergittertes Fenster, das den gleichen Ausblick bot, wie das nebenan liegende Wohnzimmerfenster.
»Nun, haben Sie sich mit Ihrem neuen Heim schon vertraut gemacht?«, schallte die Stimme so plötzlich über meinem Kopf auf, dass ich zusammenzuckte. Diese Lautsprecher schienen überall zu sein.
»Ja, nein, ich weiß nicht. Mir gehen so viele Fragen durch den Kopf.«
»Die sicher nach und nach alle beantwortet werden. Ich werde Sie jetzt erst einmal mit den wichtigsten Informationen versorgen. Hier werden Sie wohnen, hier werden Sie schlafen. Ums Essen brauchen Sie sich nicht zu kümmern, das kommt mit dem kleinen Aufzug, den Sie neben der Küchenzeile sehen. Trinken können Sie, so viel Sie wollen, dort auf der Arbeitsplatte der Küche steht ein Sprudler, mit dem Sie sich Mineralwasser bereiten können. Außerdem ist da ein Wasserkocher und in einer der Schubladen befindet sich eine großzügige Auswahl an Teesorten. Zucker werden Sie hier nicht finden.«
»Und was mache ich sonst?«
»Sie werden verschiedene Trainings durchlaufen. Alle Einzelheiten zu erklären, wäre jetzt am Anfang zu viel. Wir zeigen Ihnen den Weg und die Aufgaben, das haben Sie schnell raus. Wir fangen gleich damit an, Sie können sich schon einmal ausziehen.«
»Ausziehen?«, echote ich.
»Natürlich«, antwortete die Stimme, »oder wollen Sie mit Kleidung duschen? Sie haben während der Fahrt erbärmlich geschwitzt, oder nicht?«
»Ja, schon. Aber hätte das nicht Zeit gehabt, bis ich erst einmal richtig hier angekommen bin?«
»Sie sind angekommen. Nach dem Duschen werden Sie ins Schwimmbad gehen und Ihre erste Einheit machen.«
»Sie reden immer mit mir. Können Sie mich auch sehen?«
»Natürlich. Wir haben Einblick in jeden Raum.«
»Auch in die Dusche? Auch wenn ich nackt bin?«
»Auch in die Dusche, auch wenn Sie nackt sind. Schon aus Sicherheitsgründen, falls einmal etwas passiert. Ansonsten werde ich Sie nicht über Gebühr beobachten. Glauben Sie mir: Ich habe hier schon viele Nackte und noch mehr übergewichtige Nackte gesehen. Das ist für mich nichts Außergewöhnliches.«
»Und Sie?«, fragte ich. »Wer sind Sie? Bekomme ich Sie denn auch einmal zu sehen?«
»Nein, das ist nicht vorgesehen. In ihrem Zimmer und beim Sport werden Sie die meiste Zeit allein sein. Bei den anderen Trainings werden Sie auch mit Menschen in Kontakt kommen.«
Mir schien, als habe seine Stimme belustigt geklungen. Was sollte ich tun?
Mir blieb nichts weiter übrig, ich musste das Spiel weiter mitspielen, also zog ich mich aus. Dabei fühlte ich mich ständig Blicken ausgesetzt und schaute mich unbehaglich um, wohl wissend, dass die Kameras genauso gut versteckt waren wie die Mikrofone und Lautsprecher. Nackt ging ich ins Bad. Dort gab es eine Dusche, in der jemand wie ich ausreichend Platz hatte.
Zumindest etwas Luxus, stellte ich fest.
In einem Regal lagen Handtücher. Über dem Waschbecken fand ich einen Zahnputzbecher, eine neue, noch verpackte Zahnbürste und Zahncreme sowie eine Haarbürste. Sonst nichts. Nicht einmal ein Spiegel befand sich über dem Waschbecken. Seltsam. Nachdem ich mich ausgiebig geduscht und intensiv abfrottiert hatte, ging ich zurück in mein Zimmer, um mich anzuziehen. Meine Sachen waren weg! Ebenso mein Koffer.
»Was soll das?«, rief ich. »Ich brauche meine Sachen!«
Die prompte Reaktion bewies mir, dass die Stimme mich ständig belauschte. Sicher hatte sie mich auch beim Duschen beobachtet.
»Deine Sachen benötigst du in der nächsten Zeit nicht. Stell dich vor die Tür.«
Verdutzt wollte ich protestieren, ließ es dann aber. Ab jetzt wurde ich also geduzt. Eine recht plötzliche Veränderung der Umgangsformen. Gerade jetzt, wo ich nackt, schutzlos und unsicher war. Wütend stürmte ich ins Schlafzimmer und zog mir die Decke vor den Körper.
»Ich will mich anziehen!«, rief ich. »Und im Bad will ich einen Badeanzug!«
»Du wirst dich an die Nacktheit gewöhnen«, versuchte die Stimme mich zu beruhigen. »Außerdem solltest du dich an die wichtigste Regel halten, die hier gilt: Gehorsam! All das hier funktioniert nur, wenn du gehorchst. Absolut! Das wirst du im Verlauf der Zeit verstehen. Du bist jetzt hier, du hast deinen Vertrag zu erfüllen und dazu gehört, dass du tust, was dir gesagt wird. Immer, ohne Ausnahme und sofort. Da heute dein erster Tag ist, wirst du für Ungehorsam nicht bestraft. Sei versichert, dass es nicht nur Strafen geben wird, sondern dass wir auch die Möglichkeiten haben, Befehle durchzusetzen. Also geh jetzt zur Tür. Sofort!«
Ich erschrak. Das »Sofort« hatte eine Schärfe gehabt, eine fast hypnotische Intensität, dass ich die Decke auf das Bett warf und tatsächlich zur Tür eilte. Diese öffnete sich wie von Geisterhand und ich war überzeugt, dass ich sie vorher nicht hätte öffnen können.
»Links den Gang entlang und dann rechts in den abzweigenden Gang, den du vorhin schon gesehen hast. Den gehst du bis zum Ende.«
Dort fand ich wieder eine Tür, die für mich offen stand, kam in einen Vorraum und von dort in ein mittelgroßes Bad.
»Du wirst in das Becken steigen und zunächst eine halbe Stunde Folgendes machen: Du schwimmst eine Bahn und gehst dann die Bahn zurück. Genauso. Immer hin und her. Streng dich ruhig ein wenig an, damit du ins Schwitzen kommst. Deswegen ist das Wasser auch nicht zu warm, es dürfte erträglich sein.«
Als ich ins Wasser stieg, zitterte ich nicht nur vor Kälte. Hier war alles so surreal. Eine Stimme, die ständig bei mir war, ansonsten war kein Mensch zu sehen. Türen, die sich von selbst verriegelten und öffneten. Sachen, die verschwanden. Das Wasser reichte mir etwa bis zur Brust. An die Temperatur hatte ich mich schnell gewöhnt und so schwamm ich die erste Bahn. Es war gar nicht so kalt, genau wie er gesagt hatte. Dann stellte ich mich auf und ging die Bahn zurück. Das war deutlich anstrengender als das Schwimmen. Die Kühle des Wassers spürte ich nicht mehr, stattdessen wurde mir langsam warm. Schon nach wenigen Bahnen merkte ich, wie mir der Kopf zu glühen begann, so wie ich es von früher her kannte, wenn ich versucht hatte, mich sportlich zu bewegen. Das Wasser nahm mir viel vom Schwitzen ab.
»Wenn wir deinen Körper an eine Belastung gewöhnen wollen, so ist das im Wasser am besten. So werden deine Gelenke nicht strapaziert und du brauchst das Gewicht deines Körpers nicht zu tragen, das übernimmt überwiegend das Wasser für dich«, erklärte die Stimme.
Klar, dachte ich, Fett schwimmt halt oben.
Trotzdem war ich nach zehn Minuten völlig fertig. Die Uhr im Bad tickte in quälender Langsamkeit. »Eine halbe Stunde«, hatte er gesagt. Wie sollte ich das schaffen?
Klar, er hatte meine Schwäche bemerkt.
»Lass es ruhig etwas langsamer angehen«, meinte er zu mir. »Wichtig ist nicht das Tempo, sondern dass du die halbe Stunde durchhältst.«
Leicht gesagt. Die letzten zehn Minuten wankte ich mehr durchs Wasser, als dass ich lief oder schwamm. Am liebsten hätte ich aufgehört, traute mich aber aus mir unerfindlichen Gründen nicht.
»Das reicht«, erlöste mich die Stimme schließlich. »Lass dich jetzt einfach ein wenig vom Wasser tragen, bis sich dein Puls erholt hat und du nicht mehr so stark schwitzt. Du hast Zeit, nichts treibt dich hier. In etwa einer Viertelstunde bin ich wieder bei dir.«
Ob er jetzt tatsächlich irgendwo anders hinging? Oder sich mit einer anderen Dicken beschäftigte? Seit meinem ersten Gang durch den Flur ließ mich die Frage nicht mehr los, wie viele übergewichtige, junge Frauen hier untergebracht waren. Oder gab es auch ältere Semester? Oder gar Männer? Ich konnte mir nicht vorstellen, dass er mir diese Fragen beantworten würde.
»Hallo?«, rief ich schüchtern.
Es kam keine Antwort. War ich tatsächlich allein? Ganz allein? Ich vermochte es nicht zu glauben.
Pünktlich nach fünfzehn Minuten war er wieder da.
»So jetzt steigst du aus dem Wasser und gehst dort in die Ecke, wo du diesen Schemel und den gelben Schlauch siehst. Du setzt dich auf den Schemel, drehst das Wasser auf, es ist kalt, und versuchst, dir die ganze Körperoberfläche damit zu massieren. Die Strahlen sind kräftig, das wirkt gut. Du hast noch eine junge Haut, die sich selbst regenerieren kann. Dabei müssen wir ihr dadurch helfen, dass wir die Durchblutung anregen. Und damit sollten wir schon am ersten Tag anfangen. Die Rückenpartie kannst du nebenan an dem Duschpanel bearbeiten. Da darfst du sogar etwas warmes Wasser zumischen.«
Ich tat wie mir geheißen und richtete den kalten Strahl zuerst auf meine Beine. Es war eisig!
»Weiter machen!«, schallte die Stimme durch das Bad. »Auch daran wirst du dich schnell gewöhnen.«
Schließlich hatte ich mich am ganzen Körper massiert und den Rücken vom Duschpanel bearbeiten lassen. Die Stimme führte mich zurück in mein Appartement, deutlich hörte ich, wie sich die Tür hinter mir verriegelte, nachdem ich sie hatte ins Schloss fallen lassen.
Ich hatte einen Durst, wie ich ihn noch nie gekannt hatte, also machte ich mir zuallererst Sprudelwasser. Das musst du dir zukünftig vorbereiten und in den Kühlschrank stellen, dachte ich. Etwas gekühlt wäre besser. Dann hörte ich den Fahrstuhl und bemerkte, wie mein Magen knurrte. Meine Hoffnung und mein Magen wurden enttäuscht: nur eine Schüssel mit Obst, ein paar geschälten Möhren und zwei Scheiben Kohlrabi. Nicht einmal eine Banane war dabei. Ich hatte es geahnt. Trotzdem machte ich mich hungrig über die Sachen her. Hinterher blätterte ich unlustig durch ein paar Magazine. Lesen war noch nie mein Ding gewesen. Aber einen anderen Zeitvertreib schien es hier nicht zu geben. Einen Fernseher suchte ich vergeblich.
»Nicht vorgesehen«, meinte die Stimme, als ich danach fragte.
Also ging ich schließlich früh ins Bett. Der Tag war anstrengend gewesen und so konnte ich wenigstens mit der Bettdecke meine Blöße verdecken.
Kapitel 5
Am nächsten Morgen gab es ein eingeschränktes Frühstück: Obst, Tomaten, Möhren und immerhin ein Ei. Kein Salz für das Ei oder die Tomaten. Während des Frühstücks dozierte die Stimme über meine Abnehmziele. Ich erfuhr, dass mein Körper normalerweise einen Wasseranteil von etwa 67 % hat. Dass da Knochen, Zähne und Muskelgewebe eingerechnet sind, während mein Übergewicht praktisch nur aus Fett und Haut bestand und somit einen Wasseranteil von mehr als 85 %, eher 90 % hatte. Das Ziel sollte also sein: Wasserverlust! Darum zunächst kein Salz. Aber viel trinken. Was für mich seltsam klang. Viel trinken, um Wasser abzugeben?
»Ja«, meinte die Stimme, »es muss ausgeschwemmt werden. Abnehmen kann man nur über die Nieren, durch Schweiß und Verbrennung, niemals über den Darm. Da kommt nur raus, was man zu sich genommen hat und tote Darmbakterien.«
Man lernt nie aus!
Nach dem Frühstück ging es ins Schwimmbad, wo ich meine halbe Stunde Wasserjogging mit nachfolgender Hautpflege ableistete. Anschließend ging es nicht sofort zurück ins Zimmer, sondern einen Weg, den ich noch nicht kannte. Schließlich stand ich vor einer Tür, die sich ebenfalls von selbst öffnete. Ich trat ein und gewahrte einen Friseurstuhl. Friseurstuhl? Meine Haare waren kurz! Sie leuchteten mir grellrot aus dem Spiegel entgegen, der sich vor dem Stuhl befand. Direkt darunter sah ich meinen kugelrunden Kopf, der fast ohne Hals auf einem unförmigen, unglaublich fetten Körper prangte. Das Gesicht des runden Kopfes wurde blass, nur um gleich darauf puterrot anzulaufen. Ja, das war ich. Dort stand das nackte Ergebnis meiner Fresslust. Des Anschauens nicht wert.
»Ich weiß nicht, warum ihr dicken Frauen immer so einen fürchterlichen Hang zu grellroten Haaren habt«, meinte die Stimme zu mir. »Da wir hier ein Ausbildungsinstitut sind, werden wir heute daran etwas ändern.«
»Ich will nichts daran ändern!«, rief ich. »Meine Haare gefallen mir so, wie sie sind!«
»Du wirst dich daran gewöhnen müssen, dass dein Wille hier nicht immer entscheidend ist. Eigentlich ist er völlig unwichtig. Wie ich dir schon gesagt habe, sollst du hier unter anderem auch Gehorsam lernen. Dazu gehört auch, dich von Dingen zu befreien, hinter denen du dich verstecken kannst. Wie deine roten Haare. Setz dich!«
Wieder diese unglaubliche Schärfe in der Stimme. Ich widerstand. »Nein!«
»Setz dich, sofort!«
»Nein! Die Haare bleiben rot!«
Eine Tür öffnete sich und zwei Männer in einer Art blauer Arbeitsuniform traten ein. Beide trugen schwarze Lederhauben, die nur Augen, Ohren und Mund frei ließen. Unter der Leder bedeckten Nase befanden sich zwei Atemöffnungen. Die Hauben bedeckten fast den gesamten Kopf und machte die Männer völlig unkenntlich, wie eine Maske. Sie packten mich grob und setzten mich in den Stuhl. Ich hatte keine Chance, mich zu wehren. Danach wurden meine Hände und Füße an den Lehnen und Beinen des Stuhls festgebunden. Die Schnallen waren mir vorher entgangen. Ich war gefesselt. Gefesselt und nackt im Stuhl, den Blicken der Männer hilflos ausgeliefert.
»Was soll das?«, rief ich. »Ich will nicht!«
»Ich werde mich nicht dauernd wiederholen«, sagte die Stimme.
Als ich gerade zu einem erneuten Protest den Mund öffnete, schob mir einer der Männer mit einem schnellen Ruck einen Holzstab zwischen die Zähne, an dessen Enden Metallketten mit Schnallen hingen. Der andere Mann griff zu den Schnallen und verzurrte sie hinter meinem Kopf, während der erste den Holzstab in meinen Mund gedrückt hielt. Der Stock schnitt schmerzhaft in meine Mundwinkel. Ein Protest war nicht mehr möglich. Im Spiegel starrte mich ein fettes rothaariges Mädchen boshaft an, das eine Kandare im Mund hatte wie ein Pferd. Einer der Männer steckte eine Stange hinten in die Rückenlehne des Sitzes, die einen Querbalken hatte. Daran wurden zwei weitere Stangen befestigt, die seitlich an der Kandare eingeklinkt werden konnten. Sie rasteten deutlich hörbar ein. Ich konnte meinen Kopf nicht mehr bewegen.
Die beiden Männer gingen und ein anderer Mann kam, der ebenfalls eine Maske trug.
»Du siehst, dass wir hier auf alles vorbereitet sind«, meinte er gleichmütig. »Du bist nicht die erste junge Dame, die sich sperrt.«
Er begann damit, mir meine Haare mit einem elektrischen Haarschneider in dicken Büscheln vom Kopf zu rasieren. Wie einem Schaf bei der Schur. Ich hielt still. Was sollte ich mich noch wehren? Den Kopf hätte ich ohnehin nur minimal bewegen können. Im Spiegel beobachtete ich, wie sich meine rote Haarpracht Stück für Stück verflüchtigte. Das ging bemerkenswert schnell, er brauchte nicht auf einen korrekten Schnitt zu achten. Im Nacken störte meine Fessel, das schien er zu kennen. Mit demselben Gleichmut, wie er gesprochen hatte, schob er meinen Kopf ein wenig hoch und runter und hatte auch diesen vielleicht anderthalb Zentimeter breiten Streifen schnell geschnitten. Er nahm sich einen Rasierpinsel, schäumte meinen Kopf ein und entfernte mit einem Nassrasierer sorgfältig die Reste meiner Haare. Damit nicht genug, er rasierte auch meine Augenbrauen ab, sodass ich glatzköpfig war wie eine Bowlingkugel. Ungläubig betrachtete ich meinen dicken, kugelrunden Kopf im Spiegel und beobachtete die einzelne Träne, die sich aus meinem rechten Auge heraus ihren Weg bis zum Nasenflügel suchte. Das kitzelte fürchterlich, aber ich vermochte mich nicht zu kratzen.
Plötzlich fuhr die Rückenlehne zurück, zwangsläufig streckte ich mich und nahm wahr, dass sich die Stuhlbeine auseinander bewegten. Von einem leichten Summen der Elektromotoren begleitet wurde ich in eine Position gefahren, die ich vom Frauenarzt her kannte und die dem Friseur meine Scham trotz meiner dicken Schinken mit weit gespreizten Beinen leicht zugänglich präsentierte. Ich wollte schreien, protestieren, meine Schenkel zusammenpressen, nichts von alledem gelang mir, gefesselt wie ich war.
Mit geschäftsmäßiger Gleichgültigkeit zog sich der Mann einen Schemel heran, setzte sich und verschwand damit aus meinem durch die Kandare eingeschränkten Blickwinkel. Wieder machte sich der Rasierer an die Arbeit und ich »sah« förmlich, wie meine Schamhaare grob abgeschnitten wurden. Anschließend spürte ich einen Pinsel an meiner Musch, als er Venushügel und Schamlippen einseifte. Bis gestern hatte mich noch nie in meinem Leben ein Mann nackt gesehen. Ja, leider. Das hätte ich mir auch anders gewünscht. Aber niemals so!
Ich war zwar fett, aber eine Jungfrau. Und jetzt lag ich hier mit weit gespreizten Beinen und ein wildfremder Mann fummelte und kratzte mit einem Rasiermesser an meiner Möse herum. Er rasierte mich akribisch, fuhr mit beiden Beinen fort und sprach mich dann an: »Wenn ich jetzt deine Arme losbinde: Schaffen wir die Arme und Achseln, ohne dass ich die Kavallerie rufen muss?«
»Darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an«, presste ich schluchzend an der Kandare vorbei heraus.
So löste er meine Handfesseln, ich hob bereitwillig die Hände in die Höhe und er beendete seine Arbeit damit, dass er mir noch beide Arme und die Achseln rasierte. Da ich keine Haare auf den Zähnen hatte, war mein Körper jetzt vollkommen haarlos. Sehen konnte ich mich in der Liegeposition im Spiegel zwar nicht mehr, aber da mich Weinkrämpfe schüttelten und meine Augen tränenüberströmt waren, hätte ich vermutlich ohnehin nichts erkennen können. Was hatte ich getan? Worauf hatte ich mich eingelassen? So langsam wuchs die Erkenntnis, dass ich die Sache etwas blauäugig angegangen war!
Nachdem er seinen Auftrag der Komplettenthaarung erfüllt hatte, trocknete er mich noch ab und fuhr den Stuhl in Normalposition. Fast dankbar registrierte ich, wie sich meine Beine wieder schlossen. Dann kamen die beiden anderen Männer zurück und befreiten mich aus meiner misslichen Lage. Wütend sprang ich auf, so schnell es mir meine Pfunde erlaubten, sprang auf einen der Männer zu und trommelte gegen seine Brust.