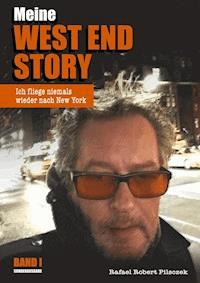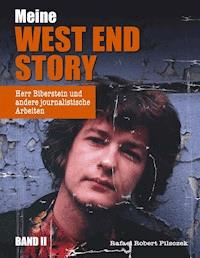Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rafael R. Pilsczek beschreibt in seinem neuen Roman die heutigen Sicherheiten und Unsicherheiten des Lebens in offenen Gesellschaften. Der amerikanische Dichter Lance Biermanski aus Deep River und sein Kusin Joffe, ein junger deutscher Geschäftsmann, der im Widerstehen zum Helden wird, zeigen, was Demokraten und Freunde des Lebens am ehesten vor dem Untergang unserer humanistischen Gesellschaften beschützt: wehrhafte Humanisten zu sein oder zu werden. Der Extremismus hatte Joffe und seine Freunde zum Harburger Aufstand gezwungen, der in den ersten Krieg unter Europäern mündete. Wie aus Joffe ein Held in neuen Zeiten wird, davon erzählt diese Familiengeschichte. Das Drama entfaltet sich vor dem Hintergrund neuer Mächte und Realitäten. Der Freund der beiden Kusins, der Bahai Lafayette, erzählt ihre Lebensgeschichte voller Abenteuer, großer Ereignisse und nicht zuletzt auch ihrer sehnsüchtigen Freude am Leben. Das 11. Buch des Hamburger Schriftstellers ist seine Antwort auf die Gegenwart eines neuen Zeitalters. Es trägt die Vision in sich, wie aus dem etwas Gelungenes wird, was wir in uns tragen. Und dass die erlebten Bedrohungen nicht, so Gott will, noch größere Schrecknisse und eine neue Wirklichkeit mit sich bringen werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 776
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
Weitere Informationen:
www.ppr-hamburg.com
www.pilsczek.com
Inhaltsverzeichnis
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Widmung
Den Vätern, Söhnen und Männern,
die an vielen Orten und in vielen Zeiten
Verantwortung übernommen
haben, so dass die Würde des
Menschen unantastbar blieb. Und
den Außergewöhnlichen unter diesen,
denen ich nahe kommen durfte.
Besonders denke ich an Mustafa
aus Altona, der mich darum bat,
dass ich dieses Buch auch für
ihn schreibe. Er hatte es versucht,
ein guter Mann des Lebens und der
Worte zu werden und war darin
ohne eigene Schuld gescheitert.
Ich sage allen diesen Danke.
Zitat
„Ich bete, dass Sie und Ihre Lieben in Sicherheit sind.“
„T. ist unaussprechlich. Er ist, wenn Sie mir verzeihen, ein Braunhemd, mit schrecklichen autokratischen Tendenzen und genug Macht, um vieles davon durchzusetzen. Gott sei Dank ist mein Vater nicht mehr am Leben, um das zu erleben.“
„Ich fürchte, Sie haben Recht, dass dies ein entscheidender Moment ist. Entweder kippen wir in Richtung mehr Unruhen oder wir kehren zu einer gewissen Form von Normalität zurück.“
„Auch ich bin stolz auf Ihre Regierung, aber nicht auf unsere, die von Kleptokraten und irreligiösen Autokraten geführt wird. Eine sehr gefährliche
Zeit. Hoffentlich können wir das Ruder herumreißen.“
„Bleiben Sie dran und Gott segne Sie!“
Der amerikanische Freund
Washington, D. C., (Frühjahr 2020)
I. Kapitel
Es ist, das muss ich der Ehrlichkeit halber erwähnen, eine klägliche, gleichwohl ernsthafte Entschuldigung, dass ich von Beruf Jurist und Verleger und nicht der geborene Schriftsteller bin. Vielleicht bräuchte es einen Romancier des 19. Jahrhunderts, der Gesellschaftsepochen in gut lesbare Romane verwandelte. Die Worte und Sätze, die verfasste Form eines Buches, sind meiner Meinung nach ebenso wertvoll wie der Inhalt der darin enthaltenen Menschen und der Inhalt ihrer Schicksale.
Es ist mir zum einen zur inneren Pflicht gereift und zum anderen zur frohmütigen Aufgabe geworden, dieses Buch zu schreiben, obwohl der Zustand „Frohmut“ in diesen schweren Zeiten kaum erreicht werden kann. Den beiden Kusins ein Denkmal zu meißeln und zu schleifen bereitet mir gleichwohl Freude. Es ist meine Pflicht über sie zu schreiben. Ich kann leider nicht jedem Menschen eine Erzählung über sich bieten. So viele bedeutsame Menschen traf ich, die ihnen zur Seite standen oder die in der Mitte der Taten gewirkt haben. Nur einige von ihnen kann ich erwähnen, was schade und zu beklagen ist. Es ist gleichwohl nicht zu ändern, mehr als das für mich Mögliche zu leisten. So beziehe ich mich weitgehend auf die beiden Blutsverwandten. Dort bin ich bereit, alles breit und tief zu ihnen und ihrer langen Familiengeschichte zu berichten. Ich bin nicht der Beste im Präsentieren. Mir geht es gleichwohl um die Sache.
Jeder Mensch hat ein unbedingtes Anrecht darauf, seine eigene Geschichte zu erzählen oder erzählt zu bekommen. Jeder Mensch steht darin auch in unveräußerlicher Gleichheit zum nächsten. Wenn ihm dazu die Mittel und die Fertigkeiten fehlten, wäre es die Aufgabe der Gemeinschaft, diese Herausforderung zu meistern. Dies ist tatsächlich mein fester Glaubenssatz als Verleger. Es ist mir im Laufe meines Lebens sehr klar geworden, dass es ein Verbrechen unserer Gesellschaft an den zahllosen Namenlosen ist, dass diese ihre Geschichte als unerwähnt erleben und als unerzählt hinterlassen. (Und ich weiß, dass es keine noch so große Gemeinschaft von Schriftstellern zu leisten vermag, diesen Mangel jemals ausgleichen zu können.)
Es mag vielen als ein Unterfangen ohne viel Sinn erscheinen, jedem Menschen eine Hinterlassenschaft über seinen Tod hinaus mitzugeben. Würden die Geschichten von allen erzählt, fehlte uns nicht das Besondere der Auswahl? Dies ist genau das Diktatorische, dass es nur wenige sind, die entscheiden, wessen Geschichte erzählt wird und wessen nicht. So geschieht es in der Bücherwelt, so geschieht es an zu vielen Orten unseres Gesellschaftssystem heutzutage.
(Meine Aussagen entfalten einen noch größeren Sinn vor dem Hintergrund, dass die Welt des kabellosen Geflechtes sich rasch veränderte nach den Vorfällen in den All-Americanas und der Partnerschaft mit der New Asia Alliance. Das Geflecht war geschlossen worden und die Freiheiten zu Unfreiheiten geworden. Die frühere Vision war längst gescheitert. Es war nicht mehr wahr, dass jeder eine freie und wahrhaftige Erzählung von sich hätte und hinterließe. Nun ist dies selbst eine längst erkaltete Geschichte geworden, da diese Kabel gekappt worden sind.)
Meine hiermit vorliegende erzählerische Hinterlassenschaft geschieht nun, leider, zu Zeiten eines neuen Horrors. Im Grunde müsste dieser nun lang anhaltende Terreur Absolue ohne Worte bleiben, hätten Worte nicht weiterhin Gewicht. Worte kommen auch dem Schlimmsten bei, da der Mensch am Ende sehr viel erträgt.
Selbst nach der Shoah fanden sich Jahr auf Jahr Worte, die den absoluten Schrecken des Holocaust besser und besser in Sprache einfasste. Davon zeugen viele schriftstellerische Arbeiten. Solche früh der Auschwitz-Überlebenden eines Elie Wiesels und später eines Roman Fristers. Auch Deutsche, die unterdrückt waren, ohne in den Vernichtungslagern gewesen zu sein, führten die Sprache dazu fort, wie die Bücher des Hamburgers Ralph Giordano zeigen. Auch ein Paul Celan beweist diese wiedergefundene Sprache in seinem nach dem Zweiten Weltkrieg verfassten Gedicht „Die Todesfuge“, das als das beste Gedicht in der deutschen Sprache überhaupt gewürdigt wurde. Wolfgang Borchert ist vielleicht ebenso zu erwähnen, der über die deutsche Soldaten und die Heimgebliebenen nachdachte und das Stück der Heimkehrer aus dem Krieg auf das Beste verfasst hat in seinem Text „Draußen vor der Tür“.
Der eine Kusin in diesem Buch ist ein Schriftsteller aus den All-Americanas. Lance ist sein Vorname.
Der andere ist ein Deutscher und in seinem besonderen Leben unter anderem Kriegskundschafter gewesen. Er heißt Joseph und wurde seit der Kindheit Joffe gerufen, was sein gerade bei Frauen sehr beliebter Spitzname blieb.
Beide haben derart gehaltvoll gehandelt, gesprochen und geschrieben, dass mir ihre Worte für uns und für unsere Kinder und Kindeskinder als bedeutsam erscheinen und ich sie in diesem Buch bewahren möchte.
Dieses Buch ist vor allem das Geschenk an alle Menschen aus dem Leben der beiden Kusins.
***
Ich bin mir sicher, dass die Meinungen vielfältig sein werden, darunter wohlwollende, bewundernde, gnadenlose und auch niederträchtige. Es wird aus Teilnahmslosigkeit heraus auch gar keine Urteile geben. Es wird solche geben, die in der Urteilsfindung von den Göttern der Anhängern der Weltregionen geleitet sind, von Anhängern der politischen Gedankenwelten und von Anhängern vieler Kulturgemeinschaften und Teil-Gemeinschaften. Auch einzelne Personen werden ihre Meinung finden, die aus Überheblichkeit oder aus Unkenntnis über sich in ihrer Meinung alleine stehen werden. Auch solche werden dabei sein, die sich aufgrund ihrer Verwirrung nicht leicht einem Milieu zurechnen lassen. Als Ausnahme lasse ich die gelten, die durch harte Arbeit des Denkens eine eigene, nachvollziehbare Meinung gefunden haben.
Dazu gehören die sogenannten Eklektiker. Diese Menschen haben die Möglichkeiten und Fähigkeiten, durch ihre Analytik aus den Büchern ein eigenes Gedankengebäude, ein eigenes intellektuelles System zu erschaffen. Dazu gehört, dass sie ihre Erforschungen mit tatsächlich eigenem Erlebten anreichern. Es meint nicht, sich aus dem Vorhandenen seinen eigenen Cocktail zum Genuss zu mixen. Es meint, aus eigener Kraft zu einer eigenen Haltung zu kommen. Sehr wenige gehen diesen Weg. Die, die ihn gehen, haben unsere Hochachtung verdient.
Als einen solchen sehe ich den Bundeskanzler der alten Bonner Republik, Helmut Schmidt. Zeit seines Leben war er ein Lernender. Und ihm war ein sehr hohes Alter vergönnt. Er war stets im Gespräch mit den Klugen, Einflussreichen und Machtvollen. Dieser Mensch bestand viel aus Pflicht. So ist er ein Vorbild geworden, fand immer ein kluges Argument zu einer Lage. Erst das Argumentieren ermöglichte ihm gutes Regieren, selbst dort, wo Politik Macht war und ist. Wer ihn hörte und las, vor allem weit nach seiner Zeit als Staatsmann, der konnte sich ihm kaum entziehen.
So ist er das Beispiel eines Eklektikers, dessen geschriebene und gesprochene Worte wir gut verstanden. Er hat niemals aufgehört zu versuchen, sich jedem Menschen verständlich zu machen, ein Lehrer und Unterweisender von viel Wissen zu sein. Ihm gelang genau dies.
Ob Joffe und viele andere aus Hamburg-Harburg das Richtige aus seiner Sicht taten, ist eine schmerzende Frage. Sie findet keine Antwort, da Herr Schmidt bereits lange vor den Ereignissen verstarb. Wie wäre sein Urteil ausgefallen? Dass Joffe und viele andere ohne ihn und seine Empfehlung handelten, war richtig. Nicht zu handeln, da die Vorbilder den Segen nicht erteilen konnten, wäre falsch gewesen. Das gilt selbstredend vor allem für diese, die lange oder längst verstorben waren.
Es liegt wie stets daran, wie sich die Nachfahren später mit dem, was ich hiermit vorlege, beschäftigen und in welchen Zeitströmen sie fließen werden. Es ist heute nicht einsichtig, wie die Zukunft über die Taten unserer Gegenwart sprechen wird, lobend oder tadelnd, anerkennend oder verächtlich, gelangweilt oder elektrisiert, schlicht oder umfänglich, weich oder hart, vernichtend oder huldigend.
***
Die Linie der Familie von Lance und Joffe ist – wenn auch vage – ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu verfolgen, also bis zu den Bewegungen der republikanischen Deutschen und dem im Krieg erzwungenen Umstand, aus dem Flickenteppich des ehemals Heiligen Reiches Deutscher Nation das geeinte Deutsche Reich als eigene, geeinte Nation zu schaffen. Die Biermanskis, da Bergleute zu jener Zeit, waren nicht weiter rückwärtig zu recherchieren, so dass ihre Geschichte mit den Eltern von Hermann L. Biermanski beginnt, deren Sohn dann in das Licht der ersten tatsächlichen und belegten Fakten rückte.
Es war damals eine anstrengende Zeit, da sie regelmäßig auf Frieden Krieg und auf Krieg Frieden folgen ließ. Anfang des Jahres 1871 zogen der preußische König und seine Bande, beschönigend Entourage, also ihn treu Umgebende genannt, in den Spiegelsaal des Schlosses der Franzosen in Versailles nahe Paris ein. Dort riefen sie den deutschen König zum Kaiser Wilhelm I. aus und begründeten von oben nach unten das „Deutsche Reich“. Das geschah im raschen Anschluss an den blutigen Krieg gegen die französischen Nachbarn.
Die Krönung war eine bewusste Tat der Erniedrigung, nur darum wurde diese auf dem Boden des besiegten Feindes ausgeführt. Damit nahmen sie den Franzosen neben dem Sieg noch etwas anderes, etwas, das als „Stolz“ und „Ehre“ bekannt ist. Die Biermanskis lebten damals auf der Fläche der Preußen und des Kaisers Wilhelm I. und des II. Ihr Leben dort war mit den großen Entwicklungen und Wirrungen verwoben. Dass die Großmutter von Lance und Joffe es als den schönsten Moment in ihrem Leben ohne Unterlass beschrieb, Kaiser Wilhelm II. hoch zu Ross an ihr vorbei reiten gesehen zu haben, ist ein Momentum, das zeigt, dass die große Geschichte auch stets die kleine Geschichte sein kann. Dass Agathe dabei empfand, wie sie sagte, dass der Kaiser ihr einen besonderen Blick zuwarf, mag Legende sein. Tatsächlich hat dieser Moment aus ihr stets eine Frau gemacht, die ihre Kaiser-Treue und spätere Hitler-Treue darin fand, wie sie es verstand, dass bestimmte Männer der Größe in ihr Gefühle der eigenen Größe bewirkten.
Der Angriff von 1870/71 auf Frankreich war nur eine der vielen innereuropäischen Traurigkeiten, seitdem der Gott Zeus eine Frau – die Europa – der Sage nach dem damaligen Osten entriss und nach Kreta entführte. Kreta war bereits griechisch geprägt und lag als südlichste Insel des europäischen Kontinents wenige Kilometer nördlich des späteren Arabiens. Dort, auf Kreta, löste dieser Gott der Götter vor drei Tausend Jahren die Geschichtsschreibung dieses Kontinents aus. Die Herausbildung des Westens in Trennung zum Osten begann. Sicher ist es, dass es einen Gott Zeus nicht gab, selbstredend. Menschen, die nicht an Höheres glauben, sahen und sehen in den damaligen Göttergestalten lediglich gemeinschaftsbildende Ideengebäude.
Religiös-Gläubige, wie ich einer bin, erkennen in ihnen nicht allein den Wunsch der Menschen nach einem höheren Sinn. Sie suchen am Ende das ewige Leben, das ihnen ihre Religionsstifter versprochen haben und bis heute versprechen. Ihre Versprechen, ewig mit ihnen zu leben, war und ist zugleich in einem zynischen Sinne die klügste Art gewesen, Menschen für sich zu gewinnen und geradezu für sich zu rekrutieren. Auch ich suche nach einer tieferen Bedeutung des eigenen Lebens, das nicht einfach zwei Meter in einem Sarg unter der Erde zu Ende ist. Daher haben Sagen wie die von Zeus für Gläubige andere Bedeutungen als für Nichtgläubige. Diese sind Vorboten der Gründung von Religionen, Kulturen, Herrschaften und Veränderungen.
Vor drei Tausend Jahren ging ein erstes Gefühl von Kreta aus, dass diese Fläche – der Westen – eine gemeinsame wäre, eine verbindende, eine geschaffene, eine von den Göttern gesegnete. Ob die Trennung von Asien damals den Urzustand von Feindschaft zueinander begründete, vermag ich nicht zu sagen. Eine Teilung ist selten friedvoll, wenn auch manchmal notwendig. Dass in der Folge ein neuer Teil entstanden ist, – der Westen –, war stets besser, als dass es eine vorherige unfriedliche Teilung des großen Ganzen aus Ost und West gewesen wäre. Das zu bestreiten wäre töricht, füge ich hinzu.
Von Kreta und den griechischen Hafen-Städten aus, dann von Rom und seinen Herrschaftsgebieten aus empfanden sich die Menschen auf dieser Fläche vom Süden der Antike bis in den Norden zu den Kelten mehr und mehr als westlich. Die Idee, sich zu unterscheiden, westlich in Abgrenzung zum Osten zu sein, prägte unseren Kontinent mehr und mehr. Sie gipfelte in der Bildung der Europäischen Union, die bis zu ihrem Höhepunkt achtundzwanzig Nationen in einem Bündnis zusammenbrachte. In der jüngeren Geschichte unseres Kontinentes erhob sich daher das Wort „Europa“ als das vereinende Wort über all diese unterschiedlichen Menschen und Regionen.
Es sind neben dem Schönen und Erfreulichen ebenso die Traurigkeiten, die uns in Europa bis zur Gründung der Europäischen Union ausmachten. Mittels der Kompromissfähigkeit unter den verschiedenen Meinungen war es gelungen, diese zu erschaffen. Diese Fähigkeit war es auch, eine unwahrscheinlich lange Zeit der Abwesenheit von Krieg, Gewalt und Leid auf europäischem Boden zu ermöglichen. Es war eine Zeit, die dann im innereuropäischen Krieg ein furchtbares Ende nahm. Es sind – leider – die sich wiederholenden Phasen zu erkennen, die Frieden auf Krieg und Krieg auf kurz oder länger währenden Frieden nach sich zogen.
Vor der Kaiserkrönung des preußischen König in 1870/71 ist zu erwähnen, dass unter dem Schlachtenführer Napoleon Bonaparte französische Truppen wenige Jahrzehnte zuvor blutig über uns Deutsche hergefallen waren. An der Völkerschlacht von Leipzig im Oktober des Jahres 1813 waren in der Folge fünfhunderttausend Soldaten beteiligt. Schätzungsweise einhundert Tausend Soldaten ließen ihr Leben. Es war der Beginn des Untergangs Bonapartes, und es war ein grausiger Krieg, der dahin führte. Viele nahmen später an, dass dadurch eine lang währende Feindschaft beider europäischer Brüdervölker begründet wurde.
Und die Menschen der Mitte, die Franken, und die des Nordens, die Kelten, alle Stämme und Gemeinschaften stammten doch aus einer Geschichte der Fläche, die sie in verschiedenen Weisen auf ihre jeweilige Art und Weise bewirtschaft und in verschiedenen Phasen beherrscht hatten. Die eigentliche Feindschaft der Deutschen und Franzosen in der Neuzeit war, wenn, von oben nach unten gedacht und von unten nach oben gefühlt. Viele Historiker deuteten diese damalige „Brüderfeindschaft“ als eine vor allem von den Eliten ausgelöste.
Es waren dann Adolf Hitlers Deutsche, die Frankreich im Jahr 1939 überfielen. Die Historiker gehen davon aus, dass die davor liegenden Jahrhunderte nicht gut im Frieden bearbeitet worden waren. Nur zwanzig Jahren später, nachdem Deutsche bereits im Ersten Weltkrieg Franzosen erneut in die Schützengräben von Verdun gezwungen hatten, waren die Deutschen erneut bereit, ihre Nachbarn beherrschen zu wollen, weil alles in der Feindschaft im 19. Jahrhundert begann und im Grunde noch viel weiter davor.
Erneut wurde auf beiden Seiten Blut in den Straßen, in den Häusern und auf den Feldern vergossen. Es war unerträglich häufig und unerträglich viel, was Europa sich antat. Als gäbe es nichts Wichtigeres, als den Herrschern größere Herrschaftsgebiete zu verschaffen, verhielten sich die europäischen Stämme, Völker und Nationen derart, dass ihre Geschichte eine Geschichte des Krieges ist. Die Deutschen führten Krieg. Die Franzosen führten Krieg. Die Griechen führten Krieg. Die Italiener führten Krieg. Die Österreicher führten Krieg. Die Dänen führten Krieg, die Engländer führten Krieg, der Balkan und Spanien sowie Portugal ebenso wie im Grunde alle anderen auch. Es ist kaum möglich, eine Fläche in Europa zu finden, auf der es im Laufe der Geschichte keinen Krieg gab.
So handelt dieses Buch vor allem von einer langen Familiengeschichte, die auf ihre Weise mit der großen Geschichte von Europa verbunden ist. Es erzählt auch von der Zeit, als die Grenzen sich nach dem Mauerfall im Jahr 1989 wieder öffneten und sogar die ganze Welt sich zu einer einzigen goldenen Zeit zu öffnen schien. Es handelt von der Erkenntnis, dass kein Mensch für sich allein auf einer einzelnen Scholle lebt, die alleine im Wasser triebe.
***
Lance Hermann M. Biermanski verstarb an einem Tag, der von den damaligen Ereignissen der europäischen Neuzeit viele Jahrzehnte entfernt lag. Sein Leben endete mit dem gefährlichen Unterfangen, aus den All-Americanas zu fliehen. Die Flucht war als Rettungsunternehmen mit einem geplanten Flug nach Europa organisiert. Kurz, bevor es gelungen gewesen wäre, war er getroffen worden. Über dem Atlantik erlag er seinen Schussverletzungen. Im Laderaum der Regierungsmaschine tat er, in die Arme seines Kusins Joffe gebettet, den letzten Atemzug.
Lance war ein Schlaks, lang, groß, empfindlich, ein hübscher Mann. Seine blonden vollen Haare trug er stets ungekämmt, seine Augen waren blau wie ein See zur Mittagszeit. Er redete nicht viel, als ich ihn 1989 in Berlin an der Seite seines deutschen Kusins Joffe das erste Mal traf. Ich mochte ihn sofort und hätte mich in ihn verliebt, hätte ich damals gewusst, wie das nur ginge. Später fand ich in einem David Bowie-Song eine Zeile, die ich ihm schickte. Er stimmte zu, dass er das war, was Bowie von sich sang: „I am a thinker, not a talker”. Lance war ein wenig gerührt, dass ich ihn in eine Linie mit diesem Mann stellte.
Als ich ihn im Jahr 1990 in Manhattan wieder sah, trug er Blue Jeans und ein frisch gebügeltes Hemd. Er hatte, anders als Joffe und ich, keine Freude daran, ein Gangtuch um den Kopf gebunden zu haben, während wir damit durch die Straßen New Yorks zogen. Lance und Joffe waren sich sehr zugewandt, beinahe wie ein platonisches Liebespaar. Wir waren oft zu dritt unterwegs, immer im Glauben daran, dass das Glück nur darauf wartete, ergriffen zu werden. Wir kehrten ein paar Mal im Billard-Studio „St. Paul‘s“ am Astor‘s Place ein. Lance überraschte uns dort wieder und wieder, wie sicher und ruhig er die Kugel mit dem Queue traf, den jeweils passenden Winkel und mittels der jeweils passenden Kraft spielte und damit die Kugel in der Tasche versank. Er beherrschte die korrekte Armhaltung beim Stoß. War es der Normalstoß oder ein Rückläufer, er war uns immer weit voraus.
In der Stadt, in der er groß geworden war, Deep River, so erzählte er einmal, als wir uns über seine Kunstfertigkeit wunderten, hätte es eine Kneipe am Wehr gegeben. Dort hätte er bereits mit vierzehn Jahren mitspielen dürfen. Die Männer hatten einen Club und pflegten an den Feierabenden das Billard-Spiel. Dem Jungen, der so wenig sagte, brachten sie es bei, so dass Lance nun in New York zwischen uns überraschend groß raus kam. Die meisten Wettbewerbe vor Ort im „St. Paul‘s“ gewannen wir nur dadurch, dass Lance uns aus der Patsche half.
Beim Bier war er zurückhaltend, ebenso bei den Mädchen. Das heißt aber nicht, dass er nicht gesellig war. Er war immer dabei, wenn wir uns durch Manhattan treiben ließen, im “Strand’s” nach Büchern suchten und auf Partys gingen, auf denen es umsonst etwas zu essen und zu trinken gab. Er war der Nach-Innen-Gekehrte. Joffe, kaum jünger, ging stets aus sich heraus. Lance wiederum nahm alles um sich herum auf, als wäre sein Gehirn keine Ansammlung von Zellen, sondern eine Sammlung von Platinen. Ich mochte ihn mehr und mehr.
Dann veränderte sich Amerika. Später als 2001. Europa war ebenfalls erneut aus den Angeln gerissen worden. In der Folge, als sich in Asien und in Amerika Geflechte von Mächten erhoben, wie sie niemals zuvor in der Menschheitsgeschichte vorzufinden waren. Die Clanflächenregierungen entstanden. Sie beherrschten große Flächen der Erde. Die Außenseiter hatten zuerst diese Gefahr erspäht und davor gewarnt. Einer der Warner war unser Lance gewesen. Es folgten Warnungen der Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. Und dann stand das Unausweichliche bevor, das uns alle betraf, alle, auch solche, die sich in Europa aufhielten.
Lance wurde aus seinem Leben als Grundschullehrer gerissen und hineingesteckt mitten in das furchtbare Chemie- und Holz-Werk von Deep River. Seite an Seite stand er fortan Tag für Tag neben anderen erbärmlichen Menschen, die neben den personalisierten Robotern standen. Diese wirkten fast wie gleichwerte Kollegen. Die hochentwickelten Maschinen verdingten die Menschen mehr als Behandelte denn als Steuernde. So arbeitete Lance neben bitterarmen Menschen. Er bemitleidete die abgerissenen Gestalten voller Leere an Hoffnung und ohne jegliche mutmachende Aussicht auf Besserung ihrer Umstände. Er bemitleidete auch sich selbst. Dass er von der Clanflächenregierung verfolgt wurde, weil er ein Schriftsteller der Ehrlichkeit geworden war, machte ihn selten stolz.
Dass er als Intellektueller kaum in das Werk gehörte, lag offen zu Tage. Es war die Bestrafung eines Mannes, der das Wort als Waffe geführt hatte und nun in der Folge bewacht und in Deep River im Grunde eingesperrt war. Es war dort, wo er arbeitete, der neue Teil der deklassierten Schicht zu sehen, eine kontrollierte und mittels der modernen Hochtechnologie überwachten Werksklasse in den All-Americanas. Diese Menschen stammten vor allem aus dem ehemaligen Südamerika. Im Grunde arbeiteten sie überhaupt nicht mehr als Lohnarbeiter. Sie lebten wie Fremd- und Zwangsarbeiter. Sie waren Ausführende eines ihnen aufgezwungenen Lebens. Sie gingen durch die Tage und Nächte, schlecht, und das bis in das heutige Jahr.
Wie hatte Lance es wieder und wieder versucht! In der großen Diktatur eines Clans, eigener Regeln fähig und in der Kunst der Unterwerfung auf das Schlimmste erfinderisch, hatte er versucht, ein Schriftsteller der Wahrheit zu bleiben. Lance maßte sich gar an, unter diesen Bedingungen einer zu werden. Er war zwar veröffentlicht worden, – ja, das kam zu Anfang noch vor –, er stand zugleich unter dem kleinteiligen Schirm einer ausgeweiteten Zensurbehörde. Er wurde beschattet, in der Nähe überwacht und täglich beobachtet. Er durfte nicht schreiben, was er schreiben wollte. Er durfte nicht sagen, was er sagen wollte. Er durfte kaum das denken, was er sich zu denken vornahm. Es war, als schriebe nur noch der kleinste Teil seines ursprünglichen Selbst.
Geblieben war ihm das kleine Haus der verstorbenen Eltern. Die Eltern waren deutsche Einwanderer gewesen, die in den Fünfziger Jahren in die damalige USA gekommen waren. Sein schwächster Trost in der Misere war der, nicht ins Lager verbracht worden zu sein. Dass das nicht geschah, dafür war der Einfluss der Familie seiner Schwester gross und weitreichend genügend.
Als sein europäischer Verleger veröffentlichte ich Lance vor und während der ersten Zeit der Clanflächenregierung in den All-Americanas mehrfach auf Deutsch, Italienisch und Spanisch. Ich ahnte seinen inneren Niedergang bald voraus. Ich spürte im Geist seiner Worte voraus, was folgen könnte. Ich trug in mir die Sorge, dass sich der Westen zu einem Tornado neuer zerstörerischer Kraft drehen könnte. Der Unterschied zwischen Lance und mir wurde Jahr auf Jahr offensichtlicher: ich führte im Sehnsuchtsland Deutschland, dem neuen Land der Träume, zu dem wir geworden waren, ein gutes Leben, er in den USA keines mehr.
Lance lebte sehr früh in einem Land mit der Angst, dann in einem Land der Angst. Während ich diese Entwicklung in seinem Land eher kognitiv-logisch, als vom Verstand her ausdeutete, versank das Land für Lance in dessen psychosozialem Gefühlsleben im Morast. Es wurde alles zuerst flüssig. Neu, anders. Lange, bevor dann die Tatsachen des Morastes geschaffen worden waren. Folgend war aus der Fläche der ehemaligen USA und darüber hinaus der härteste Untergrund geworden. So waren die Bücher von Lance stets auch ein – hilfloses – Mahnen gewesen. Er hatte gewusst, dass dem Mahnen noch lange nicht ein Verhindern folgen würde.
***
Ich schaue nun auf die versammelte Trauergemeinde, die sich auf dem Alten Friedhof in größter Anzahl versammelt hat. Wir begraben heute Joffe. Auf dem Weg nach Harburg dachte ich an Lance, wie er in den letzten Jahren mittels eines unverbleiten Stiftes auf Papier schrieb. Keine Drohne, kein Audiomikrofon, kein Seismograf, keine Wärmebildkamera und kein weiteres Werkzeug moderner Überwachungstechnik konnte dieses Schreiben verhindern, dokumentieren und in der Folge maßregeln. Lance schrieb im Wald an der Ostküste unter den Baumkronen mittels dieser alten Technik, in kurzen, unregelmäßigen Zügen. Dadurch wollte er verhindern, dass sich ein Muster für die Bewacher zeigte. Er verscharrte seine Papierseiten an einer Wurzelstelle tief in der Nähe einer ihm heiligen Pinie.
So schaue ich heute, am Tag der Beerdigung Joffes, im Umfang fast ganz Harburgs in leere, nasse Augen des Trauerns und zugleich in Augen voller Entschlossenheit und Schärfe. Ich sehe, wie sie alle dort als Demokraten, in jedem Fall als Anti-Diktatur-Überzeugte, zusammenstehen. Alle kamen sie, um Joffe das letzte Geleit zu geben. Die Gläubigen unter uns verfielen in Gebete, innere und äußere. Wir wünschten ihm, dass er nun im Tode gut hinter dem Fluss auf der anderen Seite der Verstorbenen aufgenommen worden war. Diese Grenze überschritt er nun ganz für sich allein.
Noch in jeder Religion und in jedem der über die Jahrhunderte getragenen spirituellen Gedanken ist der Fluss als der Ort benannt, der die Lebenden von den Toten trennt. Daher wünschen wir den Gestorbenen eine gute Überfahrt. Die Flussquerung möge jedem Toten das neue Leben als Verstorbener hinter diesem den gewünschten Frieden oder gar das ewige Leben schenken. Zum Flussbild treten weitere Vorstellungen, die des Himmels und der Hölle, der Wiederkehr in anderer körperlicher Form, oder andere, auch nun stofflich verwandelte Wesen, Menschen oder gar Tiere. Das Bild des Flusses ist eines der bindenden aller dieser Glaubensschulen. Es ist überall in den Erzählungen und Schriften vorhanden, weil es Flüsse überall auf der Erde gab und gibt.
Das Überqueren dieser, mittels eines Fährmanns oder anders, war durchaus ein Jahrtausende währendes gefährliches Unterfangen. Wer auf die Strömung oder die Breite von anschwellenden und reißenden Flüssen auch nur einmal in seinem Leben schauen durfte, kann dies bestätigen. Dessen Gefahr, dort hinten ein neues, für uns hier unbekanntes Leben nach dem Tode zu finden, paart sich mit dem Gedanken, dass sich hinter jedem Fluss ein neues Stück Land findet. Das Land hinter dem Fluss ist unbekannt und damit gefühlt auch oft eine Gefahr. Eine Sorge trägt sich mit ihm, solange der Fluss nicht wagemutig überwunden ist. Die Toten, im Bewusstsein einer offenen Zukunft, finden dort das neue, im Grunde unbekannte, Leben vor. So sind sie auch Vorausgeschickte, denen wir alle unausweichlich folgen werden. Sie sind Botschafter, Botschafter für uns Lebende.
Wir haben an jenem Tag in Harburg einen Helden beerdigt: Joffe, den Träger des Hohen Adlers, der Tapferkeitsmedaille des Eurocorps, den langjährigen Berater des Neuen Immigration Bewegungshauses (NIBH) in Brüssel. Den Bestsellerautor, der uns in seinen großartigen Reportagen von der Welt oftmals vom Schlechten und vom Bösen berichtet hat und dem zugleich der Sinn seines Lebens nicht abhanden kam. Auch das heilende Gute fand er stets hinter den Trümmern unzerstörbar vor. Sein Blick richtete sich wieder und wieder hinter die Bilderwelt des Bilderterrors.
Auch seine Rolle als Moderator der Sendung „Die Stimme Harburgs“ ist zu erwähnen, in der er Stimmen der unterdrückten Kritik aus den Clanflächenregierungen zu Wort kommen ließ. Als Inhaber des Stadttreffkiosk „‘68“ formte er wie ein Skulpteur Frieden unter Harburgs Einwohnerschaft. Als Handelsunternehmer, der er in der zweiten Lebenshälfte auch war, ist zu betonen, dass er zeigte, dass Geschäfte ehrbar vor sich gehen konnten. So wusste Joffe, dass der empfing, der zuvor gegeben hatte.
Und uns allen bewies er seinen Mut und seine Hoffnungskraft, gegen Widerstände Mut zu haben, erst jüngst vor drei Jahren. Er bestieg den Kilimandscharo, unterstützt von zwei Freunden und seinem besten Freund Jiyan Sipan. Er tat dies behindert, da er in den Kriegen seinen linken Arm verloren hatte. Er lachte uns stets aus, wenn die Sprache darauf kam. Er sagte dann gerne und verschmitzt, dass er auf seine Schreibhand, die rechte, aufgepasst habe, und diese in seinem Leben die bedeutsamere sei, da er seinen rechten Haken gerne genau in diese Richtung aushole und die Ohrfeige mittels der linken Hand vor allem eines war: feige. Vom Kilimandscharo brachte Joffe mir Samen einer dort beheimateten Pflanze mit, die er ebenso an ihn bekannte Biologen überreichte.
Wissenschaftler hatten ihm den Auftrag gegeben, diese Pflanze, wohl eine von starkem Wuchs und Gehalt, die besonders erforscht werden sollte, von seiner Reise mitzubringen. Es war eine Pflanze, von der sich die Wissenschaftler Erkenntnisse zur Viren-Vitalität und -Neubildung versprachen. Da die Region ein gefährliches Krisengebiet war, waren Joffe und seine drei Freunde in eine Sondereinheit eingebettet, die auf die Gruppe achtsam aufpasste. Was die Wissenschaft aus diesem Samen machte, weiß ich nicht. Nur, dass mein Samen keine Pflanze hervorbrachte. Ich hatte wohl vergessen zu klären, wie ich aus diesem Samen einen Keim hätte ziehen können.
Mir sind nicht alle Ereignisse im Leben Joffes bekannt und ich will mich auf die bedeutsamen beschränken, wenn Beschränkung in diesem Fall überhaupt das passende Wort wäre. Wer sich die Menge der zu berichtenden Ereignisse anschaut, die mit ihm zu tun haben, erkennt, dass es notwendig ist, von diesen zu berichten. Wir müssen Grenzen ziehen. Joffes Leben war eines, das viele Grenzen hinter sich ließ.
Als Verleger muss ich noch hinzufügen, dass Joffe früh Beziehungen zu Dissidenten der New Asia Alliance und der Pan South Africa Unit zu pflegen begann. Diese organisierte er unter anderem im Verein VVP, dem „Verein der Religionen (der Offenheit) und ihre dazugehörigen Philosophen (der Offenheit) von Harburg von 2002 e.V.“. Es war sein später Traum gewesen, dass die Clanflächenregierungen von innen reformiert würden, also von den dortigen Aufständischen. So unterstützte er Bemühungen, Dissidenten Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen. Joffe nahm bis zu seinem Tod jegliche Möglichkeiten dazu wahr, auch, wenn die Veränderungen heute noch weit von ihrer Umsetzung entfernt sind. Es ist bis heute nur der Hauch eines großen geschichtlichen Gegenwindes auf diesen Flächen zu atmen.
Zum Schluss dieser kurzen Vorstellung will ich Joffe, den Sportler, erwähnen und seinen Umgang mit Tai Chi. Die vielen Stunden, die ich mit ihm in dieser friedlichen Form der Kampfkunst verbringen durfte, über Jahrzehnte hinweg, waren mit die schönsten an seiner Seite. Er trug den Braungürtel aus dem Aikido, was er als sehr junger Mensch in Duisburg gelernt hatte. Später hatte er sich dem Tai Chi zugewandt, da ihm diese Verteidigungssport noch sanfter und friedlicher vorkam. Wir führten den Sport aus, ohne, dass wir jeglichen Schmerz zuließen. So sanft lebten wir beide unsere Form des Tai Chi. Wenn wir gemeinsam an verschiedenen Orten unserer gemeinsamen Leidenschaft nachgingen, spürte ich das Spirituelle in mir, während Joffe mir sagte, bei ihm sei es meditativ ... was in jenen Momenten keinen Unterschied in uns auszumachen schien. Es waren Figuren des Friedens, die wir in die Luft zeichneten.
Die Luft und damit ein Nichts als Gegner zu haben, dieser innere Frieden, den wir erlebten, das waren Momente, nach denen wir uns mehr und mehr sehnten, je älter wir wurden. Wurden wir älter, kämpften wir weniger und weniger gegen die Physik der Dinge an. Das Gefühl, angegriffen werden zu können, verflüchtigte sich im Älterwerden. Wer in der Folge in einem weithin inneren Frieden mit sich selbst lebte, konnte sich sehr von den Ängsten der Kindheit und Jugend befreien. War er weitgehend befreit davon, dann älter und älter, entstand in ihm eine größere Unabhängigkeit dem Leben gegenüber.
So lebte er im Alter in dem Gefühl, kaum noch angegriffen werden zu können. So oft es nur ging, pflegten Joffe und ich diesen Gedanken. So standen wir auf Rasen oder auf Sand. Besonders, diese Figuren bei geschlossenen Augen in Zeitlupe zu malen, waren für den Geist und das innere Gleichgewicht die wohltuende Art, sich wieder zu finden, wenn um uns herum alles verloren schien.
Es war ein Gefühl großer Freiheit und Sicherheit. Es war das Gefühl, dass das Leben offen war. So wie die Sicht auf den Atlantik, als wir am Strand von Long Island, zur besseren Zeit dort, unseren Übungen früh morgens vor Sonnenaufgang nachgingen. Dies geschah vor Jahrzehnten, in einem anderen Leben, wie es mir scheint. Wir wohnten in New York und unsere gemeinsame Freundschaft verstetigte sich. Wo wir uns kennenlernten? Wir waren in Ost-Berlin im Winter 1989 im „Franz Club“ aufeinander gestoßen. Davor waren wir als junge Männer Westdeutschlands lediglich in Jugendgruppen organisiert in den Osten gegangen und hatten die DDR am Ende ihrer Existenz dort als Reisende studiert. Wir beide hatten Interesse daran, getrennt voneinander, – da wir uns noch nicht kannten –, das Leben der Menschen unter den Bedingungen einer sterbenden Diktatur kennenzulernen.
Nun, nach dem Mauerfall, eroberten wir, wie manche andere, große Teile einer ganzen Generation, gierig den Ostteil des damaligen Deutschlands. Mir war, als wäre ich im „Franz Club“ auf einen Propheten gestoßen. Als ich Joffe im Club zur Seite stand, richtete er unversehens seine erste Frage an mich. Die erste Frage, denen viele in den kommenden Jahrzehnten folgen sollten. Die Frage war derart unmodern selbst für mich, dass ich sie mir bis heute gemerkt habe. Joffe fragte: „Was ist der Sinn in deinem Leben?“ So war aus einem Abend im „Franz Club“ ein Bündnis lebenslanger Bedeutung geworden. Ein Sonderfall war Joffe. Ein Fall für sich.
***
So verabschieden wir uns heute von einem Wegbegleiter, einem Wegweiser und einem Freund. Joseph Hermann H. „Joffe“ Biermanski verstarb ebenfalls in der Folge seiner Verletzungen während des Fluchtversuches von Lance. Nur drei Monate nach Lance verließ uns Joffe. Er war bis zum Schluss von seinen Lieben und Freunden umgeben. Er blieb zwei Tage im Wohnzimmer seines Marmstorfer Hauses aufgebahrt, damit die Trauernden nach und nach kommen konnten. Viele wollten nach alter Weise bei ihm – auch während der Nachtwache – sitzen, während sich sein Ich aus dieser Welt zu verflüchtigen begann, wie ich den Übergang des Todes in die Nachwelt der Toten zu formulieren gelernt habe.
Sein Körper hatte die Temperatur schnell angenommen, zu der er sich im Geiste in den letzten vielen Jahren hatte hin entwickeln müssen. Zu einem eisig kalten Körper war er nun als Toter gewandelt an einem diesigen und kühlen Novembertag in Harburg. Er musste eisigkühl im Wesen im höheren Alter werden, damit er uns zu all den Kämpfen anleiten konnte. Sein Freund Peter Meier, ein ehemaliger Priester, hielt sich an seinem Sterbebett auf, jedoch weiß ich nicht zu berichten, ob Joffe seine letzten Sakramente erhalten hatte. Vor Jahren sprach er davon, dass Peter dazu geeignet wäre. Peter war Katholik wie Joffe und ein Mensch, den sich Joffe ausgesprochenermaßen für seinen letzten Lebensmoment aufbewahrt hatte.
Wir wollen Joffe danken, lese ich in meinen Notizen von der Beerdigung. (Früher hätte ich niemals einem Mann für solche Taten gedankt.) Wir alle danken ihm vor allem dafür, dass er uns gut durch die innereuropäischen Kriege und all das andere geführt und begleitet hatte. Auch für das, was sich in Nis zugetragen hat und wodurch sich eine wichtige Befriedung auf dem Balkan ermöglichte. Wir tragen Hochachtung in uns. Durch sein Eingreifen nahmen die Entwicklungen einen neuen Verlauf. Er holte Tom Jones nach Berlin. Was dieser tapfere Mann dort der Weltgemeinschaft mitteilte (dem Rest an zuhörender und noch ehrlicher Weltgemeinschaft) war so wichtig. Es führte dazu, dass ab Ende 2032 schließlich in der Verlautbarung unserer Gesamtregierung die letzten US-Wahlen vor der Errichtung der Diktatur und in der Folge vor der Errichtung der dortigen Clanflächenregierung als gekaufte und getäuschte felsenfest dokumentiert werden konnten.
Diese neuen, nun tatsächlich bestätigten Erkenntnisse nahmen keinen weiteren großen Einfluss mehr auf die gegenwärtigen Entwicklungen. Es war lediglich die Bestätigung unserer Vermutungen. Es entstand ein weiteres Anschwellen weiterer Aufstände und Attacken mutiger Anhänger auf den Böden der anderen Welt und dort gegen diese großen unmenschlichen Welten. Dort, auf den großen Flächen, auf denen die Clanflächenregierungen zu ihrem ureigenen Vorteil ihre Machtzonen in sehr, sehr weiten Teilen der Erde erfolgreich erdacht und umgesetzt hatten. Sie hatten eine, militärisch gesprochen, neue Form der Staatsgründung und -form geschaffen. Sie handelten gemeinschaftlich im Schwarm und kamen ohne einen (männlichen) Anführer (und einen einzigen Diktator) aus. Ihre ganz neue Form einer verwandtschaftlichen Räteregierung hatten sie derart gut entwickelt, dass sie sich im häufig verwendeten Begriff „Clanflächenregierungen“ gut zusammenfassen lässt.
Meine hoffnungsfrohe Annahme für dieses Buch ist, die Werke und die Werte des Lebens von Joffe zu ihrer Bewahrung im Rahmen meiner Möglichkeiten fortzuführen. In Worten, die uns keiner entreißen kann. Die Gedanken, die zur Not unter dem hintersten Kellermauerstein oder in der letzten Ecke des Dachbodens als Papier gelagert sind.
Zu viel spricht dagegen, als dass wir aus dieser irdischen Welt in Frieden scheiden. Zu vieles ist seit 2001 geschehen. Vor allem die atomare Zündung eines Mittelstreckenballistikums in Bangladesch gehört zu diesen Geschehnissen. Die Auseinandersetzung zwischen dem (islamisch streng geführten) New Pan Arabia über ihren Bundesgenossen Pakistan mit dem (hinduistisch streng geführten) Indien war die Folge aller großen Entwicklungen. Ausgerechnet auf dem Boden Bangladeschs, einem der traurigsten Länder Gottes in diesem Abschnitt der Menschheitsgeschichte, führte es zum größtmöglichen Vorfall. Seit Jahrzehnten hatten alle Gottesspötter der Welt nur darauf gewartet, dass es einen regionalen Atomschlag gäbe. Wir alle hatten diesen lange befürchtet.
Befürchtet hatten wir es, da die Atomwaffen bereits seit langem immer kleiner und wendiger geworden waren. So war es die Annahme, dass einem regionalen Schlag nicht generisch der Dritte Weltkrieg darauf folgte, und so kam es auch. Die Abwürfe der Atombomben in diesem ersten regionalen Stellvertreterkrieg, die ersten seit den Abwürfen über Hiroshima und Nagasaki in 1945, waren verheerend und allauslöschend. Es folgte eine Schockwirkung in die Seelen der Menschheit, derer, die noch einen Zugang zu so etwas wie zu dem hatten, was die Schriften Seele nennen.
Es führte zu einer bis heute anhaltenden Ruhephase der Welt. Wenn Joffe mit seinen Freunden sprach, vermittelte er stets Hoffnung, selbst, wenn er diese innerlich oftmals aufgegeben hatte. Nun, die Hoffnung über seinen Tod hinaus zu erhalten, und sei es nur unter uns, seinen Freunden, das sehe ich heute als meine Aufgabe an. Die Aufgabe ist groß und wiegt schwer. Sie wiegt mehr als vieles andere, was ich in meinem Leben zu tragen hatte. Es gibt in allen Denkweisen den Hinweis, dass die Hoffnung zum Schluss stürbe, am Ende stünde, dass diese daher die größte aller Mächte eines Menschen wäre.
Ob das stimmt, weiß ich nicht. Als ich Menschen sterben sah, sah ich in ihren Augen oftmals keine Hoffnung mehr. Können Menschen auch ohne Hoffnung in sich leben? Welchen Unterschied macht das? Acht lange Monate nach dem Tode Joffes ist mir klar, dass wir darin nicht einer Meinung sein müssen. Es reicht, wenn ich mich hinter seinem starken Rücken, Schutz suchend, verstecken kann. Dass sich bis heute nichts zum Besseren gewendet hat, ist die Tatsache, die der Verstand anzuerkennen hat. Dass es schlimmer kommen kann, wiewohl das Schlimmste bereits geschah, gehört dazu.
Die Clanflächenregierungen hatten nicht aufgehört, ihre Kriegerrobots zu entwickeln und einzusetzen. Der versteckte Krieg über die Geflechte der Stromkabel war fortgeführt worden (die bekanntermaßen die kabellosen Geflechte ablösten, da diese Technik, über Strom zu arbeiten, sich zu dem bestmöglichen Wunderwerk der bösen Ingenieurskunst entwickelt hatte). Dazu kam der stetig weitere Ausbau der Angriffssatelliten in der Erdumlaufbahn und weitere Umstände und Vorfälle von größtem Ungemach, die über die Menschheit gekommen waren. Wir sehnten und sehnen uns nach dem Goldenen Jahrzehnt zurück, als wir junge Männer waren, zwischen den Jahren 1990 und 2001.
Wir schauen im Umkehrschluss bitterlich auf den 9. September 2001 und die nachfolgenden Tage, als die USA in New York und in Washington, D. C., und an weiteren Orten auf das Heftigste angegriffen worden waren. Die Angriffe waren derart viele und derart verlustreich auf dem Heimatboden der USA, dass es für Amerikaner der erste Krieg zuhause wurde. Die Angreifer kamen aus dem Ausland und sie kamen auf den Boden, den bis dahin kein ausländischer Krieger zu betreten wagte. Viele waren es. Starke. Mächtige. Und erschreckend wirksam waren sie.
Die USA fühlten sich derart auf eigenem Boden herausgefordert, dass sie in der Folge in die ersten Großen Kriege seit dem Zweiten Weltkrieg hineingingen. Dieser Traum, mit einer zweihundertjährigen Geschichte als Land zwischen zwei Ozeanen auf der Veranda niemals den Feind stehen zu sehen, platzte brutal und löste alles aus, was danach nicht hätte passieren dürfen. Amerika überforderte und überspannte sich. Das Land konnte nicht überall gleich hart zurückschlagen. Es kam in der Folge zur Wahl des Mannes, dessen Namen ich nicht dadurch stärken möchte, dass ich ihn an dieser Stelle nenne. Er war der Propagandist der medialen Moderne und der Schneisenschläger in eine neue Zeit eines ehedem gesamten, nun uneinigen Westens. Sein Name ist heute wohl kaum einem Menschen unbekannt. Alles große Unglück der gesamten Menschheit begann mit dieser Zeit.
***
Ich selbst trage den Namen einer langen Familientradition und bin Träger einer Religion, die bis heute nicht frei ist. Meine Väter gaben mir den Namen Hassan I. Al-Lafayette und damit einen Namen, der sowohl in der Tradition der Bahais als auch in der der Länder steht, in denen wir wirkten und lebten. Wir sind persisch-deutsch-englische Wohnhafte in der Welt und zählen eine sehr, sehr große Familie. Zugleich sind wir Vertriebene aus dem Iran seit den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts. Wir sind Angehörige einer großen, weltumspannenden Gemeinde. Die Bahais wurden und werden in vielen arabischen Ländern verfolgt. Wir haben bis heute unser religiöses Zentrum in Israel. Dort sind wir halb geduldet halb anerkannt, da wir von jeher in Frieden mit den anderen Weltreligionen lebten. Joffe war von meinem Glauben fasziniert, als schlüge er mit mir ein neues Buch auf, das er eingehend studieren müsste.
Seit meiner Zeit als junger Mann war Joffe mir über die Jahrzehnte der allervorzüglichste Männerfreund, und mit ihm sein Kusin Lance zum Freund, geworden. In meiner Erinnerung werden sie immer meine Freunde bleiben. Beider gedenke ich mit Fotos und Erinnerungstücken auf meinem Ahnenaltar zuhause. Auf diesen zu schauen, wenn ich im Wohnzimmer auch nur kurz an dem Bord vorbei gehe, auf dem der Altar steht, macht mich seit Monaten oft traurig und zugleich glücklich. Vor allem für einen Menschen, wie ich es bin, eher zögerlich und gehemmt im Umgang mit Menschen, und eher auf deren Ansprache mir gegenüber angewiesen, tat der einzigartige Zauber Joffes viel an mir. Er begeisterte Menschen. Er beseelte sie gar.
Zudem fand ich in Joffe viel Reiches, das zu stets wiederkehrenden Gesprächen großer Nähe führte: ich ein Deutscher persischer Herkunft, er ein Arbeiterkind und Enkel eines Unternehmers aus Katowice (als es deutsch war, hieß es Kattowitz), der nach dem Zweiten Weltkrieg nach Köln geflüchtet war, während Joffes Vater in Duisburg-Ruhrort sesshaft wurde. Ich das fünfte Einwandererkind der 2. Generation in Deutschland aus einer großen, gläubigen Handels- und Arztfamilie mit einem Familienhauptsitz, der im wohlhabenden Berlin-Charlottenburg liegt. Joffe ein nichtgläubiger Mensch im Sinne der Anhänger klassischer Religionsformen.
Er aus einer ursprünglich katholischen Familienlinie und ein Verfechter der Wissenschaft und ihrer logischen Abfolgen. Ich reformierter Gläubiger des Bahai‘ismus und ein Suchender, meine Religion und ihre Strukturen zu verwandeln. Ich ein Rückkehrer zum Bab, nachdem ich mich vom inneren Konzept der Religion meiner Väter und meiner Mütter erst lösen musste, damit ich später, gewandelt und anders, zu ihm wieder heimkehrte. Er ein Mensch, der den Einzelnen ansah, als wäre er die ganze Welt und dadurch Menschen an sich band, die aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Religion oder ihres Standes ohne jegliche Bande zu ihm hätten sein müssen.
So fand ich in Joffe einen Menschen, der bereits immer schon und später bedeutsam mehr in Menschen das gemeinsam Bindende sah. Mir fiel das stets auf. Es war mir der sehr sympathische Zug eines Deutschen, der in einem Land groß geworden war, das lange kein Land für erfolgreiche Einwanderung gewesen war, wie es viele früher behaupteten. Joffe schritt in einer Atmosphäre voran, die alle verschiedenen Bewegungen und Tonalitäten zu einem Gemeinsamen modulierte.
Ihre verschiedenen Formen, Blicke, ihre Kleidung, ihre anderen Bücher, Werke und Gedanken, die er nicht aus einer ersten absoluten Abwehrhaltung von vornherein verstieß. Seine Fähigkeit, Menschen aus verschiedenen Religionen oder mit entgegengesetzten Ansichten nicht sogleich zum Ärger zu bringen, sondern ein Gespräch überhaupt erst zu ermöglichen, dessen Ende in großer Freiheit zueinander endete, war eine besondere Gabe.
Alles konnte mit ihm überraschend enden. Er nahm ihre andere Art, die Schritte zu nehmen, an. Er zwang sie eben nicht in einen gemeinsamen Schritt. Im Gegenteil spürte er ihre nur ihnen eigene Weise des Gangs durch die Innenstädte geradezu liebevoll nach. Er probierte es stets für sich selbst aus. Er war mit ihnen unterwegs auf ihren abweichenden Wegen über die Felder der Tage und der Nächte. Er nahm fortwährend ein Angebot an, diesen auf den Wegen durch das Schlechte und das Gute ein guter begleitender Spaziergänger zu werden, und darin einer zu bleiben.
***
Joffe sah nicht das Trennende dieser Menschen zueinander, weil für ihn das Leben an sich das Gemeinsame war. Es gab daher für ihn unverrückbare Gemeinsamkeiten unter ihnen. So war er darin ein großer Magier, ein magischer Lehrer, wie es der Philosoph Karl Popper nannte, im richtigen Moment für einen Menschen an der richtigen Stelle mit einem richtigen Wort, einer richtigen Frage, der richtigen Geste zur Stelle zu sein. Er war ein Mann, den wir ohne Zweifel in den letzen Jahren so nötig hatten, dass sein Heldentum in dieser Fähigkeit begründet liegt. So muss es unser Wille sein, – wo es nur irgendwie ginge –, es ihm gleich zu tun. Auf seine Weise, dass er Gleichmäßiges in jedem Einzelnen sah, wenn, ja, wenn der andere sich am Ende des Weges mit Joffe ebenso für das Leben und dessen Menschlichkeit entschied und damit das Leben wählte.
Alle diese wunderbaren Menschen sind nun in Harburg aufgestanden. Nun dürfen wir dem mehr denn je folgen. Joffe mehr denn je darin folgen, sie als gleich anzuerkennen. So sehe ich die Menschen unter den Birken auf dem Vorplatz auf dem Friedhof. Sie stehen in einer langen Schlange vor dem Tor des Gedenkhauses, in Kreisen, in Gruppen, zu dritt, zu zweit, niemals allein für sich. Alle sind sie dort als Menschen einer tatkräftigen Gemeinschaft zusammengekommen, die ich vor dem berühmten Abend Harburgs vor nunmehr vierzehn Jahren als eher getrennt denn als zusammen erlebt hatte. Die Harburger waren bereits auf dem richtigen Wege gewesen. In keinem Fall waren sie mir zuvor als derart einig oder gar vorbereitet erschienen, dass eine solche Tat, wie sie diese unternahmen, in einem fiktionalen Roman hätte geschehen können.
Ab neun Uhr morgens hatten sich bereits viele Trauergäste an der Fußgängerzone an der Lüneburger Straße eingefunden. Um 9.36 Uhr, unter Klagerufen vieler Mütter und Frauen, ging der Zug vom Greta-und-Herbert-Wehner-Platz zum Friedhof an der Bremer Straße zur dort geplanten Trauerfeier im (protestantisch geprägten) Gedenkhaus. Sechs Männer zogen den Wagen, auf dem der offene Sarg festgezurrt war. Nach den Riten der Vorzeit der Weltreligionen zogen weitere sechsunddreißig Männer, also sechs mal sechs, diesen im Wechsel in behutsamer Geschwindigkeit hoch zum Friedhof.
Wie gerne würde ich die Geschichte jedes Einzelnen dieses Trauerzuges erzählen. Dass ich es lediglich für die Familie der Biermanskis erledigen kann, verzeihen Sie mir, das weiß ich jetzt. In den letzten Wochen bedrängten mich viele geradezu wie unter Befehl, zumindest die Geschichte der Kusins in die Geschichtsschreibung durch ein Buch über sie hineinzutragen und beide damit weit in die Zukunft über die der Namenlosen hinausragen zu lassen.
Wir begraben Joffe heute in seiner Stadt, von der das Signal, – ein Pressmoment der Geschichte –, in jedem Falle von wo der unbedingte Wille ausging. Der Wille der mehrheitlich Wohlmeinenden aller Kulturen und Religionen und Herkünfte ausbrach, dass es ein Ende zu sein hatte, von Extremsten bedroht zu sein und am Ende von Extremisten geknechtet zu werden. Und in der Folge des Harburger Aufstandes die Geschichte Europas neu geschrieben wurde.
Hassan I. Al-Lafayette,
Berlin-Charlottenburg, im Jahr 2033
II. Kapitel
Jeder, der sich an diesem Tage aufmachte an den Greta-und-Herbert-Wehner-Platz, hatte seine ganz eigene Geschichte mit Joffe. Unter ihnen war auch Jiyan Sipan, neben Joffes Frau und seinen Kinder aus dritter Ehe wahrscheinlich die Person, die ihn am besten kannte. Er hatte alles gut, sicher und ruhig für die Beerdigung vorbereitet. Jiyan leitete nun als Anführer den Trauerzug. Er war mir bereits seit Jahren bekannt. Er war schon seit vielen Jahrzehnten der beste Freund Joffes in Harburg.
Der Deutsche kurdischer Abstammung hatte früh, als sich ihm die Chance bot, einen kleinen Kiosk in Harburg-Marmstorf eröffnet. Er führte sein Geschäft eher traditionell deutsch. Getragen wurde dieses hauptsächlich von der Mittelschicht, damals von Rentnern. In dem Moment, als die klassischen Postfilialen schlossen, ergatterte er sich eine Lizenz und eröffnete einen großen Kiosk mit angeschlossenen Postdienstleistungen.
Joffe und Jiyan, die sich bereits aus der Parteiarbeit beider kannten, überlegten, was sie gemeinsam für Harburg erledigen könnten. So gründeten sie gemeinsam eine Gesellschaft. Sie machten es sich zur Aufgabe, nach dem 11. September im Jahr 2001, der Harburg besonders traf, ihre Stadt in eine Gemeinschaft des Wir zu verwandeln. Tage nach dem 9. September war ein Ruck durch die Herzen der Harburger gegangen. Der Ruck war überall zu spüren, und das in jedem einzelnen. Er hielt gleichwohl nicht lange vor. Die Heilung all der Umstände, die dazu geführt hatten, trat nicht ein. Der Ruck verebbte. Die Sanduhr des Lebens fand zum Alltag zurück. Joffe hatte erkannt, dass dieses kurzzeitige Gefühl an Gemeinsamkeit sehr, sehr groß gewesen war und sehr, sehr bedeutsam.
Jeder Schmerz ist grausam. Wie gerne würde ich jedem diesen ersparen. Ich bin weit entfernt von einer Bewertung. Wer könnte dies tun, wer dürfte dies tun? Und doch schien diese Bedeutung und diese neue wiederholte Gemeinsamkeit noch größer als die, die der Tod eines Kindes in Wilhelmsburg, einem nördlichen Nachbarschaftsstadtteil von Harburg, vor Jahren nach sich zog. Das Kind war unschuldig einem Kampfhund zum Opfer gefallen. Es war von diesem auf Töten gedrillten Tier regelrecht in alle Teile zerrissen worden. Es war keine fünf Jahre alt geworden. Auch damals ging ein Ruck durch die Menschen, der Veränderungen nach sich zog. Die Kultur der Aufziehung von Kampfhunden wurde erfolgreich von der Gesellschaft, der Verwaltung und der Politik beendet.
Nun war der Umstand viel, viel größer, im September im Jahr 2001. Joffe wusste für sich, dass er sich aufmachen musste. Dazu fand er in seinem Freund Jiyan einen der bestmöglichen Partner. Sie wussten damals nicht, was sie wie und wo bei wem und wann genau zu tun hatten. Dass sie, als Männer, die Gefahren sahen, etwas tun mussten, das war ihnen klar. Sie spürten dies beide, als ginge es um ihr Leben.
Sie strebten danach, die Vereinzelung der Ichs hinter sich zu lassen, diese vielen kleinen, parallel zueinander lebenden Ichs und Wirs zu durchbrechen und zu einem gemeinsamen starken Wir zu formen. Ein Teil dieses Vorhabens beinhaltete, dass beide aus dem Kiosk von Jiyan Jahr um Jahr den großen Treffpunkt fast aller Harburger machten. Möglich wurde dies durch den Zukauf des Nachbarhauses, und später des dahinter liegenden Grundstückes, das ein konservativer Schützenbruder für sie zum Kauf frei gab. In den drei Häusern war nun ein Tee- und Restaurantbereich eingeschlossen. Mit dabei war ein Kindergarten, der von einer christlichen, jungen Frau geführt wurde und für alle Religionen und Herkünfte offen stand. Sie, eine Jesidin und damit eine Christin, die Schlimmes erlebt hatte, stammte aus Syrien und hatte in Harburg rasch Fuß gefasst.
Es besuchten zuerst wenige das „‘68“. Monat um Monat, Jahr um Jahr fand das Haus mehr und mehr Zulauf. Über die Zeit bildeten sich weitere Ausgründungen und neue Dienstleistungen, die beide anboten, darunter Umsonstkaufläden und Firmen, die sich aus der Technischen Universität herausbildeten. Stets lag alles vor allem in der Hand Jiyans, der das operative Geschäft der gemeinsamen Unternehmungen geschickt und in großer Klugheit – auch kaufmännischer Klarsicht – ausführte. Er hatte, auf Joffes frühes Anraten hin, dass Deutschland für ihn und seine Familie der sichere Hafen in den nächsten Jahrzehnten wäre, den deutschen Pass für sich und seine Familie beantragt und bald erhalten.
Wer sich bereits damals, nach dem 11. September 2001, sehr einfühlend damit beschäftigte, wie sich die Tatsachen in den anderen 200 Staaten veränderten, konnte zu keinem anderen Schluss kommen, als dass Deutschland unter allen anderen das Land der Hoffnung würde. Es war für Jiyan kein großer Umstand, dass er die Einbürgerung erhielt. Auch er sah gleichwohl, dass er und seine Familie in Deutschland ein gutes Land vorfanden, dessen Teil sie nun geworden waren. Er fühlte sich später ebenso als Deutscher wie die, die in das „‘68“ kamen, wie er später gerne sagte. Er sah sich als einen Deutschen an, der das gemacht hatte, was viele Menschen zu allen Zeiten getan hatten: dorthin zu gehen, wo es Arbeit und Frieden gab, und in der Folge daran mitzuarbeiten, das es dort weiterhin beides gab.
Jiyan zeigte uns während der Trauerfeierlichkeiten keines seiner wahren Gefühle. Es gab keinen Hinweis auf seine eigene Trauer um Joffe. Die Aufgabe, die er sich gestellt hatte, half ihm wohl dabei, wie ein deutsches Räderwerk alles ineinander greifen zu lassen. Der Tag selbst begann für ihn mit einem Gebet für sich allein zu seinem Gott, Allah. Er rezitierte aus der 60. Sure, so sagte er es mir, die von Liebe und Freundschaft sprach. Bei einem der späteren Treffen zeigte er mir den Koran in einer deutschen Übersetzung und die Stelle, die er am Tag der Beerdigung gewählt hatte.
Sie lautet, ab Vers sieben: „Vielleicht stiftet Gott ja Liebe zwischen euch und zwischen denen, die euch feindselig gesinnt sind unter ihnen – Gott ist mächtig. Gott ist bereit zu vergeben, barmherzig. Gott verbietet euch nicht, freundlich zu sein zu denen, die euch nicht der Religion wegen bekämpften und nicht aus euren Häusern vertreiben, und sie gerecht zu behandeln. Siehe, Gott liebt die, die gerecht handeln.“ Jiyan erklärte mir weiter, dass in der Überwindung der auch in den Schriften vorzufindenden Feindschaften zwischen Gläubigen und Ungläubigen diese Verse eine große Bedeutung für ihn hätten. Sie, so Jiyan, federten das Trennende ab und förderten das Gemeinsame.
Von Jiyan wusste ich die kleine Anekdote zu erzählen, dass Joffe ihn damit aufzog, dass er den teuersten Luxus-PKW gekauft hatte, der durch Harburg fuhr. Jiyan fuhr gerne damit herum. Er nahm mit dem großen PKW auch kurze Strecken. Joffe piesackte seinen Freund damit, dass das doch sehr übertrieben wäre, einen Container über die Straßen rollen zu lassen, der keine Schwergewichte ziehen und nicht in der Wildnis der Alpen seine Qualität unter Beweis stellen musste. Jiyan antwortete sodann stets klug, fröhlich und darin hinterlistig, er stamme, wie so viele aus der Türkei, und zwar aus einer alten Nomadenfamilie. Nomaden wären sie aus gutem Grunde gewesen. Das läge bereits im Wort der Griechen – „nomás“ – begründet, was im Deutschen gut mit „herumschweifend“ übersetzt sein könnte. Das Herumschweifen folge gleichwohl keiner Bewegung der Freude. Die nicht-sesshafte Lebensweise seiner Vorfahren waren Bewegungen der Notwendigkeit.
So hieß es, der Herde der Tiere zu folgen. Die Tiere sicherten die Grundlage des Lebens. War eine Fläche nicht mehr zu begrasen, zog die Familie weiter. Die Familie ging schlicht dorthin, wo es Arbeit und, das betonte Jiyan, Frieden gab. Veränderten sich die Bedingungen auf der Fläche, auf der sie lebten, verließen sie diese aus zwingenden Gründen. Es ist also, so Jiyan, der Überlebenswille und die Not, die uns zu Beherrschern der Bewegung machten. Wie könnte es also anders sein, und als ein solcher sei es eine Selbstverständlichkeit, in Zeiten der Moderne das größtmögliche Gerät der Fortbewegung zu wählen.
Das sicherste und beste deutsche Auto sei ihm gerade gut genug. Den PKW zu wählen, den der Hirte bräuchte, um seine Familie zu schützen. Abgesehen davon wäre der Verkehr in Deutschland so mörderisch, dass ein großer Wagen eine zwingende Notwendigkeit des Selbstschutzes darstellte. Joffes reiche Freunde lebten es doch vor. Die Einwanderer zögen lediglich nach. Einbürgern hieße doch, den Einwohnern in allen Belangen zu folgen. Warum also nicht auch in der Wahl des PKWs zeigen, dass man damit den größten Erfolg einer Einwanderung nach Deutschland bewiese? Beide lachten stets wieder und wieder während dieser immer wiederkehrenden Konversation.
***
Am Tag der Beerdigung wählte Jiyan ein Fahrrad, auf dem er zu denen radelte, die er erreichen wollte. Die Straße war bis an ihre Häuserwände von Menschen gefüllt. Sein Großwagen hätte keine Chance gehabt, ihn zu transportieren. Der Greta- und Herbert-Wehner-Platz, der sich vor den Außenwänden zweier fünfstöckiger Geschäftshäuser zeigte, war nach einem legendären Politiker der Sozialdemokratie benannt. Er hatte in Harburg seinen Wahlkreis gehabt und bestimmte jahrzehntelang die Geschichte der damaligen Bonner Bundesrepublik. Herbert Wehner war einer der größten Redner seiner Zeit gewesen und im Alter ausgerechnet ein kranker Mensch geworden, der seine Sprache verlor. Von ihm war vielen nicht mehr bekannt, als was sie auf der Gedenktafel auf Deutsch, Englisch, Türkisch und Arabisch lesen konnten.
Vermerkt war auf der Tafel, dass Wehner mitgeholfen habe, den damaligen Ost-West-Gegensatz aufzuheben. Er war einer derjenigen, die früh auf die damalige Sowjetunion zugingen, die dem Westen zu Zeiten des Kalten Krieges mit Auslöschung drohte. Er soll ein äußerst sachkundiger Politiker gewesen sein, der früh um fünf aufstand, damit er die Zeitungen pflichtbewusst lesen konnte, bevor das umtriebige Tagesgeschäft begann. Zudem war er einer im Parlament, der aus den Gesetzestexten als einer der wenigen eins zu eins zitieren konnte, und in alledem ein oftmals unerreichtes Vorbild für viele geworden war. Auch wenn Wehner als junger Mann im Moskauer Exil vermutlich ein Teil des Unterdrückungsapparates wurde – durch das Nennen von Namen, die zu bestrafen wären –, erarbeitete er sich in den folgenden Jahrzehnten den Ruf eines wahrhaftigen Demokraten. Selbst der konservative, jüngere Harburger Politiker Henning Perro sprach sich dafür aus, die Gedenktafel für Werner anzubringen. Es war ein wenig so, als hätte Wehner durch seine Lebensleistung seine Schuld abgetragen.
Angekommen auf dem Platz, traf ich auf Dilan und Yara, die mich mit festen, kurzen Umarmungen begrüßten. Beide Frauen, die eine am Ende ihrer Fünfziger, die andere im Ende ihrer Dreißiger, wirkten an jenem Tag anders auf mich, als ich diese beiden wichtigsten Mitarbeiterinnen des „‘68“ in Erinnerung hatte. Dilan hatte mir vor Jahren anvertraut, da sie mich als Joffes Freund ansah, dass sie keine Ehe eingegangen war, weil sie folgend lediglich als Mutter und Ehefrau eingesperrt geworden wäre. Das wäre im Lauf der Jahre in ihrer Familie und Verwandtschaft besser geworden. Sie hatte ihre Neffen und Nichten, die sie jahrelang als Freundin ansahen. Das mochte sie sehr. Ihr erzählten sie viel mehr als den Eltern. Dass sie den Zeitpunkt verpasst hatte, spät zu heiraten, als es kulturell möglich geworden war, schrieb sie niemandem als Schuld zu.
Dass es schade war, dass dieses Glück ihr fehlte, bedauerte ich sehr. Sicherlich war Dilan ein Mensch, der sich sehr nach innen verschlossen hatte und sehr selten das sagte, was sie tatsächlich im Inneren bewegte. Immer, wenn ich auf sie stieß, fiel mir ihre große Geduld im Geschäft auf – sie war eine exzellente Verkäuferin -. Ihre Augen sprachen eine zugewandte Sprache, die stets Freude vermittelten, wenn ein Mensch ihr mit Freundlichkeit begegnete. Nun standen wir neben Yara und Jordi, Yaris Ehemann. Ein bärtiger Spanier war er und sah eher aus wie ein Husar oder Seemann, derart viel Kraft ging von ihm aus. Die jüngere der beiden Frauen, Yara, führte mit ihm eine glücklich Ehe. Die Familie dieser Kurdin wiederum hatte die Partnerwahl vor wenigen Jahren zu ihrem Erstaunen nicht nur angenommen. Die Familie anerkannte Jordi schnell, da er ernsthaft arbeitete und sich neben dem Deutschen auch des Kurdischen bemächtigte.
Jordi sprach neben dem sehr guten Deutsch auch Amtstürkisch, da sich bei ihm ihm Talent zum Fleiß gesellte. Das Deutsche stellte viele andere vor große Hürden. Eine weitere Fremdsprache gut zu erlernen, als Erwachsener, das war sehr selten. Das Englische erlernten die Kinder der Einwanderer in der Schule. Oftmals mit Bravour, oftmals leidlich. Ältere Einwanderer an eine für sie zweite Fremdsprache heranzuführen, war eine große Aufgabe. Die Beschwernis, dies zu erreichen, steht dem klar vor Augen, der erkannt hat, welche Tücken und Untiefen allein das Deutsche in sich trägt.
Allein die deutschen Pronomen und Bestimmartikel sind eine Qual. Dazu ist alles geschrieben, was dazu zu sagen ist. Das Beugen und Fallen der Verben und der Hauptwörter sind von scheinbarer Unzuverlässigkeit. Einwanderer in das Deutsche sollten sich damit nicht allzu sehr plagen. Gehemmt zu sein, weil ein Mensch Fehler macht, ist keine gute Grundhaltung beim Erlernen einer Sprache. Wer auch nur einmal verstanden hat, wie umfänglich das amerikanische Englisch ist, weil es sich am Ende aus allen Volkssprachen der Welt speist, der steht in Demut vor der Herausforderung, die Sprache der neuen Heimat ganz und gar zu erlernen.