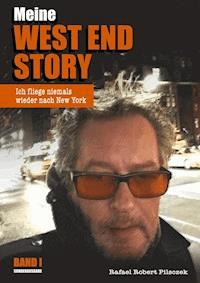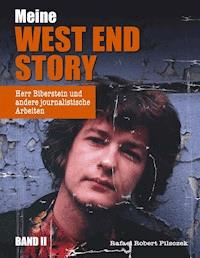Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Antwort des Hamburger Schriftstellers und Malers Rafael R. Pilsczek auf den Krieg in Europa und auf die gewachsenen Gefahren in der Nähe und in der Welt ist es nicht, auf die Gegenwart mit einer gegenwärtigen Antwort zu antworten. Vielmehr überhaupt noch zu schreiben und nicht zu verstummen, das war die Aufgabe, der er sich stellte. Dass sich so vieles zu so viel Schlechtem verdichtet hat. das hat der entschiedene Anhänger der Aufklärung seit Jahren hinter sich. Viele Gründe und Eindrücke sprachen bereits vor Jahren dafür zu erkennen, dass sich vieles nicht zum Besseren wendet. Manche Literaturkritiker um ihn herum sagen, seine Aussagen seien nicht stark, nicht klar und damit nicht brutal genug im Verhältnis zur Lage in dieser neuen Zeitenwende. Der Autor selbst aber ließ sich nicht aus dem Maß der Mitte vertreiben, da es dort am ehesten noch darum geht, nach vorne zu schauen und das Bestmögliche zu erreichen. So landete Rafael R. Pilsczek in seinem 14. Buch "Der Mond hinter der Sonne. Eine kleine Zeitreise" vor allem in der Vergangenheit und verfasste Hundertzwölf Miniaturen. die seine Leserschaft in Zeiten mitnimmt, in denen es nicht grundlegend anders war, es aber grundsätzlich so war, wie der Autor darlegt, dass die Deutschen und die Europäer vielleicht gar nicht wussten, wie gut sie es hatten. Es sind Skizzen aus verschiedenen Bereichen, die er verfasst hat, von den satten Feldern der Liebe, den traurigen und schönen Begegnungen, sehr erfunden und kaum erfunden, der allumfassenden Politik und vor allem aus dem Zeitraum der Siebzigerjahre, Achtzigerjahre und Neunzigerjahre des 20. Jahrhunderts. Vor allem die Wirkungen, als die Mauer fiel und die Sowjetunion vor allem friedlich in sich zusammenbrach, beschäftigen ihn in diesem Buch. Die damalige, eher freiheitliche, eher wohlhabende Zeitenwende in die Epoche eines wohltuenden, vor allem sozialen Liberalismus hinein ist das Leitmotiv seines neuesten Werkes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
Widmung
Zitat
Ein Wort zuvor zum Geleit (Apocalypso)
Erster Kuss
Opa alten Schlages
Geh!
Als im Bett alles anders wurde
Zu spät vermessen
Eine Plage
Köln: (fast) nur schön
Das eine besser als das andere
Auch er weckte den Widerstand
Auch unbeheimatet
Väter aus Stahl
Für einen Lehrer ging ich in Gefahr
Entscheider unter sich
So gut
Nicht abgeholt worden sein
Das Los, kein Kind zu haben
Furchtbare Nacht
Dann stahlen sich Bürgerliche davon
Politik vernebelt
Ohne Worte
Sir Paul
Frau Meisterin
Rüstig werden
Stoned (entfernt nach Bob Dylan)
Es war doch auch gut, sagten jene
Missbrauch
Ein gemachter Kapitalist
Im Schloss
Wir waren nicht untergegangen
Im Film sein
Wie Bayern zu Westfalen, wie Rostocker zu Leipzigern
Im Bundeskanzleramt
Falsch (Ergänzung zu Depeche Mode)
Warum einem Gefolterten begegnen
Die töte ich nicht
Den Stand finden
Es stinkt mir
Auf dem Balkon
Bonn, Stadt der Buße
Rübergemacht
Er setzte den Standard
Eine Mutter
Fliegen
Vergangene Abläufe
Nicht fremdgehen
Im Gedenken
Wir haben den Schuss gehört
Nicht spielen, Sohn
Opa war der Teufel, nicht sie
Jimmy (Ergänzung zu Robbie Williams)
Ein erstes Gegenargument abräumen müssen
Ein zweites Gegenargument abräumen müssen
Ich habe Angst um Amerika (Ergänzung zu David Bowie)
Mit Zungen reden (Ergänzung zu Robbie Williams)
Die Welt am Ohr
Träume sind Schäume
Am Wald
Menschheit ist universell
Für sich selbst sorgen
Revolver
Ein Wort nur dazu
Freunde aussuchen war schwierigst
Kraftlos
Kirby, West-Kirby
Das große Abenteuer für einen Kleinen
Key West
Drei Wochen Alexanderplatz
Ihr werdet früh sterben
Tja
No Future
Richard wollte nicht tanzen
Auf Reisen die Wahl beachten
Kein Mittelmaß, bitte sehr
Strecke gehen
Im Dschungel
Suchen und gefangen werden
Hinter ihr die Bande
Brüche
Die Mutter, die alles klärte
Das dritte Auge
Vers auf Herrn Sumner
(
Fast ewige) Liebe
Ich habe den Spaß gehasst
In einer Wüste
Eine Ausgestoßene
Marinas Oligarch
Pole-Position
Erste Hilfe
Der größte Tag zum Feiern
Geschasst
Was, wenn
Susi
Idioten
Idyll
Postboten und andere bekannte Gesichter
Kerle sind solche, die wir nicht mögen
Als ich Sechs war (Ergänzung zu David Bowie)
Brüder ohne Bruderschaft
Keine Modeerscheinung
Unglaublich
Es war ein neues Wort
Verbrechen
Weg bist du
Es muss nicht schlimm enden (Ergänzung zu Annett Louisan)
Ein Verteidiger
Das große Auswandern
Gute Begleitung
Tolle herum
Restbestand der Ehre
Sieger der Geschichte
Der Kriegsreporter (Ergänzung zu Ernest Hemingway)
Die Lage des Zeltes
ENDE
Bisher erschienen vom Autor
Widmung
Für Heiko Gebhardt, Kai Hermann und
Klaus Liedtke. Für die, die es aufschrieben.
Zitat
„Wenn es morgens um sechs Uhr an meiner
Tür läutet und ich kann sicher sein, dass es der
Milchmann ist, dann weiß ich, dass ich in einer
Demokratie lebe.“
„Politiker denken an die nächste Wahl, Staatsmänner
an die nächste Generation. Wir brauchen mehr
Staatsmänner.“
Winston Churchill
Ein Wort zuvor zum Geleit
Apocalypso
Forderungen und Überforderungen in der neuen Zeitenwende
Wir leben nun – erneut – in einer Epoche des Gegenwindes. Die einen sagen, dass Krisen – geschichtlich gesehen – Chancen zur Veränderung sind und gehen ohne größte Sorge durch diese Zeit. Die anderen sagen, dass wir uns bereits im Krieg befinden und sorgen sich, dass diese Krise zur Katastrophe führt. Meine Antwort auf den Krieg in Europa und auf die gewachsenen Gefahren um uns herum und in der Welt ist es nicht, auf die Gegenwart mit einer gegenwärtigen Antwort zu antworten. Es sind andere Personen, die das leisten, und viele von denen geben sich alle Mühe, diese Arbeit gut zu leisten. Vielmehr überhaupt noch zu schreiben und nicht zu verstummen, das war die Aufgabe, die ich mir stellte. Es fasst mich vieles in dieser Zeit an, und mir fehlt Gelassenheit, ich weiß.
Es sind der Krisen so viele geworden, Zeichen des Krieges an so vielen Orten wahrzunehmen, und all’ das andere, was uns aus dem Gleichgewicht bringt, die Extremismen, die Pandemie, die neuen Machtverhältnisse und der Klima-Wandel der Gegenwart, dass es andere Kräfte braucht, als Antwort genau darauf ein Buch, ein Gemälde oder ein Gedicht abzuliefern. Dass sich so vieles zu so viel Schlechtem verdichtet und das zu senden, das habe ich seit Jahren hinter mir.
Viele Gründe und Eindrücke sprachen bereits vor Jahren dafür zu erkennen, dass sich vieles zum Schlechten wendet. Davon zu berichten habe ich bereits jahrelang in Büchern und in Gemälden getan. So bin ich fest überzeugt, dass mich das Bild des alten (weißen) Mannes, der in der Vergangenheit Trost sucht und die Gegenwart verdammt, nicht beschreibt und nicht auf mich zutrifft. Andere, sie, die sich erst jetzt der Lage bewusst sind, in der wir sind, äußern sich neu und dann gewaltig, und sie mögen ihre Mission gut erledigen. Manche um mich herum sagen im Gegenteil, meine Aussagen seien nicht stark, nicht klar und damit nicht brutal genug im Verhältnis zur Lage.
Ich lasse mich selbst aber nicht aus dem Maß der Mitte vertreiben, da es dort am ehesten noch darum geht, nach vorne zu schauen und das Bestmögliche für uns zu erreichen. Ich bin gleichzeitig als Mahner dort (fast) raus und betreue mich und betreibe nun seelische Pflege und will mich dort nicht in der Gegenwart weiter und tief bis zum Grund der zu sehenden Tatsachen begeben. Ist das vor mir zu verurteilen? Das weiß ich nicht. Bücher sind geduldig, sagt man. Meine Bücher sind in diesem Sinne keine, die – auf kurzfristige Erfolge hoffend – laut und Spitz auf Knopf den Terror vor sich hertragen, sodass Autoren wie ich in eine TV-Sendung des Krawalls eingeladen werden würden, um dort nur ein Statist der Rollenspiele zu sein, und auf sie, die großen Bühnen, möchte ich auch nicht gehen.
Andere, die weniger innerlich angreifbar sind, gefestigter, mögen das tun. Ich bin dazu nicht befähigt. Bücher, ehrliche, dürfen nicht vom begeisternden Tschakka und beruhigenden Komm-mach-einfach-mal und auch nicht allein von dem lieblichen Schönen und den dahin geworfenen Liebesgeschichten erzählen, nein. Sie müssen und dürfen Düsternis verbreiten und dadurch alle auf die Zukunft vorbereiten, dass diese besser werden möge, da sie durch die Warnungen empfindsamer Literatur gewappnet seien und auch Schlimmeres zu verhüten hülfen.
So landete ich – mich mit Umsorge ausstattend – vor allem in der Vergangenheit und verfasste 2022 hundertzwölf Miniaturen aus Zeiten, in denen es – mit uns Menschen – nicht grundlegend anders war, es aber grundsätzlich so war, wie ich glaube, dass wir vielleicht gar nicht wussten, wie gut wir es hatten. Es sind Skizzen aus verschiedenen Bereichen, die ich verfasst habe, von den satten Feldern der Liebe, der traurigen Begegnungen sehr erfunden und kaum erfunden, der allumfassenden Politik und vor allem aus dem Zeitraum der Siebzigerjahre, Achtzigerjahre und Neunzigerjahre des 20. Jahrhunderts. Vor allem die Wirkungen, als die Mauer fiel und die Sowjetunion vor allem friedlich in sich zusammenbrach, beschäftigen mich in diesem Buch. Die damalige – eher freiheitliche, eher wohlhabende – Zeitenwende in die Epoche des wohltuenden Liberalismus hinein ist das Leitmotiv dieses Werkes, das kein Hauptwerk von mir ist, aber seine Berechtigung für mich hat.
Kräfte meiner Generation sind heute, Jahrzehnte später, in der jetzigen Zeitenwende nicht stark genug, mit dem Heute kräftig und kühl umzugehen, spüre ich. Zugleich sind aber auch viele Krisenerprobte unterwegs, das möglichst Richtige zu tun. Wir benötigen widerstandsfähige Bürger, sagt der Bundespräsident. Er beschwört, dass wir es gemeinsam schaffen. Und er sagt, dass Freiheit errungen und bewahrt sein will. Wer geht seinen Weg mit? Viele, wie es erscheint, da doch viele – anders als in durchaus vielen Ländern Europas – Deutschlands Demokratie mittragen, oder wären es wenige, im schlimmsten anzunehmenden Fall in der Zukunft ganz wenige?
Dann sehe ich dort in den armen Stadtteilen in Deutschland verwahrloste, bemitleidenswerte Menschen, Erwachsene und Kinder aus so vielen Ländern, Geborene im Land und Eingewanderte, und gestern erneut einen, nicht jung, eher alt, der mit einem Stock in der Mülltonne nach Pfandware stocherte und die Getränkedose, die zerknittert war, wieder in den Mülleimer zurückwarf, da sie von den Pfandmaschinen nicht akzeptiert wird. Gemeinsam schaffen wir es? Unsere offene Gesellschaft ist so zersplittert, denke ich, dass ich mich frage, wer das Gemeinsame in noch viel größeren Krisen, kämen sie, herzustellen in der Lage wäre. Es gibt so viele, die mit Taten (und teilweise unter Gefahren) unser Land am Laufen halten. Zuvorderst Polizisten, Gemeinderatsmitglieder, Bürgermeister, aber auch die Handwerker, Angestellten in den Behörden, Arbeitnehmer in der Produktion, Unternehmer von kleinen, von mittleren und großen Betrieben, Kinderlose, Alleinerziehende, Mütter und Väter, junge Menschen im Kampf gegen den Klimawandel, Schüler, die ihre Hausaufgaben mit Freude und Entschiedenheit erledigen.
Zugleich sehe ich – und, ja, das ist eine Attacke auf diese – an der Königstraße in Düsseldorf und am Neuen Wall in Hamburg und in der Innenstadt von München Menschen, die sich amüsieren, als gäbe es eben kein schwieriges Morgen für sie. In SUVs fahren sie herum, als wären sie Protz und Propaganda einer Zeit, in der geistige Werte nicht mehr viel zählen, sondern allein der Wert des Geldes und des Goldes, mit dem sie sich schmücken. Diese Pappnasen meine ich nicht, wenn ich an die denke, die sich mühen. Doch: Wie sollte es anders mit uns – oberflächlich gesagt und dafür bestraft seiend – sein?
Wir Gepamperten sind nicht an Stahl gewöhnt worden (welch ein Glück), sodass wir uns eher falsch verhielten, eher betrunken, eher unklug und uns in einer langen Zeit des trügerischen Friedens befanden. Die Volksparteien, sie, die viele gute Frauen und Männer bräuchten, verzeichnen seit Jahrzehnten Abgänge und kaum Zugänge in einer derart hohen Anzahl, dass es – allein statistisch gesehen – richtig ist zu sagen, dass sich viele Bürger, im Sinne des teilhabenden Citoyens, aus der Teilhabe dieser offenen Gesellschaft verabschiedet haben. Viele sagen in diesen Monaten, solche, die tatsächlich und bewusst wählen gehen, sie könnten eh nichts ausrichten.
Wir sind aber in keinem Fall eine verlorene Generation. Wir sind aber auf jeden Fall die Generation, die alles verspielen könnte. So schwach sind meine Begleiter, dass es zum großen Heulen anstimmen könnte, so krank und so gelähmt wie diese oft sind und sich ohnmächtig fühlen. So sind es die Krisenerprobten der Gegenwart, denen Treue zu schwören ist, und zugleich die Jungen und die Frauen der jüngeren Generation, in die wir, die Älteren, die – berechtigte – Hoffnung setzen dürfen, ja, dürfen: in ihren Mut, in ihre Klarheit, in ihr Mitgefühl, in ihre Sachkenntnis und in ihre … entschiedene Bereitschaft, das anzupacken, was angepackt werden muss.
Allein der Wandel des Klimas rüttelt an den Grundsäulen unserer Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung derart gewaltig, historisch einmalig, dass keiner wissen kann, wie beides bestehen bleibt oder nicht. Ich bin nicht raus, obwohl das Zeitalter der Überforderung über meine Generation und auch über mich gekommen ist, wie ich glaube zu sehen. Nein. Ganz raus bin ich auch nicht. Ich schreibe. Das ist mein Beitrag.
***
1
Erster Kuss
Es war wie eine Zwetschge. Tatsächlich. Wie aus dem Garten seiner Eltern. Eine reife, lila bis braunrot. Ein Steinobst. Eine saftige gleichwohl. Mit einem leckeren Kern zum Lutschen. Zum Beißen. So war es, als der junge Mann das erste Mal geküsst wurde. Als sie ihm ihre Zunge übergab. Sie waren Hand in Hand Fahrrad gefahren. Bevor es geschah. Nebeneinander Rad zu fahren störte niemanden. Diese Straßen waren abends wie leergefegt. Sie, als sie es tat, fragte sich eines. Verdammt nochmal. Warum musste ich anhalten. Und etwas beginnen, worauf ich drei Wochen lang gewartet hatte. Hätte er mich nicht längst greifen können. Warum war es an mir, es zu tun?
***
2
Opa alten Schlages
Gegenüber der Straße, in der ich wohnte, lebte eine Familie mit zwei Kindern. Die Mutter bat sie, bevor sie zur Grundschule aufbrachen, die fußläufig lag, an der Eingangstür zum gepflegten Gebet. Holte ich meinen Nachbarsfreund früh ab, nahm mich die Mutter mit in das Gebet. Sie war eine pflichtbewusste Frau, und ihr Hobby war es, Malen nach Zahlen auszuführen. Ihre Gemälde hingen im Wohnzimmer, in der Küche, im Flur hinunter in den Keller und auch an der Eingangstür. Dieser Ort war vielleicht einer der ersten, wohin ich mich wagte. Als ich sehr jung war, spielten wir am Bächlein, der hinter dem Garten lag. Das Unglück geschah dann, dass die Tochter in das Bächlein fiel und schrie, als wären alle Dämonen der Welt hinter ihr her.
Ausgerechnet an jenem Tag war die Mutter nicht zu Hause, aber der Großvater, der ein Zimmer im Haus bewohnte. Ausgerechnet mich beschimpfte er hart, und das im Kommisston der alten preußischen Kadettenanstalten. Erschrocken und verängstigt flüchtete ich über die Straße nach Hause. Meine Mutter nahm mich in das Bad und wusch mich dort, wo sich meine Panik vor diesem Alten gezeigt hatte. Frau Möllering, die Mutter von der gegenüberliegenden Seite, hatte die Größe, als sie vom Unglück erfuhr, mich mit keinem Wort zu maßregeln. So ging ich weiter dorthin und betete weiter morgens mit ihr. Ich war ihr dankbar, in all‘ jenen Jahren, dass sie mir Streuner half, wo es nur ging. Wiewohl es nur das Schmuddelkind von dort drüben war, öffnete sie stets die Türe, wenn es dort wieder an der Tür klingelte und der Pudel, da er bellte, mich ankündigte.
***
3
Geh!
Natascha machte sich dann als Erste auf. Sie hatte für einen Schriftstellerverband gearbeitet und früh davon erfahren, dass Deutschland eine Chance bot. Ihre Eltern, bei denen sie wohnte, ließen sie ziehen. Dort könnte es besser sein, und sie, das einzige Kind, könnte ein wenig Geld nach Hause schicken. Sie gaben ihr das Geld zum Abflug, das ging noch. Natascha, die sehr klug war, machte sich dann in Berlin auf die Suche nach einem Mann. Ihr half, dass sie Fingernägel, Fußnägel und auch das Gesicht pflegen konnte. Eine ältere Deutsche gab ihr Arbeit. Es war nicht ganz legal. Das störte in Ostberlin gleichwohl niemanden. Es gab ja sogar bis jetzt keine Mietverträge für die Wohnungen und auch nicht für die Gewerberäume. Natascha hatte sodann den einen und anderen an der Angel. Ihr gefiel einer unter denen. Er wohnte in Köln und hatte eine ordentliche Arbeit. Er wiederum fand sie apart und ließ sich ihre Schmeicheleien gut und gerne gefallen. Nach nur drei Monaten heirateten sie. Sie und er hatten eine gute Zeit. Sie wohnten zwar an den Gleisen, besser ging es nicht. Es reichte aber alles dafür – was er nicht wusste –, dass sie die Hälfte von dem, was er ihr gab und was sie als Kosmetikerin verdiente, nach Hause schickte. Von Monat zu Monat, wiewohl ihr Deutsch besser und besser wurde, sie neue Freunde fand, befiel sie stärker und stärker werdendes Heimweh. Der Deutsche war so sachlich, so pünktlich, so kühl. Sie, im Gefängnis nun gefangen, wusste nicht, was sie tun sollte. Sie wusste es einfach nicht. Und wurde leidend in dem Land, das ihr doch ein besseres Leben bieten sollte. Was sie tat?
Sie tat nichts. Einfach nichts. Was sie unternahm? Nichts. Einfach nichts. Mehr gibt es über Natascha nicht zu sagen. War sie in St. Petersburg die Handelnde gewesen, goss sie das neue Land wie in Blei. Als weitere Freundinnen anreisten, um es ihr gleichzutun, fiel sie dadurch auf, dass sie schwieg, während die anderen schnatterten. Natascha dachte dann oft, dass sie nur noch nicht wussten, dass sie Vögel in einer Voliere waren. In einem Freiflugraum, ja. Der doch das Drahtgeflecht um sich herum hatte, das ihnen doch nicht wirklich ermöglichte, das Gefängnis zu verlassen. Was tun? Natascha wusste es nicht. Als das Kind geboren wurde, war dann eh alles zu Ende. Das Ende, das einmal einen Beginn hatte. Und nun beendet war. Was tun? Was nur tun? Selbst diese Frage verflüssigte sich. So lange, bis nicht einmal diese Frage in ihrem Leben vorhanden war.
***
4
Als im Bett alles anders wurde
Eine – tödliche – Krankheit breitete sich aus, und niemand konnte ihr aus dem Weg gehen und sich nicht anders verhalten, als sich mit ihr zu beschäftigen. In den Schulen war sie zum Thema gemacht worden, und die ganze Generation konnte nicht mehr unbefangen mit sich und den Geliebten umgehen. In den Zeitungen und Zeitschriften, im Radio und im TV wurde es tief und breit und viel behandelt, das in einem krassen Verhältnis zum Schweigen darüber in menschlichen Beziehungen und bei den Gelegenheiten stand. An den Litfaßsäulen blickte das Thema, was zu tun sei, auf die PKW-Fahrer, die Fahrradfahrer und die Fußgänger herab. Ein Bruder, der Arzt werden wollte, hatte früh in der Post Fachmagazine, die sich auf der Heizung in der Küche stapelten, bevor er diese in sein Zimmer mitnahm. Noch viele, viele Jahre später war die Krankheit ohne Gegenmittel, dafür gab es dann spät gute Medikamente, die zumindest ein brauchbares Leben mit ihr erlaubten.
Die damalige zuständige Ministerin sagte viele, viele Jahre später, dass es vor allem darum gegangen war, dem Verfemen der Erkrankten – sie nannte es Diskriminierung – auf kluge Weise entgegenzutreten, da die Krankheit vor allem in einem Milieu in den Gesellschaften wütete. Auch weltweit hatte die Krankheit gewütet, und die dazugehörigen Zahlen waren eindeutig eine einzige Katastrophe. Es wurden in den Städten Hilfssysteme geschaffen, die Beratung und Aufklärung gaben, wie es gelänge, der Krankheit auszuweichen und diese für sich in Schach und außen vor zu halten. So war die Krankheit allbeherrschend geworden. Eine Pandemie. Sie hieß und heißt: Aids. Vier Buchstaben, die kaum einer nicht kannte. Es gab die dazu gehörigen Tests, ob man positiv oder negativ wäre. Es gab und gibt bis heute kein Impfmittel dagegen. Und, obwohl wir den Mond betraten und uns auf einen Schlag vernichten könnten, ist sie bis heute unheilbar.
***
5
Zu spät vermessen
Er war hochbegabt, nennen wir ihn Lukas. Alles lief auf jeder neuen Stufe der Schulen glatt, ohne dass sich Lukas im mindesten anzustrengen hatte. So war viel Zeit für Clownerie und andere Verhaltensweisen, die ihn ein wenig auffällig, aber zum besonderen Spielpartner machten. Die Grundschule, die Unter-, Mittel- und Oberstufe, alles geschenkt. Das Abitur, geschenkt. Dann das Physik-Studium, geschenkt. Eine Eins. Doch dann begann Lukas eine hochwertige Doktorarbeit in theoretischer Physik und wurde darüber – zum ersten Mal überhaupt in seinem Leben – schwer krank. Lukas sah ein, dass er den Herausforderungen auf dieser Ebene nicht gewachsen war und gab nach vier quälenden, langen Jahren die Arbeit an der Dissertation auf. Eine schwierige, eine erste Niederlage. Viele Jahre später eröffnete Lukas seinem besten Freund den Grund, warum er, wie er glaubte, an der Doktorarbeit gescheitert war.
Der Freund, aus einfachen Verhältnissen stammend und nicht derart intelligent wie er, dass ihm alles in den Schoß gefallen wäre, habe stets Kämpfe ausfechten müssen. Darin dann geschult, sei er, der Freund, weit gekommen. Er selbst, Lukas, habe sich als Kind, als Jugendlicher, als Jungerwachsener und später aufgrund seines hohen Talents niemals mit anderen messen müssen. Erst während der Arbeit am Doktortitel im Kreise anderer – höchst – Talentierter hätte er Durchsetzungskraft einsetzen müssen, scheiterte daran aber, da er niemals gelernt habe, sich zu messen. Lukas erzählte dem Freund im traurigen Ton davon, als beide auf der Terrasse seines Hauses saßen. Der Freund wusste nichts darauf zu sagen. Er dachte nur etwas. Dass es – bitter, wie die Einsicht war – stimmte, was der Freund – Lukas – gesagt hatte. Der Freund nahm sein Glas, goss Cointreau nach und trank in einem Zug fast die Hälfte des vollgefüllten Glases aus.
***
6
Eine Plage
Prag war eine Stadt, in der manche – nicht wenige – der Länder der europäischen Welt in ihrer Sprache schrieben, als gäbe es nicht eine physische Stadt, sondern allein einen Ort der Psyche. Dann, nach dem Einmarsch, verriegelten die Besatzer Prag. Als ein Dichter nach dem Zusammenbruch der Herrschaft ihr Präsident wurde, Václav Havel, öffnete sich die Stadt erneut. Seine ganze Seele und all‘ ihre Seelentröster feierten das Fest, erneut geistiges Zentrum geworden zu sein. Doch dann war es anders. Das Bier schmeckte. Das Gulasch schmeckte. Der Schnaps obendrauf. Die kleinen Straßen, die alten Häuser, die Brücke, das Schloss, alles lud zur Besichtigung einer Zeit ein, die dort die vielen Jahre der Unterdrückung – schmückend in der Ansicht der Ausländer – überlebt hatte. Und was passierte?
Heuschrecken fielen über das alte Prag her. Auf der Suche nach dem Bier, dem Gulasch, dem Schnaps und den viel zu preiswerten Unterkünften. Heuschrecken waren es, da die jungen Besucher aus dem Westen – vor allem aus den USA – der Stadt nichts schenkten. Die, die ich meine, schrieben keine neuen Bücher, malten keine neuen Gemälde, schufen keine neuen Skulpturen. Nein. Sie kamen nicht als Seelenläufer in die Stadt, die Seele leben wollten. Sie vergnügten sich dort, und das auf Kosten der Schädel und Skelette, die ohne Stimme auf den Friedhöfen lagen. Am schlimmsten waren die, die den jungen Frauen nachstellten, als wären sie ihr Besitz, nur weil ihre Väter und Mütter – aus weiter Entfernung – Stand gegen die Herrscher der dann überwundenen Zeit gehalten hatten. Es war Fast Food und nichts anderes. Ginge es, die Dichterinnen und Dichter hätten sich im Grabe umgedreht, wären auferstanden und hätten zu einer, zu einer weiteren Revolte gerufen.
***
7
Köln: (fast) nur schön
Köln war für die jungen Menschen ein Alles. Köln hatte den Rhein und die Promenade, die schön war. Köln hatte Museen, die Altes und Neues zeigten, das war schön. Köln hatte die Altstadt, die wegen ihrer Fachwerkhäuser fremd wirkte, und hatte gutes Essen und gutes Bier, das war schön. Köln hatte Prominente, die in Fahrstühlen auftauchten oder in einer Ecke rauchten oder abends auf einer Veranstaltung, das war schön. Köln lag räumlich so gut platziert, dass die Stadt gut mit dem PKW oder mit der Bahn erreichbar war für die, die im Bundesland wohnten, das war schön. Dazu hatte Köln eine Brücke über den Rhein, die so stählern war, so groß und so magisch, dass es schön war, von dort in den Hauptbahnhof der Heimat einzufahren. Köln hatte den Weg in die akademische Welt, und Studenten, die dort ihren Platz fanden und ihre Titel erreichten, das war schön. Köln hatte den Dom, der mächtig wirkte, das war schön. Köln hatte eine Straßenbahn, derentwegen die Wege anders waren, das war schön.
Köln hatte irgendeinen und irgendeine, die dort bereits waren und bei denen ein Schlafplatz bereitstand, das war schön. Köln hatte Nächte und Tage voller Liebe und Nähe von besonders großstädtischen Kölnerinnen und Kölnern, die es so davor niemals gegeben hatte, das war schön. Köln bot Arbeitsplätze und Arbeit, die es woanders nicht gab, das war schön. Köln hatte Konzertsäle und Discos, die es so, in ihrer Pracht, nicht in der Provinz gab, auch das war schön. Köln war alles. Alles für die, die in den Dörfern und in den Kleinstädten – in der Nähe – lebten. Köln war auch der große Karneval, ja, seine Umzüge und seine hässlichen Betrunkenen, das war das Einzige, was an Köln nicht schön war. Aber daran musste ja keiner teilnehmen, der es nicht wollte. Der ganze, große Rest, der war nur eines: wunderschön.
***
8
Das eine besser als das andere
Ja, es war ein Glück, nicht in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) groß geworden zu sein. Ja, es war ein Glück, in der Bundesrepublik (BRD) groß geworden zu sein. Wer dieses Glück anders ansieht, kann im Grunde nicht zum Freundeskreis gezählt werden. Es sind dazu alle Sachbücher, Studien, Analysen und es ist dazu alle notwendige Literatur geschrieben worden. Dass bis heute an diesem Grundsatz – von wenigen – gerüttelt wird, kratzt nicht einmal am Grundgerüst dieser Aussage. Besonders vor dem Hintergrund der Aufarbeitung der Unterlagen der Behörde für Staatssicherheit durch den späteren Bundespräsidenten Joachim Gauck und seinen Nachfolger bei der Aufarbeitung des Geheimdienstes der DDR zeigt in Klarheit und in Wahrheit nichts anderes als die unumstößliche Tatsache, dass die DDR eine Diktatur war. Es gibt auch immer graue Nischenbereiche dazu, dass die BRD kein Paradies war, wie könnte es anders nur gewesen sein. Aber in der eindeutigen Gewichtung der Tatsachen bleibt diese Aussage klipp und klar.
Eines von vielen Beispielen war der Umstand, dass in der offenen Gesellschaft der BRD die, die aus Gewissensgründen den Wehrdienst ablehnten, einen Sozialdienst leisten konnten, in großer Freiheit und bei fairer Bezahlung gar, während die in der DDR, die dort den Wehrdienst ablehnten, auf das Schlimmste gequält wurden und von ihrer – totalitären – Gesellschaft bestraft wurden, obwohl sie sich auf das universelle, überall geltende Menschenrecht beriefen, sich der Waffe und damit dem Töten verweigern zu dürfen. Damals gab es zwei Systeme, die in Ablehnung und in Feindschaft zueinander standen. Das verführte am Ende die BRD, Frankreich, England, Italien und, ja, die USA nicht dazu, sich in Antwort auf die Bedrohung der Sowjetunion und ihres Warschauer Paktes zu totalitären Gesellschaften zu entwickeln. Es ist das eine, die DDR zu verdammen. Es ist das Nächste, sich klarzumachen, dass der Westen insgesamt offen, liberal und zugleich wehrhaft blieb. Wer dies erkennt, der muss sich vor den Führungskräften des Westens und den Bürgern, die diese dazu erwählten, es gut zu machen, wie es nur ging, tatsächlich insgesamt in Demut verneigen, ohne dass es verlangt, in besondere Huldigungen zu verfallen.
***