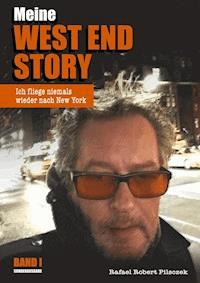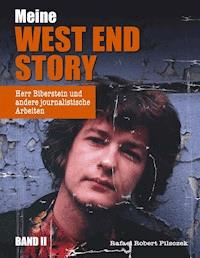
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Meine West End Story
- Sprache: Deutsch
Bleibt der Westen so erhalten, wie wir ihn kannten? Sind seine Werte in großer Gefahr in diesen Jahren? In Band II seiner zweibändigen West End Story geht der Hamburger Schriftsteller Rafael Robert Pilsczek der wohl wichtigsten Frage dieser Epoche nach, ob das Leben im Westen in derartige Schwingungen gerät, dass er bald Geschichte sein könnte. Während er in Band I unter dem begleitenden Titel "Ich fliege niemals wieder nach New York" eine große Reportage über New York, das neue Berlin und das alte Bonn als Sinnbild für den Westen veröffentlicht hat, versammelt Band II unter dem begleitenden Titel "Herr Biberstein und andere journalistische Arbeiten" den alten Westen, wie wir ihn kannten: in einer breiten Textsammlung der Arbeiten des Reporters Rafael Robert Pilsczek, die von 1987 bis 2001 in fast allen renommierten Medien veröffentlicht worden sind. Die Reportagen handeln von Junkies aus Moers ebenso wie von Massenmördern, die sich Christen nannten, und dem Leben von Pop-Stars, die immer schon wussten, dass sie berühmt werden. Die Artikel erzählen stets von der großen Freiheit, kritischer Reporter im alten, guten Westen gewesen zu sein. So ist das Kunststück in den zwei Bänden der West End Story vollendet, sowohl in die Geschichte des alten Westens zu schauen, als auch in seine Gegenwart zu blicken, in der sich auf dramatische Weise entscheidet, was Aufklärung und Demokratie in einer offenen Gesellschaft heute und in naher Zukunft noch bedeuten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Widmung
Für Irmgard Bernrieder, meiner ersten Lehrmeisterin im Journalismus, die mir meinen ersten Auftrag gab und die stets darauf vertraute, dass es gut wird, wer es wagt zu schreiben.
Zitate
„Dir fehlt nur Routine.“
(Frank-Dieter Freiling, Paris, 1987)
„Sei nicht so kontrolliert, empfehle ich dir.“
(Roman Frister, Tel Aviv, 2001)
„Du kannst ja nicht alles machen.“
(Heiko Gebhardt, Gümse, 2017)
Über den Autor
Mit der sächlichen Reportage und Berichterstattung unter dem Titel „Meine West End Story / Ich fliege niemals wieder nach New York“ hat Rafael Robert Pilsczek den BAND I als Sonderausgabe seiner sachlichen Untersuchung der möglichen Antwort auf die Frage vorgelegt, ob der Westen, wie wir ihn kannten, an sein mögliches Ende gekommen ist.
BAND I handelt vor allem von New York und Amerika, vom heutigen Berlin und dem alten Bonn als Sinnbild für das Leben im alten Westen. Mit den Erfahrungen aus mehreren Jahrzehnten als überzeugter Westerner ist BAND I für den Autor der vorläufige Schlusspunkt einer lebenslangen Recherche und Lernkurve, die ihn analytisch und biografisch begründet zu Gedanken der in diesem Jahrzehnt wohl größten Gefahr geführt hat, der Veränderung der offenen Gesellschaften des Westens in eine neue Epoche, wie sie davor nicht war.
Nun hat der Hamburger Schriftsteller den BAND II zu „Meine West End Story“ unter dem Titel „Herr Biberstein und andere journalistische Arbeiten“ vorgelegt. BAND II gehört zwingend zur Berichterstattung und dem Ausloten des Themas hinzu und erscheint eigenständig.
Es versammelt die Textsammlung der Arbeiten als Reporter, die Rafael Robert Pilsczek von 1987 bis 2001 in fast allen renommierten Medien veröffentlicht hat. Diese beschreiben den Westen, wie wir ihn kannten, ohne gewusst zu haben, wie diese Epoche in Abwesenheit von Krieg, Gewalt und Leid insgesamt eine gute Zeit gewesen war.
Mit BAND II seiner „West End Story“ legt der Autor sein sechstes Buch vor und hofft, dass seine Leser bedeutsame Hinweise aus dem Werk nehmen, die sie selbst befähigen, die für sie schlüssige, logische und wirkmächtige Antwort auf die wohl bedeutsamste Frage der Zeit für uns im Westen zu finden, ob dieser, wie wir ihn schätzten, am Auseinanderbrechen ist.
Der Autor schaut in seinen Büchern und Werken in das Leben einzelner Menschen und zieht daraus Schlüsse auf das Leben selbst. Das zeigt sich in seinem dritten Buch „Friedenskinder“ (2015), das 70 Jahre Frieden in der höchst unwahrscheinlich längsten Zeit der Abwesenheit von Krieg, Gewalt und Leid in (West-)Deutschland beschreibt und die Gefahr, den Frieden dereinst zu verlieren. Es zeigt sich genauso im Popular-Fachbuch zur modernen Kommunikation, „Mehr Sein als Schein“ (2013) als auch in der groß angelegten Liebeserklärung an Menschen und die Begegnungen mit ihnen in „Wie ich 10 Tausend Menschen nah kam“ (2014). Im Herbst 2016 veröffentlichte der Autor sein literarisches Theaterstück, „Kriegskinder“, das als Drama und Zweipersonenstück mit Latina vor allem die stets aktuelle Frage fiktional behandelt, ob Demokraten zu Barbaren werden müssen, um sich der Barbaren zu erwehren.
In seinem bisherigen Leben zog der Autor, 1968 am Rande einer Kleinstadt am linken Niederrhein geboren, stets hinaus in die nahe und weite Welt in Europa, in Übersee und Arabien, um das stete Rätsel Mensch und damit letztlich sich selbst zu entschlüsseln. In vielen Lebenswelten erfolgreich unterwegs gewesen, als Journalist und Reporter, der in allen maßgeblichen Medien veröffentlicht hat, als Politiker, Dozent, Vereinsvorsitzender und heute ein erfolgreicher mittelständischer Unternehmer, vereint Rafael Robert Pilsczek M. A. besondere Erfahrungen in sich.
Der studierte Literaturwissenschaftler und Philosoph hat aus den vielfältigen Erfahrungen und Fachthemen eine besondere inhaltliche und sprachliche Kompetenz darin entwickelt, die Welt anzuschauen und von ihr zu erzählen. Fest in der europäischen Aufklärung verankert, versteht sich der Autor als entschiedener Gegenvertreter zum gleichaltrigen deutschen Spaßliteratur-Milieu.
So können alle sechs bisher erschienen Werke und Bücher als ernsthaft erarbeitete Versuche eines Gesamtwerks begriffen werden, da sie zuerst immer von einzelnen Begegnungen und ihrer kommunikativen Nähe zu Menschen ausgehen, die zusammengenommen dann mehr erzählen als nur von Einzelteilen des Lebens.
Der Autor lebt seit über zwei Dekaden im Hamburger Süden. Alle Bücher, herausgegeben von PPR Hamburg & Friends, sind über den stationären Buchhandel, auf iTunes oder Amazon als E-Book und als gebundene Ausgaben erhältlich. Lesungen führen den Autor durch ganz Deutschland und bis nach Amerika.
Hamburg, im Winter 2017
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Gesellschaft
Jahr: 1998
Folgen von Verbrechen von rechtsaußen und ihre scheiternde
Aufarbeitung
Sehr viele Versprechen
Der Solinger Mehmet über seine Stadt fünf Jahre nach dem Brandanschlag auf die Familie G.
Jahr: 1995
Wenn Wirtschaft nicht aus eigener Kraft stark ist
Die Schweineohren sind ab
Jahr: 2000
Aufklärung und Aufdeckung
Mit Rainer Hering
Heilige Opfer für Hitler
Der Fall Biberstein und die evangelische Kirche
Jahr:
1998
Flüchtlingspolitik begann viel früher als viele heute denken
Professor Nuscheler stellte in der Stadtbibliothek Neukirchen-Vluyn
fest: „W ir leben im Jahrhundert der Flüchtlinge“
Jahr:1993
Der Kalte Krieg und seine Geschichte
Ostexperte Leonhard hielt dramatisches Referat in der Sparkasse
Kamp- Lintfort
Jahr: 1987
Gedenken und Geschichte
Das Gegenstück zu den Kriegsdenkmälern
Eine Mahntafel zum Gedenken der Opfer
Jahr: 1987
Was in Nachbarschaften kaum bekannt ist
Lehrer beschäftigt sich mit Kriegsdenkmälern in Neukirchen, Vluynund Rayen
Der Ad ler blickt nach Osten
Jahr: 1998
Warum erstreiken sich heutige Studenten ihre Rechtenicht mehr?
Von Rudi lernen
Nach dem Studentenprotest: Aktivitäten bündeln
Jahr: 1988
Wehrersatzdienst, als es das noch gab
Ohne die Arbeit der Zivildienstleistenden bliebe für viele nur das Altersheim
Einen Tag unterwegs mit dem Team des mobilen sozialen
Hilfsdie nstes
Jahr: 1988
Diktaturen erkennen
Zehn Tage im anderen Teil Deutschlands
Fremde und doch nahe Wirklichkeit
Jahr: 1988
Frühe Hassparolen
„Rotfront verrecke – Wotan“
Ein Stromkasten und eine Spraydose
Jahr: 1999
Eine Dichterin, die verfolgt wurde, weil sie im falschen Leben lebte
Auf den Erfolg einer hoffnungslosen Mission
Eine Begegnung im Moskauer Untergrund
Jahr: 1988
Stadtteilkulturen in Mittelstädten
Keine Theaterveranstaltungen mehr im „Dschungel“: Warum Jens Groß aufgibt
Ein Verlust für Moers
Jahr: 1999
Besondere Kneipengänge
Ein letzter Absacker mit Ole
Gehörl os – aber nicht geräuschlos durch die Nacht
Jahr: 1999
Eine besondere Gegend, Berlin-Ost
Alles das Beste
Jahr: 1991
Nazis und Bürger, die etwas nicht verstanden
Krawalle in Hoyerswerda
„Jetzt machen wir die Neger fertig“
Jahr: 1991
Früher Rechtsextremismus im wiedervereinigten Deutschland
Mein Sohn, der Neonazi
Jahr: 1996
Die Spaßgesellschaft, als alles noch gut war
Die zwei Seiten von Techno:
Ekstase mit und ohne Ecstasy
Jahr: 1999
Armut und Altersarmut in Moskau
Die stummen Heldinnen des Untergrunds
Jahr: 1991
Straßengewalt ist eine Kriminalität, die häufigüberraschend geschieht
Jagd auf die Polen
Jahr: 2000
Überwachungsstaat kann auch ganz privat beginnen
Mit dem Sender im Rucksack zur Schule
Jahr: 1991
Die Hauptstadt und die Geschichte ihres Zentrums
Berlin-Alexanderplatz
Das schwache Herz der Stadt
Jahr: 1996
Stresssyndrom und traumatische Belastungsstörung waren erstspät anerkannt
Schuss wunden
Jahr:1990
Geschichte der Sucht und Porträt eines Süchtigen
Einmal Junkie, immer Junkie
Jahr: 1995
Die Anerkennung der Gebärdensprache hat lange gebraucht
Den Lö wen jagen
Jahr: 1987
Starke Mädchen, hilfreicher Feminismus
Selbstverteidigungslehrgang für Mädchen
Jahr: 1998
Erinnerungskultur und Kultur des Vergessens
Kastanien erinnern an die Opfer
Jahr: 1991
Armut und das Engagement von Bürgern, Armut zu bekämpfen
Ich sehe immer ihre Augen vor mir
Jahr: 1998
Blindflug im Cyberspace
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, auch im Internet – wenn
man sehen kann
Jahr: 1997
Minderheiten in einer Minderheit
Das Alphabet der Hände
Jahr: 1991
Gewaltberichterstattung und Opfer von Gewalttaten
Tatort U-Bahn
Jahr: 1992
Aufstand der Anständigen
„Wir müssen etwas vor Ort tun“
Jahr: 1998
Arbeitnehmerrechte und Kinderrechte
Warum Sumaya jetzt besser schläft
Weltweiter Marsch gegen Kinderarbeit erreicht Hamburg
Jahr: 1988
Als die Aufarbeitung der Sklavenarbeit in Deutschland begann
Die zweite Schuld
Jahr: 1989
Städtepartnerschaften schaffen ein wenig Frieden untereinander
Arbeitslose aus Moers und Knowsley tauschten Erfahrungen aus /Pfarrer gab Anstoß
„Sozia le Lage hier ungleich härter“
Jahr: 1996
Wie wirkliche Heldengeschichten geschrieben werden
Unterwegs in zwei Welten
Jahr: 1996
Weitere Völkerverständigung
Austausch zur Verständigung
Politik
Jahr: 1995
Kleine Veränderungen im Lokalen von großer Bedeutung
„Überf allkommando“ gegen Clara Zetkin
Jahr: 1993
Parteienforschung, wie sie Parteien nicht gefällt
Alarmsignal. Der SPD brechen Teile der unteren Schicht weg – nachrechts außen
Oh! Der sozialdemokratische Republikaner
Jahr: 1998
Frühe Flüchtlingspolitiker des recht neuen Deutschlands
Deutschland macht dicht
Jahr: 1988
Demonstrationen von Extremisten
Moers macht mobil
Jahr: 1988
Einflussnahmen von Extremisten
5. Juni: Startschuss für rechtsextreme Jugendorganisationen an
Moers er Schulen
Jahr: 1988
Demonstrationen von Demokraten
NPD-Landesparteitag in Moers
Kommt zur Demo!
Jahr: 1995
Wie Extremismus entsteht
Die Üb erläufer
Jahr: 1989
Wie Parteien reden, wenn es um das Extreme geht
Der Rock rutscht hoch
Von DKP bis CDU: Wie reagieren die Moerser Parteien auf die
Neue Rechte?
Jahr: 1997
Geschichte von Sicherheit und Unsicherheit
Bei Verfolgungsjagden runter vom Gas!
Wie Sc hleswig-Holsteins Polizisten sparen sollen
Feuilleton
Jahr: 1998
Bücher in Ländern, die offen und geschlossen sind
Eine Begegnung mit dem Moskauer Schriftsteller und Pop-Star
Viktor Pelewin
Jahr: 1988
Erinnerungskultur damals wie heute
Miep Gies erzählte von ihrer Zeit mit Anne Frank
„Denken Sie nicht, dass wir immer mutig waren!“
Jahr: 1987
Brechts Theater wollte die Menschen verändern, ein Beispiel
„Püppc hen“– ein Stück, das ein heiliges Tabu bricht
Jahr: 1988
Kabarett eines sehr Klugen
Matthias Deutschmann in der Aula des Jugenddorfs
„Letzte Ölung für die Weltmeere“
Jahr: 1998
Geschichten von gestern können zeigen, wie besonders es auch früher war
Brage Bei der Wieden
„Nehmt das Pferd, Ihr seid frei!“
Jahr: 2003
Die Klassik, der Meister Johann Sebastian Bach
Das Genie strahlt weiter
Besuch bei Bach
Jahr: 1989
Kabarett eines ewigen Kabarettisten
Satire vom Weltuntergang
Koczw ara in der Kulturhalle in Neukirchen-Vluyn
Jahr: 1997
Moderne Gedenkkulturen
650 Megabyte Holocaust
Die Judenvernichtung auf CD-ROM: Wird das Medium dem Themagerech t?
Jahr: 1996
Schriftsteller lehren, das Schreiben zu lernen
Lust am Erzählen
Schrei ben mit Hermann Peter Piwitt
Jahr: 2000
Weit im Osten die Techniken der Moderne erfinden
Russische Visionäre
Jahr: 1998
Das Privatfernsehen drehte mal etwas Altes
Die Schüler des Hexers
Mit Ed gar Wallace auf Quotenjagd
Jahr: 2000
Reisen bildet und besonders, wer vergleicht
Zwei ungleiche Städte buhlen um die Gunst der Gäste
Rotter dam und Amsterdam zeigen sich in ihren schönsten Kleidern
Jahr: 1988
Wie Reden nach dem Holocaust geht
Gegen das Schweigen, für das Sprechen
Jahr: 1999
Bevor ein wichtiges Thema breit und tief öffentlich wurde
Interesse wecken, nicht verhindern
Eine Hamburger Forschungsstelle „nach/über Auschwitz“
Jahr: 1996
Wie Klischees entstehen, sieht man dort
In völliger Dunkelheit durch die erhellende Sinnenfinsternis
Jahr: 1996
Wald, der deutsche Wald
Förster im Rosengarten – Was er heute pflanzt, ernten erstseine Enkel
Der tägliche Kampf gegen die Unvernunft
Jahr: 2001
Geschichte des Holocaust
Das Glück des Roman Frister
Eine Begegnung mit dem Autor der KZ-Autobiographie „Die Mütze“
Sport
Jahr: 1991
Der kurze, starke Moment des FC Hansa Rostock
„Beim Fußball können uns die Wessis nicht bescheißen“
Jahr: 1993
Pferdesport ist ein Sport für Narren vom Niederrhein
Wettbewerbe erstmals auf eigenem Gelände
„Grand Local“ in Sonsbeck: Rennen und Turnier mit Totalisator
Jahr: 1993
Eine andere Form der Bundesliga, nein, dieses Mal kein Fußball
Für Lu tz Brors ist Lampenfieber ein Fremdwort
Unterhaltung
Jahr: 1995
Innovationen müssen nicht immer großartig und von der IT sein
Elvis auf Schokolade
Jahr: 1997
Wie Musik und ihre Richtungen sich stets neu erfinden undweiter entwickeln
Der Hi p-Hop aus dem Reihenhaus
Jahr: 1998
Glossen machen einfach Spaß
Ufos über Amerika, über Kirgisien
Wo sie landen
Jahr: 1999
Nachtclubs, Freizeitgesellschaft
„A Hard Day‘s Night“ im Kaiserkeller
Jahr: 1996
Zirkusse im alten Glanz
Zur Begrüßung tanzen die Löwen
Chinesischer Staatszirkus hat in Buxtehude sein Zelt aufgeschlagen
Jahr: 1987
Kino, als Kino groß war
Filmnacht im JFC
Marath on für Kino-Fans
Jahr: 1997
Das Wandern ist nicht nur des Müllers Lust
Die Gr enzgänger
Jahr: 1988
Generationenbeschreibungen
Die Lehre nach dem Büffeln
Jahr: 1999
Reiches Leben
Hanseatische Havanna Lounge
Hamburgs feinster Club für Anhänger der Rauch- und Genusskultur
Jahr: 1999
Pop-Kultur und Freundschaftskultur
Ich Po pstar. Du Penner.
Jahr: 1998
Das Fernsehen in Ostdeutschland und seine ganz eigene Kultur
Nettes aus dem Osten
Jahr: 1989
Eine frühe Geschichte an der Seite eines großen Schriftstellers
Fabian hätte nur gelacht
Am falschen Ort: Hot-Body-Show im Second Life
Anhang
Baby, dir
Gedich tegewichteskizzen auf die Liebe
Anmerkungen des Lektorats zu BAND I und BAND II
Bisher erschienen vom Autor
Vorwort
Ist genau so
Kurze Erklärung aus der Wirklichkeit zu meinem Ende als Reporter im Westen, weil es im Grunde kein Ende davon geben darf, was ein Reporter in einer offeneren Gesellschaft sein durfte, wer ein solcher war (journalistische Arbeiten von 1987 bis 2001).
Santa Ponsa, Spanien, im September 2017. Ich atme tief ein, ich atme tief aus. Wo es so warm, wohlig und tagsüber bis zum Sonnenuntergang um 19:36 Uhr so gelbhell ist. So ist die iberische Insel Mallorca jetzt zu mir, wie nicht in Deutschland gefühlt, wo die Blätter in Hamburg vielfach rostbraun geworden sind und in diesen Tagen auf den Boden fallen. Und Mallorca ist der Ort, an dem ich jetzt zur Ausnahme nachts wach bin, wo es Menschen wie mich gibt an diesem Wochenende, die im Mittelmeer und am Pool baden gegangen waren, wiewohl Menschen zu Hunderten dort im Mittelmeer unweit von uns auf Nussschalen reisen und auch, ja, täglich, sterben. Was für eine Welt? In der wir lebten, lasen und leben werden? Was für eine Welt! Eine Welt, wie sie unfassbarer nicht sein kann. Eine Welt, wie sie widersprüchlicher nicht sein kann. Wozu der große Reporter Egon Erwin Kisch alles gesagt hat, dass die Wirklichkeit, wie wir Reporter sie kennen, nicht größer und nicht unfassbarer sein kann, als sie ist. Eine Welt! Eine unfassbare Welt, die dort vor der Türe des Kinderzimmers ist, wer hinaustritt, um diese zu erobern. Was für eine Welt!
(Und mit Ausrufezeichen geht ein schreibender Kundiger sehr, sehr sparsam um, ist mir beigebracht worden, weil sie allein die größte Bedeutung von Worten und Sätzen unterstreichen dürfen, wenn dieses eine Wort und dieser eine Satz auf vielen Seiten die große, die größtmögliche Bedeutung gewinnen darf.)
Wie die Welt von Reportern in Sprache gebracht werden muss, wer die Worte und Sätze dazu hat, ist der Grund, warum ich Journalist wurde. Ein paar wenige Worte, die zu erklären versuchen, warum ich dieses Büchlein herausbringe. Es ist im Grunde das Vorwort zu BAND I meines Projektes „Meine West End Story“, ein Vorwort insgesamt zu BAND I und BAND II, wer es lesen und hören mag. Es tut mir leid, wenn Leidenschaft, wenn Pathos, wenn zuviel Herz davon drin ist. Es tut mir leid, und im Grunde nicht, wer sieht, wohin die Welt gerade kommt, wenn es Gefühle weckt. Es tut mir leid, wenn zu viel in zu wenige Worte gepackt wird in diesem Aufschlag. Es tut mir leid, dass ich an dieser Stelle echt bin, wie ein Freund sagte, … und verzweifelt. Es tut mir leid, wenn es starke Worte sind und keine nüchternen hamburgischen Worte, wie ich sie auch schreiben und sagen kann, wenn ich mich hamburgisch verhalten mag und muss. Es tut mir leid. Wer bedenkt, dass es spät nachts ist, jetzt, und bedenkt, dass Wörter nicht reichen, um Welterfahrung zu halten, der möge gnädig sein und …
… mit mir in BAND II nachdenken über die Zeit, in der wir heute leben, und den Westen, wie wir ihn kannten, bevor er anders wurde, als er war, wie ich ihn in vielen Artikeln festgehalten habe. Der BAND II ist zugleich zwingend notwendig die Ergänzung zu BAND I von „Meine West End Story“, wer mir intellektuell und analytisch auf dem Weg folgen wollte und will, warum der Westen, wie wir ihn kannten, in derartiges Schwingen geraten ist, dass der Westen … bereits anders geworden ist als davor, als wir in ihm insgesamt gerne lebten und in Abwesenheit von Krieg, Gewalt und Leid für viele den Tag und die Nacht durchlebten.
So, heute, auf dem Balkon vor dem Hotelzimmer, ist das mein echtes Gefühl, dass ich beginne mit dem Satz: Ihr könnt mich mal, die andren können mich mal, eine Menge an Leuten kann mich mal. Was soll ich denn noch schreiben?, spüre und denke ich und sehe hinauf auf den Großen Wagen, den Kleinen Wagen, die Sterne, die Venus, die klar und eindeutig am Himmel erscheint. Was soll ich denn noch sagen? Was soll ich denn noch meinen? Was soll ich noch berichten, wenn du tatsächlich so viel weißt, was war, was ist, was sein wird, wenn du hörst und liest seit so vielen Jahren mit mir und Leuten wie mir? Wenn, wenn, wenn jetzt der Dreck in meine Ohren und in meine Augen kommt? Wenn, wenn, jetzt das alte furchtbare Deutschland erneut sichtbar wird? Dreck, den ich so nennen sollte, als Dreck, der er ist? Wenn all das, was manche meiner Lehrer und Lehrmeister in 1989 und in 1990 im Jahr der deutschen Wiedervereinigung heraufziehen sahen, nun, ein Vierteljahrhundert später erneut nach oben gekrochen ist, als wäre es lediglich, was wir wussten, von wohlmeinenden Westernern stark unterdrückt und jetzt eine neue, alte Kraft, gegen die wir uns umsonst stemmten, weil diese neue, alte Kraft nun nach oben gekrochen ist? Posten erhalten hat und die Wörter und die Sätze, den Dreck in meine Ohren von Berlin aus in mein Bullerbü nach Hamburg trägt, den ich mit andren nicht wieder, nie wieder an mich und meine lebenden und verstorbenen Bundesgenossen herangetragen haben wollte? Der Dreck in Worten und Sätzen ist nun da und wird bleiben, mindestens vier Jahre lang.
Die Bundestagswahl 2017 ist jetzt gelaufen und entschieden. Nun sind die Extremen nicht allein in dreizehn von 16 Bundesländern vertreten, sie sind mitten in Deutschland in Berlin, in der Hauptstadt und damit im Ganzen angekommen. Was soll das Gerede, das Recherchieren, das Schreiben, wenn die Extremen ihr Wort führen dürfen und ihre Sätze in die Luft schmeißen dürfen, als wären es Brandbomben, die längt gelöscht, nein: unbestellbar, nein: unherstellbar jemals erneut erschienen? Was soll das Abwägen in der Sprache, das Nachdenken, das Ausloten, das Harmonisieren, das Kämpfen um jeden Buchstaben, wenn in Deutschland eine Aggression über uns kommt, die in der Sprache Worte und Sätze hat, die nur Ablehnung und Hass in die Ohren trägt und … damit in die Herzen, die nun erneut verseucht werden von der Macht der Sprache, die extrem ist und Extremes will? Nun, nun gibt es erneut stürmerische Schlagzeilen, Reden und Worte, die alles das sind, wogegen ein junger Mann wie ich mit vielen Bundesgenossen anschrieb, als wir im alten Westen mithalfen, dass der Westen gut bleibe.
Was soll es noch? Was soll der Journalismus, was soll ein Reporter, was soll ein Philosoph wie der Aufklärer Kant, der einer der größten Sprachbeherrscher war und gegen den Dreck anschrieb? Was soll es, wenn vor ein paar Tagen eine rechtsextreme, eine faschistische Partei mit über 90 nun alimentierten Abgeordneten in den Deutschen Bundestag einzieht? Ich, ich allein, … ich schreibe heute von etwas anderem, von einem damals jungen Mann und Muslim namens Atta. Einem Namen, der fast vergessen ist. Kein Name nur, erinnere sich jeder oder mache sich kundig. Ein Massenmörder. Ein Attentäter historischen Ausmaßes. Und aus meiner räumlichen Nähe stammte. Das ist das Thema jetzt. Genau so ist es jetzt. In diesem Moment nachts auf dem Balkon.
Es war am 9. September 2001 so, dass ich unterwegs war. Ich hatte mein Kind bei mir. Jung. Klein. Mein Kind. Wir fuhren in einem unberühmten Wagen durch die Gegend in Hamburg, Eis essen gehen bei Paolo, das war der Plan für sie und mich. Dann Radio um 15:00 Uhr, genau 15:00 Uhr, ein Hamburger Sender. Dann live. Dann furchtbar. Mein Herz schlug schneller, dann rasend. Als ich’s hörte, was dort war, dort geschah, in der Stadt der Städte, in meiner Stadt. Ich fuhr sofort nach Hause, ruhig und kontrolliert, öffnete die Haustüre und ging in das Wohnzimmer, stets das Kind behütet bei mir und schaltete den richtigen TV-Nachrichtensender ein. Dann alles, alles, alles. Alles, was der 9. September 2001 war und wurde und geblieben ist. Und TOTAL geworden ist, … die Zeitenwende im Westen, wie wir ihn kannten. Ich stelle das TV auf stumm, atme tief ein, atme tiefe aus, damit das Kind, das Menschlein es nicht erfährt und nicht hört, was die Reporter live und direkt aus New York City berichten. Was geschieht. In New York geschieht, im südlichen Manhattan, wo ich mich auskenne. Flugzeuge. In die Hochhäuser. Erst das eine. Groß, schlimm genug. Dann in das andere. Unglaublich schlimmer. Brand. Feuer. Rauch. Menschen, die sich in meinem Manhattan vom Hochhaus stürzen, weil es nicht anders geht. Dann Einsturz. Das gibt es nicht. Die Hochhauswelt stürzt in einer Wolke in sich zusammen. Das gibt es nicht. Doch, gleichwohl, kühl geschrieben, das ist nicht meine Story heute. Nein. Das Weltereignis 9/11 ist nicht meine Story. Eine andre, die ist es.
Der BAND I hieß „Meine West End Story, Ich fliege niemals wieder nach New York“ und beinhaltet eine große Reportage über die vorsichtig vorgetragene Antwort auf die Frage hin, ob der Westen, wie wir ihn kannten, an sein mögliches Ende gekommen ist. Vor allem New York, das neue Berlin und das alte Bonn hatte BAND I zum Thema. Nun zeigt BAND II, wie der alte Westen war für Leute wie mich, die sich dort getummelt haben. Es ist eine Textsammlung von nicht allein chronistischem Interesse und vom Verständnis, was im Westen war, damit wir wissen, wo wir sind … und wieder hingekommen sind. Die Textsammlung ist zugleich mit Fakten angereichert, recherchierten Fakten und voll an Bildung, an Wissen, an Erfahrung, an Spannung, an Erleben, an allem, was, wer es liest, bis heute oftmals gültig und gut zu lesen ist. Das ist BAND II: die Sammlung der wichtigsten journalistischen Arbeiten aus meinem Leben als Westerner. Dieser BAND II ist zugleich die Ergänzung zu BAND I, weil es journalistische Arbeiten aus dem Westen hat, als wir nicht wussten, wie gut der Westen zu uns war und aus heutiger Einsicht zu einer guten, einer bestmöglichen Zeit in Abwesenheit von Krieg, Gewalt und Leide wurde. Und dafür sind die Texte, die Artikel, die Sätze und die Wörter gut, die ich als junger Mann und als junger Reporter in der Wirklichkeit fand, wie der Westen war, bevor er möglicherweise andres wurde. In BAND II meines Projektes „Meine West End Story“ lote ich wie in BAND I vorsichtig, umsichtig und zärtlich aus, ob der Westen, wie wir ihn kannten, an sein mögliches Ende gekommen ist. Ich bin kein Reporter mehr, ich bin kein Wissenschaftler mehr und kein Politiker mehr, nein, es ist mir auch egal. Ich bin heute ein Mensch, der einfach schreibt und auf, sehr!, sehr gefährliche Entwicklungen in BAND I hinweist. So ist es in BAND II die Sammlung von journalistischen Texten aus meinem Leben von 1987 bis 2001, was ich in BAND II veröffentliche. So einfach, so schwer.
Wer ein Reporter ist oder ein Wissenschaftler oder ein Politiker, wenn er oder sie gut ist, geht dorthin, wo es schmutzig, wo es echt ist, wo es weh tut. Also, nach 9/11 ging ich hin. Woanders hin. In meine Nachbarschaft, wo ich wohnte. Dort, wo die Attentäter lebten, studierten, wirkten, aßen, tranken, sprachen und von Hamburg-Harburg aus den Westen turmhoch angriffen.
Die Türme stürzen ein, ich rufe in den USA an. Alles gut. Sie leben. Scheinbar gut geht es ihnen, sie leben, sagen sie, sagen sie bis 15:30 Uhr, bevor das Telefonnetz zusammenbricht, weil die ganze Welt anruft, bei denen, die sie dort lieben, in Übersee. Dann rufe ich meine Mutter an, während einer meiner Brüder dort ist, in New York City, ein Arzt. Ich sage der Mutter, fliege nicht dorthin, in wenigen Tagen, wie du es planst, du musst es aufgeben, während der Bruder mal wieder dort ist, wo es knallt. Afghanistan jung, Pakistan, Kambodscha, auch Irland, was auch immer. Meine Mutter hört auf mich, sie verspricht, sie fliegt nicht sogleich hin. Zu ihrem Sohn, der dort ist, wo es jetzt knallte, dass die Welt in einen Taumel geriet, der bis heute anhält und alles das, was der Westen war, in einem weltweiten Hurrikan von oben nach unten und von unten nach oben in eine Welt von Ablehnung und Hass gewendet hat, als gäbe es kaum ein Morgen mehr im Westen.
Dann so weit weg. 9/11 schien weit weg. Ich bin weg. Nicht Manhattan, nicht The Veselka, nicht das East Village, nicht Tom, nicht Maria, nicht die Staten Island Ferry, die dich kostenfrei über den Hudson trägt, nicht das MoMa, nicht David, nicht SJ, heutzutage weit weg von alledem, weit weg, nicht mehr New York City. 9/11 ist so weit weg, ist bereits so viele Jahre her. Scheinbar eine lange Zeit hinter uns. Scheinbar. 9/11 ist nah. Es ist der Tag, an dem die Welt eine andre wurde. Eine schlechtere, eine andre auf jeden Fall. Der Tag, an dem der Westen stürzte, es war das Jahr, in dem ich meine Arbeit als Journalist beendete.
Eine Trauerrede hielten wir kurz danach, nach 9/11. Der gesamtdeutsche, der Parteichef war auf dem Weg zu uns, im Auto, mit Chauffeur, der Müntefering. Er sagte ab, nein, jetzt, an diesem Tag, er ließ mich anrufen, jetzt, nachdem alles geplant war für einen beschaulichen Parteiabend in Hamburg-Harburg, an diesem Abend muss ich in Berlin sein, richtete er aus, er kam nicht weiter als bis auf die Autobahn hinter Berlin. Wir trauerten ohne ihn. Eine Rede. Eine Schweigeminute. In einem bescheidenen Raum in Hamburg-Harburg, an der Bremer Straße. Eine Trauerminute. Eine Schweigeminute. Weil wir ahnten, was geschehen war. Ein Weltereignis, ein Weltbeben. Es war weit weg. Nicht wahr? Nicht wahr? Weit weg, das Ereignis. Das Weltereignis? Weit weg.
Dann war es weit weg. Die Tochter baute zwei Tage später beim Zahnarzt im Warteraum einen Turm aus Plastiksteinen, hoch auf, viele Steine, hoch hinauf, und brachte es dann, dann mit einem Schlag … zum Einstürzen.
Dann, dann, dann geschah das Unglaubliche. Ist so, war so, wird so sein.
Keine wenige ein oder zwei Tage später schaue ich Fernsehen, abends, fast nachts. Normales Programm. Überall die Anschläge, das Verbrechen, der Massenmord, das Word Trade Center getilgt vom festen Inselboden, auf dem New York City gebaut worden ist, das Verteidigungsministerium angegriffen und der Flug und der Absturz, der weitere. Dann auf einem Nachrichtensender eine Ticker-Meldung. Wissen wir noch, was eine Ticker-Meldung ist? Eine Buchstabensalatbotschaft unterhalb des Bildes, die sehr schnell eine Nachricht vermeldet, ohne mehr zu sagen oder zu wissen. Die Attentäter, so sagten es die Buchstaben, auf einmal, spät abends, während ich in Hamburg-Harburg bin seit Jahren, kamen aus … Hamburg-Harburg. Mir wird schwindelig, ich taumele. Salat, Buchstabensalat. In meinem Kopf. Vor meinem Auge. Vor dem TV. Sie tanzen, die Buchstaben der Ticker-Meldung. Aus Harburg. Aus Hamburg-Harburg? Aus meinem Stadtteil? Aus meinem Kiez? Aus meiner Nachbarschaft? Aus meiner Liebe zu meinem Stadtteil? Was geschieht jetzt, denke ich abends, oder? Nein, das kann nicht sein. So schlimm, was die machten, so nah? Das kann nicht sein. 9/11 vor der Tür? Es war nur eine Ticker-Meldung, ein Halbsatz. Nein, nein, das darf nicht sein. Oder?
Ich rief an jenem Abend spät sofort eine Rufnummer an, mit einer -100er Endung, in Harburg, die ich noch nie gewählt hatte, es war 23:30 Uhr, dort darf doch keiner mehr sein, so spät, es gibt Tarifverträge im Journalismus, und wählte eine Rufnummer, die mir nicht klar war, dass sie funktionierte und doch für solche Momente wie geschaffen war. An jenem Abend rief ich den Chefredakteur der lokalen Tageszeitung von Harburg an, der inzwischen untergegangenen Harburger Anzeigen und Nachrichten, kurz HAN, die, das muss gewürdigt werden, eine gute Tageszeitung war, eine von altem Schlage, wie die Rheinische Post, bei der ich 1987 begonnen hatte, Journalist zu sein, bei der Bernrieder, ich rief die an, spät abends, 23:30 Uhr, wer geht dann noch an das Telefon?, warum sollte er noch arbeiten? Der Chefredakteur, ein guter Kerl. Warum sollte er da sein? Dann ging er ran. An das Telefon. Sofort. Es hatte nur kurz geklingelt. Tatsächlich. Um 23:30 Uhr oder so. Der ging ran, ein Journalist, wie ich es war. Ich sagte meinen Namen, er kurz seinen, er kannte mich. Ich war aufgeregt, fertig, er war cool. Er sagte nur:
… „Ja, es stimmt“, sagte der Chefredakteur der Lokalzeitung, der Zeitung aus der Nachbarschaft.… die Meldung stimmt, lernte ich.
… die Attentäter von 9/11 kamen aus der Marienstraße in Hamburg-Harburg, …
… kamen aus meiner Ecke.
Ja, es stimmte, die Attentäter von 9/11 waren aus Hamburg-Harburg. Atta und die andren. Es war so. Die Menschenfeinde, die Massenmörder von 9/11 waren aus meinem Kiez aufgebrochen, nach guten Jahren in Deutschland, in Hamburg, in Harburg, diese Männer hatten mit uns gelebt, hatten alles gehabt, was ein gutes Leben ausmacht. Ein Dach über dem Kopf, gutes Essen, Getränke, Freunde, Bekannte, Nachbarn. Ein junger Junge, dem Atta über die Haare strich, im Treppenhaus, weil er ihn wohl mochte, war später einer meiner jungen Harburger Freunde geworden, auch das. Der Professor, bei dem Atta studierte, war eine unserer vielen Säulen im Stadtteil. Und so weiter, und so weiter. Atta kam aus meiner Heimat.
Sie lebten um die Ecke, brachen auf in die USA und hatten 9/11 gemacht, als gäbe es das Morgen für sie nicht, als sie den Westen und ihre Menschen killten. Sie waren Harburger, Nachbarn, fleißige Leute wie wir, soweit ich wusste, unauffällig. Und dann waren sie aufgebrochen, alles zu zerstören, was sie gehabt haben. Sie gingen als Mörder in die USA, in meine ganze große Heimat, den Westen. Gingen dorthin, wo sie alles zerstören wollten, was sie doch schön in meinem Kiez und in meiner Nachbarschaft hatten, schön, gut, schön.
Warum es diesen BAND II zu „Meine West End Story, Ich fliege niemals wieder nach New York“ gibt? Weil zur vorsichtigen Antwort auf die Frage in BAND I, ob der Westen, wie wir ihn kannten, an sein mögliches Ende gekommen ist, die Freiheit und auch die Schönheit der Worte gehören, wie es so war, im Westen, bevor der Westen an sein mögliches Ende gekommen war. Als junge Menschen wie ich im Frieden die Presse- und Meinungsfreiheit und den Glauben an den Sinn der aufklärerischen Worte erlebten und die Abwesenheit von Krieg, Gewalt und Leid erleben durften, dann, in jener Epoche, sind die vielen Artikel aus BAND II entstanden. Sie zeigen, was war in einer Epoche von Leid, ja, von Traurigkeit und von Gewalt, von Schlechtem, gleichwohl war es 1987 bis 2001 so, als ich noch Reporter war, dass kein Staat und kein Sicherheitsorgan damals dort gewesen wäre, der uns Menschen in Unfreiheit in (West-)Deutschland gehalten hätte, uns, oder in eine solche geführt hatte. Daher: Ja, es war eine gute Zeit, aus heutiger Sicht, als ich die Artikel recherchierte und schrieb, die in BAND II nun die Welten beschreiben, um die es ging, als der Westen einem jungen Mann die Feder reichte, damit er schrieb, damit er bliebe.
Dann, dann, als ich die Ticker-Meldung im TV in meinem Wohnzimmer las, wusste ich, ich muss dorthin. Nach einer kurzen Nacht brach ich dorthin auf. Mit FW, den ich fragte, ob er mich begleitet. Am nächsten Morgen fuhr ich an die Marienstraße in Hamburg-Harburg, es dauerte keine fünf Minuten. In meinen Kiez, in meine Nachbarschaft. Dort war alles, was wahr geworden war. Die New York Times war schon da gewesen, wohl bereits in der Nacht, die besten und schnellsten im Journalismus, die es gibt, die Nachbarn waren da, auf der Straße, die Polizei am Haus. Es war wahr. Der 9/11, die Zeitenwende, die bis heute den Westen verändert hat, wie wir ihn kannten, war von einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Harburg ausgegangen, von meinem Hinterhof ausgegangen, der keine Viertelstunde Fußweg dorthin für mich bedeutete.
Und warum BAND II? Weil ich die journalistischen Arbeiten von 1987 bis 2001 an meine Freunde und Leser verschenke. Es sind gute Artikel darunter. Ist so. Sie bieten insgesamt eine Tiefe und Breite an Themen und Menschen, die insgesamt den Westen beschreiben, wie er gut war, auch wenn dort oftmals traurige Momente und Tage und Monate darin beschrieben sind. Dass sie erscheinen, hat gleichwohl auch den Aspekt, dass es der gute Westen war, der sich auch gut um die Themen und Menschen kümmern wollte … und gekümmert hat. Und dass ich Reporter in einer offenen Gesellschaft sein durfte, ohne Anklage, ohne Verhaftung, ohne Hass, ohne Verleumdung, ohne Ablehnung, ohne Repression und vor allem ohne jedwede Zensur durch Redaktionen und Chefredakteure, wie es so in vielen von 200 Ländern nicht war und nicht ist und wohl nicht sein wird, dass ich also ein tatsächlich frei arbeitender Reporter und Geist sein durfte, das hat vor allem aus heutiger Sicht einen besonderen, einen besonders hohen Wert für mich, wenn ich beobachte, wie häufig Reporter und Journalisten auch in unserer Gesellschaft heutzutage in Konflikten vor allem in den sozialen Medien und mit extremen Gedanken und Personen geraten. Ich danke so jetzt in diesem Moment allen den Westernern, die mich zuerst zum Reporter gemacht hatten und dann mich als Reporter auch zu ihrem Vorteil als ihr Stellvertreter auf der Suche nach Wahrhaftigkeit erlebten. Die haben versucht und es geschafft, Frieden insgesamt zu organisieren, die damals dort waren.
Die Story, wie Atta und alle andren, die danach kamen, nicht mehr von mir in journalistische Arbeiten gepackt wurden, hingehen, neugierig sein, schauen, hören, lernen …
… ist eine andre Story, die Kollegen recherchiert und aufgeschrieben haben. Mein Hingehen allüberall, beginnend in der Oberstufe des Gymnasiums, endend als PR-Berater und -Unternehmer in 2001 im guten Hamburg und meine brennende Neugierde auf alles und jeden als Reporter hörte auf, tatsächlich in 2001, als ich in Israel war, in Jerusalem, in seiner Altstadt, an der Klagemauer, mit Johannes im Restaurant, in dem Musik aufspielt, Fröhlichkeit im Raum war, gutes Essen und eine gute Gemeinschaft, mit andren in den Hotels unterwegs war und den Höfen der Stadt, in der Wärme der Stadt der Ewigkeit, umgeben von weißem Stein, den sie Jerusalemstein nennen, umgeben von gehauenen Steinen aus dreitausend Jahren, Pinienbäume um uns herum, Zitronenbäume um uns herum, in der Stadt, in der die gut waren zu mir und ich gut zu denen war, in der Stadt bei den Menschen, die ich mochte, in der Stadt, die die bewegendste der Weltgeschichte bis heute an, um und in sich hat, als ich 2001 in Tel Aviv war, beim wunderbaren Roman Frister war, einem Überlebenden von Auschwitz, der die Zigarre rauchte, wie ich auch später Zigarren rauchte, der freundlich war, bewandert war, ein guter Mann war, als ich in dem Land war und meine letzten Reportagen mitbrachte aus dem Land Israel, das wir doch unterstützen mussten, ewiglich, wir, wir Deutsche, die sie alle davor auslöschten und auslöschen wollten, unsere Großeltern und Urgroßeltern, so kann ich lediglich nüchtern sagen, dass ich als Reporter meine Arbeit nach dem Israel-Einsatz in 2001 beendete und mich entschied, die Seiten zu wechseln und Journalismus mit Unternehmertum einzutauschen.
Atta und weitere Attentäter von 9/11 kamen aus meiner Nachbarschaft. Vielleicht war es nur ein mathematischer, ein in der Physik zu findender Zufall. Denn in 2001 hörte ich auf, Reporter zu sein. Es gibt keinen kantischen Zusammenhang dazwischen, glaube ich, nein, das eine kosmische Große hatte nichts mit dem Kleinsten zu tun, das ich war, dass ich aufhörte, als die Zerstörer des Westens aus meiner Ecke aufbrachen, den Westen nachhaltig zu beschweren und zu beschädigen, das hatte selbstredend nicht mit dem Ende meiner Arbeit als Journalist zu tun, und ich hasse es, markttreibende Legendenbildungen zu schaffen, wie es andere gerne tun … 2001 war ein gutes Jahr für mich, dass ich aufhörte, einer anstrengenden Berufung, dem Journalismus nachzugehen, und einen weniger anstrengenden Beruf ergriff, es hatte nicht mit der Weltlage und Atta zu tun, soweit ich es in meiner inneren Wahrnehmung von der Welt weiß. Soweit ich weiß, ist es ein Zufall der Physik, dass ich 1987 begann, Reporter zu sein, und 2001 aufhörte, Reporter zu sein. Es gibt keinen Zusammenhang, weder im Herzen, in der Seele, weder äußerlich, finanziell, weder wissenschaftlich, noch psychosozial, noch anders. Im Jahr 2001 hörte ich gleichwohl auf, Reporter zu sein, als meine Nachbarn begannen, den Westen und seine Säulen zum Einstürzen zu bringen, für den ich stets hatte schreiben wollen.
… und doch hätte ich nicht gesollt, über Atta schreiben? Eine Story machen aus ihm? Wie über die andren, die ich in Worte und Sätze zuvor gepackt hatte? Eine weitere Reportage? Eine Reportage wie die vom Junkie aus Moers? Eine Reportage wie die von den Nazis in Hoyerswerda? Einen Bericht wie den von der Sitzung des Gemeinderates von Moers? Ein Interview wie die mit einem weiteren Superstar? Eine weitere Nachricht bauen, wie ich es gelernt hatte, aus den Polizeimeldungen bauen? Einen weiteren Versuch unternehmen, zuzuhören, denen zu glauben, das Gesagte überprüfen und das für mündige Bürger aufschreiben? Eine weitere Tätigkeit, die mir wenig Wohlstand einbringt und dafür viel Sinn, gegen die Fraktion der anderen anzuschreiben, die über das bis heute schreiben, bis heute das senden, was mich im Grunde weder interessiert noch was ich vor meine Augen gebracht und in meine Ohren gesendet haben will?
Nein, keine Reportage mehr, keine Story mehr, kein Journalismus mehr.
Zu viele extreme Töne, zu extreme Melodien. Die mich allabendlich im TV und täglich online erreichen, als wären die Medien nicht schuld daran, auch schuld daran, dass es schlechter und schlechter seit langem geworden ist, wie jeder weiß, der faktengetrieben erkennt, der sich auskennt.
Keine Story mehr, meine Freundin, mein Freund. So schreibe ich in diesem Jahr, in 2017, als die Extremen in den Deutschen Bundestag einziehen, wie es nie zuvor seit der Gründungsgeschichte seit 1949 in der Bundesrepublik gewesen war. Ich schreibe in 2017, als erkennbar wird, dass nicht wenige Deutsche wie kleine Panzer durch die Gemeinden, Städte und Regionen ziehen und ihre Rohre ausrichten auf Westerner wie mich und kaum mehr die Kultur vermitteln, die uns so lange in Deutschland zu einem guten Leben für uns und für unsere Nachbarn machten. Keine Story mehr. Ich war Journalist und bin keiner mehr. Weder jetzt noch später. Schaue, gucke, lerne, wie du möchtest. Es ist so, dass ich 2001 aufhörte, Reporter für Medien zu sein, und danach mein Leben begann, ein gutes, etwas Neues. Ich war raus. Ich bin raus. Ich schreibe, wohl wahr, ich schreibe gleichwohl, ohne einem Medium oder einem Redakteur zu folgen.
Wäre ich damals noch Reporter gewesen, hätte ich die Marienstraße von innen und außen, von oben und unten und um die Ecke kennengelernt und Atta und die, die ihm in meiner Nachbarschaft nah waren. So war es egal geworden, als ich in den Kiosk an der Marienstraße eintrat und die Dame fragte, ob es stimmt. Und die Dame sagte, ja, es stimmt, es sind alle da bereits. Die New York Times war bereits da. In meiner Nachbarschaft. Im September 2001 besuchte uns die New York Times. Gut. Nein, nicht gut, schlecht. Ich hätte die New York Times auf keinen Fall in meiner Nähe erleben wollen. Weil die Reporter der NYT dort sind, wo es sehr, sehr schwierig geworden ist. Sollen sie machen. Sollen sie alle machen, die Kollegen. Die Reporter von denen und alle andren. Sie waren ja zu Recht nach Hamburg-Harburg gekommen. Bei allem Wissen, was ein guter angelsächsischer Journalismus sein soll, war es ja richtig, dass sie in meinen Hinterhof kamen. Meine Kollegen aus der Welt kamen an dieses unbedeutende Fleckchen Erde in Hamburg-Harburg. Und ich fuhr nach Hause, das weiß ich noch, nachdem ich an der Marienstraße war, fühlte ich mich leer als Reporter und voll als Bürger, und war kein Reporter mehr, der das aufschrieb, wie Weltgeschichte in meiner Nachbarschaft geschrieben wurde.
… ich war raus. Ich atme tief, ich atme tief aus. Ich bin raus … aus dem Journalismus, der mehr und mehr in meiner Lernkurve zum Geschäft und Beruf und wenig mehr zu Berufung und zu Sinn wurde.
Was hat es gebracht? Reporter zu sein? Den Ideen der Aufklärung zu folgen? Der Idee, das ein Faktum ein Faktum ist und eine Atmosphäre lediglich eine Atmosphäre? Das Worte und Sätze uns alle zu besseren Menschen machen, wenn sie wahrhaftig recherchiert und geschrieben sind? Was es hat verhindert, was hat es gefördert, was hat es gebracht? Was hat es gebracht, wenn im Deutschen Bundestag über 90 Abgeordnete seit Sonntagabend ihren Platz einnehmen, die allesamt gegen alles sich stellen, was eine offene Gesellschaft und die Werte der Humanitas ausmacht, und am Ende das Leben von Freigeistern, wie meine Freunde und ich es sind, bedrohen? Was hat es gebracht, wenn derzeit unter den 200 Staaten dieser Welt über 40 in schlimmste innere und äußere Kriege blutig verwickelt sind? Ist der Anspruch hoch? Zu hoch? Nein, das ist nicht wahr. Jedes Leben ist ein einziges, wohl wahr. Dass die Menschen in den Staaten gleichwohl stets und stets erneut das Schlechte und Schlimme leben, während es davor gut und schön war, erscheint als der Kreislauf der Menschen, den zu durchbrechen sie lediglich in Phasen, Jahren, Dekaden und Epochen schaffen, und eben nicht Dauerhaftigkeit von Frieden herstellen und schon gar nicht Ewigkeit von Frieden. Was es gebracht hat? Viel, sicherlich, bei vielen tatsächlich viel und in belegbarer Bedeutung. Und insgesamt gleichwohl? Wenig, wer guckt, schaut, lernt. Immerhin, mein Leben als Reporter …
… es hat Texte hervorgebracht, die nun in BAND II vorliegen. Das hat es gebracht. Mehr nicht. Viel mehr nicht. Das ging und geht, und mehr hat es nicht geschafft.
BAND II von „Meine West End Story“ erklärt sich von selbst, weil die Artikel für sich stehen, wer sehen und lesen möchte. Daher nur kurz, dieses kurze Vorwort als Aufschlag, als ob der Tennisspieler einen neuen Satz beginnt. Alles andre, füge ich in meinem Leben hinzu, erzählen wir uns, Freunde und Leser, beim Kaffee, Tee, bei Essen, bei Lachen, beim Traurigsein, beim Quatsch, den wir machen werden, bei Gemeinschaft, zu zweit oder zu vielen, unter uns, unter uns, die Westerner sind und Westerner geblieben sind, oder ich erzähle es vielleicht in einem andren, neuen Buch.
So geht es weiter. Nur so geht es weiter. Mit dem Glauben an das Wort, den Satz … und an gute Nachbarschaft. In Manhattan, in Harburg, in Moers, in Dresden, in Tübingen, wo auch immer Menschen leben, das muss ich jetzt am Ende schreiben, die … die …
… lieben.
Auch gute Nachbarschaft hat nicht verhindert, dass ein Nachbar, Atta, zum Massenmörder wurde und der Westen, wie wir ihn kannten und wie er in BAND II beschrieben ist, keine große Geschichte mehr ist. Es bleibt gleichwohl lediglich die einzige gute Art am Ende übrig, Frieden zu schaffen, gute Nachbarschaft zu pflegen, den Nachbar zu grüßen, und dass der Glaube an das Wort und an den Satz bleibt, dass … dass am Ende eines Tages und vom Anfang eines Tages bis zu seinem Ende Liebe alles ist, was war, was ist und was kommt, wer verstehen möchte, wie das Leben ist, wenn es im Westen denn ein Leben bleiben soll.
BAND II veröffentlicht meine journalistischen Veröffentlichungen. Sie sind in fast allen deutschen renommierten Medien erschienen. Nicht mehr, nicht weniger. Es bietet das, was ich leben und schreiben durfte, ohne dass ich denke, ich wäre ein besonders, besonders großer Reporter gewesen, wie die andren, die ich von Anfang an oder in der Mitte und bis heute bewundert habe und teilweise bis über den Morgen hinaus achte. Meine Arbeiten handeln von vielen Orten, im Inland und im Ausland, von vielen Menschen, von vielen Themen. Es handelt am Ende eben von genau dem … der Haltung einer zuerst bedingungslosen Liebe zu Menschen, die ich treffen durfte, weil Liebe am Ende von allem der Anfang und nicht das Ende ist von allem, was wir Menschen haben und ich im Gegenzug von nicht wenigen Liebe erfahren durfte. So danke ich allen Beteiligten in allen Jahrzehnten und wünsche mir, dass meine Leser mit mir in diesem Buch lesen, leben …
… und voller Liebe bleiben und …
… Liebe verschenken, weil nur Liebe …
… uns retten wird, stets neu retten wird.
Ich trete ab. Der Vorhang fiel als Reporter für mich in 2001, als in einer Zufallsrechnung der Physik in meiner Nachbarschaft …
… es nicht nur liebevolle Nachbarn gab.
(Ich hatte als Kind und Jugendlicher erwartet, dass alle Liebe in sich tragen, als ich jung war und leer war und unbefangen war, weil ich es nicht anders gelernt hatte. Das war eine Täuschung. Es ist keine Enttäuschung, weil es bis heute genug derer sind, die Liebe in sich tragen, wenn ich an diese denke und mit diesen gute Begegnungen pflegen darf.)
Dank Irmgard Bernrieder, meiner ersten Chancengeberin im Journalismus, war ich Reporter geworden.
Dank vieler neuer Chancen gab ich den Beruf des Reporters auf.
Das war’s. 2001 war ich abgetreten.
Und mache seitdem andre Dinge.
… auch gute andre Dinge.
Ist so.
(03:16 Uhr, im September 2017, Santa Ponsa, Spanien, jetzt ist Schlafenszeit.)
Gesellschaft
Jahr: 1998
Folgen von Verbrechen von rechtsaußen und ihre scheiternde Aufarbeitung
Sehr viele Versprechen
Der Solinger Mehmet über seine Stadt fünf Jahre nach dem Brandanschlag auf die Familie G.
In der Nacht, als die fünf Mädchen und Frauen im Einfamilienhaus an der Unteren Wernerstraße in Solingen verbrannten, schläft Mehmet. Er hat seine Abendschicht als Taxifahrer beendet und fällt vor Müdigkeit um. Vor fünf Jahren, in der Nacht zum 29. Mai 1993, schläft ganz Solingen. Niemand ahnt, dass nach dieser Nacht die Stadt im Bergischen Land nicht mehr so sein wird, wie sie war. Bis heute.
Am nächsten Morgen hören Mehmet und seine Frau in der Nachrichtensendung des Westdeutschen Rundfunks von dem Anschlag. Mehmet geht sofort los. Er ist damals Vorsitzender des türkischen Volksvereins, kennt die Stadt, in die er als 20-Jähriger zu seinen Eltern nachzog, in- und auswendig, und hat seit Hoyerswerda, seit Rostock, seit Mölln geahnt, dass ein Anschlag von Rechtsextremen überall möglich wäre. Nun ist es in Solingen passiert. Der Taxifahrer bleibt eine Stunde an dem Haus, das wie zerbombt aussieht und ausgebrannt ist. Hunderte von Menschen sind da: „Sie hatten verzweifelte, versteinerte Gesichter“, erinnert sich Mehmet, „alle, die Menschen und die Stadt, standen unter Schock.“ Aus großen, freundlichen Augen schaut Mehmet heute, fünf Jahre später, aus den Fenstern seines Café-Restaurants „Piya“ auf die Straße. Der 39-Jährige betreibt es seit einem Jahr. Es ist Nachmittag. Deutsche und Türken gehen an dem Café an der Konrad- Adenauer-Allee in der Solinger Nordstadt vorbei. Mehmet sieht sie nicht. Er hat wieder das Haus der Familie G. vor Augen und erzählt von einem Gedicht. Er hat es nach dem Anschlag geschrieben, auf deutsch, aus Schmerz, um irgendetwas zu tun. „Aber ich bin kein Dichter“, sagt er und nippt an seinem Teeglas, in das er, wie alle anderen, immer zwei Stücke Zucker hineingibt, bis es randvoll ist. Obwohl das Glas heiß ist, behält er es in der Hand. Dietmar, Volker und Eva, Studenten, Freunde von Mehmet, bringen eine Zeitung ins Café, in der das Gedicht abgedruckt ist. Es ist nicht lang:
Ein Kind flog im Traum in das
unendliche Blau.
Ein Kind flog im Traum über grüne Wiesen.
Ein Feuer flog auf seine Flügel.
Es verbrannte, das Kind.
Es brannte. Es war kein Traum.
Was verbrannte, war die Hoffnung.
Was verbrannte, waren unsere Kinder, unsere Frauen.
Jetzt brennt es in uns.
Das Haus, in dem die Familie G. gelebt hat, steht nicht mehr. Es wurde abgerissen. Jetzt wächst Gras auf dem Grundstück. Fünf Kastanien sollen an die fünf Todesopfer des Anschlags erinnern. Familie G. konnte aus Spendenmitteln ein neues, dreigeschossiges Haus bauen, die Stadt Solingen gab ihnen für das Grundstück in der Unteren Wernerstraße ein anderes. Das Haus der G.s ist heute eine Festung mit Zaun, Gitter und Videoüberwachung. An die Untere Wernerstraße geht Mehmet kaum noch. Er will den Ort nicht mehr sehen. Auch zur Mahnwache heute in der Innenstadt von Solingen und zum stillen Gedenken am Bürgermahnmal gegen Nazismus an der Mildred-Scheel-Schule wird Mehmet nicht gehen. „Ich habe 20 Jahre lang Politik gemacht“, sagt er. „Ich habe Reden gehalten, auf Versammlungen gesprochen. Manche hielten sich die Ohren zu, andere warteten immer darauf, dass ich was sage. Aber ich bin kein Politiker. Ich habe nichts mehr zu sagen.“
Mehmet ist schweigsam geworden und mit ihm die Stadt. Vor zwei Jahren legte er den Vorsitz des Volksvereins, einer Art türkischem Heimatverein, nieder. Vor einem Jahr eröffnete er das Café. Und will es schon bald wieder schließen und noch mal neu anfangen. „Ich bin nicht zufrieden, ich lebe nicht. Es muss etwas in mir passieren.“ Waren im Jahr nach dem Anschlag Hunderte von Bürgerinnen und Bürger in Initiativen engagiert, gab es mit dem „Solinger Appell“, mit „SOS Rassismus“ und mit der Gruppe „Öffentlichkeit gegen Gewalt“ geradezu eine Bewegung für Mitmenschlichkeit in Solingen, so ist aus ihr erst ein Zusammenschluss von Gruppen, dann ein loses Bündnis, schließlich das Engagement von einzelnen geworden. Wie auch anders, Trauer verzehrt. „Es hat sich nichts Grundlegendes verändert“, sagt Mehmet auf einem Abendspaziergang durch die Innenstadt, die eine einzige Baustelle ist. „Viele haben viel versprochen. Das Wahlrecht für Ausländer. Doppelte Staatsbürgerschaft. Ein Bekenntnis zum Einwanderungsland. Das wenige, was getan wurde, hätte besser nicht getan werden sollen.“ Er findet es nicht ausreichend und lächerlich, was die Deutschen in Solingen machten.
Damit meint der Kurde, der im Osten der Türkei aufwuchs, die Aktivitäten der Stadt. Die SPD-geführte Stadtregierung steckte nach dem Anschlag viel Geld in die Jugendpolitik, sanierte Schulgebäude und finanzierte eine Stelle bei „SOS Rassismus“. Die Politiker sind stolz, dass sie trotz leerer Kassen ein interkulturelles Jugendzentrum weiter finanzieren, das durch eine Millionenspende der Bertelsmann-Stiftung eingerichtet wurde. Alle, von der CDU bis zu Bündnis 90/Die Grünen, sagen, dass einiges getan wurde. Während der CDU-Fraktionsgeschäftsführer das Zusammenleben „unproblematisch“ findet und, ganz Partei-Wahlkampflinie, vor „braunen wie rotem Terror“ warnt, weiß der Fraktionssprecher von Bündnis 90/ Die Grünen: „Genug kann man nie tun. Grundlegendes kann nur Bonn tun.“
Das Schockierende am Solinger Anschlag war die Erkenntnis, dass er überall hätte passieren können. Die vier Täter waren Söhne aus Solinger Familien. Keine Kadernazis hatten den Brandsatz geworfen, sondern Jugendliche, die kaum wussten, was sie taten. Das passt vielen Solingern nicht, weder konservativen noch linken. Die einen wollen nicht die Herkunft der Täter sehen, die anderen können das Banale der Tat nicht ertragen. Die Gerüchte um den Prozess sind bis heute nicht verstummt. Viele glauben, drei der Täter seien unschuldig. Allein Christian legte ein – später widerrufenes – Geständnis ab.
„Nach dem Anschlag“, meint Mehmet, „hatten viele Deutsche Schuldgefühle. Bekannte kamen auf mich zu und entschuldigten sich, selbst wenn ich vorher Ärger mit ihnen hatte, weil ich mit ihren Frauen geflirtet hatte. Das war merkwürdig. Später schlugen die Schuldgefühle in Aggression um. Auf einmal wollten sie mich nicht mehr sehen.“ Er macht eine Pause: „Dabei will ich nicht als Türke angesehen werden, sondern als der, der ich bin, Mehmet. Dieses Menschenrecht fordere ich ein.“
Mehmet lebt immer kurz unter null. Zwei Jahre hat er an der Kölner Universität Wirtschaft studiert, musste aber wegen Geldmangels abbrechen. Mit diversen Jobs hat er seine vierköpfige Familie ernährt. Er ist ein melancholischer Mann, der ernst dreinschaut. Doch wenn er einmal lacht, steckt das Lachen an. Als Sohn armer Eltern hatte er beruflich so gut wie keine Chance in Solingen, wo sein Vater jahrzehntelang in einer Eisenwarenfabrik an einer Maschine stand. Er hat sich anders Respekt erworben, taucht überall in Solingen auf, redet und feiert mit, sei es in einer Alternativkneipe oder in den feineren Restaurants in Solingen-Grefrath.
Mehmets Bruder dagegen gehört zu einer anderen Generation. Er hat weniger seine Ausbildung als Fußball und Mädchen im Sinn. Er geht regelmäßig ins „Getaway“, die einzige brauchbare Diskothek in Solingen. Der Geschäftsführer, kein Ausländerfeind, hatte schon Schwierigkeiten mit Skins und Dealern. Mit dem Bruder von Mehmet nie. Er ist immerhin der Bruder desjenigen, der den Laden einmal vor dem Überfall von Antifa-Aktivisten bewahrt hat. Als Symbol für die schreckliche Normalisierung in der Stadt kann gelten, dass am vergangenen Montag der Bruder und drei seiner Freunde zum ersten Mal nicht in das „Getaway“ kamen. Der Türsteher schrie sie am Eingang an: „Ihr kriegt lebenslänglich keinen Eintritt mehr.“ Einen Anlass für das Verbot hatten die vier nicht gegeben. Sie passten dem Türsteher einfach nicht. „Warum?“ fragte Mehmet seinen Bruder einen Tag später. „Weil wir anders aussehen“, antwortet der Bruder, „weil sie vergessen haben, was du für sie getan hast.“ Er meint Mehmets Intervention bei den Antifa-Aktivisten. Aber vielleicht meint er auch, weil die Solinger vergessen haben, was heute vor fünf Jahren passiert ist.
Good to know:Die Stadt Solingen ist in Erinnerungen gespalten. Seit dem 29. Mai 1993 steht sie für Fremdenhass. Bei einem Brandanschlag wurden fünf Menschen türkischer Abstammung getötet. Der rassistische Anschlag markiert bis heute einen Wendepunkt im Zusammenleben der Menschen in Solingen, und er spaltet bis heute die Gemüter. Dort, wo bis 1993 die Familie Genç gewohnt hat, wachsen heute fünf Kastanien – eine für jedes Opfer.
Jahr: 1995
Wenn Wirtschaft nicht aus eigener Kraft stark ist
Die Schweineohren sind ab
Niedergang der Industrie in Westberlin: Der Wegfall der Berlinförderung hat großen Anteil am Verschwinden von Betrieben
Es riecht nach frischem Kuchen. Doch das ist gleichgültig. Nach zehn Jahren Arbeit muss es dem Teigmischer einfach stinken. Heiner Meier, 51, im weißen T-Shirt, blickt mit müden Augen in die beiden 350-Kilogramm-Kessel und rührt mit Hilfe eines Knetarms den Teig an. Immerhin arbeitet er in der Tiefkühltorten-Produktion und hat noch einen Job bei der Heinersdorfer Backwaren GmbH, die im Westteil der Stadt schon die Geschäfte schloss. Weil Subventionen für Berlin-West wegfielen, ging die Firma nach Ostberlin, das noch Fördergelder erhält.
Seit dem Fall der Mauer sind rund 50.000 Menschen im Westteil Berlins arbeitslos geworden und schwer vermittelbar, da sie einfachste Arbeiten wie das Teigmischen oder das Verpacken ausgeführt haben. Zum erheblichen Teil wurden sie arbeitslos, weil die Wirtschaftsförderung für Westberlin ausgelaufen ist. Mit den fetten Jahre der Berlinförderung war es ab 1995 vorbei. Eine Kürzung aus dem Bonner Steuersäckel, die Berlin im Nerv traf: Wegfall der Arbeitnehmerzulage (zehn Milliarden Mark jährlich), Streichung der Berlinförderung (jährlich 15 Milliarden), Streichung der Zuschüsse für den Berliner Haushalt (30 Milliarden seit 1989), Wegfall der Subventionen bei Post, Fernmeldeverkehr, Flugverkehr und etwa bei Umzugshilfen (seit 1989 rund 70 Milliarden). So addiert der SPD-Politiker Ditmar Staffelt die Berliner Opfer auf insgesamt 120 Milliarden Mark und wirft der Bundesregierung vor, die Hauptstadt kaputtzusparen.
Noch 1990 hatte Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) dem damaligen Regierenden Bürgermeister von Berlin, Walter Momper, zugesagt, die Berlinförderung erst in sieben Jahren nach und nach abzubauen. Doch davon wollte der Bonner Finanzminister bald nichts mehr wissen. Die Bonner strichen die Gelder in vier Jahren zusammen. Auch saß in der Großen Berliner Koalition mit Finanzsenator Elmar Pieroth (CDU) nicht der Verhandlungspartner, der einen langsamen Abbau der Subventionen hätte durchsetzen können. Sprach er doch davon, dass Berlin lernen müsse, auf eigenen Beinen zu stehen. Nun wankt Berlin. Die Folge: Die „Lila Pause“ von Milka ist in Berlin geschmolzen – das Suchard-Werk dicht und 480 Arbeitsplätze gingen verloren. Der Kakao- und Kaffee-Hersteller Van Houten entließ 300 Arbeiter. Der Zigarettenproduzent Rothmann wickelt gerade sein Werk ab – 500 Arbeiter verloren ihren Job. Die Kaffeeröstereien sowie die Zigaretten- und Lebensmittelindustrie sind besonders kapitalintensiv und haben viel über Abschreibungen verdient. Diese Branchen trifft der Abbau der früheren Subventionen besonders hart.
Die Zigarettenproduzenten Reynolds und Philip Morris haben im Unternehmen Produktionspaletten umgeschichtet und daher nicht geschlossen – sie sind große Unternehmen, welche die fehlenden Gelder auffangen konnten, indem sie interne Strukturen veränderten. Früher war die Textilindustrie mit 4.000 Beschäftigten in Westberlin stark vertreten. Doch sie hing am Tropf der Berlinförderung. Nun arbeiten nur noch 1.200 Menschen in dieser Branche. „Zwei Drittel der Textilindustrie sind kaputt“, wie Wolfgang Schmidt, Geschäftsführer des Berliner Textilverbandes, sagt. Sie alle labten sich an den Subventionen, die Berlin im Insel-Kampf im „Roten Meer“ erhielt. Wege, an die Gelder heranzukommen, gab es viele: So wurden Schweinehälften in der Stadt „veredelt“, indem ihnen die Ohren abgeschnitten und Qualitätsstempel aufgedrückt wurden. Angeliefert aus dem Westen, wurden sie dort auch verkauft. Dafür erhielten Unternehmer die sogenannten Hersteller- und Abnehmerpräferenzen, einen Steuernachlass, weil sie Produkte in Berlin bearbeiteten und in den Westen verkauften. Einen gesunden Markt schaffte die Berlinförderung somit nicht. Aber sie half den Menschen in der Stadt, zu überleben. 1950 wurde das Gesetz zur Förderung der Wirtschaft von Berlin (West) erlassen. Es hatte die Aufgabe, den Standortnachteil auszugleichen, indem es Lieferungen aus Berlin von der Umsatzsteuer befreite. Weitere Gesetze zur Berlinförderung 1964 und 1978 bewahrten Berlin vor dem wirtschaftlichen Kollaps. Nun ist Berlin eine normale Stadt geworden, sagen sich die Bonner, die die Förderung schnellen Schrittes abbauten, denn die Berliner bräuchten die Gelder nicht mehr für den ideologischen Überlebenskampf.
Nun sollen Hightech-Unternehmen in Berlin angesiedelt werden. Doch Hightech ist ein Scheinbegriff aus dem politischen Raum, der nicht hält, was er verspricht. Die Herstellung von Kaffeekannen in automatisierten Werken beispielsweise gilt schon als Hightech, und Arbeitsplätze bringen solche „modernen Industriebereiche“ kaum. Das Hoffnungsinstitut „Wirtschaftsförderung GmbH“ gibt außerdem zu, dass es schwerer sei, produzierende Industrien in Berlin anzusiedeln als Dienstleistungsunternehmen. Für die vielen ausländischen Arbeitnehmer kommen die Dienstleistungsbetriebe jedoch zu spät. Zudem verlangen diese Firmen ein völlig anderes Arbeitsprofil, als die Arbeiter ausfüllen können.
Berliner Politiker forderten den langsamen Abbau der Berlinförderung. Alle klagen über den „schnellen Wegfall der Subventionen“ für Westberlin. Nun fordern die Politiker sie wieder. Aus Verzweiflung haben Politiker, Unternehmer und Gewerkschafter in einem Papier die „Einbeziehung der westlichen Stadtbezirke Berlins in die Fördermaßnahmen des Bundes und der Europäischen Union, die für die neuen Länder gelten“, verlangt.
Dabei „fressen“ die Gewerkschafter sogar Fliegen und unterstützen die Forderung nach Investitionszulagen – Gelder, von denen die Gewerkschaften nicht glauben zu wissen, dass sie Arbeitsplätze schaffen. Daran lässt sich die „prekäre Situation“ Berlins (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) ermessen. Das Merkwürdige am Dahinsiechen der Wirtschaft, so die Einschätzung der Industrie- und Handelskammer, sei, dass Berlin „einer der besten Standorte Deutschlands ist“. Vier Millionen Menschen kauften hier ein. Das bedeute eine enorme, wenn auch stagnierende Kaufkraft. Westberlin verfüge nicht über genügend qualifizierte Industriearbeiter, in Ostberlin gebe es dagegen viele. Dennoch verkleinern Unternehmer ihre Betriebe, auch um an Fördergelder für kleine Einheiten zu kommen. Sie lagern Produktionsstätten aus und gehen in sogenannte Billiglohnländer, wo eine Arbeitsminute 10 Pfennig kostet.
Doch, zynischer Trost für Menschen ohne Arbeit, die weggefallenen Subventionen treffen auch die Reichen. Bei einem Jahreseinkommen von 360.000 Mark wurde ein Manager mit 26.000 Mark subventioniert, ein Facharbeiter hingegen mit einem Jahressalär von 50.000 Mark bekam nur 2.500 Mark. Die Westberliner, die über Einnahmen von mehr als 250.000 Mark verfügen, und von ihnen gibt es etwa fünftausend, kriegen auch nichts mehr vom Förderkuchen ab.
Good to know: