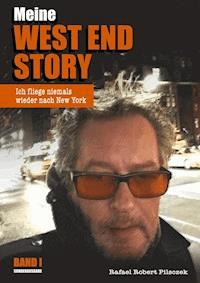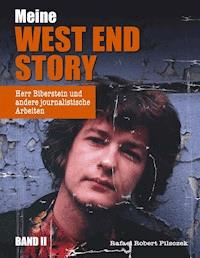Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Friedenskinder" beschreibt vor dem Hintergrund von 70 Jahren Frieden in den (west-)deutschen Generationen die stete Gefährdung der Abwesenheit von Krieg, Gewalt und Leid. In einer biografisch und davon abgeleitet generell geprägten Analyse schildert "Friedenskinder" die historisch gesehene glückliche Epoche der Deutschen, seitdem sie in der Bundesrepublik gelebt haben. Aus vielen Einzelteilen von Begegnungen mit Menschen aus der Zeit von 1945 bis 2015 ist "Friedenskinder" sowohl ein Dokument dieser Zeit, als auch ein Buch, das weit über die persönlichen Beschreibungen dieser Generationen hinausreicht. So setzt das Buch, als entschiedener Gegenentwurf zur Spaßliteratur, ernsthaft, intellektuell und bewegend der Phase des Friedens ein Denkmal. Geschrieben in 2015, mahnt es zugleich in einem Grundton vor dem "bislang" einer Zeit, die stets neu errungen sein will: die Abwesenheit von Krieg, Gewalt und Leid für Menschen, denen wieder bewusst wird, wie zerbrechlich die Zukunft in einer gefährdeten Welt ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 627
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Von Angst, Liebe und Tod in der längsten Zeit der
unwahrscheinlichen Abwesenheit von Krieg (bislang)
von Rafael Robert Pilsczek
mit einem Vorwort von Sven Lehmann
und einem Nachwort von Christopher Johann vor der Brügge
Widmung
In tiefer Dankbarkeit für Siegbert Horbrügger
für seine Verbundenheit mit meinem Leben.
Und somit in großer Dankbarkeit den Menschen,
die uns Frieden in unserem Land schufen in Zeiten,
als die längste Friedenszeit für diese nicht absehbar war.
Über den Autor
Mit dem Buch „Friedenskinder“, einer biografisch geprägten Analyse seines Lebens vor dem Hintergrund des Lebens der (west-)deutschen Generationen in Abwesenheit von Krieg, Gewalt und Leid in 70 Jahren Frieden, legt der Hamburger Schriftsteller Rafael Robert Pilsczek sein drittes Buch vor. Auch dieses Mal besticht die Mischung aus genauer Beobachtung des fremden und eigenen Lebens und der Übertragung der Themen ins Generelle. „Friedenskinder“ ist 2015 niedergeschrieben worden und auf lange Sicht aktueller denn je, wer aktuelle Nachrichten vernimmt und vergleichend die Düsternis wahrnimmt, die zwischen den Zeilen wie „ein steter Nebel“ implementiert worden ist, wie der Autor den Grundton von „Friedenskinder“ selbst nennt.
Rafael Robert Pilsczek schaut in seinen Büchern in die Welt einzelner Menschen und zieht daraus Schlüsse auf das Leben selbst. Das zeigt sich in „Friedenskinder“ genauso wie in „Mehr Sein als Schein“, seinem Fachbuch zur modernen Kommunikation aus Sicht von PR-Beratern (2013), und der Liebeserklärung an Menschen und die Begegnungen mit ihnen in „Wie ich 10 Tausend Menschen nahe kam“ (2014).
In seinem bisherigen Leben zog der Autor, 1968 am Rande einer Kleinstadt am linken Niederrhein geboren, stets hinaus in die nahe und weite Welt in Europa, Übersee und Arabien, um das stete Rätsel Mensch und damit letztlich sich selbst zu entschlüsseln. In vielen Lebenswelten unterwegs gewesen, als Journalist und Reporter, Politiker, Dozent, Vereinsvorsitzender und heute ein erfolgreicher mittelständischer Unternehmer, vereint Rafael Robert Pilsczek besondere Erfahrungen in sich. Der studierte Literaturwissenschaftler und Philosoph hat aus den vielfältigen Erfahrungen und Fachthemen eine besondere inhaltliche und sprachliche Kompetenz darin entwickelt, die Welt anzuschauen und von ihr zu erzählen.
Fest in der europäischen Aufklärung verankert, versteht sich der Autor als entschiedener Gegenvertreter zur gleichaltrigen Spaßliteratur-Generation. So können alle drei Bücher als Gesamtwerk begriffen werden, da sie zuerst immer von einzelnen Begegnungen und ihrer kommunikativen Nähe zu Menschen ausgehen, die zusammengenommen dann mehr erzählen, als nur von Einzelteilen des Lebens.
Der Autor lebt seit langem im Hamburger Süden. Alle Bücher, herausgegeben von PPR Hamburg & Friends, sind über den Buchhandel, auf iTunes oder Amazon als E-Book und als Printausgabe erhältlich. Hörbücher sind in Aussicht gestellt.
INHALT
Vorwort
Vorwort oder: Eine Kritik
Von Sven Lehmann
Vorwort vom Autor: Eine Einleitung wie in alten Zeiten
Ihr könnt mich mal ruhig in Frieden lesen
Die Epochen, ein Steinbruch
01. KAPITEL
1968: Heimeligkeit in dem Land, in dem ich geboren wurde (keine Täuschung
)
Zu Beginn des Schreibens fahre ich in ein Land, das den Krieg so nie erlebt hat
02. KAPITEL
1970er: Eine schon sehr glückliche Zeit
Wir träumten friedlich von Jane Fonda, dem VW-Käfer und Kalifornien – die Bronx war aber auch schon da
03. KAPITEL
1977; 1990; 2001: Vom unbestimmten seltenen Gefühl, vom Terror bedroht zu sein
Es kroch in die Knochen von Kindern und Jugendlichen – und in die Köpfe der Erwachsenen
04. KAPITEL
1988: Abitur-Feier der 100 Westdeutschen, die Bildung geschenkt bekamen; geschenkt bekamen; ein Geschenk erhielten
Was sie waren und was aus ihnen wurde, ist eine fast ethnologische Betrachtung einer Kohorte von allzu braven Deutschen wert
05. KAPITEL
2013: 25 Jahre später: eine Kohorte von Abiturienten; die Amerikaner würden daraus eine Soap-Opera machen oder eine Kitsch-Story, also ich auch
Es war ein junger Mann, der aufbrach in die weite Welt – und heimkehrt in einer schönen Fantasie
06. KAPITEL
1995: Mein gebildeter Freundeskreis sieht nicht in die Zukunft, aber ich wage es: Das schlechte Gewissen des Kapitalismus ist verschwunden
Rübermachen, das taten wir nicht
07. KAPITEL
1999: Eine Reise nach Moskau, in das Land, das meine Verwandten verheerten; verheerten, verstehen wir das?
Mir taten sie nichts
08. KAPITEL
1.1.1990-1.1.2000: Nostradamus‘ Vorhersage-Vision, die – selbstredend – nicht eintraf, und die Große Hoffnung auf das 21. Jahrhundert
Wer Ahnungen hat, sollte nicht zum Arzt geschickt werden
09. KAPITEL
1977: Heißer Herbst in Westdeutschland, war es davor ein heißer Sommer?
Wie der Terror viele erschrak, wiewohl es wenige waren aus heutiger Sicht, und ich ein Kind fern des Terrors war
10. KAPITEL
2001: 9/11 in Harburg, im Weißen Haus, in Kabul: Verwirrungen und Verirrungen; ein Knäuel, das sich kaum lösen lässt
Die ganze Welt in einer kleinen deutschen Familie
11. KAPITEL
1990/1991: USA vs. Ex-DDR. Wie ich im Jahr der Wiedervereinigung im äußersten Westen und im Jahr danach im tiefen Osten zum WOSSI werden wollte, eine menschliche Symbiose vom Westen und vom Osten – und, tatsächlich grandios darin, scheiterte
.
Von Marx und Marlboro, Max und Maboro
12. KAPITEL
2008ff: Ein ganz schwaches Kapitel darüber, dass die Banken teilweise zusammenbrachen, und über jemanden, der an das Haushaltsbuch seiner Mutter denkt
Die Bank gewinnt immer, nicht wahr?
13. KAPITEL
1990: Die zärtlichen Cousinen und die Gewaltigen auch: Arnold, Bruce, Sylvester, Mel, u. a. auch: Norris, Van Damme, Lundgren, dann noch ein paar andere Action-Stars
Du hast es gut geschafft, Arnie. Oder?
14. KAPITEL
1986: Vom Erwachsenwerden rechtlich – und das mit Friedrich Dürrenmatts Buch, einem Wein und Zigaretten
Ein Privatissimo
15. KAPITEL
2011: Mein Aufhören mit der Politik war der Beginn eines darüber verschütt gegangenen Nachdenkens über Politik
Zu Anfang eine Begrüßung, die warmherzig war, weil ich ja neu war
16. KAPITEL
1980: Wie die weite Welt in die Teestube hereinbrach: Über Strauß zu schreiben, ist mir fast eine Lust, jetzt
Stoppt-den-der-Kanzler-werden-will-Sticker und andere Kleinigkeiten / Aufgepasst: ein wenig Ironie, ein Mal
17. KAPITEL
2000er bis 2015: Wissen Sie, dass nicht wenige in Brüssel auf ihren Schultern die Last tragen, eine Komplexität von 28 Staaten und zig Regionen alltäglich in Frieden zueinander zu bringen?
Eine Gemeinschaft, eine Gemeinschaft?
18. KAPITEL
1988: Wie ich die DDR hassen lernte und im Auto drei Mal schlief, damit ich kurz mit der DDR-Freundin und Bratschistin Johanna reden konnte: Besuch in Straßburg
Zwei unter Beobachtung
19. KAPITEL
1987 (das erste Jahr meines professionellen Journalismus)-2015: Erste Hinweise zu meiner von mir verlassenen Heimat: dem deutschen Journalismus: Also, eine Wahl hat jeder (Journalist) an jedem Tag – wenn er oder sie sich dazu entscheidet, sich nicht beherrschen zu lassen
Mmh, es gibt Deutsche (darunter Journalisten), die Entscheidungen fällen (können
)
20. KAPITEL
2005ff: Als das Business-Netzwerk Xing in mein Leben trat; heute alles Post- Privacy ist, mit Facebook und Co
.
Kein Netzwerker, einer im Netz
21. KAPITEL
2000er und 2010er: Wo Menschen in der Hansestadt zusammenkommen und irgendwie furchtbar harmlos sind
Ist Harmlosigkeit eine Tugend oder ein Vorbote von Gefahr?
22. KAPITEL
1983: Als ich Segnung erfuhr und den Totalitarismus empfand, das TOTALE fand und das TOTALE verlor – und fortan in der Erfahrung lebte, wie es schnell geht, sich als ABSOLUT anzusehen
Niemand anderem mehr zuhören als… dem Einzigen
23. KAPITEL
1987: Beim Bundespräsidenten versammelte sich die (besonders ausgewählte) Jugend und die noch immer recht Jungen – bevor sie berühmt wurden und Einfluss nahmen
Der Soldat grüßte
24. KAPITEL
2014-2015: Wie Terroristen schon gesiegt haben, weil Touristen nicht dorthin reisen, wohin sie im Grunde reisen wollen
Spanien, eingetauscht gegen Arabien
25. KAPITEL
1970er ff: Warum denen vorbestimmt ist, die aus gutem Hause kommen, einen besseren Weg zu gehen: Es gibt tatsächlich keine klassenlose Gesellschaft
Bernd und Manuela
26. KAPITEL
1992: Mit der Fernbahn das neue Europa sehen und doch blind bleiben für das neue Gesicht Europas
Grenzen fielen, Grenzen blieben
27. KAPITEL
2003-2013: Was soll ich den Töchtern und Söhnen noch über den amerikanischen Traum erzählen?
Es gibt das Recht auf Glücklichsein, verbrieft auf jeden Fall
28. KAPITEL
2015: Auf das Meer schauend nicht mehr allein das Meer sehend
Fuerteventura, im Club, in einem Resort
29. KAPITEL
1968 bis 2015: Kinder, Kinder – die groß wurden und heute die geringste Geburtenrate Europas verantworten
Eine Generation, die auf den Hund gekommen ist
30. KAPITEL
1986-1990: Der Jugend Verführer oder das Eintauchen in die Welt von Verwirrung und Irrung
Tja, darf ich das sagen
31. KAPITEL
1985: Aufgebahrt, beklagt, beweint, Wache gehalten – das war bereits eine andere biografische Geschichte, nicht die unsere mehr
Vaters Tod
32. KAPITEL
2015 vs. 20xx: Eine Dystopie: Warum soll es auf diesem Platz und auf dieser Stelle friedlich bleiben, wenn das dort nie länger wohl als jetzt währte – und auf vielen Plätzen und Stellen der Welt von rund 200 Staaten heute bereits Geschichte ist?
Ich packe meinen Koffer, im Frieden
33. KAPITEL
1987/1988: Zum Jahreswechsel in der DDR: Aus Sicht von den zuständigen Mitarbeitern des Geheimdienstes zwei junge Kerle aus dem Westen beobachtet, die einfach losfuhren
Kein Lappen, ein Pass
34. KAPITEL
Die letzten Jahrzehnte: Auf einer Weltkarte stecken Pins, die die letzten inneren wie äußeren Kriege anzeigen – eine unvollständige Begehung der Karte, die den Blick auf den Frieden in Westuropa schärft
Des Krieges Zufall, ein falsches Spiel von wem?
35. KAPITEL
2004: Als der Tsunami über uns hereinbrach und die Gewissheit uns entrissen wurde, dass nichts Furchtbares kommen kann
Leben, eine unbekannte Größe
36. KAPITEL
1964ff: Die Wege aus der Kleinstadt führten ihn weit weg, dabei war er im Grunde nicht auf der Flucht
Einer wie keiner
37. KAPITEL
1939-2015: Die Friedenskinder Westdeutschlands sind sehr alt geworden, Eloge auf nur einen von denen
Einer unter sehr vielen, sagt er bescheiden
38. KAPITEL
1983ff: Die Zeit des Erwachens des Bewussteins für die Bedeutung des Holocaust
Nie wieder! und die Sorge, dass dies Gebot schwach würde
39. KAPITEL
1975 bis 2015: Zum Verschwinden und zum Vergessen von Menschen, die einem doch nah waren
Der Abschied trennte uns von den allermeisten
40. KAPITEL
2015 und irgendwie nur sehr kurz davor: Zum Verschwinden und zum Vergessen von berühmten Menschen, die einem doch nah waren
Die konnten es
41. KAPITEL
1968ff: Wie Dunkelheit zu Anfang ein Leben in Sorge prägt – und die Urteilskraft stets unterwandert, der meint, er könne urteilen
Ungebetene Gäste
42. KAPITEL
1995-2011: Zwei, die ein Mahnmal sind, weil sie keine Solidarität erhielten, obwohl wir anderen davon sagten
Einer, der kam, der einer war, der ging
43. KAPITEL
1988ff: Hitler und davor auch ein Bismarck und das deutsche Volk haben gemeinsam Schlimmstes getan. Die Erinnerung verblasst, daher zwei Miniaturen dazu, auch wenn es bei vielen Streit verursacht: Das muss nicht selten sein
Unsere Sklaven
44. KAPITEL
1992: Wie Afrika auf einmal ganz nah wurde, obwohl es für Friedenskinder so fern wie kaum etwas anderes ist
You Won’t Kill Me
45. KAPITEL
1995 bis 2015: Väter aus der Nachbarschaft, die etwas für ihre Familien geschafft haben, was ihre Kinder fast alle anders, nur nicht so schaffen
Eine aussterbende Gattung, der Gatte
46. KAPITEL
1974-1997: Endlich aus dem Bildungssystem entlassen und mit der Frage allein gelassen, was zum Verständnis der Welt geführt hat
Hinterher ist man tatsächlich klüger, ja, hinterher
47. KAPITEL
1945-2015: Der Tag der Befreiung und die Jahrzehnte der unwahrscheinlichen Abwesenheit von Krieg danach
Was für ein Leben dort
48. KAPITEL
1968ff: Das katholische Prinzip des ständigen schlechten Gewissens und die Priester, die dich dann segnen
Ein orgiastisches Gefühl
49. KAPITEL
1988-1990; 2000er: Den Dienst an der Waffe noch mit dem Dienst am Menschen eingetauscht haben zu können
Wir hatten die Prüfung bestanden (bis dorthin
)
50. KAPITEL
1980er bis genau Heute: Träumer, Spinner, Überzeugungstäter sind Schimpfworte, die solche im Grunde adeln zu einer Güte, die keinen Ritterschlag benötigt, damit sie ehrenwerte Herren und Damen zu nennen sind
Mann an Deck
51. KAPITEL
Ein Sonderfall
Skizzen von Gedichten
01. Gedicht
Rilkes Saite
02. Gedicht
Ode an die, die frei sind, da sie die Gefängnistüre öffnen und einfach hinaustreten
03. Gedicht
Zwei dicke Männer
04. Gedicht
HipHop aus dem Reihenhaus
05. Gedicht
Dagegen sein sehr, dafür stets bei sich
06. Gedicht
Herr und Dame Ratioportiona
07. Gedicht
Drei Dekaden konstruierter Freiheit in einem dekonstruierten Gedicht
08. Gedicht
Ein Ort für Unreife
09. Gedicht
Der Clown
10. Gedicht
Die schmächtige Haut
11. Gedicht
Mit dem Ende ist das so eine Sache
52. KAPITEL
1990-2015:
Hommage an eine liebevolle Frau in den längsten Zeiten der unwahrscheinlich schönsten Anwesenheit von Geborgenheit, Liebe und Frieden
Schlusswort
Schlusswort von Christopher Johann vor der Brügge
Frieden wertzuschätzen will gelernt sein
Danksagung
Ganze Kerle und eine Deern
Vorworte
Ein Vorwort oder: Eine Kritik
Von Sven Lehmann
du hast mit „Friedenskinder“ ein weiteres, dieses Mal besonders mutiges Buch vorgelegt. Es hat alles, was zu einem mutigen Buch gehört: sehr viel Persönlichkeit, sehr viel Meinung, Faktisches und Biografisches, Allgemeines und erlebtes Besonderes. Du nennst das Prinzip deines Schreibens die Umsetzung des Prinzips „Pars pro toto“, also die Ableitung des Ganzen (toto) aus der besonderen, einteiligen Erfahrung eines Einzelnen (Pars pro). So nehme ich es mir heraus, an dich und an deine Leserinnen und Leser in Briefform persönliche Worte zu richten, damit ich meinem Anspruch, das richtige Vorwort zu schreiben, gerecht werde, weil auch ich – natürlich – kleinteilige Erfahrungen in meinem Leben gemacht habe und zugleich das große Ganze in meinem Brief versuche in den Blick zu nehmen und in den Griff zu kriegen.
Dein Buch ist ein mutiges Buch, fast schon vermessen, finde ich. Ich erkläre dir gerne, warum es für mich ein mutiges Buch ist. So erscheint es mir so, dass du dich auf ein für dich ungewohntes Terrain begibst, auch wenn du es vielleicht anders sieht. Du schreibst in „Friedenskinder“ über eines der elementarsten, grundlegendsten Themen überhaupt, die uns Menschen bewegen: „Krieg und Frieden“. Damit wagst du dich auf einen sehr unsicheren Boden, weil es derart bedeutsam ist, und es so viele Meinungen dazu gibt, dass es nur mutig zu nennen ist, diesen Boden zu betreten und eindeutig und laut Position zu beziehen. Und du warst mutig, mich um meine Meinung zu bitten. Damit wendest du dich an einen Freund, der in vielen Äußerungen und der Haltung eines klaren, unmissverständlichen Wortes schon öfter gezeigt hat, dass er dir nicht nach dem Mund redet, sondern zu einem begründet strengen Kritiker in deinem Umfeld geworden ist.
Nun denn, ich erledige die Aufgabe gerne und werde sie so fair und frisch wie möglich und so kritisch wie hart wie nötig halten; ich kann dennoch überhaupt nicht umhinkommen, dir sogleich zu Anfang einen sehr großen, sehr persönlichen Dissens mit deiner Conclusio zum Ausdruck zu bringen. Und damit beschreibe ich einen schon schmerzhaften Unterschied zum Gesamteindruck, den dein Buch bei mir gemacht hat. Denn ich teile deine Meinung, die auf jeder Seite deines Buches mitschwingt und in jeder Unterbedeutung spürbar ist, nicht. Deine immens untergründige Skizze einer Dystopie teile ich ganz und gar nicht. So möchte ich im Grunde den Untertitel deines Buches – Angst, Liebe und Tod in den längsten Zeiten der unwahrscheinlichen Abwesenheit von Krieg, Gewalt und Leid (bislang) –, möchte ich das „bislang“ verwerfen und im Grunde den Satz ganz und gar umgeschrieben sehen, da ich nicht Anhänger deines „bislang“ bin.
Der Anspruch, ein Sachbuch zu sein zum Thema „Krieg oder Frieden“, löst dein Buch nicht ein, da es, das liegt an deiner schriftstellerischen Herangehensweise, für mich in so vielen Teilen derart autobiografische Züge trägt, dass es dem Wunsch, ein Sachbuch zu sein, einen großen Abbruch tut. Die hier und dort stärkere und authentische Wirkung, die die autobiografischen Anteile vermitteln, helfen in der Frage, die ich grundlegend im Vorwort aufwerfe, ganz und gar nicht weiter.
Du versuchst die Hauptthese des vorliegenden Buches – nämlich die Unwahrscheinlichkeit und damit das beinahe zwangsläufige baldige Ende der jahrzehntelangen Friedenszeit in der Mitte Europas seit dem Zweiten Weltkrieg – anhand vieler Stationen deines Lebens und vieler deiner Begegnungen mit Menschen von nah und fern zu erhärten. Du behauptest durch das Memorieren von persönlichen, also lediglich dir geschehenen Ereignissen und Erlebnissen mit Menschen, deine These hart zu machen. In Wahrheit schweifst du dadurch in „Friedenskinder“ wieder und wieder unvermittelt, plötzlich und ohne innere sachliche Logik ab aus dem Blick desjenigen, der die große Weltpolitik und die Weltgeschehnisse zu erklären versucht. Damit geht ein Scheitern einher, das jedem bewusst sein wird, der sich der Mühe unterzieht, dein Buch auf die These des „bislang“ zu untersuchen und Gründe dafür zu finden, weswegen es ein „bislang“ sein solle und nicht ein „weiter so!“, in Frieden in Europa weiterzuleben.
Während das Grundthema bedeutsam ist, wechselst du naiv und einfach so im nächsten Moment hinüber zum Roten Platz in Moskau, dem du ein paar Zeilen widmest, nur weil du irgendwann in deiner Biografie mal dort gewesen bist. Die stete autobiografische Herleitung führt dazu, dass zu oft irgendwelche Dönnekes und Schnackgeschichten vom Niederrhein gelesen werden müssen, die weit weg vom Thema führen. Und im nächsten Moment wechselst du als nur scheinbarer Analytiker, der so kaum einer sein kann, vom Niederrhein nach Moskau nach Nordafrika – und lässt die Leserinnen und Leser auf den vielen Reisewegen wie in der Luft hängen.
So erinnert dein drittes Buch in Stil, Duktus und Aufbau sehr an die Art und Weise, wie du im zweiten Buch „Wie ich 10 Tausend Menschen nahe kam“ deine Erinnerungen an deine Begegnungen mit Menschen geradezu zelebriert hast. Für mich ist es so: Im zweiten Buch wie nun im dritten Buch bist du immer dann besonders stark, wenn du uns Leserinnen und Leser mitnimmst in deine Innenwelt, in deine Gedanken, in die Welten, die gemeinhin als die Gefühlswelt eines Individuums beschrieben sind. Die Sequenzen, wie du am Sterbebett deines Vaters ankommst, und auch die Anekdote, wie du von deinem Philosophie-Professor aus dem Studium entlassen wirst oder auch die Begegnung mit einem Fremden nachts im Duisburger Wald, solche Teile deines Buches, in denen du ganz nah bei dir zu sein scheinst, erscheinen mir tief und sinnvoll und bewegend.
Dennoch: Alle drei Beispiele von Geschichten aus deiner Biografie in „Friedenskinder“ haben jedoch nichts, im Grunde, mit dem großen Thema „Krieg oder Frieden“ zu tun. Dass du den Bogen sowieso so weit aufspannst, ist erstaunlich. Damit wird für mich das eigentliche Thema, das große Thema, geradezu verwässert. In „Friedenskinder“ geht es um Angst, Terrorismus, Diktatur, Freiheit und Unfreiheit, Armut und Reichtum, Gewalt, Flüchtlinge und auch mehrfach um die DDR und die Staatssicherheit. Dann wieder um Naturkatastrophen, Klimawandel, Parteienkritik und Sterbehilfe. Alles das und noch viel mehr, viele, viele große Themen, werden, um ein klassisches Bild zu verwenden, für einen allzu großen Kochtopf zusammengeschnippelt in der vagen Hoffnung, daraus insgesamt einen wohlschmeckenden Eintopf zu kreieren, der gar am Ende die aufgeworfene Leitfrage des Buches beantworten könne. Am Ende gleichwohl erschließt sich mittels dieser Art und Weise einfach überhaupt nicht, warum die Kapitel in „Friedenskinder“ sinnvoll zusammenhängen könnten. Auch nach mehrmaligem aufmerksamem Lesen gelingt es mir nicht, die große These belegt, beschrieben und auskömmlich begründet zu bekommen. Ich gehe so weit zu sagen: Selbst die Existenz der Ausgangsthese – das „bislang“ in der Abwesenheit von Krieg – findet sich in diesem Buch nicht wieder.
Um es noch einmal deutlich zu formulieren: Oft wird sehr weit ausgeholt, um dann zu kleinen oder gar keinen Schlussfolgerungen zu kommen; oft werden mehr Fragen gestellt, als Antworten geliefert. Du lässt den Leser gern mit sich allein, und es ist zu spüren, dass dies sicher sogar von dir gewollt ist, ein Ziel der Strategie des Aufbaus deines Buches ist. Einige Abschnitte sind, das muss ich sagen, zudem einfach zu lang, zu schwadronierend, verschwurbelt, andere wiederum zu kurz, zu knapp und zu andeutend, sodass du den Leser am Haken von ein paar hingeworfenen Sätzen schlicht verhungern lässt.
Mir bleibst du am Ende der Lektüre einzelner Kapitel schlüssige Fakten und wissenschaftliche Belege schuldig, als dass ich dir folgen könnte oder als dass ich dir folgen wollte. Denn: In den meisten Staaten überhaupt (fast zwei Drittel) hat es seit dem Zweiten Weltkrieg keinen Krieg mehr gegeben, die Kriegstoten der letzten 70 Jahre sind um den Faktor drei bis vier kleiner (Gott sei Dank), als alleine der Zweite Weltkrieg an Toten hervorgebracht hat, und das als nur ein Hinweis bei der heute achtmilliardenfachen Möglichkeit, dass sich Menschen auf dieser Erde heute umbringen täten im Verhältnis von einer Bevölkerungsanzahl von 2,5 Milliarden zur Mitte des 20. Jahrhunderts.
Auch die von dir ausgemachten Signale die auf ein Ende der Friedenszeit hindeuten – einmal ist die Harmlosigkeit der Vorbote der Gefahr, einmal ist es die wachsende Komplexität heutiger Strukturen, die Zusammenbruch brächten, ein anderes Mal sind es schlichte Ahnungen, die dich und andere vielleicht befallen haben – alle diese Signale taugen einfach nicht dazu, einer wissenschaftlichen Betrachtung zu deinem großen Thema und deinem „bislang“ Stand zu halten. Das Suggerieren etwa, dass die Abwesenheit von Krieg mathematisch berechenbar zum Untergang führe, dass Krieg quasi statistisch gesehen auf europäischem Boden schon überfällig wäre, erinnert doch stark an die Wettleidenschaft der Engländer, will ich zynisch antworten, die für alles und jeden eine Quote stellen – während das wirkliche Leben doch alles andere als ein Glücksspiel ist…
Du säst, das werfe ich dir vor, somit Furcht als unterschwelliges Paradigma, wo gar keine vonnöten ist. Es bleibt der Beigeschmack dazu, dass etwas geradezu herbeigeredet werden soll. Ist es wirklich die Quintessenz eines Mannes in fortgeschrittenem Alter, der die Welt mehr als manch Jüngerer geschaut hat, oder ist es die Folge eines älter gewordenen deutschen Europäers, der sich in der Welt umgeschaut hat auf der fast sehnsüchtigen Suche nach Krieg und Frieden?
Was ich mich in den Tagen der Beschäftigung mit dem Buch und dem bestellten Vorwort wirklich gefragt habe, ist, was dein Antrieb, lieber Rafael, für dieses Buch war? Einer, der nur den Frieden in seinem Leben kennt, schreibt über seine Angst vor dem Krieg? Warum schreibt er – also du – nicht über die Gnade des Friedens, die er erleben darf (und auch weiter erleben wird)? Einer, der nur für sich schreibt und sich nicht um die Meinung anderer schert, warum schreibt er zugleich dazu, sich so zu fürchten wie kaum ein anderer?
Mir scheint, das Buch ist, was es ist und wohl auch sein soll, die vermeintlich groß angelegte Exegese eines doch sehr schmalen Deutschen vom Niederrhein. Du machst dich mit deinem Werk angreifbar, und du weißt es auch, dass es so sein wird, und genau deshalb darf ich hier kritisch kommentieren und mich als ersten Kritiker begründen.
Was das vorliegende Buch sehr wohl leistet, ist eine Herleitung zur eigenen Leser-Biografie. „Friedenskinder“ nimmt uns mit auf eine Reise in 70 Jahre deutsch-deutsche Nachkriegsgeschichte. Das Buch von dir hat mir mehr als einmal Anstoß gegeben, über die eigenen Erfahrungen, Erlebnisse und Erinnerungen aus meiner eigenen Biografie eines Westdeutschen ebenfalls im fortgeschrittenen Alter nachzudenken, bewegen wir uns doch in derselben Kohorte einer Generation, wie du es so schön formuliert hast. Mehr als nur einmal habe ich mit der Suchmaschine Google und dem Online-Lexikon Wikipedia zu bestimmten von dir aufgezählten Momenten und Meilensteinen der deutschen Geschichte mir noch mehr Hintergrundinformationen eingeholt und mein Wissen so auf schöne Weise aufgefrischt.
Dafür, lieber Rafael, gebührt dir Dank, wie ich finde.
Wie überhaupt die Vermischung deiner eigenen Erlebnisse mit den geschichtlichen Ereignissen (seien es große oder kleine) mir über weite Strecken – das möchte ich doch auch benennen – als sehr gelungen erscheint. Wenn an demselben geografischen Ort einmal über die Banalität und Belanglosigkeit der 100 Abiturienten der Heimatstadt berichtet wird und dann wieder über die vergessenen Grabsteine und Steinstelen unserer Altvorderen dort, dann ist das, das meine ich, schlicht und schön, großes Kino. Es ist genau diese Mischung, die das Buch am Ende dann kurzweilig zu lesen macht. Die virtuelle Abi-Feier im Hamburger Atlantic Hotel als Racheakt zu fantasieren, ist sicherlich ein Highlight – und ich weiß jetzt, dass Ruhm von Roomservice kommt und ich dafür Udo und dir Dank sagen kann.
Ich habe dir einen Brief geschrieben, weil ein Brief für mein Anliegen, kritisch auf dein Buch antworten zu wollen, eine schöne persönliche Form geblieben ist, wie ich denke. Möge sich, auch das ist wahr, jede geneigte Leserin und jeder geneigte Leser eine eigene Meinung nach der Lektüre deines Buches gebildet haben.
Am Ende, so kenne ich dich, bin ich mir sicher, dass du trotz allem, was du aufgeschrieben hast, ein überzeugter Europäer und ein zufriedener Friedensanhänger bist. Die gute Nachricht meines Vorwortes zu „Friedenskinder“ habe ich daher bis zum Schluss an dieser Stelle aufbewahrt:…
…der Frieden wird uns auch noch weiter erhalten bleiben.
Vorwort: eine Einleitung wie in alten Zeiten
Ihr könnt mich mal ruhig in Frieden lesen
Freitag, der 3. Juli 2015
Ich bin ja bescheuert, gleichwohl mag ich genau das an meinem Leben. Ich bin ja bescheuert, diesen so unscheinbaren Ort als Ort ausgewählt zu haben, wo ich meine Einleitung, mein Vorwort schreiben will. Stefanie, eine Bekannte, die ich bisher nie von Angesicht zu Angesicht traf, eine Frau, übrigens, die mit Ochsenblut-rotnagellackbewehrten Füßen auf dem Online-Profil-Foto für sich wirbt, Stefanie schickt kurz, bevor ich an diesem Freitagnachmittag aufbreche, per WhatsApp den Ort an mich, wo sie, die Stewardess aus Süddeutschland, sich grad aufhält: Ich kann es genau sagen, wo sie jetzt ist, weil es die Moderne und das GPS möglich gemacht haben.
Stefanie ist ein liebenswertes Phantom, das offenbar in seinem Leben auch irgendwie lieber etwas anderes als Flugbegleiterin sein will und daher anfängt, Bücher zu produzieren, wie ich es mit dem vorliegenden Büchlein „Friedenskinder“ zum nun dritten Mal zum Abschluss bringe. Sie ist ein Phantom für mich, das nie dort ist, wo ich gerade bin. Sie ist physisch gesehen in diesem Moment genau 9.225 Kilometer östlich von mir entfernt. Es ist in Längen- und Breitengraden genau bestimmbar. Sie ist weit, weit weg, sie war der aufgehenden Sonne entgegengeflogen, während ich in die untergehende aufbrechen will. Sie ist im tiefen Osten der Welt, während ich in meiner norddeutschen Heimat – Hamburg – alles zusammenpacke, damit ich auf meine kleine Reise aufbrechen kann. Stefanie ist in diesem Moment in der Hauptstadt Japans, in einem Stadtteil von Tokio, dessen Namen ich nicht verstehe.
Warum nur, das frage ich mich in diesem Moment, als die WhatsApp-Nachricht von ihr aus Tokio bei mir in Hamburg auf dem Smartphone ankommt, warum nur fahre ich in diese von mir erwählte, wenig glamouröse westdeutsche Stadt und warum bin ich nicht – ob bei den einen oder den anderen, die ich dort kenne –, warum, verdammt noch mal, bin ich nicht in Tokio, Shanghai, Singapur, obwohl auch das möglich wäre? Warum nicht im Glitzer, im Schein und im besten Gefühl in meinem über alles geliebten Manhattan, Union Square, was auch möglich wäre? Warum nicht auf nach Berlin, wo wahre Freunde sind, wo erlebte Geschichte für mich ist, wo ich mich immer so fühle, als hätte der Tag keine Nacht, das gar preiswerter zu erreichen ist als die Städte im Ausland?
Warum nicht mal nach Rio de Janeiro reisen zum Schreiben, wo ich noch nie gewesen bin, nach Kolumbien, wo die ist, von der ich vor vielen Jahren eingeladen worden war, oder warum nicht jetzt zu meinem Freund David B. nach Paris reisen, zu Jordi G. nach Spanien, zu Daddy und seiner Freundin nach Hawaii, wo sie heute sind? Warum nicht einfach zu Stefanie nach Tokio fliegen, dass ich sie endlich LIVE, also von Angesicht zu Angesicht kennenlerne nach den zurückliegenden Jahren des virtuellen, also nicht-physischen Kommunizierens? Warum nicht? Die Zeiten heute sind so, dass ich – wir – es könnten, reisen überallhin, an Orte weit, weit weg.
Warum ist man wo zu welcher Zeit? Auch das ist ein Basis-Ton meines Büchleins, die ewige Frage, wo ein Mensch wann an welchem Ort zu welcher Zeit warum ist. Und vor allem: Wo ist man zur rechten Zeit? Während Stefanie als Stewardess durch die ganze Welt reist, von hier und dort Nachrichten an mich sendet, FLÜGGE ist, fliehend und vielleicht nie ankommend, ist es mir die ständige, mich bedrängende Frage meines Lebens, wo denn ich zur rechten Zeit, verdammt noch mal, sein sollte. Es ist mir tatsächlich wichtig geworden, nicht dort zu sein, wo ich sein muss, weil die Eltern das wollten oder weil der Beruf mich dorthin ruft. Es ist mir wichtig geworden zu überlegen, wo ich und meine Engsten RICHTIG sind.
Ja, ich weiß. Viele sind dort geblieben, wo sie groß geworden sind. Viele sind dort hingegangen, wohin sie eine Liebe oder der Beruf hingebracht hat. Ja, ich weiß, es ist heute ein gutes Land –…
…mir ist es gleichwohl wichtig, immer gewesen, TATSÄCHLICH alles dafür zu tun, dass Leute wie ich FREIWILLIG und VERNUNFTGESTEUERT im Sinne des Aufklärers Immanuel Kant aufgestellt sind, dass ich und meine Engsten frei und vernünftig entscheiden, ganz am Ende ganz alleine entscheiden, WO und WANN ich und sie unser einziges Leben – mein, ihr einziges Leben – verbringen wollen. So ist es Deutschland geworden, wo ich geblieben bin, und zwar nicht allein deswegen, weil ich dort geboren und groß geworden bin und weil dort mein Leben MICH gefunden hätte. Es ist so, tatsächlich, dass ich frei und vernunftgesteuert das Leben in diesem Land gesucht habe. Warum? Auch davon, warum, erzählt mein Büchlein.
Es ist VOR ALLEM ANDEREN so, dass ich ein Kind des Friedens bin; ein Mensch, der in Abwesenheit von Krieg, Gewalt und Leid bis heute gelebt hat. Wie wir heißen, wie wir genannt werden? Noch gibt es keinen Namen im öffentlichen Bewusstsein für diese. So habe ich mir den Namen selbst gewählt, für Leute wie mich, für meine Generation …
…Friedenskinder. (Klingt lakonisch, ich weiß, es passt gleichwohl gut.)
Einer, der sich so nennt, hat in Abwesenheit von Krieg, Gewalt und Leid etwas Besonderes erfahren dürfen. Wie das so ist, ein Friedenskind zu sein, ist vor allem das Thema des Büchleins. Was es bedeutet, ein Friedenskind zu sein.
Meine Generation, Leute wie ich, wir sind FRIEDENSKINDER.
Ein Kind von Eltern, die den Krieg als Kinder noch erlebt haben und den Hunger nicht stillenden Geschmack der Steckrüben-Suppe kannten. Ein Kind von Großeltern, die den Großen Krieg miterlebt und mitgemacht und erst ermöglicht haben und Tod so sehr als alltäglichen Begleiter kannten, sodass der Tod bei vielen keine besonderen Gefühle mehr hervorrief. Ein Kind bin ich von Verwandten, die früh in ihrem Leben in ANWESENHEIT von Krieg, Gewalt und Leid gelebt haben und Krieg, Gewalt und Leid über ANDERE früh und mehrfach gebracht hatten. Ich dagegen darf in Frieden leben seit einer unendlich langen Zeitspanne.
Es ist tatsächlich so, und das ist das besondere Thema meines Büchleins, dass diese (west-) deutsche Generation und auch ein Teil ihrer Eltern in der historisch gesehenen längsten Zeit der eigentlich in historischer Sicht sehr unwahrscheinlichen Abwesenheit von Krieg, Gewalt und Leid gelebt haben. So wissen es die kundigen Historiker der europäischen Geschichte zu erzählen, so künden die kundigen Chronisten davon, die dieses Europa erzählen, so berichten es die alten und sehr alten Geschichten, Urkunden, Belege, dass auf DIESEM Boden – auf europäischem Boden – noch jede Generation ihren Krieg, ihre Gewalt und ihr Leid erlebt hat, Kinder, Frauen, Männer. Wer Europa als eine Fläche großen Ausmaßes versteht und als eine Fläche, auf der immer viele Stämme, Völker und Menschen gelebt haben, der wird diese Fläche in diesem Sinne historisch-kritisch ansehen und mir zustimmen müssen.
Wer den Ort historisch-kritisch anschaut, wo er wohnt, auf den kleinen Fleck schaut in Westdeutschland, dann die Fläche in Frankreich, in England, schon nicht mehr in Ostdeutschland, schon nicht mehr in Südosteuropa, nach Polen, Tschechien usw., darüber hinaus nach Spanien, Portugal, Griechenland usw., darüber hinaus noch weiter weg schaut, der muss diesen Fakt anerkennen, dass wir wirklich Friedenskinder sind und dass wir als Friedenskinderenkel in einer derart langen Zeit der Abwesenheit des SCHLIMMSTMÖGLICHEN, was sich Menschen antun – Krieg –, leben, dass es nur ein…
…dass es im historischen Vergleich nur ein Wimpernschlag der Geschichte ist. Dass ein Leben 70 Jahre lang in Frieden (in Westdeutschland) eine Zeitspanne ist, die weder die Eltern noch die Großeltern noch wir selbst haben voraussehen können. Dass es Frieden hier bei uns gibt bis heute, ist eine Tatsache und ein Umstand – der nun mehr und mehr und in immer größeren Umdrehungen immer mehr in…
…in Gefahr seiner Dauerhaftigkeit gerät. Gerät? Ja, in Gefahr gerät. Seit rund fünf Jahren laufe ich herum und frage Menschen, von kleiner und von großer Bedeutung, Abgeordnete des Deutschen Bundestages, Wirtschaftsführer, Milliardäre und Verkäuferinnen beim Discounter in meiner Nachbarschaft, ob sie es auch spüren, dass die Umdrehungen stärker werden. Dass die Ereignisse schneller werden. Dass es mehr Sorgen gibt. Dass…. die Gefahr wirklicher wird, diese ABWESENHEIT zu verlieren. Während ich zu Anfang, vor fünf Jahren, fast immer verlacht wurde ob meiner Frage, merke ich, dass es Jahr um Jahr anders geworden ist; von Monat zu Monat und von Jahr zu Jahr bin ich LEIDER immer weniger einsam geworden in meinem unheimlichen Gefühl, dass die Umdrehungen der Zeit schneller werden als davor und dass die Zeiten des Friedens zu einem Ende kommen könnten. So ist es kaum ein Wunder, dass ich ausgerechnet in diesem Jahr dieses Büchlein vorlege.
Und ist es nicht verwunderlich, dass ich meinen Ort, um mein Vorwort zu schreiben, nicht in Berlin suche, nicht in München, Frankfurt, nicht in Stockholm, nicht in Paris oder London. Es ist kaum verwunderlich, dass mich meine Reise in eine recht kleine Stadt führt. Diese Äcker, diese Wälder dort, die Wiesen, die Felder dort haben etwas zu erzählen, denke ich mir, dass GRÖSSER ist als das, was ich an anderen Orten zu meinem Thema vorfände. Diese Fläche im Westen Deutschlands, im Landstrich Westfalen gelegen, irgendwo im Nirgendwo, irgendwie überraschend, irgendwie OHNE Bedeutung, diese Fläche passt thematisch doch gut. Dorthin reise ich jetzt. Die Reise zu meinem Vorwort führt mich über Hamburg, Bremen, Osnabrück in nur wenigen Stunden Autofahrt auf der A 1 in die Stadt…
…Münster.
Münster ist der Ort, den ich an zwei Tagen, am Samstag und am Sonntag, untersuchen will mittels eines historisch-kritischen Skalpells, damit es ein Vorwort zu meinem Büchlein „Friedenskinder“ ergibt, welches gehaltvoll in das Buch einführt und die dortigen Aussagen ergänzt. Was ist geschehen in Münster, dass ich diese Stadt am Rande des Randes eines großartigen Europas und einer überhaupt vibrierenden Welt erwählt habe? Wer weiß es noch?
Ich auf jeden Fall bin ja bescheuert, dorthin – nach Münster – zu reisen, gleichwohl mag ich das an meinem Leben, derart bescheuerte Sachen zu tun…da diese SACHE, diese ANGELEGENHEIT für mich alles andere als bescheuert ist, wie ich mir selber zeigen will, als ich mich auf den Weg mache.
Es ist 17:51 Uhr an diesem Freitagnachmittag, als ich auf die A 1 auffahre. Es geht los. (Start Me Up.) Hi, Stefanie, notiere ich auf WhatsApp. Ich grüße dich in Tokio, schreibe ich kurz. Ich warne dich kurz, dass ich mein neues Büchlein mit dir beginne. Warne dich davor, dich an dieser Stelle und an diesem Platz einzubinden. Als Rechercheur und als Kundiger der deutschen Geschichte werde ich dorthin fahren. Mein Handwerkszeug als Rüstzeug ist so, wie ich es gelernt habe, so schreibe ich: hingehen, hinschauen, hinhören, nachdenken, hinschreiben, selbst Zeuge sein. Meine Art, schriftstellerisch in diesem Büchlein zu arbeiten.
Während der Anreise in die Heimat meiner Kindheit, Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland in Deutschland, geht es vorbei an Feldern, Wiesen, Äckern, Wäldern, an Grün und fast Türkis, an Flächen, wo es friedlich wirkt und schön. Es geht vorbei an Flächen, auf denen Getreide wächst und Landschaftskulturen gepflegt werden. Während ich immer wieder nach rechts und links auf die Landschaft Niedersachsens und dann des Nordens von Nordrhein-Westfalen schaue, entdecke ich in mir das andere Bild dieser Landschaft. Ich führe mir vor Augen, während ich recht langsam fahre, nie schneller als 140 Stundenkilometer, wie es damals war in der Zeit, über die ich lernen will. Wie es war, als vor 300 Jahren Heere durch diese Landschaft zogen; wie es war, als Söldner und Soldaten einfielen und blieben und verheerten und den Menschen Krieg, Gewalt und Leid brachten; wie es war, als die Heere dort standen, in großer Anzahl, 10 Tausend in einem Heer, 20 Tausend in einem anderen Heer; wie sie von den Bauern und den Handwerkern die Steuern eintrieben; wie die Heeresführer den Hof beanspruchten, Tiere beanspruchten, Kinder, Männer und Frauen nahmen, als wären sie ein Gut, das durch Rüstung und Schwert kostenfrei gekauft werden könnte, als wäre es das Normalste von der Welt.
Ich stelle mir vage, sehr weit weg vor, wie dort in den Landstrichen Dorf um Dorf, Stadt um Stadt von Banden, marodierend, eingenommen wurden; wie sie blieben und was sie taten; dass ihre Taten unerzählt und kaum dokumentiert, eben nicht in der Geschichtsschreibung breit und tief bewahrt wurden; wie sie lynchten, mordeten, vergewaltigten, schunden, versklavten, vertrieben, die Landstriche je nach Stärke und Kraft beherrschten; wie sie davonzogen, wenn sie es wollten; wie sie blieben, wenn sie es wollten; wie andere Heere kamen, falls das jeweils andere Heer geschlagen und vertrieben worden war; …
…wie diese Fläche im Dreißigjährigen Kriege dreißig Jahre lang in Unfrieden und in steter Anwesenheit von Krieg, Gewalt und Leid lebte. Vorbei an heutigen pittoresken Landschaftsgemälden fahre ich und stelle mir auch rückblickend die Kriegsgemälde des damaligen Krieges vor, wären sie damals bereits für die Nachwelt gemalt worden. In der Zeit, in der im 17. Jahrhundert ganze Landstriche verheert wurden. Wo genau, von wem, wie, wann, wissen wir nicht und werden wir nie erfahren. Bekommen Reisende, frage ich mich, die nach Münster aufbrechen, dies erzählt oder in Münster selbst, was dort war, der Abschluss des Westfälischen Friedens, der 30 Jahre Krieg beendete, nachdem die Gesandten fünf Jahre darüber ebendort in Münster verhandelt hatten? So ist das, über heutige Friedenskinder zu schreiben, auch ein Versuch zurückzuschauen, als Krieg STETIG war, eine PFLICHT, ein VERHÄLTNIS, eine WIRKLICHKEIT. Und Münster als Symbol einer anderen Wirklichkeit aufsuchen, die nicht allein von Krieg erzählt, sondern von Frieden.
1945 endete der Zweite Weltkrieg, 1989 fiel die Mauer, die Deutschland geteilt hatte. In Westdeutschland herrscht seit 1945 Frieden, also die Abwesenheit von Krieg, Gewalt und Leid. Seit 1989 ist das Ende einer gewalttätigen Diktatur tatsächlich auch so für Ostdeutschland zu definieren. Die Menschen, die die Bundesrepublik bis 1989 und die Deutschland als vereintes Land ab 1989 als ihre Heimat erleben durften, diese Menschen sind bislang kaum aus diesem Fokus, Friedenskinder zu sein, beschrieben worden. Tatsächlich ist mir ihre Generationenbeschreibung – die Generationen der Friedenskinder – nur ein einziges Mal während der Recherchen zu diesem Büchlein in die Finger geraten. Ein altgedienter Journalist hatte im April dieses Jahres über das Phänomen geschrieben, was es heißt, 70 Jahre lang im Frieden gelebt zu haben. Er hat nur wenige Zeilen geschrieben, andere Themen waren ihm dort wichtiger. Über das Phänomen der Abwesenheit von Krieg, Gewalt und Leid in den Biografien der Kinder des Zweiten Weltkrieges, ihrer Kinder und ihrer Enkel gibt es bislang keine großen mir bekannten Bücher, Studien, Beschreibungen, Reportagen.
Warum es so ist, ist mir nicht leicht erklärlich. Die einfachste und damit wirksamste Erklärung scheint mir zu sein, dass das BEWUSSTSEIN der Abwesenheit kaum entwickelt ist in dem Moment, in der man sich in dieser Situation der Abwesenheit befindet. Das Bewusstsein dafür, es rückwärtig, also in der Vergangenheit erlebt zu haben, wird dann dadurch scharf und wach, wenn die Abwesenheit endet, auch schon, wenn die Abwesenheit weniger gesichert erscheint. Das BEWUSSTSEIN von Glück erschließt sich vielen Menschen auf jeden Fall erst in der Rückschau einer Goldenen Zeit. Dann, wenn Frieden fehlt. So ist es kaum verwunderlich, dass die Friedenskinder erst in diesen Jahren und in dieser Phase der europäischen Geschichte von der Geschichte wachgeküsst werden, wenn der Frieden in Gefahr zu geraten scheint. Wir Friedenskinder wissen es erst, seitdem es mehr und mehr unheimlich wird erneut in Europa, dass Frieden WENIGER SICHER und WIEDER UNSICHERER erscheint.
Auf der Autobahn. Für die nächsten Tage habe ich mich entschieden, die tatsächlich beste Band der Welt als Begleitung zu hören. Es sind, na klar, die Rolling Stones. Verschiedene ihrer Lieder und zwei CDs mit ihrem Konzert im Londoner Hyde Park habe ich mir heruntergeladen. Bei wunderbaren 32 Grad im Schatten war ich Klimaanlagen-gekühlt losgefahren. Die Fahrt an sich verläuft einfach, routiniert und gut, wie es einem Vertriebler alter Schule zur Ehre gereichte, der Stunden über Stunden ohne inneren Aufwand fährt, damit er dann ein halbstündiges Verkaufsgespräch in einer fernen Einkaufszentrale führt. Nach nur knapp vier Stunden sehe ich meine eigentliche Heimat vor dem Horizont und vor der großen Frontfensterscheibe des PKW auftauchen. Die eigentliche Heimat, dort, wo ich geboren bin, ist sofort erkennbar, riechbar, schmeckbar, fühlbar. Es ist das Ruhrgebiet. Meine Heimat sind die staksigen Fördertürme vor Recklinghausen, die sich sichtbar über die Baumgruppen aufstellen, als wäre es ein Stolz, so hoch in den abendlichen Himmel aufzuzeigen.
Meine eigentliche Heimat hat die meisten stillgelegten Industrieanlagen im Ruhrgebiet, die sich jedem Autobahnfahrer deutlich zeigen, der dorthin reist. Es sind die dampfenden Anlagen der Chemie-Unternehmen, die noch arbeiten. Es ist eine kleine Fläche in der Mitte Deutschlands, des Mittleren Westens meines Landes, wie ich meine eigentliche Heimat zärtlich im Ausland nenne, wo das Ruhrgebiet recht unbekannt ist, der Mittlere Westen ist eine Fläche, auf und an der es aber auch erstaunlich viel Wald gibt, erstaunlich viel Wald für eine Fläche, auf und in der viel Stahl gegossen und viel Kohle gehoben wurde.
Bei Oberhausen beginnen die Schnellspuren anstrengend zu werden für einen Metropolenbewohner, der oft im Stau steht und wenig beschleunigt, manche der Fahrer dort geben jetzt richtig Gas. Man muss dort im Ruhrgebiet immer wachsam sein und aufpassen, wenn man auf den Autobahnen ist, drei Spuren, schnelle Autos, die kreuzen, überholen, beschleunigen, als gäbe es keine Geschwindigkeitsbegrenzungen. Es sind viele Autobahnbrücken dort, viele Auffahrten, viele Abfahrten. Viele eher unsichere Fahrer meiden daher das Ruhrgebiet, das ein komplexes Straßennetz hat, das das Wort Netz auch verdient hat. Die Rolling Stones geben mir den Ton dieser Fahrt und damit auch dieser kommenden Tage vor. (It’s Only Rock And Roll.) (But I Like it.) Mittels des Navigationsgerätes zoome ich auf der Höhe von Duisburg-Hochfeld das Gebiet des Friedens aus 70 Jahren hoch: Die Fläche des Friedens ist gut zoombar, vergrößerbar, das Gebiet des Friedens ist auf dem Bildschirm gut sichtbar. Es reicht nördlich nach Skandinavien, Dänemark ist sichtbar, westlich nach Amsterdam und bis an die Küste des Vereinigten Königreichs, sogar London ist ein Punkt auf meinem Navigationsbildschirm. Meine Fläche des Friedens reicht bis nach Belgien, Holland, bis nach Nordfrankreich, sogar bis nach Paris.
Während ich auf der Autobahn in Richtung der holländischen Grenzstadt Venlo unterwegs bin, sehe ich die Fläche, die weder überfallen noch verheert worden ist in langer Zeit. Über die vielen Baumreihen in Duisburg-Hochfeld hinweg, die es dort, wie gesagt, gut gibt, sehe ich die Sonne, die gerade untergeht, als Feuerball, als wäre es das Feuer im Stahlofen, wenn das flüssige Metall sich in die Bahnen, die dafür vorgesehen sind, ergießt. Schließlich fahre ich an den Abfahrten nach Moers vorbei, nachdem ich die Rheinbrücke überquert und dem alten mythischen deutschen Fluss einen Gruß erteilt habe. Moers-Ost ist die Abfahrt, an der ich abfahre. Es ist bereits spät. Ich werde mich heute im niederrheinischen Moers einquartieren und erst morgen früh zum Ziel meiner Reise nach Münster aufbrechen. Moers aufzusuchen, die alte Wirkungsstätte, ist immer eine Reise wert, weil es dort erlebte Geschichte gibt, und ich liebe erlebte Geschichte, die mir das Gefühl gibt, dass ich bereits lange gelebt habe und viel daraus gemacht habe.
Ich denke sehr wohlwollend an meine alte Heimat zurück und insgesamt blicke ich wohlgelaunt auf mein Leben zurück und versuche gern über gern abzuwenden, was dort an Dunklem und Schwierigem am Entstehen zu sein scheint. Manche unter denen, denen ich begegnet bin, die nicht stetig darin erfolgreich waren, ihren Lebensalltag zum Hellen und Besseren zu wenden, endeten zunehmend in einer Art von lähmender Verzweiflung, die zur Abschottung vor der Welt, der Vita Activa führen kann. Das ist meines Erachtens keine Antwort auf die Frage, welche HALTUNG einzunehmen ist für diejenigen, die ohne Krieg, Gewalt und Leid groß geworden sind: Ihr könnt mich alle mal.
Nein, das ist keine Haltung.
Hinter der Abfahrt Moers-Ost komme ich auf vertrautes Terrain. Zwei Jungen fallen mir auf, während ich in das Zentrum von Moers fahre. Sie kicken Fußball vor dem fensterlosen Rücken eines Mehrfamilienhauses, dessen Farbe alt ist und dessen Rasen davor ungepflegt erscheint. Ja, sie alle kicken hier, gegen Garagenwände, auf Wiesen, auf den Straßen. So wie in meiner Kindheit und Jugend kicken sie noch immer dort, es ist der Sport des Ruhrgebiets selbstredend, Fußball. Zwei Schwarzafrikaner stehen weiter vorne an der Straße in diesem Stadtteil und reden mit einem arabisch aussehenden Mann. Alle drei stehen an einem PKW, es ist keine Luxuskarosse, die Welt hat sich verändert, wir sind ein Einwanderungsland geworden, denke ich, während ich ihnen im Rückspiegel nachschaue. Schließlich fahre ich in den Kreisverkehr und komme in das Stadtzentrum von Moers, eine Stadt, die stolz ist, zu den kleinsten Großstädten des Landes gezählt zu werden. Vorbei geht es am Jugendzentrum, das es noch immer gibt, und dem Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum, das recht neu ist, und ich wähle mir den Parkplatz in der Tiefgarage am Eingang zur Fußgängerzone. Es ist altes Terrain, bekannt und erprobt in meinem Leben. Es ist noch immer hell, als ich dort parke.
Ich will zum Schreiben in das „Bermuda-Dreieck“, wie wir die Ansammlung von Cafés und Kneipen nannten, die dort im Zentrum auf engstem Raum in der Fußgängerzone lagen, als wir jung waren. Mein Ziel ist das „Café des Arts“, ein ganz erstaunlich elegantes Café für Moerser Verhältnisse, das fast immer nur weibliche, dazu gut aussehende Kellner zum Personal hat. Als ich dort ankomme, ist viel los, hey, es ist Freitagabend, es ist warm, es ist Sommer, es ist ein guter Ort in Moers und am linken Niederrhein, der Region, die von hier aus sich linksrheinisch bis nach Holland erstreckt. Ich gehe dorthin, die Laptoptasche locker geschultert, nehme Platz auf einem Bistro-Stuhl draußen vor dem Café etwas abseits vom Eingang. Ich bestelle ein Pils, wie viele dort es tun, Bier ist das Heilgetränk des Ruhrgebiets, nicht Wein, auch in einem Café. Ich hole den Laptop aus meiner Tasche, zünde mir eine Zigarette an, fange an zu tippen, ohne dass es unangenehm auffiele, Moers war stets offen und tolerant. Als ich beginne zu schreiben, fällt mir jetzt ein, was ich auf der Autobahnbrücke vor Moers-Ost gelesen habe. Dort war ein Plakat quer zur Brücke aufgehängt. „Ich bin in Europa“ war dort zu lesen. Es fehlten gleichwohl Buchstaben, das Plakat wirkte verwittert. So gibt es jetzt beim Pils den Ton des Zweifels vor, mit dem ich angereist war. Dort stand nur: I.h b.. in Eu..pa…
… unvollständiges Europa, auch ein Thema meines Buches. Ich beginne das Schreiben. Und bin irgendwie unsicher, weil ich erst am nächsten Tag in Münster sein werde, wo ich ja eigentlich hinwollte, und heute Abend und heute Nacht in Moers, der Stadt, die mir viel geschenkt hat und die vielen anderen jungen Menschen viel geschenkt hatte – weit vor dem Fall des Eisernen Vorhangs.
Wünsch dir was, dann geht auch was
Also, Moers, das „Café des Arts“. Es ist ein sehr warmer Abend, auch die Nacht wird erwartungsgemäß warm genug sein. Ich schreibe. Sehe den Ort dort und könnte an vielen Ecken dazu genau dort erlebte Geschichten erzählen. Wie der Bogen aus Stein aufgestellt wurde dort vor dem Café, ein Bogen, der an die jüdischen Moerser erinnert, die dem Holocaust, der Shoah zum Opfer fielen. Wie in der Buchhandlung direkt neben dem Café es eine große Auswahl von Taschenbüchern der Weltliteratur gegeben hatte, bevor sie schloss. Wie es war, hier mit Freunden und Bekannten lange in den Abend hinein zu reden. Was es war, was Moers zu einem für uns einzigartigen Ort gemacht hatte, als Dutzende von jungen Leuten ein gemeinsames Magazin herausbrachten und mindestens die Schützenvereine und die damalige rechtsradikale Partei der Republikaner schreibend verärgerten.
(She Would Never Say Where She Came From.) (Yesterday Don’t Matter.) (In The Darkest Night.) (She Comes.) (Good Bye.) (Still I Am Gonna Miss You.) Vergangen, die Zeit ist hinter uns. So viel Zeit bereits. Wir können uns nicht selbst beschummeln.
Heute Abend, heute plaudern sie wieder alle gerne, eher in die Jahre gekommene, bestimmt viele darunter, die geschieden sind, manche, die ohne Partner blieben, das Gesicht ist ein wenig voller geworden im Laufe der Jahre. Unverändert geblieben ist der Ton des Niederrheines. Es ist ein Ton, den ich ansonsten so nicht woanders gehört habe. Es ist ein freundlicher gleichmäßiger Singsang ohne besondere Höhe und Tiefen. Es ist das stete Erzählen von dem, was gerade war, was ist, von dem, was sein könnte. Im Ton des Niederrheins erzählen sie sich hinplätschernd gleich und gleich freundlich, was das Leben so an sich hat, ohne ein Erlebnis oder einen Gedanken derart zu verfremden, dass er falsch wird, dafür gleichwohl eine schallende spitze Pointe bildet, wie es in Hamburg gerne gedreht wird.
Ich schreibe für mich, ohne Anschluss an Gäste zu suchen, und denke an den berühmten, vor Jahren verstorbenen Hanns-Dieter Hüsch, den Ehrenbürger der Stadt Moers. Er, ein Kabarettist des Alltages, hat einst gesagt, dass der Niederrheiner sich dadurch auszeichne, dass er überall mitreden könne, auch wenn er von nichts wirklich Bescheid wisse. So bitte ich zu entschuldigen, dass ich nur zum Teil Hamburger geworden bin und zum Teil Niederrheiner geblieben bin. Was wichtig ist und was nicht, das ist eben nicht leicht zu entscheiden, was in die eine oder in die andere Richtung zu schieben ist. Tatsächlich ist dieses Büchlein auch eher ein niederrheinisches Werk in der Semantik, durch das nachdenkliche Aufschreiben von auch fließenden Gedanken entstanden, um damit die Größe eines Themas zu erfassen, das sehr groß ist, und um die Gedanken überhaupt zu erzählen, die sehr viele sind, und um herauszufinden, was zu diesem großen Thema tatsächlich dazu gehören könnte.
Es ist Mitternacht geworden, es feiern die Niederrheiner weiter vor dem Café mit Bier und in Gesprächen. Während drinnen zwei junge DJs Musik auflegen, ist es einfach zu angenehm, draußen zu bleiben, so dass die DJs innen drin kein tanzendes Publikum finden. Nun rede ich noch mit zwei Gästen, wir lachen, nun trinke ich noch ein Pils. Während vor Jahren junge Leute abends und nachts zum Feiern in die Discotheken gingen, in das feine und fast zu feine „Kobra“ oder in das große, fast zu große „Second Life“, gibt es heute außer Orten zum Reden kaum etwas anderes in Moers. Warum? Weil auch diese Stadt nicht mehr die Menge an jungen Menschen hat, die solche Orte füllten und damit überlebensfähig machten. Ich schultere schließlich meine Laptoptasche, verabschiede mich von den beiden Gesprächspartnern, verlasse das Zentrum, gehe an einer Shisha-Bar, die unbesucht ist, vorbei in die Tiefgarage, starte meinen Wagen und fahre in ein einfaches, großes Hotel am Rande der Stadt und wundere mich, dass ich gefragt werde, ob ich mir ein Raucher- oder Nichtraucherzimmer zur Nacht wünsche. Raucherzimmer? Wo gibt es das denn noch? Außer in Moers? Zum Einschlafen höre ich noch ein wenig Musik, Jagger-Musik. (Who Could Hang A Name On You.) (Still I Am Gonna Miss Ya.) Morgen werde ich in Münster sein.
Samstag, der 4. Juli 2015
Hallo? Geht es dir gut? 6:41 Uhr. (Auschecken. Einsteigen. Losfahren. Mehr war nicht.) (Doch.) (Da war mehr.) (Morgens am Rande von Moers.)
Ich plane die Anfahrt nach Münster. Was erwarte ich von Münster? Was weiß ich über Münster? Was sehe ich vor meinem geistigen Auge, wenn ich meine Augen so zukneife und an Münster denke? Was macht die Reise für einen Sinn? Was macht das alles für einen Sinn? Eine hohe Auflage will ich nicht. Ich will in keine Talkshow. Ich will nicht einmal, dass andere von mir reden. Es ist die Verletzlichkeit, die am Morgen kommt; vor allem, wenn ich in irgendeinem verdammten Hotel irgendwo in dieser Welt wach werde und nicht genau weiß, wo ich bin. Wo gehören wir hin? Wir beschweren uns? Wir Friedenskinder beschweren uns? Der eine hat eine Depression, der andere ist psychotisch, der Nächste hat keine Arbeit, einer hat was Neues, das sich Burnout nennt, andere haben keine Partner, viele haben keine wahren Freunde, wieder ein anderer findet keine Zeit für seine Männerfreunde, weil er als spät gewordener Vater keine Nischen mehr für sich hat, der Nächste ist schwer krank, wieder einer ist im Ausland, der Nächste ist schon tot, verstorben, tatsächlich, wieder einer jammert nur am Telefon und das zehn Minuten lang, wiewohl er ein Freund ist und schafft es nicht, auch nur einmal zu fragen, wie es mir geht; der weitere, der dem Alkohol verfallen ist; die, die auf Stütze sind, die mit der Erbschaft, die sie verspielen vs. versaufen vs. verhuren vs. unnütz verwenden; die, die arbeiten und arbeiten und sich beschweren darüber; die alle beschweren sich, die NICHT im FRIEDEN mit sich sind. Wir sind doch Friedenskinder, frage ich mich früh morgens, verletzlich, was machen wir daraus? Frieden zu haben und zu halten, ist im Verhältnis zum Leben des Einzelnen zu sehen; gleichwohl nein; das, was ich versuche zu beschreiben, ist, dass wir alle Friedenskinder in Abwesenheit von Krieg, Gewalt und Leid sind, DAS haben sie alle gemeinsam, mag es dem Einzelnen gefühlt oder real auch besonders in diesen Jahren schlecht gehen.
Dann gibt es die, an die ich gar nicht denken will heute Morgen, als ich mich im Bad vor dem Spiegel sehe, mich unter die kalte Dusche stelle und zwei Mal langsam bis 20 zähle, weil das stets hilft. Was ist mit denen, denen es gut geht, wir müssen doch dankbar sein, weil wir reisen, trinken, essen, fühlen, wir haben keine Narben im Gesicht und am Rücken, wir müssen zufrieden sein, und doch – wir, viele unter uns, sind es gleichwohl NICHT, wir sind es nicht, wiewohl der Sturm, der Zyklon, der Taifun, alles um uns herum langsam zu tosen beginnt, wir sehen es, wir hören es, wir wissen es, wir CITOYENS der bestausgebildeten Art. Wir sind die, die nie wirklich Sorge haben mussten – was ist schon eine Depression, was ist ein kleineres Haus, was ist ein kleinerer Wagen, was ist Kleidung von der Stange, was ist ein überzogener Dispositionskredit, wenn er doch eingeräumt wird, was ist Arbeit, einfach zu arbeiten, gehen wir doch an die Stahlöfen, in die Bergwerke, in die Schmieden, an das Band, in die Fabriken, in die Produktion, in den Akkord, gehen wir doch dorthin, wo es schwierig war für die Eltern, die Großeltern und für die Urgroßeltern, für die es davor noch schwieriger war. Schauen wir in eine Zeit, als es darum ging, zu töten, zu leben, zu überleben. Heute ist es einfach. Heute ist es friedlich. Und was tun wir? Wir jammern. Wir sind halt nicht vom alten Schlage, so denke ich es mir, während ich im Hotel-Zimmer beim Ankleiden TV-Nachrichten aus einer verstörenden Welt sehe, wir hier sind nicht durch diese Härte gegangen, in Jahrhunderten, wie es die Generationen vor uns erlebten, wie es so viele Menschen noch heute erleiden, sie gehen noch heute überall in der Welt durch diese Härte. Wir? Viele, sehr viele von uns nicht.
Und dann denke ich: Was soll Ruhm, was soll Geld, was soll sogar Gesundheit, wenn, ja, wenn wir unverdient, ja, wenn wir UNVERDIENT das Kapital des Friedens der Eltern und Großeltern vielleicht Mark um Mark, Tat um Tat, Nicht-Tat um Nicht-Tat aufbrauchen, wenn wir es offenbar nicht schaffen, diesen Lebensalltag zu würdigen und daher zu erhalten. Sehen wir uns doch um, wir schaffen es nicht, dem Frieden gemäß die Leistung, die Stärke, die Entschiedenheit, die Klugheit aufzubringen, wir schaffen es nicht, die Demokratie zu würdigen und zu erhalten. Viele aus meiner Generation waren voller Chancen. Was haben wir daraus gemacht? Wir sind verteilt in die Welt, aufgeteilt in wankende Figuren bizarrer, selbstsüchtiger, narzisstischer Rollen, deren Vorbilder wir im TV, im Kino sehen. Wir sind Abbilder von Comicfiguren, Bilder eines kaum geplanten Lebens, hin- und hergeworfen ohne das wichtige Ziel zu sehen, in einem Spiel, das wir nicht mehr beherrschen.
Es gibt keinen Coffee To Go in diesem verdammten Hotel, jammere ich über diesen Morgen. Friedenskinder – ha! – sind am Morgen zerstörte Wesen, die sich erst später am Tag wieder zusammensetzen, … wenn sie die Kraft dazu aufbringen können … (Angie.) (Lights behind.) Schluss, was ist Schluss, was Anfang … Auf geht es, vergiss es. (Baby.)
Die Wiedertäufer waren in Münster, das weiß ich über diese Stadt. Eine radikale Gruppe des aufkommenden Protestantismus im 16. Jahrhundert, die der Vision verfallen waren, dass bald das Ende der Welt gekommen sei, die Apokalypse. Ja, daran glaubten sie, die Wiedertäufer, die in Münster in einem Blutbad aufgehalten wurden, ihre Sicht auf die Wahrheit weiter zu verbreiten. Es ist, das wissen manche Akademiker, eine Universitätsstadt, eine reiche Stadt, will ich vorausschicken, während ich mich auf die Anfahrt nach Münster mache. Ein weißer Audi fährt auf der Ruhrgebietsautobahn mit doppelter Geschwindigkeit an mir vorbei und überholt von rechts nach links, und das schon am frühen Morgen, anstrengend. Dann endlich nach einer Stunde die Einfahrt in die Stadt. Münster. Ein Schloss. Ein See. Die große Universitätsklinik, viele neue, große Gebäude, die sich mir aus dem Süden kommend zeigen. Das ist, wie mir jetzt auffällt, anders als im Vergleich zur letzten Anfahrt nach Münster vor vielen, vielen Jahren. Dann sehe ich die Fahrräder, überall Fahrradfahrer, die Fahrradstadt Münster, so viele, jetzt aufpassen beim Abbiegen nach links und bei den Ampeln und beim Kreuzen. Die Augen zusammenkneifen und beherrscht sein. Es darf ja nichts passieren. Ein heißer Tag ist angekündigt, es ist schon jetzt früh warm. Ich parke am Markt, ein öffentlicher Parkplatz mit Wachhäuschen. Ich gehe los. Will den Westfälischen Frieden finden, für den die Stadt steht. Erst einmal fallen mir die Menschen auf. Die Menschen um den Marktplatz herum sitzen bereits in den Cafés im Schatten. Ein Bettler singt. Oh Darling, Oh Darling, habe ich das recht verstanden? Ein Inder, denke ich. Ja, älter ist er schon. Ein Familienvater, denke ich. Er hat ein Tamburin in der Hand, sieht gepflegt aus, ein Singsang hallt über die Straße, Oh Darling, Oh Darling, verstehe ich, und es ist wirklich verwirrend, dass ein Bettler in diesem Alter um diese Zeit an diesem Platz diese Wörter singt.
Ich werde den Bettler noch an verschiedenen Stellen rund um das Rathaus immer wieder sehen und vor allem hören, wohin ich mich auch bewege an diesem Samstagvormittag. Eine Nonne geht vor mir, wie lange habe ich schon keine Nonne mehr gesehen in meinem säkularisierten Hamburg. Drei Kirchen sind augenblicklich in Sicht. Drei auf einem Fleck! Es sind noch mehr Kirchen, die sich zeigen werden. Es ist zu lernen, dass die vielen Kirchen von