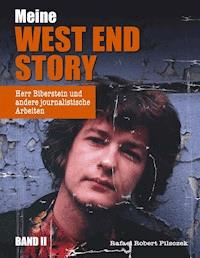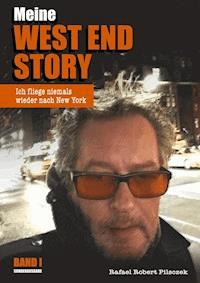
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Meine West End Story
- Sprache: Deutsch
Mit der Reportage unter dem Titel "Meine West End Story / Ich fliege niemals wieder nach New York" legt Rafael Robert Pilsczek den BAND I als Sonderausgabe seiner sachlichen Untersuchung der möglichen Antwort auf die Frage vor, ob der Westen, wie wir ihn kannten, an sein mögliches Ende gekommen ist. BAND I handelt vor allem von New York und Amerika, vom heutigen Berlin und dem alten Bonn als Sinnbild für das Leben im alten Westen. Mit den Erfahrungen aus mehreren Jahrzehnten als überzeugter Westerner ist BAND I für den Autor der vorläufige Schlusspunkt einer lebenslangen Recherche und Lernkurve, die ihn analytisch und biografisch begründet zu Gedanken der in diesem Jahrzehnt wohl größten Gefahr geführt hat, der Veränderung der offenen Gesellschaften des Westens in eine neue Epoche, wie sie davor nicht war. BAND II zu "Meine West End Story" gehört zwingend zur Berichterstattung und dem Ausloten des Themas hinzu und erscheint eigenständig. Mit BAND I Sonderausgabe legt der Autor sein fünftes Buch vor und hofft, dass seine Leser bedeutsame Hinweise aus dem Werk nehmen, die sie selbst befähigen, die für sie schlüssige, logische und wirkmächtige Antwort auf die wohl bedeutsamste Frage der Zeit für uns im Westen zu finden, ob dieser, wie wir ihn schätzten, am Auseinanderbrechen ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 875
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Widmung
Für meine Verwandten, Freunde und all die Roadies,
die mir Amerika nahebrachten.
So long, Marina und Russ Davis, Maryland, USA;
Ellen (in alle Ewigkeit) und David Rothstein, North-Hollywood, USA;
sowie dem lebenslangen Wegweiser Peter Opdemom, Bonn/USA.
Über den Autor
Mit der Reportage und Berichterstattung unter dem Titel „Meine West End Story / Ich fliege niemals wieder nach New York“ legt Rafael Robert Pilsczek den BAND I als Sonderausgabe seiner sachlichen Untersuchung der möglichen Antwort auf die Frage vor, ob der Westen, wie wir ihn kannten, an sein mögliches Ende gekommen ist. BAND I handelt vor allem von New York und Amerika, vom heutigen Berlin und dem alten Bonn als Sinnbild für das Leben im alten Westen. Mit den Erfahrungen aus mehreren Jahrzehnten als überzeugter Westerner ist BAND I für den Autor der vorläufige Schlusspunkt einer lebenslangen Recherche und Lernkurve, die ihn analytisch und biografisch begründet zu Gedanken der in diesem Jahrzehnt wohl größten Gefahr geführt hat, der Veränderung der offenen Gesellschaften des Westens in eine neue Epoche, wie sie davor nicht war. BAND II zu „Meine West End Story“ gehört zwingend zur Berichterstattung und dem Ausloten des Themas hinzu und erscheint eigenständig. Mit BAND I Sonderausgabe legt der Autor sein fünftes Buch vor und hofft, dass seine Leser bedeutsame Hinweise aus dem Werk nehmen, die sie selbst befähigen, die für sie schlüssige, logische und wirkmächtige Antwort auf die wohl bedeutsamste Frage der Zeit für uns im Westen zu finden, ob dieser, wie wir ihn schätzten, am Auseinanderbrechen ist.
Der Autor schaut in seinen Büchern und Werken in das Leben einzelner Menschen und zieht daraus Schlüsse auf das Leben selbst. Das zeigt sich in seinem dritten Buch „Friedenskinder“ (2015), das 70 Jahre Frieden in der höchst unwahrscheinlich längsten Zeit der Abwesenheit von Krieg, Gewalt und Leid in (West-)Deutschland beschreibt und die Gefahr, den Frieden dereinst zu verlieren. Es zeigt sich genauso im Popular-Fachbuch zur modernen Kommunikation, „Mehr Sein als Schein“ (2013) als auch in der groß angelegten Liebeserklärung an Menschen und die Begegnungen mit ihnen in „Wie ich 10 Tausend Menschen nah kam“ (2014). Im Herbst 2016 veröffentlichte der Autor sein literarisches Theaterstück, „Kriegskinder“, das als Drama und Zweipersonenstück mit Latina vor allem die stets aktuelle Frage fiktional behandelt, ob Demokraten zu Barbaren werden müssen, um sich der Barbaren zu erwehren.
In seinem bisherigen Leben zog der Autor, 1968 am Rande einer Kleinstadt am linken Niederrhein geboren, stets hinaus in die nahe und weite Welt in Europa, in Übersee und Arabien, um das stete Rätsel Mensch und damit letztlich sich selbst zu entschlüsseln. In vielen Lebenswelten erfolgreich unterwegs gewesen, als Journalist und Reporter, der in allen maßgeblichen Medien veröffentlicht hat, als Politiker, Dozent, Vereinsvorsitzender und heute ein erfolgreicher mittelständischer Unternehmer, vereint Rafael Robert Pilsczek besondere Erfahrungen in sich. Der studierte Literaturwissenschaftler und Philosoph hat aus den vielfältigen Erfahrungen und Fachthemen eine besondere inhaltliche und sprachliche Kompetenz darin entwickelt, die Welt anzuschauen und von ihr zu erzählen.
Fest in der europäischen Aufklärung verankert, versteht sich der Autor als entschiedener Gegenvertreter zur gleichaltrigen Spaßliteratur-Fraktion. So können alle fünf bisher erschienen Werke und Bücher als ernsthaft erarbeitete Versuche eines Gesamtwerks begriffen werden, da sie zuerst immer von einzelnen Begegnungen und ihrer kommunikativen Nähe zu Menschen ausgehen, die zusammengenommen dann mehr erzählen als nur von Einzelteilen des Lebens.
Der Autor lebt seit über zwei Dekaden im Hamburger Süden. Alle Bücher, herausgegeben von PPR Hamburg & Friends, sind über den stationären Buchhandel, auf iTunes oder Amazon als E-Book und als gebundene Ausgaben erhältlich. Lesungen führen den Autor durch ganz Deutschland und bis nach Amerika.
Zitate
„Die Sonne geht im Osten auf.
Im Westen gleichwohl lebt es sich
am Besten.“
(Am Ende des Westens, Venice Beach, L. A., im Sommer 1990.)
„Geht es euch gut?“
(Anruf in Amerika am 11. September 2001 um genau 15:17 Uhr.)
„Schön, dich wiederzusehen …
Du weißt, es wird schlimm
werden.“
(Tom Goodman, Times Square, New York City, im Winter 2016.)
Inhaltsverzeichnis
1
.
Tag: Samstag, den 3. Dezember 2016: New York City
Ich ziehe nicht als Erster
Mein Western, liebe Freunde, endet hier und jetzt
Berlin, Berlin
Ein großes X, das mir meinen Aufklärungsglauben zerstört
Vom Anfang des Endes, kein Reporter mehr zu sein
Bonn, das alte Bonn
Wo der Westen gut war
Wo der Westen auf jeden Fall nicht besonders schlecht war, wie wir heute wissen
2. Tag: Sonntag, den 4. Dezember 2016: New York City
In Blei gegossen
Warum Kunst genossen wird und so gut wie keine Folgen unter den Genießern auslöst
Berlin, Berlin
Auf einen Politiker treffen, der Hoffnung verschenkt
Warum sich viele tatsächlich abmühen, es gut zu machen, ist am Pariser Platz und drumherum zu besichtigen, das Beispiel Johannes Kahrs
Bonn, das alte Bonn
Wo Vorbilder landeten
Ein Raumschiff ist mir näher als ein Planet, weil es ja zu uns zurückkehrt
3. Tag: Montag, den 5. Dezember 2016: New York City
Wo ehrenwerte Müllmänner Gedanken und den ganzen Rest entsorgen
Willst du eine Achterbahn der Gefühle erleben, Junge, geh nach New York, geh in die Stadt der Städte
Berlin, Berlin
Eins, eins, auch meines?
Hymne auf eine Stadt, die nur schwerlich eine Heimstatt ist, und die Hymne auf den Berg, von dem aus gesehen Berlin und das Land so ganz anders erscheinen als damals im Jahr der Wiedervereinigung
Bonn, das alte Bonn
Diese Aufklärung hatte dort funktioniert
Wer gut groß wird, der kann sich das Schlechte kaum vorstellen, was es all überall gibt
4. Tag: Dienstag, den 6. Dezember 2016: New York City
Mein Land der Träume, damals
Wie ich auch in einen All Black-Club eintrat und mich mit denen stimmig fühlte, weil Amerika auch das für mich ist
Berlin, Berlin
Neue Zeiten gab’s dort viele
Gedanken während einer Fahrt an Stätten des Berliner Journalismus, begleitet von Von Wegen Lisbeth
Bonn, das alte Bonn
Strahlkraft dreier Städte
Wie anziehend der Westen bleibt, ob schwächer oder stärker, das scheint unvorhersagbar
5. Tag: Mittwoch, den 7. Dezember 2016: New York City
Alles gecrackt
New York 1990 gegen New York 2016 geschnitten und geschaut, was Freiheit von Gewalt in einer offenen Gesellschaft bedeutet
Berlin, Berlin
Dort geschah es
Gedanken zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin, als zwölf Menschen ermordet wurden, es 50 Verletzte gab und ein Land zu besichtigen war, das das Attentat eines Terroristen fast wie eine bereits alltägliche Randerscheinung rasch abhakte
Bonn, das alte Bonn
Räume, wunderbare Räume
Begegnungen mit Menschen des alten Westens, vor denen keiner Angst haben musste, wer die Türe in ihr Leben durchschritt
6. Tag: Donnerstag, den 8. Dezember 2016: New York City
100 Wall Street, wo ich las
Der neue gigantische Grand Canyon, der den Westen und seinen inneren Zusammenhalt gefährdet: Hinweise zu Supersupersuperreichen
Berlin, Berlin
Ein offenes Haus, ein offenes Land
Wer das Land dichtmachen will, sollte zurückschauen, was die Vorfahren taten
Bonn, das alte Bonn
Glaube mir
Von denen, die die Kirchen verlassen haben, und von denen, deren Helden heute alle irgendwann vom Sockel fallen
7. Tag: Freitag, den 9. Dezember 2016: New York City
Endlicher Spaß
Boten, die Stoffe bieten: Ein Abend mit Jeffrey, Wallace und einer Menge an Chemikalien, zu performen nach dem Song Da Da Da
Berlin, Berlin
Herr Gaul, deutscher Gentleman
Auch die Wirtschaft hofft, auch die Wirtschaft glaubt, auch die Wirtschaft will den Westen, wie wir ihn kannten, bewahren
Bonn, das alte Bonn
Das Totale
Vom Ende im Glauben, den Enden im Journalismus und dem Ende in einem Lied mit Villon
8. Tag: Samstag, den 10. Dezember 2016: New York City
Der Griff nach uns
Überspannt in Manhattan, weil der Zustand der Ausnahme im Westen zum Umstand der Regel wird, so langsam, dass die innere Feder stets mehr unter Spannung gerät
Berlin, Berlin
Gedanken zum größten Verbrechen an sich und anderen, der Gier
Soll ich Großes groß schreiben? Oder klein halten, da wahre Größe heute kleingeschrieben wird?
Bonn, das alte Bonn
An unserer Seite waren sie
Wir müssen über meine Generation reden. Wir haben keine Ausrede mehr
9. Tag: Sonntag, den 11. Dezember 2016: New York City
Aufstiege, Abstiege
Die offenen Gesellschaften lösten oft ein, dass es die Kinder besser hatten als ihre Eltern, und heute?
Berlin, Berlin
Kleine Ode an die Jugend
Warum auf die Älteren nie wirklich zu zählen war, wenn die Jüngeren den Älteren nicht sagten, wo es nun neu lang gehen muss
Bonn, das alte Bonn
Den Schlüssel nicht vergessen, mein Kind
Der Schriftsteller Heinrich Böll war die Stimme des alten Bonn. Von ihm zu lernen hieß, die offene Gesellschaft bleiben zu lernen und zu wissen, in welche Tür wir hereintreten wollen
10. Tag: Montag, den 12. Dezember 2016: New York City
Ich fliege in meine Heimat
Abschied aus der Stadt der Städte, die anders geworden ist als gedacht, und angekommen in einem Alter, das mich zu etwas anderem gemacht hat als gedacht
Berlin, Berlin
Und die Moral von der Geschicht‘?
In der Gedächtniskirche nehme ich auf der Bank Platz, und im Kumpelnest bin ich bei ein paar Außenseitern, an denen sich das große Ganze misst
Bonn, das alte Bonn
Abschiede von einer Zeit, in der Frieden war
Bewahren, was gut war, verabschieden, was schlecht war. Eine neue Zeit bricht an
11. Tag: Dienstag, den 13. Dezember 2016: New York City-London-Hamburg
Keine Rückkehr, eine Heimkehr
ENDE BAND I Endlich in Deutschland angekommen sein, um erneut zu bleiben, weil es dort erstaunlich gut geworden ist
I.KAPITEL
1. Tag: Samstag, den 3. Dezember 2016: New York City
Ich ziehe nicht als Erster
Mein Western, liebe Freunde, endet hier und jetzt
Helfen nur Stoßgebete in diesen Tagen?
Ich sitze an einer Bartheke in Midtown und ihre Frage rührt mich augenblicklich vollkommen, weil sie tatsächlich umsonst gestellt ist. Ich bin wieder dort, wo der Westen, wie wir ihn kennen, die guten und schlechten Höhen seiner Geschichte bis fast an der Wolken Ende emporgezogen hat. Ich bin wieder dort, wo der Westen an den Wolken und damit vielleicht an Gott selbst kratzen will: Ich bin wieder in der Stadt der Städte, in New York City. Die ganzen letzten Wochen war es mir um die Frage gegangen, ob ich dorthin fliege werde. Die ganzen letzten Wochen hatte ich es mir überlegen müssen, wer dort wann wie welches Geld von mir will und was sonst noch an Ungemütlichkeiten auf mich zukommen, wenn ich auf meine Art nach New York aufbreche. Dann diese Frage.
Es schien alles zuerst so einfach gewesen zu sein. Während ich längst die Haltung eingenommen hatte, nicht mehr dorthin zu reisen, da ich kein Millionär bin, und nicht mehr dorthin reisen wollte, ohne als deutscher Europäer und Freund der USA eingeladen zu werden, hatte sich genau das Wunder ereignet.
Eine alte Jugendfreundin, die zu Wohlstand gekommen war, hatte mich in die Stadt eingeladen, in der wir vor über zwei Jahrzehnten Freunde gewesen waren, als wir jung, ich naiv und sie noch arm war. Wir hatten bereits getrennt die Flüge gebucht. Sie hatte das große Apartment, in dessen Küche wir kochen wollten und in der ich eine Heimstatt finden sollte, an einer ruhigen Straße in der Nähe des Times Square gebucht. Wir hatten Begegnungen abgesprochen und Pläne geschmiedet. Sie wollte mich in das Hit-Musical einladen, das weltweit Beachtung fand, und mir damit ein verspätetes Geburtstagsgeschenk machen. Die Karten dafür waren bereits anvisiert, obwohl die Abende auf lange Sicht ausverkauft waren und nur über besondere Kontakte zu einem besonders hohen Preis zu erhalten waren. Wir wollten Freunde sein und unsere Freundschaft in einem guten gegenseitigen Geben und Nehmen feiern.
So wollte ich dann doch erneut über den Atlantik an meinen alten Sehnsuchtsort fliegen. So wollte ich erneut nach New York zurückkehren, nachdem ich für mich längst entschieden hatte, dass diese Stadt nicht allein unter Hunderte von Millionären gefallen war (ich kenne die Anzahl derer), sondern längst unter nicht wenigen Milliardären (deren Anzahl auch bekannt ist) aufgeteilt war. Ich hatte lange darüber nachgedacht, es läge nur an mir, dass ich eben genügend Geld verdienen müsste, selbst wenn ich eben lediglich einfachst dort unterkommen wollte, wollte ich tatsächlich dorthin zurück. Nach Jahren, vielen Jahren, die angefüllt waren mit vielen Besuchen in den USA, hatte sich gleichwohl tatsächlich sodann das Gefühl von Wut entwickelt und Trotz, dass ich nicht mehr dorthin wollte als im ernsten Sinne relativ Armer, der nicht dorthin gehört; als Kurzzeit-Tourist in einem nur brauchbaren Hotel oder für nur wenige Tage als genügend wohl lebender Besucher. Die Stadt hatte sich weiter und weiter zu einem kosmischen Monster an Kosten und Preisen entwickelt, sodass sie damit unsichtbare Grenzen aus unsichtbarem Stacheldraht wie in einem Science-Fiction-Film wie nie zuvor durch ihre Straßen zog. Ich wollte dort nicht shoppen, ich war nicht reich, ich shoppe selten. Ich wollte meine Kreditkarte nicht blanko einem Hotelkonzern überlassen, wenn ich in einem seiner Hotels einchecke. Ich wollte nicht dorthin reisen, als wäre es der kurze, einzige Jahresurlaub eines Deutschen der Mittelklasse, ein teures Vergnügen oder so etwas. Ich wollte, wenn überhaupt und das entschieden, ein Teil dieser Stadt und seiner Menschen sein, und keiner der Financiers von immer noch mehr, die New Yorks touristische Glitzerwelt mit ihrem Geld bedienen, ohne die Stadt, ohne New York, zu leben. Ich wollte, vielleicht ist das anmaßend, kann sein, wieder ein wenig ein New Yorker sein, Weltbürger, einer von Guten dort. Den Guten dort, die es auch gibt.
So nahm ich die Einladung an und organisierte meinen Anteil daran und darum. Nur zwei Wochen vor der geplanten Hinreise entwickelte sich alles anders und schlecht. Aus Gründen, die ich kaum gut kurz erklären kann, sagte die Jugendfreundin schwankend … ab. Ich sagte ihr dann in der Folge eines Nachts am Telefon entschieden … ab. Ich brach mit ihr tatsächlich endgültig, da einer der wichtigsten Pflöcke, auf denen Freundschaft stehen muss, Verlässlichkeit ist – und sie doch lediglich ihr ewiges eigenes Muster von Nutzen und Benutzen zu meinem Nachteil erneut, wieder erneut auslebte. So brachte sie diesen Pflock, den man Verbindlichkeit nennt, derart ins Wanken, dass ich kein Vertrauen mehr darin hatte, anders als mit einer zutiefst unzuverlässigen, sogar stark gestörten Person ausgerechnet im Monster New York zu sein. Ich schickte sie in jenem letzten Telefonat in der Nacht zum Teufel und entschied für mich bitterlich, dass ich ohne Grund und Boden nicht nach New York reisen werde.
(Und dann, zu meiner größten Überraschung, ein weiteres Wunder, sagten meine Leute in Deutschland am nächsten Tag entschieden, als ich sagte, ich fahre nicht, dann sagten meine Leute entschieden, dann sagten generöse deutsche Menschen um mich herum: Flieg, Rafael, flieg dennoch, du willst es so sehr, das kriegen wir hin, flieg dennoch.)
Die Frau, die mich nun am ersten Abend nicht weit weg vom Times Square zu Tränen rührte, war keine besondere in dem Sinne, dass sie besonders reich oder besonders arm zu sein schien, weder besonders hübsch noch besonders unattraktiv. Sie war in die Bar mit dem bezeichnenden Namen „The Three Wise Monkeys“ nach mir hereingetreten. In ihrem Schlepptau waren weitere drei Endvierziger, die allesamt nun im Dezember 2016 Weihnachtsmützen trugen und bei guter Laune auf einem Ausflug in die große Stadt waren. Sie kamen aus Massachusetts, waren allesamt verheiratet und waren Mütter. Sie kamen in die Bar, die stolz darauf ist, am Eingang Statuen der drei vorgeblich weisen Affen zu präsentieren, die genau das taten, was ich, fast zu meinem Bedauern heute, nie wirklich insgesamt in meinem Leben getan hatte. Der eine hielt sich, in eine Plastik gegossen, die Ohren zu. Der zweite hielt sich mit der flachen Hand den Mund zu. Und der dritte Affe sah nicht in die Welt, weil er beide Hände vor die Augen geschlagen hatte. Die Amerikanerin und ich kamen ins Gespräch, weil neben mir an der ansonsten voll besetzten Bar noch Plätze frei waren und ich gerne zuhöre, ich gerne rede und auch nach links und rechts schauen kann.
Ich hatte bereits ein Helles getrunken, eines dieser typischen amerikanischen, weichen und limonadeartigen Biere, wie ich sie seit meiner ersten Reise in die USA immer dort gemocht hatte. Über der Bartheke schaute ich müde und stets angelockt von den fließenden Bildern auf die verschiedenen TV-Bildschirme hinauf, die stumm Football, Baseball und News boten. Ich war im Grunde erschöpft, da ich viele Stunden auf den Beinen war. In der Nacht zuvor war ich in Hamburg aufgebrochen. Nun war ich am frühen Abend des nächsten Tages an meinem ersten New York-Tag in dieser Bar angekommen und nahm mir vor, erst um so 23:00 Uhr Ortszeit in meinem ärmlichen Zimmer zurück in Harlem zu sein. Ich wollte durchhalten und normal spät schlafen gehen, damit ich den Jetlag, also die Zeitverschiebung zwischen Mitteleuropa und der Ostküste der USA, gut überstehe und durch das Annehmen des ortsüblichen Zeitrhythmus den Jetlag, gelernt ist gelernt, kille, also besiege. Nicht ich hatte die Ostküsten-Frau angesprochen. Sie sprach mich an.
Als wir uns gegenseitig vorstellen und dabei die Hand reichen, ich aus Deutschland, sie aus einer US-Kleinstadt, schaut sie derart offen und zugewandt in meine Augen, so unbekümmert und so unvoreingenommen, dass es mich sofort an so viele gute Begegnungen in diesem Land erinnert, die ich in vielen Jahren in den USA erleben durfte. Schnell finden wir die grundlegenden Themen und nichts anderes, hey, es war die beginnende Weihnachtszeit, hey, es war kalt draußen, hey, es war die Zeit vor einem der höchsten Festtage der Christenheit. Wir sprachen in Stichworten von Krankheit, Partnern, Kindern, Liebe, von Weihnachtsthemen eben, also alles rund um den schönen Dreiklang des Christentums, den Wörtern und seinen Inhalten von Glaube, Liebe und Hoffnung. Sie und ihre Freundinnen hatten wohl noch einmal kurz in eine Bar gewollt, erfahre ich, nachdem sie den ganzen Samstag unterwegs gewesen waren und sich hier und dort in Manhattan umgeschaut hatten.
Die anderen drei lachen neben uns beiden frei auf, während wir reden. Sie flachsen untereinander. Sie essen etwas und wollen dann, wie ich lerne, alle gemeinsam den Bus gleich am Abend zurück in ihre Kleinstadt nehmen. Die Frau links von mir pendelt kaum zwischen den anderen und mir hin und her. Sie schenkt mir stets genügend Aufmerksamkeit, ohne dass ihre Freundinnen das offenbar als komisch wahrnehmen, dass sie sich mit mir angeregt unterhält.
Mir war die ganze letzte, schlaflose Nacht auf dem Weg nach New York in den Knochen und mir waren die vielen Tage davor in Deutschland bereits derart grundlegend in meinem Leben vorgekommen, dazu das neue zusätzliche Tosen in der Welt nach der kürzlichen Wahl von Donald Trump zum 45. Präsidenten der USA, dass ich ihr jetzt in der Bar sachlich und gelernt ernsthaft beichte, dass ich kein Gläubiger bin, kaum einen überhöhten Glauben habe, ein kläglicher, hoffnungsloser Fall für all das bin, was sie mit ihrer katholischen Familie und ihren katholischen Freundinnen lebt, wie sie es für sich mir erklärt. Sie fragt nach, warum ich nicht glaube. Ich erkläre, warum das so ist, und dass ich es bedauere, nicht glauben zu können. Sie sagt, warum sie glaubt. Ich frage, wie geht das, Glauben? Sie sagt, ihr Glaube ist das lebenslange Größte, was ihr geschieht, der Glaube an Jesus, an Gott, den Heiligen Geist und den Glauben an das Gute und das Barmherzige in Jesus, in Gott, dem Heiligen Geist und in, auch das noch, das Gute im Menschen.
Naja, denke ich währenddessen ein wenig arrogant, ich weiß, ohne es ihr zu sagen, das, ja, überrascht mich nicht, was du sagst. Das kenne ich gut und habe ich oft erzählt bekommen. Bekennende Gläubige sind sie gleichwohl alle Viere, das ist klar und offenbar. Ja, es sind gläubige, weiße Damen, vermutlich gute Mütter, gute Ehefrauen, die in ihrer Stadt dazu Aufgaben des Ehrenamtes übernehmen, typische Mittelklasse-Amerikaner, denen es noch gut geht. Ich, denke ich weiter, habe zwar nie den Song „Obviously Five Believers“ der US-Legende Bob Dylan verstanden, an den ich jetzt denken muss. Dass dort gleichwohl vier gläubige Damen auf einmal in einer Freundesgruppe auf einem kleinen Ausflug voller Freude und in großer Harmlosigkeit in Manhattan sind, das verstehe ich wohl, bei Dylan sind es halt Fünfe, was macht das schon im Song zu einem Unterschied für mich, und ich denke, hey, das ist sehr schön auf eine bestimmte Art, denke ich, wie die Viere so sind und so leben. Also, alles wie gehabt, denke ich.
Ich denke gleichwohl falsch. Mal wieder falsch. Mein Stolz und mein Vorurteil treten jetzt erneut in einem besonderen Moment zu Tage, sodass es augenblicklich vollkommen wehtut, mein langes, das für alle menschliche Drama von Stolz und Vorurteil, das mich und uns Menschen häufig in die falsche Richtung aufbrechen lässt.
Sodann sagt sie etwas, was mich unvorbereitet trifft. Sodann packt diese freundliche Gestalt mit nur einer Frage mein innerstes Herz derart auseinander, eine Frage an mich, die ich in meinem Leben seit Jahrzehnten nicht mehr gehört habe, sodass ich kaum einatmen kann, während sofort Tränen in meine Augen schießen, als wäre alles von einer höheren Macht für diesen einen Moment in dieser Bar in Midtown vorbereitet worden. Sie, ich weiß ihren Namen nicht mehr, beugt sich ein wenig zu mir herüber. Sie fragt, und das auch noch unaufdringlich, muss ich hinzufügen, im Ton sanft, in der Sache überzeugt, ohne einen Scheiß dabei, nur menschlich gemeint und offenbar zärtlich die Menschen liebend. Sie sagt, ohne mich bekehren zu wollen:
„Darf ich für dich heute beten, Rafael?
Darf ich? Heute?
Gleich?
Für dich beten, Rafael?“
So fragt mich dann diese Amerikanerin aus Massachusetts zu Anfang meines New York-Abenteuers in der Bar, in der ich eingekehrt war, nur damit ich wach bleibe. Sie schenkt mir damit augenblicklich tatsächlich einen besonders kostbaren Moment, ein Gefühl von großer Bedeutung jetzt, ohne etwas anderes dafür zu verlangen, in der Stadt der Gier, wie ich sie vor allem kenne, als dass ich über die Antwort ernsthaft nachdenke. Was soll ich ihr antworten, frage ich mich.
***
Auf den Erfolg unserer hoffnungslosen Mission
Zuerst fühle ich mich hilflos. Ich, der ich wie so viele neue andere Sorgen um die kleinen und großen Welten gewonnen habe, in der Welt, in Europa, in den USA und für uns alle in Deutschland; ich, der ich nicht an Aberglaube, an Spiritualismus oder an ein höheres Wesen glaube; ich, der ich ein Buch geschrieben habe, das die Ängste vor der Zukunft in Europa und in Deutschland inhaliert hat; ich, der ich katholisch groß geworden bin und Messdiener war und voller Hass und Schuldgefühl auf mich selbst bin, weil ich Messdiener und Katholik als Kind gewesen war; ich, der ich frühestmöglich austrat aus der Kirche und den Weg in die Ratio, in die Philosophie und in die Mitte der Realität und der Normalität suchte; ich, der ich nun ein Buch schreibe über das mögliche Versagen des Westens in uns und um uns und sein mögliches Ende; ich, der ich nicht denke, dass ich besonders bin, nicht besonders klug, nur darin besonders geeignet, kleinste Welten zu führen; ich, der ich durch Zufall zur richtigen Zeit für einen Schriftsteller in New York bin, kurz nachdem der Milliardär Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wurde, und vieles, wenn nicht alles anders unter uns westlichen Staaten und Freunden beginnen wird.
So geht es weiter in mir. Ich, der ich zwanghaft klären möchte, wenn ein Geräusch unbestimmt ist neben und hinter mir, weil es mich irritiert, wenn ich darüber nicht Bescheid weiß; ich, der ich ein westlicher, ein überzeugter deutscher Europäer bin und versuche, es noch zu sein; ich, der ich anderen ihre Fantasien, ihre Dämonen und Unklarheiten stets auszutreiben versuche, damit es ihnen besser geht; ich, der ich Sozialdemokrat sein möchte und doch voller Zweifel bin an dem, was demokratischer Sozialismus heute ist, und stets zwischen Reform und Revolution wanke; ich, ja, der ich Journalist war, Politiker und Lehrer und nun Unternehmer bin und tief in der Idee der Aufklärung verankert sein möchte; ich, der ich verwurzelt bin im Gedanken, dass der Verstand das beste Mittel ist, Frieden zu schaffen, wenn er nur genügend mit Informationen bedient ist; ich, der ich an Fakten und Wissen und Bildung glauben will, dass es das Beste ist, was unter uns Menschen Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit bringt; ich, ja, und so weiter; ich, der ich nun in Manhattan bin und sich doch alleine fühlt, verlassen, einsam, lediglich funktionieren will, will ich die nächsten zehn Tage dort in diesem Monster hinkriegen.
Ja, ich weiß: Ich, der ich an dieser Stelle in meinem Büchlein viel „ich“ sage und nicht viel „wir“ gerade und „ihr“ und „sie“ und „er“, sondern „ich“; ich, der sich dort trotz allem endgültig wieder einmal als ein geschlossenes Ich empfindet, als kompletten Menschen und reifen Erwachsenen, der kein Kind mehr ist, das Angst vor dem Einschlafen hat im Zimmer voller Schatten; ich, der ich kein Reporter, kein Suchender, kein Aufnehmender mehr sein will; ich, der ich vom Rest der Welt fast die Nase voll habe; ich, der ich nicht Anteile anderer mehr in mich aufnehmen will und muss, weil alles drin ist in mir und sortiert und gut abgewogen und mit starken Brandschutzwänden versehen, die mir erlauben, auszusenden und eine starke Säule geworden zu sein, ein fertiger Mensch mit allem drum und dran; ich, der nicht betet und nicht Gott verehre, nicht Allah, nicht Jahwe und nicht Buddha verehre; ich, der nicht an etwas glaubt, außer es wäre von den Wissenschaften, von den Fakten-Prüfern und von mir selbst recherchiert und bewiesen; ich, der ich den Selbstmord wieder als Möglichkeit und Ausdruck des freien Willens, das tägliche Versagen als notwendiges Erleben und den Tod und die Widersprüche in uns und um uns herum als endgültig ansehe; ich, ja, es tut mir leid, so häufig „ich“ zu schreiben; ich meine es so, doch: Doch nein, es ist mir nicht egal, es ist mein Leben, meine Botschaft: Ich weiß doch, dass ich gut bin; ich weiß doch auch, ich bin erwiesenermaßen kein Egomane, kein Narziss, kein Gestörter; nein, ich nicht.
Ich bin, als sie mich, ein Menschlein, ein Menschlein in einer Bar fragt, ich bin sofort, augenblicklich vollkommen unter Tränen; mein innerstes Herz ist sofort so schön, so liebevoll, so wärmend …
… ausgepackt.
Es ist ihr nicht peinlich, dass ich träne. So schaue ich ihr lange in die Augen, ich erkenne die Farben ihrer Augen nicht gut in dem schummrigen Licht der Bar, und sage ihr etwas, nachdem ich den Preis gezahlt habe, den sie wollte und der nicht hoch war. Ich sage ihr etwas liebes, nachdem ich schnellstens und doch lange nachgedacht habe; ich weiß, dass ich in diesem Moment erneut begreife, dass all die Vernunft und all das Normale und all das Materielle und all das Physische nicht ausreichen, damit wir das mögliche Ende des Westens als Anfang hoffnungsvoll begreifen und nicht als sein mögliches hoffnungsloses Ende und hoffnungslos werden; ich sage ihr klar und eindeutig eine Antwort, die mich selbst nicht zu meinem Erstaunen überrascht, sondern eine Hoffnung darin hat, dass sie mir ihre Frage zu einem Schatz, einen Wert und als Blick in das Licht macht, das im Gegensatz zu den neuen Verdüsterungen in der Welt steht, wie ich es und viel andere derzeit sehen.
Ich sage ihr:
„Ja, bete gerne für mich …
… gerne sogar …“
Sie sagt dann, weil es wohl so für sie passt, und sie meint es ernst, weiß ich sicher:
„Dann, …
… dann bete ich für dich, Rafael …
… noch heute bete ich für dich, lieber Rafael.“
Nur wenig später müssen die vier Damen bezahlen und die Bar verlassen. Sie müssen ihren Bus pünktlich erreichen, sie haben die Fahrkarten dafür. Ich gebe ihr noch meine Visitenkarte mit dem Hinweis, dass, wenn ihre Kinder durch Westeuropa reisen, ich diese gerne unterstütze. Sie bedankt sich und wünscht mir alles Gute. Sie sagt erneut, sie wird für mich beten. Wir geben uns die Hand, ich wünsche ihr alles Gute, dann verschwindet sie in ihrer kleinen Gruppe, die Weihnachtsmütze auf dem Kopf, durch die Türe und an den Statuen vorbei in die Nacht von Midtown, Manhattan, und ich bleibe mit mir alleine zurück in der Bar …
… und nicht alleine bin ich mehr in der Bar, weil da jemand ist, der für mich heute Abend beten wird.
Ich danke ihr. Die Dame aus Massachusetts hat mich, ohne es zu wissen, befähigt, den Anfang meiner West End Story zu finden. Ich beginne jetzt zu schreiben, wird mir klar, dort wieder allein an der Bar-Theke in Midtown sitzend. Ich weiß, was ich zu Anfang meines Büchleins tun muss … Jetzt in diesem Moment weiß ich, was ich erzählen will. Ich muss glauben, nicht lediglich wissen. Ich muss nicht informiert sein, ich muss fühlen, was zu tun ist. Ich muss hoffen, nicht verzweifeln. Ich muss in der Mitte bleiben, nicht an den Rand ziehen. Ich muss sein wollen, wie ich bin und nicht, wie andere sind. Ich muss, ich will, ich soll. Alles gut, sage ich mir für einen gar nicht so kurzen Moment.
Die russische Dichterin Alina hatte mir einst in Moskau Ende der 90er in einer Bar zugeprostet: Nastrowje, Rafael, auf den Erfolg unserer hoffnungslosen Mission. Damals lehnte ich es ab, über einen derart absurden Spruch ernsthaft nachzudenken, wiewohl ich ihn in der Reportage über sie einpflegen wollte. Ich muss, wenn ich jetzt den Anfang meines Büchleins schreibe, an ihre absurde Zeile denken. Sie, die im Gefängnis war, ohne eine Verbrecherin gewesen zu sein, hatte die Absurdität eines Mischmaschs von Westen, Osten, Norden und Süden aufgesogen, das Konglomerat von allem, was damals schon in Moskau nicht zusammenpasste, also, sie hatte sich innerlich vom allem distanziert, was klar war, um im russischen Gefängnis klar zu kommen; sie, weiterhin, war damals, so scheint es mir, viel weiter, als ich noch heute nicht bin. Ich denke nun, da ich das schreibe, an sie. Ich weiß nicht, wie es ihr später ergangen ist. Ich rufe ihr jetzt gleichwohl aus der Entfernung von Jahren zu: Alina, ja, Nastrowje, auf den Erfolg nun auch meiner hoffnungslosen Mission. Wo ist die Klarheit, wenn viele unklar sind? Wo ist die Haltung, wenn ein Mischmach bei vielen Haltungsschäden hervorruft? Wo ist der Anker, der Rahmen und das Genaue, das uns führt, nun, da Lüge und Wahrheit, Fakten und Unfakten fast gleichberechtigt in der Welt öffentlich nebeneinander stehen? Dank, sage ich dort zu Alina, und sei verflucht, dass ich manchmal heute dort bin, wo du früher warst, ohne dass ich befürchte zu erleiden, was du erlitten hast.
***
Ein Bett, ein Sofa und eine Heizung zu haben, das muss doch reichen in dieser Stadt
Nun war ich einer von rund 60 Millionen Gästen, die New York 2016 besuchten. Die Grenze von 60 Millionen Gästen war erst kürzlich überschritten worden, wie das örtliche Fremdenverkehrsamt mitteilte. Also, warum sollte ich mir denken, ich wäre ein besonderer Gast? Zumindest war ich einer derjenigen, die dort unterkamen, wo es nicht so viele der Touristen hin verschlägt: im nördlichsten Harlem, weit oberhalb eines inzwischen besseren südlichen Harlem, wo der ehemalige US-Präsident Bill Clinton vor Jahren sein Büro eröffnete und den vermutlich bescheidenen Boom an Erneuerung auslöste. Auf einem Übernachtungsportal hatte ich bei „Charles“ das Zimmer für 59 Dollar die Nacht buchen lassen. Da es sehr kurzfristig war und ich Gottvertrauen in das bessere Harlem hatte, von dem ich las, kümmerte mich die eigentliche Adresse nicht. Mich kümmerte allein der Preis, den ich bereit und fähig war dafür zu zahlen, und mein Budget dafür, all das zu machen, was ich in Manhattan machen wollte.
Ich hatte mir in Altona eine für Harlem passende einfache Kapuzenjacke gekauft, trug meine schwere, pechschwarze Seemannsjacke und trug meine wahlweise als schön oder als unauffällig angesehenen Schuhe, je nachdem so wahrgenommen, wo ich war. Ich nahm mir vor, während des gesamten Aufenthaltes meine dafür gemachte Brille mit tieforangefarbenen Gläsern zu tragen, da ich weich wirken und unerkannt in die Welt schauen wollte und zugleich als recht unnahbar wirken wollte und weil ich annahm, dass diese Brille in New York nun keinerlei komische Fragen hervorbrachte, während es in Deutschland so war, dass ich gefragt werde, ob ich eine Augenkrankheit habe, wenn ich eine solche Brille trage. Mich begleitete eine Reisetasche mit viel Symbolkraft für mich, die ich 1990 für recht viel Geld in meiner Heimatstadt gekauft hatte und die damals bereits meine Tasche für – meine erste – USA-Reise gewesen war. Sie war aus starkem PVC und ihre Reißverschlüsse verzahnten sich noch 26 Jahre später verlässlich gut. Als ich in Hamburg abhob, fiel – ich meine, zum ersten Mal auf solchen Reisen – die deutsche Anspannung nicht merklich ab und die innere Freude, die sich sonst stets belegbar einstellte, kam nicht als wärmender Klumpen in mir auf. Warum ich nach New York flog, wusste ich auf dem Weg nach London auch nicht mehr wirklich. Es hatte sich zu viel in der Welt und vermutlich auch in der Welt meines Kopfes verändert.
In London gelandet, am Flughafen von Heathrow, führten über 20 verschiedene wegweisende Flughafenbedienstete uns Ankommende die Gänge zum Gate entlang, teilweise waren die Gänge Baustellen mit herunterhängenden Kabeln von den Decken und umrahmt von hilflos aufgestellten Holzwänden an den Seiten. Wir, die wir aus Hamburg ankamen, hatten keine Gelegenheit zum Verschnaufen. Wir sahen nicht einen einzigen aufmunternden Shoppingbereich, nicht ein einziges brauchbares Restaurant noch ein einziges brauchbares Café. Ich weiß nicht, warum das so war, tatsächlich war es fast so, als ob die Reisenden in die USA bewusst abseits der mir sonst bekannten schönen Bereiche des Londoner Großflughafens streng, fast ein wenig unhöflich und stets erneut und erneut kontrolliert die schlechten Gänge entlang zum Gate geführt wurden. Es gab zudem ein paar Schwierigkeiten, die es sich gleichwohl nicht lohnt zu erzählen.
Schließlich bestiegen wir alle das Flugzeug und hoben ab nach Übersee. Während des Fluges verkürzten sich viele, darunter auch ich, die Flugzeit, indem sie die neuesten oder auch die alten Hollywood-Blockbuster auf den kleinen Bildschirmen stur und stetig schauten, die auf der Rückseite der Vordersitze als Kommunikationssystem eingebaut waren. Solche Systeme helfen, die Flugzeit zu verkürzen. Sie beruhigen auch solche, die während der Flüge vielleicht ungeduldig, übellaunig oder Schlimmeres waren. 1990, während meiner ersten Reise in die USA, sah ich noch in den Kinos Kinofilme, die erst Monate später in die deutschen Kinos gelangten. Diesen Zeitvorteil nutzten junge Leute wie ich damals, bereits besser Bescheid zu wissen. Besser Bescheid darüber zu wissen, was noch in die deutschen Kinos kommt, war wie eine kleine Auszeichnung, die, zurückgekehrt, Leute wie mich für manche damals in Deutschland noch ein wenig interessanter machten. Nun liefen Filme auf dem Flug nach New York, die in Deutschland bereits in den Kinos liefen oder bereits online zu laden waren. Nun, am Samstag, den 3. Dezember 2016, war alles wenig gewohnt schön, eher vieles überraschend hässlich.
Sogar die Stewardessen und Stewards erschienen mir grob und übellaunig, was mir selten auf Flügen geschehen war, was ich gleichwohl bestens verstand, als jemand, der die Veränderung der Arbeitsbedingungen eines solchen Berufes in den letzten 20 Jahren hautnah miterlebt und über solche Veränderungen wenig Gutes gelesen und gelernt hat. Dazu einen Flug nach New York zu betreuen, in die Großstadt, die tatsächlich das Hauptziel auch des Terrorismus war und bis heute ist, mag auch den Glanz und die Freude kaum noch vermitteln, die solche Damen und Herren und Leute wie ich verspürten, als wir früher und vor den Anschlägen und dem ganzen Scheiß dorthin flogen. Es hat sich allein für Einreisende aus Deutschland sehr viel zum Schlechteren verändert, seit Leute wie ich 1990 und später auch dort in den USA waren; alles ist bekannt, und meine Sehnsucht nach Amerika war damals noch während der Einreisephase mit vielen schönen Erlebnissen und Geschehnissen unterfüttert worden. Nun, als ich später mit trommelnden Kopfschmerzen durch die stets anstrengende Einwanderungsprozedur hindurch war, fand ich meinen Weg zu den Taxisund nahm nun einen Teil meiner Fahrt gemeinsam mit einer deutschen Mutter und ihrer Tochter, die mit aus Hamburg hergekommen waren, zur westlichen Seite des Central Parks, wo sie ihr Hotel hatten, und wir teilten uns dadurch den Pauschalpreis der Fahrt. Als ich dann dort in einem Café schließlich online Kontakt aufnehmen konnte mit meinem Vermieter und nun, als ich dann selbst abermals ein Taxi nahm, ich war zu erschöpft für die Subway, verschwitzt und mutlos, fuhr mein zweiter Taxifahrer stetig beunruhigend weiter Richtung Norden, immer weiter nach oben von Manhattan bis an das nördliche Ende von Harlem.
Wir fuhren Block um Block, ich schaute hinaus und erkannte, dass die Gegend ärmlicher wurde und der Taxifahrer trotz Navigationsgerät zudem mehrfach kreuzen musste, weil er den Weg nicht fand. Also, als ich dann schließlich das Taxi an der West 147. Straße verließ, also, als die Anreise endlich zu ihrem Ende kam, da verließ mich all das, was noch an Rest von US-Freude in mir war. Die geringe Vorfreude sank auf null Grad und die Überzeugung, den Westen erneut auf eine schöne Art zu erobern, kühlte auf unter null ab. Warum das so war? Weil ich müde war? Oder wegen eines größeren Themas? Weil ich nicht wohlhabend in Manhattan lebte oder weil der Zeitstrom, in dem wir alle waren, allen Druck und alle Sorgen zu einem Klumpen von Beklemmung zusammenpresste? Oder weil ich einfach nicht kapierte, dass die großen Verdüsterungen im Grunde nichts mit mir zu tun hatten? Oder weil der Westen hüben wie drüben, wie ich ihn kannte, so genau wie ich ihn kannte, sich wirklich in den letzten Jahren in seine bloßen Einzelteile aufzulösen und unwirklich wie im Nebel zu etwas Ungreifbarem und zu etwas Gespenstischem aufzulösen begann? Oder weil ich älter, bitterer und ohne große verbliebenen Illusionen geworden war? Oder weil mein Thema, das Sinken all dessen, was gut um uns herum war, wirklich eine Tatsachenbeschreibung geworden war?
Nun, an der 147. Straße angekommen, stieg ich aus dem Taxis und war vor den Stufen des mittelgroßen Hochhauses angekommen, in dem ich wohnen sollte. Zuerst rauchte ich recht zittrig eine Zigarette und traute mich nicht, mich in der Straße umzuschauen, weil ich keinen der Blicke der Menschen dort mit Blicken auf mich ziehen wollte. Ich ging recht schwer atmend die neun breiten Stufen mit einem mulmigen Gefühl hinauf … und hatte keinerlei Begeisterung mehr in mir, dort meine Unterkunft aufzusuchen.
Mein amerikanischer Western, wenn man so will, hatte vor 26 Jahren begonnen, als ich von meinem Onkel am John F. Kennedy-Flughafen in New York liebevoll abgeholt wurde und eine der schönsten Zeiten meines Lebens ausgerechnet in den USA begann. Nun musste ich Charles anrufen, dass er vom 5. Stock herunterkommt und die verrostete, große, vergitterte Haustüre für mich von innen öffnete. Er kam herunter und führte mich sehr freundlich die Treppen hoch und in seine kleine Wohnung. Charles zeigte mir mein Zimmer und gab mir die Schlüssel zum Apartment, Türnummer P5, sowie die Hausschlüssel. Er zeigte mir die Küche, gab mir das Internet-Passwort und erklärte, dass ich drei Blocks weiter die Subway-Station vorfinde, die mich in einem Schnellzug rasch nach Midtown bringt. Er sagte auch, dass ich bestimmt eine gute Zeit in New York haben und ich ihn immer fragen könnte, falls ich eine Frage habe. Mein Zimmer hatte ein Bett, ein Sofa und einen kleinen Tisch, den Charles für mich aufbaute, als er erfuhr, dass ich zum Schreiben gekommen war. Er erzählte noch, dass er Christ ist, sich um Gangmitglieder und Arme und so kümmert. Er sagte, er arbeitet von zu Hause im EDV-Bereich und halte in verschiedenen Kirchen regelmäßig Predigten. Ich sagte, ich bin dankbar für das Zimmer und seine Freundlichkeit. Ich ruhte eine halbe Stunde aus, nachdem Charles in sein Zimmer am Ende des schmalen Flures seiner Wohnung verschwunden war.
Dann nahm ich alles, was ich brauchte, und machte mich, in die Kapuzenjacke gewickelt und bebrillt und ohne Tasche, auf den Weg zur Subway-Station. Auf dem Weg dorthin schaute ich nicht hoch, außer ich musste, damit ich die Ampeln und alles andere mitkriegte, was mir den Weg zeigte. Ich sah tatsächlich für mich zu viele Cops auf dem Weg, zwei, drei Streifenwagen fuhren hin und her, ich erkannte den Supermarkt an einer Ecke und fand recht wenige Menschen an diesem Samstagnachmittag auf den Fußgängerwegen vor. Die allermeisten, die ich wahrnahm, waren Afroamerikaner, also schwarz, und ich entschied mich dafür, dass das jetzt mein Kiez, mein Viertel war, meine Leute waren, ich also dazugehörte und mir deswegen nichts passierte. Ich zündete mir eine Zigarette an und hielt sie möglichst unauffällig eng am Körper, damit möglichst niemand mich um eine Kippe bat. Ich musste an den Arbeitstitel eines Buches denken, das mir kürzlich irgendwie online unter die Augen gekommen war. Der Arbeitstitel war sehr wahr geworden, immer wenn ich auf das Leben von so vielen um mich herum in Deutschland und woanders genau schaue. Der Titel hieß: „Das Zeitalter der Überforderung“. Ich dachte, als ich die Treppen hinunter in die U-Bahnstation nahm, hey, sieh die Wahrheit, du bist in New York, du bist alt geworden, du bist überfordert. Es war vielleicht immer so, dass es für meine Eltern und Großeltern auch gegolten hatte, dass sie überfordert waren, klar. Von der Überforderung, in Kriegszeiten Kinder gewesen zu sein, gar zu schweigen. Es war gleichwohl auch wahr, dass es jetzt am späten Nachmittag in New York auch für mich zutraf, dass ich überfordert war. Ich hielt mich am Geländer die Treppen hinunter fest, atmete tief ein und atmete tief aus und war im Untergrund, in der Metrostation verschwunden.
Den Rest habe ich erzählt. Als die Damen aus Massachusetts gegangen waren, später am Abend, war es auch bald an mir zu gehen. Nach einem weiteren Hellen verließ auch ich am Abend in Midtown das „The Three Wise Monkeys“ und … ging immerhin innerlich und äußerlich gewärmt lächelnd zurück in die kalte Nacht von Manhattan, wo die Lichter grell und viele derer dort waren und das Bier sehr, sehr teuer war. Ich warf ihr, als ich mich auf den Weg machte an die 147. Straße und meinen Kragen vor dem Eingang der Bar hochschlug, auf den Straßen von New York einen Handkuss zu. Ich wischte mir die letzten Tränen endgültig aus dem Gesicht. Ich nahm dann den Weg zurück in meinen Teil von Harlem, wo es wenig Lichter und wenige Werbeschilder auf den Straßen gab. Ich fand schließlich meine Straße und ging auf mein Zimmer, das für die nächsten zehn Tage meine Schlafstätte in New York war. Ich dachte, bevor ich einschlief, hey, so weit oben von Manhattan war ich, dass, so bin ich mir sicher, meine mir liebe Dame, die für mich heute betete, und ihre Freundinnen sicherlich noch nie dort waren und vermutlich dort nie sein werden.
Ich fiel in einen tiefen, traumlosen Schlaf.
***
II.KAPITEL
Berlin, Berlin
Ein großes X, das mir meinen Aufklärungsglauben zerstört
Vom Anfang des Endes, kein Reporter mehr zu sein
Die Hauptstadt zu denken, verlangt erst einmal nach grundlegenden Gedanken
Ich wollte bereits als Kind von zehn Jahren Journalist und genauer: Reporter werden. Seit ich ein Kind war, hatte ich stets alle Räume auch verlassen, in denen ich schlief oder sein musste. Als Kind war ich oft draußen auf den Weizenfeldern und legte mich auf denen in die Sonne, wenn ich mir den goldenen Weizen zu einem Ruheplatzplatt getreten hatte. Als Jugendlicher hatte ich bereits geschrieben und es begann, als ich als Karateka über Turniere und Trainingslager kleine Berichte verfasste. Als Erwachsener von 18 Jahren war ich bereits, und dafür hatte ich mich jahrelang vorbereitet, freier Mitarbeiter der Rheinischen Post in meiner Heimatregion. Warum ich Reporter geworden war, lässt sich selbstredend nicht einfach in zwei, drei Sätzen beschreiben. Ich denke, dass einer der tieferen Gründe der ist, dass ich nichts oder kaum etwas in mir hatte, als ich in die Welt und als Kind und als Jugendlicher und als Erwachsener in der Welt war. Ich konnte mir die Welt nicht vorstellen und hatte keine Fantasie in mir von ihr. Die Wirklichkeit, wie sie so war, was mir lange eher als eine große Truhe verschlossen, die schwere Schlösser trug. Ich wurde eben nicht früh Stück für Stück und Schritt für Schritt in die Wirklichkeit geführt. Ich war nicht gut begleitet und die Wirklichkeit war mir nicht so zugänglich wie bei vielen anderen und damit in allen Entwicklungsphasen passend und gesund zu einer guten Wirklichkeit gemacht. Also, eher aus der Mangelerfahrung heraus, dass ich das Füllhorn meines Lebens mit Wirklichkeit erst in einer großen Suche nach ihr füllen musste, damit sie überhaupt in mir als wirklich und griffig wäre, verließ ich stets alle Räume, in denen ich schlief und die Nächte verbrachte und in denen ich sein musste. Gott sei Dank ging ich stets hinaus vor die Türen und holte mir das ab, was die Welt mir anbot. Das Leben ist ein Angebot, sage ich jungen Freunden gerne, also nutze es … Es war tatsächlich meine Art, wie ich an der Welt und, das erst spät, an ihr gesundete.
So ist es gewesen, dass ich sehr lange keine Fantasie von der Welt in mir hatte und ich mich stets – im Grunde bis heute – aufmachte, dem, was da ist, eigene Wörter zu geben; dem, was ich sah, wirkliche eigene Bilder zu schenken; und dem, was ich da hörte, in mir zu einem Klang und zu Stimmen meines eigenen Orchesters mit mir als souveränem und, Entschuldigung, meisterlichem Dirigenten zu machen. Dass es auch andere Persönlichkeiten gibt, die gute Reporter oder was auch immer geworden sind, ohne die stete, fast bereits zwanghafte Suche nach dem, was dort vor der Haustüre so ist, ist mir sehr bewusst. Ich machte mich auf, weil ich in mir zu wenig hatte, was mich stark, fröhlich und fest gemacht hätte. Ein Grund für Traurigkeit ist das? Ist es traurig, dass ein Menschlein sich so sieht, dass er erst suchen musste, bevor er die Welt und sich fand? Dass er erst ein Schüler sein musste, um ein Meister zu werden? Dass er keine eigenen Antworten auf die Fragen um ihn herum hatte und daher erst Fragen stellte, damit er von Vielen Antworten bekam in der erlösenden Erwartung, dadurch seine eigenen Antworten zu finden? Nein, selbstredend ist es nicht ein trauriges Privileg, derart gelebt zu haben. Es ist hundertfach beschrieben, wie Kinder und Jugendliche und Erwachsene sich mittels ihrer eigenen Geschichte und der Suche nach ihrem Platz im Leben entwickeln. Es ist zugleich wenig beschrieben, denke ich, dass sehr häufig Entwicklungsgeschichten von Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen auch anders, in dem Sinne einfacher und ohne Not und Qual und Schmerz sich schreiben.
Mein Weg vor die Türen war stets vor allem ein Weg auch von Not und Qual und Schmerz. Ich bin heute sehr froh, dass meine Leidensfähigkeit groß genug war, sodass ich durch das Hindurchgehen all dessen doch noch zu einem kompletten Menschen geworden war. Dass dieser Weg nicht einer der schönsten ist, dass rufe ich denen zu, die ohne besondere Not und Qual und Schmerz komplette Menschen geworden sind, und ich bin frei von Neid auf diese, sondern vor allem erfüllt von Freude, dass diese diese kleinen und großen Höllen auf dem Weg zu einem kompletten Menschen in dieser hohen Anzahl, wie es Leute wie ich durchlebt haben, nicht erleben mussten. So schreibe ich heute am Ende eines langen Weges, 1968 am Rande einer Kleinstadt in Westdeutschland geboren, meine letzte Reportage in dem Sinne, dass ich weiß, dass ich nicht mehr suchen muss, was dort an Wahrheit, Wirklichkeit und Welt ist, weil alles, was ich an Wahrheit, Wirklichkeit und an Welt für mich in meinem Leben heute haben will, von mir in mir ausreichend aufgefüllt ist.
Mein Füllhorn ist reich gefüllt, ist gesättigt und reicht satt für den ganzen Rest meines Lebens. So war es keine besonders schwierige Aufgabe mehr, nach Berlin zu fahren und nachzuschauen, was dort am Bahnhof Zoo heute so los ist, nachdem das bekannte Buch über die jugendliche Junkie-Frau Christiane F., „Wir Kinder von Bahnhof Zoo“, eines meiner ersten Bücher war, dass mich in meinen Vorstellungen an die Orte brachte, an denen was los ist. Während meiner Ausbildungsjahre traf ich auf den Co-Autor dieses Buches und war nur froh, dass er mich in der Redaktion sehr gut behandelte und mir in seinem meisterlichen Umgang zeigte, dass auch ich es würdig war, an seiner Seite in einer Redaktion zu sein. Ich parke jetzt meinen Pkw am Los Angeles-Platz in Charlottenburg, West-Berlin, und gehe zu Fuß hinüber zum Bahnhof Zoo, der der Ort für uns früher gewesen ist, weit vor dem Mauerfall 1989, der vielleicht den besten Ort in West-Deutschland darstellt, den sich junge westdeutsche Reporter als Recherche-Ort nur denken konnten, weil der Star-Reporter Kai Hermann dort bereits gewesen war. Dann, an einem Samstag im Januar 2017, lasse ich nun das berühmte Kino West-Berlins rechts von mir liegen und tummele mich in der kleinen Region des Bahnhofes Zoo, in dem es früher einmal viel Schmutz, Dreck, Armut, Gewalt, Alkohol und Heroinabhängige und Stricherjungen und viele Obdachlose gegeben hat. Bahnhof Zoo, sind dort noch heute verlassene Kinder? Ich schaue nach.
***
Das ist Wahrheit, auch wenn uns Reportern heute der Zuspruch eines Immanuel Kant fehlt
Die Idee des ursprünglichen, angelsächsischen Journalismus, der auch die westdeutschen Verlage jahrzehntelang geprägt hat, war, dass die Welt und jeder einzelne Mensch dadurch besser wird, wenn die Reporter als Stellvertreter des Lesers hinausgehen und mit Informationen, Fakten und Eindrücken zurückkehren, um von ihren Erlebnissen wahrheitsgemäß zu berichten, damit die Leserin und der Leser, die Hörerin und der Hörer und die Zuschauerin und der Zuschauer im Sinne der Aufklärung ihre eigene Meinung bilden können, damit diese und die Welt eine bessere wird. Darin war auch ich mit allen möglichen Gewichten verankert, den stets neuen Versuch zu meistern, den Bericht von der Welt und die Meinung des Journalisten voneinander kenntlich zu trennen. So war alles, was andere und Leute wie ich taten, die bereits vor dem Mauerfall 1989 Journalisten waren, der stete, oftmals enttäuschende Versuch, große und kleine Kriege und große und kleine Probleme und große und kleine Brandherde dadurch zu löschen, dass jeder, der willens war in der offenen Gesellschaft, gut davon erfuhr und sich derart verhielt, dass die Kriege, die Probleme und die Brandherde von ihnen durch verschiedene Haltungen, durch verschiedenes Verhalten und durch verschiedene Taten wenn nicht verhindert, dann gelöscht wurden. Alles dafür, wofür die meisten kleinen und großen Medien standen, war im Grunde einzig von der Kantischen Idee, also aufklärerischen Idee, getrieben, dass der, der Bescheid weiß, deswegen das Bessere dachte, das Bessere tat und die Welt, die kleinen und die großen Welten, besser dadurch würden. So gibt es zahlreiche Berichte, Reportagen, Essays, Interviews und alles andere, die bezeugen, dass der im Glauben an den angelsächsischen Journalismus Geschulte ein Reporter der Wahrheit und von nichts anderem sein wollte und, denke ich, auch war. Es ist nicht Meine West End Story, den Journalismus und seine Entwicklungen bis heute beschreiben zu versuchen.
Es ist gleichwohl Meine West End Story zu beschreiben, dass ein Journalist und Reporter dorthin ging, wo es stank, wo es knallte, wo es weh tat und wo Menschen in kleiner oder großer Not waren. Seit meinen ersten Anfängen im Journalismus – im Lokalen – bis zum Ende meines reinen Journalismus im Großen, als ich 2001 aus Jerusalem und Tel Aviv zurückkehrte und mich entschied, einen anderen Beruf ganz und gar zu wählen, war ich beseelt – ja, beseelt –, dass die Stellvertreter der Leserinnen und Leser, die Journalisten, die im Grunde einzige Aufgabe haben, für eine bessere Welt zu sorgen. Alle Reportagen und Berichte, die ich in den Jahren als Journalist schrieb, waren im Grunde der Anbetung der Suche nach Wahrheit geschuldet. Seien es kleine Berichte über das damalige Tabuthema des sexuellen Missbrauchs, waren es die Reportagen über die wieder neu auftretenden Nazis in den Jahren nach der Wiedervereinigung oder sind es die historisch-kritischen Artikel zu so über einen wie Herrn Biberstein, der zuerst evangelischer Propst war und dann zum Massenmörder wurde und nach dem Zweiten Weltkrieg gleichwohl noch immer von der evangelischen Kirche behütet wurde; nein, all die Stücke aufzuzählen, die ich schreiben durfte und von denen einige im BAND II enthalten sind, bringt die Frage nicht zur Antwort. Es bringt nicht die Frage zur Antwort, in welcher Zeit wir heute leben, die sich sehenden Auges verdüstert. Es bringt nicht die Frage zur Antwort, in welchem Zeitstrom wir heute schwimmen.
Es bringt nicht die Frage zur Antwort, warum es nicht allein mein Eindruck ist, dass alles, wofür große Leute wie Rudolf Augstein, Henri Nannen, Gerd Bucerius, Marion Gräfin Dönhoff, auch jemand wie Hans-Joachim Friedrichs oder auch Ulrich Wickert, standen, vielleicht von einer großen Warte aus ergebnislos war. Es bringt die Frage nicht zur Antwort, warum wie viele andere große Leute, darunter meine Lehrmeister wie Klaus Liedtke, Heiko Gebhardt und viele andere Kolleginnen und Kollegen, vielleicht nicht genügend gut und vorbereitend auf die neuen Lagen gearbeitet haben. Es bringt nicht die Frage zur Antwort, und, das meine ich ernsthaft, wieso kleine Leute wie ich versuchten dafür, dass es eine bessere Welt gibt, eingestanden sind und stets offensichtlich scheiterten, wer sich so umschaut. Es bringt die große und vielleicht größte heutige Frage nicht zur Antwort, warum das jahrzehntelange Pflegen, Bewahren und Ausbauen der westlichen Welt offenbar wahrscheinlich nicht ein gutes Ende nimmt … Warum das Hohe Haus des Westens in ein gigantisches Schwanken seit langer Zeit gekommen ist und warum all die Häuser und Wohnungen, in denen der Westen jahrzehntelang mehr behütet als faktisch geschunden gewohnt hatte, von Rissen in der Außenmauer, von zerbrochenen Fenstergläsern und sogar bereits von gewaltsam geöffneten Haustüren geprägt ist. Wer die Berichte des ehrenwerten Vereins „Reporter ohne Grenzen“ im Kleinen liest und die ehrenwerten Berichte der Vereinten Nationen über die Konflikte in der Welt im Großen und vieler andere Einrichtungen und Institutionen, die jahrzehntelang den Westen und bis heute seine Werte verkörpern, der wird nicht umhin kommen, sich einzugestehen, dass das Leben im Großen wie im Kleinen erneut und erneut ein gefährdetes geworden ist – und an vielen Orten als tatsächliche gefährliche Welt durch die Berichte rechtschaffener Reporter zu besichtigen ist.
So ist ein Leben voller Dankbarkeit für heute vorhanden für Leute wie mich, die nie zensiert worden sind in ihrer Arbeit als Journalist, die nie verklagt worden sind von Menschen, die einem Böses wollten, die einfach sich aufmachen durften, die Türen hinter sich zu schließen und mit etwas wieder zurück an die Tür zu kommen, was die Freunde, Gäste und Bewohner hinter der Tür sich anhören wollten, damit sie sich ein möglichst gutes Bild von den Lagen der Welt vor der Tür machen konnten. Viele Bücher, auch und vor allem aus der Welt der armen Jugendlichen, wie die ewigen und bewegenden Jugendstories „Rolltreppe abwärts“ von Hans-Georg Noack (1970) oder auch „Andi“ von Kai Hermann und Heiko Gebhardt (1980) und viele, viele andere, sprachen stets im Sinne davon, dass alle Journalisten und Reporter die Schwachen, die Armen und die Kranken und Geknechteten achten und beschützen müssen und vor allem durch ihre Arbeit ihr Leben verbessern helfen wollten und sollten. So sind nicht wenige Journalisten und Reporter in die Welt gezogen, damit die Welt eine bessere wird, und bis heute sind viele Journalisten in der Welt dabei, durch ihre Arbeit bessere Welten schaffen zu wollen, ohne ihr eigenes Leben stets schützen zu können, genügend Achtung erfahren und auf durchaus wenig Hilfe nur vertrauen dürfen, wenn ihnen Unrecht, Anklagen und Schlimmeres widerfährt.
Was ist die Größe eines Reporters? Das ist eine gute Frage. Eine Größe des Reporters ist es, sich stets während seiner Arbeit gefragt zu haben, was andere groß macht und nicht nur ihn selbst. In diesem Sinne schreibe ich Meine West End Story als meine letzte Reportage, da ich kein Reporter mehr bin und mache mich vermutlich mehr größer als andere, über die ich nun schreibe. Meine West End Story ist in Räumen geschrieben, die eine Tür haben, die ein Bett haben und eine Heizung – und in einem Staat, Deutschland, der bis heute dafür sorgt, dass, wenn es an der Tür klingelt, wie es der britische Premierminister und Weltenretter Winston Churchill einmal sagte, ich davon ausgehen darf, dass es der Milchmann (so zu Churchills Zeiten) ist oder, auf heutige Zeiten umgemünzt, der Paketmann ist. Ich darf davon ausgehen, dass es nicht solche sind, die dich aus dem Haus abführen dorthin, wo kein Mensch sein will. Leider, ja, leider ist Meine West End Story auch die kurz Geschichte davon, dass jemand wie ich, je älter die Zeiten wurden, in denen er lebt, an die Aufklärung in dieser Art, von einer höheren Warte aus gesehen, nicht mehr so sehr und komplett glaubt. Bevor ich nach Berlin aufbrach, hatte ich ein Ölgemälde gemalt.
Es war kein Plan gewesen, das zu malen, was ich in meinem Atelier auf die Leinwand brachte. Was ich dort in Schwarz und nur ein wenig in Blau auftrug, war derart beängstigend geworden, dass jedes Mal, wenn ich seitdem auf die Staffelei mit diesem Ölgemälde schaue, ich einen gehörigen Schrecken kriege. Auf dem Gemälde sind Bücherregale zu erkennen und viele verschiedenen Bücher, die in diesen stehen. Eine Lampe über den Regalen ist angedeutet und nur schwach als solche zu erkennen. Ich hatte es über den Jahreswechsel gemalt und es gab mir, ohne es zu wissen, die Farbe vor, die ich empfing, als ich mich ein wenig später nach Berlin aufmachte. Vor den Regalen, die auf dem Gemälde zu sehen sind, sind ein Tisch und Stuhl zu sehen. In ihren einfachsten Formen ist klar, dass dort Bücher sind und ein Tisch und ein Stuhl dafür, die Bücher zu lesen. Vor allem gleichwohl ist ein X, ein großes, grobes und durch und durch schwarzes X über die gesamte Größe der Leinwand gemalt. Ich hatte, ohne vorher zu wissen, was ich malen wollte oder sollte, mein Bild davon gemalt, dass all diese Bücher und all diese Wörter, dass all das Reporterleben, dass all das Aufklärerische, das all das Wissen in unseren Regalen und in unserem Leben …
… wenig geholfen haben, sehr wenig geholfen hat, oder anders gesagt, die Nachrichten der Reporter, die uns erreichen, die die Welt in weiterer und vielleicht größerer Gefahr schildern, wenig geholfen haben. Das Gemälde steht noch heute in meinem Atelier. Warum ich es nicht wegstelle, weiß ich nicht wirklich. Vielleicht mahnt es mich daran, den Schrecken, den es zeigt, wach und bewusst und alarmiert in mir zu halten, wann immer ich in die kleinen und großen Welten schaue, die das zeigen, was dort ist …
… und eben kein Frieden all überall, keine Gewalt all überall, keine andere Welt, als die stets gefährdeten kleinen und großen Welten, die wir Reporter zurück hinter die Türen in die Wohnzimmer brachten und bringen, ohne dass es von einer höheren Warte aus besser geworden ist.
***
Eine schöne Stadt, denke ich tatsächlich für einen langen Moment