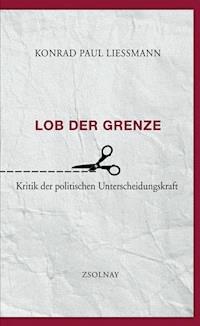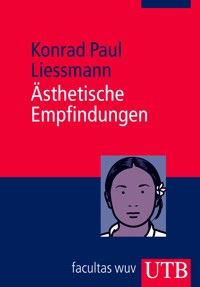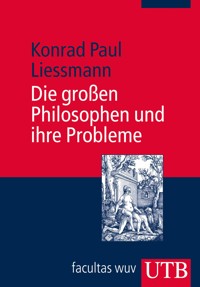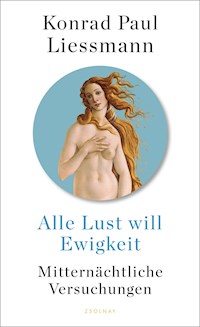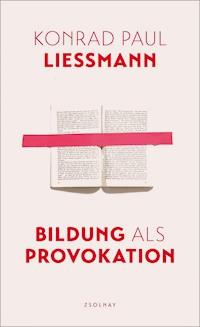Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Lügen unserer Zeit – Konrad Paul Liessmann liefert einen pointierten und provokanten Beitrag zu den Themen der Gegenwart.
Halbwahrheiten, Meinungsblasen, Propaganda, Euphemismen, Fake News, Verschwörungstheorien – lauter Lügen. Schrill, unüberseh- und unüberhörbar dominieren sie die Medien und die Diskurse. Um in diesem Gewirr und auch abseits davon die Wahrheit zu erhaschen, bedarf es eines scharfen Blicks und Ohrs.
Konrad Paul Liessmann seziert die Gegenwart, sowohl aus der Distanz und mit sanfter Ironie als auch engagiert und mit großem Ernst. Hinter den pathetischen Formeln unserer Kultur erkennt er deren beengte Verhältnisse, in den Alltäglichkeiten unseres Denkens entdeckt er die Signaturen der Epoche. Pointiert entwirft der Philosoph ein facettenreiches Panorama unserer Gesellschaft und ein Mosaik ihrer Irrtümer und Selbsttäuschungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Die Lügen unserer Zeit — Konrad Paul Liessmann liefert einen pointierten und provokanten Beitrag zu den Themen der Gegenwart.Halbwahrheiten, Meinungsblasen, Propaganda, Euphemismen, Fake News, Verschwörungstheorien — lauter Lügen. Schrill, unüberseh- und unüberhörbar dominieren sie die Medien und die Diskurse. Um in diesem Gewirr und auch abseits davon die Wahrheit zu erhaschen, bedarf es eines scharfen Blicks und Ohrs.Konrad Paul Liessmann seziert die Gegenwart, sowohl aus der Distanz und mit sanfter Ironie als auch engagiert und mit großem Ernst. Hinter den pathetischen Formeln unserer Kultur erkennt er deren beengte Verhältnisse, in den Alltäglichkeiten unseres Denkens entdeckt er die Signaturen der Epoche. Pointiert entwirft der Philosoph ein facettenreiches Panorama unserer Gesellschaft und ein Mosaik ihrer Irrtümer und Selbsttäuschungen.
Konrad Paul Liessmann
Lauter Lügen
und andere Wahrheiten
Paul Zsolnay Verlag
Vorwort —Zur Ambivalenz von Zeitgenossenschaft
In einer der berühmtesten Szenen der Weltliteratur irrt ein junger Mann, der glaubt, in der Fremde für eine große Sache kämpfen zu müssen, am Rand eines Dorfes umher, Schüsse fallen, Reiter galoppieren vorbei, er wird leicht verwundet, sucht Zuflucht in einem Gasthof, flirtet mit den Töchtern der Wirtin und kehrt über Umwege in die Heimat zurück. Doch eine Frage bleibt, die sich Fabrizio, der zweifelhafte Held von Stendhals großem Roman »Die Kartause von Parma«, nicht beantworten kann: »War das, was er da miterlebt hatte, wirklich eine Schlacht gewesen? Und weiter: War das die Schlacht bei Waterloo gewesen?« Seiner eigenen Zeit gegenüber, so Stendhal mit milder Ironie, habe sich sein Protagonist wie ein Kind verhalten: neugierig, aber ahnungslos.
Zeitgenossenschaft ist eine undankbare Sache. Das, was vor den eigenen Augen geschieht, was man erlebt, was man aus den Medien erfährt, was an Nachrichten, Meinungen, Bildern auf uns einströmt, ist vorerst nicht viel mehr als ein Sammelsurium von unterschiedlichen Eindrücken. Diesen chaotischen Impressionen müssen wir erst eine Ordnung, eine Bedeutung verleihen, wir unterziehen sie einer Bewertung und Beurteilung, ohne wirklich alle Hintergründe zu kennen und die weiteren Konsequenzen abschätzen zu können. Wer sich der Aufgabe stellt, das Zeitgeschehen zu kommentieren, von markanten Vorkommnissen auf den Geist seiner Zeit zu schließen, in manchen Nachrichten die Signaturen der Epoche zu erkennen, bewegt sich stets auf schwankendem Boden und dünnem Eis.
Der Kolumnist ist kein Chronist der laufenden Ereignisse, er wählt aus, lässt sich mitreißen von Debatten und Erregungen, in denen sich die Feuilletons und Nachrichtenportale selbst als Nabel der Welt missverstehen, er pflegt seine Vorurteile, interpretiert, spekuliert, glossiert. Im Gegensatz zum engagierten Haltungsjournalisten weiß es der Kolumnist nicht besser, er will auch nicht die Welt verändern, er möchte verstehen. Das ist schwer genug.
Und hinter all dem steht die Stendhal’sche Frage: In welcher Zeit lebe ich eigentlich? An welchen Ereignissen, die eine zukünftige Geschichtsschreibung als markant und epochal beschreiben wird, nehme ich gerade teil, von welcher Entwicklung, die sich als Wende zum Guten oder als erster Schritt ins Verhängnis erweisen wird, werde ich sagen können: Ich war dabei?
Zeitgenossen tendieren dazu, sich selbst und ihre Gegenwart zu überschätzen. Wer seine Beobachtungen mit der Floskel »Noch nie …« einleitet, droht dieser Hybris zu verfallen. Das Wort des Predigers aus dem Alten Testament, dass es nichts Neues unter der Sonne gäbe, mag angesichts dramatischer technischer und sozialer Revolutionen etwas keck klingen, aber nicht nur für die Skandale und Skandälchen der Politik gibt es entsprechende Parallelaktionen in der Vergangenheit, auch die Warmzeiten, auf die wir zusteuern, hat es auf dieser Erde schon einmal gegeben. Ob man unter solchen Bedingungen als Mensch menschlich leben wird können, ist allerdings eine andere Frage. Und völlig falsch wäre es, sich an der Vergangenheit zu orientieren und aus dieser Lehren ziehen zu wollen, die nicht zu ziehen sind: Denn wohl irrt jede Zeit, jede irrt jedoch auf ihre Weise.
Im Unbestimmbaren der Gegenwart liegt eine große Lust und Versuchung. Als Wesen, die sich nach Sinn verzehren, können wir nicht umhin, alles Geschehen mit Bedeutung aufzuladen — im Großen wie im Kleinen. Von der pathetischen Geste, die aus kontingenten Aktionen gleich eine Zeitenwende ableiten möchte, bis zur schmeichelnden Verlockung, in intellektuellen und kulturellen Moden, die man selbst akklamiert, einen dramatischen Wandel der Gesellschaft zu erblicken, reichen diese Deutungsansprüche. Manchmal erfasst man ja tatsächlich Entscheidendes, manchmal liegt man damit einfach nur daneben.
Wer das je aktuelle Geschehen zur Sprache bringen will, ist vor solchen Fehlschlüssen nie gefeit. Diese können sich fallweise durchaus als produktiv erweisen. Mitunter ist es verblüffend zu sehen, wie schnell sich vermeintlich gravierende und vieldiskutierte Phänomene als belanglos herausstellen, im Gegenzug ist es ernüchternd, feststellen zu müssen, wie oft wirklich Wichtiges schlicht übersehen werden konnte. Tatsächlich ist es unmöglich, die Sensibilität gegenüber der Zeit, in der man lebt, so zu schulen, dass man auf Anhieb immer gleich zu sagen wüsste, was es ist, dem man jetzt gerade beiwohnt. Doch man kann es versuchen. Zeitgenossenschaft bedeutet, sich tastend dem anzunähern, was die Zeit, in der man lebt, ausmachen könnte. Die in diesem Band versammelten Texte stellen solche Annäherungsversuche dar.
Wien, im November 2022
Konrad Paul Liessmann
Lauter Lügen
Verschwörungstheorien und andere Vergnügungen
Die nackte Wahrheit
Im Paradies, wir erinnern uns, waren die Menschen nackt, und sie schämten sich nicht. Erst nach dem Sündenfall, erst nachdem sie sich, verführt von der Schlange, dazu hinreißen ließen, vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen zu essen, sahen sie, dass sie nackt waren, und sie bedeckten ihre Blöße. An dieser Geste aber erkannte Gott, dass seine Geschöpfe sein Gebot übertreten hatten. Nur jemand, der das Gute von dem Bösen zu unterscheiden weiß, schämt sich seiner Nacktheit. Aber warum eigentlich? Ist das Böse nackt oder das Nackte böse?
Die biblische Geschichte, auch wenn sie uns im Wortlaut nicht mehr präsent sein mag, prägt unser Verhältnis zur Nacktheit noch immer. Gilt den einen die zur Schau gestellte Nacktheit als Ausdruck jener Sündhaftigkeit, die uns das Paradies kostete, sehen die anderen in einem natürlichen und unverkrampften Verhältnis zur Nacktheit die Wiedergewinnung eines paradiesischen Zustandes, wenn nicht im Garten Eden, dann wenigstens im Englischen Garten. Jenseits solcher Zuschreibungen bleibt Nacktheit, also der entblößte oder teilentblößte Körper, einer der stärksten Reize in einer reizüberfluteten Welt, und nicht einmal die inflationäre Präsentation nackter Haut in der Werbung und im Film, an den Stränden und im Internet, im Theater und im Kunstbetrieb vermochte daran etwas zu ändern. Worin besteht eigentlich die ungebrochene Faszination der Nacktheit in einer liberalen Gesellschaft, die schon längst und bis zum Überdruss alles gezeigt hat, was es zu zeigen gibt?
Nacktheit, und darauf verweist die biblische Geschichte, rührt an ein zentrales Motiv menschlichen Selbstverständnisses: an sein Verhältnis zur Natur. Der nackte Körper ist der natürliche Körper, was an diesem zu sehen ist, ist der Mensch im Zustand seiner Tierheit. Es waren nicht die schlechtesten Exegeten, die wie etwa G. W. F. Hegel in der Vertreibung aus dem Paradies den Austritt des Menschen aus einer natürlichen Unmittelbarkeit und seinen Eintritt in das Reich der Kultur, der Vernunft, der Technik und der Zivilisation gesehen haben. Mensch sein heißt, seine Natur zu umhüllen, seine Blößen zu bedecken, seine unbehaarte Haut zu schützen, seiner Tierheit Einhalt zu gebieten. Deshalb ist der Zusammenhang zwischen Erkenntnis und Körperscham von den Autoren der Genesis richtig gesehen worden: Nur ein Wesen, das in seinem Bewusstsein über die natürlichen Bedingungen seines Daseins schon hinaus ist, kann, ja muss sich dieser Natur schämen. Der nackte Körper wird so bis auf weiteres die Unzugänglichkeit einer Natur repräsentieren, der man ausgeliefert ist, aber nicht mehr ausgeliefert sein will — wenigstens nicht immer.
Nacktheit wird — und das begründet ihr Faszinosum — in jene Bereiche verbannt, in denen der Animalität noch Raum gegeben werden kann: im Privaten und im Intimen. Nacktheit ist deshalb in hohem Maße mit dem Erotischen und Sexuellen assoziiert, zu sehen, dass man nackt ist, bedeutet zu erkennen, dass man von einer Physis, einem Trieb, einem Begehren dominiert wird, das sich aller rationalen Kontrolle, aller zivilisatorischen Mäßigung entzieht. Sich seiner Geschlechtswerkzeuge zu schämen, bedeutet nicht, wie vielleicht naive Leser der Genesis glaubten, im Sex die Inkarnation der Sünde zu sehen, sondern das Eingeständnis, im eigenen Körper, allen Anstrengungen zum Trotz, letztlich etwas Unverfügbares vorzufinden. In der Regel ist es besser, dieses vor fremden Blicken zu verbergen.
Nacktheit ist nicht gleich Nacktheit. Der entkleidete Oberkörper eines Landarbeiters sendet eine andere Botschaft aus als der entblößte Busen einer jungen Frau an einem Badestrand. Das Faszinosum und der Skandal von Nacktheit sind an ihre Bedeutung für intime Körperfunktionen gekoppelt. Funktionale Nacktheit am richtigen Ort ist unproblematisch, nackte Beine oder Oberarme stören höchstens, wenn dadurch eine Etikette verletzt wird. Der Mann in Shorts ist in der Oper fehl am Platz, im Freien kann man darüber hinwegsehen. Es ist die angedeutete oder demonstrierte Entblößung vor allem jener Körperteile, die das Begehren und den Sex symbolisieren, die in der Öffentlichkeit das zweideutige Interesse an der Nacktheit generieren. Und dies nicht nur, weil der öffentliche Raum nicht der richtige Ort für intime Signale ist, sondern vor allem, weil das Erotische selbst der vollkommenen Entblößung gegenüber höchst ambivalent ist.
Das Erotische lebt von einer Gestik des Entblößens, die weiß, dass das Wechselspiel von Enthüllen und Verhüllen nicht nur in einem faktischen Sinn das Begehren strukturiert, sondern dem Eros auch seine philosophische Dignität gibt. Denn immerhin dachte sich das Abendland die Wahrheit als ein Weib, das seiner Enthüllung harrt, ohne sich den lüsternen Blicken des Erkenntnissuchenden je vollständig preiszugeben. Die nackte Wahrheit steht deshalb auch immer für eine Erkenntnis, die man sich unter Umständen lieber erspart hätte. Die Wahrheit, so notierte es sich einmal Friedrich Nietzsche, ist hässlich; aber wir haben die Kunst, damit wir an dieser Wahrheit nicht zugrunde gehen. Und genau aus diesem Grund verhüllen wir auch — mehr oder weniger ambitioniert — unsere Körper.
Im Spiel von Sein und Schein nimmt deshalb die Ästhetik des Verhüllens eine zentrale Rolle ein. Wohl kann manche Mode — man denke an das Dekolleté oder die Schamkapseln der Renaissance — die sexuellen Signale des Körpers unterstreichen, gleichzeitig kann damit aber auch eine Sinnlichkeit vorgetäuscht werden, die in Wahrheit nicht hält, was die Kleidung verspricht. Vor solchen Enttäuschungen bewahrt eine Verhüllung des Körpers, die überhaupt keine Rückschlüsse auf Konturen, Geschlechtsmerkmale oder gar nackte Haut mehr zulässt. Nicht nur Prüderie und ein überhöhtes Schamgefühl, auch die Bewahrung des Körpers als eines Geheimnisses, dessen Entbergung fast niemandem zusteht, mag so manche Religionen zu strikten Verhüllungsordnungen geführt haben — und das gilt für die Kutte des Mönchs ebenso wie für die Burka der muslimischen Frau.
Das Erotische selbst ist in hohem Maße ein Spiel mit dem Verbergen und Entbergen von Wahrheiten, und das zufällig oder gezielt dem Blick preisgegebene kleine Stück nackter Haut, das mehr erahnen als sehen ließ, galt lange als das sinnfälligste Moment in der Dynamik erotischer Begegnungen. Nirgendwo wird die Krise des Eros deshalb deutlicher als in der Dominanz von purer und unverblümt zur Schau gestellter Nacktheit. Kulturen der Nacktheit sind Kulturen ohne Erotik. Wer vor einer ersten Begegnung schon ein Nacktfoto des Begehrten auf seinem Smartphone vorfindet, dem bleibt es erspart, etwas Verborgenes mit zunehmender Spannung erst zu enthüllen. In der engen Koppelung unverblümt demonstrierter Nacktheit mit dem sexuellen Begehren verschwinden alle Zwischentöne, die das Erotische einmal gekennzeichnet, aber auch gefährlich, weil mehrdeutig gemacht haben. Die Nacktheit suggeriert jene Eindeutigkeit, nach der sich unsere Gegenwart, die es verlernt hat, mit Mehrdeutigkeiten umzugehen, verzehrt.
Aber auch die nur scheinbar aufgeklärte Geste, die Nacktheit zu einem unproblematischen Zustand der Natürlichkeit erklärt und offen propagiert, streicht den Körper als mögliches Objekt des Begehrens durch. Die Freikörperkulturen des frühen zwanzigsten Jahrhunderts und die davon abgeleitete durchaus prüde FKK-Ästhetik zeugen davon. Wohl lässt man alle Hüllen fallen, aber gleichzeitig wird mehr als deutlich, dass der nackte, vom Tageslicht ausgeleuchtete Körper kein erotischer Stimulus mehr sein kann und sein darf. Für diese Situationen entsexualisierter Nacktheit — ein anders Beispiel wären die unbekleideten, schwitzenden Leiber in einer Sauna — gilt deshalb auch ein strenges Regime des gezähmten Blicks. An einem Strand bestünde zwischen dem mit einem Burkini verhüllten und dem entkleideten Körper — so paradox es klingen mag — kein Unterschied: Beide sind dem erotischen Blick entzogen.
Öffentliche Versammlungen von Nacktheit offenbaren darüber hinaus ein unangenehmes Geheimnis: Der durchschnittliche nackte menschliche Körper ist nämlich eher unansehnlich. Ihn vor den Blicken der anderen zu verbergen, kann auch als Gebot der Höflichkeit und Rücksichtnahme gewertet werden. Vielleicht sahen Adam und Eva nach dem Biss in den Apfel vom Baum der Erkenntnis nicht nur, dass sie nackt waren, vielleicht sahen sie auch, dass sie eigentlich hässlich waren. Die Provokation des unbekleideten menschlichen Körpers besteht darin, dass wir diesen nur dort wirklich sehen und genießen können, wo er durch seine Schönheit über die Wahrheit seiner Nacktheit hinwegzutrösten vermag. Solches Glück wird uns aber wohl nur selten zuteil.
Feine Fakten
Wir leben also, so kann man es lesen, in einem postfaktischen Zeitalter. Ungeniert können Populisten Lügen verbreiten, ihre Anhänger wissen das und jubeln trotzdem oder vielleicht gerade deshalb. Dem Wahrheitsfreund graut, zumal er ja, so muss man den erschütterten Kommentaren zur post-truth politics entnehmen, in einer Zeit groß geworden ist, in der Wahrheit in der Politik noch eine entscheidende Kategorie war und sich die Wähler an den besseren und faktengetreuen Argumenten orientierten.
Natürlich stimmt diese in die Vergangenheit projizierte Idylle nicht. In der Politik wurde immer schon gelogen, und immer schon haben die Anhänger dieser Politik das augenzwinkernd akklamiert. Die Lügen, mit denen Colin Powell, Tony Blair und George W. Bush der Weltöffentlichkeit ihre Kriegsabenteuer, die bis heute Abertausenden Menschen das Leben kosten, schmackhaft machten, hatten keine Konsequenzen; und wie sagte doch Jean-Claude Juncker, der sich gerne als moralische Instanz gab: »Wenn es ernst wird, muss man lügen.« Haben wir das schon vergessen? Und als es darum ging, gute Stimmung für Flüchtlinge zu erzeugen, scheuten auch sogenannte Qualitätsmedien nicht davor zurück, jenseits der Fakten von gut ausgebildeten Frauen und jungen Ärzten zu schwärmen, die nun ins Land kämen.
Aber abgesehen davon: Erfreut sich eine postfaktische Attitüde gerade in progressiven Kreisen nicht seit langem großer Beliebtheit? Man erinnere sich an die Attraktivität des Konstruktivismus, der Wahrheit für die Erfindung eines Lügners hielt, oder an die Nonchalance, mit der in Genderdebatten Verweise auf biologische Fakten ignoriert und ins rechtskonservative Eck abgeschoben werden. Die neue Campus-Kultur, in der es von Mikroaggressionen und Trigger Warnings wimmelt, lebt doch davon, dass Fakten nichts, die Gefühle und Befindlichkeiten der Betroffenen aber alles zählen. Und überhaupt: Gilt »Faktenwissen« nicht seit langem in der modernen Pädagogik und Didaktik als verzichtbar, ja als geradezu schädlich, da jugendliche Gehirne keinesfalls mit Wissen belastet werden dürfen, wenn es doch um Kompetenzen und Emotionen geht? Dass man nichts mehr wissen muss, weil die Digital Natives ohnehin alles googeln können, war eine dieser verheerenden reformpädagogischen Ideen, die sich nun anfangen, bitter zu rächen.
Allerdings: Zwischen einer postfaktischen Politik und einer postfaktischen Wissenschaft und ihrer Didaktik gibt es gravierende Unterschiede. Es mag sein, dass es in Zeiten sozialer Medien und ihrer Filterblasen für Politiker leichter ist zu lügen, ohne damit Anhänger und potentielle Wähler vor den Kopf zu stoßen; aber Wahlen in einer Demokratie waren nie Veranstaltungen zur Entscheidung von Wahrheitsansprüchen. In der Politik geht es nicht um Wahrheits-, sondern um Machtfragen. Anders in der Wissenschaft. Für sie ist Wahrheitsfindung die regulative Leitidee. Verzichtet sie darauf, weil alles Konstruktion oder Ausdruck ungerechter Verhältnisse ist, gibt sie sich als Wissenschaft auf. Wird das Konzept wissenschaftlicher Rationalität aus ideologischen oder moralischen Gründen außer Kraft gesetzt, ist dies viel bedenklicher und auch gefährlicher als die dreisten Flunkereien des einen oder anderen Wahlwerbers. Die Lügen in der Politik gehören gleichsam zum Geschäft, die Wahrheit hat sich der Parteiräson unterzuordnen. In der Wissenschaft jedoch sabotiert auch die wohlmeinende Lüge das Denken selbst.
Lauter Lügen
Auch die Guten lügen. Wer hätte das gedacht! Das Entsetzen, das sich nach der Entlarvung des preisgekrönten Spiegel-Journalisten Claas Relotius als Fälscher in den Feuilletons breitgemacht hatte, war entweder gut gespielt oder grenzenlos naiv. Natürlich lügen auch die Guten, vor allem dann, wenn sich die Wirklichkeit den Ideen des Guten zu widersetzen scheint. Neu ist diese Mischung von Fakten und Fiktionen wahrlich nicht, aber sie bescherte uns doch die eine oder andere interessante Fragestellung.
Dürfen zum Beispiel Dichter lügen? Was für eine Frage. Sie dürfen nicht nur, es ist ihr Geschäft. Die poetische Fiktion, die innerhalb und außerhalb von Sprachkunstwerken auftauchen kann, generiert allerdings ihre eigenen Wahrheitskriterien. Zu den Ergebnissen einer sehr alten Debatte über ästhetische Wahrheit gehört die Einsicht, dass diese selbst in der Form der Lüge erscheinen kann — wie umgekehrt übrigens die politische Lüge in Form der Wahrheit zu reüssieren vermag. Dass heute über die Wahrheitsverpflichtung der Literatur so gesprochen wird, als lebten wir in einer politisch korrekten Schrumpfform des platonischen Staates, aus dem bekanntlich die Dichter wegen ihres unverbesserlichen Hanges zum hemmungslosen Flunkern verbannt werden sollten, verwundert dann doch ein wenig.
Vielleicht sollte man sich in diesem Zusammenhang an einen Aphorismus von Friedrich Nietzsche erinnern, der da lautet: »Es führt zu wesentlichen Entdeckungen, wenn man den Künstler einmal als Betrüger fasst.« Und das war, anders als heute, nicht in einem moralisch abwertenden Sinn gemeint, sondern ein Lob. Der Betrug ist eine Methode der Erkenntnis. Nietzsches Kollege Søren Kierkegaard hat dies klar ausgesprochen: Man müsse die Menschen hineintäuschen in das Wahre.
Überhaupt Nietzsche. Er ist der Denker unserer Tage. »Sagen, was ist.« Mit diesem Leitspruch Rudolf Augsteins wollte sich Der Spiegel reuig und zähneknirschend in Selbstkritik üben und auf seine alten, nun von einem Jungstar beschmutzten Ideale besinnen. Man hätte dieses Pathos lieber sein lassen sollen, denn diese Maxime stimmte noch nie. Niemand kann sagen, was ist — nicht einmal die empirischen Wissenschaften.
Sprache an sich, und dies war eine unüberbietbare Einsicht des jungen Nietzsche, stellt immer schon eine Verfälschung der Wirklichkeit dar. Jedes Wort ist eine Verkürzung, jeder Satz eine Deutung, jedes sprachliche Bild eine poetische Fiktion, jede Beschreibung bestenfalls eine Annäherung, wenn nicht eine glatte Erfindung. Und dabei geht es nicht um die klassische Lüge, bei der jemand das Gegenteil von dem sagt, was er selbst für wahr hält. Es geht bei all den aktuellen Skandälchen ja um Thesen und Texte aus dem Geist einer redlichen Überzeugung. Aber, um nochmals Nietzsche zu zitieren: »Überzeugungen sind gefährlichere Feinde der Wahrheit als die Lügen.«
Heißt das, dass wir die Scheidung zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Fakten und Fiktionen aufgeben sollten und alles zur poetischen Imagination erklären müssen? Mitnichten. Es kommt sehr wohl darauf an, unter welchen Bedingungen, in welchen Zusammenhängen, mit welchen Mitteln, mit welchen Absichten, mit welchen Hintergedanken wir uns an die Annäherung an die Wirklichkeit machen. Mindestens sollte man sich der Begrenztheit und Unzulänglichkeit seiner Mittel bewusst sein. Und man könnte vielleicht auch dem politischen Gegner zugestehen, sich durch seine Überzeugungen zu ähnlichen Feindseligkeiten der Wahrheit gegenüber hinreißen zu lassen wie man selbst. Dazu aber wäre Größe erforderlich, und das ist heute zu viel verlangt. Zumindest moralische Überlegenheit aber ist in einer Welt von lauter Lügen prinzipiell fehl am Platz.
Lob des Lügners
Unter dem Titel »Wahrheit und Politik« veröffentlichte die Philosophin Hannah Arendt im Jahre 1967 einen Essay, aus dem immer wieder gerne zitiert wird. Wenig Beachtung findet dabei allerdings Arendts Beobachtung, dass »Wahrhaftigkeit niemals zu den politischen Tugenden zählte und die Lüge immer als ein erlaubtes Mittel in der Politik galt«. Nicht alle haben dies so offen ausgesprochen wie Niccolò Machiavelli, der die Lüge für legitim hielt, wenn sie dem Machterhalt (das ist die böse Variante) oder dem Wohl des Volkes (das ist die gute Variante) diente. Dass mit der Wahrheit in der Politik, in der es um Machtansprüche, um den Kampf zwischen Meinungen und Ideologien geht, wenig zu erreichen ist, mag ein Gemeinplatz sein. Dennoch überrascht stets aufs Neue, mit welcher Verve ausgerechnet in diesem Feld Ehrlichkeit eingefordert und die Lüge als der große Sündenfall gebrandmarkt wird.
Über die moralische Bewertung der Lüge herrscht alles andere als Einigkeit. Und dies gilt nicht nur für die Politik. Wirklich konsequent vertraten lediglich Augustinus und Immanuel Kant die Auffassung, dass es unter keinen Umständen erlaubt sein könne, zu lügen, da damit der menschlichen Kommunikation, die auf Vertrauen beruht, der Boden unter den Füßen weggezogen würde. Andere sahen die Dinge etwas lockerer, wollten zumindest, wie Kants Zeitgenosse Benjamin Constant, die Notlüge »aus Menschenliebe« gestatten. Noch weiter ging Arthur Schopenhauer: Die Lüge kann ein Mittel sein, um sich gegen Angriffe zu wehren und der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen. Vor allem aber ist für den großen Pessimisten das bloße Verweigern einer Aussage kein Unrecht. Wer schweigt, lügt nicht. Manchen wird das gar nicht gefallen.
Braucht die Macht die Lüge? Ja, weil es kein Leben ohne Lüge gibt. So sah dies zumindest Friedrich Nietzsche. Um an der Welt nicht zu verzweifeln, zeichnen wir von dieser ein geschöntes und verkürztes Bild, das unseren Interessen entspricht. Und nicht selten verschließen wir die Augen vor einer Wahrheit, die unsere Ideale konterkariert und von der wir fürchten, dass sie womöglich in falsche Hände gerät. Damit belügen wir uns selbst.
Nietzsche war kein Verächter der Lüge, eher im Gegenteil: Erst die Lüge macht die Menschen kreativ, stachelt ihre Phantasie und ihr Denkvermögen an. Lügner müssen einfallsreich sein, sie dürfen sich nicht in Widersprüche verwickeln, ihre Geschichten sollten plausibel klingen, und sie benötigen ein tadelloses und geschultes Gedächtnis. Ihr Medium ist nicht die plumpe, leicht durchschaubare Unwahrheit, sondern das Spiel mit Wahrscheinlichkeiten, Halbwahrheiten, Übertreibungen, Auslassungen und Zweideutigkeiten. Das hatte schon Sokrates dazu gebracht, den raffinierten Lügner Odysseus für fähiger und besser zu halten als den wahrhaftigen, aber einfältigen Achill.
Der Lügner hat immer einen Vorsprung: Er kennt auch die Wahrheit. Alle anderen tappen im Dunkeln. Aus dieser starken Position des Lügners rührt unsere Lust, diesen letztlich doch noch zu überführen. All unseren Scharfsinn wenden wir auf, um Ungereimtheiten und Erinnerungslücken aufzuspüren, wir sammeln fleißig Indizien, um die Wirklichkeit selbst gegen die vermeintliche Falschaussage in den Zeugenstand zu rufen. So versuchen wir, den Lügner in die Enge zu treiben. Fruchtet das nicht, mangelt es an Beweisen, achten wir auf verräterische Signale: das Zittern in der Stimme, die Bewegung der Hände, den unsteten Blick, das plötzliche Erröten der Wangen, die Verwendung von Phrasen und unscharfen Begriffen. Möglich, dass sich dadurch ein Lügner tatsächlich verrät. Aber dann war es ein Anfänger.
Hassen Hater?
Viel ist in letzter Zeit vom Hass im Netz die Rede. Für die Verfasser von Hasspostings hat sich ein neuer Anglizismus eingebürgert: Hater. Das klingt einerseits zeitgeistiger als der dumpfe deutsche Hasser und rückt den Protagonisten in die Nähe anderer Netz-Helden, wie dem User oder dem schon in die Jahre gekommenen Surfer. Aber der Hater ist auch die erste Erscheinungsform des Negativen und Bösen in den sozialen Medien, die sich hier als durchaus asozial erweisen. Zwar haben Kulturpessimisten immer schon davor gewarnt, dass das anonymisierte Internet nicht nur Bürgerbeteiligung, Liquid Democracy, Schwarmintelligenz und einen neuen Journalismus von unten hervorbringen wird, aber dass sich Aggression und Hass in seinen übelsten Formen so rasch und so flächendeckend bemerkbar machen könnten, überstieg auch die Befürchtungen der Netzskeptiker. Drohend zeichnet sich nun für Besorgte gar eine neue Herrschaft des Pöbels ab.
An Vorschlägen, wie mit dieser Gefahr umzugehen sei, mangelt es nicht. Von Aufklärung über pädagogische Interventionen bis zur strafrechtlichen Verfolgung reicht der Katalog der Maßnahmen, die erwogen werden. Eher selten ist allerdings davon die Rede, dass der alten, lange verpönten Tugend der Selbstbeherrschung wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte: Es muss nicht jeder Affekt gleich aller Welt kommuniziert werden. Einer Generation, der man eingeredet hat, dass Gefühle unantastbar sind, wird das schwer zu vermitteln sein. Dafür beginnt die tiefenpsychologische Ausdeutung der Hater: Was sind das für Menschen, aus welchen Verunsicherungen, falschen Informationen, Lügengespinsten und Fake News speist sich dieser Hass, ist er Ausdruck eines Gefühls der Ohnmacht oder ein Protest gegen politisch korrekte Sprachvorschriften, sind es nur alte Ressentiments, oder handelt es sich um tiefer liegende Symptome sozialer Verwerfungen?
Das sind berechtigte Fragen. Dennoch fehlt in dieser Debatte ein wesentlicher Aspekt: die Virtualität, die all dies trägt und erlaubt. Fast niemand, so lässt sich vermuten, würde einem realen Gegenüber solche Tiraden des Hasses und der Verachtung entgegenschleudern wie im Schutze der Anonymität des Netzes. Und Likes sind schnell vergeben, auch für das Böse. Wenn dies stimmte, stellte sich aber auch die Frage: Wie wirklich ist der virtuelle Hass eigentlich? Stecken tatsächlich jene starken Emotionen und Affekte dahinter, die wir gerne unterstellen? Die von den Propagandisten des Netzes forcierte These, dass es keinen Unterschied zwischen Realität und Virtualität mehr gebe, fällt nun auf diese zurück. Haben nicht wir selbst es verlernt, zwischen Fakten und Fiktionen zu unterscheiden?
Wie wäre es, betrachtete man die Hasspostings einmal so, wie Medienpädagogen in der Regel blutrünstige Computerspiele sehen: als ästhetische Ereignisse, die der Triebabfuhr dienen und dadurch sogar imstande sind, soziale Verhältnisse zu stabilisieren. Natürlich: Der Hater ist einen Schritt näher an der Realität, denn die Objekte seiner verbalen Aggressionen sind existierende, oft namentlich genannte Personen. Aber das macht das Spiel mit der Rhetorik des Hasses, mit den Figuren der Beschimpfung, mit den Verlockungen der Tabubrüche, gnadenlosen Übertreibungen und provozierenden Verallgemeinerungen nur noch attraktiver — getreu dem Diktum der ästhetischen Avantgarde, dass die Grenze zwischen Kunst und Leben stets zur Disposition stehe. Hieß es nicht bei Joseph Beuys, dass jeder Mensch ein Künstler sei? Vielleicht zeigen uns die Hater nicht die Fratze, sondern die Wahrheit dieses Satzes.
Vergnügliche Verschwörungen
Verschwörungstheorien erfreuen sich großer Beliebtheit. Keine Demonstration für oder gegen Corona, bei der nicht Verschwörungstheoretiker, denen keine Idee zu abstrus ist, um sich die Welt zu erklären, gesichtet werden. Unglaublich, wie der Blitz des Unsinns in den naiven Volksboden einschlagen und zur politischen Macht werden kann. Verschwörungstheorien werden aber auch von ihren aufgeklärten Gegnern geliebt. Wie einfach ist es doch, Ansichten zu kritisieren, deren Absurdität offen zutage liegt. Daraus lässt sich wohlfeiles Kapital schlagen. Da es zur Logik der Dummheit gehört, dass man sie nicht aufwendig widerlegen muss, genügt es, störende Meinungen und unangenehme Positionen in die Nähe von Verschwörungstheorien zu rücken, um sich ihrer zu entledigen. Argumentative Auseinandersetzungen erübrigen sich, an deren Stelle tritt die pädagogische Besorgnis. Verzweifelt wird gefragt, was man gegen die rasende Verbreitung von Verschwörungstheorien tun könne. Die Antwort ist immer dieselbe: Bildung, Bildung, Bildung. Vergessen wird dabei, dass nicht wenige Anhänger von Verschwörungstheorien überzeugt davon sind, besser informiert zu sein und mehr zu wissen als die durch offiziöse Medien gegängelten Menschen.
Wie wäre es, dieses Phänomen einmal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten? Über die Motive von Verschwörungstheoretikern wird viel geforscht, meistens unterstellt man ihnen eine dumpfe Sehnsucht nach einfachen Welterklärungen und stereotypen Schuldzuweisungen. Das mag wohl stimmen. Unterschlagen werden dabei jedoch Aspekte, die nicht nur Verschwörungstheorien auszeichnen: die Vermutung etwa, dass das unmittelbar Wahrnehmbare noch nicht das Wahre ist — seit Platon lebt die Philosophie von dieser Annahme; oder die Lust, die darin besteht, sich eine Welt auszudenken, in der es alles gibt, was es sonst nicht gibt. Alle Kunst und Literatur lassen sich darauf zurückführen. Der Erfolg von Filmen über Aliens speist sich aus derselben Quelle wie der Glaube, dass die Außerirdischen längst unter uns sind.
Vielleicht sollte man Verschwörungstheorien gelassener entgegentreten und sie gelegentlich unter ästhetischen Gesichtspunkten analysieren. Man sähe dann schnell, dass manche in ihrem Aufwand und ihrer Raffinesse tatsächlich das Zeug zu einem guten Thriller oder abgründigen Roman hätten. Die Vorstellung, dass Stanley Kubrick, der Regisseur des bedeutendsten Science-Fiction-Films aller Zeiten, sein vermeintlich eigentliches Hauptwerk, die fingierte Mondlandung der Amerikaner, unter dem Deckmantel der absoluten Verschwiegenheit hätte inszenieren müssen, ist doch einigermaßen vergnüglich. Andere Konstrukte stellten sich unter dieser Perspektive hingegen sofort als plumpe, gehässige und bösartige Unterstellungen dar, denen kein ästhetischer Mehrwert abzupressen ist.
Verschwörungstheorien nicht nach ihrem Wahrheitsgehalt — das bringt wenig —, sondern nach ihrem künstlerischen Potential zu betrachten, nähme ihnen die politische Spitze, ohne sie im empörten Ton moralisierender Besserwisserei verurteilen zu müssen. Das Problem dabei: Dies kann nur eine Handreichung für Menschen sein, die selbst für Verschwörungstheorien wenig anfällig sind. Für deren Anhänger gilt das nicht. Diese können die haarsträubenden Produkte ihrer überreizten Phantasie gar nicht richtig genießen, denn sie sind von deren Wahrheit überzeugt. Die »felsenfesten Überzeugungen« aber, so vermutete schon Friedrich Nietzsche, gehören fast immer ins Irrenhaus. Dies gilt allerdings nicht nur für Verschwörungstheorien.
Transparente Trennwände
Seit einiger Zeit kann man in Hotels, aber auch in Privatwohnungen, die nach den Vorgaben modernen Designs ausgestattet sind, eine teils interessante, teils unangenehme Beobachtung machen: Badezimmer und Toiletten sind oft nur mehr durch eine Glaswand von den anderen Räumen getrennt, bieten also einen vollständigen Einblick, wenn nicht die Badewanne ohnehin mitten im Wohnzimmer steht. Die Botschaft dieses zweifelhaften Gestaltungseinfalls ist klar: Sei nicht verklemmt, du hast nichts zu verbergen, wer auf Privatsphäre beharrt, ist konservativ. Dass man auch nahestehenden Menschen, Partnern, Freunden, Kindern oder Eltern, mit denen man lebt oder verreist, nicht alle intimen Details der Körperpflege preisgeben will, scheint einer Zeit unverständlich, die universelle Transparenz für eine große Errungenschaft hält.
Diese Architektur der Durchsichtigkeit erinnert nicht von ungefähr an den entscheidenden Imperativ unserer Tage: Zeige alles von dir. Schäme dich nicht. So lächerlich oder peinlich können deine Daten gar nicht sein, dass sie nicht verwertet werden könnten. Im Privaten wird die Aufhebung des Privaten schon einmal erprobt, das morgendliche Waschritual im Bild festzuhalten und um die Welt zu schicken, ist dann der nächste Schritt. In all seinen Verrichtungen von unzähligen Kameras beobachtet zu werden, wird kaum noch als Zumutung empfunden. Das Gefühl für Scham und Peinlichkeit muss ja verschwinden, wenn die Gesellschaft der hemmungslosen Datenflüsse und gläsernen Menschen funktionieren soll.
Der beliebte, aber nicht sonderlich kluge Satz, dass sich niemand vor Beobachtung fürchten muss, solange er nichts zu verbergen hat, vergisst, dass es auch jenseits des kriminellen Aktes genug Dinge gibt, die besser im Verborgenen bleiben sollten. Den anderen gegenüber undurchsichtig zu sein, kann auch als Ausdruck einer Würde gelten, die darauf beharrt, als Mensch nicht ausschließlich Objekt zu sein. Wer programmatisch die Privatsphäre des Menschen nicht mehr respektieren will, versagt dem Menschen überhaupt den Respekt und damit die Achtung.
Die indiskrete Zurschaustellung des Intimen korrespondiert aber auch mit einem anderen Phänomen unserer Tage: einer Empfindlichkeit, die sich den Blicken der anderen eben nicht verweigert, sondern diesen mitunter offensiv aufdrängt. Seine Verletzlichkeiten, Traumata, intimen Erfahrungen der Öffentlichkeit zu offerieren, gilt uneingeschränkt als Tugend. Dass es eine Form der Selbstachtung geben könnte, die sich diesem Druck zur Präsentation seines Inneren verweigern müsste, gehört nicht mehr in das Programm des selbstkompetenten Menschen. Dieser stülpt sein Inneres nach außen — und manchmal tut man besser daran, dann nicht hinzublicken.
Transparente Trennwände können die Intimsphäre nämlich nicht so einfach zum Verschwinden bringen. Diese wird gerade noch respektiert, indem der Blick sich der Einladung, die eine Glaswand bietet, verweigert. Man blickt nicht hin und hofft, dass auch der andere nicht hinblickt. Damit verdeutlichen diese innenarchitektonischen Moden ein weiteres Merkmal unserer Zeit: Wir können nicht mehr alles sehen, was vor uns liegt oder sich uns aufdringlich zeigt. Niemand beherrscht die Einheit von Hinschauen und Wegschauen so gut wie unsere Kultur, und je nach moralischer oder ideologischer Ausrichtung wird einmal das eine, dann das andere der Realität ausgeblendet. Es mag paradox sein, aber in dieser Haltung, die nicht alles sehen will, was sich zeigt, steckt vielleicht der letzte Rest jener Diskretion, die einmal als Signum der Zivilisation gegolten hatte.
Keine Werbung
Die rührenden Versuche staatlicher und europäischer Einrichtungen, die Datengier der Internetkonzerne einzudämmen, werfen nicht nur die Frage nach den monopolistischen Strukturen des digitalen Kapitalismus auf, sondern auch die nach dem eigentlichen Sinn des hemmungslosen Datensammelns. Dass mit diesen Daten bislang wenig Schlimmes passiert, da sie nur dazu dienen, den Internetanbietern präzisere Profile ihrer Kunden zu liefern, um diese mit optimierten und individualisierten Angeboten zu verwöhnen, mag im ersten Augenblick sogar beruhigend klingen. Möglich aber, dass sich gerade hinter dieser trivialen Erklärung der eigentliche Schrecken verbirgt.
Daten werden angeboten, preisgegeben, gesammelt und zusammengeführt, um potentielle Käufer ausfindig zu machen. Natürlich soll es jedem Bürger freistehen, seine Daten anderen zu überlassen, um kostenlose oder verbilligte Angebote in Anspruch zu nehmen. Der Preis dafür ist bekannt: ein unaufhörlicher Strom von Werbung, dem man sich auszusetzen hat. Was soll daran eigentlich schlimm sein? Wer sich dem entziehen möchte, kann ja auf kostenpflichtige Angebote umsteigen, die dafür wenigstens fallweise auf Werbung verzichten. Allerdings: Das Geschäftsmodell Schnäppchen gegen Daten und Werbung ist mittlerweile fast zu einer Lebensform geworden. Deren Formel lautet: Ich werde beworben, also bin ich.
Die Welt, in der wir leben, ist in all ihren Facetten von Werbung geprägt. Das trifft unsere digitale Existenz genauso wie die analogen Verhältnisse, in denen wir uns bewegen. Überall Leuchtschriften, überall eingeblendete Kurzvideos, überall Bilder, Sätze, Sprüche, Szenen, Geschichten, die nur eines im Sinn haben: uns mit Produkten zu konfrontieren, die wir kaufen sollen. Zumindest aber soll eine Marke oder der Name eines Unternehmens in unser Bewusstsein einsickern und irgendwann einmal unser Verhalten steuern.
Für diese Welt sind wir nur aus einem einzigen Grund interessant und deshalb Adressat dieser Botschaften: Wir könnten Konsumenten sein. Natürlich ist der Mensch auch ein konsumierendes Wesen, aber er ist nicht darauf zu reduzieren. Die Unverfrorenheit, mit der Werbung alle Lebensbereiche durchdringt, Filme und Musik unterbricht, die Ästhetik von Straßenzügen, Fassaden, öffentlichen Plätzen, Bahnhöfen und U-Bahnstationen dominiert, jede freie Fläche, jede Pause, jede Lücke, jede Recherche besetzt und begleitet, die Selbstverständlichkeit, mit der sich die Werbung bei jeder Gelegenheit aufdrängt, lässt den Gedanken an eine Welt ohne diese Zumutungen erst gar nicht mehr aufkommen.
Der Hinweis, dass sich im Medium der Werbung doch die ästhetischen Avantgarden unserer Tage artikulieren, trägt wenig. Der Großteil der Werbung ist einfach nur penetrant, formal und inhaltlich nicht selten an der Grenze zur Idiotie.
Die eine oder andere avancierte Reklame kompensiert kaum die Verwüstungen, die eine wahnwitzig gewordene Werbewelt generell im Wahrnehmen und Denken der Menschen anrichten muss. Wäre es anders, würden all diese Attacken der neuen Hausierer wirkungslos verpuffen und aus Mangel an Erfolg eingestellt werden.
Gerne wird darüber geklagt, dass unserer Zeit der Wille zur Utopie, zur Antizipation ganz anderer Zustände abhandengekommen sei. Nun, wie wäre es, sich eine Welt zu denken, in der freie und selbstbewusste Bürger sich dann über Produkte informieren, wenn sie ein Bedürfnis danach entwickeln? Eine Welt, in der es nicht gestattet ist, den öffentlichen Raum und die privaten Lebenswelten mit unverlangter Werbung zuzudecken? In solch einer Welt würde vielleicht deutlich werden, dass Menschsein mehr bedeutet, als lediglich ein Objekt für maßgeschneiderte Werbestrategien zu sein. Das würde auch dem Gerangel um unsere Daten eine neue Perspektive verleihen.