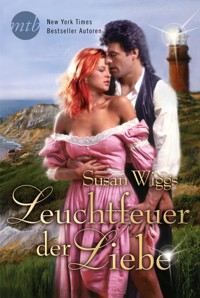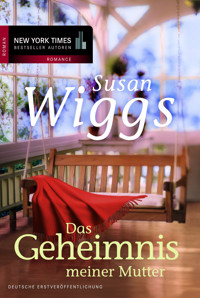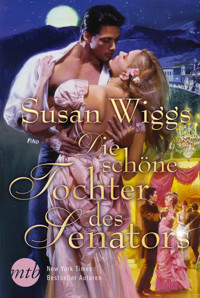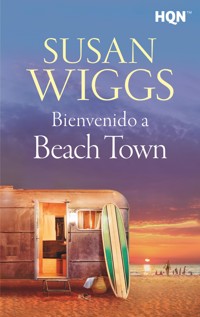5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CORA Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historical Präsentiert
- Sprache: Deutsch
Columbia River, 1876: Mit letzter Kraft erreicht die junge Mary Dare nach einem Schiffsunglück den Strand, wo sie von Jesse Morgan gefunden und gerettet wird. So sehr sich der verschlossene Leuchtturmwärter auch gegen die Stimme seines Herzens wehrt - dem Zauber der schönen Irin kann er nicht widerstehen! Und Mary, die das Feuer hinter Jesses kühler Fassade sehr wohl spürt, erwidert sein Verlangen heiß. Am liebsten möchte sie mit ihm für immer in der Geborgenheit des Leuchtturms leben. Sie ahnt nicht, dass ihr eigenes Schicksal bereits unlösbar mit Jesses tragischer Vergangenheit verknüpft ist ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
IMPRESSUM
HISTORICAL PRÄSENTIERT erscheint in der HarperCollins Germany GmbH
© Erste Neuauflage in der Reihe HISTORICAL PRÄSENTIERTBand 34 - 2017 by HarperCollins Germany GmbH, Hamburg
© 1997 by Susan Wiggs Originaltitel: „The Lightkeeper“ erschienen bei: MIRA Books, Toronto Published by arrangement with HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V./S.àr.l.
Übersetzung: Traudi Perlinger
© Deutsche Erstausgabe by CORA Verlag GmbH & Co. KG, Hamburg, in der Reihe: HISTORICAL GOLD, Band 154 (2) 2005
Abbildungen: Harlequin Books S.A., merc67 / GettyImages, alle Rechte vorbehalten
Veröffentlicht im ePub Format in 10/2017 – die elektronische Ausgabe stimmt mit der Printversion überein.
E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 9783733768539
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten. CORA-Romane dürfen nicht verliehen oder zum gewerbsmäßigen Umtausch verwendet werden. Sämtliche Personen dieser Ausgabe sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
Weitere Roman-Reihen im CORA Verlag:BACCARA, BIANCA, JULIA, ROMANA, MYSTERY, TIFFANY
Alles über Roman-Neuheiten, Spar-Aktionen, Lesetipps und Gutscheine erhalten Sie in unserem CORA-Shop www.cora.de
Werden Sie Fan vom CORA Verlag auf Facebook.
1. KAPITEL
Washington Territory, 1876
Am Sonntag wurde etwas an Land gespült.
Der Morgen dämmerte herauf wie alle anderen – tief hängender, kalter Nebel verhüllte die fahle Sonne, die bleigraue Dünung rollte von weit draußen heran, schwoll an und nahm an Kraft zu, um tosend gegen die gezackten Felsen von Cape Disappointment zu branden. Die höher steigende Sonne glich einem entzündeten Furunkel, als sie durch Wolken und Nebel brach.
Jesse Morgan beobachtete fasziniert den Sonnenaufgang vom schmalen Eisensteg des Leuchtturms, den er hinaufgeklettert war, um die Walöllampen zu löschen und seinen Arbeitstag mit dem Stutzen der Dochte und dem Säubern der Glaslinsen zu beginnen.
Doch dann fiel ihm etwas unten am Strand auf.
Er wusste nicht genau, warum er in die Tiefe spähte. Vermutlich hatte er es immer getan, ohne sich dessen bewusst zu sein. Wenn er zu lange in die bleigrauen Wogen blickte, deren weiße Gischt den hellen Sand bedeckte oder tosend gegen die Felsen brach, bestand die Gefahr, dass er sich daran erinnerte, was die See ihm weggenommen hatte.
Für gewöhnlich achtete er nicht darauf. Dachte nicht. Fühlte nicht.
Heute aber spürte er eine Unruhe in der Luft, als hauche ihm ein unsichtbarer Fremder seinen Atem in den Nacken.
Ohne auch nur kurz zu überlegen, stellte er die Leinölflasche ab, legte das Poliertuch daneben und trat in den bitterkalten Wind auf die Plattform.
Eine seltsame Macht zwang ihn, sich mit einer Hand an der Eisenreling festzuhalten, sich weit vorzubeugen, um über die Landspitze und die Felsenklippen auf den sturmgepeitschten Küstenstreifen zu schauen.
Ein Klumpen Seetang. Stränge gelbbrauner Algen hüllten eine längliche Form ein. Vermutlich nur ein Haufen ineinander verschlungener Meerespflanzen, vielleicht auch ein verendeter Seehund, ein altes Tier, dessen Bartborsten weiß und Zähne braun geworden waren.
Tiere waren vernünftiger als Menschen, sie zogen ihr Leben nicht unnötig in die Länge.
Während Jesse auf das angespülte Treibgut starrte, spürte er … etwas Eigenartiges. Als drehe sich ein stumpfes Messer in seiner Brust. Es war kein Schmerz. Auch keine Neugier.
Unausweichliches Schicksal.
Noch während ihm dieser befremdliche Gedanke durch den Sinn schoss, polterte er mit schweren Stiefelschritten die gewundene Eisenstiege des Leuchtturms nach unten und stürmte den felsigen Pfad entlang.
Er kannte jeden Stein zum einsamen Strand, hatte den Weg wohl tausendmal zurückgelegt.
Was ihn verwunderte, war seine Hast.
Jesse Morgan hatte seit vielen Jahren keine Eile gehabt.
Nun aber rannte er keuchend, jeden Muskel angespannt. Sobald er aber den Haufen Seetang erreichte, blieb er stehen. Stocksteif und angstvoll.
Jesse Morgan hatte seit langer Zeit Angst, obwohl ihm das kein Mensch angesehen hätte.
Die Leute in Ilwaco, zweitausend Einwohner, die das ganze Jahr hier lebten, und etwa tausend Urlauber, die im Sommer die Gegend bevölkerten, hielten Jesse Morgan für rau und unbeugsam wie die Felsklippen, über die er in seinem Leuchtturm wachte.
Er galt als stark und furchtlos und ließ niemand hinter seine versteinerte Maske blicken.
Er war erst vierunddreißig und fühlte sich wie ein alter Mann.
Nun stand er allein am Strand, gelähmt vor Angst, ohne zu wissen, warum. Bis er etwas zu seinen Füßen unter dem Haufen Seetang zu entdecken glaubte.
Barmherziger Gott. Er fiel auf die Knie, die Nässe des Sandes drang kalt durch seine Hose. Er wusste nicht, wo er anfangen sollte, war unschlüssig, ob er den Schleier des Geheimnisses überhaupt lüften sollte.
Die Algenstränge fühlten sich unangenehm schwammig und kalt an, klebten unnachgiebig an … Woran?
Seine Hände ertasteten geschliffenes Holz. Gehobelt, geglättet, lackiert. Das Wrackteil eines Schiffes. Ein Stück von einem Mast oder vom Bugspriet, mit Tau umwickelt, dessen lose Enden mit Pech bestrichen waren.
Hör auf, befahl er sich, ahnte bereits, was er finden würde. Das alte Grauen, nach all den Jahren brennend wie am ersten Tag, packte ihn.
Hör sofort auf damit. Er könnte aufstehen, die Klippen hinaufsteigen, durch den Wald laufen und Palina und Magnus wecken, könnte sie an den Strand schicken, um das Treibgut zu untersuchen.
Stattdessen zerrte er mit fahrigen Händen an den glitschigen Tangsträngen, grub tiefer, legte ein weiteres Stück des Mastes frei, fand das abgesplitterte Ende …
Einen Fuß. Nackt. Kalt wie Eis. Und Zehennägel wie winzige Muscheln.
Er holte ächzend Atem, arbeitete verbissen weiter, mit zitternden Fingern und dröhnendem Herzschlag.
Ein schlankes Bein. Nein, mager. Mager und voller Sommersprossen, die sich dunkel gegen leblose, fahle Haut abhoben.
Jesse stieß einen Schwall Gotteslästerungen zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Früher hatte er mit Gott gesprochen. Nun verfluchte er ihn und die Welt.
Jede Sekunde des Grauens stand für sich, kristallisiert in einem Wissen, dem er seit Jahren zu entfliehen suchte. Er hatte sich bis ans Ende der Welt zurückgezogen, um der Vergangenheit zu entfliehen.
Er konnte ihr nicht entkommen. Er konnte nicht verhindern, daran zu denken. Er konnte nicht vergessen, was die See ihm geraubt hatte.
Und er wusste, was die See ihm heute vor die Füße gespült hatte. Eine Frau, wie konnte es anders sein. Das war der eisige Gipfel grausamer Ironie.
Er arbeitete sich unbeirrt weiter nach oben, legte das Gesicht frei. Und wünschte, er hätte es nicht getan. Denn als er sie sah, wusste er, warum es ihn so machtvoll zur Eile gedrängt hatte.
An diesem Morgen war ein Engel an seinem Strand gestorben. Ihr Heiligenschein bestand aus glitschigem Tang, der sich in ihren roten Haarsträhnen verfangen hatte, und ihr Engelsgesicht war mit Sommersprossen übersät.
Dieses bleiche Gesicht mit dem vollen Schwung lavendelblauer Lippen war von einem Bildhauer geschaffen worden, dem es gelungen war, Marmor in Poesie zu verwandeln. Ein Frauengesicht, wie es nur Träumer erblicken, die an Wunder glauben.
Aber sie war tot, heimgekehrt ins Reich der Engel, wohin sie gehörte, in ein Reich, das sie besser nie verlassen hätte.
Jesse sträubte sich dagegen, sie zu berühren, seine Hände aber gehorchten ihm nicht. Er packte sie bei der Schulter, rüttelte sie sanft, drehte den Mast ein wenig, an dem sie festgebunden war. Nun sah er die Gestalt von Kopf bis Fuß.
Sie war schwanger.
Zorn durchzuckte ihn wie ein Blitz. Es reichte nicht, dass eine schöne junge Frau ihr Leben lassen musste. Auch das dunkle Geheimnis, das süße keimende Leben in ihrem gewölbten Leib war vernichtet worden. Zwei Lebenslichter waren durch einen unbarmherzigen Sturm erloschen, durch haushohe Brecher einer gnadenlosen See.
Dies ist der Beginn, dachte Jesse, während er die leblose Gestalt losband und in die Arme nahm, der Beginn einer Reise, vor der ihm graute.
Die leblose Frau sackte vornüber wie eine Stoffpuppe. Eine kalte Hand krallte sich an Jesses Arm fest. Er wich entsetzt zurück, ließ sie im nassen braunen Sand liegen.
Sie stöhnte auf, hustete und erbrach Meerwasser.
Jesse Morgan, der selten lächelte, strahlte übers ganze Gesicht. „Verdammt“, knurrte er und riss sich den Gummimantel von den Schultern. „Sie lebt.“
Er legte ihr den gefütterten Mantel um die Schultern und hob sie hoch.
„Ich bin … am Leben“, hauchte sie kaum hörbar. „Ich glaube“, fügte sie genauso leise hinzu, und ihr Kopf sank nach vorn, „das ist ein Wunder.“
Mehr sagte sie nicht und fing an, an allen Gliedern zu schlottern. Sie fühlte sich an wie ein Fisch im Todeskampf, und Jesse hatte alle Mühe, sie nicht fallen zu lassen.
Und während er seine Last den steilen Felspfad hinauftrug, so schnell seine Beine ihn trugen, war ihm mit unumstößlicher Gewissheit klar, dass dieser Tag etwas Neues, etwas Außergewöhnliches, etwas unendlich Faszinierendes und Beängstigendes in sein Leben gebracht hatte.
2. KAPITEL
Panik überflutete ihn in mächtigen, Schwindel erregenden Wellen. Wieso er? Wieso jetzt? Eine Fremde und ihr ungeborenes Kind zu retten war das Letzte, worauf er vorbereitet war.
Aber er war gezwungen, sie zu retten. Seit zwölf Jahren widmete er als Leuchtturmwärter sein Leben der Überwachung dieser tückischen Gewässer. Ihm blieb keine andere Wahl.
Mit weit ausholenden Schritten stieg er den gewundenen Pfad zur Warte hinauf, stürmte den flachen Hang auf der anderen Seite des Felsplateaus hinunter zum Waldrand, wo das Haus des Leuchtturmwärters stand. Das Gewicht des beinahe leblosen Körpers zerrte an seinen Armen. Er nahm zwei Holzstufen zur Veranda auf einmal und stieß die Haustür mit der Schulter auf.
Er trug die Frau in eine Kammer neben der Küche und legte sie aufs Bett. Die jahrelang unbenutzte Matratze mit dem vergilbten Drillichbezug roch muffig. Er kramte in einem hohen Schrank und fand ein paar alte gesteppte Quilts und eine karierte Wolldecke.
Er deckte die Frau zu, versuchte, ihr Wasser und Whiskey einzuflößen, doch die Flüssigkeit lief ihr aus den Mundwinkeln. Sie war ohne Bewusstsein.
Er hastete hinaus auf die Holzveranda und läutete die große Messingglocke, um Magnus Jonsson und seine Frau Palina zu alarmieren, deren Haus eine Viertelmeile entfernt im Wald lag. Er stocherte die ersterbende Glut im Küchenherd auf, legte Holz nach und stellte einen Wasserkessel auf. Danach ging er wieder in die Kammer.
Er musste ihr die nasse Kleidung ausziehen. Er musste sie berühren. Widerstrebend schlug er die Decken zurück. Seine Finger zitterten leicht, als er ihr nasses Haar zur Seite streifte und die Knopfleiste am Hals fand.
Eine Frau zu entkleiden war für Jesse etwas Ungewohntes geworden. Gleichzeitig erschien es ihm unerträglich vertraut.
Er biss die Zähne zusammen und öffnete die Knöpfe. Sie war immer noch ohne Bewusstsein, spürte nichts von seinen ungelenken Bemühungen, als er ihr einen Ärmel abstreifte, dann den zweiten, sie danach aus dem nassen Wollkleid schälte und es auf den Boden warf.
Darunter trug sie ein schlichtes Hemd, das einst weiß gewesen war. Ihre Brüste und ihr gewölbter Leib zeichneten sich deutlich unter dem dünnen, nassen Stoff ab. Er deckte sie zu und streifte ihr das Hemd unter der Decke ab. Auch ohne sie anzusehen, spürte er ihre weiblichen Rundungen und ihre glatte Haut.
Ihre Haut fühlte sich Besorgnis erregend kalt an.
In seiner Aufgeregtheit zerriss er das Hemd, während er es ihr nach unten zog, dann warf er es zum Kleid auf den Boden. Er zog ihr die Decken bis zum Hals hoch, schlug sie an den Seiten ein und stand auf.
Er zitterte an allen Gliedern.
In der Küche füllte er Flaschen und Kannen mit heißem Wasser und stellte die Gefäße nah an ihren Körper, um sie zu wärmen. Danach lehnte er sich gegen die roh gezimmerte Bretterwand und schloss für einen kurzen Moment die Augen. Geschafft. Doch der schwierige Teil lag noch vor ihm.
Das Haus des Leuchtturmwärters war weniger ein Heim als eine Notunterkunft. Das einstöckige Holzhaus mit einem offenen Speicherraum am Waldrand reichte für Jesses Zwecke vollauf, der keine Ansprüche stellte, nur das Nötigste zum Überleben brauchte. Doch nun, im Licht der Morgensonne, das durch das Ostfenster auf die leblose Gestalt im Bett fiel, wirkte es klein, eng und schäbig.
Die Kammer neben der Küche war dafür gedacht, einen bettlägerigen Kranken zu beherbergen, um die Pflege zu erleichtern. In all den Jahren, die Jesse hier wohnte, war sie bislang unbewohnt geblieben.
Bis jetzt.
Die Frau lag reglos unter den Decken. Ihr Gesicht war bleich, ihr Ausdruck friedlich, ihr nasses rotes Haar von Salzwasser verklebt. Eine zierliche Hand lag unter dem Kinn. Ihre zarten Lider waren von hauchdünnen blauen Äderchen durchzogen.
Ich bin am Leben. Ich glaube, das ist ein Wunder.
Die Worte, die sie unten am Strand gehaucht hatte, gingen ihm durch den Sinn. Aus den kurzen Sätzen hatte er einen Akzent herausgehört, einen Singsang, den er nicht einordnen konnte. Sie hatte die Augen nicht geöffnet.
Er hätte gerne gewusst, welche Farbe ihre Augen hatten.
„Wer bist du?“, raunte er heiser. „Wer, zum Teufel, bist du?“
Dornröschen. Ihr Bett sollte in einer sonnendurchfluteten, von Rosen umrankten Laube stehen, sie sollte nicht in einer grob gezimmerten Bettstatt mit einer durchgelegenen Strohmatratze liegen. Sie sollte von einem Märchenprinzen geweckt werden, nicht von Jesse Kane Morgan.
Er wandte sich ab. Sie anzusehen schmerzte ihn wie der Blick in die gleißende Sommersonne. Es wäre besser für alle, wenn sie das Bewusstsein nicht wiedererlangte und in den Tod hinüberdämmerte und nie erfuhr, wer sie dem Meer entrissen hatte.
Zugleich aber drängte es ihn, auf die Knie zu sinken, die Frau bei den Schultern zu nehmen und sie anzuflehen, am Leben zu bleiben.
Er begann, in der Kammer hin und her zu wandern, und fragte sich, wo die Jonssons so lange blieben. Während er versuchte, seine Ungeduld zu zähmen, sah Jesse sein Haus mit anderen Augen, so wie ein Fremder es sehen würde. Grob gezimmerte Holzmöbel, eine einfache Wanduhr, deren langes Pendel die Zeit mit unerbittlicher Verlässlichkeit maß. Die Fensterläden waren geöffnet, um die Morgensonne einzulassen. Palina hatte sich erboten, Vorhänge zu nähen, Jesse aber hatte nichts übrig für Rüschen und Spitzen.
An der Längsseite des Wohnraums stand ein Regal voller Bücher. Romane von Dumas, Flaubert, Dickens. Essays und Erzählungen von Emerson und Thoreau. Als Jesse die Welt hinter sich gelassen hatte, hatte er seine Bücher als einzigen Besitz in die Einsamkeit mitgenommen. Er war ein unersättlicher Leser, floh beim Lesen in eine Scheinwelt. In den ersten Jahren nach der Tragödie hatte er sich an seine Bücher geklammert wie an einen Rettungsanker. Die geschwätzigen Stimmen der Romanfiguren hatten die Leere in seinem Kopf ausgefüllt und den Schrei des Grauens seiner Seele erstickt. Die Bücher hatten ihn davor bewahrt, wahnsinnig zu werden.
Auf Regalbrettern in der Küche standen Krüge, Kannen und Töpfe der Größe nach geordnet wie Zinnsoldaten. Den großen Eisenherd putzte und schwärzte er seit vielen Jahren in regelmäßigen Abständen.
Jahre, die er nicht zählen wollte.
Die Ungeduld trieb ihn wieder auf die Veranda. Er riss heftig am Juteseil, was nicht nötig gewesen wäre, da Magnus’ und Palinas gedämpfte Stimmen bereits durch den dichten Wald, der die Leuchtturmstation von Cape Disappointment umgab, zu hören waren. Der Waldboden war mit braunen Tannennadeln gepolstert und dämpfte ihre Schritte. Sie redeten lebhaft in ihrer isländischen Muttersprache wie gute Freunde, die sich nach langer Trennung wieder gefunden hatten.
Jesse wunderte sich immer wieder über die harmonische Beziehung der Eheleute, die sich auch nach dreißig gemeinsam verbrachten Jahren noch so viel zu sagen hatten. Sie hatten einen beinahe erwachsenen, geistig leicht behinderten Sohn, Erik, den sie abgöttisch liebten. Stark wie ein junger Stier und einsilbig, machte auch Erik sich auf der Station nützlich.
Die Jonssons tauchten an der Wegbiegung aus dem Wald auf. Die Morgensonne, die durch die Äste der hohen Kiefern und Fichten schien, ließ die Gesichter der beiden Alten aufleuchten, die lächelnd winkten, während sie ihre Schritte beschleunigten.
Magnus Jonsson hatte den mächtigen Brustkasten und die breiten Schultern eines Fischers, der sein Leben damit verbracht hatte, Netze auszuwerfen und Winschen hochzukurbeln. Nach einem Unfall, bei dem er die linke Hand verlor, hatte er den Beruf aufgegeben. Die meisten Männer in seiner Situation hätten auch den Mut verloren und wären gestorben, Magnus aber hatte einen unbeugsamen Lebenswillen und war wieder genesen.
Palina, obwohl kräftig gebaut, wirkte neben ihrem kraftstrotzenden Ehemann beinahe unscheinbar. Sie hatte helle Augen und große, vorstehende Zähne. Hinter ihren ruhigen Gesichtszügen verbarg sich offensichtlich ein scharfer Verstand und eine lebhafte Fantasie.
„Guten Morgen, Jesse“, grüßte sie mit einem leichten Singsang in der Stimme. „Sieh nur! Odin hat uns heute wieder einen prachtvollen Morgen beschert.“ Bei ihrer weit ausholenden Armbewegung über die sonnendurchflutete Lichtung und die idyllische Pferdeweide am Hang geriet ihr orangefarbener Schal ins Flattern.
„Aegirs Atem hat die Wolken vertrieben und den Nebel aufgesaugt“, fügte Magnus hinzu.
Jesse nickte seinen Morgengruß. Er hatte sich an die ständigen Anspielungen der beiden auf Sagen und heidnische Gottheiten gewöhnt.
„Das ist aber noch nicht alles, was der Morgen uns beschert hat“, brummelte er, stieß die Tür auf und ließ die beiden eintreten. Dann ging er durch Wohnraum und Küche voraus in die hintere Kammer.
Als die Jonssons die Frau im Bett entdeckten, blieben sie wie angewurzelt stehen und fassten sich an den Händen.
„Hamingjan góoa“, murmelte Magnus. „Was hat das zu bedeuten?“
„Sie wurde an Land gespült.“ Jesse war verlegen, wie damals in seiner Kindheit, als er ein Geschenk bekommen hatte, das er nicht haben wollte. Was sagte man in einem solchen Fall?
Danke.
Aber er war nicht dankbar. Keineswegs.
„Sie lebt noch“, fügte er unbeholfen hinzu.
Palina beugte sich bereits über die Frau wie eine Glucke über ihr Küken. Jesse trat näher. „Oder etwa nicht?“
„Ja, ja. Sie lebt, aber sie ist halb erfroren, litla greyid, die Kleine. Mach Feuer im Herd, Magnus“, befahl sie über die Schulter. „Aha, du hast ihr das nasse Zeug schon ausgezogen.“ In ihrer Stimme schwang keine Spur von Tadel. Sie wusste genau wie Jesse, wie man unterkühlte Schiffbrüchige wärmte.
„Sie braucht schleunigst trockene Sachen.“ Palina nahm die Hand der Frau zwischen ihre beiden Hände und rieb sie sanft. „Was für ein gesegneter Tag. Nie hätte ich mir träumen lassen, dass die Meeresgötter einem Mann ein solches Geschenk machen.“
Ein Geschenk?
Dummes Zeug. Aberglaube.
Wo, zum Teufel, sollte er saubere Kleidung für die Frau hernehmen? Er besaß nur das Nötigste für den Sommer und den Winter. Kentucky-Jeans, ein paar Hemden und seine Uniform als Leuchtturmwärter. Die Sachen, die er nicht trug, waren in der Schmutzwäsche und wurden in einem großen Kessel auf dem Herd ausgekocht. Erst heute Morgen hatte er sein Nachthemd in die Schmutzwäsche gegeben.
„Du hast Frauenkleider in deinem Haus, Palina“, sagte er.
„Nein. Das dauert zu lang. Sie ist halb erfroren. Sie braucht etwas zum Anziehen, und zwar schnell!“
Gegen seinen Willen warf er einen Blick auf die alte Seemannskiste am Fußende des Bettes.
„Ich habe nichts“, log er krächzend, die Kehle war ihm wie zugeschnürt. „Hör zu, ich laufe zu eurem Haus und bin in zehn Minuten wieder da.“
„Ich brauche jetzt trockene Sachen für sie.“ Palina fixierte ihn mit einem Blick, der keinen Widerspruch duldete. „Sie braucht die Sachen jetzt.“
Jesse ballte die Hände zu Fäusten. Nein. Er schreckte vor dem Gedanken zurück, in seiner Vergangenheit zu wühlen. Doch dann tat er etwas, was er sich geschworen hatte, nie im Leben zu tun.
Widerstrebend öffnete er den Deckel der Truhe. Ein vertrauter Duft stieg ihm in die Nase und ließ ihm die Knie weich werden. Emily. Er zwang sich, in den sorgfältig gefalteten Kleidern zu wühlen, spürte flauschigen Flanell, riss den Stoff heraus und warf ihn Palina zu. Verzeih, Emily. „Hier“, knurrte er. „Ich mache Holz fürs Feuer.“
Er spürte Palinas forschenden Blick wie glühende Kohlen im Rücken, während er aus dem Haus zum Geräteschuppen stapfte und die Axt holte.
Er stellte einen großen Klotz auf den Hackstock, hob die Axt mit beiden Händen über den Kopf, ließ sie mit einem wuchtigen Schwung niedersausen und spaltete den Klotz mit einem einzigen Schlag in zwei Teile, die so hell leuchteten wie eine frische Wunde. Jesse schlug die Klötze in handliche Scheite, verbissen mit rhythmischer Gewalt.
Doch sein Zorn vermochte die Dämonen nicht zu vertreiben. Er hatte es gewusst, bevor er die Seekiste geöffnet hatte – die Büchse der Pandora, die er jahrelang verschlossen gehalten hatte.
Er hatte das Flanellnachthemd kaum wahrgenommen, das er Palina zugeworfen hatte, und dennoch sah er den Stoff in jeder Einzelheit vor sich – das Muster aus kleinen grünen Blättern und blauen Streublumen, die weiße Baumwollspitze an Ausschnitt und Ärmeln. Am schlimmsten war der Duft, der immer noch in ihren Kleidern hing.
Der Duft seiner Frau. Wie eine Melodie, die ihm nicht aus dem Sinn ging und unerwünschte Erinnerungen wie Wellen in ihm hochschwappen ließen. Er sah sie vor sich, hörte ihr Lachen, roch den Duft der Seife, des Puders, die sie benutzte.
Auch nach all den Jahren blutete seine Seele, wenn er an sie dachte. Wenn er an die Hoffnungen und Träume dachte, die er so leichtfertig zerstört hatte.
Grimmig ließ er die Axt niedersausen, immer wieder, als könne Gewalt ihn von seiner Pein befreien. Seine Schultermuskeln schmerzten, der Schweiß lief ihm von der Stirn in die Augen, tropfte ihm vom Hals und Brust. Als Magnus aus dem Haus kam, stand Jesse knietief in frisch gespaltenen Holzscheiten. Magnus blickte verständnislos auf den riesigen Berg Brennholz. „Es ist besser, du kommst jetzt ins Haus“, sagte er.
Im Haus war es erstickend warm. Das blaue Kleid der Frau war im Waschbottich auf dem Herd gelandet. Jesse behagte der Gedanke ganz und gar nicht, dass das Kleid dieser Fremden zusammen mit seiner Wäsche gewaschen wurde.
Palina schnalzte besorgt mit der Zunge und schob der Frau Kissen in den Rücken.
„Was bist du bloß für ein wichtigtuerisches altes Weib“, sagte Jesse. Zu seinem Erstaunen klang seine Stimme beinahe normal.
„Und darauf bin ich stolz“, entgegnete sie spitz.
Wäre Jesse ein heiterer Mann gewesen, hätte er jetzt gelächelt. Er hatte Magnus und Palina wirklich gern, die genau wussten, wann sie ihm helfen und wann sie ihn in Ruhe lassen sollten. Im Augenblick brauchte er ihre Hilfe.
„Na?“, stichelte Palina. „Interessiert es dich gar nicht, ob es deiner kleinen Besucherin besser geht?“
„Geht es ihr besser?“
Palina nickte und fuhr sich mit abgearbeiteten Händen glättend über ihre weiße Schürze. „Bei guter Pflege wird sie bald wieder auf der Höhe sein und sicher ein gesundes Baby zur Welt bringen.“
Bei der Erwähnung des Kindes zuckte Jesse innerlich zusammen, ließ sich jedoch nichts anmerken und gab sich kühl und verschlossen. „Mit dem Karren können wir sie in euer Haus schaffen“, sagte er.
„Nein“, entgegnete Palina.
„Dann trage ich sie.“
„Nicht so schnell, mein Freund.“ Magnus hob seine gesunde Hand. „Die Frau kommt nicht zu uns.“
„Natürlich kommt sie zu euch. Wo sonst …“
„Sie bleibt hier“, fiel Palina ihm ins Wort. „Hier kann sie zu Kräften kommen und gesund werden in der Pflege des Mannes, der sie gefunden hat. Des Mannes, für den das Geschenk gedacht war.“
„Wir müssen praktisch denken“, fügte Magnus hinzu. „Du hast hier genügend Platz. Wir haben nur zwei kleine Kammern und den Speicher für Erik.“
Jesse lachte trocken. „Das ist unmöglich. Ich halte mir nicht einmal einen Hund, verdammt noch mal. Ich kann nicht eine … eine …“
„Frau“, half Palina ihm auf die Sprünge. „Eine Frau, die ein Kind erwartet. Kannst du das etwa nicht aussprechen? Kannst du der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen?“
Panik flackerte in Jesse auf. Die Jonssons meinten es ernst, erwarteten tatsächlich, dass er diese Fremde hier behielt, sich um sie kümmerte, sie gesund pflegte.
„Sie bleibt nicht.“ Er bemühte sich, ruhig zu sprechen. „Wenn ihr sie nicht aufnehmt, bringe ich sie in die Stadt.“
Magnus redete isländisch mit seiner Frau, die bedächtig nickte und an ihrem Kopftuch nestelte. „Es wäre auf jeden Fall zu riskant, sie in die Stadt zu transportieren nach dem Schock, den sie erlitten hat.“
„Aber …“ Jesse schwieg und biss die Zähne aufeinander. Zwei steile Falten bildeten sich auf seiner Stirn, während er verwirrt nach einer Lösung suchte. Wenn Palina Recht hatte und der Frau auf dem Weg in die Stadt etwas zustieße, würde er dafür verantwortlich sein.
Wieder einmal. Wie immer.
„Es ist das Gesetz der See“, sagte Magnus und fuhr sich mit der rechten Hand durch das buschige Haar. „Gott hat sie dir geschenkt.“
Die drei standen auf den Fliesen vor dem großen schwarzen Herd, Palina zupfte zerstreut einen Faden von Magnus’ leerem weißen Hemdsärmel. Ihr Blick aber war unverwandt auf Jesse gerichtet. Und wieder bemerkte er in den Tiefen ihrer Augen diesen heidnischen Glauben, alt und unausrottbar.
„Ich glaube nicht an alte Märchen“, sagte er.
„Es zählt nicht, was du glaubst. Trotzdem ist es wahr“, sagte Magnus.
Palina stemmte die Hände in die Hüften. „Es gibt Fügungen, die aus der Ewigkeit auf uns zukommen, Fügungen, gegen die wir uns nicht auflehnen dürfen. Das, was heute geschehen ist, gehört dazu.“
Jede Faser in Jesses Körper spannte sich heftig an. Er wollte und konnte diese Fremde nicht in seinem Haus, in seiner Welt haben.
„Sie kann nicht bleiben.“ Die Angst ließ seine Stimme zornig klingen, verletzend wie ein Peitschenhieb. „Ich kann ihr nichts bieten. Ich kann ihr keine Hilfe, keine Hoffnung geben. Ich bin kein Krankenpfleger. Begreift ihr das nicht? In der Hölle hätte sie eine bessere Überlebenschance.“
Er hatte die Worte ausgestoßen, ehe er begriff, was er sagte. Sie kamen aus der vergifteten Dunkelheit in ihm und waren die unleugbare Wahrheit.
Magnus und Palina tauschten einen Blick, wechselten ein paar leise Worte, dann neigte Palina den Kopf zur Seite. „Du wirst tun, was du für diese Frau tun musst. Für dieses Kind.“ Ihr Blick schärfte sich. „Vor zwölf Jahren hat dir die See alles genommen, was dir lieb und teuer war.“ Ihre Worte hingen unheilvoll in der Stille. „Jetzt aber hat die See dir etwas zurückgegeben.“
Die Jonssons verließen das Haus. Jesse hatte keinen Zweifel daran, dass Palina sich darüber im Klaren war, was sie gerade getan hatte. Sie hatte die Grenzen ihrer stillschweigenden Übereinkunft verletzt. In zwölf Jahren hatte niemand gewagt, mit ihm über die Tragödie zu sprechen. Nur weil er nicht über die Dinge redete, die ihn jede Sekunde seines Lebens quälten, hatte er es geschafft, zu überleben.
Steifbeinig trat er auf die Veranda. „Kommt zurück, verdammt noch mal!“, brüllte er den beiden nach. Er hatte die Jonssons noch nie angeschrien, noch nie beschimpft. Doch ihre eigensinnige Ablehnung, ihm zu helfen, machte ihn blind vor Zorn. „Kommt sofort zurück, und helft mir mit dieser … dieser …“
Palina drehte sich an der Wegbiegung um. „Frau ist das Wort, nach dem du suchst, Jesse. Eine Frau, die ein Kind erwartet.“
„Kannst du das glauben, D’Artagnan?“, fragte Jesse verärgert, während er vom Pferd stieg und es an dem Pfosten vor Ilwacos einzigem Gemischtwarenladen festband. „Die Jonssons denken tatsächlich, ich müsse diese fremde Person wegen einer blöden Fabel über das Meer behalten. So ein Quatsch. Das ist genauso verrückt wie …“
„Wie mit deinem Pferd zu sprechen?“, fragte eine Stimme auf dem Gehweg hinter Jesse.
Er drehte sich mit finsterer Miene um. „D’Artagnan wird in der Stadt ziemlich nervös, Judson.“
Judson Espy, der Hafenmeister, verschränkte die Arme vor der Brust, wippte auf den Fersen und nickte ernsthaft. „Ich wäre auch nervös, wenn man mir einen französischen Namen gegeben hätte.“
„D’Artagnan ist der Anführer der drei Musketiere.“
Judson machte ein verständnisloses Gesicht.
„Das ist ein Roman.“
„Aha. Wenn der Klepper so verdammt nervös ist, könntest du ihn ja mir überlassen.“
„Seit zehn Jahren versuchst du nun, mir das Pferd abzuschwatzen.“
„Und du sagst seit zehn Jahren Nein.“
„Dann frage ich mich, wieso du immer wieder davon anfängst.“ Jesse streichelte den kraftvollen Hals des Wallachs. D’Artagnan war an einem Tiefpunkt seines Lebens zu ihm gekommen, als er beinahe entschlossen war aufzugeben … alles aufzugeben. Ein Chinook-Indianer hatte ihm den halb wilden Einjährigen verkauft, und Jesse hatte aus ihm das beste Pferd im ganzen Territorium gemacht. Im Laufe der Jahre hatte er drei weitere Pferde angeschafft – Artos, Portos und Aramis hatten das Quartett der Musketiere vervollständigt.
Er ging neben Judson her. Die schweren Stiefel der Männer polterten auf den Holzplanken des Gehsteigs. Als sie den Gemischtwarenladen passierten, verließ die Witwe Hestia Swann den Laden, stattlich wie eine Barkasse. Zwischen Daumen und Zeigefinger ihrer behandschuhten Hand hielt sie affektiert das hauchdünne Gespinst eines Taschentuchs. Ihren Kopf zierte ein ausladendes Gebilde, mehr Blumenstrauß als Hut.
„Guten Tag, Mr. Espy.“ Und merklich kühler fügte sie hinzu: „Ach, und Mr. Morgan. Welch eine seltene Ehre.“
Jesse nahm an ihrer kühlen Haltung keinen Anstoß. Für die meisten Bewohner von Ilwaco war er auch nach zwölf Jahren noch ein Fremder.
„Mrs. Swann“, erwiderte er ihren Gruß und zog seinen geölten Leinenhut.
Ein verkrampftes Lächeln huschte über ihre Lippen. Mrs. Swann legte großen Wert auf gesellschaftlichen Status und behandelte ihn mit ausgesuchter Höflichkeit – wegen seiner Familie in Portland.
Als ob das noch eine Rolle spielen würde.
„Wie gehts, Ma’am?“ Judson wollte ein Gespräch beginnen, und Jesse machte sich auf den Rückzug.
Die Dame fächelte sich mit dem Spitzentüchlein Luft zu. „Danke der Nachfrage, Mr. Espy, nicht sehr gut. Seit mein lieber Sherman auf See geblieben ist, leide ich an Schwermut. Das ist nun erst zwei Jahre her, doch es kommt mir vor wie eine Ewigkeit.“
„Tut mir Leid, das zu hören, Ma’am. Trotzdem einen schönen Tag noch.“ Judson beeilte sich, Jesse einzuholen. „Was ist eigentlich an dem Gerede dran, du hättest eine Frau bei dir aufgenommen?“
Er hatte absichtlich die Stimme erhoben, daran hatte Jesse keinen Zweifel. Hestia Swann, die ihren zweirädrigen Studebaker ansteuerte, blieb stocksteif stehen, als habe ihr jemand einen Besenstiel in den Rücken gerammt. Ihr Fischbeinkorsett knackte, als sie sich umdrehte und die beiden Männer empört anstarrte.
„Wie bitte?“, entrüstete sie sich. „Mr. Morgan lebt mit einer Frau zusammen?“
Judson nickte, und seine Augen blitzten belustigt. „Ja. Das hat er gerade seinem Pferd erzählt.“
„Grundgütiger! Wieso sollte er mit seinem Pferd reden?“
„Weil er Jesse Morgan ist.“
„Und er ist nicht taub“, mischte Jesse sich gereizt ein.
„Schweigen Sie“, fuhr Mrs. Swann ihn an. „Es schickt sich nicht, mit einer Frau zusammenzuleben …“
„Ich lebe nicht mit ihr zusammen …“
„Aha! Dann gibt es also doch eine Frau!“, entrüstete Mrs. Swann sich.
„Was ist hier los?“ Abner Cobb trat aus seinem Laden. In den vollen Taschen seiner Arbeitsschürze klimperten Nägel und Schrauben.
Jesse bezwang seinen Wunsch, in D’Artagnans Sattel zu springen und das Weite zu suchen.
„Jesse Morgan lebt mit einer Frau zusammen“, verkündete Hestia Swann mit schriller Stimme.
Der breit grinsende Abner schlug Jesse auf den Rücken. „Wurde ja auch Zeit. Solange ich dich kenne, habe ich dich nie mit einer Frau gesehen.“
„Ich bin mit keiner Frau zusammen“, sagte Jesse, dem niemand mehr zuhörte. Weitere Passanten hatten sich der kleinen Gruppe zugesellt, und alle redeten über die unschicklichen Vorgänge auf der Leuchtturmstation aufgeregt durcheinander. Abners Frau war neugierig herbeigeeilt, gefolgt von Bert Palais, dem Herausgeber des Ilwaco Journals.
„Woher kommt sie?“, fragte Bert und zückte eifrig seinen Notizblock.
„Ich fand sie am …“
„Aha. Vermutlich aus der Großstadt“, verkündete Mrs. Swann, deren üppiger Busen sich selbstgefällig hob und senkte. „Hab ich Recht, Mr. Morgan?“
„Eigentlich ist sie …“
„Ich nehme an, Sie kennen die Dame aus Portland“, stellte die Witwe fest und nickte zufrieden über ihre Schlussfolgerung, während weitere Passanten herbeieilten. „Ja, das ist es. Jesse ist nämlich ein Morgan aus Portland.“ Sie beugte sich über Berts Schulter. „Seine Familie besitzt die Shoalwater Bay Company. Das Unternehmen hat Geschäftsbeziehungen bis nach San Francisco. Wussten Sie das?“
„Natürlich weiß ich das“, antwortete der Zeitungsverleger und prahlte mit weiterem Wissen. „Mr. und Mrs. Horatio Morgan haben im April eine ausgedehnte Europareise angetreten.“
„Ich erinnere mich, über ein großes gesellschaftliches Ereignis vor einigen Jahren gelesen zu haben“, warf Mrs. Cobb ein. „Die Hochzeit von Annabelle Morgan und Granger Clapp.“
Hestias Doppelkinn bebte, als sie heftig zustimmte. „Jesses Schwester. Es war die Hochzeit des Jahrzehnts. Vielleicht ist die Frau eine Freundin von Annabelle.“
Jesse hörte sich den Klatsch nicht länger an. Er machte kehrt und ging. Ihm war, als würden Geier auf ihn einhacken. Gewöhnlich erledigte er seine Besorgungen in der Stadt zügig, ohne sich unnötig lange aufzuhalten. Niemand außer Judson, der sich eilig an seine Fersen heftete, schien bemerkt zu haben, dass er sich aus dem Staub gemacht hatte.
„Vielen Dank“, sagte Jesse zähneknirschend und bog in eine Seitengasse ein.
„Wohin gehst du?“, fragte Judson.
„Zu Doktor MacEwan.“
„Braucht die Frau einen Arzt?“
„Hm.“
„Ist sie etwa krank oder was?“
„Oder was.“
Judson zog die Stirn in Falten. „Was, zum Teufel, hat sie denn?“
„Sie ist schwanger.“
Judson schlug sich mit der Hand gegen die Stirn und taumelte rückwärts. „Ich fasse es nicht. Du Teufelskerl, Jesse …“
„Und wenn du irgendwem nur ein verdammtes Wort davon erzählst“, warnte Jesse ihn, „dann …“
Es war bereits zu spät. Judson rannte bereits um die Ecke. „He, Leute!“, brüllte er der Versammlung auf dem Gehsteig zu. „Ratet mal!“
Jesse umfing den Messingknauf der Tür zur Arztpraxis. Was war nur aus seinem stillen, zurückgezogenen Leben geworden? Dann schlug er mit der Stirn kräftig gegen die Tür, ein Mal, zwei Mal, drei Mal.
Es half nichts.
Dr. MacEwan nahm keinen Anstoß daran, ständiger Gesprächsstoff der Bewohner von Ilwaco zu sein. Als Verfechterin moderner Errungenschaften der Medizin mit Kenntnissen, die sie sich an einer angesehenen Universität im Osten der Staaten angeeignet hatte, war sie eine leidenschaftliche, kämpferische und ausgesprochen fähige Ärztin.
Dennoch brachten einige engstirnige Bewohner von Ilwaco Dr. Fiona MacEwan eine gehörige Portion Misstrauen entgegen. Möglicherweise war das ein Grund, warum Jesse sich zu ihr hingezogen fühlte.
Er wartete in seiner Küche, während Fiona die fremde Schiffbrüchige untersuchte. Nach dem unangenehmen und aufreibenden Besuch in der Stadt versuchte Jesse, sich ein wenig zu entspannen. Nur unter massiven Drohungen war es ihm dann endlich gelungen, sein Anliegen beim Hafenmeister durchzusetzen und Judson zu zwingen, seine Aufzeichnungen zu prüfen und Nachforschungen über ein Schiff anzustellen, das einen Hafen in der Nähe der Columbia-Mündung hätte anlaufen müssen. Dadurch würde sich die Identität der Frau mit Sicherheit feststellen lassen.
Und nun war die Ärztin gekommen. Es würde nicht mehr lange dauern, bevor Dr. MacEwan ihn von der Fremden befreien und sein Leben wieder in normalen Bahnen verlaufen würde.
Normal bedeutete Einsamkeit.
Jesse biss die Zähne zusammen, um seine Gefühle zu verdrängen. Gefühle hatten seinen Untergang bedeutet. Dieses einsame Leben, sein Exil, war sein Schicksal.
Er blickte an der Vorderseite des Hauses aus dem Fenster. Die Tage wurden immer länger, und es blieben noch ein paar Stunden Zeit, bevor er die Lampen im Leuchtturm anzünden musste.
Dann würde seine einsame Nachtwache beginnen.
Als er Schritte hinter sich hörte, drehte er sich um und sah Dr. MacEwan aus der Kammer kommen. Fiona hatte ein flächiges Gesicht und kraftvolle Hände wie eine Bäuerin, Hände, die zupacken konnten. Sie trug ihr volles, grau meliertes Haar zu einem Nackenknoten gebunden, von einer Stricknadel oder einem Schreibstift zusammengehalten, was immer gerade zur Hand war. Heute hatte sie eine alte Häkelnadel zur Befestigung des Knotens gewählt.
„Nun?“, fragte Jesse.
„Sie ist halb bei Bewusstsein.“
„Was bedeutet das?“
„Sie ist in einem Dämmerzustand zwischen Wachen und Schlafen.“ Fiona nahm ihr Stethoskop vom Hals und legte es in ein schwarzes Samtetui. „Ist Ihnen aufgefallen, dass sie keinen Ehering trägt?“
„Nicht alle tragen einen Ehering.“
„Dadurch ergeben sich interessante Möglichkeiten“, sagte sie. „Vielleicht ist sie eine Witwe …“
„Oder ein gefallenes Mädchen.“ Es war leichter für ihn, schlecht von der Fremden zu denken.
„Wieso gibt es eigentlich nur gefallene Frauen?“, fragte Fiona sinnend. „Nie einen gefallenen Mann?“
„Jedenfalls ist sie ins Meer gefallen und wahrscheinlich besser dran als er.“
„Richtig.“ Fiona zog ihren weißen Arztkittel aus und legte ihn sorgfältig zusammen. „Ich konnte ihr ein wenig Wasser einflößen. Aber sie steht unter Schock und ist immer noch in Lebensgefahr.“
„Ist sie irgendwie verletzt?“ Jesse stellte die Frage, weil er wünschte, dass sie bald wieder zu Kräften kam und aus seinem Leben verschwand. Je früher, desto besser.
„Sie hat eine böse Prellung am Schlüsselbein, darauf müssen Sie achten.“
„Wieso ich?“ Das Grauen kroch wie eine Spinne über Jesses Brust.
„Ja. Die Schulterpartie ist stark geschwollen.“ Ohne um Erlaubnis zu fragen, trat Fiona an das Regal und goss zwei Finger breit Brandy in ein Glas. „Die rechte Seite.“
„Das sollten Sie den Leuten sagen, bei denen sie unterkommen wird.“ Während Jesse sprach, kroch Argwohn in ihm hoch.
Fiona trank den Brandy in einem Zug und schloss genüsslich die Augen, während die Flüssigkeit ihr durch die Kehle lief, und ein seliges Lächeln breitete sich über ihre klaren Gesichtzüge. Dann öffnete sie die Augen. „Sie bleibt bei Ihnen. Jesse, Sie haben die junge Frau gerettet. Sie tragen die Verantwortung für sie.“
„Nein.“ Er trat an den Küchentisch, schlug die flachen Hände auf die Platte, beugte sich vor und starrte die Ärztin finster an. „Verflucht noch mal, Fiona, ich dulde nicht …“
„Sie dulden nicht“, spottete sie. „Es geht immer nur um Sie, nicht wahr, Jesse Morgan? Sie sehen alles nur aus Ihrer Sicht.“
„Wie denn sonst?“
„Aus der Sicht der bedauernswerten Frau da drin, Sie Dickschädel!“ Fiona goss sich einen weiteren Schluck Brandy ein. „Sie hat keine sichtbaren Verletzungen, abgesehen von ein paar Blutergüssen und Abschürfungen. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass wir sie durch die Gegend kutschieren dürfen. Sie ist in einem bedenklichen Zustand, machen Sie sich darüber keine Illusionen.“
„Sie müssen sie mitnehmen.“ Seine Stimme war ein raues Krächzen.
„Ich denke nicht daran.“
„Hier kann sie nicht bleiben.“
„Den mexikanischen Seemann haben Sie letztes Jahr sechs Wochen bei sich behalten.“
„Das war etwas anderes.“ Jesse hatte den Matrosen gerettet, bevor sein Beiboot in der Brandung an den Felsklippen zerschellt war. „Er schlief im Schuppen und telegrafierte um Hilfe.“
„Und er sprach nicht Englisch“, ergänzte Fiona, als habe Jesse Schuld daran, „und konnte Ihre Einsamkeit nicht stören.“
„Seit wann ist es ein Verbrechen, wenn man seine Ruhe haben will?“
„Es ist ein Verbrechen, eine Frau unnötig in Lebensgefahr zu bringen, weil Sie Angst davor haben, sie zu behalten.“
Der Vorwurf erschreckte Jesse. „Das war ein verdammter Schlag unter die Gürtellinie, Fiona.“
Sie nippte am Brandy. „Ich weiß. An der Universität habe ich gelernt, mit unfairen Mitteln zu kämpfen. Und ich habe nie den Kürzeren gezogen. Schon gar nicht im Kampf mit einem Mann.“
Jesse richtete sich auf und trat vom Tisch zurück. „Was ist mit dem Ruf der Frau? Wahrscheinlich ist sie eine anständige, gottesfürchtige Person. Ich nehme an, Mrs. Swann verbreitet schon haarsträubende Gerüchte über sie in der Stadt. Es schickt sich nicht, wenn eine Frau mit einem Mann, mit dem sie nicht verheiratet ist, unter einem Dach wohnt.“
„Sobald ich die Leute darüber aufkläre, in welchem Zustand sie sich befindet, werden auch die engstirnigsten Bürger nicht argwöhnen, es gehe etwas Unschickliches in Ihrem Haus vor.“
„Sie haben ja eine hohe Meinung von Ihren Mitbürgern“, sagte Jesse spöttisch. „Die Leute werden kein gutes Haar an ihr lassen.“
„Seit wann stört Jesse Morgan sich an bösem Klatsch?“, fragte Fiona, leerte das Glas und klappte die braune Arzttasche zu. „In ein paar Tagen sehe ich wieder nach ihr. Wenn sie bereit ist zu sprechen, finden Sie heraus, wo ihre Familie lebt und wie wir sie erreichen können.“
Jesse begleitete sie zur Tür. „Tun Sie das nicht, Fiona. Lassen Sie mich nicht mit dieser Frau allein.“
Er spürte, wie ihr der Geduldsfaden riss. Sie funkelte ihn wütend an. „Sie kümmern sich um diese Frau, Jesse Morgan, und helfen ihr, gesund zu werden, haben Sie verstanden? Schluss mit Ihren Ausflüchten. Sie ist schwanger, falls Sie das noch nicht bemerkt haben sollten.“
„Ich habe es bemerkt.“
„Eine Schwangerschaft ist immer ein gefährlicher Zustand, auch für eine Frau, die kein traumatisches Erlebnis hatte. Sollte sie ihre Familie bei dem Schiffsunglück verloren haben, dann ist das Baby alles, was ihr geblieben ist. Es ist unsere verdammte Pflicht, alles zu tun, was in unserer Macht steht, damit sie ein gesundes Kind zur Welt bringt. Wenn ich mit meiner Schätzung richtig liege, müsste es in vier Monaten so weit sein.“
Nachdem die Ärztin gegangen war, horchte Jesse lange auf das Ticken der Wanduhr. Und in der Kammer neben der Küche schlief die schöne fremde Frau.
3. KAPITEL
Dunkelheit. Das Keuchen ihrer Atemzüge. Bilder und Erinnerungsfetzen. Das Gesicht eines Fremden. Starke Arme, die sie umfingen. Die Frucht der Schande in ihrem Bauch, das heranwachsende Leben in ihr, das sie liebte.
Der Gedanke an das Baby zwang sie aufzuwachen. Das Bett, in dem sie lag, war erstaunlich weich, ein willkommener Luxus nach der Enge im Schiffsrumpf.
Was haben wir denn da? Einen blinden Passagier? Das muss ich dem Kapitän melden.
Die Erinnerung jagte ihr einen Schauder über den Rücken, sie blinzelte träge, bis sie dunkle Umrisse erkennen konnte. Das kleine Viereck eines Fensters mit geschlossenen Läden. Ein Waschtisch, eine Seekiste. Ein klobiges Möbelstück, ein Schrank.
Ein starker, angenehmer Geruch. Seifenlauge, vielleicht. Und Kaffee, der schon eine Weile stand.
Geborgen. Hier fühlte sie sich geborgen. Sie hatte zwar keine Ahnung, wo dieses Hier war, spürte aber eine Kraft, die sie schützte und wärmte. Endlich in Sicherheit. Jeder Ort war sicher im Vergleich zu dem Ort, dem sie entflohen war.
Sobald ihr dieser Gedanke in den Sinn kam, wehrte sie sich dagegen. Sie war noch nicht bereit nachzudenken und wünschte sich, die Vergangenheit vergessen zu können.
Sie legte die Hand über die sanfte Wölbung ihres Leibes. Nein. Es gab kein Vergessen.
„Hallo?“, flüsterte sie in die Dunkelheit.
Keine Antwort. Nur ein entferntes, stetiges Rauschen.
Zaghaft schob sie die Decken von sich und verzog das Gesicht, als ihr ein scharfer Schmerz in die Schulter fuhr. Sie trug ein Nachthemd aus weichem Flanell – ein warmer Stoff, den sie sich als Kind gewünscht hätte, wenn sie im Speicher der Kate ihrer Eltern vor Kälte schlotterte, da das Herdfeuer in der Stube nicht ausreichte, um ihre Kammer zu wärmen.
Sie stand vorsichtig auf, tastete sich an der Wand entlang zur Tür, die einen Spalt offen stand. An der rauen Holzwand zog sie sich einen Schiefer ein, den sie nicht beachtete. Nach all dem Grauen, das sie durchgemacht hatte, konnte sie ein winziger Splitter in der Haut nicht erschüttern.
Der Holzboden war im Laufe der Jahre glatt geschliffen. An der Tür blieb sie stehen und sammelte ihre Kräfte.
Das Rauschen musste die Meeresbrandung sein, die gegen Felsen schlug.
Sie hatte ihr Leben am Meer verbracht und empfand das Tosen als angenehm. Der Schiffbruch hatte ihrer Liebe zum Meer keinen Abbruch getan. Was immer auch geschah, das Tosen der Wellen hatte ewigen Bestand.
Ein behäbiger Eisenherd in der Küche verbreitete wohltuende Wärme. Von der Küche aus öffnete sich ein Wohnraum. Sie machte die Herdklappe auf, um mehr Licht zu bekommen. Der rötliche Schein der Flammen ließ grob gezimmerte Einrichtungsgegenstände und eine schmale Stiege erkennen. Sie stieg die Stufen hinauf und spähte durch eine offene Tür. In der Dämmerung erkannte sie ein großes Pfostenbett.
Das Bett war leer.
Wo bin ich eigentlich?
Obwohl sie nun bei jedem Schritt gegen den Schwindel ankämpfte, drängte es sie, das Haus weiter zu erkunden, um Antworten auf die Fragen zu finden, die ihr im Kopf herumschwirrten. Mit zittrigen Knien stieg sie die Stufen wieder hinunter, trat ins Freie auf eine Holzveranda.
Nun hörte sie das Tosen der Brandung laut und rhythmisch. Über den dunklen Himmel zogen große Wolken, die, von einem seltsamen Licht beleuchtet, wie fette Fische durch die Nacht schwammen.
Woher kam dieses Licht? Verwirrt hielt sie sich an der Balustrade fest, der Schwindel hatte sich verstärkt, ihre verletzte Schulter pochte schmerzhaft. In der Dunkelheit erspähte sie einen Holzverschlag, halb verdeckt von Fliederbüschen. Das Klosett? Ja. Fröstelnd tappte sie auf nackten Füßen durch frisch gemähtes, nasses Gras. Nachdem sie sich erleichtert hatte und den Verschlag verließ, wurde sie wie magisch von dem silbrigen Lichtschein angezogen. Mühsam schleppte sie sich einen sanften Hügel hinauf. Hinter dichten hohen Bäumen ragte die Silhouette eines imposanten Turms in den Nachthimmel. Ein Leuchtturm.
Erinnerungsfetzen stiegen in ihr auf. Das grässliche Übelkeitsgefühl, als der Schiffsrumpf von einer Seite zur anderen schlingerte. Das Ächzen und splitternde Krachen der berstenden Schiffsplanken. Ein Seemann, der ihr mit heiserer Stimme etwas zuschrie, ihr ein Tauende zuwarf. Ein Stück vom Mast oder der Rahnock, das im Wasser trieb. Sie hatte sich mit dem Tau daran festgebunden. Sie erinnerte sich, wie sie den Horizont verzweifelt mit Blicken abgesucht hatte.
Als die See den Viermaster verschlang – Blind Chance hieß das Schiff –, mit unheimlich gurgelndem Schlürfen, hatte sie das Licht erspäht, zunächst wie eine schwache Funzel. Es konnte kein Stern sein, dafür stand es zu tief am Horizont. Sie hatte das Licht nicht mehr aus den Augen gelassen, war stundenlang, wie ihr schien, mit Händen und Füßen in seine Richtung gepaddelt. Das Wasser war kalt, aber erträglich. In gleich bleibendem Takt hatte der Leuchtturm sie näher und näher gezogen: Ein lang anhaltender Lichtstreifen, gefolgt von kurzer Dunkelheit, tauchte mit zuversichtlicher Regelmäßigkeit auf, spornte sie an, durchzuhalten.
Als die Morgendämmerung den Horizont schwach erhellte, hatte die Erschöpfung sie übermannt. Als letztes Bild hatte ihr Bewusstsein das Licht wahrgenommen. Sie entsann sich, gedacht zu haben, es sei tröstlich, mit dem letzten Atemzug ein Licht zu sehen.
Nun stand sie auf der Hügelkuppe in maßlosem Staunen, überlebt zu haben.
Aber wer war ihr Retter?
Sie überlegte, ob sie ihn suchen sollte, stand unschlüssig im Schatten eines hohen Nadelbaumes, spürte die feuchte, nachgiebige Erde unter ihren nackten Fußsohlen.
Und dann sah sie ihn.
Ihr erster Gedanke war Flucht. Doch das war wohl nicht nötig, er konnte sie gewiss nicht sehen.
Er stand auf dem eisernen Laufgang hoch oben auf dem Turm und blickte auf die See hinaus. Der rotierende Lichtstreifen erfasste seine hohe Gestalt. Der Nachtwind zerrte an seinen langen Haaren. Etwas erschien ihr merkwürdig an seiner Haltung. Er hatte die Hände tief in den Taschen seiner Seemannsjacke vergraben und die Schultern hochgezogen, als friere er. Aber die Nacht war nicht kalt, es wehte ein lauer Wind.
Er stand reglos, versteinert wie der Turm. Der Lichtkegel, der ihn in regelmäßigen Abständen streifte, tauchte ihn in einen fahlen, gespenstischen Schein.
Nur das Licht bewegte sich, der Mann aber stand vollkommen still.
Sie beobachtete ihn lange, eine Ewigkeit, wie ihr schien. In die Gestalt des Fremden an der Eisenbrüstung des Leuchtturms kam kein Leben. Müde und geschwächt schleppte sie sich mit letzter Kraft ins Haus und kroch wieder ins Bett.
Kaum lag ihr Kopf auf dem Kissen, war sie wieder eingeschlafen und hatte zum ersten Mal seit langer Zeit keine Angst.
Es war Zeit, sich von der Nacht zu verabschieden.
Jesse genoss die stillen Momente zwischen Nacht und Tag. Würziger Geruch stieg vom feuchten Waldboden und den Wiesen auf. Die Kormorane, die sich nachts in den Klippen niedergelassen hatten, ließen ihre klagenden Schreie hören. Ein graues Nichts, in dem die Welt stillzustehen schien. Die Nacht war gegangen, und ein neuer Tag brach an. In diesen Momenten zwischen der Zeit war er ganz allein, was er so schätzte. Die Stille. Den Frieden.
Der neue Tag gab kein Versprechen. Nur die Gleichförmigkeit des Vortags und das dumpfe Wissen, dass der morgige Tag ebenso eintönig verlaufen würde.
Dies wurde Jesse in solchen Augenblicken deutlicher bewusst als sonst, wenn der Horizont sich erhellte, als gieße man Wasser in schwarze Tinte, bevor der Tag den Himmel im Osten in stechender Klarheit färbte.
Doch heute ist alles anders, dachte er, betrat das Haus und näherte sich der Kammer neben der Küche. Wegen ihr.
Sie lag anders da als vor ein paar Stunden, stellte er im Morgengrauen fest. Sie lag schräg im Bett, schlief tief und entspannt wie ein Kind. Eine der beiden Steppdecken war auf den Fußboden gerutscht.
Sein Blick glitt durchs Zimmer. Die Schüssel und der Krug auf dem Waschtisch waren unberührt. Er trat einen Schritt vor, um besser sehen zu können.
Ein nackter Fuß, zart wie der einer Porzellanpuppe, lugte unter den Decken hervor. An der Fußsohle klebten nasse Tannennadeln.
Jesse richtete sich so hastig auf, dass er mit dem Kopf gegen einen niedrigen Holzbalken stieß. Er fluchte leise. Der Gedanke, dass diese fremde Person in seinem Haus herumschnüffelte, behagte ihm nicht. Es passte ihm nicht, dass sie in seine kleine Welt eindrang, die er sich erschaffen hatte, dass sie sich ein Urteil über ihn bildete.
Er wischte den Gedanken beiseite. Die Frau war krank. Wieso sollte sie an ihm interessiert sein? Vermutlich war sie orientierungslos und benommen herumgeirrt auf der Suche nach ihrem Ehemann, den sie bei dem Schiffsunglück verloren hatte.
Wieso sollte sie sich für einen Leuchtturmwärter interessieren? Sie hatte keinen Grund, in seinem Leben herumzuschnüffeln. Sobald sie gesund wäre, würde sie zu ihrer Familie zurückgehen.
Jesse blieb noch einen Moment. Das zunehmende Morgenlicht erhellte die Kammer. Er sollte gehen, sie in Ruhe lassen, rührte sich aber nicht von der Stelle, gebannt in einer unerklärlichen Faszination.
Fiona hatte die Situation für so selbstverständlich genommen. Wieso begriff sie nicht, wie ungewöhnlich das alles war? Weshalb fehlte ihr jedes Verständnis für seine Ablehnung, diese Frau kennen zu lernen?
Die zarte Schönheit dieser Fremden war ein glatter Hohn. Eine Prüfung. Ein boshaftes Schicksal wollte ihn auf die Probe stellen, ob er willensstark genug war, um einem engelsgleichen Gesicht, einem Körper, verlockend wie eine reife Frucht, zu widerstehen.
„Verdammt“, knurrte er in die Stille. „Wieso sieht sie nicht aus wie eine alte Hexe?“
Seltsamerweise würde das kaum etwas an der Situation ändern. Wenn sie ein Froschgesicht oder drei Arme hätte, würde er nicht anders empfinden. Auch dann wäre er von dem Geheimnis, das sie umgab, fasziniert. Ihre Schönheit war nur das Tüpfelchen auf dem i dieser ironischen Schicksalswende.
Die ersten Sonnenstrahlen stahlen sich durchs Fenster. Sie seufzte im Schlaf, drehte sich auf die andere Seite, zog die Knie an und legte einen Arm schützend über ihren gewölbten Leib.
Sie war im fünften Monat schwanger, hatte Fiona gesagt. Das Baby machte sich bemerkbar, und die Mutter würde die winzigen Stöße von Armen und Beinen spüren. Fiona hatte ihm das mit einem seligen Lächeln verkündet, als erwarte sie, er würde sich darüber freuen.
Eine lange Haarsträhne fiel der Schlafenden ins Gesicht. Jesse konnte den Blick nicht wenden. Ein Strahlenbündel der Morgensonne verlieh ihrem Haar einen rubinroten Glanz. Er beugte sich vor und strich ihr das Haar nach hinten. Die Berührung der seidig weichen Locke traf ihn so unerwartet, dass ihm der Atem stockte.
Hastig richtete er sich auf und trat einen Schritt zurück. Er hatte sie berührt. Sie war eine Fremde. Die Frau eines anderen. Oder eine Witwe. Jesse Morgan hatte kein Recht, sie zu berühren.
Er verließ die Kammer, schloss die Tür bis auf einen winzigen Spalt, um zu hören, wenn sie das Bett verließ. In seinem Zimmer schleuderte er die Stiefel von sich und sank mit einem tiefen Stöhnen aufs Bett.
Aber er konnte nicht schlafen, die Gegenwart der fremden Frau irritierte ihn. Es war eine Verheißung, die nicht für ihn bestimmt war.
„Wie schön, Sie wieder einmal zu sehen, Mr. Jones“, grüßte der livrierte Portier mit einer unterwürfigen Verbeugung.
Granger erwiderte den Gruß mit einem knappen Nicken. Der lächelnde Portier ließ sich den falschen Namen auf der Zunge zergehen und zwinkerte Mr. Jones vertraulich zu.
Doch Granger war schlecht gelaunt und hatte wenig Sinn für Vertraulichkeiten. Am Montagmorgen, beim Betreten seines Kontors in San Francisco, hatte er erfahren, dass eines seiner Schiffe nicht im Hafen von Portland eingelaufen war. Am Dienstag entschlossen die leitenden Direktoren sich, die Versicherungsgesellschaft davon zu unterrichten, dass der Viermaster mit großer Wahrscheinlichkeit auf eine Sandbank in der Mündung des Columbia Rivers aufgelaufen und gesunken war, Schiffbruch erlitten hatte, wie ungezählte Schiffe zuvor.
Er fragte sich, wie das passieren konnte. Der Kapitän war ein erfahrener Mann, der seit vielen Jahren in seinen Diensten stand. Hatte der alte Seebär im dichten Nebel die Untiefen falsch eingeschätzt? Hatte der Leuchtturmwärter seine Pflicht vernachlässigt? Granger wusste, welche verheerenden Folgen eine solche Nachlässigkeit nach sich ziehen würde. Er selbst hatte vor vielen Jahren mit dieser List bittere Vergeltung an seinem Todfeind genommen – an Jesse Kane Morgan. Sein Freund, sein Geschäftspartner, sein Rivale, der Mann, der ihm alles genommen hatte.
Selbst jetzt noch, nach all den Jahren, durchbohrte Granger ein Stich der Eifersucht bei dem Gedanken, dass ihn die geliebte Frau abgewiesen und Jesse geheiratet hatte. Emily und Jesse, das glückliche Paar, von der Gesellschaft in Portland und San Francisco gleichermaßen bejubelt und gefeiert. Aber der Stachel in Grangers Fleisch schmerzte noch immer, auch nachdem er dieses Glück zerstört hatte. Vielleicht musste er noch mehr zerstören, um seine Rachegelüste zu stillen.
Ungehalten eilte er am Türsteher vorbei, durchquerte das Marmorfoyer des Esperson Building, der vornehmsten Wohnadresse in San Francisco, die „Mr. Jones“ sich ein kleines Vermögen kosten ließ.
Aber er kam reichlich auf seine Kosten. Während er die breite Treppe mit dem glänzenden Messinggeländer hinaufeilte, barg er das Gesicht in dem Blumenstrauß in seiner Hand und sog den Rosenduft tief ein. Er dachte an ihre sanfte Hand an seiner Stirn, ihre großen Augen, ihren unschuldigen Blick. Sie war seine Zuflucht vor den Stürmen des Lebens, bei ihr suchte er Schutz, wenn alle sich gegen ihn stellten. Seine ständig nörgelnden Eltern, seine enttäuschende Ehefrau, seine lästigen Gläubiger – all diese Menschen ließ er hinter sich, wenn er sie besuchte.
Bald würde er diese kostspielige Wohnung aufgeben. Wenn er sein Ziel bei dem Mädchen erreicht hatte, würde er es in eine bescheidenere Unterkunft einquartieren. Als er sie kennen gelernt hatte – verzweifelt und halb verhungert und dennoch unendlich reizvoll –, hatte er ihr nach allen Regeln der Kunst den Hof gemacht. Um sie von seinen ehrlichen Absichten zu überzeugen und ihr das Gefühl der Geborgenheit zu geben, hatte er ihr eine Luxuswohnung im exklusiven Esperson gemietet und sie besucht, wann immer seine Zeit es gestattete.
Er nahm sich häufig Zeit für sie. Und bald würde er für seine Bemühungen belohnt werden. Vor einigen Wochen hatte sie ihm gestanden, ein Kind von ihm zu erwarten, und ihm bei ihrem Geständnis hoffnungsvoll in die Augen geblickt. „Nun werden wir heiraten, damit das Kleine den Namen seines Vaters trägt“, hatte sie gesagt.
Er hätte sie nicht auslachen dürfen, aber er hatte sich nicht beherrschen können. Er wünschte sich, dass sie ihm ein Kind gebar – einzig und allein darum ging es ihm. Das Kind würde tatsächlich seinen Namen tragen, wenn sie es ihm nach der Geburt aushändigte. Allerdings hatte er einen schweren Fehler begangen, ihr seinen Plan zu erzählen. Er hätte das Geheimnis für sich bewahren sollen, bis es so weit war. Dummerweise hatte er ihren Mutterinstinkt unterschätzt.
Voller Entsetzen und außer sich hatte sie einen Handspiegel nach ihm geschleudert. Er hatte versucht, beschwichtigend auf sie einzureden. „Hab keine Angst, beruhige dich. Ich will dir nicht wehtun …“
Und in den darauffolgenden Wochen war sie tatsächlich ruhiger geworden, und er hatte zu hoffen begonnen, dass sie Einsicht zeigen und seinen Standpunkt akzeptieren würde. Geduldig hatte er ihr die Vorzüge erklärt, die sein Sohn genießen sollte, den er zum Erben seines Vermögens einzusetzen beabsichtigte. Er sollte die besten Schulen besuchen und später ein unbeschwertes Leben in Reichtum in den besten Gesellschaftskreisen von San Francisco und Portland führen.
Sie würde sich über die Blumen freuen, vielleicht konnte er ihr damit sogar ein Lächeln entlocken. Eine Weile blieb er vor der Tür stehen, bis sein Atem sich vom hastigen Treppensteigen erholt hatte. Der Gedanke an das Kind rief eine Sehnsucht in ihm wach, so mächtig, dass er beinahe laut aufgejauchzt hätte. Ein Sohn, ein Erbe. Ein Sohn, dem er die Welt zeigen könnte, der auf seinen Knien sitzen und andächtig seinen Geschichten lauschen würde. Ein Sohn, der ihn lieben würde, so wie er nie geliebt worden war.
Er drehte den Kristallknauf und öffnete die Tür. Jedes Mal beim Betreten der Diele trat er auf die einzige knarrende Stelle im Parkett. Diesmal knarrte sie besonders laut in der stillen Wohnung. „Ich bin es“, rief er. „Ich habe dir etwas mitgebracht.“
Stille. Vielleicht schlief sie. Frauen in anderen Umständen brauchten viel Schlaf. Doch das sorgfältig gemachte Bett war leer.
Eine kalte Ahnung beschlich ihn, dennoch bewahrte er Ruhe. Methodisch durchsuchte er jeden Winkel der eleganten Wohnung. Nichts fehlte – keine Silbergabel, kein Kleid, keines der Schmuckstücke, die er ihr geschenkt hatte. Nur eines fehlte: die Frau.
Er zwang sich zur Ruhe und wartete. Vermutlich war sie ausgegangen, machte einen Spaziergang, einen Einkaufsbummel. Ja, so musste es sein. Doch später, nachdem er den Portier befragt und erfahren hatte, dass sie eine Woche zuvor aus dem Haus gegangen war und seither nicht mehr gesehen worden war, musste er sich eingestehen, dass sie ihn verlassen hatte.
Verwundert blickte er auf den Rosenstrauß, den er noch immer in der Hand hielt, ohne es zu bemerken. Und dann zerdrückte er jede einzelne Rose bis zur Unkenntlichkeit, ohne auf die Dornen zu achten, die ihm die Finger blutig stachen.
Jesse starrte in die Holzbalken und horchte auf das Ticken der Wanduhr. Nach langer Zeit zog er seine Stiefel wieder an und verließ das Haus, um die Pferde zu versorgen.