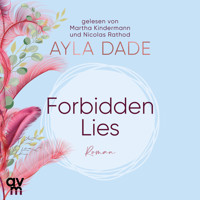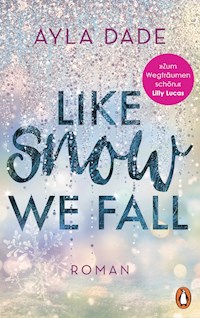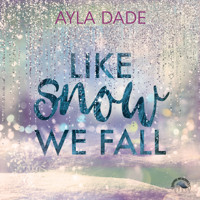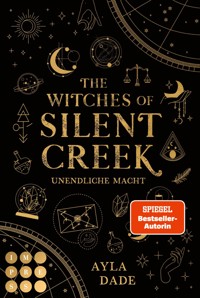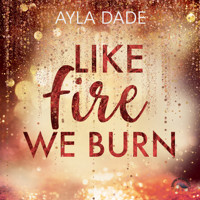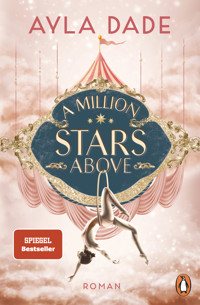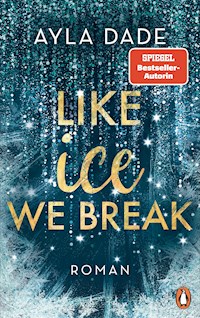
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Winter-Dreams-Reihe
- Sprache: Deutsch
Als Einzelläufer waren sie es gewohnt, für sich selbst zu kämpfen. Doch um es gemeinsam an die Spitze zu schaffen, müssen sie lernen, einander bedingungslos zu vertrauen ...
Als die renommierte Eislaufschule iSkate der jungen Einzelläuferin Gwen kündigt, fühlt es sich an, als würde das Eis unter ihr brechen. Alles, wofür sie gelebt und hart trainiert hat, ist plötzlich umsonst. Der einzige Ausweg: Sie läuft künftig zusammen mit einem Partner. Und als wäre das nicht schlimm genug, handelt es sich ausgerechnet um den Neuen in Aspen: Oscar, dem sie nach einem katastrophalen Abend nie wieder unter die Augen treten wollte. Seine Ablehnung ist überdeutlich, und doch löst sein Blick ein unerwünschtes Prickeln in ihren Adern aus. Auch wenn sich alles in ihr sträubt, ihm die Kontrolle zu überlassen, ergreift Gwen diese letzte Chance auf ihren großen Traum. Um gemeinsam über das Eis zu fliegen, braucht es Leidenschaft und grenzenloses Vertrauen – doch Gwen spürt nicht nur, dass Oscar düstere Geheimnisse vor ihr hat. Viel schlimmer ist, dass sie sich selbst nicht mehr trauen kann ...
Erlebe ein Feuerwerk der Gefühle im Wintersportparadies Aspen – mit den weiteren Bänden der zauberhaften Winter-Dreams-Reihe:
1. Like Snow We Fall
2. Like Fire We Burn
3. Like Ice We Break
4. Like Shadows We Hide
Die Bände der Reihe sind unabhängig voneinander lesbar.
Enthaltene Tropes: Sports Romance, Dark Secret, Enemies to Lovers, Forced Proximity
Spice-Level: 3 von 5
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 539
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
AYLA DADE wurde 1994 geboren und lebt mit ihrer Familie im Norden Deutschlands. Sie hat Jura studiert, nutzt aber am liebsten jede freie Minute zum Schreiben. Die Seiten ihrer Romane füllt die beliebte Buchbloggerin mit großen Emotionen an zauberhaften Schauplätzen. Wenn sie sich nicht in die Welt ihrer Bücher träumt, verbringt sie ihre Zeit mit Sport und kuschligen Lesestunden vor dem Kamin. Bereits mit Like Snow We Fall und Like Fire We Burn, den ersten beiden Bänden ihrer Winter-Dreams-Reihe, eroberte sie die Herzen ihrer Leserinnen und die Bestsellerliste im Sturm.
Heiß geliebt von Leser*innen, Blogger*innen und in der Presse:
»Eine Eiskunstläuferin, die nach den Sternen greift. Ein Snowboarder, der die Herzen höher schlagen lässt. Und ein Ort, der eine lebendige Postkarte sein könnte. Zum Wegträumen schön!« Bestsellerautorin Lilly Lucas über Like Snow We Fall
»Diese New-Adult-Romance ist der perfekte Lesestoff für kalte Tage.« OK! Über Like Snow We Fall
»Dieses Buch, die Geschichte von Aria und Wyatt, ist alles auf einmal: Gänsehaut, Herzschmerz, Poesie, Liebe und all das, was dazwischen liegt!« alexandra_nordwest über Like Fire We Burn
»Das Buch ist ein Wohlfühlroman sondergleichen und großartig geschrieben.« Literaturblog »Buechegge« über Like Fire We Burn
Außerdem von Ayla Dade lieferbar:
Like Snow We Fall
Like Fire We Burn
AYLA DADE
LIKE ICEWE BREAK
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2022 by Penguin Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Umschlag: bürosüd GmbH
Umschlagmotiv: www.buerosued.de
Redaktion: Steffi Korda
Sensitivity Reading: Cathérine Patzelt
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-29447-2V001
www.penguin-verlag.de
Liebe Leser*innen,
es könnte sein, dass einige Passagen des Buches euch persönlich nahegehen, wenn ihr ähnliche Erfahrungen macht oder gemacht habt. Aus diesem Grund findet ihr eine Triggerwarnung, die aufzeigt, um welche Inhalte es sich hierbei handelt.
Ayla Dade und der Penguin Verlag
Für KathrinDanke für dein Bibidi Bobedi Boo, weil meine Aspen Crew ohne dich nicht existieren würde.1000x danke, 1000x mehr, weil ich nicht weiß, was jetzt ohne dich wär.
Es gab diesen Moment
Wir haben uns getroffen
zum ersten Mal
und da war Magie
überall
Du hast mich angesehen und laut gedacht
Ozean-Augen, mit einem Glanz, der stumme Worte formte
Sie wisperten:
Du bist ganz anders
Ganz anders, als die Welt dich haben will
Und das ist das absolut
Schönste an dir
Ich hatte keine Kraft, dir zu erklären
wer ich war
Also nahm ich dich an die Hand
und zeigte dir das Leben
so wie ich es sah
Und dabei dachte ich:
ich glaub, ich geh grad
unter
falle tief und schwerelos
deshalb brauch ich deine Hand, die mich führt
Zusammen machen wir alles
wieder bunter
Und keine Ahnung, was du fühlst
keine Ahnung, ob da überhaupt was ist
weiß nur, dass du für mich
irgendwie gerade alles bist
Ayla Dade
BLEEDING TREES
Oscar
Reiche Chicks sind reiche Chicks. Das ergibt keinen Sinn, klar, aber für mich schon. Ich meine, ich sehe sie an, und sie sind einfach genau das.
Reiche. Chicks.
Facettenreich? Nope. Interessant? Scheiße, nein. Tiefgründig, mit diesem seltenen Schimmer in den Augen, der mir verrät, dass da eine Seele weint, ein Herz kämpft? Fehlanzeige.
In ihren guten Tagen, als ich sie noch nicht zerstört hatte, hätte Briony Adams mich jetzt mit ihrem vorwurfsvollen Blick traktiert. Sie hätte den Kopf geschüttelt und gesagt: »Das ist Schwachsinn, Oscar, so ein verdammter Schwachsinn. Du hast Vorurteile, weil du so viel Mist erlebt hast und deshalb nur das Schlechte siehst. Nur das, was du sehen willst. Ich kann nicht fassen, dass dir so etwas Bescheuertes über die Lippen kommt, weil das eigentlich gar nicht geht, weil deine Lippen zu göttlich für so einen Scheiß sind, meine Fresse.« Das kam in jedem Satz vor, mindestens. Meine Fresse war einfach ihr Ausdruck, ohne den ging es nicht. Sie sagte es schon damals auf der Highschool, wenn ihr Marker wieder einmal leer war, weil sie immer den kompletten Text markierte. Sie sagte es beim Sex, sie sagte es, wenn ich mich geprügelt hatte – also jeden Tag. Sie schüttete billige Cornflakes in diese hässliche Tonschüssel vom Flohmarkt und sagte meine Fresse, einfach so, keine Ahnung, warum. Aber was ich weiß, ist, dass Briony recht hätte. Ich sehe diese Leute so, wie ich sie sehen will. Ich habe Vorurteile.
Witzig, dass ich jetzt zu ihnen gehöre. Nicht zu den Chicks, aber zu den Kids. Den Rich Kids. Oder eher Bonzen, wenn man bedenkt, dass ich längst erwachsen bin. Auch wenn ich mich manchmal, nachts, schweißgebadet nach einem Albtraum, noch immer wie ein armseliges Kind im Dreck fühle.
»Mrs Addington?«
Georgia, deren Blick gerade noch den Saal nach der Veranstalterin dieses Wohltätigkeitsabends abgesucht hat, dreht sich jäh um. Ihr teures Parfüm steigt mir in die Nase. Es übertüncht sogar mein eigenes. Ihre großen braunen Augen heften sich auf die junge Frau, die uns den Weg abgeschnitten hat, und plötzlich macht sich ein breites Lächeln auf Georgias Lippen breit, als sie das engelsgleiche Gesicht mit den goldenen Löckchen zu erkennen scheint.
»Phoebe!« Georgia legt ihre Hände auf Phoebes zierliche Schultern, dann hauchen sie sich links und rechts ein Küsschen zu, ganz adrett, natürlich, denn sie sind ja reiche Chicks. »Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Meine Güte, wie geht es dir? Wie war die Zeit mit deiner Verwandtschaft? Himmel, bist du erwachsen geworden!« Bevor Phoebe, die in meinem Alter zu sein scheint, antworten kann, dreht Georgia sich zu mir um. Sie nickt wie ein Wackeldackel, ganz aufgeregt, klar, klar, hör mal, Oscar, hör mal, hier sind News, die du dir merken musst, unbedingt, weil du dich anpassen sollst, hatten wir ja so besprochen, weißt doch. »Phoebe war für einige Jahre am niederländischen Königshof! Sie ist entfernt mit der Königin verwandt, ist das nicht aufregend?«
»So aufregend, ich kipp gleich um.« Ich schenke Phoebe mein Grinsen, von dem ich weiß, dass es seine Wirkung bis in ihre Mitte entfaltet, und verfluche Georgia innerlich dafür, mich mitgeschleppt zu haben, weil die Leute mich kennenlernen sollten.
Phoebe starrt mich an, und dann, wow, so unauffällig, zupft sie den Ausschnitt ihres Kleides etwas tiefer. Nicht dass es mich stören würde. Ich liebe es, wenn Frauen ihre Vorzüge zur Geltung bringen. Dazu haben sie jedes Recht.
»Phoebe, ja? Ich könnte dich Prinzessin nennen, wenn du willst.«
»Oscar!«, zischt Georgia.
Aber Phoebe wedelt bloß mit ihrer Hand durch die Luft – selbst diese Geste wirkt eleganter als meine Haltung in dem steifen Yves-Saint-Laurent-Smoking. Sie lächelt, aber sie kennt mich nicht, sie weiß nicht, dass ich ein Meister darin bin, Menschen zu lesen. Ihre porenfreie Haut über den Wangenknochen färbt sich rosa. In einer nervösen Geste streicht sie sich über den Chiffonstoff ihres Cocktailkleides. Ich sehe, wie sie schluckt, während sie mich mustert, und in ihren Augen erkenne ich den Ausdruck, den ich meistens zu sehen bekomme, wenn ich mit Frauen spreche: Verlangen.
Phoebe hat keine Ahnung, was für eine dreckige Geschichte mein Herz zertrümmert und aus einzelnen Splittern wieder zusammengesetzt hat. Was für ein Glück, dass dir dieser Teil erspart bleibt, Prinzessin. Er würde dich verderben, und jeder weiß doch, dass Prinzessinnen nicht schmutzig werden dürfen.
Aber Phoebe will mich, bei Gott, sie will mich so hart.
»Er albert doch nur rum, Mrs Addington.« Ihr Blick heftet sich auf mich. Phoebe streicht sich eine Strähne ihres blonden Haares über die Schulter und macht eine Bewegung, die ich nicht einordnen kann. Es ist eine Mischung aus Kopfneigen, Lächeln und irgendeiner Art angedeuteter Miniknicks oder so. Wohl so ein Ding reicher Chicks, kein Plan. »Ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen?«
»Leider nicht. Daran hätte ich mich erinnert.«
»Oscar!« Georgia muss sich zusammennehmen, um ihre Kinnlade daran zu hindern herunterzufallen.
Phoebe hingegen lacht leise. »Ich weiß nicht, was du meinst.«
»Dürfen Prinzessinnen lügen?« Meine Stimme ist kühl und abweisend, ein bisschen nüchtern, aber Phoebe kichert trotzdem.
»Lieber Herr im Himmel«, murmelt Georgia. Sie schließt kurz die Augen, ehe sie sich mit einem entschuldigenden Blick an unsere Little Princess wendet. »Es tut mir leid, Phoebe. Ihm fällt es noch etwas schwer, sich einzugewöhnen. Oscar ist … Wir haben ihn adoptiert.«
Korrigier dich nicht, Georgia. Nenn die Sache beim Namen. Sag, was du sagen wolltest. Oscar war ein Straßenpenner.
»Oh, du bist der Oscar! Der Eiskunstläufer, der auf TikTok viral gegangen ist!« Sie ist kurz vor der Schnappatmung. »Meine Eltern haben mir erzählt, dass du jetzt bei den Addingtons lebst. Und dass du einen Haufen Werbedeals durch deine Bekanntheit bekommst. Freut mich so sehr für dich! Vor allem … mit deiner Herkunft.« Phoebe sieht mich mit diesem bestimmten Blick an, der mit zwei Wörtern perfekt zu beschreiben ist:
Reiches.
Chick.
Sie lächelt ein breites Lächeln, mit dem sie mir sagen will, wie wundervoll das alles ist, die Adoption und ich und überhaupt all diese rosa Bläschen um uns herum, die gar nicht da sind, aber sie lässt sie irgendwie entstehen durch ihren Ach-wie-ist-das-alles-schön-Blick. Aber hinter der Fassade stecken ganz andere Gedanken. Ich zweifle nicht daran, dass jeder andere ihr dieses geheuchelte Lächeln abkaufen würde, aber, sorry, ich habe gerade elf Jahre Dreck auf den Straßen der Bronx hinter mir. Ich weiß, wie Menschen ticken. Ich weiß, was Menschen wirklich denken, wenn sie dir ins Gesicht lachen. Ich kann sie alle lesen, als wären sie offene Grundschulbücher mit dicken Großbuchstaben.
Phoebe lächelt, aber ihre Augen sagen etwas anderes. Die Art, wie sie mich mustert. Wie ihr Blick an der Narbe in meinem Gesicht hängen bleibt. Nicht mehr bewundernd, sondern wertend. Wie sie meinen Anzug betrachtet, ganz schnell, nur eine kleine Bewegung ihrer Augen. Sie denkt, ich hätte ihn nicht verdient. Sie denkt, dass ich nicht zu ihnen gehöre. Verwunderung in ihrem Blick, Vorurteile im Herzen. Klar, sie will mich trotzdem, auch das erkenne ich. Ihr gerötetes Dekolleté. Der leichte Biss auf die Unterlippe. Ein einladender Augenaufschlag. Sie zieht mich förmlich mit den Blicken aus. Ja, sie will mich. Aber nicht, weil ich einen potenziellen Partner für ihre Zukunft abgäbe, sondern weil ich der verbotene Junge bin, den eine Prinzessin nicht anfassen darf. Ihre Gedanken sind so laut, sie schreien mich an.
Der hat Narben im Gesicht. Schwarze Tinte auf dem freien Stück Haut, das die Ärmel seines Sakkos freigeben. Und, fuck, er hat Muskeln, als wäre er tägliche Straßenkämpfe gewohnt. Es muss einen Grund geben, warum er adoptiert wurde. Vielleicht wollten ihn seine Eltern nicht. Vielleicht war er ihnen zu anstrengend, weil er nur Probleme gemacht hat. Probleme … Badboy.
Das letzte Wort ist ihre Alarmsirene. Rot blinkend. Das Stoppschild, vor dem alle Mütter warnen – und gleichzeitig die große Tüte Popcorn mit fettigem Buttertopping am schwächsten Moment ihrer Diät.
»Ja, der Oscar«, sage ich. »Aber mach dir keine Hoffnungen. Ich bin vielleicht adoptiert, aber unsere Welten könnten unterschiedlicher nicht sein, Prinzessin.«
Klang hart, aber ich war ehrlich. Ich würde keine Frau ausnutzen. Vor allem nicht ihre Gefühle.
Ich kenne Georgia gerade einmal ein paar Monate. Die Addingtons haben mich letztes Jahr im Central Park auf dem gefrorenen See laufen sehen, den berühmten Oscar, dessen Reels viral gingen. Von heute auf morgen war der bisherige Straßenpenner ein angehimmelter Influencer, dem tagtäglich Werbeverträge angeboten wurden. Kohle hier, Models da. Nur keine Familie. Die gab’s nicht dazu.
Als Georgia mir erzählte, dass sie sich nach einem Sohn sehne, dachte ich, sie würde mich verarschen. Für gewöhnlich adoptierten Frauen mit Kinderwunsch Babys. Oder Kleinkinder. Aber keinen erwachsenen Mann, der längst niemanden brauchte.
Tja, Georgia nicht. Sie meinte es ernst. Sie wollte keinen kleiner Scheißer, wie sie es ausdrückte, der ihr jeden Nerv raubte, sondern diesen Teil gern überspringen und ein großes »Kind«, für das sie sorgen könnte. Wie gesagt, es war alles sehr plötzlich gekommen. Genauso meine Entscheidung, zu ihnen nach Aspen zu ziehen. Immerhin kannte ich die beiden kaum. Aber was ich inzwischen mit Gewissheit über Georgia weiß: In ihrem Hirn schlägt irgendeine feine Antenne aus, sobald eine für sie nicht akzeptable Stimmung herrscht. Und die Stimmung zwischen mir und Phoebe pulsiert förmlich, konstante Wellen aus ihren Lass-uns-jetzt-sofort-Sex-haben-du-verruchter-Typ-Gedanken und meinen lautlosen Bleib-mir-vom-Acker-du-reiches-Chick-Hilferufen. Eine interessante Mischung, bisschen heiß, bisschen unangenehm, aber Georgias Antenne dreht völlig durch, so hundert Prozent nicht akzeptabel ist das.
»Phoebe, komm, lass uns einen Martini trinken. Ich muss unbedingt alles über deinen Aufenthalt in den Niederlanden hören! Ist es wahr, dass sie dort Holzschuhe tragen?« Meine Adoptivmutter streckt den rechten Arm aus, um Phoebe an der Schulter in die andere Richtung zu führen.
Phoebe scheint hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, Georgia nicht vor den Kopf zu stoßen, und dem Verlangen, sich weiter mit dem bösen Jungen zu unterhalten. Aber der Händedruck meiner Ziehmutter scheint zu gewinnen, denn Phoebe wendet sich mit bedauernder Miene ab.
»Tu mir einen Gefallen und such Timothy, ja, Oscar?«, fügt Georgia an mich gerichtet hinzu, ehe sie sich von mir abwendet. »Er soll sich nicht den ganzen Abend wieder mit Whiskey zuschütten.«
»Alles klar.«
»Danke.« Sie lächelt kurz, bevor sie mit Phoebe verschwindet. Ich glaube, ihr Lächeln ist echt.
Und dann stehe ich allein in diesem riesigen Saal, vollgestopft mit Menschen, die ich alle nicht kenne, und Menschen, die ich überhaupt nicht kennen will. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das hier fühlt sich so dermaßen unecht an. Ich fühle mich unecht an. Wie ein veganes Hühnerfilet zwischen all den Fleischschenkeln auf dem Grill. Wie ich hier stehe in diesem fucking Anzug, der mehr gekostet hat, als ich je an Geld besessen habe, samt Krawatte, die in meinem früheren Leben bloß dafür gut gewesen wäre, sich den Arm abzuschnüren, bevor sich irgendjemand eine dreckige Spritze reingehauen hätte.
Keine Ahnung, wie ich mich verhalten soll. Keine Ahnung, wer ich sein soll, damit ich bin wie die anderen. Keine Ahnung, was ich sagen muss, um so zu klingen wie sie.
Keineahnungkeineahnungkeineahnung.
Beethovens neunte Sinfonie erfüllt den Saal. Vermutlich würden die meisten über mich denken, dass ich mit klassischer Musik nichts anfangen kann, denn, hallo, here I am, Oscar aus der Tonne, der hört nur Rap, den richtig harten von den Gangstern mit den Baggyhosen und Bandanas, mit all den Schimpfwörtern, die im Alltag nie, nie, niemals erlaubt sind. Aber nein, so ist es nicht. Ich steh auf klassische Musik. Sie beruhigt mich. Wenn alles in mir wieder einmal zu viel wird, wenn die Gedanken toben, das Blut pulsiert und ich aggressiv werde, einfach so ohne Grund, nur weil das Leben beschissen zu mir war, und ich wütend sein will, dann sind Beethoven, Mozart und Chopin, vor allem Chopin, meine besten Freunde.
»Es gibt zwei Möglichkeiten«, höre ich plötzlich eine Stimme neben mir.
Ich sehe zur Seite und erkenne eine hochgewachsene junge Frau mit fuchsrotem Haar und hellem Teint. Sommersprossen zieren ihr Gesicht. Die blauen Augen könnten friedlich wirken, wäre da nicht eine Verbitterung, eine abgrundtiefe Abneigung in ihnen. Gegen was ist diese Abneigung gerichtet? Die Menschen? Ihr Leben? Oder beides?
Sie nippt an ihrer Champagnerflöte und lässt den Blick durch den marmornen Saal schweifen. »Entweder, du steigst direkt aus dieser Scheiße aus und rebellierst, und damit meine ich, wirklich rebellieren, weil du so leicht nicht mehr aus der Sache hier herauskommst, oder du passt dich an. Für was auch immer du dich entscheidest, mach dir bewusst, dass es endgültig sein wird.«
Ich ziehe die Augenbrauen hoch. »Bisschen pathetisch, findest du nicht?«
»Nein.« Ihre Augen heften sich auf einen Mann, der sich mit einem anderen unterhält und dabei so laut und affektiert lacht, dass jeder Ton ein falsch, falsch, falsch mit sich trägt. »Ich meine es ernst. Du bist neu, du kannst dich noch entscheiden. Aber wofür auch immer, es wird Nachwirkungen haben.«
»Woher weißt du, dass ich neu bin?«
Jetzt erst sieht sie mich an, ein nachsichtiges Lächeln im Gesicht, als wäre ich ein kleines Kind, das sich gerade eine Ladung Eis über die Wangen geschmiert hat.
»Jeder hier weiß, dass du Oscar Addington bist. Und jeder weiß, dass du von der Straße kommst.«
»Aha.« Sie ist erfrischend ehrlich. Ich mag dieses Mädchen. Ich nehme mir eine Champagnerflöte vom Tablett eines Kellners, der an uns vorbeiläuft. »Und woher?«
Sie gibt ein leises Lachen von sich. »Du lebst nicht mehr in New York. Das hier ist Aspen. Jeder kennt jeden, und wenn etwas passiert, dann wissen sofort alle davon. Gewöhn dich dran. Außerdem«, sie streicht sich eine Korkenziehersträhne aus dem Gesicht, »gehörst du jetzt zur High Society. Hier sind Neuigkeiten die Drogen der Menschen. Sie brauchen sie wie die Luft zum Atmen, um sich die Mäuler mit ihren gespritzten Lippen über die Personen zu zerreißen, die sie als ihre Freunde bezeichnen.«
»Klingt, als wärst du richtig gern Teil dieser Gesellschaft.«
Sie gibt ein verbittertes Lachen von sich. »Es ist meine ganz persönliche Hölle. Aber wie ich schon sagte: unmöglich, hier wieder rauszukommen.«
»Wetten, es ist ganz einfach?« Ich kippe den Rest Champagner hinunter und genieße das Prickeln in meinem Mund. »Wetten, dass ich einfach umdrehen und aus dieser Tür hinausgehen könnte, ohne dass es jemanden interessiert?«
Die junge Frau hebt eine ihrer roten Augenbrauen in die Stirn. »Wetten, dass du dann wochenlang Gesprächsthema Nummer eins sein wirst, bei den nächsten Veranstaltungen vorwurfsvolle Blicke erntest, und deine Adoptiveltern dir verflucht lange Vorträge mit verflucht vielen Schimpfwörtern halten werden, warum du so etwas nicht machen kannst?« Sie neigte den Kopf. »Vermutlich stünde sogar dein Platz an der iSkate auf der Kippe.«
Scheinbar verbreiteten sich Neuigkeiten hier wirklich wie Flöhe auf einer Katze. Nachdem ich Georgia zugesagt hatte, dass ich zu ihnen ziehen und mich adoptieren lassen würde, haben die Addingtons mir einen Platz an der renommiertesten Eiskunstlaufschule weltweit gesichert. Es war immer mein Traum, dort hinzugehen. Jetzt hat sich nicht nur der erfüllt, sondern noch der andere, viel größere Wunsch, endlich Teil einer Familie zu sein. Endlich eine Konstante in meinem Leben zu haben, der ich etwas bedeute.
Eine Weile sehe ich das Mädchen an und überlege zu kontern. Aber schließlich lasse ich bloß resigniert die Schultern sinken. Ich habe keine Lust mehr zu kämpfen. Das musste ich zweiundzwanzig Jahre meines Lebens, seit ich gewaltsam aus dem Mutterleib einer Wahnsinnigen gezerrt wurde, kurz bevor sie von der Straße in die Geschlossene verfrachtet wurde. Nun, was soll ich sagen: Das Baby von der Straße wurde zum Kind von der Straße wurde zum Mann von der Straße wurde zum Schicksal seiner Mutter.
Also sage ich: »Danke für die Warnung, aber so schlimm kann es nicht werden. Ich schlafe in einem King-Size-Bett mit wolkenweicher Matratze und frischen Laken, die nach Lavendel riechen. Früher lag ich auf einer Isomatte und bin neben Pisse und Ratten wach geworden. Was glaubst du, wofür ich mich entscheide?«
Sie wendet den Blick ab und sieht geradeaus. Ein Typ kommt vorbei und fordert sie zum Tanzen auf. Sie lehnt mit einem höflichen Lächeln ab, das sofort wieder in sich zusammenfällt, als der Kerl sich umdreht. »Du wirst schnell merken, dass ein goldener Käfig nicht unbedingt besser ist, Oscar«, murmelt sie.
Ich runzele die Stirn. »Wie heißt du?«
»Harper«, sagt sie. »Harper Davenport.«
»Okay, Harper. Du bist merkwürdig.«
Jetzt lacht sie. Ich glaube, das Lachen ist echt, und das wundert mich, denn sie ist eine von ihnen.
»Nicht merkwürdig. Nur anders.«
Ich hätte mich gern noch länger mit Harper unterhalten, aber in dieser Sekunde klingelt mein Handy. Und als ich den Namen auf dem Display lese, verkrampft mein Magen. »Sorry, muss kurz weg.«
»Lass dich nicht aufhalten.« Harper zuckt die Achseln. »Ich stehe wahrscheinlich noch in zehn Jahren hier und genieße mein Glück.«
»Alles klar, viel Spaß.« Ich nehme den Anruf an und sage: »Warte. Bleib kurz dran.«
Duftwolken hochwertigen Parfüms und teurer Champagnersorten hüllen mich ein, während ich mich durch die Menge zu den Toiletten hindurchschiebe. Gott sei Dank ist niemand hier, denke ich, als ich die Tür aufstoße. Ich lehne mich gegen den marmornen Waschbeckentisch, schließe kurz die Augen und atme tief durch. Dann halte ich mir das Handy ans Ohr. »Hi, Briony.«
»Wo bist du?«
Klar. Kein Hey, Oscar. Kein Wie geht es dir? Die Zeiten, in denen Briony Adams sich dafür interessiert hat, wie ich mich fühle, sind längst vorbei.
»Auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung.«
Sie schnaubt ins Telefon. »Wichser.«
»Warum tust du das, Bri? Was habe ich dir getan?«
»Ist das dein beschissener Ernst, Jones?«
Ich zucke zusammen, als sie meinen früheren Nachnamen verwendet. »Hör auf, mich so zu nennen. Das bin ich nicht mehr.«
»Klar, rede dir das nur ein. Du denkst, du wärst was Besseres, jetzt, wo du in deiner Scheiß-Luxuswelt lebst, mit deiner Scheiß-Bonzenfamilie, aber weißt du was? Du wirst immer ein Jones bleiben, egal, für wen du dich ausgibst. Du wirst immer dreckig bleiben, egal, was du für Kleidung trägst, um dich zu verstecken.«
Ich presse die Zähne zusammen. Mit dem Finger fahre ich über ein Muster im Marmor. »Warum rufst du an?«
»Um dich zu fragen, wann du zu mir zurückkommst.«
»Ich komme nicht zurück, Bri.«
»Doch.«
»Nein.«
Eine Pause entsteht, in der ich sie heftig atmen höre. Meine Brust schnürt sich zusammen, kurz darauf entflammen heiße Schuldgefühle in mir.
»Du kannst mich hier nicht allein lassen«, sagt sie leise. Ihre Stimme zittert. »Scheiße, echt, das kannst du nicht bringen, Os.«
»Es tut mir leid«, murmele ich. Sie kann nicht sehen, wie ich das Gesicht verziehe, und das ist gut.
»Als ob«, zischt sie. »Du bist so ein beschissener Lügner, weißt du das? Ist dir klar, was du mit mir gemacht hast? Du schuldest mir was!«
Ich stoße die angehaltene Luft aus und beuge mich über das Waschbecken, um meine Stirn auf die kühle Armatur zu legen. Meine Schläfen pochen. Ich habe das Gefühl, mein Kopf wird jede Sekunde platzen.
»Ich weiß. Ich weiß, Bri! Fuck, und ich bin für dich da, okay? Ich stehe hinter dir, egal, wo ich bin. Wenn du etwas brauchst, weißt du, dass du auf mich zählen kannst, also …«
»Und wenn ich dich brauche?«
Ich stocke. Meine Hand, mit der ich das Handy umklammere, zittert.
Als ein paar Augenblicke vergehen, ohne dass ich etwas entgegne, schnaubt Briony. »Ja, genau. Schon klar. Danke für nichts, Arschloch!«
Sie legt auf und lässt mich zurück mit einem Herzen schwer wie Blei. Das Handy rutscht mir aus der Hand und in das runde Waschbecken hinein.
Ich hebe den Blick und betrachte mein Spiegelbild. Noch nie waren meine goldbraunen Haare derart ordentlich geschnitten. Für gewöhnlich tat es die Haarschneidemaschine, mit der ich die Strähnen auf einen Millimeter herunterraspelte. Jetzt sehe ich aus wie ein junger Selfmade-Millionär. Und auch die Schatten unter meinen Augen, von denen ich jahrelang dachte, sie gehörten zu meinem Gesicht, sind beinahe verschwunden. Aus meinen großen Augen stechen eisblaue Iriden heraus. In ihren Tiefen erkenne ich noch immer die unendliche Traurigkeit.
Briony hat recht. Ich bin ein Arschloch. Und dieses Gefühl ist so schlimm, so einnehmend, dass ich es nicht aushalte. Langsam richte ich mich auf, ziehe mein Sakko aus und werfe es auf den Waschtisch. Ich krempele die weißen Hemdsärmel über die Ellbogen und betrachte meine sehnigen Unterarme im Spiegel, während ich zitternd die Luft ausstoße. Schwarze Tinte verdeckt die Hautfarbe. Mit dem Fingernagel fahre ich über das Bild von dem düsteren Wald, fahre die kahlen Bäume entlang, deren Äste unter dem Hemdsärmel verschwinden. Ich drücke den Nagel fest in die Haut, bis ich merke, wie sie unter der Tinte aufschürft. Statt aufzuhören, kratze ich mit dem Fingernagel noch einmal darüber. Und noch einmal. Ein bisschen hilft es. Aber nur ein bisschen. Nie genug.
Ich ziehe das Sakko wieder an, verlasse die Toilette und gehe Timothy suchen, um ihm zu sagen, dass er nicht so viel Whiskey trinken soll.
Die Bäume bluten. Und niemand bemerkt es.
FAITH, LOVE, HOPE
Gwendolyn
»Okay, erzähl.«
Ich lasse meine Wasserflasche sinken und sehe meine beste Freundin fragend an. »Wie jetzt? Ich bekomme den Freifahrtschein von Paisley Harris, sie offiziell vollzulabern, ohne das Thema einzugrenzen? Wow, gut, warte. Das muss ich kurz verdauen.« Im Kopf zähle ich zwei Sekunden. »Okay, ja, bin so weit. Also: Hast du gewusst, dass Seeotter im Schlaf Händchen halten, damit sie nicht voneinander wegdriften? Ist das irre, oder ist das irre? Ich sollte dringend einmal nach Kalifornien, um mir das anzusehen, und …«
Weiter komme ich nicht, denn Paisley drückt mir ihre Hand auf den Mund. Lachend ducke ich mich weg, was keine gute Idee ist, weil mein Kopf unsanft gegen die Bande der Eishalle stößt.
Die Kufen meiner Schlittschuhe knirschen auf dem Eis, als ich mich wieder aufrichte. Gespielt vorwurfsvoll sehe ich Paisley an und stemme die Hände in die Hüfte. »Wolltest du mich umbringen, oder was?«
»Spoiler Alert: Man kann auch durch die Nase atmen.« Paisley schiebt eine Haarspange aus dem blonden Dutt, nur um sie wieder fester zu positionieren.
»Ja aber, hallo, da waren überall eklige Fussel von deinem ekligen Handschuh in meinem Mund, und du weißt, wie sehr ich Fussel auf der Zunge hasse.«
»Weiß ich eigentlich nicht. Und mein Handschuh ist nicht eklig. Ich wasche ihn.«
»Gestern hast du einen Buttercup-Riegel mit ihm gegessen, und die Schokolade ist geschmolzen. Die klebt jetzt überall in den Fasern. Jetzt sag noch mal, dass das nicht eklig ist.«
Paisley lacht. »Mann, Gwen! Kannst du einmal ernst bleiben?«
»Nein.«
»Musst du jetzt aber.«
Auf der anderen Seite der Eisfläche steht Paisleys Trainerin Polina an der Bande und beobachtet uns. Paisleys Finger berühren meinen Ellbogen, um mir zu bedeuten loszulaufen.
Ich werfe meine Wasserflasche mit dem Logo der iSkate über die Bande und verfehle den anvisierten Sitz auf der Tribüne. Die Flasche rollt über den Boden, und ich kann nicht anders, als zu denken, wie ähnlich wir uns sind, diese Wasserflasche und ich. Wie ähnlich.
Paisley und ich weichen Erin und Levi aus, die gerade die Todesspirale üben, und ich mache einen extragroßen Bogen, denn ich habe keine Lust auf Kufen in meinem Bein. Heute nicht, nein, nein.
»Also«, sagt Paisley, während sie einen Moctaw-Schritt macht und rückwärts weiterläuft. Ich tue es ihr nach, strecke die Arme aus und konzentriere mich auf meine Schritte. »Ich habe es jetzt mehrere Tage mit angesehen, ohne etwas zu sagen, obwohl das echt komisch war und es jedem aufgefallen ist. Sogar Polina hat mich gefragt, dabei fragt mich Polina nie irgendetwas, das nichts mit meinen Sprüngen zu tun hat, und jetzt halte ich es nicht mehr aus.«
Ich weiß, was als Nächstes kommt. Was sie sagen will. Aber ich will es nicht hören, oder, besser gesagt, ich will nicht antworten. Weil eine Antwort es real machen würde, irgendwie endgültig. Nicht darüber zu sprechen, nimmt der Realität die Macht, die sich so erbarmungslos auf meine Brust drückt und mir die Luft abschnürt.
Aber ich brauche Luft. Ich will leben. Also tschüss Realität, Augen zu, Ohren zu, weg, weg, weg mit dir.
Als Paisley den Mund öffnet, um weiterzusprechen, verlagere ich mein Gewicht auf das linke Bein, ehe ich mit der rechten Kufe aufs Eis tippe und von dort aus abspringe. Und dann fliege ich. Nur ein paar Sekunden, ganz kurz, aber für mich ist es Zeitlupe, wie Schmetterlinge in meinem Herzen, ein Prickeln in den Adern – pure Euphorie, wie Drogen, nur besser.
Ich drehe mich dreimal um die eigene Achse und lande auf dem Eis. Wacklig. Aber ich lande. Ich stehe den Sprung. Ein überraschtes Lachen huscht mir über die Lippen, während mein Blick den von Paisley sucht.
Sie hat die Augen aufgerissen und rudert wie ein kleiner Pinguin mit den Armen durch die Luft. »War das …«
»… ein dreifacher, oder? Das waren drei Drehungen, sag mir, dass es drei waren, Pais, ich dreh durch, ich …«
»Es waren drei. Ganz sicher. Holy Moly.«
»Bestimmt nicht. Vielleicht haben wir halluziniert.«
»Wir beide?«
»Haben Erin und Levi das gesehen?« Ich lasse den Blick durch die Eishalle zu den Jungs schweifen, aber die sind völlig in ihre noch katastrophale Todesspirale vertieft. »Harper?«, murmele ich fast schon verzweifelt, aber die hängt irgendwo am Ende der Eisfläche rum und probiert, den Rittberger auf einem Bein zu stehen, statt – wie immer – wie ein wackliges Rehkitz auf beiden Beinen zu landen.
»Das war ein dreifacher Lutz, Gwen!« Paisleys Arme rudern immer noch. »O mein Gott, o mein Gott, das ist …«
»Crazy, crazy, hast du gesehen, was ich gemacht habe? Wie habe ich das hinbekommen? Waren meine Arme irgendwie …«
»Nein, auf keinen Fall, die waren wie immer, aber ich glaube dein Bein hatte mehr Schwung, weil du beim Tippen …«
»… mehr ausgeholt habe, ja, habe ich gespürt. Krass, Pais! Ich glaub, ich hab’s gecheckt. Ich muss das noch mal probieren.«
Ich drehe mich, gleite rückwärts und will gerade wieder Anlauf nehmen, als Paisleys Finger sich um mein Handgelenk legen. Meine Kufen knirschen über das Eis, während ich in einem Halbmond zu ihr herumwirble.
»Gwen, warte.« Paisley legt ihre behandschuhten Hände auf meine Schultern und sieht mir in die Augen. »Wo ist dein Vater?«
Da ist sie. Die Fragen aller Fragen. Hallo, Realität, wie schön, dass du mich einholst. Und wie schnell du warst, meine Güte.
»Keine Ahnung. Wieso fragst du das?«
Wie dumm, wie dumm! Natürlich weiß ich, warum sie fragt. Aber wenn man so tut, als wäre nichts, wenn man so tut, als würde etwas gar keinen Sinn ergeben, obwohl es das tut, dann sagt man komische Sachen, die gar nicht passen, einfach nur, weil man unbedingt normal sein, unbedingt passen will. In den Moment. In dieses Leben. Für sich selbst. Für andere. Mehr für andere, auf jeden Fall.
»Ähm.« Paisley blinzelt. »Weil er dein Trainer ist und schon seit über einer Woche nicht mehr in der Eishalle auftaucht?«
»Er ist krank«, sage ich knapp.
Sie quittiert meine Antwort mit einem misstrauischen Blick. »Im Falle eines Krankheitsfalles bekommen wir einen temporären Ersatztrainer, Gwen.«
Ich seufze. »Du kennst dieses bescheuerte Regelwerk echt auswendig, oder?«
»Ja. Aber davon mal abgesehen weiß jeder, dass uns Ersatztrainer zur Verfügung stehen. Also: Was ist los?«
Ich hadere, während ich meiner besten Freundin ins Gesicht sehe. Ihre blauen Augen sind groß und offen, wie immer. Ich kann hören, was sie sagen, und das ist crazy, denn Augen hört man nicht. Aber mit Paisley ist das so. Sie sieht jemanden an, sagt nichts, und man denkt sich, krass, wie sie schreit, heftige Sache. Pais kann das. Pais hat diese Ausstrahlung, die mich an einen Teddybären erinnert, und wenn sie vor mir steht mit dem schreienden Blick und ihrer Offenheit, dann ist das, als würde Pooh der Bär mich umarmen wollen. Meistens hat sie mich damit, denn, ganz ehrlich, niemand kann Nein zu dem gelben Bären mit dem Honigtopf sagen. Niemand.
Also knicke ich ein. Ich öffne gerade den Mund, um es ihr zu sagen – als Polinas Stimme durch die Halle tönt, kälter als die Luft um uns herum und so forsch, dass ich mir fast einbilde, der Ton würde das Eis unter uns brechen.
»Paisley Harris! Wenn ich sinnloses Gelaber will, schaue ich mir den Bachelor im Fernsehen an! Los jetzt, ich trainiere dich nicht fürs Rumstehen!«
»Sie kennt den Bachelor? Ich bin schockiert.«
Wir fahren an. Unsere Kufen kratzen über das Eis, und von irgendwoher weht Harpers definitiv nicht jugendfreier Fluch herüber, ehe sie gegen die Bande tritt.
»Ich hätte gedacht, Polina sitzt zu Hause bloß still auf einem harten Sessel in der dunklen Ecke rum und wartet, bis der nächste Tag anbricht, um dich herumzukommandieren.«
»Sie ist ein Mysterium«, murmelt Paisley, nachdem sie einen dreifachen Lutz gesprungen und sauber neben mir gelandet ist. Ein heißer Schmerz durchzuckt mich, und ich kann ihn sofort einordnen. Eifersucht. »Würde mich nicht wundern, wenn sie an den Wochenenden auf irgendwelchen Raves abfeiert.«
»Das Wort klingt so verrucht, wenn du es sagst.«
»Raves sind verrucht«, sagt Paisley amüsiert, formt mit den Lippen ein wir reden später und verschwindet in die andere Richtung.
Ein Seufzen von mir verliert sich in der eisigen Luft. Eine Weile sehe ich auf meine Schlittschuhe, beobachte die Kufen, während ich über das Eis gleite. Es ist verrückt. Eigentlich sind es bloß schmale Dinger aus Stahl, die an Schuhen kleben. Nichts weiter. Aber für mich bedeuten sie die Welt. Für mich sind sie Himmel und Wolken und Regenbogen und Meeresrauschen und Schmetterlinge und Liebe und Sternennächte und Schneegestöber zusammen. Alles mal zwei.
Ich fahre in die Mitte der Eisfläche, verlagere mein Gewicht auf das linke Bein, strecke das rechte nach hinten und mache eine lange, diagonale Rückwärtsgleitung in Richtung der Eisbahnecke. Ich konzentriere mich nur auf mich selbst. Die Geräusche um mich herum – Harpers frustrierter Laut, Levis Lachen, Erins Stimme, die unaufhörlich auf ihn einredet, Polinas forscher Ton, mit dem sie Paisley Anweisungen gibt, bevor ihre sanfte Kürmusik durch die Halle tönt –, all das gerät in den Hintergrund. Mit dem rechten Fuß tippe ich ins Eis. Ich höre meinen Puls in den Ohren, als ich von der Außenkante abspringe.
Eine Drehung – die Spitzen meines Pferdeschwanzes peitschen meine Wange.
Zwei Drehungen – ich denke an Träume, an Hoffnung und an den seidenen Faden, der sie beide trägt.
Drei Drehungen – für eine Sekunde sind meine Gedanken schwerelos.
Ich lande auf dem linken Bein, die Arme parallel gestreckt. Nichts an mir ist wacklig. Alles sicher. Das passt nicht zu mir, denn meine Emotionen sind wacklig, alles in mir ist volle Kanne unsicher, aber mein Körper nicht, jetzt gerade stehe ich, und das kann ich nicht fassen. Wie kann das sein, von außen so gefasst, völlige Beherrschung, von innen alles xmow#jenqyznmo&fp?
Keine Ahnung, echt, aber gerade ist es mir egal. Gerade kann ich nur daran denken, dass ich einen dreifachen Lutz gesprungen und ihn sicher gelandet bin. In meiner Brust applaudiert etwas mit rasanten Schlägen. Fühlt sich an wie ein Vogel. Sanft und friedlich. Klein und zart. Zerbrechlich.
Flatter-Flatter-
Flieger-Herz.
Ich sehe auf und begegne meinem eigenen Blick in dem Spiegel, der an der Litfaßsäule hinter der Bande angebracht ist. Meine dunklen Augen sind riesig. Aber das Gesicht, das mir entgegensieht, kann unmöglich mir gehören. Denn es strahlt. Ohne Lügen und so. Die Gwen im Spiegel strahlt vor Glück, als wäre sie das. Glücklich. Und das bin ich nicht. Nicht, seitdem ich mich nicht mehr kenne. Seitdem ich täglich Angst davor habe, aufzuwachen und nicht zu wissen, wer ich bin. Ich strahle nicht, weil ich ein Schatten bin. Aber die Gwendolyn aus dem Spiegel sagt mir, dass es dennoch irgendwie geht. Dass es möglich ist, und eine Möglichkeit, dieses Gefühl in mir hervorzurufen, ist jetzt. In dieser Sekunde.
Ich. Auf dem Eis. Das Geräusch der Kufen, die darübergleiten, kratzig, aber zart, gebrechlich, ein bisschen wie ich, ein bisschen wie die Melodie meiner Seele. Nur schöner, vielleicht.
Ich strahle, weil ich einen dreifachen Lutz gestanden habe. Weil mir endlich der Sprung gelungen ist, für den ich seit Monaten trainiere. Es ist ein Erfolgserlebnis, das eine gewaltige Welle der Euphorie durch mich spült, fast wie küssen im Schnee, fast wie mit sechzehn auf dem Schulflur, wenn der beliebte Quarterback einem sein heißes Viertellächeln schenkt und man einfach denkt, man stirbt, weil, oh-mein-Gott, dieses Lächeln, shit.
Aber als ich den Blick durch die Halle schweifen lasse, verebbt die Euphorie. Ich sehe Paisley, die eine Spread-Eagle-Pirouette mit gestreckten Armen und Beinen dreht, das Gesicht in Richtung Hallendecke. Ich sehe Erin und Levi, die von ihrem Trainer Simon zusammengestaucht werden und sich missmutige Blicke zuwerfen. Ich sehe Polina, die Paisley konzentriert beobachtet, die Zunge zwischen die Lippen geschoben, darauf bedacht, jede Kleinigkeit kritisch zu bewerten.
Was ich nicht sehe, ist mein Vater. Was ich nicht sehe, ist sein bewundernder Blick, mit dem er die Welle meiner Euphorie in einen Tsunami hätte verwandeln können. Ich sehe keinen Stolz, der mir gilt. Ich sehe keine Anerkennung. Und mir wird bewusst, dass mein Erfolg bedeutungslos ist. Ich habe einen dreifachen Lutz gestanden, mein Ziel erreicht, für das ich Woche um Woche um Woche gekämpft habe, richtig gekämpft, mit Schweiß und Blut und Tränen und keine Ahnung, allem einfach, dabei ist es egal. Wie mein Schatten, wenn er sich glücklich fühlt und denkt, er könnte strahlen, obwohl das ein lächerliches Hirngespinst ist.
Sinnlos.
Deshalb ist mein Vater nicht hier. Selbst wenn ich einen dreifachen Axel stünde, würde es ihn nicht jucken. Ein Trainer muss sich bloß dafür interessieren, was seine Schülerin weiterbringt, um an die Spitze zu kommen. Und das ist der Punkt. Mich bringt nichts mehr weiter. Ich kann nicht mehr an die Spitze kommen. Das Ding ist gelaufen. Die einzige mir gebliebene Möglichkeit, Licht ins Dunkel zu bringen, ist eine beschissene Illusion, an der ich festhalte. Ein Seil, das ins Nichts führt.
Happy birthday, Gwen, am Ende fällst du.
Warum ich weiter daran festhalte? Keine Ahnung. Hoffnung vielleicht. Wunschdenken, dass alles gar nicht wahr ist. Dass es nicht wahr bleibt, wenn ich so tue, als wäre alles anders. Möglicherweise auch Angst vor dem Danach. Vor dem Abgrund. Ich weiß nicht, wie es dort unten ist. Ich weiß nicht, welchen Weg ich gehen muss. Ich kenne nur diesen hier. Und ich will nicht, dass er endet. Also akzeptiere ich es nicht, aber ich weiß, da kommt bald jemand, der sagt, du, hier geht’s halt echt nicht weiter, siehst du, alles Steine hier, kommst nicht rüber ohne Hilfe, und, ne, ne, ich helfe dir nicht, also tschüss, da unten lang, genau, bis dann.
Die Kufen knirschen über das Eis, als ich bremse. Diesmal klingt es nicht schön. Nicht sanft. Es klingt kratzig, hart und unbarmherzig. Wie ein Ende, aber kein gutes. Meine Finger klammern sich so um die Bande, dass die Knöchel weiß hervortreten. Ich beuge den Oberkörper darüber und hole tief Luft, aber es kommt nichts an. Ich versuche es wieder und wieder und wieder, spüre Kälte, die meine Lunge betäubt, doch trotzdem ist es, als würde der Sauerstoff gegen eine Wand in meiner Kehle stoßen und nicht weiterkommen. Ein erstickter Laut huscht über meine Lippen, gefolgt von einem verzweifelten Keuchen. Ich schließe die Augen und öffne sie wieder. Die roten Sitze auf der Tribüne verschwimmen zu einem einheitlichen, unklaren Fleck, alles wässrig, Aquarell vor meinen Augen, die Farben laufen ineinander. Kein schönes Bild, nein, eher wütend, unkontrolliert und aggressiv, und alles schreit. In meinem Kopf hallt es.
CHAOS-chaos-CHAOS-chaos-CHAOS.
Hoffnung ist ein starkes Gefühl. Eines der drei wichtigsten.
Glaube, Liebe, Hoffnung.
Drei Helden im Leben eines Menschen. Aber Helden haben Feinde. Gegner, die dafür kämpfen, sie zu stürzen. Jeder Antagonist ist für seine Grausamkeit bekannt, das Gute im Keim zu ersticken. Und in diesem Fall gibt es drei.
Unglaube, Hass, Verzweiflung.
Und sie sind auf dem Weg zu gewinnen, denn ich glaube nicht mehr daran, dass das hier ein gutes Ende nehmen wird. Ich beginne das Eis zu hassen, weil es meine größte Liebe ist und sie mich im Stich lässt. Vor die Hoffnung, die ihre letzten Strahlen kraftvoll durch die dunklen Wolken sendet, schiebt sich der Schatten meiner Verzweiflung – ein weitaus mächtigerer Teil meiner Emotionen.
Ich entscheide mich zu gehen. Meine Finger sind steif, als ich die Bande loslasse und über das Eis zur Bandentür gleite. Harper wirbelt herum, und ich frage mich, ob es meine Traurigkeit war, deren Schreie sie gehört hat, denn in meinem Kopf war es so laut, so unerträglich, dass es mir nicht möglich scheint, sie zu überhören.
Harper und ich sind wie Katz und Maus. Sie kann mich nicht ausstehen. Und ich verstehe das, denn ich bin der Grund, weshalb ihre beste Freundin vor etwas mehr als zwei Jahren verzweifelt aus Aspen geflüchtet ist. Ich bin der Grund, weshalb die einzige Person aus ihrem Leben verschwand, die für sie Familie bedeutete. Wäre ich sie, würde ich mich auch hassen.
Aber jetzt gerade lese ich nichts von diesen Emotionen in ihrem Blick. Jetzt gerade sieht sie mich an wie einen Vogel, der verletzt am Straßenrand liegt und schwach mit den Flügeln raschelt, in dem hoffnungslosen Versuch aufzustehen. Sie schaut mich an, als würde sie durch mein aufgesetztes Lächeln hindurchsehen und erkennen, wie dunkel es ist, während ich verzweifelt nach dem Lichtschalter suche. Ich glaube, sie kann das sehen, weil sie es kennt. Ich glaube, wenn man viel Zeit an düsteren Orten verbringt, entwickelt man Nachtsicht für die Dunkelheit, mit all den schlimmen Gedanken, die dort leben, mit all den traurigen Wahrheiten und ernsten Themen. Es sind keine schönen Orte. Es ist unheimlich.
Kennt man so eine Schwärze, weicht man aus, wenn eine zweite auftaucht.
MY HEART IS DANCING IN A BURNING ROOM
Oscar
Vor mir erstreckt sich die atemberaubendste Aussicht, die ich je gesehen habe. Im Ernst. So etwas ist nicht normal. Und wenn nicht für die Welt, dann auf jeden Fall für mich. Mein Rücken lehnt gegen den Hocker des Chesterfield-Sessels. Das kühle Leder frisst sich in die Haut meines nackten Oberkörpers, während mein Blick starr geradeaus durch das Panoramafenster meines Schlafzimmers gleitet. Vermutlich würde ich frieren, aber die züngelnden Flammen lecken großzügig über die Holzscheite in dem gemauerten Kamin und senden eine wohlige Wärme aus.
Meine Finger legen die vielen Bänder übereinander. Jedes einzelne besitzt eine andere grüne Farbnuance. Sie spiegeln für mich die Tannen von draußen wider. Die Bewegungen des Knüpfens haben eine beruhigende Wirkung auf mich. Früher, in der Bronx, habe ich die Dinger verkauft. Jetzt mache ich sie nur noch, um meine Gefühle zu verarbeiten. Es ist wie Tagebuch schreiben. Jedes Armband sagt etwas aus, das in meinem Herzen lebt. Jetzt gerade ist es der Anblick der Natur und ihre heilende Wirkung auf mich.
Ich wohne seit zwei Wochen in diesem luxuriösen Haus aus Holz und Glas inmitten der Aspen Highlands. Die meiste Zeit habe ich hier auf dem eichenfarbenen Parkett verbracht, um über die verschneiten Tannen und gewaltigen Berggipfel hinwegzusehen. Manchmal nehme ich ein Fernglas und beobachte die Schneeeulen und Käuzchen, die ihre großen Flügel ausstrecken und den Frieden der Natur genießen. Dann wünschte ich, ich wäre wie sie, sorgenfrei und schwerelos. Und dann lache ich, weil das Bullshit ist. Nicht der Wunsch, aber der Gedanke, jemand wie ich könnte wirklich sorgenfrei sein – haha, ja, als ob.
Kalte Luft weht durch die geöffneten Fenster herein. An meinen tätowierten Armen stellen sich nun doch die Haare auf, denn draußen herrschen Minusgrade. Doch ich bewege mich keinen Millimeter. Ich kriege nicht genug von dem eisigen Schneeduft, der jedes Mal gleich riecht: immer rein und besonders und hell – alles, was ich nicht bin.
»Oscar?« Georgias Stimme auf dem Flur hinter der Tür. Sie klopft zweimal, ehe sie die Tür öffnet und den Kopf hereinsteckt. Sie trägt einen gefütterten Cape-Mantel mit bronzefarbenen Knöpfen, unter dem sie eine dieser beigen Stoffschlaghosen trägt, auf die auch jeder in New York so abgefahren ist.
Als sie lächelt, bewundere ich wieder einmal, wie jung Georgia in ihren Mittvierzigern noch aussieht.
»Bist du so weit?«
Eigentlich nicht. Eigentlich würde ich gern die nächsten Stunden und die Nacht und vielleicht auch den nächsten Tag und immer so weiter damit verbringen, hier zu sitzen und den Duft des Schnees in mich aufzunehmen, während ich Aspens weite Natur bewundere. Aber das geht nicht. Ich habe bereits die letzte Stadtversammlung geschwänzt, und die Addingtons waren nur deshalb gnädig, weil sie meinten, ich müsste mich erst einmal »neu sortieren und ankommen«. Aber ein zweites Mal werden sie nicht zustimmen.
Diese merkwürdigen Versammlungen waren das Erste, wovon sie mir erzählt haben, als wir in der First Class im Flugzeug von New York nach Aspen saßen.
»Sie finden jeden Sonntagabend statt, Oscar, und du darfst sie niemals schwänzen, weil wir auf gar keinen Fall wollen, dass William schlecht von uns denkt«, hat Timothy gesagt, während er an der Minibar einen Drink für uns bestellte. Beinahe ironisch, dass die Meinung eines alten Mannes einem Special Agent so wichtig ist. »Für gewöhnlich wäre mir das egal, aber William ist penetrant. Er würde nicht aufhören, mich zu nerven, bis wir wieder in seiner alten Scheune auftauchen.«
Georgia hat genickt und an ihrem Martini genippt. »Komm schon, Timothy. Tu nicht so. Du hast das Kleinstadtleben auch lieben gelernt. Vor allem den Tratsch.« In Georgias Augen trat ein helles Leuchten. »Außerdem sind die Veranstaltungen witzig. Niemand will es verpassen. Wir erfahren die brisantesten News, und die müssen wir wissen, Oscar, unbedingt, sonst können wir nicht mitreden und wissen nicht, was gerade das angesagte Stadtthema ist.«
Als ich fragte, was daran so schlimm wäre, haben mich beide mit ihren Blicken gepfählt, und ich habe beschlossen, die Bedeutsamkeit dieser Stadtversammlungen nicht mehr infrage zu stellen.
»Ja, bin so weit.« Ich rapple mich vom Boden auf und schlurfe in das Ankleidezimmer. Die angebrachten Stangen an den Wänden ächzen unter der Last der Designerhemden, teuren Markenpullover, Jacken und Hosen. Auf dem Boden reihen sich etliche Schuhe in allen Variationen aneinander: Panama-Jacks, Timberlands, Chanel-Slipper für den Sommer, Gucci-Mokassins – die Boots sind cool, aber diese geleckten Designerschühchen machen mir jetzt schon Angst. Jeder, der nicht ganz neben der Spur ist, würde merken, was hier abgeht; man müsste bloß diesen begehbaren Kleiderschrank betreten, und schon wäre klar, dass ich kein Individuum mehr bin, sondern der kleine Chihuahua der Addingtons, dem sie nach Belieben das neueste schicke Kleidchen überziehen.
Das Problem an der Sache ist, dass ich eigentlich ein Pitbull bin.
»Oh, zieh dieses hier an!«, sagt Georgia, von der ich nicht einmal mitbekommen habe, dass sie mir gefolgt ist. Das helle Licht lässt ihre dunkle Haut funkeln, als sie begeistert ein schwarzes Hemd vom Bügel nimmt. Es ist auf jeder freien Stelle übersät mit weißen Buchstaben.
Ich nehme es Georgia mit einem verkrampften Lächeln ab und streife es über. Es fühlt sich falsch an. Es fühlt sich an, als würde ich armen Menschen das Essen wegnehmen. Wie ein Verrat meinen Leuten gegenüber. Meinen früheren Leuten.
Georgia strahlt über beide Ohren, nachdem ich das Hemd zugeknöpft habe. Mit der Handfläche streicht sie über die nicht vorhandenen Falten, ehe sie ihre Finger an meine Wange legt und kurz mit dem Daumen über meinen hervortretenden Wangenknochen streicht. »Ich bin stolz auf dich, Oscar. Du passt dich ganz hervorragend an. Und dieses Hemd sieht aus wie für dich gemacht.«
Es sollte ein Kompliment sein, aber ich könnte kotzen. Das hier bin nicht ich. Und mir anzuhören, es wäre so, ist wie der Schnitt eines Skalpells durch meine Brust. Dennoch lächle ich, weil ich keine Ahnung habe, was ich sonst tun soll. Ich kann der Frau, die mich von den Straßen der Bronx geholt hat, um mir ein Leben wie dieses zu ermöglichen, nicht sagen, dass ich mich wie ein verkleidetes Kind am Mardi Gras fühle. Wie undankbar wäre das? Stattdessen halte ich an der Hoffnung fest, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis auch mein Herz sich an diese Art von Leben gewöhnt. Klar fühle ich mich unwohl. Klar komme ich auf diese Weise nicht zurecht. Wie sollte es auch sonst sein, wenn ich nichts anderes kenne als dreckige Jogginghosen, zerbeulte Hoodies und löchrige Sneaker?
Dieser Zustand wird sich legen. Irgendwann wird mein kaputtes Herz ankommen und sich neu orientieren. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Einfach mitmachen. Einfach alles für normal halten. Dann wird das schon.
»Schuhe?«, frage ich mit einem wackligen Lächeln, weil ich gar nicht erst versuchen will, welche auszusuchen. Am Ende würde Georgia ohnehin nachsichtig den Kopf schütteln und auf ein anderes Paar zeigen. Ich bete nur, dass der Schnee draußen sie von diesen Michael-Jackson-Dingern abhalten wird, bitte, bitte, nicht die Slipper, alles, nur nicht …
»Die Slipper würden großartig dazu aussehen, meinst du nicht?«
Jep. Wundervoll. Eine bessere Wahl hätte ich nicht treffen können.
Ich presse die Lippen zusammen, ehe ich ihr die Gucci-Dinger abnehme. »Ist es dafür nicht zu kalt?«
»Unsinn.« Georgia schnalzt amüsiert mit der Zunge und wedelt mit der Hand durch die Luft. »Wir fahren mit dem Auto und sind dann in der Scheune. Es geht um dein Auftreten, weißt du, Oscar?«
Mein Auftreten in einer Scheune. Scheune. Ich soll mit verdammten Eintausend-Dollar-Schuhen einen Stall betreten, einfach nur, damit die Leute sehen können, wer ich nicht bin, um zu denken, dass ich so bin. Halleluja. Ich atme zweimal tief durch im festen Vorhaben, Georgia zu erklären, warum ich das nicht tun möchte, aber dann begegne ich ihrem blinzelnden Blick. Ihrem Stolz in den Augen, mit denen sie mich mustert. Mein Herz wird zerquetscht, denn ich habe ein Déjà-vu. Kein echtes, nur ein halbes, weil es bloß die Vorstellung meiner nächtlichen Familienträume wiedergibt, aber trotzdem. Mein Leben lang wollte ich auf diese Art angesehen werden. Mein Leben lang wollte ich ein Sohn sein, auf den seine Eltern stolz sind, warum auch immer. Und wenn dieser Blick bedeutet, dass ich hierfür diese Schlappen an den Füßen tragen muss, so what?
»Klar, natürlich. Und sie passen zum Hemd. Danke, Georgie.«
»Georgie«, wiederholt sie in einem gerührten Ton und legt sich eine Hand an die Brust. Das helle Licht bricht sich in ihren feinen goldenen Ringen. »So hast du mich noch nie genannt.«
»Ist doch kein Ding«, murmele ich, während ich in die Slipper schlüpfe. Das Leder fühlt sich an wie eine kühle Makrele, die über meine Haut glibbert. »Nur ein Spitzname.«
Sie sieht mich immer noch an, als wäre ich einer der drei heiligen Könige mit einem Sack voller Geschenke auf dem Rücken. Dann dreht sie sich um, und als sie mein Schlafzimmer verlässt und die eindrucksvolle Treppe aus rustikalem Holz und Marmor hinuntergeht, höre ich sie rufen: »Timothy, er hat mich Georgie genannt. Georgie!«
Ja, Georgia Addington weiß, dass ich zweiundzwanzig Jahre alt bin. Und ja, sie behandelt mich trotzdem, als wäre ich ihr Baby, das gerade laufen lernt, das erste Wort spricht oder ihr eine vollgeschissene Windel hinterlässt. Ob es mich stört? Scheiße, nein. Ich bin wie ein nach Futter lechzender Welpe, der ihr sabbernd hinterherläuft in der Hoffnung auf das nächste Leckerli. Meine Leckerlis sind in dem Fall ihre Aufmerksamkeit. Vielleicht ist das für normale Menschen erbärmlich, aber ich bin nicht normal. Ich bin ein Typ, der aussieht wie ein Schrank, weil man in der Bronx als Lauch nicht weiterkommt, meine düsteren Gefühle mit Tinte auf meiner Haut verewigt – teils, weil ich es wollte, und teils, weil man ohne nicht dazugehört hat. Aber in mir drin ist alles butterweich und zerbrechlich und klein. Ich sehe vielleicht erwachsen aus, doch ich fühle mich wie ein Kind, das jeden Tag heulen und nach Mom rufen will, stundenlang, ohne eine Antwort zu bekommen, natürlich, denn Mom wird nicht kommen, weil, fun fact: Mom existiert nicht. Aber jetzt gibt es Georgia, und sie will genau das für mich sein. Und das Kind in mir heult schon wieder, aber diesmal vor Freude.
Als ich nach unten ins Wohnzimmer komme, von dem drei Wände komplett verglast sind und den Ausblick auf die Bergkette und den frischen, hohen Pulverschnee zulassen, bedenkt Timothy mich mit einem anerkennenden Blick. Er nickt knapp, mit einem leichten Lächeln auf den schmalen Lippen, als wollte er sagen: Super, mein Sohn, den Nobelpreis hast du dir verdient, oder so. Wahrscheinlich wegen der Slipper. Georgia steht zwischen dem riesigen beigen Sofa, das in seiner U-Form fast den kompletten Raum einnimmt. In die Granitwand ihr gegenüber ist ein Kamin eingelassen, aber nicht gemauert, wie in meinem Zimmer, sondern in einer seltsamen 3D-Optik, die den Anschein erweckt, das Feuer befinde sich in einem tieferen Gang durch die Wand hindurch. Es ist wie eine optische Täuschung und auf jeden Fall genau das, worauf die Addingtons stehen. Bisschen extravagant, bisschen seltsam, definitiv designermäßig.
Wir fahren im Dartz Prombron durch die Berge Richtung Zentrum. Dieses Auto sieht aus wie ein schwarzer Panzer. Ich glaube, so ein Ding als Normalsterblicher zu besitzen, ist so utopisch, dass kaum einer sagen würde: »Ey, yo, irgendwann bin ich krass rich, dann gönne ich mir einen Dartz Prombron, ich schwöre.« Die Typen reden einfach das nach, was sie von allen anderen Proleten kennen: Porsche, Mercedes, Bentley. Aber das hier? Ein ganz neues Level.
Wir erreichen das Ende der Highlands. Timothy setzt den Blinker und fährt in diese kleine Weihnachtsmannstadt hinein. Obwohl ich seit zwei Wochen hier lebe, war ich bisher kaum im Zentrum. Meistens bin ich durch den Schnee der Berge gewatet, bis ich so nass war, dass es zwei Stunden im heißen Whirlpoolwasser brauchte, um meine gefrosteten Venen wieder aufzutauen. Georgia hat eine schwarze american express auf meinen Namen freischalten lassen, damit ich Zugriff auf das Familienkonto habe, und meinte, ich solle mich demnächst mal in dem Viertel mit den Boutiquen umsehen. Ich habe mir fest vorgenommen, die Stadt zu erkunden und anschließend mit Kleidungsstücken nach Hause zu kommen, in denen ich mich wohlfühle. Um ein bisschen mehr ich selbst zu bleiben.
Der weiche Autositz in beiger Chesterfield-Optik gibt ein leichtes Knarren von sich, als ich mein Gewicht verlagere und aus dem Fenster sehe. Im ersten Moment denke ich, Glühwürmchen haben es sich in Aspen bequem gemacht, bis mir klar wird, dass es die warmen Laternenleuchten sind, deren goldene Strahlen durch den starken Schneefall hindurchscheinen. Es ist erst Oktober, aber in Aspen schneit es beinahe das ganze Jahr über. Lichterketten rekeln sich um die kahlen Bäume am Asphalt und lassen sie glühen. Wir fahren an einem beleuchteten Platz mit großem Glockenturm vorbei, biegen an einem Eckhäuschen mit Neonreklame ab, auf dem in bunten Lettern Kates Diner steht. Das K ist nicht mehr beleuchtet, also eigentlich liest man bloß noch ates Diner.
Irgendwann werden die Abstände zwischen den Häusern größer, bis nur noch vereinzelt welche auftauchen. Sie enden schließlich an einem Weg, der in den Buttermilk Mountain führt. Hier stehen eine Menge teurer Autos, denn in Aspen leben eine Menge reicher Leute. Wir parken hinter einem Porsche, und als ich aussteige, versinken meine supergeilen Slipper tief im Schnee. Ich presse die Zähne zusammen und bemühe mich, keine Miene zu verziehen, während ich die Knöpfe meines Mantels schließe und meinen neuen Eltern hinterherstapfe. Vermutlich wird sich jeder auf dieser Veranstaltung fragen, weshalb die Addingtons einen zweiundzwanzigjährigen Mann adoptiert haben. In diesem Alter passiert so etwas selten. Ich hasse die Vorstellung, dass sie mich als ein elendes Häufchen betrachten werden. Worte wie bemitleidenswerter, armer Junge tuscheln. Ist zweiundzwanzig und kann nicht für sich selbst sorgen.
Inzwischen ist das nämlich nicht mehr wahr. Ich könnte für mich selbst sorgen. Konnte ich schon immer, aber jetzt auch richtig. Ich habe Anfragen bekommen. Für Werbedeals. Modeljobs. Und das von weltbekannten Unternehmen. Bei dieser Adoption ging es mir nicht darum, versorgt zu werden oder ein Dach über dem Kopf zu haben.
Es ging mir darum, meinen Herzenswunsch zu erfüllen.
Es ging mir um eine Familie. Genauso wie Georgia und Timothy. Niemand sollte kritisieren, dass sie sich zu dem Großziehen eines Babys oder Kleinkindes nicht in der Lage fühlen. Die meisten wissen, dass Georgia damals ihr Kleinkind an einer schlimmen Form von Windpocken verloren hat. Aber kaum einer weiß, dass ihre Tochter sie in den drei Jahren in den Wahnsinn getrieben hat. Erst ein Schreibaby. Dann ein Schreikleinkind. Georgia hat mir erzählt, dass sie am Ende war. Ein Schatten ihrer selbst. Sie meinte, niemals im Leben wäre sie dazu imstande, so etwas noch einmal durchzustehen. Zumal sie dafür auch schon zu alt wäre, wie sie mir selbst mit einem Lachen in der Stimme mitgeteilt hat.
Geräusche wabern durch die eisige Luft zu mir herüber. Ich sehe auf und erkenne, dass wir unser Ziel erreicht haben. Die Holzfassade der Scheune ist rot gestrichen, mit weiß umrahmten Fensterläden und Türrahmen. Es ist seltsam, wie wir in unserer überteuerten Kleidung auf diese einsame Scheune zusteuern, aber je mehr ich über diese Stadt und ihre Bewohner höre, desto mehr glaube ich, hier läuft gar nichts normal ab.
»Hey«, höre ich plötzlich eine Stimme neben mir. »Oscar, oder?«
Ich bleibe vor der Öffnung im Holzzaun, der zur Scheune führt, stehen.
»Ja«, sage ich. »Hi.«
Georgia und Timothy drehen sich beinahe zeitgleich um. Sie schenken dem Typen mit den Panama Jacks und der Daunenjacke ein Lächeln. Er kommt mir bekannt vor, aber keine Ahnung, woher. Sein Gesicht wirkt sehr symmetrisch.
»Hallo, Knox.«
Knox … Knox … Nö, kein Plan.
Besagter Knox erwidert das Lächeln. »Dad ist schon drin. Ganz vorn. Er hält euch zwei Plätze frei.«
»Super.« Timothy reibt sich die Hände. »Komm, Georgie. Ich will die Wetteinsätze nicht verpassen.«
»Wetteinsätze?«, frage ich verwirrt, doch sie sind schon vorgelaufen, und der pfeifende Wind trägt meine Stimme fort. Neben mir wippt Knox mit seinen Boots im Schnee, die Hände in den Hosentaschen vergraben. »Manchmal wird gewettet, wie lange es dauert, bis William seinen ersten Tobsuchtsanfall bekommt.«
»Tobsuchtsanfall?«
Knox lacht. »Gehen wir rein. Später weißt du, was ich meine.«
»Okay.«
Unsere Schritte knirschen im Schnee, als wir zur Scheune gehen. Ich öffne die Tür etwas zu schwungvoll und kann sie gerade noch daran hindern, gegen die Holzfassade zu krachen. Stimmengewirr, warme Luft und der Geruch nach Heu, Parfüm und chinesischem Essen empfängt uns. Ich sehe mich im Raum um, kann aber nirgendwo ein Büfett entdecken.
Stirnrunzelnd wende ich mich an Knox. »Bilde ich mir das ein oder riecht es nach Essen?«
»Es riecht nach Essen. Merk dir eins: Stadtversammlung bedeutet Fast Food. Merk dir noch was: William erlaubt es nicht. Versteck es, und wenn er fragt, sag, da ist gepflückter Salbei drin.«
»Was?« Ich bin komplett verwirrt.
Die Heuballen in der Scheune sind bereits überwiegend besetzt. Knox deutet auf den äußeren Rand der mittleren Reihe, wo ein paar Leute in unserem Alter sitzen. »William steht auf alles, was mit der Natur zusammenhängt«, sagt er, während er vorangeht. »Er ist seltsam, und wenn du willst, dass er auf deiner Seite ist, sei genauso seltsam. Dann befindet ihr euch in einer perfekten Symbiose und schwimmt auf derselben Zykluswelle.«
»Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, Mann.«
»Knox«, sagt da eins der Mädchen auf den Heubänken, die wir gerade erreicht haben. Ihr volles braunes Haar fällt ihr bis auf die Hüfte, und ihre Hand ist mit der eines gut gebräunten Typen mit rückwärts aufgesetzter Cap verschränkt. »Er ist neu, okay? Verschreck ihn nicht direkt.«
»Sorry«, wendet sich ein anderes Mädchen an mich. Sie hat blondes Haar, riesige blaue Augen, die fast so groß wie meine sein müssen, und abstehende Segelohren. »Aria hat recht. Und – hi! Ich bin Paisley und war auch mal neu. Ich weiß also, wie erschreckend das sein kann.« Sie wirft Knox einen vorwurfsvollen Blick zu. »Und er kann einen manchmal ganz schön überfallen.«
»Als ob«, entgegnet Knox und zieht an ihrem Ohrläppchen, nur um sich eine Sekunde später über sie zu beugen und zu küssen. »Ich mach das nicht bei jedem, Babe. Nur bei dir.«
»Mit Sicherheit.« Amüsiert verdreht sie die Augen in meine Richtung. »Lass dich von seiner Sympathie nicht täuschen. Das sind seine extrovertierten Snowboarder-Gene.«
Beim Wort »Snowboarder« klingelt es. Die Puzzleteile setzen sich zusammen. Der Name, das Aussehen, der Sport …
»Du bist dieser bekannte Snowboardstar«, sage ich an Knox gewandt, während ich mich auf den freien Platz neben Aria setze.
»War dieser bekannte Snowboardstar«, entgegnet der Typ mit der Cap. Er nimmt einen braunen Pappkarton vom Boden und beginnt, sich mit vorgebeugtem Oberkörper chinesische Nudeln in den Mund zu schaufeln. Die Hälfte davon landet auf Arias Stiefeln.
»Ich liebe deine Essgewohnheiten, Wyatt«, sagt Aria, während sie mit der Sohle die Nudeln von ihrem anderen Schuh auf den Boden fegt.
»Wenn du willst, kann ich dir die Nudeln auch in die Socken schieben.«
»Das wäre besonders heiß.«
»Ich weiß. Dann holen wir sie später wieder raus.« Er wackelt mit den Brauen, während ihm weitere Nudeln auf den Boden fallen. »Wenn wir allein sind. Nur du, die Nudeln und ich.«
»Du kennst meine tiefsten Wünsche.«
»Und mein tiefster Wunsch ist, das gerade nicht mitbekommen zu haben«, sagt eine Frauenstimme, die ich schon einmal gehört habe.
Ich sehe auf und erkenne das Gesicht von Harper Davenport, dem rothaarigen Mädchen von der Wohltätigkeitsveranstaltung. Die Kälte hat ihre blassen Wangen gerötet. Sie schenkt mir ein schnelles Lächeln, ehe sie mir mit einer Handbewegung bedeutet, zur Seite zu rutschen. Ich mache Platz, und Harper setzt sich in einer eleganten Bewegung zwischen mich und Aria.
»Hi«, sage ich. Und dann: »Ich dachte nicht, dass ich dich hier treffen würde.«
Sie runzelt die Stirn. »Warum? Du weißt doch, dass ich hier lebe.«
»In der Scheune?«