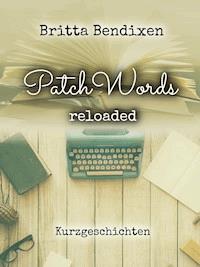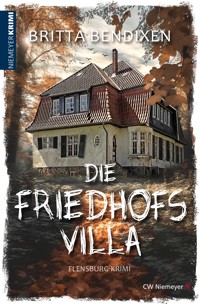9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CW Niemeyer
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Eine Männer-WG, ein Maler & ein mörderisches Geheimnis Der arbeitslose Handwerker Tom Jakobs wird tot am Rande der A7 entdeckt. Zunächst scheint es sich um einen Suizid zu handeln, doch bald steht fest: Jemand hat nachgeholfen. Die Flensburger Kommissare Andresen und Weichert ermitteln. Jakobs lebte mit drei anderen alleinstehenden Männern in einer WG. Hatte einer der Mitbewohner mit dem Opfer eine Rechnung offen? Oder besaß Jakobs' Bruder, ein erfolgreicher Flensburger Künstler, ein Motiv für den Mord? Dessen überhebliche Art ist Andresen jedenfalls ein Dorn im Auge. Obwohl die Brüder angeblich seit Jahren keinen Kontakt hatten, ahnt Andresen, dass Max Jacoby ihm etwas Wesentliches verschweigt. Der Fall rückt jedoch in den Hintergrund, als den Kommissar eine schlimme private Krise ereilt. Und dann überschlagen sich die Ereignisse …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Der Roman spielt hauptsächlich in bekannten Regionen, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und Charaktere sind frei erfunden.
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über www.dnb.de© 2022 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hamelnwww.niemeyer-buch.deAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: C. RiethmüllerDer Umschlag verwendet Motiv(e) von 123rf.comEPub Produktion durch CW Niemeyer Buchverlage GmbHeISBN 978-3-8271-8430-6
Britta BendixenList und Lüge
Honesty is such a lonely wordEveryone is so untrueHonesty is hardly ever heardAnd mostly what I need from you(Billy Joel)
PROLOG
Der Stoß vor die Brust kam überraschend.
Instinktiv bewegte sich sein rechtes Bein nach hinten, um Halt zu finden. Doch sein Fuß ertastete nur gnadenlose Leere. Was kein Wunder war, befand er sich doch weit oben auf der Treppe. Panisch mit den Armen rudernd, bemühte er sich, das Gleichgewicht zu halten. Vergebens.
„Hilf mir!“, rief er drängend und streckte einen Arm aus. „Schnell! Halt mich fest!“
Doch die Hände, von denen er sich Hilfe erhoffte, hoben sich nicht. Ballten sich stattdessen zu Fäusten. Fassungslos wanderte sein Blick nach oben, blieb an dem Gesicht hängen, das ihn beobachtete. Die Augen darin waren schmaler als sonst, die Lippen nicht länger geschwungen, sondern zusammengepresst. Ein Strich anstelle eines Mundes.
Ihm sah der personifizierte Hass entgegen.
In dieser Sekunde verlor er den Kampf gegen die Schwerkraft.
Der Versuch, sich abzustützen, misslang. Die Quittung dafür war ein stechender Schmerz in seinem Handgelenk. Schon verprügelten ihn hartkantige Stufen. Sie malträtierten sein Steißbein, den Rücken, die Schultern. Er wollte seinen Kopf schützen, konnte aber nicht mehr verhindern, dass dieser gegen eine Stufe prallte. Er stöhnte auf, sah tiefe Schwärze, dann eine Farbenexplosion. Sterne, Funkenregen, ein Feuerwerk.
Die bunten Punkte verblassten, und die Dunkelheit wich. Er lag nun still, war am Fuße der Treppe angelangt. Die Stufen hatten ihn zermalmt und ausgespuckt. Vorsichtig öffnete er die Augen. Betrachtete seine Umgebung. Alles wirkte verschwommen, die Umrisse flossen ineinander, wurden aber langsam schärfer.
Er wollte seinen linken Fuß, der auf der untersten Stufe liegen geblieben war, herunterziehen, konnte das Bein aber nicht bewegen. Auch die Arme verweigerten ihren Dienst. Sein Hinterkopf fühlte sich an, als hätte er einen Axthieb abbekommen, und sein rechtes Handgelenk pochte unangenehm.
Eigentlich tat ihm alles weh.
Seine Lider wurden schwer. Er wollte schlafen, nur schlafen. Keinen Schmerz mehr spüren. Dann fielen seine Augen zu, und ihn umfing gnädige Dunkelheit.
Ein lauter werdendes Pfeifen in den Ohren und ein Dröhnen in seinem Schädel weckten ihn auf. Er wollte die Augen öffnen, doch seine Lider weigerten sich, sich zu heben. Und jeder Versuch, sich zu bewegen, glich einer Tortur. Also verharrte er still in Finsternis und wartete darauf, dass sich jemand um ihn kümmerte.
Wie aus weiter Ferne vernahm er eine Stimme. „Er ist tot, ich bin sicher.“
Tot! So ein Unsinn, er war nicht tot. Er mochte sich zwar fühlen, als hätte man ihn durch einen Fleischwolf gedreht, aber er lebte, ohne jeden Zweifel.
„Tu es einfach!“, sagte die Stimme.
Einige eindringliche, aber unverständliche Sätze später verstummte sie, und Schritte näherten sich.
Er musste ein Lebenszeichen von sich geben. Jetzt gleich. Also versuchte er, seinen Mund zu öffnen, aber offenbar hatte jemand seine Lippen aneinandergeklebt.
Mit aller Kraft versuchte er, sie zu trennen. Langsam und so zögernd wie die Schalen einer Muschel löste sich die Oberlippe von der unteren. Erleichterung durchflutete ihn, wich jedoch Ernüchterung als er merkte, dass er kein Wort herausbrachte. Keinen verdammten Ton!
Also versuchte er, die Lider anzuheben. Leider fühlten sie sich an wie Vorhänge, in deren Saum Bänder mit Bleiperlen eingearbeitet waren, damit sie glatt und schwer herunterhingen.
Sein ganzer verdammter Kopf ließ ihn im Stich.
Wut und Enttäuschung machten sich in ihm breit. Aber so leicht gab er nicht auf. Er schaffte doch immer alles, was er sich vornahm!
Also konzentrierte er sich auf seine Hände. Die rechte Hand fühlte sich taub an, sie rührte sich nicht. Seine linke jedoch konnte er spüren. Und so versuchte er, seinen Fingern mit aller Energie, die er aufbringen konnte, Leben einzuhauchen.
Und es funktionierte! Es war nur ein Zittern, aber das reichte aus.
Die Schritte kamen immer näher. Hielten abrupt inne.
„Oh, mein Gott!“
Die Schritte entfernten sich eilig. Gewiss, um Hilfe zu holen.
Er lächelte. Glaubte zumindest, dass seine Mundwinkel sich auseinanderzogen. Ob sie es wirklich taten oder sein Gesicht noch immer jede Mitarbeit verweigerte, wusste er nicht. Es war ihm auch egal, denn nun strömte Zuversicht durch seine Adern. Alles würde gut werden.
Er spürte, dass die Bewusstlosigkeit erneut ihre Arme nach ihm ausstreckte. Willig ließ er sich umklammern und in ihre Tiefen hinabziehen.
Als sein Kopf sich plötzlich vom Boden hob, tauchte er wieder an die Oberfläche des Bewusstseins, denn diese Bewegung tat brutal weh. Ein Ton des Protestes entrang sich seiner Kehle, ging jedoch in einem merkwürdigen Knistern und Rascheln unter. Er kannte das Geräusch, konnte es bloß nicht zuordnen.
Irgendwas geschah mit ihm. Nur was?
Vermutlich war die Hilfe gekommen. Der Notarzt. Er würde alles in Ordnung bringen. Ein paar Stunden oder Tage noch, dann würde er an die letzten qualvollen Minuten zwar mit einem Schaudern, aber auch mit Erleichterung, sie überstanden zu haben, zurückdenken.
Das Atmen wurde mühsam. Etwas drückte seinen Hals zusammen. Schnürte ihm die Kehle zu. Was zum Teufel …?
An seinen Lippen klebte etwas Widerliches. Atmete er aus, verschwand es, kehrte jedoch mit jedem mühsamen Einatmen unerbittlich zurück, um immer länger zu verharren.
Die Bleibänder in seinen Lidern waren verschwunden. Er riss die Augen auf, konnte jedoch nichts erkennen. Nur hellen, undurchdringlichen Nebel.
Ein Hilfeschrei formte sich in seinem Inneren, kroch die verengte Kehle hinauf, erreichte seine Zunge, dieses nutzlose Ding, verkümmerte und erstarb.
Er wollte sich wehren. Sich aufrichten, befreien, losreißen.
Seine Arme und Beine gehorchten nicht. Als wären sie nicht mit Muskeln und Sehnen, sondern mit gekochten Spaghetti gefüllt. Sein Kopf dagegen fühlte sich an, als wäre er ein knallroter Ballon, kurz vor dem Zerplatzen.
Farben explodierten vor seinen Augen. Rot, Gelb, Blau, Grün.
Alles war bunt.
Er verwandelte sich in einen beschissenen Kindergeburtstag!
Wie hatte er seine Geburtstage damals gehasst! Seine Eltern hatten alles getan, damit er glücklich war, trotzdem konnte er diese Feiern nie genießen. Wie ein Video im Zeitraffer sah er eine mit Kerzen geschmückte Torte, lachende Gesichter, Girlanden, lustige Hüte und farbenprächtig verpackte Geschenke. Doch er verband keine Glücksgefühle mit diesen Bildern. Nur Zorn und das Gefühl, betrogen worden zu sein.
Das eklige Zeug klebte immer noch an seinen Lippen, saugte zugleich die Luft aus seinen Lungen. Ihm war, als küsse er den Tod.
Dann verschmolzen die bunten Farben, wurden zu einer dunklen, lilagrauen Masse.
Schließlich verschwand auch sie, und nichts blieb mehr übrig.
KAPITEL 1
„Carsten, wo bleibst du?“, rief Daniela Mücke aus dem Flur. „Wir müssen los!“
Im Schlafzimmer hockte Kriminalhauptkommissar Carsten Andresen im Unterhemd am Fußende des breiten Bettes, sein Handy in der Hand. Er schloss die Facebook-App, wo er sich einige Kommentare zu einem Post in der SG-Fan-Gruppe durchgelesen hatte.
„Komme gleich!“, rief er lustlos, legte das Smartphone neben sich und stand auf, um ein frisches Hemd aus dem Schrank zu holen.
An seinem letzten Urlaubstag würde er sich viel lieber mit Daniela und einem Bier vor den Fernseher setzen oder auf der Terrasse die letzten Sonnenstrahlen genießen, als zu Verenas Lesung zu gehen.
Aber Daniela freute sich nun mal darauf, und obendrein hatte sie seinem Kollegen Lutz Weichert fest zugesagt, dass sie kommen würden. Allerdings ohne es vorher mit ihm, Carsten, abgesprochen zu haben. Gegen den bittenden Blick seiner Freundin war er jedoch machtlos gewesen. Wie so oft. In ihren Händen wurde aus dem hartgesottenen Kommissar ein weicher Klumpen Wachs. Normalerweise konnte er damit gut leben, doch heute …
Seufzend schaute er aus dem Fenster, während er das zugeknöpfte Hemd in seine Hose stopfte. Die Sonne strahlte von einem blauen Himmel. Ein Septemberabend wie aus dem Bilderbuch. Dieses Phänomen häufte sich in der letzten Zeit. Tagsüber blieb es bedeckt und trüb, abends jedoch verschwanden alle Wolken, als hätten sie Feierabend. In seiner Vorstellung steckte sich die Sonne jetzt gerade die Daumen in die Ohren, wedelte mit den Fingern und streckte feixend die Zunge heraus.
„Carrr-sten!“
Wenn Daniela seinen Namen mit drei R aussprach, wurde es ernst. Mit einem brummelnden „Komme ja schon!“ trat er auf den Flur.
Direkt vor der Wohnungstür standen die ausgehfein gemachte Daniela, ihre Tochter Antonia, genannt Toni, sowie Andresens eigener Nachwuchs. Desirée hatte sich zu einer jungen Dame entwickelt, stellte er wieder einmal fest. Die blonden Locken hatte sie mit einem Zopfgummi gebändigt, der hartnäckige Babyspeck, unter dem sie lange gelitten hatte, war verschwunden, und statt löchriger Jeans und ausgelatschter Turnschuhe trug sie eine schwarze Hose, ein lässiges Blusenshirt und dazu goldglitzernde Sandalen mit Keilabsatz.
Andresen seufzte leise. Wo waren die Jahre geblieben? Und wozu hatte sie sich so in Schale geworfen? Desirée kam nicht mit zur Lesung, sondern sollte an diesem Abend den Babysitter machen. Oder vielmehr den Pubertier-Sitter.
Auch Antonia hatte sich entwickelt. Sie war vom aufgeweckten Grundschulkind zum Kaktus mutiert. Stachelig und unnahbar. Die Zwölfjährige und ihre Mutter zofften sich bei jeder Gelegenheit. Zuletzt hatte sich Toni darüber beschwert, dass sie nicht allein zu Hause bleiben durfte. Da sie es aber genoss, wenn sie Zeit mit der so erwachsenen und coolen Desirée verbringen durfte, war der Streit nicht eskaliert.
Carsten Andresen war dankbar dafür, dass er diese anstrengende Phase bei seiner Tochter damals nicht so hautnah mitbekommen hatte. Zu jener Zeit lebten seine Ex-Frau Marianne und er bereits lange getrennt. Aber er erinnerte sich deutlich an die Telefonate mit Marianne, in denen sie ihm das unangemessene Verhalten des Teenagers in den buntesten Farben geschildert hatte. Beneidet hatte er sie keine Sekunde lang. An den Wochenenden, die sie bei ihm verbrachte, war Desirée recht pflegeleicht gewesen. Vermutlich, weil er ihr mehr erlaubt hatte als ihre Mutter.
„Carsten, ich und Desirée wollen den dritten Harry-Potter-Film gucken!“, rief eine begeisterte Antonia ihm zu. „Auf Netflix.“
„Desirée und ich“, verbesserte Daniela automatisch, während sie sich im Spiegel betrachtete und eine widerspenstige dunkle Haarsträhne zur Räson brachte.
„Nee, du bist doch gar nicht da“, feixte Antonia.
Andresen begrüßte seine Tochter mit einem Küsschen auf die Wange. „Hallo, Liebes. Toni hat sich schon den ganzen Tag auf den Abend mit dir gefreut.“
„Hi, Paps.“ Desirée zwinkerte der Zwölfjährigen zu. „Wir werden es uns so richtig gemütlich machen.“
Er nickte wissend. „Davon bin ich überzeugt. Auf dem Tisch steht Knabberzeug, und im Kühlschrank findet ihr Limo.“
„Cola?“, fragte Antonia begierig.
Andresen nickte. „Selbstverständlich.“
„Aber du trinkst nicht mehr als zwei Gläser, verstanden?“ Daniela fixierte ihr Töchterchen mit strengem Blick. „Sonst kannst du nicht schlafen.“
Desirée legte einen Arm um Antonias Schultern. „Ich pass auf, keine Sorge.“
„Ja, Mama, keine Sorge. Sag mal, wann fängt diese Vorlesung eigentlich an?“
„Du kannst es wohl nicht erwarten, dass wir verschwinden“, bemerkte Andresen.
Antonia grinste nur.
„Es heißt Lesung, mein Schatz“, belehrte Daniela ihre Tochter, „nicht Vorlesung.“
„Aber da wird doch vorgelesen, oder etwa nicht?“
„Doch, schon.“
„Und wieso heißt es dann Lesung und nicht Vorlesung?“
„Weil man Unterricht an Universitäten Vorlesungen nennt und das zu Verwechslungen führen könnte“, antwortete Daniela. Sie nahm Andresens Jackett vom Garderobenhaken und warf es ihm zu. „Nehme ich jedenfalls an.“
Antonia verschränkte die Arme, und obwohl sie kleiner war als ihre Mutter, gelang es ihr, sie von oben herab anzusehen. „Also du weißt es nicht.“
Daniela ging nicht darauf ein. Sie warf einen Blick auf die Uhr und wandte sich an Andresen. „Wir müssen jetzt wirklich los, Carsten, Margarete wartet.“
„Ich weiß.“
„Ach, Oma kommt auch mit?“, wunderte sich Desirée. „Ich wusste gar nicht, dass sie neuerdings auf Krimis steht. Sonst liest sie doch nur Liebesschmonzetten und so was.“
Daniela lächelte. „Sie kam selten genug raus in der letzten Zeit. Ich habe sie also gefragt, ob sie mitkommen möchte, und sie schien großes Interesse zu haben.“
„Grüßt sie ganz lieb von mir, ja?“, bat Desirée. „Ist viel zu lange her, dass ich sie gesehen habe. Ich rufe sie morgen mal an.“
„Gute Idee“, meinte Andresen und stieß seinen rechten Arm durch den Jackettärmel. „Mann, hab ich eine Lust!“
Danielas Hand legte sich auf die Türklinke. „Es wird bestimmt nett. Immerhin spielt Verenas neuer Krimi auf dem Campingplatz in Holnis. Wir sind also ganz dicht am Tatort.“
„Hoffentlich hat sie sich nicht unseren Fall damals als Vorlage genommen“, unkte Andresen. Vor wenigen Jahren hatten seine Kollegen und er im Ostseecamp auf der Halbinsel Holnis in einem kniffligen Mordfall ermittelt, und Verena Christen hatte an der Seite von Andresens Kollege Weichert alles hautnah mitbekommen.
„Bestimmt nicht“, beruhigte ihn Daniela. „Schriftsteller verfügen doch über eine blühende Fantasie. Sie wird sich etwas Eigenes ausgedacht haben. Und nun komm.“ Sie öffnete die Tür und schenkte den beiden Mädchen ein Lächeln. „Viel Spaß, ihr zwei. Und denkt dran, nach dem Film ist Kinderbettzeit.“
„Ja-ha!“, stöhnte Antonia. „Das hast du jetzt schon dreimal gesagt. Und ja, bevor du es zum zwanzigsten Mal wiederholst: Ich werde mir artig die Zähne putzen, ehe ich ins Bett gehe. Und mich waschen.“
„So ist es recht, mein Goldkind.“ Daniela drückte ihrer Tochter einen Kuss auf die Wange und winkte Andresen. „Gehen wir.“
Sie traten aus der Hausscheibe, in der sie seit einem Jahr zusammenlebten. Andresen mochte die Gartenstadt Weiche, die ihre gemeinsame neue Heimat geworden war. Es war eine ruhige, sehr grüne Gegend, in der mehrere Kinder in Antonias Alter wohnten. Die Busanbindung war gut, es gab Einkaufsmöglichkeiten, Spielplätze und sogar ein Freibad in unmittelbarer Nähe. Wenige Jahrzehnte zuvor hatte sich hier die Briesen-Kaserne befunden, die deutsche und amerikanische Soldaten beherbergte. Daran erinnerte allerdings nichts mehr.
Auch die Straßennamen in der Gartenstadt hatten mit der militärischen Geschichte der Gegend rein gar nichts am Hut. Sie orientierten sich stattdessen an Getreidesorten und Schmetterlingsarten. Sie selbst wohnten im Distelfalterhof, einer ruhigen Sackgasse. Daniela genoss besonders das kleine Stück Garten, das zu dem Reihenhaus gehörte. Dort pflanzte sie Blumen und Kräuter, zupfte Unkraut und stutzte die Büsche. Einzig aufs Rasenmähen hatte sie keine Lust, das war seine Aufgabe. Carsten übernahm das ganz gern, zumal das Rasenstück eine überschaubare Größe hatte und die Arbeit daher schnell erledigt war.
„Jetzt fehlt uns nur noch ein Hund“, hatte er gesagt, nachdem sie eingezogen waren, doch Daniela hatte dieses Ansinnen sofort im Keim erstickt, obwohl auch Antonia von dem Gedanken begeistert gewesen war.
„Kommt nicht infrage. Früher oder später bleibt die Arbeit an mir hängen, das kenne ich noch aus meiner Kindheit. Wir hatten ebenfalls einen Hund, und nach kürzester Zeit wollten weder mein Bruder noch ich bei jedem Wetter mit ihm rausgehen. Es gab ständig Zoff deswegen. Außerdem machen Hunde Dreck und Lärm. Nein, vielen Dank, das könnt ihr vergessen.“
Margarete Andresen stand wartend am Straßenrand, als sie den Twedter Plack erreichten. Die Rentnerin bewohnte hier eine freundliche und altersgerechte Zwei-Zimmer-Wohnung mit kleinem Balkon. Carsten hielt direkt neben ihr, und prompt tauchten graue Locken an der offenen Autotür auf.
„Ihr seid ja beinahe pünktlich“, sagte seine Mutter zur Begrüßung, und kletterte mit leisem Stöhnen auf die Rückbank. Es klang, als quäle sie sich in einen Mini-Cooper, dabei war Andresens Mercedes eigentlich sehr geräumig.
„Hallo, Mama“, sagte er trocken. „Wir freuen uns auch, dich zu sehen.“
„Nu fahr endlich los, mien Jung!“, schalt sie ihn. „Du stehst den anderen Autos im Weg. Hallo, meine Liebe.“
Das galt Daniela, die die alte Dame gut gelaunt begrüßte.
Andresen gab Gas. Es war merkwürdig. Obwohl er inzwischen über fünfzig war, kam er sich in Gegenwart seiner Mutter stets wie ein Schuljunge vor.
„Wie geht’s dir?“, fragte er, als sie die baumbestandene Straße Richtung Glücksburg entlangfuhren.
„Gut so weit. Nur mein Rücken macht Fisimatenten. Verschleiß, sagt der Arzt. Ich soll Pillen schlucken, mich ordentlich bewegen und so alberne Übungen machen.“
„Bewegung kann nie schaden“, meinte Daniela.
Sie schnaubte. „Helfen tut es aber auch nicht.“
„Hast du das schon deinem Arzt gesagt?“
„Natürlich! Er meint nur, ich soll Geduld haben. Aber ein geduldiger Mensch war ich noch nie, stimmt’s, mien Jung?“
„Stimmt. Doch ich fürchte, in diesem Fall wird dir nichts anderes übrig bleiben. Aber mal was anderes, Mama. Hast du deinen Impfausweis dabei?“
„Ach, verflixt“, ärgerte sich Margarete Andresen. „Den hab ich vergessen. So langsam werd’ ich tüdelig.“
„Für die Lesung brauchst du ihn aber“, meinte Daniela. „Carsten, dreh doch eben um. Das kostet uns nur ein paar Minuten.“
Andresen setzte den Blinker, um in einer Stichstraße zu wenden, doch seine Mutter widersprach. „Nee, fahr weiter, Carsten, zurück ist doch Quatsch.“
„Ohne Impfausweis oder aktuellen Test lassen sie dich aber nicht rein.“
„Dann mach ich eben einen Test.“
„Es ist nach sechs, Mama. Um diese Uhrzeit haben die Teststationen schon geschlossen. Wir müssen also auf jeden Fall umdrehen.“
„Müssen wir nicht“, kam es trotzig von der Rückbank.
Andresen schöpfte Hoffnung. „Dann hast du den Ausweis doch dabei?“
„Nee.“ Nach einer kurzen Pause fügte seine Mutter kaum hörbar hinzu: „Ich hab mich noch gar nicht impfen lassen.“
„Was?!“ Andresen fuhr an den Straßenrand und machte den Motor aus. Verärgert wandte er sich zu ihr um. „Sag mal, willst du mich verarschen?“
„Du sollst nicht so ungehobelt reden, Junge.“
„Schon vor Wochen hast du behauptet, du wärst geimpft“, sagte er erbost. „Wieso hast du mich angelogen?“
„Weil ich Spritzen nun mal nicht leiden kann. Und wer weiß, was sie einem da in die Venen jagen? Ich bin doch kein Versuchskaninchen!“
„Nee, aber offensichtlich ein Aluhut-Träger“, brummte Andresen und fügte ungläubig und an Daniela gewandt hinzu: „Meine Mutter ist im gleichen Klub wie Xavier Naidoo und dieser komische Koch!“
„Vergiss den Wendler nicht“, erinnerte Daniela ihn. Dann drehte sie sich nach hinten. „Margarete, die Impfung ist zu deinem eigenen Schutz. Solange nicht alle gegen Corona geimpft sind, besteht immer noch Gefahr. Und die kann tödlich enden.“
Doch die alte Dame winkte ab. „Papperlapapp! An irgendwas sterben wir doch sowieso. Und wenn es mich erwischt, dann ist es eben so.“
„Mama!“ Andresen sah seine Mutter erschrocken an. Solche Reden kannte er nicht von ihr. „Den Piks merkst du gar nicht. Ich gehe mit dir hin, wenn du willst. Aber versprich mir bitte, dass du dich impfen lässt. Bald, hörst du?“
Sie winkte ab. „Ja, ja.“
Was das heißt, weiß ich genau, dachte Andresen mutlos.
„Was machen wir denn jetzt?“ Daniela wirkte ratlos. „Ohne Test oder Impfpass kann sie nicht an der Lesung teilnehmen.“
„Ich könnte Johanna anrufen. Vielleicht macht sie mir zuliebe eine Ausnahme.“
„Ganz sicher nicht. Carsten, überleg doch mal: Es wäre ein Risiko, das nach hinten losgehen kann. Du willst doch nicht, dass Johanna wegen euch womöglich in Schwierigkeiten gerät.“
„Du hast ja recht“, gab er zu. „War ’ne dumme Idee.“
„Es ist so ein schöner Abend“, meldete sich seine Mutter zu Wort. „Ich setze mich draußen hin, an ein offenes Fenster. Dann kriege ich genug mit.“
Andresen verdrehte die Augen. „Oh, Mama, du machst mich wahnsinnig!“
„Schön, machen wir es so“, beendete Daniela das Thema. „Wenn es dir ernst ist, dass du draußen sitzen willst. Es könnte kühl werden“, fügte sie warnend hinzu.
Margarete fegte den Einwand mit einer Handbewegung fort. „Ich bin nicht aus Zucker.“
„Bestimmt hat Johanna eine Decke für dich.“ Carsten ließ den Motor an und fuhr kopfschüttelnd los. „Mensch, Mama, du machst vielleicht Sachen …“
Als sie beim Strandcafé in Holnis, das direkt an der Promenade lag, ankamen, ließ sich Andresens Mutter an einem Tisch nieder, der nahe an einem Fenster stand, das man auf Kipp gestellt hatte. „Geht ihr ruhig, hier sitz ich gut. Viel Spaß.“
Andresen blickte durch die Scheibe ins Innere des Cafés. Die Einrichtung aus hellen, rustikalen Möbeln, angenehmer Beleuchtung und maritimem Ambiente wirkte gemütlich und einladend.
Er entdeckte Verena Christen. Sie stand vor einem Tisch, auf dem sie mehrere Exemplare ihrer beiden bisher erschienenen Bücher dekorativ ausgestellt hatte und alles ein wenig hin- und herschob, bis sie mit dem Ergebnis zufrieden war.
Immer mehr Gäste strömten ins Café und suchten sich Sitzplätze.
„Was ist?“, fragte Daniela, „gehen wir rein?“
Andresen nickte ihr zu und wandte sich dann an seine Mutter. „Ich komm gleich noch mal zu dir raus.“
„Nur keine Umstände“, meinte sie abwinkend. „Genießt den Abend.“
„Schnutenpullis raus“, sagte Daniela, ehe er etwas erwidern konnte.
Er zog gehorsam eine hellblaue Maske aus seiner Jacketttasche und verhüllte seine untere Gesichtshälfte.
Dass man nur noch medizinische Schutzmasken oder diese grässlichen FFP2-Dinger benutzen durfte, unter denen Andresen immer entsetzlich transpirierte, nervte ihn gewaltig. Zum letzten Weihnachtsfest hatte er von Daniela eine sehr bequeme und schicke Maske mit dem Logo der SG Flensburg-Handewitt bekommen und sich ehrlich darüber gefreut. Wenngleich er selbstverständlich darüber gescherzt hatte, dass es merkwürdige Zeiten seien, in denen man sich über so ein absurdes Geschenk wie eine Gesichtsmaske freute.
Getragen hatte er seinen SG-Schnutenpulli allerdings nur kurze Zeit, denn seit Ende Januar waren nur noch die medizinischen Masken erlaubt. Wer auch immer die herstellt, dachte Andresen, verdient sich derzeit garantiert eine goldene Nase.
Es war warm im Inneren des Gebäudes, sodass er bereits jetzt unter der Maske schwitzte. Wie er diese Dinger verabscheute! Wenn sie endlich nicht mehr nötig waren, das hatte er sich fest vorgenommen, würde er damit ein schönes Lagerfeuer im Garten machen.
Am Eingangsbereich stauten sich die Besucher. Die erforderlichen anderthalb Meter Abstand hielt kaum jemand ein.
Andresen gelang es dank seiner knapp zwei Meter Körpergröße, über die vor ihm Stehenden hinweg einen Blick in den Veranstaltungsraum zu werfen. Ein Angestellter überprüfte an der Tür zum Café den Impfstatus der Gäste. Das nahm Zeit in Anspruch, sodass es nur langsam voranging.
Neben Verena entdeckte Carsten seine Bekannte Johanna Marquardsen. Ihr gehörten sowohl das Café als auch der angrenzende Campingplatz.
Endlich waren Daniela und er an der Kontrolle vorbei. Sie betraten den Raum und steuerten Verena und Johanna an.
„Ich hätte nicht gedacht, dass so viele kommen würden“, hörte Carsten Verena sagen. Ihre Wangen glühten hellrot. Ob vor Freude oder Nervosität, wusste Andresen nicht.
„Ist doch wunderbar!“, erwiderte Johanna. Im nächsten Moment fiel ihr Blick auf Carsten Andresen und Daniela. Strahlend ging sie ihnen entgegen. „Hallo, ihr Lieben! Schön, dass ihr da seid.“
Üblicherweise stellte sie sich auf die Zehenspitzen, wenn sie auf den ungleich größeren Andresen traf, und begrüßte ihn mit einem flüchtigen Wangenkuss. Diesmal hielt sie ihm lediglich den Ellenbogen hin. Corona-Begrüßung. Er stieß mit seinem dagegen. „Hallo Johanna. Wie geht’s?“
„Prächtig“, antwortete sie, sichtlich gut gelaunt.
„Daniela kennst du ja“, sagte Andresen, „und das da draußen, vor dem Fenster, ist meine Mutter. Sie hat ihren Impfpass vergessen.“
Dass sie noch ungeimpft war, brauchte Johanna nicht zu wissen, fand er.
„Willkommen!“ Johanna wiederholte die Ellenbogen-Prozedur bei Daniela und winkte Andresens Mutter, die die Szene von der anderen Seite des bodentiefen Fensters beobachtete. Sie wedelte huldvoll mit der Hand und lächelte freundlich.
„Soll sie da draußen sitzen bleiben?“, fragte Johanna irritiert.
„Geht ja nicht anders“, antwortete Andresen. „Sie hat auch keinen aktuellen Test dabei. Es war ihr Vorschlag, mach dir keinen Kopf.“
„Na dann“, meinte Johanna achselzuckend. „Ich sorge dafür, dass sie eine Decke und einen Becher Tee bekommt.“
„Das ist lieb von dir, danke.“
Daniela schaute sich um. „Ich hätte nicht gedacht, dass es so voll wird.“
„Die Werbung im Bistro, in der Zeitung und am Schwarzen Brett des Campingplatzes hat was gebracht, wie man sieht“, meinte Johanna zufrieden. „Kommt, ihr setzt euch am besten da drüben hin.“ Sie führte Andresen und Daniela zu einem Tisch, der nur einen knappen Meter von seiner draußen sitzenden Mutter entfernt war.
Am größeren Nebentisch entdeckte Andresen seinen Kollegen Lutz Weichert zwischen zwei Paaren. Das eine Pärchen war Carsten bekannt. Es handelte sich um Prof. Dr. Christen, den Vater von Verena, und dessen Lebensgefährtin. Andresen hatte ihren Namen allerdings vergessen. Soweit er sich erinnerte, war sie Oberärztin in der Diako, der Klinik, in der Prof. Dr. Christen auf dem Chefarztsessel der Chirurgie saß.
Das andere Pärchen, das Weichert gegenübersaß, war jüngeren Alters. Der Mann wirkte wie Anfang vierzig, die Frau schätzte Andresen auf Mitte dreißig. Sie hatte eine rotbraune Kurzhaarfrisur und ein hübsches schmales Gesicht, das von auffälligen Ohrringen eingerahmt wurde. Die Bluse, deren Farbe Andresen stark an Lachs erinnerte, gab ihrer von der Sonne gebräunten Gesichtshaut einen rosigen Anstrich. Sie unterhielt sich angeregt mit der Oberärztin. Der Mann dagegen redete auf Prof. Dr. Christen ein und hielt höchstens einmal inne, um an seinem Weißwein zu nippen. Er trug trotz des Sommerabends einen schwarzen Rolli und auf der Nase eine Brille mit auffälligem rotem Rahmen, was ihm einen extravaganten Touch verlieh.
„Das ist Maximilian Jacoby“, raunte Johanna Marquardsen, die Andresens Blick offenbar gefolgt war, ihm zu. „Der Künstler.“
Die Ehrfurcht in ihrer Stimme war nicht zu überhören.
„Ist es sehr peinlich, wenn ich sage, dass ich den Namen noch nie gehört habe?“
„Von dir habe ich nichts anderes erwartet“, gab sie mit sanftem Spott zurück. „Siehst du die Bilder an den Wänden? Die sind alle von ihm. Er hat mich gefragt, ob er die Veranstaltung dafür nutzen dürfe, ein paar seiner Werke auszustellen, und natürlich habe ich ihm das gern erlaubt. Wir sind alte Bekannte.“
„Interessant.“ Daniela ließ ihren Blick über die Kunstwerke schweifen. „Da sind so einige Hingucker dabei.“
„Das denke ich auch“, stimmte Johanna ihr zu.
Andresen betrachtete die Gemälde und schaute dann ungläubig von Johanna zu Daniela. „Macht ihr Witze? So was hat Desirée früher aus dem Kindergarten mit nach Hause gebracht, um damit unseren Kühlschrank zu dekorieren. Ihre Bilder waren zwar kleiner als die hier, aber sonst …“
„Oh Carsten, du bist ein solcher Kulturbanause!“ Daniela sah ihn strafend an.
Johanna lachte. „Das war er schon immer. Carsten, das nennt man moderne Kunst. Es ist die Stilrichtung Picassos. Im Übrigen“, fügte sie mit einem Augenzwinkern hinzu, „hast du durchaus etwas mit Jacoby gemein.“
Andresen betrachtete den Urheber der Bilder und hob zweifelnd eine Braue. „Ach, tatsächlich?“
„Wenn ich es dir sage. Er ist genau wie du ein großer SG-Fan. Soviel ich weiß, hat er eine Dauerkarte für einen Platz, für den andere sich einen Arm ausreißen würden. Außerdem kennt er mehrere Spieler und den SG-Geschäftsführer persönlich.“
„Mach den Mund wieder zu, Carsten“, bat Daniela und stieß ihn sacht in die Rippen. „Dir steht der Neid ins Gesicht geschrieben.“
„Ich bin absolut nicht neidisch“, log Andresen, dessen Dauerkarten-Sitzplatz sich in einer der vier Hallenecken befand, noch dazu auf einem der oberen Ränge und somit weit weg vom Geschehen auf der Spielfläche.
Johanna sah auf ihre Armbanduhr. „Gleich geht’s los. Ich denke, es sind jetzt alle da. Viel Spaß euch beiden!“
„Danke.“ Andresen merkte, dass Weichert auf ihren Tisch zukam und sich dabei umständlich eine FFP2-Maske vor Mund und Nase fummelte. Wie üblich hatte er seine dünnen Beine in eine enge Jeans gezwängt. Statt eines zitronengelben oder laubfroschgrünen Jacketts trug er an diesem Abend jedoch nur ein kurzärmeliges, farbenfrohes Sommerhemd.
„Zurück aus dem Urlaub?“, erkundigte er sich. „Sind Sie gut erholt? Wie war Österreich?“
„Wunderbar!“, antwortete Daniela mit einem breiten Lächeln. „Ich konnte mich an den Bergen gar nicht sattsehen. Mal was anderes, wenn man von der Küste kommt.“
„Aber diese Kraxelei …“, fügte Andresen mit einem leichten Stöhnen hinzu. „Das war wie ewiges Treppensteigen. Und bei Ihnen? Irgendwas Besonderes passiert?“
Weichert winkte ab. „Nein, alles ist wie immer. Sie haben nichts verpasst.“
„Dann ist es ja gut.“ Andresen bemerkte die Motive auf dem Hemd seines Kollegen. Er gluckste. „Sind … sind das lauter bunte Fische da auf Ihrem Hemd?“
„Ja, es sind Fische“, erwiderte Weichert verstimmt. „Das Hemd erschien mir zu dem Anlass passend. Haben Sie ein Problem damit, Herr Kollege?“
„Hat er nicht“, antwortete Daniela schnell. „Sagen Sie, ist Ihre Verlobte sehr nervös wegen der Lesung?“
Andresen warf ihr mit erhobener Augenbraue einen Blick zu. Sie schaute hochmütig zurück. Es war die Art stummer Wortwechsel, den die zwei über die letzten Jahre perfektioniert hatten.
„Ja, sie ist ziemlich aufgeregt.“ Lutz Weichert sah über die Schulter zu Verena hinüber, die nun an einem Rednerpult mit Mikrofon stand und in einem Buch blätterte, in dem viele bunte Zettel steckten. „Es ist zwar nicht ihre erste Lesung, aber die erste aus dem neuen Buch.“
Daniela wies lächelnd auf den Büchertisch, der links von ihnen an der Wand aufgebaut war und der das Kaufinteresse der Anwesenden wecken sollte.
„Später werde ich mir den Krimi auch holen. Meinen Sie, Ihre Verlobte könnte ihn signieren?“
Er nickte überzeugt. „Das macht sie bestimmt gern. Ich weiß, dass sie sich einen Kugelschreiber eingesteckt hat.“
Andresen starrte noch immer auf das Hemd seines Kollegen und versuchte, ein Lachen zu unterdrücken.
Weichert bemerkte dies, seufzte und verschränkte die Arme. „Also los, lassen Sie ohne Hemmungen raus, was Ihnen auf der Zunge liegt. Man soll bekanntlich nichts unterdrücken, sonst bekommt man Verstopfung.“
Andresen fing Danielas warnenden Blick auf. „Es ist nichts“, sagte er tonlos, ohne den Blick von den bunten Meeresbewohnern abzuwenden. „Gar nichts.“
„Na, dann ist es ja gut.“ Weichert hob verabschiedend eine Hand. „Wir sehen uns später. Viel Spaß.“ Damit kehrte er zu seinem Platz zurück und setzte sich.
„Wieso wünschen uns alle viel Spaß?“, wunderte sich Andresen. „Ist das eine Krimi-Lesung oder eine Comedyshow?“
Daniela musterte ihn verärgert. „Manchmal bist du ein solcher Klotz.“
„Ich bitte dich! Er sieht aus wie ein wandelndes Aquarium.“ Andresen lachte leise vor sich hin.
„Wolltest du nicht noch mal nach deiner Mutter sehen?“
Er schaute durch das Fenster nach draußen. Johanna hatte Wort gehalten, auf dem Tisch vor Andresens Mutter stand ein dampfender Becher, und auf ihren Knien lag eine Decke. Sie fing seinen Blick auf, lächelte ihm zu und hob einen Daumen. Er nickte zufrieden, winkte kurz und wandte sich an Daniela. „Alles gut, es geht ihr prima.“
Dann fiel ihm auf, dass im Gegensatz zu ihr und ihm selbst alle Gäste ein Glas vor sich stehen hatten. Prompt überfiel ihn gewaltiger Bierdurst.
„Ich hole uns rasch etwas zu trinken“, beschloss er und machte Anstalten, aufzustehen, doch Daniela hielt ihn zurück. „Psst! Es geht los.“
„Aber ich will doch nur –“
„Bleib sitzen, Carsten!“
Enttäuscht ließ er die Schultern nach unten sacken und blieb, wo er war.
Johanna Marquardsen stand am Mikrofon. „Herzlich willkommen zu unserer Krimi-Lesung am Tatort, und danke, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Es ist mir eine große Freude …“
Neidisch die anderen Gäste betrachtend, die sich an ihren Getränken labten, hörte Andresen mit halbem Ohr zu, wie die Gastgeberin die Autorin ankündigte, und klatschte brav mit, als die anderen Gäste applaudierten.
Verenas sichtliche Nervosität war bei der Begrüßung spürbar, verschwand aber rasch, nachdem sie angefangen hatte zu lesen. Ihre Stimme wurde fester, und sie schien Spaß daran zu haben, ihre Zuhörer mit in die Handlung zu nehmen.
Sein Durst sorgte in der folgenden halben Stunde zwar dafür, dass Andresens Konzentration hin und wieder nachließ, doch bekam er genug mit von Verenas Vortrag, um entgegen seiner Erwartung angenehm überrascht zu sein. Natürlich musste die Polizeiarbeit in ihrem Roman zugunsten der Unterhaltung von der Realität ein gutes Stück abweichen, doch sie verstand es, spannend, interessant und zuweilen gar humorvoll zu erzählen.
Als sie ihre Zuhörer in die Pause entließ, sprang Andresen sofort auf und zupfte seine Maske aus der Hosentasche. „Was möchtest du trinken?“
„Ich nehme einen Aperol Spritz.“ Daniela lächelte ihm mitleidig zu. „Hast du sehr gelitten?“
„Weniger, als ich befürchtet habe, muss ich zugeben. Aber trotzdem … Bin gleich wieder da.“
„Du, ich gehe raus zu deiner Mutter.“
„Alles klar! Ich finde dich schon.“
Sein Leiden fand kein so rasches Ende, wie er gehofft hatte. Bis er sich zur Bar durchgekämpft hatte, standen dort bereits viele andere an. Da die Gäste den erforderlichen Abstand nun einhielten, wirkte die Schlange noch länger. Andresen trat ungeduldig von einem Fuß auf den anderen.
Mit einem großen Bier in der einen und einem bauchigen Glas, das mit einer quietschorangenen Flüssigkeit gefüllt war, in der anderen Hand, bahnte er sich einige Minuten später einen Weg durch die plaudernde Menge nach draußen.
Es erwies sich als etwas umständlich, mit vollen Händen die Maske vom Mund zu entfernen, doch es gelang. Carsten hob das Bierglas an die Lippen. Endlich!
Als die herbe Flüssigkeit durch seine Kehle rann, schloss er genießerisch die Augen und spürte jedem Tropfen nach. Himmel, tat das gut! Zufrieden setzte er das Glas ab und schaute sich um.
In offenkundig bester Laune umringten mehrere Gäste die vor dem Café aufgestellten Bistrotische, rauchten, lachten und schwatzten.
Zunächst steuerte Andresen seine Mutter an. Sie hatte an ihrem Tisch Gesellschaft bekommen. Ein Pärchen im mittleren Alter saß ebenfalls dort und ließ sich gerade erzählen, dass Margarete Andresen ihren Impfausweis „vergessen“ hatte und deshalb von hier aus zuhörte. „Aber das stört mich überhaupt nicht“, behauptete sie gerade. „Man kann alles gut verstehen, und das Wetter ist ja heute sehr angenehm.“
Andresen trat an ihre Seite, beugte sich hinunter und fragte, ob er ihr etwas zu trinken besorgen solle.
„Nee, lass man, mien Jung“, wehrte seine Mutter ab. „Ich trinke abends nicht mehr so viel, der Tee reicht mir völlig.“
„Ah, Sie san oiso der Sohn, der Herr Hauptkommissar?“, erkundigte sich der Herr am Tisch. Ganz offensichtlich ein Urlauber aus dem Süden der Republik.
„Das stimmt“, bestätigte Andresen.
„Wie aufregend!“, quietschte seine Begleiterin, die ein wenig zu tief ins Make-up-Tiegelchen gegriffen hatte. Die knallroten Lippen glänzten unnatürlich, und auch die rosa Wangen waren definitiv kein Ergebnis von zu viel Sonne.
Andresen lächelte gezwungen und wandte sich an seine Mutter. „Ich bin bei Daniela, wenn irgendwas ist“, sagte er.
Sie nickte. „Geh nur, mien Jung. Mir geht es gut.“
Als Andresen seine Lebensgefährtin endlich entdeckte, seufzte er leise. Sie unterhielt sich mit diesem Künstler und seiner Begleitung. Außer den dreien befand sich noch ein dicklicher Mann im Business-Anzug in dieser Gruppe. Der Anzugträger starrte den Maler aus wasserblauen Augen bewundernd an. Der wiederum sonnte sich offensichtlich in dessen schwärmerischem Blick.
Andresen konnte es nicht ändern, er mochte diesen Maximilian Jacoby nicht. Und bisher hatte sein Instinkt ihn in dieser Hinsicht nie getrogen. Auch dass sie ein Hobby teilten, änderte den ersten Eindruck nicht.
Es gab nach Andresens Meinung zwei Sorten von SG-Fans in der Flens-Arena: die, die den Sport liebten und ebenso leidenschaftlich wie lautstark die Spieler anfeuerten, ihre Siege feierten und nach einer Niederlage sowohl tiefe Enttäuschung und Trauer verspürten als auch eine tiefe Loyalität zu ihrem Team. Und dann gab es noch die, denen es hauptsächlich darum ging, bei einem Glas Wein in der VIP-Lounge gesehen zu werden, das hochklassige Catering zu genießen, und im besten Falle wertvolle Kontakte zu knüpfen.
Jene Fans konnten nach Andresens Vermutung einen Tempogegenstoß nicht von einem Kempa-Trick unterscheiden, aber viele von ihnen unterstützten die SG finanziell. Dafür durften sie am nächsten Tag in ihrem Freundeskreis damit prahlen, sie hätten mit dem Trainer ein Bierchen geschlürft.
Andresen war davon überzeugt, dass Jacoby zu der zweiten Sorte Fan gehörte.
„Ihre Bilder sind wirklich wunderschön“, sagte Daniela gerade zu dem Künstler, als Andresen neben sie trat und ihr das orangefarbene Getränk reichte. Sie nahm es, dankte ihm beiläufig und widmete ihre Aufmerksamkeit dann wieder Max Jacoby. „Diese Farbgewalt, diese Energie, diese lebendige Leichtigkeit, das ist durchaus was Besonderes.“
Max Jacoby deutete eine Verbeugung an. „Vielen Dank.“
Sie scheint ihr Lob tatsächlich ernst zu meinen, schoss es Andresen durch den Kopf. Dabei sah in seinen Augen jedes einzelne dieser sogenannten Kunstwerke aus, als wäre auf der Leinwand ein Farbkasten explodiert. Auf einigen Exponaten waren zwar mit etwas Mühe Motive zu erkennen, doch gingen diese in den bunten Feuerwerken beinahe unter.
Nee, dachte Carsten Andresen abfällig, schön geht echt anders. Er mochte Bilder wie das mit den Uhren von Dalí, vielleicht noch die Sonnenblumen von van Gogh, aber weiter, musste er einräumen, reichte sein Kunstwissen nicht.
„Herr Jacoby, darf ich Ihnen meinen Lebensgefährten vorstellen“, sagte Daniela nun und wies auf ihn. „Carsten Andresen.“
„Max Jacoby“, sagte der Künstler und nickte Andresen mit einem kleinen Lächeln zu. „Und dies ist meine Lebensgefährtin, Eliana Nowak.“
Die Dame mit dem kecken roten Haarschopf begrüßte Andresen höflich, und er nickte ihr zu. „Sind Sie ebenfalls Künstlerin?“, fragte er.
Sie schüttelte den Kopf. „Nein, leider bin ich in dieser Hinsicht ohne jedes Talent.“
Andresen hörte aus ihren Worten einen leichten polnischen Akzent heraus.
„Dafür haben Sie andere Qualitäten, nehme ich an“, meinte der Geschäftsmann schmeichelnd.
„In der Tat.“ Jacoby legte einen Arm um die Taille seiner Begleiterin. „Eliana ist sehr belesen, spielt ganz anständig Klavier und ist auch eine passable Schachspielerin. Außerdem hat sie früher als Model gearbeitet.“
„Vielseitig talentiert, ich habe es geahnt“, behauptete der Typ im Anzug.
„Weit kommt man aber nur, wenn man sich auf eine Sache konzentriert“, erwiderte Eliana bescheiden.
„Wie man ja an Herrn Jacoby sehen kann“, hakte sich Daniela ins Gespräch. „Je länger man seine Bilder betrachtet, umso mehr kann man in sie hineininterpretieren, finden Sie nicht auch?“, erkundigte sie sich bei dem Mann im Anzug.
Der nickte eifrig. „Man spürt die immense Leidenschaft, die dahintersteckt. Bei uns hängt eines seiner Bilder im Wohnzimmer über der Couch, und ich freue mich jedes Mal, wenn mein Blick darauf fällt. Es wertet den gesamten Raum auf.“ Er hob sein Sektglas und stieß mit dem Maler an, der sichtlich geschmeichelt das Lob entgegennahm.
„Ich versuche, in meiner Arbeit die verborgenen Schichten von Mensch und Gesellschaft zu erkunden“, tönte Maximilian Jacoby, „und freue mich immer, wenn mir dies gelingt.“
Andresen rollte unauffällig mit den Augen und versuchte Danielas Blick einzufangen, doch ihrer hing an Jacoby fest. „Ihre Werke sind so … dunkelbunt“, meinte sie gerade, „das gefällt mir sehr.“
Andresen starrte sie ungläubig an und trank dann einen großen Schluck. Daniela offenbarte ihm gerade eine Seite ihres Wesens, die ihm völlig neu war.
„Dunkelbunt …“, wiederholte Jacoby nachdenklich und schenkte Daniela ein breites Lächeln. „Diese Bezeichnung ist durchaus passend, scheint mir.“
„Ja, in der Tat“, ließ sich Eliana Nowak vernehmen. „Das Wort kannte ich noch nicht, aber es gefällt mir.“
„Es kam mir plötzlich in den Sinn“, sagte Daniela mit kaum verborgenem Stolz. Sie wies auf die Kette um Elianas Hals, an der ein tropfenförmiger Anhänger mit einer Perle baumelte. „Sehr hübsch. Ist die Perle echt?“
„Ich glaube ja.“ Mit einem fast zärtlichen Lächeln berührte Eliana den Anhänger. „Die Kette bedeutet mir sehr viel. Ich habe sie bereits seit vielen Jahren.“
„Ein Erbstück?“
Eliana schüttelte den Kopf. „Nein. Ich habe sie von meinem ersten selbst verdienten Geld gekauft.“
„Interessant“, sagte Daniela. „Und was für eine gute Idee. Ich habe mir für meinen ersten Lohn als Auszubildende ein Paar Stiefel geleistet. Die sind natürlich längst hinüber.“
„Bei mir war es ein Pinselset“, erinnerte sich Max Jacoby, der, wie Andresen vermutete, es gar nicht schätzte, nicht Mittelpunkt der Unterhaltung zu sein. Prompt begann er zu berichten, was für atemberaubende Werke mit jenen Pinseln entstanden waren.
Carsten hatte endgültig genug von dem Kunstgeschwafel. Es wurde Zeit, das Thema zu wechseln. Er wartete, bis der Künstler Luft holte, und sagte rasch: „Stimmt es, was mir Johanna Marquardsen erzählt hat? Sie sind SG-Fan?“
Jacoby stutzte kurz, dann nickte er, und seine Augen begannen zu leuchten. „Schon seit vielen Jahren, ja. Ich freue mich sehr auf die neue Saison. Sobald Zuschauer wieder live dabei sein können, werde ich in der Halle sein.“
Die Ablenkung hat funktioniert, freute sich Andresen. „Auch bei Maskenpflicht?“, hakte er nach. Denn darauf hatte er nicht die geringste Lust. In dem Fall schaute er sich die Spiele doch lieber im Fernsehen an.
„Natürlich“, antwortete der Künstler, in einem Ton, als hätte Andresen gefragt, ob er ein menschliches Wesen sei. „Ein richtiger Fan lässt sich doch wegen solch einer Lappalie nicht abschrecken.“
Andresen schluckte die Kröte mit einiger Mühe und wusste nichts zu erwidern. Aber er bemerkte aus dem Augenwinkel, dass Daniela sich mühsam ein Grinsen verkniff.
„Was meinen Sie?“, wollte Jacoby wissen, „werden wir dieses Jahr wieder Meister?“
„Nun, die Zugänge sind vielversprechend“, antwortete Andresen bedächtig. „Allerdings weiß man nicht, wie lange Möller und Semper verletzt sein werden. Und Göran Søgard war zuletzt ebenfalls angeschlagen. Dazu die knappe Pause wegen Olympia … Leicht wird es sicherlich nicht werden.“
„Ja, da stimme ich Ihnen zu. Die Spieler brauchen dringend mehr Regenerationszeit. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, nicht wahr?“
Andresen lächelte pflichtschuldig.
Als sich das Gespräch dank des Businesstypen wieder dem Thema Kunst zuwandte, ließ Carsten den Blick schweifen und entdeckte Lutz Weichert, der just in diesem Moment durch die Tür nach draußen trat. Unauffällig zog sich Andresen von der Ansammlung aus Kunstfans zurück und steuerte seinen Kollegen an.
„Du liebe Güte“, sagte er mit einem Seitenblick auf den umschwärmten Künstler, „das ist vielleicht ein Fatzke.“
„Max Jacoby?“ Weichert lächelte wissend. „Sie können mit Kunst natürlich nichts anfangen, das war mir von vornherein klar.“
„Kunst an sich gefällt mir durchaus. Aber das!“ Er schüttelte den Kopf. „Mögen Sie etwa diese Klecksereien?“
Sein Kollege zuckte die Achseln. „Ich würde nicht jedes davon in mein Wohnzimmer hängen, das gebe ich zu, aber einige Bilder sind gar nicht so übel. Es sind außerdem echte Wertanlagen. Wissen Sie, wie viel eins seiner Gemälde kostet?“
„Sie denken immer nur an Geld“, warf Andresen seinem Kollegen vor, und betrachtete die Kunstwerke, die er durch die Glasfront erkennen konnte. Einige waren nicht viel größer als eine DIN-A4-Seite, andere waren fast so groß wie ein Flachbildfernseher.
Er schüttelte den Kopf. „Ich habe keine Ahnung, was man für so einen Schinken hinblättern muss.“
„Für die Kleineren müssten Sie sechs- bis siebenhundert Euro berappen. Und jetzt raten Sie mal, wie viel ihm die Größeren einbringen.“
„Das will ich mir lieber gar nicht vorstellen“, brummte Andresen. „Und er verkauft die wirklich? Ich meine, es gibt Leute, die dafür eine Summe auf den Tisch legen, für die man in den Urlaub fliegen könnte?“
„Mehr, als Sie sich vorstellen können. Maximilian Jacoby verdient in manchen Monaten so viel wie wir in einem Jahr. Er ist echt angesagt. Und zwar nicht nur in Flensburg und Umgebung, sondern in ganz Schleswig-Holstein, in Hamburg, Niedersachsen und in Süddänemark.“
Das erklärt die exklusive VIP-Dauerkarte, dachte Andresen.
„Übrigens signiert Verena gerade ihre Bücher“, meinte Weichert. „Wollten Sie nicht auch eins kaufen, bevor die Lesung weitergeht?“
„Daniela wollte das“, korrigierte Andresen, doch dann gab er nach. „Da ich aber ein fürsorglicher Mensch bin, erledige ich das für sie. Und meine Mutter möchte bestimmt auch eins. Außerdem ist mein Bier alle. Kommen Sie mit hinein? Die Fische auf ihrem Hemd wirken so deprimiert, vermutlich, weil sie das Meer sehen, aber nicht hineinspringen dürfen.“
„Witzig!“ Weichert zog seine Maske vom Handgelenk, wo er sie griffbereit aufbewahrt hatte, band sie um und folgte Andresen zurück ins Café.
Mit einem frischen Bier und zwei signierten Büchern kehrte Andresen an seinen Tisch zurück und nahm mit einem Seufzer der Erleichterung seine Schutzmaske ab. Daniela war inzwischen ebenfalls wieder da. Er reichte ihr das für sie bestimmte Exemplar. „Hier, für dich. Signiert.“
Erfreut nahm sie das Buch entgegen und schlug es auf. „Für Daniela. Spannende Unterhaltung wünscht Verena Christen“, las sie vor und drückte Andresen einen Kuss auf die Lippen. „Danke, mein Schatz.“
„Sehr gern.“ Er hob das zweite Buch. „Und eins ist für Mama. Ihr gebe ich es später.“
Verenas Vater, Prof. Dr. Christen, hatte Andresen entdeckt und steuerte auf ihn zu. „Ah, Herr Hauptkommissar“, begrüßte er ihn leutselig. „Was sagen Sie als Profi denn bisher zu Verenas Roman?“
„Nun ja, ich denke, er –“
„Ach, sind Sie auch bei der Kripo?“, fiel ihm Jacoby ins Wort, der plötzlich hinter dem Professor auftauchte. „Wie der liebe Lutz?“
„In der Tat“, bestätigte Andresen. „Wie der liebe Lutz.“
„Ich stelle mir das schrecklich vor“, meinte der Maler. „Ständig mit Leichen zu tun zu haben. Und mit Verbrechern. Lutz erzählt ja nicht viel, aber leicht ist das bestimmt nicht. Das Ganze geht doch sicher sehr auf die Psyche, oder?“
„Wissen Sie“, erwiderte Andresen lächelnd, „wir Kripobeamte sind allgemein ein seltsames Völkchen. Verschwiegen, schwarzhumorig … Aber vor allem sind wir diskret. Im Gegensatz zu manch anderem reden wir nur selten von unserer Arbeit.“
Er konnte zwar nur die Augen von Jacoby sehen, doch er war sicher, unter der Maske kräuselten sich seine Lippen zu einem mühsamen Lächeln.
„Ich verstehe, das ging gegen mich“, erwiderte er. „Und Sie haben recht, ich gebe es zu. Wir Künstler sprechen gern und viel von unserer Tätigkeit. Vermutlich, weil wir sie mit Leidenschaft ausüben.“
„Das wird der Unterschied sein“, stimmte Andresen dem Künstler zu. „Ich kann nicht behaupten, dass mich eine Art von Leidenschaft packt, wenn wir zu einem Tatort gerufen werden, an dem ein Mensch auf brutale Weise sein Leben verloren hat. Das wäre reichlich pietätlos, finden Sie nicht auch?“
Lutz Weichert gesellte sich zu ihnen und ergriff das Wort. Offenbar hatte er Andresens Antwort mitbekommen.
„Da hat mein Kollege absolut recht“, stimmte er ihm zu. „Was wir jedoch entwickeln, wenn es darum geht, einen Verbrecher seiner gerechten Strafe zuzuführen, ist eine gesunde Portion Ehrgeiz.“
Ehe Jacoby darauf eingehen konnte, erklang Verenas Stimme durch das Mikrofon und läutete damit das Ende der Pause ein. Der Künstler und sein Gefolge verabschiedeten sich eilig.
Andresen hielt Weichert am Arm zurück. „Gut gesprochen, Herr Kollege“, sagte er. „Wie üblich ein wenig zu schwülstig für meinen Geschmack, aber treffend.“
„Zu viel der Ehre.“ Weichert grinste unter seiner Maske. „Ich muss wieder rüber“, fügte er hinzu, nickte Daniela zu und kehrte zu seinem Tisch zurück.
Vor dort warf der Künstler Carsten Andresen einen kühlen Blick zu, den dieser ebenso frostig erwiderte. „Ich kann den Kerl nicht ausstehen“, flüsterte er in Danielas Richtung.
„Ach tatsächlich?“ Ihr Tonfall klang schnippisch. „Ist mir gar nicht aufgefallen.“
„Sag bloß, du findest den nett.“
„Schsch! Ich will zuhören.“ Sie legte einen Zeigefinger auf ihre gespitzten Lippen.
Andresen nippte an seinem Bier. Der einzige Gedanke, der ihn aufheiterte, war, dass er den arroganten Bilderkleckser nach diesem Abend vermutlich nie mehr wiedersehen würde.
KAPITEL 2
Schwungvoll schlug Oliver Fröhlich die Autotür zu und schloss den BMW ab. Kühler Ostwind spuckte ihm Nieseltropfen ins Gesicht. Es war November und das Wetter entsprechend. Mit hochgezogenen Schultern strebte er dem Bürogebäude zu.
Der zweigeschossige, modern gestaltete Bau mit den vielen Giebeln war Mitte der Neunzigerjahre entstanden. Der Eingangsbereich bestach mit dunkelgrünen Rahmen, farblich passenden Schriftzügen und viel Glas.
Mit energischen Schritten trat er auf den Empfangstresen zu, den seit etwa eineinhalb Jahren eine Plexiglasscheibe zierte. Eine Corona-Schutzmaßnahme. Bis vor Kurzem hatten sie innerhalb der Kanzlei zusätzlich einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Zu Olivers Erleichterung war diese Anordnung inzwischen hinfällig, da sämtliche Angestellten geimpft waren.
Hinter dem Plexiglas saß wie in einem Terrarium Frau Herzog. Deren blonde, mit viel Haarspray fixierte Hochsteckfrisur machte die Empfangssekretärin älter, als sie eigentlich war. Die Gleitsichtbrille auf der spitzen Nase unterstrich das Gouvernantenhafte, das sie ausstrahlte, und wie immer schien Monika Herzog auch jetzt äußerst beschäftigt. Im Augenblick füllte sie mit ihrer engen, schräggestellten Handschrift einen Telefonzettel aus. Name des Anrufers, Aktenzeichen des Vorgangs, Datum und Uhrzeit waren bereits vermerkt, wie Oliver mit einem raschen Blick konstatierte. Nun gab Frau Herzog auf den darunter liegenden Zeilen an, was genau der Anrufer gewollt hatte. Das konnte dauern. Oliver beschloss daher, sie zu unterbrechen, und räusperte sich vernehmlich.
Die Herzogin, wie einige Kollegen sie nannten, hob den Kopf und schob ihre Brille höher den Nasenrücken hinauf. Ihr hellrot bemalter Mund mit den schmalen Lippen blieb unbewegt. Oliver vermutete bereits seit Langem, dass die Herzogin zum Lachen in den Keller ging. Oder sie verbot sich jede fröhliche Anwandlung, um keine Falten zu bekommen.
„Hallo, Frau Herzog“, begann er.
Sie nickte knapp. „Herr Fröhlich.“
Warum der Chef ausgerechnet diese humorlose Ziege am Empfang beschäftigte, war Oliver ein Rätsel. Wenn er hier das Sagen hätte, würde er dafür sorgen, dass eine Mitarbeiterin die Mandanten begrüßte, die Wärme und Freundlichkeit ausstrahlte und nicht den Charme einer Flasche Essig.
„Gab es irgendwas Wichtiges?“, fragte Oliver.
„Ein paar Anrufe. Ich habe sie zu Frau Lechner durchgestellt.“
„Danke.“ Oliver nickte und wollte sich schon abwenden, als Frau Herzog mit kaum verborgener Süffisanz hinzufügte: „Ach ja, und Dr. Hoffmann möchte Sie sprechen.“
Oliver hielt inne. „Er ist da?“
„In seinem Büro.“
„Hat er gesagt, was er will?“
„Tut mir leid, nein.“
„Gut, danke.“
Langsam machte er sich auf den Weg in sein Büro. Vorbei am Wartezimmer, in dem ein einzelner Herr auf einem Stuhl am Fenster saß, einen zusammengerollten Schnellhefter in den Händen. Mit leerem Blick starrte der Mann aus dem Fenster.
Oliver ging weiter. Vorbei an dem leeren Besprechungsraum I, der bis zu acht Personen Platz bot. Besprechungsraum II im Obergeschoss war fast doppelt so groß, weshalb er gern für kleine interne Feiern der Kanzlei genutzt wurde. Zuletzt war das vor Corona der Fall gewesen. Vielleicht, dachte Oliver, gibt es dieses Jahr endlich wieder ein gemütliches Weihnachtsfrühstück. Aber er rechnete nicht wirklich damit.
Frau Lechner saß an ihrem Schreibtisch und hämmerte mit flinken Fingern auf ihre Tastatur ein.
„Guten Morgen, Frau Lechner.“
Sie sah auf. „Guten Morgen. Einen Kaffee?“
„Gern.“ Er lächelte ihr knapp zu und verschwand in seinem Büro.
Nachdenklich ließ er sich in seinen Bürosessel fallen und schaute aus dem Fenster, das zum Parkplatz hinausging. Was, grübelte er, wollte der Alte wohl von ihm?
Dr. Hans-Jürgen Hoffmann war derjenige, der die Kanzlei Dr. Hoffmann, Schmitt & Vogel vor über dreißig Jahren gegründet hatte. Ein Teil von ihm steckte noch immer tief im vorigen Jahrhundert, doch beruflich war der Alte stets auf dem Laufenden, das musste man ihm lassen. Noch immer genoss er vor Gericht und bei vielen Kollegen hohes Ansehen und größten Respekt. Doch er wurde alt und zog sich mehr und mehr aus dem Geschäft zurück. Inzwischen war er Ende siebzig und gesundheitlich angeschlagen. Öfter als zweimal wöchentlich schaute er nur selten vorbei. Und dass er freitags auftauchte, war äußerst ungewöhnlich.
Frau Lechner kam herein und stellte mit einem kurzen „Ihr Kaffee“ einen dampfenden Becher vor Oliver ab.
„Danke“, sagte er und fügte hinzu: „Dr. Hoffmann hat nach mir gefragt?“
Sie stutzte. „Ach, Sie wissen es schon? Ich wollte Ihnen gerade ausrichten, dass er Sie in seinem Büro erwartet.“
„Die Herzogin hat es mir gesagt. Sie können sich vorstellen, in welchem Tonfall.“
„So schlimm wird es sicher nicht werden.“ Sie lächelte ihm ermutigend zu und schloss wenig später die Tür hinter sich.
Oliver warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Jetzt war es Viertel nach elf. Wenn Hoffmann vormittags im Haus war, ging er meist gegen zwölf nach Hause. Oliver beschloss, die Audienz beim Alten gleich nach dem Kaffee hinter sich zu bringen.
An dem Becher nippend ging er die eingegangenen Anrufe durch. Nichts Wichtiges, stellte er beruhigt fest. Eine Mandantin bat um Rückruf, Rechtsanwalt Schaller, Vertreter der Gegenpartei in einem Nachbarschaftsstreit, hatte einen Besprechungstermin bestätigt, und ein Mandant wollte später noch einmal anrufen, um über die Behauptungen im Schriftsatz der gegnerischen Anwälte zu reden. Oliver rollte mit den Augen. Diese Sache kostete mehr Zeit und Nerven als zehn andere zusammen.
Er schob die Zettel zur Seite, schaute Kaffee schlürfend aus dem Fenster und grübelte darüber nach, was der Alte von ihm wollte.
Dr. Hoffmann stand neben dem Schreibtisch von Frau Gerlach, die für ihn und für den anderen Seniorpartner, Robert Schmitt, das Sekretariat erledigte, und besprach etwas mit ihr, als Oliver nähertrat. Sein Chef sah auf, bemerkte ihn und lächelte breit. „Ah, Herr Kollege Fröhlich“, begrüßte er ihn. „Zurück vom Arbeitsgericht? Wie ist es gelaufen?“
Die offensichtliche gute Laune des Alten beruhigte Oliver. „Sehr gut“, sagte er. „Die Klage der Gegenseite wurde abgewiesen.“
Dr. Hoffmann holte angestrengt Luft. Er litt unter Asthma, das war in der Kanzlei bekannt. Außerdem wurde er wegen Arthrose, Bluthochdruck und Diabetes behandelt. Wenn ich so krank wäre, dachte Oliver nicht zum ersten Mal, würde ich mich in den Ruhestand verabschieden, damit ich noch was habe vom Rest meines Lebens.
„Was meinen Sie?“, erkundigte sich der Alte, „werden Balke und Schröder Berufung einlegen?“
Oliver schüttelte den Kopf. „Ich denke nicht. Zumindest hat der Kollege Schröder den Eindruck erweckt, als hätte ihn jeder Kampfgeist verlassen. Kein Wunder, nach den neuesten Erkenntnissen liegen die Erfolgsaussichten seines Mandanten praktisch bei null.“
„Wunderbar.“ Dr. Hoffmann nickte zufrieden. „Kommen Sie herein, wir haben etwas zu besprechen.“
Alle Anwaltsbüros der Kanzlei waren modern und stylisch eingerichtet. Edles Holz, Designer-Schreibtische, viel Glas, dezente Grünpflanzen und geschmackvolle Kunstdrucke an den Wänden. Die Tür zum Büro des Alten jedoch war wie ein Wurmloch, das einen in die späten Achtzigerjahre katapultierte. Dunkelgrüne, altmodisch gemusterte Auslegeware, Möbel aus dunklem Eichenholz, Gardinen am Fenster, und an den Wänden hingen Trophäen von Jagdausflügen. Dr. Hoffmann war ein passionierter Jäger. Auf einem Foto stand er neben einem erlegten Hirsch, einen Fuß auf dem toten, massigen Körper. Das Bild war für Oliver das Schlimmste in diesem Sammelsurium der Geschmacklosigkeiten. Ein modernes Telefon und der Computer-Flatscreen wirkten hier wie futuristische Fremdkörper.
„Setzen Sie sich“, bat Dr. Hoffmann jovial und ließ sich selbst hinter seinem wuchtigen Schreibtisch auf einem Ledersessel nieder, der protestierend schnaufte. Oliver nahm auf einem der beiden Besucherstühle Platz. Hohe Rückenlehne, Brokatpolsterung, ebenfalls in Grün. Wo hatte der Chef diese Relikte bloß her? Aus dem Keller seiner Eltern?
„Das war kein einfacher Fall“, sagte Dr. Hoffmann und holte tief Luft.
„Stimmt. Ich habe mich gewundert, dass Sie ihn mir gegeben haben und nicht Rechtsanwalt Vogel.“
Der jüngste Seniorpartner, immerhin bereits Ende fünfzig, war Fachanwalt für Arbeitsrecht. Oliver dagegen bearbeitete hauptsächlich Zivilrecht. Doch heute war er als Vertreter einer großen Flensburger Baufirma aufgetreten, die von einem ehemaligen Angestellten verklagt worden war.
„Um ehrlich zu sein, habe ich Sie gebeten, die Sache zu übernehmen, um zu sehen, wie Sie sich schlagen“, sagte Dr. Hoffmann und ließ Oliver dabei nicht aus den Augen.
Der runzelte die Stirn. „Sie meinen, Sie haben mich einer Art Test unterzogen?“
Er gab sich keine Mühe, seine Verärgerung zu verbergen. Oliver war lange genug im Job und in der Kanzlei. Er hatte längst bewiesen, dass er ein verdammt guter Anwalt war. Daher erschien es ihm unangemessen, noch immer wie ein Anfänger behandelt zu werden.
Dr. Hoffmann lehnte sich zurück und legte seine Fingerkuppen gegeneinander, sodass seine Hände ein schmales Zelt bildeten. „Keinem simplen Test, lieber Kollege, nein. Schließlich erwarten unsere Mandanten von uns allerhöchste Professionalität. Ich hätte Ihnen den Fall nicht zugeteilt, wenn ich Sie nicht für fähig gehalten hätte, das Bestmögliche für unseren Mandanten herauszuholen. Um ehrlich zu sein, hatte ich damit gerechnet, dass es bei der Verhandlung doch noch auf einen Vergleich hinausläuft.“
Er machte eine kurze Pause, um Luft zu holen. Dann verzog sich sein Mund zu einem Lächeln. Seine blaugrauen Augen ruhten auf Oliver, der sich unter diesem Blick vorkam wie ein Insekt unter dem Mikroskop. „Stattdessen haben Sie einen wichtigen Zeugen aufgetrieben, den Fall dank dessen Aussage gewonnen und mich so endgültig davon überzeugt, dass Sie der Richtige sind. Wie sagt man so schön? Das Glück des Lebens besteht nicht darin, wenig oder keine Schwierigkeiten zu haben, sondern sie alle siegreich und glorreich zu überwinden.“
Oliver presste die Lippen aufeinander. Der Alte und seine klugen Sprüche! Er hatte für jede Gelegenheit einen auf Lager. Inzwischen hatte Oliver gelernt, sie zu überhören und sich auf den Teil von Dr. Hoffmanns Monolog zu fokussieren, der für ihn wesentlich war. „Der Richtige? Wofür?“, hakte er nach.
Sein Chef antwortete nicht sofort. Er liebte es, sein Gegenüber zappeln zu lassen, das wusste Oliver. Also gab er sich so gelassen wie möglich, um sich seine Neugier und seine Ungeduld nicht anmerken zu lassen.
Der Alte ließ ihn nicht aus den Augen. „Der richtige Kandidat für eine Partnerschaft.“
Olivers Puls beschleunigte sich. Er sollte Partner werden?
Sein Name würde im Firmenlogo auftauchen, er würde ein größeres Büro bekommen und natürlich auch mehr Gehalt. Für all das hatte er in den letzten Jahren viel und hart gearbeitet. Doch hatte er nicht damit gerechnet, so bald schon die Früchte dieser Arbeit zu ernten. Nach all dem Frust in der letzten Zeit war dies endlich einmal eine gute Nachricht.
„Das … das wäre fantastisch“, brachte er hervor. „Danke, Dr. Hoffmann.“
Der Alte erhob sich mühsam. Sofort stand auch Oliver auf. Sein Chef hob warnend den linken Zeigefinger. „Sie sollten sich jetzt keinesfalls auf diesen Lorbeeren ausruhen, Herr Kollege. Die Ernennung tritt erst Anfang des nächsten Jahres in Kraft. Falls Sie sich bis dahin etwas zuschulden kommen lassen … Es gibt durchaus andere Kollegen, die ähnlich ehrgeizig und fleißig sind wie Sie.“
„Das ist mir bewusst“, sagte Oliver ernst. „Machen Sie sich keine Gedanken, an der Qualität meiner Arbeit wird sich selbstverständlich nichts ändern.“
Dr. Hoffmann brachte ihn zur Tür. „Davon bin ich überzeugt. Allerdings …“ Er blieb stehen und schaute Oliver prüfend an. „Es gibt da noch etwas, das mir Sorgen bereitet. Ich hörte kürzlich von Ihrer … Wohnsituation.“
Oliver war perplex, damit hatte er nicht gerechnet. „Meine Wohnsituation?“, wiederholte er.
„Ja. Es geht das Gerücht, Sie würden neuerdings in einer Art … Kommune leben.“
Die zögerliche Art, mit der sein Chef Worte wie ,Wohnsituation‘ und ,Kommune‘ aussprach, machten Oliver deutlich, dass jegliche alternative Lebensformen ihm suspekt waren. Jäh wurde ihm klar, dass dieses Thema neben der Beförderung der eigentliche Grund für ihre Unterredung war. Dass Dr. Hoffmann es nun wie nebenbei im Rahmen des Abschieds zur Sprache brachte, war ebenso typisch für den Alten wie seine Lebensweisheiten. Oliver kannte ihn inzwischen gut genug, um derlei Finten zu durchschauen.
„Es handelt sich keinesfalls um eine Kommune, Herr Dr. Hoffmann“, sagte er und bemühte sich, in ruhigem Tonfall zu sprechen, obwohl es in ihm brodelte. „Meine drei Freunde und ich haben vor einigen Monaten beschlossen, gemeinsam in meinem Haus zu leben. Für mich allein ist es zu groß, seit meine Kinder aus dem Haus sind und meine Frau und ich getrennt leben.“
„Aha, hm“, machte Dr. Hoffmann. „Also vier Männer unter einem Dach?“
„Genau. Meine Freunde sind ebenfalls alleinstehend.“
„Ach! Das ist ungewöhnlich. Darf man fragen, wie es dazu gekommen ist?“
Oliver hob die Achseln. „Wie das eben heute so ist. Der eine ist geschieden, der andere verwitwet und der Dritte ein Junggeselle, der nichts von der Ehe hält.“
„Ich hörte aber auch von einer Frau, die bei Ihnen ans Telefon geht und …“
„Das ist unsere Haushälterin“, sagte Oliver schnell. „Wir sind beruflich stark eingespannt und in Sachen Haushalt nicht sehr versiert. Frau Engelkamp macht deshalb sauber, kümmert sich um die Wäsche, das Einkaufen und Kochen. Aber sie lebt nicht im Haus.“
„Ich verstehe.“ Der Alte machte eine halbe Drehung von der Tür weg, trat an das bodentiefe Fenster und schaute durch den dünnen Gardinenstoff nach draußen. Ein Sonnenstrahl, der sich durch die graue Wolkendecke gekämpft hatte, machte den tanzenden Staub im Zimmer sichtbar, der sich in dieser spießigen Umgebung sehr wohlzufühlen schien.
Oliver schaute an seinem Chef vorbei ebenfalls hinaus. Die Kanzlei hatte ihren Sitz am Rande von Flensburg, sodass man von hier aus ins Grüne und auf ein Biotop blicken konnte, an dessen Rändern Schilf wuchs. Im Sommer sah man dort hin und wieder Reiher, die auf ihren langen Beinen im Wasser herumstaksten. Jetzt, im Herbst, wirkte das kleine Gewässer trostlos.