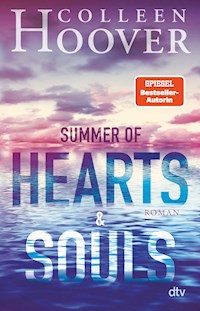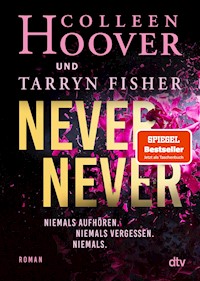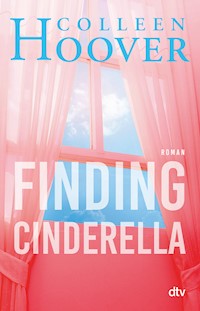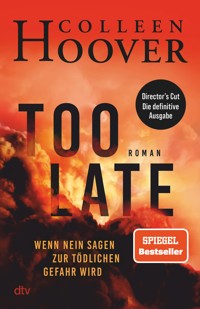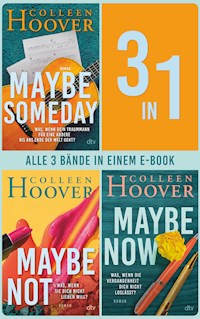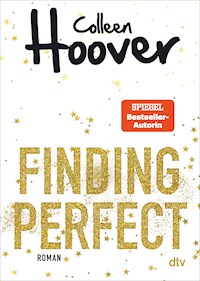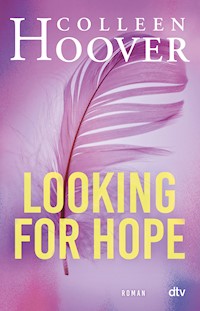
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Sky & Dean-Reihe
- Sprache: Deutsch
Die hoch emotionale und tiefgründige Liebesgeschichte aus Deans Perspektive Was, wenn der einzige Weg zum Glück über deine dunkle Vergangenheit führt? Ein Roman mit ungeheurer emotionaler Wucht – Die Liebesgeschichte von Sky und Dean geht in die zweite Runde. Dean Holder vermeidet es seit dem Tod seiner Schwester, auf die Vergangenheit zurückzublicken, und arbeitet stattdessen lieber kräftig an seinem Image als Bad Boy. Bis er Sky trifft, die seine Welt von einem Moment auf den anderen aus den Angeln hebt. Denn sie erinnert Dean an seine verschwundene Kindheitsfreundin Hope, nach der er seit Jahren vergeblich sucht. In Skys Gegenwart brechen Gefühle auf, die Dean längst verloren glaubte – doch immer mehr wird klar: Um in die Zukunft blicken zu können, muss Dean sich den Geistern seiner Vergangenheit ebenso stellen wie Sky ... Der Roman kann auch unabhängig von ›Hope Forever‹ gelesen werden. »Colleen Hoover überzeugt jedes Mal aufs Neue.« Publishers Weekly »Colleen Hoover schreibt die Art von Büchern, über die noch lange gesprochen wird.« USA Today
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2015
Sammlungen
Ähnliche
Colleen Hoover
Looking for Hope
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Katarina Ganslandt
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Dieses Buch widme ich meinem Mann und meinen Söhnen.
Ich danke euch für eure grenzenlose Unterstützung.
EINS
Eigentlich müsste mein hämmernder Puls das Signal sein, mich sofort umzudrehen und zu gehen. Les hat mir oft genug gesagt, dass ich mich raushalten soll. Andererseits ist sie noch nie Bruder gewesen und hat keine Ahnung, wie hart es ist, in so einer Situation wegzuschauen. Verdammt, dieser Typ ist so ein unglaubliches Arschloch, das kann ich einfach nicht ignorieren.
Ich stehe hinter der Couch, starre auf ihn hinunter und schiebe sicherheitshalber die Hände in die Taschen meiner Jeans. Hoffentlich schaffe ich es, sie dortzubehalten. Wie lang es wohl dauert, bis er mich bemerkt? Dieser Widerling ist so damit beschäftigt, das Mädchen auf seinem Schoß zu befummeln, dass er nichts anderes wahrnimmt. Tatsächlich stehe ich mehrere Minuten so da, ohne dass er mitbekommt, dass ich kurz vor der Explosion bin. Am liebsten würde ich ja ein kleines Beweisvideo drehen, aber das kann ich Les nicht antun. Das wäre sadistisch.
Irgendwann halte ich es nicht mehr aus. Wenn ich auch nur noch eine Sekunde länger zusehen muss, wie er die Brust dieses Mädchens betatscht, ohne dabei einen Gedanken an seine Freundin – meine Schwester – zu verschwenden, besteht ernsthaft die Gefahr, dass ich ihm den verdammten Arm auskugele.
»Hey«, sage ich laut.
Er nimmt seine Zunge aus ihrem Hals, legt den Kopf in den Nacken und sieht mit glasigen Augen zu mir auf. Als ihm dämmert, wer da hinter ihm steht, schiebt er seine Gespielin hektisch von seinem Schoß.
»Holder …« Grayson steht mühsam auf, schwankt aber so, dass er sich kaum auf den Beinen halten kann. Er sieht mich flehend an und zeigt auf das Mädchen, das hastig versucht, ihren quasi nicht vorhandenen Minirock über die Schenkel zu zerren. »Das, äh … ist nicht so, wie du denkst …«
Ich verschränke die Arme, um mich daran zu hindern, ihm eine reinzuschlagen. Bei dem Gedanken daran, wie gut sich das anfühlen würde, balle ich unwillkürlich die Fäuste.
Aber statt ihn zu schlagen, hole ich tief Luft. Einmal, zweimal und dann – einfach nur, weil ich es genieße, wie er sich windet – noch ein drittes Mal. Danach schüttle ich den Kopf, sehe ihn an und sage kalt: »Gib mir dein Handy.«
Sein verwirrter Gesichtsausdruck würde mich glatt zum Lachen bringen, wenn ich nicht so scheißwütend wäre. Grayson grinst unsicher und tritt einen Schritt zurück, wobei er gegen den Couchtisch stößt und fast umkippt. Er kann sich gerade noch mit einer Hand abfangen und richtet sich wankend wieder auf. »Nimm doch dein eigenes«, murmelt er und schiebt sich am Tisch vorbei, ohne mich anzusehen. Ich gehe seelenruhig um die Couch herum und stelle mich ihm mit ausgestreckter Hand in den Weg.
»Dein Handy, Grayson. Sofort.«
Kräftemäßig sind wir uns wahrscheinlich ebenbürtig, aber was die Körpergröße angeht, bin ich ihm eindeutig unterlegen. Wobei ich diesen Nachteil vermutlich durch das Adrenalin wettmache, das der blanke Hass durch meine Adern pumpt. Grayson schätzt das anscheinend richtig ein. Er versucht mir auszuweichen und geht ein paar Schritte rückwärts, was taktisch nicht besonders klug ist, weil er sich dadurch genau in die Ecke des Wohnzimmers manövriert. Als ihm klar wird, dass er in der Falle sitzt, gibt er auf.
»Okay, okay.« Er zieht sein Handy heraus und hält es mir hin. »Hier hast du’s, Mann. Was willst du damit?«
Ich greife danach, scrolle durch die Kontakte, bis Les’ Name angezeigt wird, und gebe es ihm zurück.
»Ruf sie an. Sag ihr, was für ein elendes Arschloch du bist und dass sie viel zu gut für dich ist, weshalb ihr euch leider trennen müsst.«
Grayson schaut auf sein Handy hinunter und dann wieder zu mir. »Leck mich.«
Ich atme ein paarmal tief durch und lasse den Kopf im Nacken kreisen, bis der Wirbel knackst. Als das nichts gegen mein überwältigendes Bedürfnis hilft, ihm wehzutun, packe ich ihn am Kragen seines hässlichen roten T-Shirts und drücke ihn mit dem Unterarm gegen die Wand. Ich darf ihn auf keinen Fall schlagen, bevor er diesen Anruf gemacht hat, sonst habe ich mich in den letzten zehn Minuten völlig umsonst zurückgehalten.
Das Blut rauscht in meinen Ohren. Ich glaube, ich habe noch nie einen Menschen so sehr gehasst wie diesen Typen. Mein Verlangen, ihn das spüren zu lassen, ist so groß, dass es mir sogar selbst Angst macht.
Ich sehe ihm in die Augen und lasse ihn wissen, wie ernst es mir ist. »Grayson«, stoße ich zwischen zusammengepressten Zähnen hervor, »wenn du nicht willst, dass ich das mit dir mache, was ich jetzt gern mit dir machen würde, empfehle ich dir, meine Schwester anzurufen und die Sache ein für alle Mal zu beenden. Danach legst du auf und lässt sie für den Rest deines Lebens in Ruhe.« Ich drücke den Unterarm fester gegen seinen Hals und bemerke, dass sein Gesicht aufgrund des Sauerstoffmangels inzwischen fast röter leuchtet als sein Shirt.
»Ist ja schon gut, Mann. Ich mach’s«, röchelt er.
Ich warte, bis er auf Anrufen geklickt hat und sich das Handy ans Ohr hält, bevor ich den Arm sinken lasse. Wir lassen uns gegenseitig nicht aus den Augen, während wir darauf warten, dass Les sich meldet.
Ich weiß, wie hart sie das treffen wird, aber sie hat keine Ahnung, was dieser Typ hinter ihrem Rücken treibt. Ganz egal, wie viele Leute es ihr erzählen, sie weigert sich, es zu glauben. Bis jetzt ist es ihm immer wieder gelungen, sich mit irgendwelchen faulen Ausreden aus der Affäre zu ziehen.
Aber diesmal schafft er das nicht. Nicht wenn ich es verhindern kann. Ich werde nicht zulassen, dass er meine Schwester weiter so verarscht.
»Hey«, sagt er ins Handy und versucht, sich wegzudrehen, aber ich drücke seine Schultern wieder gegen die Wand. Er verzieht das Gesicht.
»Was? Äh … nein, Babe.« Seine Stimme klingt nervös. »Ich bin dann doch noch zu Jaxon auf die Party gegangen.« Er lauscht in den Hörer. »Ja, ich weiß, dass ich das gesagt habe, aber das war … gelogen. Deswegen rufe ich auch an. Les, ich … ich glaube, wir brauchen eine Auszeit.«
Ich schüttle den Kopf, um ihm klarzumachen, dass er einen endgültigen Schlussstrich ziehen soll. Eine Auszeit reicht mir nicht. Ich will, dass er Les freigibt.
Grayson verdreht die Augen und zeigt mir den Mittelfinger. »Hör zu, ich … ich mach Schluss. Das mit uns beiden ist vorbei«, sagt er und schweigt dann, während sie spricht. Sein Gesicht lässt keinerlei Regung erkennen, was nur beweist, was für ein gefühlloser Kotzbrocken er ist. Meine Hände zittern, und mir wird schlecht, weil ich mir ganz genau vorstellen kann, wie Les sich jetzt fühlt. Ich hasse mich dafür, dass ich ihr das antun muss, aber Les hat einen besseren Mann verdient, auch wenn sie das im Moment noch nicht so sehen kann.
»Ich lege jetzt auf«, sagt Grayson ins Handy.
Ich drücke ihn wieder gegen die Wand und zwinge ihn, mich anzusehen. »Du entschuldigst dich bei ihr«, zische ich leise, weil ich nicht will, dass Les mich hört. Er schließt die Augen und seufzt, dann duckt er sich, um sich aus meinem Griff zu winden.
»Tut mir leid, Leslie. Glaub mir, ich hab das so nicht gewollt.« Er nimmt das Telefon vom Ohr und drückt sie weg. Nachdem er einen Moment lang aufs Display gestarrt hat, hebt er den Kopf und sieht mich an.
»Ich hoffe, du bist zufrieden«, knurrt er. »Du hast deiner Schwester nämlich gerade das Herz gebrochen.«
Das ist das Letzte, was Grayson zu mir sagt. Meine Faust trifft ihn am Kiefer und er sackt zu Boden. Ich schüttle meine schmerzende Hand, drehe mich um und dränge mich durch das Partygewühl zur Tür. Noch bevor ich beim Wagen bin, vibriert in der Hosentasche mein Handy. Ich ziehe es heraus und melde mich, ohne einen Blick darauf zu werfen. Ich weiß, wer dran ist.
»Hey«, sage ich und hoffe, sie kriegt nicht mit, dass meine Stimme vor Wut zittert. Aber da höre ich sie am anderen Ende schon schluchzen. »Ich bin auf dem Weg, Les. Nicht weinen, okay? Ich bin gleich bei dir.«
Es ist jetzt fast zwanzig Stunden her, dass Grayson Leslie angerufen hat, und mittlerweile wünsche ich mir fast, ich hätte ihn nie dazu gezwungen. Um mich selbst zu bestrafen, verlängere ich meine abendliche Laufrunde um fünf zusätzliche Kilometer. Natürlich hatte ich damit gerechnet, dass sie traurig sein würde. Aber dass es sie so tief trifft, war mir nicht klar gewesen. Inzwischen weiß ich, dass das Ganze wahrscheinlich nicht die beste Idee war, die ich in meinem Leben je hatte – zumindest die Methode war vermutlich nicht ideal. Andererseits hätte ich es niemals geschafft, untätig zuzuschauen, wie dieses Arschloch sie wieder mal vor aller Augen betrügt.
Merkwürdigerweise erstreckt sich Les’ Wut nicht nur auf Grayson, sondern auf sämtliche Männer dieser Welt. Als ich gestern Abend nach Hause kam, um sie zu trösten, lief sie schluchzend in ihrem Zimmer auf und ab und brüllte immer wieder, was für kranke, perverse Schweine wir alle wären. Ich konnte nichts anderes tun, als dasitzen und zusehen. Irgendwann brach sie neben mir auf dem Bett zusammen und weinte sich in den Schlaf, während ich ihr über die Haare strich. Ich bin die ganze Nacht bei ihr geblieben und habe kein Auge zugemacht, weil ich mich so schuldig fühlte – und auch, um sicherzustellen, dass sie Grayson nicht anruft und ihn anfleht, sie zurückzunehmen. Das wäre ihr durchaus zuzutrauen.
Aber meine Schwester ist anscheinend stärker, als ich gedacht hätte. Auch heute tagsüber hat sie nicht versucht, ihn anzurufen, obwohl ich ihr angesehen habe, wie unglücklich sie war. Am Mittag hat sie sich dann noch mal hingelegt, um ein bisschen zu schlafen und alles zu vergessen. Ich bin immer wieder an ihrem Zimmer vorbeigeschlichen, um sicherzugehen, dass sie nicht doch noch schwach wird und Grayson anruft, aber es war kein Ton zu hören. Ich bin froh, dass sie anscheinend wenigstens schlafen kann. Wenn sie nachher aufwacht, wird der Schmerz vielleicht schon ein bisschen erträglicher sein. Ja, die Aktion war hart, und es tut mir leid, dass ich ihr das antun musste. Trotz allem bin ich davon überzeugt, dass es die beste Lösung war. Allein an der Art, wie dieser Typ mit ihr Schluss gemacht hat, muss sie erkannt haben, was für ein herzloser Arsch er ist.
Nach dem Laufen gehe ich in die Küche, um ein großes Glas Wasser zu trinken. Eigentlich war ich heute mit Daniel verabredet, aber ich habe ihm schon geschrieben, dass er ohne mich losziehen muss. Les hat mich gebeten, bei ihr zu bleiben, weil sie auf keinen Fall das Haus verlassen und Grayson irgendwo über den Weg laufen will. Sie hat echt Glück, dass sie so cool ist. Ich weiß nicht, wie viele andere siebzehnjährige Typen bereit wären, an einem Samstagabend mit ihrer Schwester romantische Komödien zu schauen. Andererseits kenne ich auch keine anderen Geschwister, die sich so gut verstehen wie wir. Ich weiß nicht, ob das nur damit zu tun hat, dass wir Zwillinge sind. Weil wir sonst keine Geschwister haben, fehlt mir der Vergleich. Les würde vielleicht sagen, dass ich mich manchmal ein bisschen zu sehr als ihr Beschützer aufspiele, womit sie wahrscheinlich sogar recht hat. Was aber nicht heißt, dass ich vorhätte, diese Rolle in naher Zukunft – oder überhaupt jemals – abzulegen.
Noch auf der Treppe ziehe ich mein verschwitztes T-Shirt aus und drücke, oben angekommen, die Tür zum Badezimmer auf. Während ich das Wasser warm laufen lasse, klopfe ich an die Tür zu Les’ Zimmer gegenüber.
»Ich dusche noch schnell. Bestellst du schon mal die Pizza?«
Mit einer Hand am Türrahmen abgestützt, ziehe ich meine Socken aus, drehe mich halb um und werfe sie ins Bad. Dann klopfe ich noch einmal. »Les!«
Keine Reaktion. Plötzlich keimt ein Verdacht in mir. Hat sie mit Grayson telefoniert, während ich unterwegs war? Dann hat er ihr nämlich garantiert erzählt, dass ich ihn gezwungen habe, mit ihr Schluss zu machen.
Ich bereite mich innerlich darauf vor, mir einen weiteren wütenden Vortrag darüber anzuhören, dass ich mich gefälligst nicht in ihr Liebesleben einmischen soll, und öffne die Tür.
Les liegt auf dem Bett. Der Anblick katapultiert mich von einer Sekunde zur anderen zurück in meine Kindheit. Zurück zu dem einen Moment, der alles verändert hat. Mein Leben. Mich. Zurück zu dem Moment, in dem sich die Welt, die ich bis dahin als bunt und fröhlich erlebt hatte, mit einem Mal grau färbte. Der Himmel, das Gras, die Bäume … alles Schöne verlor seinen Glanz, als mir klar wurde, dass ich schuld daran war, dass unsere beste Freundin Hope entführt worden war.
Danach habe ich die Menschen und die Welt um mich herum nie mehr mit denselben Augen gesehen. Alles, was einmal Bedeutung und Sinn gehabt hatte, war belanglos geworden. Ich hatte kein Ziel mehr, keine Zukunft. Die Welt war zu einer grauen, leblosen Kopie des fröhlichen Abenteuerlands geworden, das sie vorher gewesen war.
Genau wie Les’ Augen.
Das sind nicht ihre Augen. Sie stehen offen. Sie sehen mich an.
Aber sie sehen mich nicht.
Die Farbe ist aus ihnen verschwunden. Das Mädchen, das da auf dem Bett liegt, ist nur noch eine graue, leblose Kopie meiner Schwester.
Meiner Les.
In mir ist alles wie erstarrt. Ich warte darauf, dass sie blinzelt und kichert, dass sie prustet und sich vor Lachen nicht mehr einkriegt, weil ihr kranker kleiner Streich tatsächlich funktioniert hat. Ich warte darauf, dass mein Herz wieder zu schlagen beginnt, dass meine Lungen sich mit Luft füllen. Warte darauf, dass ich die Kontrolle über meinen Körper zurückgewinne. Keine Ahnung, wer ihn jetzt gerade steuert. Ich ganz bestimmt nicht. Ich warte und warte und frage mich, wie lange sie diese Nummer wohl noch durchziehen kann. Wie lange können Menschen ihre Augen offen halten, ohne zu blinzeln? Wie lange können sie die Luft anhalten, bevor ihr Körper keuchend Sauerstoff einfordert?
Verdammt, wie lange bleibe ich hier noch stehen, bis ich mich endlich in Bewegung setze und etwas tue?
Ich stürze zu ihr. Fahre über ihr Gesicht, packe sie an den Armen, schüttle sie und ziehe sie auf meinen Schoß. Ein leeres Pillenfläschchen fällt aus ihrer schlaffen Hand und rollt über den Boden. Ihr Kopf, den ich kurz loslasse, kippt nach hinten, die Augen blicken starr zur Decke.
Les zuckt nicht zusammen, als ich ihren Namen brülle, und auch nicht, als ich sie ohrfeige. Sie reagiert nicht, als ich anfange zu schluchzen.
Sie tut nichts, verdammt.
Gar nichts.
Vor allen Dingen flüstert sie nicht, dass alles wieder gut wird, als jede einzelne Zelle von dem, was in meiner Brust übrig geblieben ist, von der Erkenntnis durchzuckt wird, dass der allerbeste Teil von mir … tot ist.
ZWEI
»Kannst du nach oben gehen und das pinkfarbene Oberteil und die schwarze Hose aus ihrem Schrank raussuchen?«, bittet mich meine Mutter tonlos, ohne den Blick von den Formularen zu nehmen, die sie gerade ausfüllt. Der Mann vom Beerdigungsinstitut, der ihr gegenübersitzt, deutet auf eine gepunktete Linie.
»Hier unten bitte. Es sind nur noch ein paar Seiten, Mrs Holder«, sagt er. »Gleich haben Sie es geschafft.«
Meine Mutter setzt mechanisch ihre Unterschrift auf das Blatt. Ich sehe ihr an, wie viel Mühe es sie kostet, Haltung zu bewahren. Sobald die fremden Menschen aus dem Haus sind, wird sie sich wieder in Tränen auflösen. Es sind jetzt achtundvierzig Stunden vergangen, seit ich Les gefunden habe. Nicht einmal annähernd genug Zeit, um sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass sie tot ist. Geschweige denn, ihn zu akzeptieren.
Man glaubt ja, ein Mensch könnte nur ein Mal sterben. Man glaubt, man könnte den leblosen Körper seiner Schwester nur ein Mal finden. Man glaubt, man müsste nur ein Mal erleben, wie für die eigene Mutter die Welt zusammenbricht, als sie erfährt, dass ihre einzige Tochter tot ist.
Aber wenn man das glaubt, dann irrt man sich.
Denn tatsächlich passiert es wieder und wieder und wieder.
Sobald ich meine Augen schließe, sehe ich Les’ Augen vor mir. Sobald meine Mutter mich ansieht, werde ich in den Moment zurückversetzt, in dem ich ihr sagen muss, dass ihre Tochter nicht mehr lebt. Zum zweiten Mal, zum dritten Mal … zum tausendsten Mal. Sobald ich Atem hole oder blinzle oder etwas sage, trifft es mich aufs Neue mit voller Wucht: Les ist tot. Ich frage mich nicht, wann die Erkenntnis, dass sie tot ist, jemals bei mir angekommen sein wird. Ich frage mich, wann ich aufhören werde, ihren Tod immer und immer wieder durchleben zu müssen.
»Holder? Die Leute vom Beerdigungsinstitut brauchen etwas, das sie ihr anziehen können«, dringt die Stimme meiner Mutter zu mir. »Bitte geh nach oben und schau nach, ob du das pinkfarbene Oberteil mit den langen Ärmeln findest. Das hat sie doch immer so gern angehabt.«
Meine Mutter weiß, dass ich Les’ Zimmer genauso wenig betreten möchte wie sie. Trotzdem schiebe ich den Stuhl zurück und stehe auf.
»Les ist tot«, murmle ich, während ich mich die Treppe hochschleppe. »Es ist ihr garantiert scheißegal, was sie anhat.«
Vor der Tür bleibe ich stehen. Ich weiß, dass ich in dem Moment, in dem ich sie öffne, noch einmal den Moment erleben werde, in dem ich Les tot auf dem Bett gefunden habe. Seitdem bin ich nicht mehr in ihrem Zimmer gewesen und hatte eigentlich auch nicht vor, jemals wieder einen Fuß hineinzusetzen.
Ich holte tief Luft, drücke die Klinke runter und gehe hinein. Nachdem ich die Tür hinter mir zugemacht habe, drehe ich mich zum Schrank und versuche, dabei so wenig zu denken wie möglich.
Pinkfarbenes Oberteil.
Denk nicht an sie.
Langärmlig.
Denk nicht daran, was du alles dafür geben würdest, wenn du die Zeit zum Samstagnachmittag zurückdrehen könntest.
Schwarze Hose.
Denk nicht daran, wie sehr du dich dafür hasst, nicht da gewesen zu sein, als sie dich gebraucht hat.
Aber ich tue es. Ich denke daran und sofort spüre ich wieder die Wut und den Schmerz. Blindlings greife ich in den Schrank, ziehe irgendwelche Shirts von den Bügeln und lasse sie zu Boden fallen. Mit beiden Händen klammere ich mich an der Schranktür fest und schließe die Augen, während ich auf das leise Quietschen der hin- und herschwingenden Bügel lausche. Ich versuche, mich auf meine Aufgabe zu konzentrieren. Darauf, dass ich gekommen bin, um zwei Sachen zu holen und wieder zu gehen. Aber ich kann mich nicht rühren. Ich kann nicht verhindern, dass ich in Gedanken wieder in das Zimmer trete und Les leblos auf dem Bett finde.
Mit geschlossenen Augen lasse ich mich langsam zu Boden sinken und bleibe so lange sitzen, bis mir klar wird, dass ich es hier keine Sekunde länger aushalte. Ich öffne die Augen und wühle in den am Boden liegenden Oberteilen, bis ich eines finde, das pink ist und lange Ärmel hat. Ich sehe zu den Hosen auf, die über mir an den Bügeln baumeln, und ziehe eine schwarze herunter. Als ich gerade aufstehen will, fällt mein Blick auf ein in Leder gebundenes Buch, das auf dem untersten Regalbrett liegt.
Ich greife danach und kauere mich wieder auf den Boden. Ich erinnere mich an dieses Buch. Unser Vater hat es Les vor ungefähr drei Jahren geschenkt, aber sie hatte keine Lust, Tagebuch zu schreiben, weil das genau das war, was ihr unser Therapeut empfohlen hatte. Les hat die Sitzungen bei ihm gehasst, und ich habe nie verstanden, warum Mom sie gedrängt hat, trotzdem weiter hinzugehen. Nach der Scheidung unserer Eltern haben wir beide eine Therapie begonnen, aber als wir auf die Highschool wechselten, überschnitten sich die Termine mit meinem Footballtraining. Mom hatte nichts dagegen, dass ich aufhörte, aber Les ging weiterhin einmal pro Woche hin. Bis sie vor zwei Tagen den Beweis dafür geliefert hat, dass die Behandlung ihr nicht sonderlich viel gebracht haben kann.
Als ich das Buch aufschlage und die leeren Seiten sehe, überrascht mich das nicht. Ich frage mich, ob vielleicht alles anders gekommen wäre, wenn sie auf den Therapeuten gehört und tatsächlich ihre Gedanken aufgeschrieben hätte. Ehrlich gesagt bezweifle ich es. Ich weiß nicht, was es gebraucht hätte, um Les vor sich selbst zu retten. Ein paar leere Blätter und ein Stift jedenfalls sicher nicht.
Ohne nachzudenken, ziehe ich den Kuli aus der Lederschlaufe, schlage die erste Seite auf und beginne einen Brief an sie. Ich kann nicht mal sagen, warum ich ihr schreibe. Ich weiß nicht, ob sie mich da, wo sie jetzt ist, sehen kann, oder ob es diesen Ort überhaupt gibt. Aber falls sie mich sieht, soll sie erfahren, was sie mir mit ihrem Abgang angetan hat. Erst Hope und dann auch noch Les. Hopeless. Jetzt fühle ich mich endgültig allein, unendlich schuldig und … im wahrsten Sinn des Wortes hoffnungslos.
ZWEIEINHALB
Hey Les,
deine Jeans liegt zerknäult vor dem Bett, als hättest du sie eben erst ausgezogen. Der Anblick hat was Bizarres. Ich meine, du wusstest doch, was du tun würdest. Hättest du sie nicht wenigstens in den Wäschekorb werfen können? Hast du keinen Gedanken daran verschwendet, dass irgendjemand sie aufheben muss, wenn du tot bist? Ich tue es jedenfalls garantiert nicht. Und deine heruntergefallenen Tops werde ich auch nicht wieder auf die Bügel zurückhängen.
Ich bin gerade in deinem Zimmer. Genauer gesagt sitze ich auf dem Boden vor deinem Kleiderschrank und schreibe diesen Brief in dein Tagebuch, das du nie benutzt hast. Wobei ich eigentlich gar nicht weiß, was ich dir sagen oder dich fragen soll. Die eine große Frage, die sich jetzt aufdrängt, ist natürlich: »Warum hast du es getan?« Aber die bekommst du von mir nicht zu hören.
Du kannst mir nicht antworten. Du bist tot.
Ich weiß nicht mal, ob es mich wirklich interessiert, warum du es getan hast. Ganz ehrlich – was war an deinem Leben so schlimm, dass du einen berechtigten Grund gehabt hättest, dich umzubringen?
Ach ja: Falls du es von da, wo du jetzt bist, noch nicht mitbekommen hast: Du hast Mom damit das Herz gebrochen.
Mir wird gerade klar, dass ich mir nie wirklich bewusst gemacht habe, was dieser Ausdruck bedeutet. Ich hab immer gedacht, es hätte uns das Herz gebrochen, als Hope damals entführt wurde. Mittlerweile weiß ich, dass das zwar eine schreckliche Tragödie war, aber der Schmerz, den wir damals empfunden haben, nichts ist im Vergleich zu dem, was Mom gerade durchmacht. Und zwar deinetwegen, Les. Dein Tod hat ihr so dermaßen das Herz gebrochen, dass es diesem Begriff eine ganz neue Bedeutung gibt. Eigentlich sollte er ab jetzt nur noch für die Gefühlslage einer Mutter, die ihr Kind verloren hat, verwendet werden dürfen. Es ist echt absurd, dass die Leute ständig gedankenlos sagen, dies und das würde ihnen »das Herz brechen«.
Verdammt, du fehlst mir so, Les. Es tut mir leid, dass ich dich alleingelassen habe. Es tut mir leid, dass ich nicht erkannt habe, was wirklich in dir vorging, wenn du gesagt hast, alles wäre okay.
Ach Scheiße, vielleicht muss ich es dich ja doch fragen …
Okay, Les: Warum? Warum hast du es getan?
H.
ZWEIDREIVIERTEL
Gratuliere, Les,
du bist echt wahnsinnig beliebt. Es sind so viele Leute zu deiner Trauerfeier gekommen, dass nicht nur der Parkplatz des Bestattungsinstituts komplett belegt war, sondern auch noch die der beiden Kirchen in der Nachbarschaft. Es war echt ein Massenauflauf.
Während der Feier hab ich es geschafft, einigermaßen die Fassung zu bewahren. Hauptsächlich Mom zuliebe. Dad sah auch extrem mitgenommen aus. Die Atmosphäre war übrigens total merkwürdig. Ich hab mich die ganze Zeit gefragt, ob die Leute sich uns gegenüber wohl anders verhalten würden, wenn du »normal« gestorben wärst, also zum Beispiel bei einem Autounfall, statt dich umzubringen (auch wenn Mom lieber von einer bewussten Überdosis spricht). Es kam mir beinahe so vor, als hätten die Leute Angst vor uns. Als würden sie denken, Selbstmord wäre ansteckend. Alle haben uns angestarrt und flüsternd über uns gesprochen, als wären wir gar nicht da. Am liebsten hätte ich Mom am Arm gepackt und sie nach draußen gezogen, weil ich ihr angesehen habe, dass es ihr geht wie mir. Dass sie mit jeder Umarmung, jeder Träne und jedem mitfühlenden Lächeln immer wieder deinen Tod durchleben muss.
Irgendwie hatte ich das Gefühl, die Leute geben uns die Schuld dafür. Ich konnte an ihren Gesichtern ablesen, was sie dachten.
Wie kann es sein, dass sie nicht gemerkt haben, was mit ihr los war?
Es gibt doch immer Anzeichen. Wie haben sie die übersehen können?
Was ist das nur für eine Mutter?
Was ist das nur für ein Bruder, der nicht mitbekommt, dass seine Schwester – seine Zwillingsschwester – selbstmordgefährdet ist?
Als die Trauerfeier dann anfing, haben sich die Leute zum Glück mehr auf die Bilder konzentriert, die per Beamer an die Wand geworfen wurden, als auf uns. Auf vielen der Fotos waren wir beide zusammen zu sehen. Oder du mit deinen Freundinnen. Du und Mom und Dad in der Zeit vor der Scheidung. Du und Mom mit Brian, kurz nachdem sie mit ihm zusammengekommen ist. Du mit Dad und Pamela. Und auf all diesen Bildern sahst du glücklich aus. Du hast immer gestrahlt.
Aber als das letzte Bild auf die Leinwand gebeamt wurde, fiel es mir plötzlich wie Schuppen von den Augen. Es war das Foto, das etwa ein halbes Jahr nach Hopes Verschwinden vor unserem alten Haus in Austin gemacht wurde. Du hast das Armband an, das du für sie und dich gebastelt und ihr an dem Tag geschenkt hast, an dem sie entführt wurde.
Mir fällt gerade ein, dass du dieses Armband bis vor ein paar Jahren immer getragen hast und dann plötzlich nicht mehr. Ich habe dich nie gefragt, warum. Ich wusste ja, dass du nicht gerne über sie sprichst.
Auf dem Foto habe ich dir einen Arm um die Schultern gelegt. Wir schauen beide in die Kamera und du lächelst. Mir fiel plötzlich auf, dass du auf allen, wirklich ALLEN Fotos, die ich jemals von dir gesehen habe, exakt dieses Lächeln zeigst. Das ist doch krass, oder? Es existiert kein einziges Bild von dir, auf dem du mal schlecht gelaunt guckst oder genervt oder auch nur neutral. So als hättest du dein ganzes Leben lang daran gearbeitet, eine Fassade aufrechtzuerhalten. Ich weiß nicht, für wen du das getan hast, Les. Hattest du Angst, die Kamera könnte deine wahren Gefühle aufspüren und für alle Ewigkeit festhalten? Irgendeinen Grund muss es jedenfalls gegeben haben, denn mal ehrlich: Du warst nicht immer glücklich. Es gab Nächte, in denen du stundenlang geweint hast. Nächte, in denen du wolltest, dass ich dich einfach nur halte. Aber du hast mir nie erzählt, was dich so traurig macht. Verflucht, Les, was hat dich so belastet? Wir haben doch beide praktisch dasselbe Leben geführt – was hat dich so viel mehr mitgenommen als mich? Und woher hätte ich wissen sollen, wie ernst es ist, wenn du nie mit mir darüber geredet hast?
Vielleicht … Gott, ich will das gar nicht hinschreiben … vielleicht habe ich dich gar nicht wirklich gekannt, sondern nur die Oberfläche, die du gezeigt hast. Ja, so muss es gewesen sein. Ich kannte das Mädchen, das auf den Fotos gelächelt und manchmal nachts geweint hat, aber den Menschen dahinter habe ich wahrscheinlich nie kennengelernt. Ich habe keine Ahnung, warum du uns allen ein falsches Lächeln gezeigt, aber echte Tränen geweint hast.
Wenn man jemanden wirklich liebt, müsste man dann nicht wissen, was denjenigen zum Lächeln bringt und was zum Weinen? Aber ich hab es nicht gewusst. Ich habe keinen verdammten Schimmer gehabt und habe ihn bis heute nicht. Deshalb kann ich nur immer wieder sagen: Es tut mir leid, Les. Es tut mir so leid, nicht hartnäckiger gefragt zu haben, was mit dir los ist, wenn du geweint hast. Es tut mir so leid, nichts getan zu haben, als du der Welt vorgespielt hast, du wärst glücklich – obwohl du in Wahrheit meilenweit davon entfernt warst.
H.
DREI
»Leg dich doch ins Bett, Beth«, sagt Brian, der Freund meiner Mutter. »Du bist völlig erschöpft und solltest versuchen, ein bisschen zu schlafen.«
Meine Mutter, die am Herd steht und in einem Topf mit Kürbissuppe rührt, schüttelt den Kopf. Unsere Nachbarn und Freunde haben uns so viel Essen vorbeigebracht, dass wir eine ganze Armee durchfüttern könnten. Trotzdem besteht sie darauf, selbst für uns zu kochen, damit wir nicht den »Trauerfraß« essen müssen, wie sie mit bitterem Ton dazu sagt. Ehrlich gesagt habe ich nichts dagegen. Ich kann nämlich keine frittierten Hähnchenteile mehr sehen. Das scheint das Standardgericht zu sein, das man bei einem Beileidsbesuch mitbringt. Seit Les’ Tod vor vier Tagen habe ich praktisch zu jeder Mahlzeit frittierte Hähnchenteile gegessen.
Als ich zum Herd gehe und Mom den Kochlöffel aus der Hand nehme, lehnt sie sich an mich und seufzt. Aber es klingt nicht erleichtert. Es ist ein Seufzen, das ausdrückt: Ich kann nicht mehr.
»Setz dich bitte wenigstens rüber auf die Couch. Ich kümmere mich ums Essen«, sage ich zu ihr. Sie nickt und schleppt sich wie ein Zombie ins Wohnzimmer. Ich sehe von der Küche aus zu, wie sie sich aufs Sofa fallen lässt und an die Decke starrt. Brian setzt sich neben sie und zieht sie an sich. Auch ohne etwas zu hören, weiß ich, dass sie wieder weint. Ich erkenne es daran, wie sie sich an seine Schulter sinken lässt und die Hände in sein Hemd krallt.
Ich wende den Blick ab.
Mein Vater lehnt an der Küchentheke. »Vielleicht solltest du zu uns nach Austin ziehen, Dean«, schlägt er vor. »Nur für eine Weile. Ein bisschen Abstand würde dir wahrscheinlich guttun.«
Er ist der einzige Mensch, der mich noch Dean nennt. Seit meinem achten Lebensjahr bin ich für alle »Holder«. Nur er ist bei Dean geblieben, was vermutlich daran liegt, dass er selbst so heißt und ich nach ihm benannt wurde. Das ist okay, weil ich ihn sowieso nicht öfter als zweimal im Jahr sehe, aber eigentlich hasse ich diesen Namen.
Ich sehe zu meiner Mutter rüber, die sich im Wohnzimmer immer noch an Brian klammert, und schüttle den Kopf. »Das geht nicht, Dad. Ich kann sie jetzt nicht alleinlassen.«
Mein Vater versucht schon seit der Scheidung immer wieder, mich dazu zu überreden, zu ihm nach Austin zu ziehen. Es ist nicht so, dass ich ein Problem mit ihm hätte, aber hier fühle ich mich einfach wohler. Seit Mom, Les und ich hierhergezogen sind, bin ich nicht mehr gern in Austin. Dort erinnert mich zu viel an Hope.
Wobei es hier wahrscheinlich in Zukunft zu viel geben wird, was mich an Les erinnert …
»Mein Angebot steht jedenfalls«, sagt er. »Du bist jederzeit herzlich willkommen bei uns. Das weißt du.«
Ich nicke und schalte den Herd aus. »Essen ist fertig«, rufe ich.
Brian kommt mit Dads neuer Frau Pam in die Küche und wir setzen uns an den Tisch. Mom bleibt im Wohnzimmer und starrt ins Leere.
Ich stehe gerade vor dem Haus und verabschiede meinen Vater und Pam, die wieder nach Austin zurückmüssen, als Amy in ihrem Wagen um die Ecke biegt. Sie wartet mit laufendem Motor, bis mein Vater weg ist, und fährt dann in die Einfahrt.
Ich gehe um ihr Auto herum und öffne die Tür. »Hey.«
»Hey.« Amy lächelt zittrig, klappt die Sonnenblende herunter und wischt sich die verlaufene Wimperntusche von der Wange. Obwohl es schon dunkel ist, trägt sie eine Sonnenbrille.
Ich habe in den letzten vier Tagen kaum mit ihr gesprochen, aber ich muss sie nicht fragen, wie es ihr geht. Sie und Les sind sieben Jahre lang allerbeste Freundinnen gewesen. Wenn es irgendjemanden gibt, der sich so fühlt wie ich, dann sie.
»Wo hast du Thomas gelassen?«, frage ich, als sie aussteigt.
Sie schiebt sich die Sonnenbrille in die blonden Haare. »Zu Hause. Er musste seinem Vater nach der Schule im Garten helfen.«
Ich weiß nicht genau, seit wann die beiden zusammen sind; sie waren schon ineinander verliebt, als Les und ich hergezogen sind. Und damals waren wir in der vierten Klasse.
»Wie geht es deiner Mom?«, fragt sie und schlägt sich sofort die Hand vor den Mund. »Bitte entschuldige, Holder. Das war eine total unsensible Frage. Dabei hatte ich mir so fest vorgenommen, nicht wie diese ganzen Idioten zu sein.«
»Glaub mir, das bist du nicht«, versichere ich ihr und deute zur Tür. »Willst du reinkommen?«
Sie sieht zum Haus und dann zu mir. »Würde es dir was ausmachen, wenn ich in ihrem Zimmer ein paar Fotos zusammensuche? Bitte sag es, wenn das nicht okay für dich ist. Das könnte ich absolut verstehen. Es ist nur … Ich hätte gern ein paar Erinnerungen.«
»Na klar, kein Problem.« Amy und Les waren so eng befreundet, dass sie ein mindestens so großes Anrecht darauf hat, ihr Zimmer zu betreten, wie wir. Ich weiß, Les hätte gewollt, dass Amy sich von ihren Sachen nimmt, was immer sie möchte.
Als sie mir ins Haus folgt und wir die Treppe hinaufgehen, sehe ich, dass meine Mutter nicht mehr auf der Couch sitzt. Anscheinend hat Brian sie endlich dazu gebracht, sich ins Bett zu legen. Oben angekommen zeige ich auf die Tür, die ich seit Tagen nicht mehr geöffnet habe.
»Geh ruhig rein. Ich bin drüben bei mir, falls du mich brauchst.«
Amy holt tief Luft und atmet langsam aus. Zögernd legt sie die Hand auf die Klinke, während ich an ihr vorbei in mein Zimmer gehe. Ich setze mich aufs Bett und greife nach Les’ Tagebuch. Zwar habe ich ihr heute schon mal geschrieben, aber weil ich nichts Besseres zu tun habe, beschließe ich, ihr noch einmal zu schreiben. Es hätte keinen Sinn, irgendetwas anderes zu machen, weil ich sowieso ständig nur an sie denke.
DREIEINHALB
Hey Les,
Amy ist hier. Sie ist gerade in deinem Zimmer, weil sie sich ein paar Erinnerungsfotos mitnehmen möchte.
Ob sie wohl geahnt hat, wie schlecht es dir geht? Ich weiß, dass es Dinge gibt, die ein Mädchen nur seiner besten Freundin anvertraut und sonst niemandem – nicht mal ihrem Zwillingsbruder. Hast du ihr jemals erzählt, was dich so unglücklich macht? Hast du irgendetwas angedeutet? Ich hoffe mal schwer, dass du das nicht getan hast. Denn dann würde sie sich jetzt verdammt schuldig fühlen. Und das hat sie nicht verdient. Immerhin war sie sieben Jahre lang deine beste Freundin.
Ich fühle mich zwar auch schuldig, aber mein schlechtes Gewissen ist zumindest berechtigt. Ein Bruder hat gegenüber seiner Schwester eine ganz andere Verantwortung als ihre Freundin. Es war meine Aufgabe, dich zu beschützen, nicht Amys. Deswegen hoffe ich sehr, dass sie sich keine Schuld an dem gibt, was passiert ist.
Gerade denke ich, dass vielleicht genau das das Problem war. Vielleicht war ich viel zu sehr darauf fixiert, dich vor Grayson zu beschützen. Und bin deswegen nicht auf die Idee gekommen, dass man dich vor dir selbst hätte schützen müssen …
Als ich ein leises Klopfen höre, klappe ich das Tagebuch zu und lege es auf den Nachttisch. Amy öffnet die Tür und späht durch den Spalt. Ich winke ihr, hereinzukommen, worauf sie sich zaghaft ins Zimmer schiebt und die Tür hinter sich zumacht. An der Kommode bleibt sie stehen und legt die Fotos darauf, die sie mitgenommen hat. Tränen laufen über ihre Wangen.
»Komm her.« Ich strecke die Hand nach ihr aus. Als sich unsere Blicke kreuzen, bricht ein Schluchzen aus ihr hervor. Ich ziehe sie wortlos zu mir aufs Bett und schlinge die Arme um sie. Amy schmiegt sich an mich und beginnt unkontrolliert zu weinen. Sie zittert am ganzen Körper.
Ich schließe die Augen und versuche, den Schmerz nicht so nah an mich heranzulassen, wie Amy ihn gerade erlebt, aber das fällt mir schwer. Meiner Mutter zuliebe kann ich mich zusammenreißen, weil ich das Gefühl habe, für sie stark sein zu müssen. Bei Amy ist das anders.
»Schsch.« Ich ziehe ihr sanft die Sonnenbrille aus den Haaren, lege sie auf den Nachttisch und streiche ihr über den Kopf. Ich weiß, dass sie nicht mit irgendwelchen Worthülsen getröstet werden will. Sie braucht jemanden, der versteht, was in ihr vorgeht, und ich bin vielleicht der einzige Mensch in ihrem Umfeld, der ihren Schmerz wirklich nachvollziehen kann. Deswegen sage ich ihr auch nicht, dass sie nicht weinen soll. Ich weiß genau, dass man nichts dagegen tun kann. Stattdessen drücke ich meine Wange an ihre Schläfe und spüre, wie auch mir die Tränen in die Augen steigen. Bisher habe ich es ganz gut geschafft, sie zurückzudrängen, aber jetzt kann ich nicht mehr. Ich halte Amy in den Armen, lasse mich von ihr halten und merke, wie gut mir das tut. Zum ersten Mal seit Tagen fühle ich mich nicht allein und verlassen.
Während ich Amys leisem Schluchzen lausche, denke ich an die Nächte, in denen Les so in meinen Armen lag und weinte. Sie hat nie mit mir darüber gesprochen, was sie so unglücklich gemacht hat, hat sich nie helfen lassen. Sie wollte nur, dass ich sie halte und weinen lasse, ohne Fragen zu stellen. Jetzt für Amy da sein zu können, gibt mir das Gefühl, gebraucht zu werden. Ein Gefühl, das mir von Les so vertraut war. Ich habe es nicht mehr gespürt, seit sie beschlossen hat, von jetzt an keinen mehr zu brauchen.
»Ich fühle mich so schuldig«, sagt Amy dumpf in mein T-Shirt.
»Tu das nicht. Du kannst nichts dafür.«
Sie hält die Luft an und versucht, ihr Schluchzen zu unterdrücken, doch es hilft nichts. »Aber ich hätte es wissen müssen, Holder.« Mit tränenüberströmtem Gesicht sieht sie zu mir auf. »Ich war ihre beste Freundin, und trotzdem hatte ich keine Ahnung, was mit ihr los war. Es kommt mir vor, als würden mir alle die Schuld geben und … ich weiß nicht, vielleicht haben sie recht. Ich hätte doch was merken müssen. Vielleicht hat sie ja versucht, mit mir darüber zu reden, und ich hab es nicht mitbekommen, weil ich zu sehr mit mir und Thomas beschäftigt war …«
Ich kann das so gut nachfühlen. »Dann geht es dir wie mir«, sage ich leise und wische ihr die Tränen aus dem Gesicht. »Ich überlege auch schon die ganze Zeit, ob ich einen Moment verpasst habe, in dem ich irgendwas hätte tun oder sagen können. Aber gleichzeitig habe ich Zweifel, ob das etwas geändert hätte. Selbst wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, weiß ich nicht, was ich anders machen würde … Les ist die Einzige, die uns sagen könnte, warum sie es getan hat, und blöderweise ist sie gerade nicht hier.«
Amy löst sich ein Stück von mir, lehnt sich zurück und sieht mich ernst an. »Sie kann froh sein, dass sie nicht hier ist, weil ich verdammt sauer auf sie bin, Holder«, sagt sie mit erstickter Stimme. Dann beginnt sie wieder zu schluchzen und bedeckt die Augen mit der Hand. »Ich bin so scheißwütend auf sie, weil sie sich mir nicht anvertraut hat, und ich hab das Gefühl, dass ich das niemandem sagen kann … nur dir«, flüstert sie.
Ich ziehe ihr die Hand von den Augen und sehe sie an. »Versuch, dich nicht schuldig zu fühlen, okay? Versprich mir das.«
Sie nickt mit bebendem Kinn und probiert ein Lächeln. Ich lege meine Hand auf ihre und streiche mit den Fingerspitzen tröstend darüber. Ich weiß, wie sie sich fühlt, sie weiß, wie ich mich fühle, und es ist gut, dass wir uns haben, auch wenn es nur für diesen einen Moment ist.
Ich würde ihr gern dafür danken, dass sie Les die ganzen Jahre über eine so gute Freundin war. Aber es kommt mir unpassend vor, ihr das ausgerechnet jetzt zu sagen, wo sie genau das Gegenteil davon empfindet. Ich weiß nicht, warum ich mich ihr auf einmal so nahe fühle – ob es die gemeinsame Trauer um Les ist oder die Tatsache, dass sie mir wieder das Gefühl vermittelt hat, gebraucht zu werden. Vielleicht hat es auch einfach damit zu tun, dass sich mein Kopf und mein Herz schon viel zu viele Tage wie betäubt angefühlt haben. Aber ganz egal, woher dieses Gefühl kommt, es ist da, und ich will nicht, dass es so schnell wieder verschwindet. Deswegen lasse ich zu, dass es mich komplett erfüllt, und beuge mich langsam zu ihr vor.
Es ist nicht so, als hätte ich beschlossen, sie zu küssen. Ich erwarte, dass ich innehalte, bevor es so weit kommt, aber das tue ich nicht. Ich erwarte, dass sie mich wegschiebt, aber sie tut es nicht. Im Gegenteil. In dem Moment, in dem mein Mund ihren berührt, öffnet sie unwillkürlich die Lippen und seufzt, als wäre dieser Kuss genau das, was sie von mir braucht. Und ihr Seufzen verstärkt meinen Wunsch, sie zu küssen. Ich küsse sie in dem Wissen, dass sie die beste Freundin meiner Schwester war. In dem Wissen, dass sie einen Freund hat. In dem Wissen, dass ich sie unter anderen Umständen niemals küssen würde …
Amy streicht mit den Fingern meinen Arm hinauf und schiebt sie unter den Ärmel meines T-Shirts. Ich ziehe sie sanft mit mir zur Mitte des Betts und vertiefe unseren Kuss. Falls es Amy so geht wie mir, gibt sie ihrem Verlangen vor allem deshalb so bereitwillig nach, weil körperliche Nähe die einzige Möglichkeit zu sein scheint, die Trauer für einen Moment zu vergessen. Wir küssen uns immer wilder und drängender, um den Schmerz nicht spüren zu müssen. Amys Berührung bringt die Gedanken, die seit Tagen in meinem Kopf kreisen, zum ersten Mal zum Stillstand. Ich küsse sie immer verzweifelter, weil ich nichts lieber will, als mein Leben für einen Moment komplett auszublenden. Meine Hände schieben sich unter ihr enges Top, und in der Sekunde, in der meine Hand ihre Brust umschließt, stöhnt sie auf und gräbt ihre Fingernägel in meinen Unterarm.
Während sie mir das T-Shirt über den Kopf zieht und ich mit dem Reißverschluss ihrer Jeans kämpfe, sind nur noch zwei Gedanken in meinem Kopf.
Wir müssen diese Klamotten loswerden.
Thomas.
Normalerweise denke ich nicht an andere Typen, wenn ich mit einem Mädchen rummache, aber normalerweise mache ich auch nicht mit den Mädchen anderer Typen rum. Amy ist nicht mein Mädchen und eigentlich darf ich sie nicht küssen, trotzdem tue ich es. Ich habe kein Recht, sie auszuziehen, trotzdem tue ich es. Ich dürfte meine Hand nicht in ihren Slip gleiten lassen, trotzdem tue ich es.
Ich löse mich von ihr und richte mich ein Stück auf, während sie stöhnend den Hinterkopf ins Kissen drückt.
Ohne in meiner Bewegung innezuhalten, beuge ich mich übers Bett und nehme mit der freien Hand ein Kondom aus der Nachttischschublade. Ich reiße die Verpackung mit den Zähnen auf und lasse Amy dabei nicht aus den Augen. Ich weiß, dass wir beide gerade nicht wir selbst sind, sonst würde das hier nicht passieren. Aber ganz egal, ob wir zurechnungsfähig sind oder nicht, zumindest wollen wir dasselbe. Ich hoffe es jedenfalls.
»Amy?«, flüstere ich. »Was ist mit … Thomas?« Natürlich ist es brutal und unromantisch, ein Mädchen nach ihrem Freund zu fragen, wenn sie noch ungefähr dreißig Sekunden davon entfernt ist, ihn komplett zu vergessen, aber ich muss es tun. Ich will nicht, dass Amy das, was wahrscheinlich gleich passiert, noch mehr bereut, als sie es ohnehin tun wird. Als wir beide es tun werden.
Sie stöhnt leise, hält die Augen aber geschlossen und stemmt beide Hände gegen meine Brust. »Er ist zu Hause«, murmelt sie und macht nicht den Eindruck, als würde die Erwähnung seines Namens in ihr den Wunsch auslösen, mit dem aufzuhören, was wir gerade machen. »Er musste seinem Vater nach der Schule im Garten helfen.«
Ich kann mir ein leises Lachen nicht verkneifen, weil das exakt die Antwort ist, die sie mir auch vorhin in der Einfahrt gegeben hat. Sie öffnet die Augen und sieht mich verwirrt lächelnd an. Wahrscheinlich fragt sie sich, was ich so komisch finde. Ich bin dankbar für dieses Lächeln, weil ich die Tränen und traurigen Gesichter um mich herum so satthabe. So dermaßen satt.
Und verdammt, wenn sie keine Gewissensbisse hat – wonach es definitiv aussieht –, dann habe ich auch keine. Bereuen können wir auch später noch.
Genau in dem Moment, in dem sie nach Luft schnappt und laut aufstöhnt, berühre ich mit meinen Lippen ihre und lasse sie ihren Freund und alles andere vergessen.
Amy sitzt auf der Kante meines Betts und zieht ihre Chucks an. Ich habe mir eben die Jeans zugeknöpft und stehe unschlüssig herum, weil ich nicht weiß, was ich tun oder sagen soll. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte, was gerade passiert ist – und dem Ausdruck auf Amys Gesicht nach zu urteilen, geht es ihr genauso. Sie steht auf und nimmt die Bilder, die sie aus Les’ Zimmer geholt hat, von der Kommode. Soll ich sie nach unten begleiten? Ihr einen Abschiedskuss geben? Ihr sagen, dass ich mich bei ihr melde?
Was zur Hölle habe ich gerade getan?
Amy schiebt sich an mir vorbei in den Flur, dann dreht sie sich zu mir um. Allerdings schaut sie mir nicht in die Augen, sondern auf die Fotos in ihrer Hand. »Ich war bloß kurz wegen der Bilder da, stimmt’s?«, fragt sie vorsichtig. Vielleicht befürchtet sie, ich könnte denken, das gerade zwischen uns wäre mehr, als es war.
Ich lächle. »Klar, Amy«, bestätige ich. »Du hast bloß die Fotos zusammengesucht und danach bist du wieder gegangen. Und Thomas ist zu Hause und hilft seinem Vater im Garten.«
Sie lacht, wenn man es als Lachen bezeichnen kann, und sieht mich dankbar an. Einen Moment schweigen wir beide, dann lacht sie noch einmal. »Hey, was war das eben?«, fragt sie und deutet in Richtung meines Zimmers. »Das waren doch nicht wir, Holder, oder? Wir gehören nicht zu denen, die so was machen.«
Nein, zu denen gehören wir nicht, da gebe ich ihr völlig recht. Ich lehne den Kopf an den Türrahmen und spüre die Reue lauern. Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist und warum die Tatsache, dass sie einen Freund hat, mich nicht davon abgehalten hat. Ich kann es mir nur damit erklären, dass das, was zwischen uns passiert ist, eine direkte Folge unserer Trauer ist. Und unsere Trauer ist eine direkte Folge von Les’ egoistischer Entscheidung, sich umzubringen.
»Ich bin dafür, dass wir Les die Schuld geben«, sage ich und meine das nur halb im Scherz. »Es wäre nie passiert, wenn sie hier wäre.«
Amy grinst. »Stimmt«, sagt sie und schüttelt in gespielter Empörung den Kopf. »Was für ein Aas, uns praktisch dazu zu zwingen, so was Ekelhaftes zu tun.«
Ich lache. »Echt fies von ihr.«
Amy hebt die Hand mit den Fotos. »Danke für …« Sie wirft einen Blick auf die Bilder und sieht dann mich an. »Für … keine Ahnung. Fürs da sein.«
Ich nicke nur stumm und sehe zu, wie sie sich umdreht und nach unten geht. Danach schließe ich die Tür, lasse mich aufs Bett fallen und greife wieder nach dem Tagebuch. Ich schlage es an der Stelle auf, an der ich vor einer Stunde aufgehört habe, als Amy an die Tür geklopft hat.
DREIDREIVIERTEL
Was da eben mit Amy passiert ist … das ist ganz allein deine Schuld, Les. Nur dass das klar ist.
H.
VIER
Herzlichen Glückwunsch zum zweiwöchigen Sterbetag, Les!
Zu krass? Kann sein, aber ich werde mich nicht dafür entschuldigen.
Montag muss ich wieder in die Schule, worauf ich echt verzichten könnte. Daniel hält mich über die Gerüchte auf dem Laufenden, obwohl ich ihm gesagt habe, dass es mir scheißegal ist, was die Leute reden. Natürlich denken alle, du hättest dich wegen Grayson umgebracht. Dabei bin ich mir sicher, dass das nicht der Grund war. Je mehr ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir, dass du lange bevor Grayson überhaupt auf der Bildfläche aufgetaucht ist, nur noch so getan hast, als wärst du am Leben.
Ach so, in dem Zusammenhang muss ich dir noch was beichten. Grayson hat mit dir Schluss gemacht, weil ich ihn dazu gezwungen habe. Ich will jetzt nicht in Einzelheiten gehen, das wäre zu kompliziert, aber glaub mir: Der Typ hatte dich nicht verdient. Anscheinend hat sich die Geschichte an der Schule rumgesprochen, und die meisten Leute sind der Meinung, dass ich dich dadurch indirekt in den Selbstmord getrieben habe. Grayson ist jetzt auf einmal das arme Opfer, und ich kann mir lebhaft vorstellen, wie dieses Arschloch es genießt, bemitleidet zu werden.
Aber das ist noch nicht alles: Angeblich bin ich selbst kurz davor, mich umzubringen, weil ich mit meiner Schuld nicht leben kann. Und wenn die Leute das sagen, dann muss es wohl stimmen, oder?
Soll ich dir mal was verraten, Les? Ich bin ein viel zu großes Weichei, als dass ich das jemals machen würde. Bitte sag’s nicht weiter (nicht dass du das jetzt noch könntest, selbst wenn du wolltest), aber das ist die armselige Wahrheit. Ich hätte viel zu viel Schiss davor, mich umzubringen, weil ich keine Ahnung habe, was mich danach erwartet. Ich meine, was ist, wenn das Leben nach dem Tod schlimmer ist als das Leben, vor dem man davonläuft? Sich bewusst kopfüber ins Unbekannte zu stürzen, erfordert ganz schön Mut. Und eins muss ich dir lassen, Les, du warst viel mutiger als ich.
Okay, das war’s für heute. Ich krieg gleich einen Krampf in den Fingern. Dir Mails zu schreiben, wäre einfacher, aber du magst es ja gern kompliziert, stimmt’s?
Ach so, noch was. Wenn ich Grayson am Montag in der Schule über den Weg laufe, reiße ich ihm die Eier ab und schick sie dir. Kannst du mir bitte deine neue Adresse durchgeben?
H.
Als ich am Montag auf den Schulparkplatz einbiege, sehe ich Daniel, der an seinem Wagen lehnt und offensichtlich auf mich wartet.
»Und, wie sieht deine Taktik aus?«, fragt er, als ich neben ihm halte und aussteige.
Ich zerbreche mir den Kopf, ob ich irgendein wichtiges Footballspiel oder so was vergessen habe, das heute ansteht, aber mir fällt nichts ein.
»Taktik wofür?«, frage ich zurück.
»Überlebenstaktik für heute, du Schrumpfhirn.« Er greift nach seinem Rucksack, der auf dem Wagendach liegt, hängt ihn sich über die Schulter und schlendert neben mir her Richtung Haupteingang. »Ich hab dir doch erzählt, was hier für ein Scheiß über dich verbreitet wird. Deshalb wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir uns eine Taktik überlegen, wie du darauf reagierst. Ich könnte dich zum Beispiel wie ein rohes Ei behandeln und dir die ganze Zeit über den Kopf streichen, sodass sich keiner an dich rantraut. Willst du das? Nein, bestimmt nicht«, beantwortet er sich die Frage gleich selbst. »Außerdem würde das diese Heuchler vielleicht eher auf die Idee bringen, dich zu bemitleiden, und ich weiß, dass du das nicht ertragen würdest. Ich könnte irgendeine Show abziehen, um die Hyänen von dir abzulenken. Da fällt mir sicher was ein. Auch wenn du es nicht wahrhaben willst, Alter: Die ganze Schule redet seit zwei Wochen von nichts anderem als von dir und Leslie.« Er verdreht die Augen. »Ich kann die Storys echt nicht mehr hören.«
Obwohl ich mir fest vorgenommen habe, mich nicht um das Gerede zu kümmern, bin ich verdammt froh, Daniel an meiner Seite zu haben.
»Wir können natürlich auch einfach so tun, als wär nichts passiert, und hoffen, dass die Leute mittlerweile ein spannenderes Thema gefunden haben«, denkt er laut nach. »Aber die Chance ist gering.« Plötzlich lacht er auf, läuft rückwärts vor mir her und reibt sich die Hände. »Hey, ich hab’s. Ich spiele deinen persönlichen Bodyguard und weiche dir nicht von der Seite. Sobald jemand es wagt, irgendeinen Bullshit zu dir zu sagen, kriegt er es mit mir zu tun. Bitte, darf ich? Ja?«
Ich lache. »Wir werden den Tag schon irgendwie hinter uns bringen – auch ohne Taktik.«
Daniel runzelt enttäuscht die Stirn. »Dir ist anscheinend nicht klar, wie viel Spaß diese Meute daran hat, sich das Maul zu zerreißen. Okay, anderer Vorschlag. Du bleibst still und hältst dich raus – wenn eingegriffen werden muss, übernehme ich das. Ich träum seit zwei Wochen davon, diesen Idioten endlich mal die Meinung zu sagen.«
Ich bin Daniel zwar dankbar für seine Fürsorge, kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sich jemand trauen wird, in meiner Nähe Les’ Namen auch nur zu erwähnen. Und das ist gut so.
Weil es noch nicht zur ersten Stunde gegongt hat, stehen vor dem Eingangsportal Grüppchen von Schülern zusammen. Zum ersten Mal in meinem Leben betrete ich die Schule ohne Les an meiner Seite. Der Gedanke allein reicht, um wieder vor mir zu sehen, wie ich in ihr Zimmer kam und sie tot auf dem Bett fand. Verdammt, ich will diesen Moment nicht noch mal durchleben. Erst recht nicht hier und jetzt. Um den neugierigen Blicken nicht begegnen zu müssen, ziehe ich mein Handy aus der Jacke und tue so, als würde ich eine Nachricht schreiben. Ich sehe ein, dass Daniel mit seiner Einschätzung der Lage recht gehabt haben könnte. Es ist sicher kein Zufall, dass alle Leute um uns herum schlagartig aufhören zu reden, als wir an ihnen vorbeigehen. Oh Mann, ich kann nur hoffen, dass sich die Situation so bald wie möglich normalisiert.
Daniel und ich haben erst in der dritten Stunde zusammen Unterricht, also verabschiedet er sich in der Eingangshalle und geht in die entgegengesetzte Richtung davon. Als ich kurz darauf das Klassenzimmer betrete, in dem mein erster Kurs stattfindet, herrscht Totenstille. Sämtliche Augen sind auf mich gerichtet, während ich an meinen Platz gehe.
Obwohl ich weiter auf meinem Handy herumtippe, ist mir bewusst, dass ich im Zentrum der Aufmerksamkeit stehe. Gott, ich habe mich in meinem Leben selten so unwohl gefühlt. Oder bilde ich mir das womöglich alles bloß ein? Verhalten sich gar nicht die Leute anders, sondern ich? Wobei das eigentlich keine Rolle spielt, denn eines ist klar: Dieser Zustand ist unerträglich. Wird ab jetzt jede Sekunde meines Lebens davon bestimmt sein, dass meine Schwester nicht mehr hier ist?