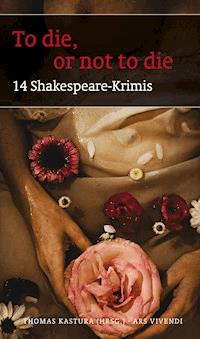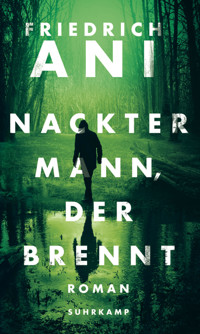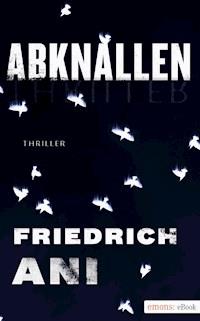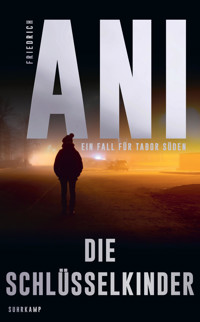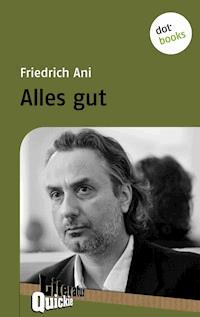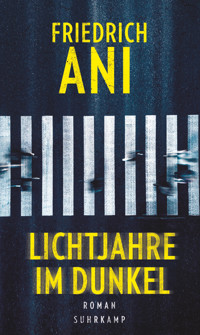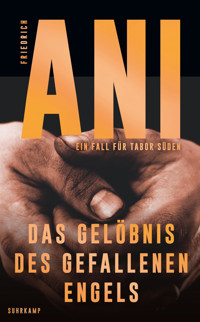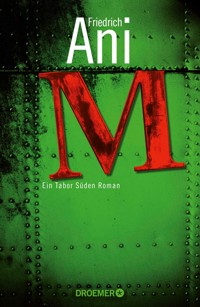
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Tabor Süden
- Sprache: Deutsch
»Er war irgendwie anders in letzter Zeit.« Mit diesen Worten beauftragt die Redakteurin Mia Bischof die Detektei Liebergesell, nach ihrem vermissten Freund zu suchen. Süden und seine Kollegen kommt die Frau von Anfang an seltsam vor. Sie sehen sich in ihrem unguten Gefühl bestätigt, als irritierende Hinweise im Arbeitsumfeld des Vermissten auftauchen. Er habe Kontakt zu Neonazis, heißt es. Doch Mia bestreitet das vehement. Süden schiebt seine persönlichen Bedenken beiseite – bis seine Kollegen in höchste Gefahr geraten und er um ihr Leben fürchten muss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Friedrich Ani
M
Ein Tabor Süden Roman
Knaur e-books
Über dieses Buch
Alles beginnt wie immer mit einer Vermisstenmeldung. Mia Bischof, Redakteurin beim »Tagesanzeiger« beauftragt die Detektei Liebergesell mit der Suche nach ihrem Freund Siegfried Denning. »Er war irgendwie anders in letzter Zeit.« Bei seinen Ermittlungen stösst Süden auf irritierende Hinweise im Arbeitsumfeld von Denning. Angeblich habe der Vermisste Kontakte zu Neonazis. Seine Freundin streitet dies vehement ab. Süden wird immer misstrauischer, die Arbeit an dem Fall für die übrigen Mitarbeiter der Detektei immer gefährlicher. Und für Edith Liebergesell führt der Fall zu dem traumatischsten Erlebnis ihres Lebens.
Inhaltsübersicht
First you dream, then you die.
Cornell Woolrich
Erster Teil
1
Am zehnten Todestag ihres Sohnes wurde Edith Liebergesell jäh bewusst, dass sie seit undenklichen Zeiten niemanden mehr in ihre Wohnung eingeladen hatte. Als sie auf der schwarzen Ledercouch saß und auf ihre Tränen wartete, entwischte ihr Blick dem vom Erinnern verdunkelten Verlies ihrer Augen und fiel auf das Ensemble der Stumpenkerzen, die nebeneinander auf dem niedrigen Bücherschrank standen, in Grün und Gelb und Rot und Weiß und Braun und Beige und Violett und Ocker. Vierzehn Kerzen, jede ungefähr zehn Zentimeter hoch, ohne Verzierung, alle mit weißen Dochten, alle aus dem einzigen Grund gekauft, den Gästen beim Essen und Trinken und Reden mit munterem Flackern Gesellschaft zu leisten.
Das war es, was Edith Liebergesell sich vorstellte, während sie mit dem gerahmten Foto in den Händen am Rand der Couch saß: dass da wie selbstverständlich Leute waren, die ohne elektrisches Licht eine Nähe teilten. Die rauchten oder auch nicht; die Singles waren oder echte Einzelgänger; die daheim eine Familie hatten oder einen Hund; die, wenn sie redeten, von Zuhörern umgeben waren und nicht von notgedrungen Verstummten; die sich anschauten und an der Tür einander umarmten und beim Abräumen und Abspülen helfen wollten und keine Chance gegen den Willen der Gastgeberin hatten. Die eine Stille zurückließen, in der die Kerzen knisternd musizierten, weit nach Mitternacht, wenn die Weinreste schon in den Gläsern trockneten und die Speisereste auf den Tellern.
So hätte das alles sein können, sagte sie lautlos und fragte das Bild in ihren Händen, warum ihr erst heute auffiel, dass niemand da war außer ihr.
Dann Tränen. Das Zimmer versank vor ihren Augen, und als es wieder auftauchte, war vor den Fenstern und in der Wohnung stockdunkle Nacht. Edith Liebergesell wollte aufstehen, aber es gelang ihr nicht. Etwas – nicht ihr elendes Übergewicht, nicht der Schmerz, nicht die trostlose Stille, nicht die Angst vor dem Licht, das sie gleich anschalten musste – zwang sie auszuharren und das Foto nicht loszulassen. Etwas, das sie verblüffte, ließ sie den Kopf heben und zum Flur schauen, durch den Rahmen der ausgehängten Tür. Im Flur war alles schwarz. Und doch war etwas anders als sonst, etwas war nicht in der gewohnten Ordnung, etwas veranlasste Edith Liebergesell, noch weiter an den Rand der Couch zu rutschen und die Knie aneinanderzupressen und die Luft anzuhalten, bis sie einen lauten Seufzer von sich gab, der sie selbst erschreckte.
Das Foto glitt ihr aus den Händen und fiel aufs Parkett. Das Glas zersplitterte nicht. Sie bückte sich danach, ergriff es mit Daumen und Zeigefinger am Rahmen und hob es auf. Sie betrachtete das vertraute, verschattete Jungengesicht mit den schmalen, müden Augen und sah noch einmal zur Tür. Sie atmete mit offenem Mund tief ein, was wie ein Röcheln im Schlaf klang, und stand mit einem Ruck auf.
Das, was sie soeben noch niedergedrückt und verstört hatte, schien wie bei einer Explosion aus ihr herauszubrechen.
In diesem Augenblick zerschmetterte ein Gedanke alle anderen, loderte eine Empfindung in ihr auf, wobei sie keine Vorstellung davon hatte, wodurch diese entzündet worden sein mochte und der sie sich doch wehrlos hingab. Es ist passiert, dachte sie vom Herzen her. Heute ist es so weit, heute und von dieser Stunde an.
Zehn Jahre nach Ingmars Entführung und Ermordung stand Edith Liebergesell in ihrer Wohnung, beseelt von der Vorstellung, dass der Abschied von nun an kein blutiger Prozess mehr war, sondern eine Narbe, die zu ihr gehörte wie ihre Stimme. Sie war ein Teil ihrer Persönlichkeit. Ingmars Tod gehörte nicht länger dem Täter, sondern allein ihr, seiner Mutter.
Beinahe hätte sie noch einmal angefangen zu weinen. Sie stellte das gerahmte Bild ins Regal zurück, drückte auf den Lichtschalter neben der Tür und beschloss, die Kerzen anzuzünden, alle vierzehn, zehn für ihren Sohn, zwei für dessen Vater und zwei für sich. Bevor sie sie im Wohnzimmer, im Flur, in der Küche und im Badezimmer verteilte, rauchte sie bei weit geöffnetem Fenster eine Zigarette. Hätte sie wissen müssen, dass sie über die Ereignisse der Vergangenheit und die Echos ihrer Erinnerung keine Macht besaß, solange Ingmars Ermordung dem Täter bis heute eine Gegenwart erlaubte?
Das Beste an den Gesprächen mit seinem Vater war, dass er wusste, er könnte sie bis in alle Ewigkeit fortführen. Mit solchen Unterhaltungen in der flüchtigen Dämmerung oder der Schattenhaftigkeit eines Zimmers hatte er Erfahrung. Er lebte fast davon, wegen Martin Heuer. Seit so vielen Jahren, die nicht einmal doppelt zählten und ihm dennoch wie Jahrzehnte erschienen, besprach Tabor Süden mit seinem besten Freund die Dinge des Tages und lud das Gerümpel seiner Gedanken bei ihm ab. Mit wem hätte er auch reden sollen außer mit dem Menschen, dessen Nähe seine Heimstatt war seit jenem Tag, an dem seine Mutter starb? Seit jenem Tag, an dem sein Vater beschloss, eines Tages zu verschwinden, bis er drei Jahre später tatsächlich einen leeren Stuhl zurückließ, seine Lederjacke, einen unbegreiflichen Brief und die Küche ohne ein einziges Trostbrot.
Das war an einem Sonntag gewesen, zwei Tage vor Heiligabend. Obwohl Tabor schon sechzehn und geübt darin war, sich gegen die weißen Wände der Einsamkeit zu stemmen und keine Fragen mehr an seine tote Mutter, an Gott und die Madonna in der Kirche zu stellen – und stattdessen Gedichte las, Musik hörte und im Wald Bäume umarmte –, empfand er das Haus an jenem Nachmittag wie ein im schwarzen Weltall vergessenes Raumschiff.
Und als er nach draußen trat, sog die Finsternis ihn in einen Strudel aus Furcht und Zorn, in dem er womöglich jede Zuversicht verloren oder abgetötet hätte, wäre nicht sein bester Freund wie ein Engel mit Schnurrbart und Parka und einer Fluppe im Mund aus dem Nichts der Welt aufgetaucht. Ohne Umschweife scheuchte Martin ihn vom Seeufer weg und bugsierte ihn in die Alte Schmiede, wo Evi auch an Jugendliche Bier ausschenkte, besonders gern an Tabor, den sie sofort mit nach Hause genommen hätte, wäre sie nicht dreißig Jahre älter und mit einem gemeingefährlichen Blödmann verheiratet gewesen. Später tauchten zwei Streifenpolizisten auf, aber es ging ihnen nicht um den Jugendschutz in Gaststätten, sondern ums Abholen des Jungen, der von seiner Tante Lisbeth und seinem Onkel Willibald vermisst wurde. Bei den beiden sollte Tabor von nun an leben. Wenigstens das hatte sein Vater heimlich geregelt, wenn auch erst am Tag seines Verschwindens, wie Süden erfuhr.
Im Grunde wich Martin Heuer von Stund an nicht mehr von seiner Seite – bis zu jener Nacht, in der Martin in einen Müllcontainer in Berg am Laim kletterte, den Deckel schloss und sich mit seiner Heckler & Koch eine Kugel in den Kopf jagte. Die Sterne am Himmel hatten Martins schwarzen Schmerz jahrelang gespiegelt, und doch hatte Süden die Tat nicht verhindern können. Inzwischen hatte er akzeptiert, dass ihn keine Schuld traf – zumindest keine, die ihn hätte treffen sollen, wie Martin ihm unermüdlich aus dem Himmel versicherte.
Martin lag neben der Kolonialwarenhändlerswitwe Krescenzia Wohlgemuth auf dem Waldfriedhof im Kreis Zehntausender Toter und hörte, weil er keine Wahl hatte, Süden, der bis heute nach Vermissten und Verschwundenen suchte, geduldig zu.
Seit einiger Zeit redete Süden auch mit seinem Vater, der ein paar hundert Meter von Martins Grab entfernt lag. Allerdings wusste Süden nicht, wo genau die Asche seines Vaters beerdigt worden war, irgendwo drei Meter tief in der Erde, auf der Wiese der Anonymen, in einem der mit Erdreich überdeckten Quader, deren Anordnung nur die Grabmacher kannten.
Nach seiner Rückkehr nach München – Süden hatte keine Vorstellung, wo in der Welt sein Vater sich all die Jahre herumgetrieben hatte –, verfügte Branko Süden in seinem Testament eine Feuerbestattung und die anonyme Beisetzung seiner Urne. Somit, dachte Süden, schloss sich der Kreis: Er würde nie erfahren, wo sein Vater gelebt hatte, und er würde nie erfahren, wo die Asche seines Leichnams verstreut worden war. Ein fremder Mann war gestorben, sein Vater. Dennoch redete Süden mit ihm wie mit einem Vertrauten, auf dessen Rücken er einmal galoppiert war, dessen Stimme ihn in den Schlaf gewiegt, dessen Elfmeter er gehalten hatte.
Dieses Reden war kein Gedankengetümmel, kein Murmeln mit halb geschlossenem Mund. Wenn Süden Zwiesprache mit seinem Vater hielt, nahm er keine Rücksicht auf verwirrte Friedhofsbesucher oder Krähen, die in Ruhe im Gras herumpicken wollten. Auf und ab gehend, manchmal wie aus Versehen mit einer Hand durch die Luft wedelnd, als würde er von den eigenen Worten mitgerissen, sprach er mit fester Stimme zur Erde. Er sprach auch zu den Sträuchern, den Buchen und Tannen, ins sinkende Licht – untermalt vom monotonen Rauschen der nahen Autobahn und vom Rufen der schwarzblauen Vögel, die vielleicht um ihre Stimmenhoheit fürchteten. Dann hob Süden den Kopf und sah ihnen zu, wie sie mit scheinbar schwerfälligem Flügelschlag ein Baumkrone-wechsele-dich-Spiel begannen, vielleicht mit dem Ziel, den Stillezerstörer abzulenken oder so lange zu nerven, bis er einsah, dass dieser Flecken Friedhof keine Bühne für zweibeinige Selbstdarsteller war.
Von Jugend an hielt Süden Krähen für Abgesandte der Unterwelt. Er war überzeugt, sie würden jedes Wort verstehen und nachts, wenn die Friedhofstore geschlossen waren, im roten Flackern der Kerzen den Gesang der Toten hören und ihre Stimmen einstudieren, um damit tagsüber die Trauernden zu trösten oder sie auszulachen. Süden ließ sich nicht stören. Er redete hinauf zum Geäst oder beugte sich zu einer Krähe hinunter, die beflissen vor ihm herhüpfte, als wollte sie ihm den Weg zum Ausgang weisen.
Immer aber kehrte er zu der kleinen Mauer und den Büschen zurück. Dort hinterließen Angehörige in ihrer Ratlosigkeit Bilder und Geschenke, Figuren aus Holz oder Plastik, eingeschweißte Fotos der Verstorbenen, Kerzen und Blumensträuße. Grabschmuck für unsichtbare Gräber, Beschwörungsrituale in einem All aus Unverständnis.
Mehrere Male hatte Süden miterlebt, wie eine Frau ihre verstorbene Schwester beschimpfte, weil diese »sich einfach davongemacht« hätte, »ohne Rücksicht auf uns alle, und bei Nacht und Nebel in der Erde verscharrt wie ein Hund«. Und ein alter Mann schlug bis zur Erschöpfung mit seinem Krückstock auf die Erde ein, stieß Flüche und einen Namen aus, den Süden auf die Entfernung nicht verstand, und hörte nur auf, weil ein Hustenanfall ihn dazu zwang und er seinen Stock verlor, nach dem er sich mühsam bücken musste.
Von einem der in dunkles Grau gekleideten Grabmacher – Süden nannte sie nach wie vor Totengräber – hatte er erfahren, dass die Zahl der anonymen Beisetzungen stetig ansteige, mittlerweile seien es knapp neunhundert im Jahr. »Die Leut’ wollen halt niemand zur Last fallen.«
Auch sein Vater, dachte Süden, wollte niemandem zur Last fallen, schon zu Lebzeiten nicht. Deswegen war Branko Süden damals verschwunden, weil er seinem Sohn seine innere Not nicht länger zumuten wollte. Und doch hatte er gerade durch sein Abtauchen in die Anonymität die Last ins Unermessliche gesteigert – zumindest zwei Jahre lang, bis Tabor achtzehn wurde und seine erste eigene Wohnung in der Stadt bezog, gemeinsam mit Martin, seinem Schwellenwächter.
Vorwürfe machte er seinem Vater schon lange nicht mehr. Nur geredet hätte er gern mit ihm. Hätte ihm gern zugehört. Hätte gern etwas erfahren. Vater-Sohn-Sachen, sagte er zur Luft, zu seinen Schuhen, zur Krähe in der Nachbarschaft. Dabei wusste er aus seiner zwölfjährigen Erfahrung als Vermisstenfahnder bei der Kripo, dass die so beschworenen Vater-Sohn- oder Mutter-Tochter- und Kind-Familien- und Bruder-Schwester-Sachen meist Illusionen blieben, ausgelöst durch Tod oder Verschwinden, durch die Pflicht, das Leben in unverschuldeter Verlorenheit weiterführen zu müssen.
Sechzehn Jahre, dachte Süden, hätte er Zeit gehabt, mit seinem Vater zu sprechen. Sechzehn Jahre lebten sie beide unter einem Dach. Sechzehn Jahre lang passierte nichts anderes, als dass der Vater sein Schweigen dem Sohn vererbte und der Sohn dem Vater zu jedem Geburtstag einen Korb voller Nachsicht schenkte und beide einander umarmten. Nach dem Tod der Mutter wurde das Erbe des Vaters noch bedeutsamer, das Geschenk des Sohnes noch hingebungsvoller, und sie umarmten einander in neuer Nähe, die in Wahrheit nichts als ein Abgrund war. Sie wussten es beide, was also hätte Süden ihm vorwerfen sollen, auf der Wiese der Anonymen? Wo sonst hätte sein unbekannter Vater seine letzte Ruhestätte finden sollen?
Ein Mitbringsel hatte Süden bisher nicht dagelassen. Er wusste nicht, welches. Das einzige Foto, das er von seinem Vater besaß, würde er nicht hergeben. Außerdem – und darauf hatten seine katholische Erziehung und seine Karriere als Ministrant, Süden hatte es bis zum Lektor im Gottesdienst gebracht, seltsamerweise keinerlei Einfluss – misstraute er den meisten Friedhofsbesuchern. Sie klauten. Wer für die Allgemeinheit bestimmte Plastikgießkannen und mit Deckeln versehene Stumpenkerzen von fremden Gräbern mitgehen ließ, der bediente sich erst recht bei den Geschenken für die Anonymen. Und wenn er sich beim letzten Mal nicht verschaut hatte, fehlten diesmal zwei Stoffelche und eine Kerze mit drei Dochten. Davon abgesehen, dachte Süden, erwartete sein Vater kein Geschenk.
Bevor er den Friedhof an diesem ersten Februar verließ, erzählte er noch ein wenig von seinem aktuellen Fall, einer mysteriösen Vermissung, die er für die Detektei Liebergesell aufzuklären hatte.
Der Geliebte – oder Lebensgefährte? – der Journalistin Mia Bischof war angeblich seit mehr als einer Woche spurlos verschwunden. Ihrer Aussage zufolge hatte der vierundfünfzigjährige Taxifahrer am späten Sonntagnachmittag, 22. Januar, ihre Wohnung verlassen, um den Nachtdienst bei seinem Arbeitgeber anzutreten. Dieser jedoch erklärte, sein Mitarbeiter Siegfried Denning habe ihn angerufen und ihm mitgeteilt, er sei an Grippe erkrankt und nehme ein paar Tage frei, am Mittwoch oder Donnerstag würde er sich wieder melden.
In der Detektei, wo sie vor zwei Tagen erschienen war, sagte Mia Bischof, sie habe Denning weder am Handy, das die ganze Zeit ausgeschaltet blieb, noch am Festnetz, an das kein Anrufbeantworter angeschlossen war, erreicht und ihn auch nicht zu Hause angetroffen. Zu seiner Wohnung in der Wilramstraße habe sie zwar keinen Schlüssel. Nachbarn hätten ihr aber gesagt, Denning längere Zeit nicht mehr gesehen zu haben. Die Polizei, erzählte Süden seinem Vater, riet ihr das Übliche: Geduld zu bewahren. Da nichts auf einen Suizid oder ein Verbrechen hindeute, nach aktuellem Stand also keine konkrete Gefahr für Leben oder körperliche Unversehrtheit bestehe, könnten die Polizisten nichts unternehmen. Das freie Bestimmungsrecht erlaube es jedem Bürger über achtzehn ohne Ankündigung wegzugehen, abzuhauen, sich aus dem Staub zu machen.
Das brauchte Süden seinem Vater nicht näher zu erläutern. Branko Süden hatte entsprechend gehandelt.
Auf seine Fragen allerdings erhielt Süden keine befriedigende Antwort, auch wenn eine der Krähen seinen Monolog beständig und wichtigtuerisch kommentierte. »Sie lügen alle«, rief Süden ihr zu. Damit meinte er Angehörige, Freunde, Arbeitskollegen, Geliebte, Lebensgefährtinnen, Eheleute. Das plötzliche Verschwinden eines Menschen öffnete nicht selten die Tapetentür zu einer Nebenwelt, die bisher sorgfältig verborgen gehalten wurde und in der jede Person, die nun behauptete, überrascht und erschrocken zu sein, seinen eigenen Winkel, seine mit ureigenem Herzensgerümpel vollgestopfte Truhe besaß.
Wann genau hatten Denning und Mia Bischof sich kennengelernt?, fragte Süden. Vor etwa einem Jahr, meinte die Journalistin. Dagegen war der Taxiunternehmer überzeugt, Denning habe seit mindestens zwei Jahren eine feste Beziehung. Warum hatte Mia bei aller Innigkeit keinen Schlüssel zu Dennings Wohnung? Weil er auch keinen zu ihrer Wohnung bekam? Warum nicht? War Denning wirklich selbstmordgefährdet, wie Mia in der Detektei angedeutet, den Polizisten jedoch verschwiegen hatte, weil sie sich »dafür geschämt« habe? Sie schämte sich, ging aber trotzdem auf ein Revier. Warum? Sie ging davon aus, die Polizei würde auf jeden Fall nach ihrem Freund suchen, weil er doch spurlos verschwunden war.
Naive Menschen, sagte Süden zu seinem Vater, dachten vielleicht so, aber eine aufgeklärte, kluge Journalistin wie die achtunddreißigjährige Mia Bischof? Würde eine Frau wie sie sich vor Polizisten wegen der Depressionen oder anderer seelischer Zustände ihres Partners schämen? Noch dazu, wo sie sich entschlossen hatte, nach Tagen des bangen Wartens die Polizei doch noch einzuschalten? Was stimmte nicht an ihrem Verhalten?
Oder bewertete Süden die Dinge falsch? Das war möglich und ihm als Kommissar schon passiert. Das oberste Gebot lautete, bei einer Vermissung nicht an einen vergleichbaren Fall zu denken. Jede Geschichte eines Verschwundenen war einzigartig und hatte ihre ganz besonderen Ursachen und Zusammenhänge. Die Wahrheit lag oft tiefer unter der Erde als die Asche der Anonymen auf dem Waldfriedhof. Und so wie bei berechtigten Zweifeln an der Todesursache ein Gericht eine Exhumierung anordnen und ein Gerichtsmediziner anorganisches Gift noch in der Asche nachweisen konnte, so grub sich ein erfahrener Ermittler Schicht um Schicht zum Mittelpunkt der Welt hinter der Tapetenwand vor. Was er dort vorfand, stimmte fast nie mit dem überein, was er bereits kannte.
Früher hatte Süden jeden Fall mit größtmöglicher Intensität bearbeitet und war Teil jener geheimen Welt geworden, für deren Ausleuchtung er bezahlt wurde. Das, hatte er sich vorgenommen, wollte er nicht mehr.
Davon erzählte er seinem Vater heute zum ersten Mal. Nüchterner, gelassener, funktionaler wollte er von nun an auftreten und handeln, auch im Stillen, vor sich selbst. Das war, dachte er, zurückgekehrt zum luftigen Altar der kleinen Geschenke, kein bewusster Entschluss gewesen, eher eine Empfindung, die anfing, ihn zu leiten. Er war einverstanden. Eine ungewohnte Ruhe stieg in ihm auf, ein fast beschwingter Atem trug seine Worte über das Feld. Als er, wie bei jedem Abschied von seinem Vater, schon den Arm hob, um zu winken, hielt er inne und schaute den blätterlosen, grauen Strauch an, vor dem er stand. Der Strauch war leer, kein Anhänger, keine Christbaumkugel, kein Lichterkranz. Ohne darüber nachgedacht zu haben, zog Süden den Reißverschluss seiner Lederjacke auf und nahm die Halskette ab, die er trug, seit er dreizehn war. Ein indianischer Schamane hatte ihm das Lederband mit dem blauen Stein geschenkt. In den Stein war ein Adlermotiv geritzt. Bis heute hatte Süden keine Ahnung, woher sein Vater den Medizinmann oder dessen deutsche Freunde gekannt hatte. Sie waren nach Amerika geflogen in der Hoffnung auf eine letzte Chance für die schwerkranke Mutter. Doch sie starb bald nach ihrer Rückkehr. Die Kette und die alte, mit Rentierleder bespannte Trommel aus Lärchenholz, die ihm der Indianer ebenfalls geschenkt hatte, bewahrte Süden trotzdem all die Jahre auf.
Jetzt baumelte das Amulett am trockenen Ast eines dürren, vom Wind zerzausten Strauches, abseits der anderen Geschenke. Süden zog den Reißverschluss seiner Jacke zu, legte den Kopf in den Nacken und schloss die Augen. Er war viel länger auf dem Friedhof geblieben als geplant. Er musste sich beeilen. Seine Kollegin Patrizia wartete in der Detektei auf ihn, während sein Kollege Kreutzer den Auftrag ausführte, um den er ihn am Vormittag gebeten hatte. Im Moment waren sie nur zu dritt, weil die Chefin aus persönlichen Gründen von Montag bis Freitag freigenommen hatte.
Er würde sich nicht hetzen lassen. Er würde bedächtig einen Fuß vor den anderen setzen, ohne innere Nacktheit, gelassen, seinem Alter und seiner Erfahrung entsprechend.
Hätte er ahnen müssen, dass der Fall, von dem er seinem Vater erzählt hatte, ihn durch eine Tapetentür führen würde, hinter der seine Auslöschung bloß eine Frage der Zeit war?
2
Mia Bischof hegte keinen Zweifel an ihrem Leben. Von Kindheit an waren die Werte, die ihr Vater ihr vermittelte, die Grundlagen ihres Denkens und Handelns. Er hatte sie ermutigt und bestärkt in ihren Zielen, schon im Gymnasium, als sie eine mittelmäßige Schülerin war, das Abitur durch strenge Disziplin aber mit einer Durchschnittsnote von 1,9 schaffte.
Obwohl sie ihr Studium abbrach, bekam sie ein Volontariat beim »Tagesanzeiger« und nach zwei Jahren eine Festanstellung als Redakteurin im Lokalteil. Dort arbeitete sie bis heute, geschätzt von den Kollegen, beliebt bei den Lesern. Zu ihrem Vater, der ein Hotel am Starnberger See betrieb – ihre lebendigsten Kindheitserinnerungen spielten auf der großen Terrasse und in der Lobby –, pflegte sie nach wie vor ein enges Verhältnis, trotz der Tatsache, dass sie im Alter von sechs Jahren mit ihrer Mutter nach München gezogen war und ihren Vater in den Jahren danach nur noch selten gesehen hatte. Das änderte sich in ihrer Jugend. Heute besuchte sie die Mutter höchstens vier Mal im Jahr, zum Vater nach Starnberg fuhr sie mindestens einmal im Monat. Außerhalb ihres Berufs engagierte sie sich als ehrenamtliche Schwimmtrainerin für Kinder und half in einer Krabbelgruppe in Neuhausen aus, wo sie wohnte.
Als dieser Mann vor ungefähr einem Jahr in ihrem Leben auftauchte – an das genaue Datum konnte sie sich nicht mehr erinnern, nur an das erste Mal mit ihm im Bett –, fand sie ihn nicht spektakulär genug, um ihm eine Veränderung ihres bisherigen Lebens zuzutrauen. Niemand hatte je Einfluss auf ihr Leben nehmen können. Der einzige Mensch, dem sie es erlaubt hatte, war ihr Vater gewesen. Ihm vertraute sie sich noch immer an, wenn sie wichtige Entscheidungen treffen musste oder an der Welt, die sie umgab, verzweifelte.
Denning – so hieß der Mann, bei dem sie seit sechs Monaten regelmäßig übernachtete – hatte sie gegenüber ihrem Vater noch mit keinem Wort erwähnt. Sie hatte keine Erklärung dafür, was sie ein wenig erstaunte. Sie hatte andere Männer gehabt, mit denen sie nach Starnberg gefahren war, um eine Nacht im Hotel ihres Vaters zu verbringen. Sie war, gerade volljährig, sogar verheiratet gewesen und entschlossen, eine Familie zu gründen, Kinder zu bekommen, eine unzerstörbare Gemeinschaft zu bilden. Dass nichts daraus wurde, lag an ihr, das wusste sie, auch wenn ihr Mann das Gegenteil behauptete und sich selbst die Schuld gab. Lange her und alles vorbei, dachte sie.
Es war nicht vorbei. Dieser sechzehn Jahre ältere Mann mit der rauhen Stimme und den blauen Augen und dem mächtigen, machtvollen Körper löste ein vergessenes Brennen in ihr aus und beschwor Wünsche herauf, die sie so unerbittlich quälten wie sein abruptes, beleidigendes Verschwinden. Sie hätte begreifen müssen – wachsam und schlau, wie sie glaubte zu sein –, dass ihre Hingabe an diesen Mann niemals ausreichen würde, ihr inneres Leben zu ändern, neu zu erschaffen.
Doch Mia Bischof war so ergriffen von der Wahrhaftigkeit ihres Verlangens, dass sie am Morgen des 30. Januar beschloss, eine Detektei, deren Adresse sie aus dem Internet hatte, aufzusuchen und jedes Honorar für die Suche nach ihrem Liebsten zu bezahlen.
Das Ausmaß ihrer Selbsttäuschung hätte sie niemals für möglich gehalten.
3
Hinter dem chaotisch anmutenden Schreibtisch der Chefin saß ein schmächtiger, grau gekleideter alter Mann mit einer Hornbrille aus den sechziger Jahren und kurzen, nach hinten gekämmten graubraunen Haaren. Sein lächelnder Gesichtsausdruck wirkte im Vergleich zu seiner Erscheinung – billige Windjacke, billiges Hemd, billige Hose – geradezu farbig. Leonhard Kreutzer war achtundsechzig, Witwer. Früher betrieb er gemeinsam mit seiner Frau ein gutgehendes Schreibwarengeschäft, das er nach einem Herzinfarkt aufgeben musste. Wenig später verstarb seine Frau, Leonhard Kreutzer zog in einen anderen Stadtteil und begann, die Stunden des Tages zu zählen, und die Minuten der Nacht. Aus der Mitte seiner Einsamkeit entsprang ein Fluss aus Langeweile, von dem er sich treiben ließ, bis er einen Anruf erhielt und zu einer Einweihung eingeladen wurde.
Die Frau, die am Sendlinger-Tor-Platz eine Detektei eröffnete, kannte er noch aus seiner Zeit im Laden, wo sie für ihren Sohn Ingmar Schulsachen und Comic-Hefte kaufte und eine seiner Stammkundinnen war. Nach Ingmars Tod kam sie seltener, manchmal nur, um ein paar Worte zu wechseln. Auf der Beerdigung von Kreutzers Frau hielt sie am offenen Grab eine Zeitlang seine Hand, was er nie vergessen würde. An jenem Geburtstag der Detektei Liebergesell stand er in einem braunen Anzug mit Bügelfalten lange außerhalb des Kreises von Freunden und Bekannten der Gastgeberin, bevor er sich einen Ruck gab und Edith Liebergesell zum offenen Fenster folgte, vor dem sie sich eine Zigarette anzündete – die vierte innerhalb der vergangenen sechzig Minuten, wie er genau beobachtet hatte. Was er ihr vorschlug, schien sie zunächst zu amüsieren. Dann aber hörte sie ihm anders zu, sah ihn lange an, drückte die Zigarette im Glasaschenbecher auf dem Fensterbrett aus, nahm seine Hand, drückte sie fest und sagte: »Auf geht’s, Leo, versuchen wir’s.«
Von diesem Moment an waren sie per Du, und Leonhard Kreutzer hatte einen neuen Job als Detektiv. Aufgrund seines verhuschten Wesens, wie er es nannte, hielt er sich für einen idealen Beschatter, einen aus der grauen Masse, der kein Aufsehen erregte und den später niemand beschreiben könnte. Tatsächlich führte er bald äußerst zielführende Beschattungen durch. Er begann, behutsam zu joggen, um seine Kondition zu verbessern. Er gewöhnte sich sogar – nach wochenlanger, nervenzehrender Pfriemelei und auch eher freudlos und ausschließlich bei heiklen Einsätzen – an das Tragen weicher Kontaktlinsen. Außerdem entpuppte er sich als feinsinniger Zuhörer und geschickter Fragensteller bei Kindsvermissungen, wenn die Eltern sich entweder in Panik oder aus Berechnung um Kopf und Kragen redeten.
Ursprünglich hatte Edith Liebergesell die Idee gehabt, den Arbeitsschwerpunkt der Detektei auf die Suche nach verschwundenen Kindern und Jugendlichen zu legen. Bald musste sie einsehen, dass sie damit nicht überleben konnte. Auch wenn manche verzweifelte Eltern mit der Arbeit der Polizei unzufrieden waren, investierten sie nur widerstrebend fünfundsechzig Euro pro Stunde in einen Detektiv. Eher wandten sie sich übers Internet an private, ehrenamtlich tätige Organisationen. In Einzelfällen reduzierte Edith Liebergesell das Honorar, wohl wissend, dass sie nur sich selbst und ihren Mitarbeitern schadete. Also erweiterte sie ihr Spektrum um die klassischen Aufgaben einer Detektei: Observationen von Personen im Zusammenhang mit Unterhaltsrecht oder Betrugsaffären; Ermittlungen im Umfeld untergetauchter Schuldner oder zwielichtiger Mitarbeiter von Firmen.
Wie Leonhard Kreutzer – nach eigener Aussage »grauester Schattenschleicher« der Stadt – nach wenigen Wochen feststellen musste, unterschieden sich die Auftraggeber oft in einem wesentlichen Aspekt von der Zielperson: Sie waren die größeren Arschgeigen.
Was vor diesem Hintergrund Ermittlungen in Privatsachen betraf, so hatte Kreutzer nicht nur einmal einen Kunden angelogen und ihm erklärt, er habe die gesuchte Ehefrau oder Lebensgefährtin nicht aufgespürt, weil er sie in dem Frauenhaus, wohin sie sich geflüchtet hatte, wesentlich besser aufgehoben fand als zu Hause. Seine Chefin betrachtete diese eigenmächtigen Entscheidungen mit Skepsis, hielt sie für grenzwertig und fast unseriös, unterband sie bisher aber nicht. Dafür verlor Kreutzer kein Wort über den Anblick ihres auf Kunden möglicherweise abschreckend wirkenden Schreibtischs. In seinem Schreibwarenladen, dessen war er sich sicher, wäre eine solche Unordnung schlecht fürs Geschäft gewesen.
Da lagen unzählige Blöcke in diversen Formaten, Akten, Klarsichtfolien, Briefmarken, Kuverts und Muscheln kreuz und quer durcheinander; dazwischen Kastanien, Streichholzschachteln und eine Unmenge von Stiften aller Art, USB-Sticks, Post-it-Aufkleber in bunten Farben, zwei Taschenkalender. In der Mitte ein Laptop, dahinter, mit der Hand schwer zu erreichen, ein rotes Telefon. Und an dem einen Rand des Holztisches stand ein antiker Globus, ebenfalls aus Holz, am anderen Rand eine Bankierslampe aus poliertem Messing mit grünem Glasschirm und quadratischem Fuß – zwei Schmuckstücke in einer absolut unangemessenen Umgebung.
Jedes Mal, wenn die Chefin für längere Zeit außer Haus war oder frei hatte, durfte Kreutzer sich an ihren Tisch setzen und Aufträge annehmen. Voraussetzung war, dass er versprach, allenfalls den einen oder anderen Block, einen Stift, den Laptop und das Telefon zu benutzen und ansonsten die Dinge keinen Millimeter zu verrücken.
Die Detektei befand sich im fünften Stock eines im Jahr 1913 erbauten Hauses an der Ostseite des Sendlinger-Tor-Platzes, über einer Gaststätte und im selben Gebäudekomplex wie die Sendlinger-Tor-Lichtspiele, das älteste Kino der Stadt. Von gegenüber drangen die Glocken der Bischofskirche St. Matthäus herüber, von der sechsspurigen Sonnenstraße das Brummen und Rauschen der Autos und Straßenbahnen.
Ihre Besprechungen hielten die Detektive an einem rechteckigen Tisch vor der Fensterfront ab, der auch zum Schreiben und Recherchieren diente. Dafür standen Kreutzer, Süden und Patrizia Roos zwei weitere Laptops und zwei schnurlose Telefone zur Verfügung. Die vierunddreißgjährige Patrizia mit der akkurat geschnittenen und knapp über den Augenbrauen endenden Ponyfrisur arbeitete zusätzlich drei Tage in einer Szenebar in der Müllerstraße, nicht weit von der Detektei entfernt. Ihr und auch Edith Liebergesells Ziel war, dass sie den Job hinterm Tresen auf maximal zwei Tage in der Woche reduzierte und ansonsten ihr Geld auf Stundenlohnbasis von der Detektei erhielt, wie Leonhard Kreutzer. Für Süden hatte die Chefin ein monatliches Honorar von zweitausend Euro netto festgelegt, plus Bonuszahlungen bei besonders aufwendigen und erfolgreich abgeschlossenen Ermittlungen.
Als ehemaligem Hauptkommissar, Besoldungsgruppe A11, räumte sie ihm diesen Sonderstatus ein, der sich zudem auf seine Tätigkeit bezog: Er kümmerte sich ausschließlich um Vermisste und Verschwundene und durfte, wann immer er es für richtig hielt, von zu Hause aus arbeiten und brauchte nicht an den täglichen Besprechungen teilzunehmen. Er war, wie Edith Liebergesell sagte, »für die Straße und die Zimmer zuständig«. Ihre Süden-Planung hatte sie mit Patrizia und Leo abgesprochen, und beide waren einverstanden gewesen.
Seit Süden regelmäßig in der Detektei auftauchte, hatte Patrizia zu ihrer Überraschung und dann zu ihrem Vergnügen eine Flirtlaune entwickelt, die ihr als ständig beglühter Barfrau leicht vergangen war und nun offensichtlich zu neuer Blüte heranreifte – vor allem, wenn Patrizia Süden dabei erwischte, wie seine Blicke über ihren durchaus dekolletierten und grobmaschig gestrickten Pullover wuselten. Sie hatte eine Vorliebe für solche Pullover und fühlte sich wohl darin. Auf Anweisung der Chefin durfte sie sie bei Ermittlungen außer Haus auf keinen Fall tragen, was sie spießig fand. Aber es war eine der Anweisungen, denen man nicht widersprechen durfte.
Über manche Themen, das hatte Patrizia gleich zu Anfang ihrer Tätigkeit als Teilzeitdetektivin begriffen, konnte man mit der Chefin nicht oder nur sehr einseitig diskutieren – über die Wirkung von Kleidungsstücken, den Nutzen von Diäten, die Gefährlichkeit des Rauchens, Politik im Allgemeinen und die Arbeitsweise bestimmter hiesiger Polizisten im Besonderen. Davon abgesehen, schätzte sie das offene Wort, und Patrizia ließ sich in dieser Hinsicht nicht zweimal bitten. In ihrem Elternhaus zählte die freie Meinungsäußerung zu den Grundregeln im Umgang miteinander und mit wem auch immer.
Und die Zahl derer, die damals einen Blick in ihr Kinderzimmer warfen, einen freundlichen Kommentar abgaben und in die Küche zurückkehrten, um dort mit anderen Fremden weiter zu diskutieren, erschien Patrizia mit jedem Jahr unübersichtlicher. Flur, Wohnzimmer, Küche und Balkon verwandelten sich ständig in einen Marktplatz aus Stimmen von Leuten, die offensichtlich nirgendwo sonst zu Wort kamen. Patrizia vergaß ihre Namen im selben Moment, in dem sie sie hörte. Wenn sie nachts im Bett lag und darüber nachdachte, wer diese langhaarigen und bärtigen Männer und buntgekleideten Frauen mit den vielen Halsketten überhaupt waren, kam manchmal ihre Mutter herein, setzte sich zu ihr und sagte Sätze wie: Wir reden über den gefährlichen Schah und seine Verbündeten, mach dir keine Sorgen. Oder: Der Schah ist ein Verbrecher, aber du brauchst keine Angst zu haben. Oder: Der Schah ist gestorben.
Für die vierjährige Patrizia musste dieser Schah ein Bruder von diesem Strauß sein, den die Erwachsenen auch immer als gefährlichen Verbrecher und schlimmen Menschen bezeichneten. Beim Einkaufen geriet ihre Mutter regelmäßig in Streitereien mit Angestellten oder Kunden, die anscheinend falsche Sachen sagten. Ihre Mutter redete auf sie ein und ließ sich von ihnen beschimpfen, was ihr nichts auszumachen schien. Auf der Straße strich sie ihrer Tochter über den Kopf und meinte nur: Man muss sagen, was man denkt, sonst wird man krank. Diesen Satz, der zu einer Art Mantra ihrer Kindheit und Jugend wurde, hatte Patrizia sich eingeprägt. Als sie, mit fünfzehn oder sechzehn, zum ersten Mal nachts in die Küche stürmte und laut und vernehmlich um absolute Ruhe bat, weil sie nämlich schlafen wolle und ein Recht auf die ungestörte Entwicklung ihrer Persönlichkeit habe, erntete sie grimmige Kommentare und gnädiges Nicken. Ein paar Minuten später kam ihre Mutter ins Zimmer, setzte sich auf die Bettkante, gab ihrer Tochter einen Kuss auf die Stirn und bat im Namen aller um Entschuldigung. Sie fügte jedoch hinzu, dass sie in einem offenen Haus lebten, in dem es halt manchmal turbulent zugehe und die Gäste ihr Herz auf der Zunge trügen. Patrizia war es egal, wo die Leute ihr Herz trugen, Hauptsache, sie hielten ihre Zunge im Zaum.
Das »Haus« war eine Vierzimmerwohnung, in dem jedes Zimmer eine Tür zum Zumachen hatte. So etwas sagte sie aber nicht, weil sie festgestellt hatte, dass ihr das ständige Kommen und Gehen auf eine ihr nicht ganz begreifliche Weise Freude bereitete und sie es im Skilager oder im Sommercamp ziemlich vermisste. Auch hatte sie sich angewöhnt, vor Lehrern in der Klasse und auf dem Pausenhof ungeniert ihre Meinung kundzutun. Je heftiger sie dafür gescholten wurde, desto unerschrockener meldete sie sich zu Wort. Erst in ihrer Funktion als Klassensprecherin und schließlich Schulsprecherin erntete sie uneingeschränktes Lob für ihr offenes, unbestechliches, streitlustiges und konstruktives Auftreten. Als im Lokalteil einer Tageszeitung ein Artikel über sie und ihre mögliche Zukunft als Pädagogin oder Politikerin erschien, stellte sie fest, dass sie – wie sie sich gegenüber einer Freundin ausdrückte –, »null nada Interesse am Wichtigsein« hatte.
Sie ließ sich nichts gefallen, das war alles. Sie hasste es, »wenn wer mit seinen Gefühlen und Gedanken rumtrickst«, und sie stellte so jemanden gern zur Rede. Aber sie verfolgte kein Ziel damit. Sie wollte niemanden belehren oder ändern, sondern bloß »gradraus« sein. Ihr künftiges Leben stellte sie sich in einem überschaubaren Kosmos aus Ehrlichkeit, Gradlinigkeit und entspannter gegenseitiger Befeuerung vor.
Zwar hatte sie ihr Studium abgebrochen (Deutsch, Theaterwissenschaft, Englisch); zwar hielt ihre Verlobung mit einem Schriftsteller nur fünf Monate; zwar hatte sie die Ausbildung zur Hotelkauffrau nach einem Jahr wegen allgemeiner Unentspanntheit und grundsätzlicher Unehrlichkeit einiger Kollegen abgebrochen; und ihre Karriere als DJane und Barfrau hätte sie vielleicht in angesagtere Clubs und in trendigere Städte führen können als ausgerechnet ins Grizzleys in der Münchner Müllerstraße, aber wenn sie heute, mit Mitte dreißig, eine erste Bilanz zog, empfand sie keinen Mangel. Doch die mitternächtliche Begegnung mit der lässig betrunkenen, zielstrebig rauchenden, jeden Anwanzer unaufwendig wegbügelnden Detektivin Edith Liebergesell hatte ihre Vorstellung von einem selbstbestimmten Leben unter Gleichgesinnten auf eine neue, herausfordernde Ebene katapultiert.
Deswegen lautete das Ziel: die Arbeitszeit in der Bar weiter reduzieren, bis die Chance auf eine Anstellung als dauerhaft feste-freie Mitarbeiterin in der Detektei bestand. Im Kreis von Edith Liebergesell, Leonhard Kreutzer und Tabor Süden hätte Patrizia Tag und Nacht observieren, recherchieren und vor Ort ermitteln können, so sehr entsprach diese Gemeinschaft ihrem Nähe-Empfinden. Und wenn Süden, dachte sie, weniger schweigen und sich öfter mal auf einen wilden Disput einlassen würde, hätte sein ungelenkes Flirten eine echte Aussicht auf Erfolg, auch ohne Pullover.
Die Frau mit den Zöpfen, die an diesem Montag hereinkam, hielt sie vom ersten Augenblick an für unaufrichtig, auch wenn sie nicht den geringsten Beweis dafür hatte.
Etwas an der Frau war falsch, dachte Patrizia Roos und warf Süden, der reglos, wie unbeteiligt, mit hinter dem Rücken verschränkten Händen vor der Wand stand, einen Blick zu. Etwas an der Frau wirkte abweisend und kalt.
Ihr Blick erzählte eine andere Geschichte als ihre Stimme, dachte Süden beim Zuhören.
»Sprechen Sie weiter«, sagte Leonhard Kreutzer. »Wollen Sie nicht doch Platz nehmen?«
»Nein«, sagte sie, obwohl sie sich lieber gesetzt hätte. Der an der Wand stehende Mann flößte ihr Unbehagen ein, obwohl sie ihn interessant und fast attraktiv fand. Seit sie den Raum betreten hatte, hatte er noch kein Wort gesprochen. Seinen Namen wusste sie nicht mehr. Der ältere Mann, der sich an der Eingangstür als Stellvertreter der abwesenden Chefin vorgestellt hatte, sah sie die ganze Zeit mitleidig an. Das passte ihr nicht. Und die junge Frau, die sich hinter ihrem Laptop verschanzte, hielt sich für sehr clever, das war Mia Bischof sofort klar gewesen.
Dumme Idee, hierherzukommen, dachte sie. Im Treppenhaus hatte sie noch das Gegenteil gedacht. »Ich bin mir nicht sicher … Wahrscheinlich bin ich bei Ihnen verkehrt.«
Nach einem Moment des Zögerns stand Leonhard Kreutzer auf und kam um den beladenen Schreibtisch herum. Nachdem er die Frau im Flur begrüßt, ins Büro geführt und seinem Kollegen und seiner Kollegin vorgestellt hatte, bat er sie, sich an den langen Tisch zu setzen. Da sie stehen blieb, kehrte er an seinen Platz zurück, weil er Edith Liebergesell dabei beobachtet hatte, dass sie dasselbe tat, wenn ein Gast erst einmal unschlüssig herumstand. »Ihr Bekannter ist verschwunden, und Sie machen sich Sorgen um ihn«, sagte er.
So was hätte ich nicht sagen sollen, dachte Mia Bischof, ich hab einen Fehler gemacht, ich muss wieder weg. Um nicht unhöflich zu erscheinen, sagte sie: »Das ist wahr, aber jetzt denke ich, er will mir nur einen Schrecken einjagen. Manchmal ist er so. Er benimmt sich dann wie ein ungezogenes Kind, das seine Mutter tratzen möchte. Das muss man hinnehmen, das geht vorbei. Ich war voreilig, entschuldigen Sie, ich möchte Ihnen nicht Ihre Zeit stehlen. Und ich muss auch zur Arbeit.«
Was war los mit dieser Frau?, dachte Patrizia Roos. Was wollte sie wirklich hier?
»Wo arbeiten Sie?«, fragte Kreutzer.
»Ich bin Redakteurin beim Tagesanzeiger.« Sie bemerkte, dass jeder im Raum sie ansah, und zupfte an ihrer karierten Wollmütze, aus der zwei geflochtene Zöpfe herausragten. Dann herrschte Schweigen. Nur die Geräusche der Straße waren gedämpft zu hören. Der Fehler, den sie aus Gründen begangen hatte, die ihr gerade völlig rätselhaft waren, machte sie allmählich wütend. Eine Stimme riss sie aus ihren Gedanken.
»Sie haben uns noch nicht gesagt, wie der Mann heißt, den Sie vermissen.«
Der Mann an der Wand. Sie schaute zu ihm hin. Weißes Hemd, schwarze Jeans, Bauch, schlecht rasiert, Halskette mit blauem Stein, fast schulterlange Haare, ein Einzelgänger. Sie hatte einen Kollegen, der ähnlich aussah, allerdings redete der mehr, von morgens bis abends, am liebsten über Lokalpolitik und Klatschgeschichten. Der Mann an der Wand schien ihr unberechenbar, wie einer, mit dem man rechnen musste, wenn man mit niemandem rechnete. »Er wird schon wiederkommen«, sagte sie zu ihm und wandte sich um. Bevor sie die Tür erreichte, war Süden neben ihr. Sie erschrak, wich einen Schritt zur Seite und stieß mit dem Knie gegen den schmiedeeisernen Schirmständer.
»Haben Sie sich weh getan?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Ich bin Tabor Süden und werde Ihren Freund finden.«
Er sprach ruhig und freundlich, mit einer wohlklingenden Stimme. Und doch jagte etwas an seiner Art ihr einen solchen Schrecken ein, dass sie für einige Sekunden überzeugt war, er wüsste über sie Bescheid und würde im nächsten Moment ihr Lebenswerk zunichtemachen.
4
Vor der Polizei, sagte Mia Bischof, habe sie ihn in kein schlechtes Licht rücken wollen. »Wenn man von jemandem behauptet, er will sich womöglich was antun, schauen alle schief und machen einen gleich dafür verantwortlich. Das wollt ich vermeiden.«
»Jetzt wollen Sie es nicht mehr vermeiden«, sagte Süden. Nachdem er die Frau dazu gebracht hatte, sich auf der Fensterseite an den Tisch zu setzen, hatte er ihr gegenüber Platz genommen, neben Patrizia.
Kreutzer saß hoch konzentriert an Ediths Schreibtisch, Blick zur Tür, und schrieb mit einem frisch gespitzten, nur acht Zentimeter langen Bleistift Notizen auf einen linierten DIN-A4-Block, Zeile um Zeile, in einer schwungvollen, klaren Handschrift. Er vermerkte auch die Pausen und Ticks der Klientin, wenn sie zum wiederholten Mal am halb geöffneten Reißverschluss ihrer Daunenjacke nestelte oder an ihrer Mütze zupfte, die sie nicht abgenommen hatte. Ansonsten hielt sie die Hände im Schoß.
Unter der grauen Daunenjacke trug sie einen schwarzen Rollkragenpullover und dazu einen knöchellangen schwarzen Wollrock. Zu ihren blonden Haaren und dem blassen, beinahe wächsernen Gesicht bildeten ihre dunklen Augen einen auffallenden Kontrast. Ihre Gesten wirkten nervös und gleichzeitig kontrolliert. Sie schien tatsächlich Angst um ihren Freund oder Liebhaber oder Lebensgefährten zu haben, verwandte jedoch eine enorme Anstrengung darauf, ihre Empfindungen unter Verschluss zu halten – ähnlich wie Süden, was dessen Irritation betraf.
»Entschuldigung?«, sagte Mia Bischof.
»Sie halten es für möglich, dass sich Ihr Lebensgefährte etwas antun will.«
»Ich weiß nicht … mein Lebensgefährte … Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann. Er ist mein Freund, das schon.«
»Er ist Ihnen sehr wichtig.«
»Ja, natürlich, sonst wär ich ja … Wir kennen uns erst seit … ich weiß nicht genau … seit einem Jahr. Ist das wichtig?«
»Nein«, sagte Süden. »Er ist seit letztem Sonntag verschwunden.«
Kreutzer schrieb »Sonntag, 22. Januar« auf seinen Block, hielt inne, die Bleistiftspitze zwei Zentimeter über dem Papier, wartete auf genauere Angaben. Doch Mia nickte nur, warf Patrizia einen flüchtigen, abschätzigen Blick zu und zog den Reißverschluss ihrer Jacke wieder ein Stück höher. Draußen waren es drei Grad minus, hier drin mindestens zwanzig Grad plus. Ob Mia fror, war nicht zu erkennen. Vielleicht, dachte Patrizia, brauchte sie einen Panzer um sich.
Süden beugte sich über den Tisch, was einen unmerklichen Ruck in Mia auslöste. »Ihr Freund musste zur Arbeit, er hatte Nachtschicht als Taxifahrer.« Mia schaute ihn an, weiter nichts, die Hände im Schoß, mit reglosen Augen. »Und jetzt möchte ich gern seinen Namen erfahren.«
»Denning, Siegfried.« Eine tonlose, seltsam unbeteiligt klingende Stimme.
»Siegfried Denning«, wiederholte Kreutzer und notierte den Namen. »Wie alt?« Den Handballen aufgestützt, blieb er in Schreibstellung. Süden warf ihm ein unsichtbares Lächeln zu.
»Entschuldigung?«
»Das Alter Ihres Freundes«, sagte Kreutzer.
»Er war … er ist … ich weiß nicht … Er ist fünfzig, Anfang fünfzig.«
»Sie wissen es nicht genau.«
»Doch, er ist … vierundfünfzig.«
»Vierundfünfzig«, sagte Kreutzer und schrieb.
Süden entging nicht, dass Patrizia die Fäuste gegen ihren Laptop drückte, um mit ihrer Ungeduld fertig zu werden. Er wusste, dass sie andere, härtere Fragen gestellt und die Frau entweder zu einer eindeutigen und überzeugenden Erklärung gezwungen oder sie längst vor die Tür gesetzt hätte. Mit zusammengepressten Lippen brummte sie leise in sich hinein, zwischendurch trommelte sie mit den Fingern auf den Computer.
Bei Süden dagegen führte das unentschlossene, anstrengende Verhalten der Besucherin zu einer speziellen Form von Gelassenheit, die er von sich nicht kannte. Früher hatte er mit einem Übermaß an Ruhe und Geduld Befragungen durchgeführt, hatte sein Schweigen ebenso mit wichtigen Informationen gefüllt wie mit belanglosen Abschweifungen. Schließlich hatte er seine gesammelten Puzzlestücke zum Bild eines Zimmers zusammengefügt, in dem der beredte Schatten eines Verschwundenen hauste, der ihn vielleicht ans Ziel führte. Dieses Ziel bedeutete das Auffinden, nicht zwangsläufig das Zurückbegleiten des Gesuchten, wenn dieser an seinem neuen, selbsterfundenen Ort wieder zu atmen lernte oder wenigstens zu lächeln. Die Freiheit aufzubrechen hieß für Süden immer auch die Freiheit zu bleiben.
Jetzt, stellte er fest, hörte er zu, durchaus geduldig und konzentriert, aber in guter Distanz, wie es sich für einen professionellen Ermittler gehörte. Er dachte mehr an die materielle Seite des Auftrags als an alles andere. Mia Bischof war im besten Fall eine Klientin, deren Auftrag erfolgreich zu Ende gebracht werden musste, und nicht eine weitere Bewohnerin jener Verliese, mit deren Ausleuchtung Süden sein halbes Leben verbracht hatte.
Er lehnte sich zurück und sagte: »Beschreiben Sie die Anzeichen seiner Veränderung, Frau Bischof.«
Wieder antwortete sie sofort, tonlos wie zuvor. »Er war irgendwie anders als sonst. Er hat keine Antworten mehr gegeben. Ich habe ihn gelassen, ich bin nicht so eine Frau, die einem Mann vorschreibt, was er tun und sagen soll. Ich akzeptiere den Mann, wie er ist. So bin ich, und das ist auch richtig. Er war nicht gewalttätig, er war nie gewalttätig, nie, seit ich ihn kenne. Was ich meine, ist, er ist still gewesen, das war’s, was mir aufgefallen ist. Das können Sie ruhig aufschreiben. Still war er und hat verängstigt gewirkt. Das war ungewöhnlich, denn er ist kein ängstlicher Mann, er ist mutig. Und dann war sein Handy aus, und bei ihm zu Hause war auch niemand. Einen Anrufbeantworter hat er nicht, eine Mailbox schon. Ausgeschaltet. Seinen Chef, den Griechen, habe ich natürlich angerufen, das wollte ich schon genau wissen. Der Grieche sagte, Siegfried sei krank, kommt erst Ende der Woche wieder. Das kann nicht stimmen. Deswegen bin ich zur Polizei gegangen, aber sie haben mich weggeschickt, er sei erwachsen, er könne tun, was er will. Das stimmt, ich gebe den Polizisten recht. Aber dass er so still geworden ist, hat mich beunruhigt. Deswegen sitze ich jetzt wohl hier. Seine Adresse und seinen Arbeitgeber habe ich Ihnen auf einen Zettel geschrieben. Wenn Sie Siegfried finden, wäre ich Ihnen wirklich dankbar.«
Nach Tausenden von Vermissungen, die er bearbeitet hatte, konnte Süden sich an keinen vergleichbaren Satz eines besorgten Angehörigen oder Freundes erinnern. »… wär ich Ihnen wirklich dankbar.« Kreutzer und Patrizia sahen ihn an, als erwarteten sie eine Erklärung. Er sagte: »Wir verlangen fünfundsechzig Euro in der Stunde und einen Euro Kilometerpauschale.«
»Das hat mir Ihr Kollege am Telefon gesagt. Muss ich eine Anzahlung machen?«
»Sie müssen erst einmal nur den Vertrag unterschreiben.«
Kreutzer schlug das Blatt um, das er gerade beschrieben hatte, und legte den Bleistift parallel daneben. Dann zog er, ohne das darüberliegende Branchenbuch wegzunehmen, eine Vertragskopie aus der Plastikablage auf dem Schreibtisch.
»Und wenn Sie Siegfried nicht finden, muss ich trotzdem zahlen«, sagte Mia Bischof.
»Ja.« Wenigstens ein winziges Wort musste Patrizia von sich geben, mit angemessener Betonung und dem unüberhörbaren Unterton: Was denn sonst? Ihre Hände klebten am Laptop, ihre Daumen trommelten wieder. Nichts davon schien Mia Bischof zu bemerken. Der Reißverschluss ihrer Jacke hatte sich im Futter verklemmt, sie zerrte daran herum, bis sie ihn mit einer heftigen Bewegung nach unten zog und sofort wieder nach oben. Wie Süden und Patrizia feststellten, hatte sie eine Zahl auf ihren Pullover gestickt. Unabhängig voneinander waren beide überzeugt, dass Mia den Pullover, wie auch die Mütze, selbst gestrickt haben musste. Garantiert hatte sie ein Faible für Handarbeiten. Woher sie das zu wissen glaubten, hätten die Detektive nicht sagen können.
Sie hatten recht, wie sich später herausstellen sollte.
Welche Zahl auf dem Pullover stand, konnten sie auf die Schnelle nicht sehen, möglicherweise eine weiße Zwei. Erstaunlich fanden sie, dass die Journalistin nicht schwitzte, jedenfalls hatte sie keine Schweißperlen auf der Stirn und kein gerötetes Gesicht, im Gegenteil: Ihre Wangen schienen im Lauf der vergangenen dreißig Minuten noch bleicher geworden zu sein.
»Die Vermisstenanzeige haben Sie auf der Inspektion in Ihrem Viertel aufgegeben«, sagte Süden unvermittelt.
»Nein«, erwiderte sie sofort. »Keine Vermisstenanzeige, die Polizisten meinten, ich solle abwarten. Ich habe keine Anzeige gemacht. Die Beamten würden doch sowieso nicht suchen.«
Süden sah ihr zu, wie sie den Vertrag ausfüllte. »Sie wohnen in Neuhausen.«
Mia nickte und unterschrieb den Vertrag.
»Sie haben die Telefonnummer vergessen«, sagte Kreutzer, der aufgestanden und zum Besuchertisch gegangen war.
»Entschuldigung. Ich schreibe die Nummer meiner Redaktion hin, da bin ich am besten zu erreichen.«
»Abends auch?« Patrizia platzte fast vor nicht gesagten Worten.
»Abends nicht, abends bin ich zu Hause oder bei Freunden im Kreis.«
»Bitte auch Ihre Privatnummer«, sagte Kreutzer. »Am besten Ihre Handynummer.«
»Ein Handy habe ich nicht.«
»Sie haben kein Handy?«
»Nein.«
»Sie sind doch Journalistin«, sagte Kreutzer. »Brauchen Sie in Ihrem Beruf keines?«
»In der Arbeit benutze ich ein Diensthandy, das ist erlaubt, und das reicht auch. Meine Freunde und ich treffen uns lieber persönlich.«
Was meinte sie damit?, dachte Süden und sagte: »Sie haben mit Ihren Freunden über das Verschwinden Ihres Partners gesprochen.«
»Nein. Mit niemandem. Nur mit Ihnen. Und das ist auch richtig so.«
Auch zwei Minuten nachdem die Frau die Detektei verlassen hatte, herrschte noch Schweigen im Raum. Jeder blickte zur Tür und auf den in der Mitte des Tisches liegenden Vertrag und wieder zur Tür, und keiner wusste, was er denken sollte.
5
Auf dem Weg in die Redaktion hätte sie gern ihre Freundin Isabel angerufen. Sie wollte ihr berichten, was passiert war und was sie getan hatte. Jedes Mal, wenn sie vor einer Telefonsäule stehen blieb, fürchtete sie sich so, dass sie weiterging. Das war keine konkrete Furcht – vor der vielleicht erbosten Reaktion ihrer Freundin, immerhin hatte sie ihr eine Woche lang nichts von Siegfrieds Verschwinden und ihren schlimmen Gedanken erzählt –, es war mehr dieses Rumoren in ihrem Bauch, ein Gemisch aus dumpfen Ahnungen und wüsten Erinnerungen, von denen sie überzeugt war, sie wären längst und für alle Zeit verschüttgegangen.
Ihre Begegnung mit Siegfried hatte sie leichtsinnig gemacht, und das durfte sie nicht zulassen. Was sie gerade getan hatte, war so dumm, dass Karl sie dafür halb totprügeln würde. Karl, der aus der Versenkung aufgetaucht war und sich benommen hatte, als hätte er noch Rechte bei ihr. Dabei waren diese Rechte seit mindestens zehn Jahren ungültig. Darüber hatte sie mit Isabel gesprochen, und ihre Freundin hatte sie ermutigt, stark zu bleiben.
Ich bin stark, dachte Mia Bischof, während sie durchs Leutegewühl im Stachus-Untergeschoss mit den Geschäften und Imbissbuden ging und niemandem auswich. Ich lasse mich nicht einschüchtern und rumschubsen, dachte sie, wie um sich selbst anzufeuern. Auf der Rolltreppe stieg sie, die Hände in den Jackentaschen und mit breitem Rücken, an den Stehenden vorbei nach oben und rempelte jeden an, der sich nicht rechtzeitig zur Seite drehte.
In der Fußgängerzone der Schützenstraße geriet sie außer Atem und blieb keuchend stehen. Wegen Karl, dachte sie. Wegen ihm und niemandem sonst hatte sie die aberwitzige Entscheidung getroffen. Nur wegen ihm war alles so weit gekommen, dass sie fast die Kontrolle verlor. Und dass ihr Unbehagen nicht nachließ. Und die elende Sehnsucht, die ihr nicht passte und sie von tief innen her fester umklammerte, je heftiger sie sich dagegen wehrte.
Wenn ihr Ex-Mann von dem Auftrag an die Detektei erfuhr, würde er sie totprügeln, dachte sie. Nicht halb tot, sondern tot. Er hatte sich nicht verändert, wozu denn auch? Aber sie? Wozu hatte sie sich geändert?
Vor der Eingangstür ihrer Zeitung in der Augustenstraße fragte sie sich, ob sie einem Hirngespinst nachhing, einer blöden Einbildung. Im Aufzug zum zweiten Stock überlegte sie, den Auftrag zu stornieren, jetzt sofort, und danach Siegfried Denning zu vergessen – egal, was mit ihm passiert und wer dafür verantwortlich sein mochte. Sie wollte sich nicht wie ein aufgescheuchtes Huhn benehmen, wie ein Mädel ohne Rückgrat und Verstand, wie ein Anhängsel falscher Gefühle.
»Eine Detektei Liebergesell hat angerufen«, sagte Eva, die Assistentin der Lokalredaktion. »Sie wollten wissen, ob du bei uns arbeitest. Was wollen die von dir?«
»Ich mache eine Geschichte über die«, sagte Mia Bischof im Vorbeigehen. Dass die Detektei ihre Angaben überprüfte, amüsierte sie. Im Gegensatz zu ihrem Ex führte sie ein zu hundert Prozent legales Leben, anständig und unangreifbar.
Im Sinne der Chefin seien solche Kontrollanrufe nicht, meinte Leonhard Kreutzer. Patrizia hob halb entschuldigend die Hand und tippte an ihrem Protokoll weiter, das von einer Ehefrau handelte, die der vermögende Ehemann des Ehebruchs beschuldigte. Patrizia hatte die Frau vier Tage lang observiert, und schon nach dem ersten Tag war klar, dass der Verdacht des Mannes zutraf. In der Mittagspause oder nach Dienstende in der Kanzlei, wo sie als Sekretärin arbeitete, traf die Frau einen älteren Mann in einem kleinen Hotel am Englischen Garten. Es gelang Patrizia, zwei Fotos der beiden zu schießen, als sie sich innig verabschiedeten und küssten. Noch während sie dem Auftraggeber, dem Inhaber einer Modeboutique in der Theatinerstraße, über ihre Beobachtungen in dessen Büro Bericht erstattete, begann er, mit ihr zu flirten. Als erfahrene Barfrau erwiderte sie seine Blicke und sein Charmieren auf eine Weise, die er für echt hielt. Sie nahm seine Einladung zu einem Vorabenddrink an, die sie dann zwei Stunden vorher aus Termingründen absagen musste.
Nichts Neues für die junge Detektivin, und so schrieb sie an ihrem Bericht weiter und ignorierte so gut wie möglich Kreutzers Telefonate. Er war hinter einem Mann aus Augsburg her, der vor den Unterhaltszahlungen an seinen vierjährigen Sohn und seine Ex-Freundin davonlief, angeblich zu Bekannten nach München gezogen war und in einem Lokal als Koch arbeitete. Kreutzer hatte begriffen, dass er angelogen und bewusst in die Irre geführt wurde, doch meist unterschätzten die Leute seine Zähigkeit. Sie verwechselten sein freundliches, unscheinbares Gebaren mit altersbedingter Trotteligkeit. Auf genau den Eindruck legte er absoluten Wert.
Unterdessen hatte Süden herausgefunden, dass der Taxifahrer Denning seit knapp drei Jahren für das Taxiunternehmen Leonidis in der Belgradstraße im Einsatz war. Wie dessen Chef, Jannis Leonidis, weiter erklärte, habe Denning nach eigener Aussage jahrelang ein Bekleidungsgeschäft mit Secondhand-Ware in Trudering betrieben, bis er pleiteging und nach einem neuen Job Ausschau hielt.
»Spitzenfahrer«, sagte Leonidis. »Ein Talent. Nie Probleme.« Am vergangenen Sonntag habe Denning ihn angerufen und ihm mitgeteilt, er habe die Grippe und falle zwei bis drei Tage aus. Daraufhin meldete Denning sich die ganze Woche nicht mehr. »Geht nicht so, hab telefoniert, niemand da, kein AB, nichts. Was soll ich machen?«
»Seinen Wagen hat er nicht mitgenommen«, sagte Süden.
»Der Wagen steht im Hof, wie immer. Denning hat kein eigenes Auto, er wollte keins. Was ist passiert, Herr Kommissar?«
»Ich bin Detektiv. Ihre anderen Mitarbeiter haben auch keine Ahnung, wo er sein könnte.«
»Nein.« Leonidis stand von seinem kleinen Schreibtisch auf, breitete die Arme aus und setzte sich wieder. Er schüttelte den Kopf und zeigte mit der flachen Hand auf den vor ihm liegenden, aufgeklappten Kalender. »Nix wissen die, und ich kann meine Aufträge nicht erfüllen. Er ist entlassen, fristlos, tut mir leid. Sehr guter Fahrer, lässt uns alle hängen. So was geht bei mir nicht, wir sind hier in einer zuverlässigen Stadt.«
Da außer dem Chef kein weiterer Mitarbeiter zu sprechen war, bestellte Süden bei Leonidis ein Taxi, mit dem er ans andere Ende der Stadt fahren wollte, zu Dennings Wohnung in der Wilramstraße. Auch als Hauptkommissar hatte Süden oft ein Taxi als Dienstfahrzeug benutzt, auf eigene Kosten und aus einer reinen Laune heraus. Von der Rückbank aus, hinter dem Beifahrersitz, verfolgte er die Gesichter seiner Stadt, staunte über vieles und wunderte sich über immer weniger. Er glitt, so stellte er sich vor, am Rand der Zeit entlang, ein unauffällig Vorüberhuschender inmitten des allgemeinen Geschehens; ein geselliger Einzelgänger, der das Schweigen der Verschwundenen mit seinem eigenen synchronisierte.
»Alles in Ordnung bei Ihnen?«, fragte der Taxifahrer.
»Sie kennen Ihren Kollegen Denning.«
»Mäßig.«
»Beschreiben Sie ihn.«
»Wie jetzt, körperlich?«
»Wie Sie möchten.«
»Kräftiger Typ, den macht keiner in der Nacht an. Kurze Haare, schwerer Kopf.«
»Was ist ein schwerer Kopf?«
Der Fahrer sah in den Rückspiegel, grinste. »Schwer halt, fällt auf, ernste Miene. Blaue Augen, glaub ich, bin mir jetzt nicht sicher. Redet nicht gern, wie Sie. Ansonsten? Soll mal einen Laden gehabt haben, Klamotten. Kann man sich kaum vorstellen, das ist nicht der Typ dafür, für einen Verkäufer. Man täuscht sich schnell. Da steigt ein Gast ein, und du denkst: Der macht Ärger, pass besser auf, fünfhundert Meter weiter merkst du: entspannter Typ, gut drauf, will sich amüsieren.«
»Was können Sie noch über Denning sagen?«
»Wir haben nicht oft geredet. Der neigt zu etwas merkwürdigen Ansichten, bei so was klink ich mich aus, interessiert mich nicht: Politik.«
»Sie teilen seine politischen Ansichten nicht.«
»So gut kenn ich die auch wieder nicht. Ein paarmal hat er ziemlich abgelästert über Ausländer und Schnorrer und solche. Die will er am liebsten alle nach Hause schicken, Anatolien oder so. Gut, dass der Chef das nicht mitgekriegt hat.«
»Er ist ein Rechter«, sagte Süden.
»Er sieht jedenfalls nicht so aus. Ich will ihn nicht in eine Ecke stellen, wirklich nicht. Ich bieg hier illegal links ab, sonst muss ich einen ewigen Bogen fahren.«
Beim Aussteigen sagte Süden: »Glauben Sie, Denning ist Mitglied in einer Partei?«
»Das weiß ich nicht. Wer geht heut schon freiwillig in eine Partei? Nur Fanatiker, sonst doch niemand.«
Süden stand vor einer Siedlung aus langgestreckten grauen und beigen Sozialbauten aus den sechziger Jahren, die meisten zweistöckig, schmucklos mit alten Rollos an den kleinen Fenstern, Hunderte von Wohnungen. Zwischen den Häusern waren geteerte Wege, zwischen den Wegen Grünflächen mit Bäumen. Ein weitläufiger Block wie viele im Osten der Stadt, dessen Mieter hinter einer Fassade aus Anonymität verschwanden.
Der Eingang zum Haus Nummer 27