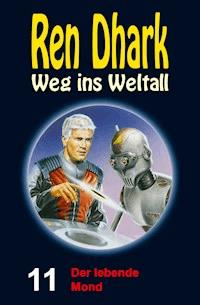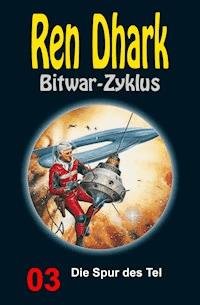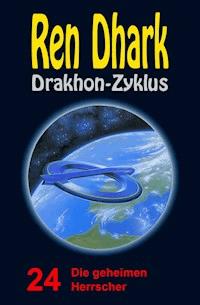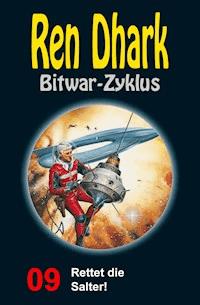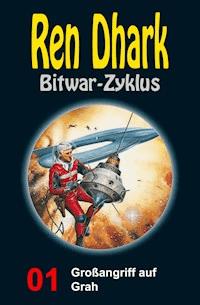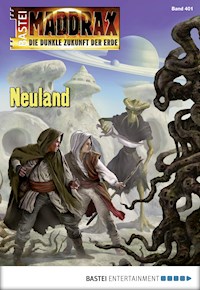1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Maddrax
- Sprache: Deutsch
Während die Dark Force die Suche nach der PLASMA und der RIVERSIDE eingestellt hat, geben die Daa'muren Grao und Ira nicht auf. Abgesetzt an der Nordostküste Amrakas, suchen sie nach einer Spur, die sie zu den verschollenen Freunden Matt und Aruula führt. Und tatsächlich glauben sie einen Hinweis gefunden zu haben, dem sie nachgehen - geradewegs in ein tödliches Abenteuer!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Was bisher geschah...
Der Weg der Daa'muren
Leserseite
Vorschau
Impressum
Am 8. Februar 2012 hält ein gewaltiger Komet Kurs auf die Erde! Man beschießt ihn mit Atomraketen. Drei Stratosphärenjets sollen die Auswirkung beobachten. Commander der Staffel ist der US-Pilot Matthew Drax. Doch die Raketen verpuffen auf dem Himmelskörper, von dem eine unbekannte Strahlung ausgeht. »Christopher-Floyd« schlägt in Asien ein. Die Druckwelle trifft auch die drei Jets und fegt sie davon...
Als Matthew und sein wissenschaftlicher Copilot Professor Dr. Jacob Smythe aus einer Ohnmacht erwachen, trudelt ihr Jet auf die Alpen zu! Smythe gelingt der Ausstieg per Schleudersitz. Matt kann die Maschine abfangen und notlanden. Er wird von Barbaren gefunden, die ihn als Gott ansehen und »Maddrax« nennen. Statt einer verwüsteten Erde sieht Matt sich fremdartigen Lebewesen und Pflanzen in einer veränderten Geografie gegenüber. Was er nicht ahnt: Die Druckwelle hat die Fliegerstaffel durch einen Zeitstrahl um 520 Jahre in die Zukunft geschleudert. Dieser Strahl, der seit Urzeiten vom Mars zur Erde reicht, sicherte vor 4,5 Milliarden Jahren den Marsbewohnern, den Hydree, das Überleben. Der vermeintliche Komet war die Arche einer Wesenheit namens »Wandler«, deren Dienerrasse, die Daa'muren, sich die Erde untertan machen will, indem sie Fauna und Fauna mutieren und die Menschen verdummen lässt. Nur die Bunkermenschen, sogenannte Technos, bewahren sich ihr Wissen, büßen dafür aber über die Jahrhunderte ihr Immunsystem ein.
Zusammen mit Aruula, einer telepathisch begabten Kriegerin, beginnt Matt Drax seinen Feldzug. Er findet Freunde – unter anderem die Hydriten, die sich aus den Hydree entwickelt haben und in den Meerestiefen leben –, kämpft gegen die Daa'muren und gerät an Schurken, allen voran Jacob Smythe, der wahnsinnig wurde und die Weltherrschaft anstrebt, bis Matt ihn am Ende unschädlich macht. Auch Smythes Zwilling aus einem Parallelwelt-Areal stirbt, während seine Freundin Haaley, ebenso verrückt wie er, entkommt. Diese Areale, die überall auf der Erde aufbrechen, sind das Ergebnis von Zeitreisen, die die Menschen einer fernen Zukunft unternahmen, um technische Artefakte zu sammeln. Matt und seine Verbündeten – zu denen sogar zwei Daa'muren zählen, Grao'sil'aana und Gal'hal'ira – können alle schließen, wobei ihnen GRÜN, eine Art Pflanzenbewusstsein der Erde, zur Seite steht.
Auch Colonel Aran Kormak stammt aus einer dieser Parallelwelten – zumindest will er Matt dies weismachen. In Wahrheit ist er sein skrupelloser Zwilling aus dieser Welt, von dem Matt glaubt, er wäre tot. Doch Kormak, Befehlshaber einer Elitetruppe namens Dark Force, die aus dem Weltrat in Waashton (Washington) hervorging, scheint sich zu besinnen und verbündet sich mit Matt, als eine neue Bedrohung auftaucht.
Denn kaum ist das letzte Areal in Afrika versiegelt, wobei GRÜN beinahe vernichtet wird, sehen sich die Gefährten einer kosmischen Bedrohung namens »Streiter« gegenüber, die noch immer den Wandler auf der Erde vermutet. In einem furiosen Endkampf gelingt es Matt, sie zu versteinern.
Doch die Freude währt nur kurz, als Aruula mit dem Gleiter RIVERSIDE verschwindet. Matt und ein Dark-Force-Trupp folgen ihr mit der PLASMA, einem gekaperten außerirdischen Raumschiff, bis nach Südamerika. Über Peru stürzen sie wegen plötzlichen Energieverlusts ab und finden die havarierte RIVERSIDE. Von Aruula keine Spur! Dafür entdeckt Matt das Wrack eines Flugzeugträgers mitten im Dschungel – und eine blinde Passagierin, die mit nach Amraka kam: Haaley.
Matt schleicht sich auf die USS Nimitz und trifft dort auf eine feindlich gesinnte Mannschaft und einen gewaltigen roten Diamanten. In der Zwischenzeit wird seine Truppe von mysteriösen Gegnern dezimiert, und Matt ist sich nicht sicher, ob nicht Haaley dahintersteckt. Die letzte Dark-Force-Soldatin stirbt beim Kampf gegen einen mutierten Jaguar, kann ihn aber erlegen – ein heiliges Tier, wie Matt und Haaley erfahren, als sie von Eingeborenen überwältigt werden. Zusammen mit einer Frau von der Nimitz warten sie auf den Tod, denn auch die Fremden sind Feinde der Indios, seit sie deren Heiligtümer, zwei rote Diamanten, raubten.
Sie versuchen zu fliehen, doch nur die Fremde entkommt. Matt und Haaley müssen eine Götterprobe bestehen: den »Spiegel von Pachacámac«, mit dem sich weitere Diamanten herstellen lassen, aus einer Todeszone zu bergen – was ihnen auch gelingt. Sie werden freigelassen und beobachten den Angriff eines Ameisenvolks auf die Nimitz. Bei der Kontaktaufnahme mit einem Indiostamm, der den Schwarm kontrollieren soll, stellen sie fest, dass das Gegenteil der Fall ist: Mabuta, der »vielbeinige Gott«, nimmt sie gefangen. Dabei stellt sich heraus, dass Haaley – wie Aruula – vom Volk der Dreizehn Inseln abstammt und latent telepathisch begabt ist, was die Kommunikation mit Mabuta erleichtert. Der wird von einem Pilzgeflecht bedroht, und Matt soll ein Mittel dagegen finden. Auf der Suche nach einem Fungizid fährt er los, Richtung Bogotá, und gerät in ein mörderisches Spiel, mit dem ein Krieg um Öl entschieden werden soll. Dabei lernt er Tschoosch Claansman kennen, der früher als Chemiker bei einem Drogenbaron gearbeitet hat und ihn weiter begleitet. Er hilft ihm, in Med'liin eine Ladung Fungizid zu stehlen.
Mit dem Amphibienpanzer PROTO und einem Lkw schaffen sie das Gift in Mabutas Dorf, wo sie es mit dem Regen verteilen, was das Pilzgeflecht in dieser Region abtötet. Zum Dank bringt der »Ameisengott« Matt und Haaley auf die Nimitz, wo sie als Aants vergeblich nach Aruula suchen, aber von einem bevorstehenden Angriff der Soldaten auf Mabuta erfahren... bevor sie in verschiedenen Tieren fliehen müssen, um in ihre Originalkörper zurückzukehren. Doch die befinden sich inzwischen in der Gewalt Dak'kars, dessen Soldaten viele Ameisen töten konnten, letztlich aber zurückgeschlagen wurden.
Mabuta versetzt Matt und Haaley unter einer Bedingung zurück in ihre Körper: Sie sollen Dak'kar töten! Doch Matt verbündet sich mit ihm, um mit Dak'kars Hilfe zu dem Pilz in der Todeszone vorzustoßen, den er für intelligent und telepathisch begabt hält und der mehr über Aruulas Verbleib wissen könnte. Dafür will er Dak'kar die Formel vom »Spiegel von Pachacámac« verschaffen, mit der weitere rote Diamanten hergestellt werden können. Denn die braucht Dak'kar, um seine heimatliche Community in Macapá, Brasilien, zu retten, in der künstliche Lymphozyten, die eigentlich die Immunschwäche der Ex-Technos heilen sollten, zu einer tödlichen Krankheit führten. Die Strahlung der Diamanten kann diese Lymphozyten abschalten.
Um Mabuta zu täuschen, der durch Haaleys Geist alles beobachtet, ersinnen sie einen Plan, um Dak'kars Tod vorzutäuschen. Er gelingt auch – bis der Anführer der Nimitz-Leute, von den anderen getrennt, in eine Fallgrube stürzt.
Derweil gab es bereits eine Rettungsmission der Dark Force, die aber aufgrund des riesigen Gebiets eingestellt werden musste. Nur die Daa'muren Grao und Ira sind an der brasilianischen Küste verblieben und versuchen weiter, eine Spur der beiden Freunde zu finden...
Der Weg der Daa'muren
von Jo Zybell
Noch waren Ozean und Himmel schwarz wie Teer. Wo hörte der eine auf, wo fing der andere an? Der Bootsjunge beugte sich aus dem Krähennest, blinzelte nach Osten. Nichts zu sehen, kein noch so schwacher Glanz. »Komm endlich, Morgenlicht!« Er tat alles, was er konnte, um wach zu bleiben – drehte sich im Kreis, kniff sich ins Ohr, sprang auf und ab. Doch nicht zu laut, sonst würden die Männer tief unter ihm auf Deck ja merken, dass er mit dem Schlaf kämpfte.
Plötzlich riss der Himmel auf, und eine schartige Mondsichel streute karges Licht auf die Welt. Der Bootsjunge starrte atemlos – stülpten sich da nicht bogenförmige Umrisse aus den Wellen? Schon schlossen die Wolken sich; alles war wieder schwarz. Nur eine dunkle Ahnung blieb. Und machte, dass sein Herz schneller schlug.
Der Bootsjunge schaute nach unten. Im Licht schaukelnder Öllampen schlachteten sie dort die gefangenen Fische. »Mal herhören!«, rief er. »Ich glaub', ich hab' ein Schiff gesehen!«
»Was jetzt, Kerlchen?«, rief der Steuermann herauf. »Hast du ein Schiff gesehen oder glaubst du's nur?«
»Ich glaube... ich denke! Wahrscheinlich hab' ich eins gesehen!«
»Geht's auch genauer?« Der Bootsmann warf zwei Hände voll ausgenommener Fische in ein Salzfass. »Eine Himmelsrichtung will ich hören!«
»Steuerbord, Ost-Nordost!« Der Bootsjunge nahm die Öllampe vom Masthaken und deutete damit in die Richtung, die er meinte. »Ungefähr da!«
Der Bootsmann und mit ihm ein paar andere Fischer traten an die Reling und spähten in die Dunkelheit. »Seht ihr irgendwo Positionslichter? Ich nicht.«
»Lichter hab' ich auch nicht gesehen! Ein Schiff hab' ich gesehen... glaub' ich! Eins ohne Lichter!«
»Kein Mensch steuert nachts einen Kahn ohne Positionslicht durch die Dunkelheit!«, rief der Steuermann.
»Vielleicht hat unser Benjii die Atemfontäne eines Wals gesehen«, vermutete einer der Fischer.
»Schon möglich.« Der Bootsmann klatschte in die Hände. »Weitermachen! Und du da oben hörst auf zu träumen! Klar?«
»Schon klar!«
Der Bootsjunge schaute zu, wie die Männer unter ihm durch die Fische wateten, deren Leiber silbrig im Licht der Öllampen glänzten. Das sah schön aus. Drei prallvolle Netze hatten sie in dieser Nacht aus dem Meer ziehen und aufs Deck leeren können. Sie hatten wirklich reiche Beute gemacht; zuhause, auf der Insel, würden sie tanzen vor Freude.
Bald hörte Benjii wieder das Klatschen von in Salzfässern aufschlagenden Fischen. Allerdings ging es nun deutlich ruhiger dort unten zu: Kaum einer schwatzte noch, keiner schimpfte, keiner sang. Was war los mit den Fischern? Fürchteten sie sich?
Unbehagen beschlich den Bootsjungen. Er kaute an den Nägeln, spähte nach Süden, in Fahrtrichtung. Von den Turmlichtern der heimatlichen Inselküste war noch kein einziges zu sehen. Er spähte nach Ost-Nordost – endlich trennte dort ein milchiger Streifen Himmel und Meer. Erstes Morgengrauen!
Unten schleppten zwei Matrosen einen Korb mit Fischinnereien zur Reling und leerten ihn ins Meer. Der milchige Silberstreifen am Osthorizont wurde heller und breiter. Tief im Süden glaubte Benjii, eine Lichtmarke der heimatlichen Insel zu erkennen. Ihm wurde leichter zumute, und er begann eine Melodie zu summen.
Am Heck schrien die ersten Möwen über dem Kielwasser. Das Morgengrauen im Osten verwandelte sich nach und nach in Morgenröte, sodass Ozean und Himmel nun an keiner Stelle mehr miteinander verschwammen.
Auf einmal sah er wieder das Ding aus den Wellen ragen, das Schiff. Die dunklen Umrisse des Rumpfes, die spitzbogenförmigen Segel, die rasch ausschlagenden Riemen zu beiden Seiten – alles zeichneten sich nun deutlich vor dem blassroten Lichtstreifen des neuen Tages ab. Sogar die Galionsfigur.
Der Bootsjunge spähte atemlos, sah genau hin, wollte diesmal ganz sicher sein. Sein Herz schlug jetzt sehr schnell und seine Hände schwitzten. »Ein Schiff!« Er beugte sich weit aus dem Krähennest und schrie, so laut er konnte: »Ein Schiff! Backbords hält ein Schiff aus Ost-Nordost auf uns zu!«
Alle Männer an den Schlachtkübeln und in den Fischhaufen richteten sich auf, alle Köpfe drehten sich nach Backbord, von allen Seiten liefen Fischer an die Backbordreling und spähten nach Osten aufs Meer hinaus. Jeder konnte das fremde Schiff nun erkennen, konnte sehen, dass kein einziges Licht in seiner Takelage und an seiner Reling leuchtete. Seine Silhouette glich einer Axtklinge, die ein Titan aus dem wogenden Meer streckte.
»Wirklich wahr!«, hieß es bald, und: »Der Bootsjunge hatte recht«, und: »Wer segelt denn in dieser Meeresgegend mit schwarzem Tuch?«
Das Schiff kam schnell näher, beängstigend schnell. Benjii wurde der Mund trocken, und auf einmal drängte seine Blase.
»Hol's der Henker!«, rief der Bootsmann. »Das ist eine verdammte Galeere!«
Vom Ruderschwengel aus rief der Steuermann: »Die rudern ja, als sei Orguudoo selbst hinter ihnen her!«
»Und sie kommen geradewegs auf uns zu!« Der Bootsmann spuckte über die Reling, schabte sich den Bart und zischte: »Was zum Henker wollen die von uns?«
Danach sagte lange keiner mehr etwas, und es wurde seltsam still an Bord. Nur die Möwen hörte der Bootsjunge noch schreien. Das Herz schlug ihm nun bis zum Hals. Er entleerte seine Blase aus dem Krähennest aufs Deck hinunter, was verboten war, doch keiner fluchte oder schimpfte, denn keiner merkte es.
Aus dem Morgengrauen pflügte das Schiff mit den schwarzen Segeln unaufhaltsam heran, wurde größer und größer. Es hatte zwei Masten. Deutlich erkannte Benjii die vielen Riemen, die zu seinen beiden Seiten in die Wogen ein- und wieder auftauchten.
»Eine Galeere mit Ramme!«, schrie irgendjemand.
Der Bootsmann zog eine Flasche aus dem Gürtel, entkorkte sie und nahm einen Schluck. »Stimmt, der verdammte Kahn schiebt einen Rammdorn vor sich her durch die Wellen!« Er reichte die Flasche weiter. »Was für Waffen haben wir an Bord?«
Bald war die heranpflügende Galeere nur noch einen Steinwurf weit entfernt. Der Bootsjunge blinzelte ins Dämmerlicht. »Eine Menge Männer an der Bugreling!«, rief er. »Noch zu dunkel, um Waffen oder Gesichter zu erkennen!«
Der Kapitän war nun auch aus seiner Kajüte gekommen. »Bewaffnet euch, so gut ihr könnt!«, rief er mit donnernder Stimme. Die Männer rannten zu ihren Unterkünften. Der Kapitän drehte sich nach dem Steuermann um. »Scharf nach Südost!«, brüllte er. »Versuch ihnen auszuweichen! Steuere an ihrer Backbordseite vorbei! Vielleicht können wir ihnen mit dem Kiel die Riemen zerbrechen!« Nach einem prüfenden Blick auf die Takelage schickte er eine Handvoll Seeleute unter die Masten, um die Rahen in den Wind zu drehen.
Die Galeere stach heran, ihr Rammbock zielte nach Backbord aufs Heck. Jetzt konnte der Junge im Ausguck die Gesichter der Angreifer hinter ihrer Bugreling erkennen – graue, knochige, eingefallene Gesichter. Axtklingen und Säbel glitzerten im ersten Morgenlicht. Es gab kein Ausweichen mehr!
Der Bootsjunge stand wie gelähmt. Unter ihm hasteten die Fischer zurück an die Reling, versammelten sich rings um Bootsmann und Kapitän, mit Spießen, Fischhaken, Keulen und Hämmern bewaffnet. Einige knieten auf den Planken nieder und legten Gewehre und Harpunen an. Der Steuermann beschimpfte die Männer unter den Masten, weil sie die Rahen nicht schnell genug drehten.
Mit offenem Mund und weit aufgerissenen Augen sah der Junge die Galeere auf ihrer schäumenden Bugwelle herankommen. Die Angreifer drängten sich am Bug und schüttelten Waffen und Fäuste. Einer von ihnen, ein riesenhafter Mann, hatte strähniges rotes Haar und trug einen schwarzen Mantel. Dort, wo früher sein rechtes Ohr gesessen haben mochte, wölbte sich wie Wurmgeflecht eine große Narbe.
Die Fremden trugen schwarze Kleidung aus Leder, einige dazu schwarze Gesichtsmasken. Die meisten stießen gierige Schreie aus, einige hüpften sogar lachend auf und ab, ganz so, als könnten sie den Kampf nicht erwarten. Und alle sahen sie aus, als hätten Gräber sie ausgespuckt. Oder Orguudoos Feuerhölle.
Unter ihnen, am Bug ihrer Galeere, tauchte für einen Augenblick der eiserne Rammdorn aus den Wellen auf. Heißer Schrecken fuhr dem Bootsjungen in die Glieder.
»Ich kann ihnen nicht mehr ausweichen!«, brüllte der Steuermann. »Sie werden unser Achterschiff rammen!«
Plötzlich ging ein gewaltiger Ruck durch das Boot – der Rumpf bebte und schwankte, Benjii hörte es splittern und krachen. Atemlos und mit beiden Händen an den Rand des Krähennestes geklammert, sah er den Großen mit dem roten Haar aufs Fischerboot herüberspringen. Dutzende folgten ihm, rannten an dem Roten vorbei, stürzten unter die Fischer. Wie Mumien sahen sie aus, wie Tote, in die böse Geister gefahren waren, um sie zu kurzem mörderischen Leben zu erwecken.
Schon wimmelte es von fremden Kämpfern unter dem Krähennest. Kampfgeschrei steigerte sich zu wildem Kreischen. Schwerter klirrten gegen Hämmer, Schüsse krachten, die Deckplanken dröhnten unter stampfenden Schritten und stürzenden Körpern.
Der Bootsjunge zitterte, und das Herz pochte ihm rasend schnell in der Kehle, während er mit tränenden Augen beobachtete, wie die Gegenwehr der Fischer zusammenbrach.
Und dann musste Benjii etwas mit ansehen, was er noch nie zuvor gesehen hatte: Die Mumienhaften schlugen ihre Zähne in die Hälse der sterbenden Fischer! Wie grässlich! Was taten die da? Soffen sie etwa das Blut der Sterbenden?
Glitzernde Helligkeit flutete plötzlich den Morgenhimmel – die Sonne ging auf. Kaum funkelte ihr gleißendes Licht auf Fischleibern, Blut, Leichen und abgetrennten Gliedern, zuckten die grauen Gesichter der Widerlichen von den klaffenden Hälsen der Fischer weg. Wie in großem Schrecken rissen sie ihre blutigen Münder auf, schlugen die Hände vor die Augen, als würde das Licht sie schmerzen. Einige taumelten wie betäubt über Deck, andere zupften Masken unter ihren Gürteln hervor und zogen sie sich über die knochigen Gesichter.
Der Bootsjunge erfasste seine Chance sofort und mit dem Instinkt eines Todgeweihten: Er schwang sich aus dem Krähennest, turnte die Takelage hinab und sprang vom Bugspriet aus ins Meer.
Als er auftauchte, sah er den Rothaarigen: Mit sechs anderen Mumienartigen stand er in einem Beiboot, das seine Männer in die Wogen herabließen!
Benjii tauchte unter und schwamm nach Süden, der heimatlichen Insel entgegen. Er tauchte auf und sah das Beiboot mit dem Rothaarigen drei Steinwürfe hinter sich. Es rückte näher und näher.
Der Bootsjunge schwamm, so schnell er nur konnte. »Ich schaffe es«, keuchte er, »ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es...«
Juli 2552
Jemand zeigte ihnen den Dschungelpfad zum nächsten Dorf; ein männlicher Primärrassenvertreter: klein, drahtig, nackt und mit vielen bunten Bildern auf der Haut. »Es sind mit Dornen gespickte Kothaufen«, sagte er beim Abschied. »Selbst wenn du sie zertrittst, verletzen sie dich.« Er sprach von den Waldleuten des Dorfes, zu dem der Pfad angeblich führte.
»Wie lange läuft man bis dorthin?«, wollte Gal'hal'ira wissen.
»Unsere besten Jäger bräuchten zehn Wegstunden, Meisterin.« Der Nackte – die seinen nannten ihn Geisterrufer –verbeugte sich vor der Daa'murin. »Doch keiner von ihnen käme jemals auf die Idee, dorthin zu gehen.«
»Wegen ein paar Kothaufen?« Grao'sil'aana runzelte die menschliche Stirn, die wie von Schuppenflechte überzogen aussah. Das einzige Merkmal, das sie nicht perfekt nachbilden konnten.
»Mit giftigen Dornen gespickte Kothaufen, großer Meister.« Der Nackte verbeugte sich besonders tief. »Sie stinken nicht nur, sie rauben dir das Leben.«
»Nun gut, wir werden sehen.« Während Grao sich bereits abwandte, hob Ira die Rechte zum Gruß. »Danke für eure Gastfreundschaft. Mögen die guten Geister des Waldes euch die Kinderwiegen und die Bäuche füllen.«
Der Nackte verbeugte sich so tief, dass die Daa'murin das Bild des rot, gelb und grün flammenden Baumes auf seinem Rücken sehen konnte. »Mögen die guten Geister des Waldes euch nähren, schützen und führen, ihr mächtigen Meister.« Unter respektvollen Verbeugungen tastete sich der Geisterrufer rückwärts durchs Unterholz bis zurück zu seinen Leuten, die am offenen Walltor der Dschungelfestung warteten.