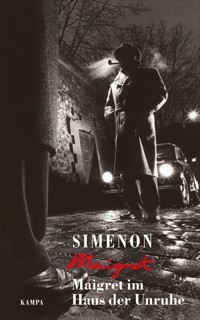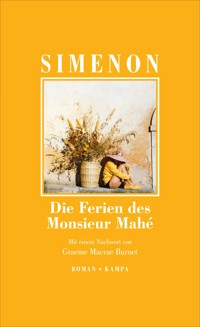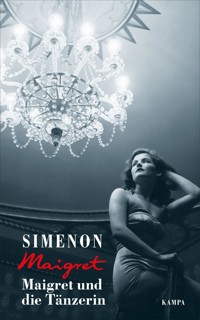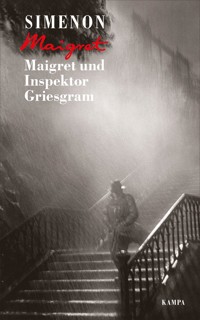Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Georges Simenon
- Sprache: Deutsch
Ob Stehvermögen oder Sitzfleisch - einige Fälle, das weiß Maigret, kann man nur mit Beharrlichkeit lösen. Einmal verfolgt er einen Verdächtigen fünf Tage und fünf Nächte lang quer durch Paris. Ein andermal sitzt der Kommissar stundenlang im Restaurant Chez Marina und beobachtet eine Gangsterbande, die wiederum eine rivalisierende Bande im Bistro gegenüber auskundschaftet. Wer hält länger durch? Und schließlich ist natürlich auch sein Verhörtalent gefragt: Denn eine junge Frau in seinem Büro will und will nicht reden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 91
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Georges Simenon
Maigret und der Mann auf der Straße
Erzählungen
Aus dem Französischen von Melanie Walz und Sara Wegmann Mit einem Vorwort von Gabriel García Marquéz
Kampa
Gabriel García MárquezDieselbe Geschichte, nur anders
Eine der Geschichten, die mich in meiner kurzen Jugend am meisten beeindruckt haben, entwickelte sich für mich zu einem Rätsel, das bis vor sechs Monaten ungelöst geblieben ist. Ich kannte weder den Titel noch wusste ich, wer sie geschrieben, noch in welcher Sprache, noch in welcher Sammlung ich sie gesehen hatte. Vierundzwanzig Jahre habe ich gebraucht, um alle Einzelheiten herauszubekommen. Aber damit nicht genug: Jetzt, wo ich die Geschichte endlich wiedergelesen habe, finde ich sie zwar noch genauso eindrucksvoll wie in der Erinnerung, aber aus anderen Gründen.
1950, als ich die Geschichte zum ersten Mal las, hatte ich gerade meine erste Übung als Journalist unterbrochen und zog durch die Dörfer der kolumbianischen Guajira, um Lexika und technische Handbücher auf Raten zu verkaufen. Eigentlich war das nur ein Vorwand, um die Gegend kennenzulernen, in der meine Mutter geboren war und in die sie ihre Eltern dann geschickt hatten, um ihre Liebschaft mit dem Telegraphenbeamten von Aracataca zu durchkreuzen. Vor allem wollte ich die Gegend mit dem vergleichen, was ich von Kindheit an über sie hatte sagen hören, denn ich ahnte, dass dort meine Wurzeln als Schriftsteller lagen.
Es blieb mir so viel Zeit zum Lesen, dass mir die Lektüre ausging und ich in den ärmlichen Pensionen am Weg viele Stunden damit zubrachte, die Bücher zu lesen, die ich als Verkaufsmuster dabeihatte: Handbücher der Chirurgie, juristische Fallsammlungen, Anleitungen zum Brückenbau und im Extremfall auch die zehn Bände einer illustrierten Enzyklopädie. Außerdem traf ich immer wieder Freunde, die mir Bücher borgten. Ich weiß nicht mehr, wer von ihnen mir die Sammlung von Kriminalgeschichten geschenkt hatte, die ich dann fieberhaft gespannt in Victor Cohens Hotel an der Plaza Mayor von Valledupar gelesen habe. Da stieß ich auf die Erzählung.
Die Geschichte, so wie ich sie immer in Erinnerung hatte, handelte von einem Verdächtigen, den zwei Polizisten tage- und nächtelang erbarmungslos durch die Straßen von Paris verfolgten, immer in der Hoffnung, dass er früher oder später gezwungen sein würde, nach Hause zurückzukehren, denn nur dort lagen die Beweise, die es möglich machten, ihn vor Gericht zu bringen. Wie es mir mit Kriminalgeschichten und auch im wirklichen Leben immer geht, hat sich mir dort nicht die Verbissenheit der Verfolger, sondern die Angst des Verfolgten tief eingeprägt.
Das Geschäft mit den Büchern ging schlecht, und ich musste Victor Cohen schließlich einen Schuldschein geben, um die Hotelrechnung für ein oder zwei Monate zu bezahlen. Außerdem überließ ich ihm meine Musterkollektionen, die ich nun nicht mehr brauchte, sowie zwei oder drei schon ausgelesene Bücher. Darunter bestimmt auch die Sammlung von Kriminalgeschichten.
Sechs Jahre später, als ich bereits einen Namen als Reporter hatte und mein erster Roman schon erschienen war, strandete ich in Paris. Es war ein müder Herbst, und die Stadt war so, wie ihre Dichter sie beschreiben: der Himmel tief und aschgrau, auf den Straßen der Geruch von in Kohlebecken gerösteten Kastanien, an den Vordächern der Metzgereien mit Papiernelken geschmückte ganze Schweine, die letzten Ziehharmonikaklänge des vergangenen Sommers. Mitten auf dem Pont Saint-Michel ließ mich ein eisiger Windstoß ins nächste Café flüchten.
Es war ein heller, angenehmer Raum, wie bei Hemingway, mit verliebten Paaren, deren lange Küsse sich in den Spiegeln an den Wänden vervielfachten, und Kriegsveteranen, die über die Nachrichten aus Algerien wetterten. Ich setzte mich ans Fenster zur Straße und tat so, als läse ich Zeitung, in Wirklichkeit aber beobachtete ich die Lastkähne, die langsam wie schwimmende Hütten auf der Seine vorbeifuhren, Windeln neugeborener Kinder waren zum Trocknen aufgehängt, und grimmige Hunde bellten von Bord aus die Wasserspeier von Notre-Dame an. Plötzlich hatte ich das deutliche Gefühl, dass mich jemand beobachtete. Ich warf einen Blick über die Schulter, und da war er.
Ein harter Mann, mit drei Tage altem Bart und gekleidet wie ein Landstreicher, der mich aus einer hinteren Ecke erbarmungslos musterte. Ich senkte den Blick auf meine Zeitung und tat so, als ob ich läse. Als ich wieder aufblickte, war der Mann immer noch da und sah mich unverwandt an. Es war falscher Alarm. Aber in dem Augenblick erlebte ich, mehr als an jenem Tag, als ich die Geschichte gelesen hatte, von Neuem den Schrecken des Verfolgten. Erst da fiel mir auf, dass ich nicht einmal wusste, wie die Geschichte ausging. Ich nahm mir also vor, sie zu suchen, um sie noch einmal mit größerer Sorgfalt zu lesen.
Ich erinnerte mich, dass das Buch, in dem ich die Geschichte gelesen hatte, mindestens vierhundert Seiten stark gewesen war, aber ich hatte vergessen, wer es mir geliehen hatte und ob es wirklich unter denen war, die ich im Hotel von Victor Cohen zurückgelassen hatte. Der Band musste, wie das meiste, was wir damals lasen, in Buenos Aires gedruckt worden sein, vielleicht bei Santiago Rueda, denn es war ein großes Format mit gut lesbarer Schrift, wie bei diesem Verlag üblich. Nach Genre, Land und Zeit zu urteilen, musste es eine der vielen Anthologien von Jorge Luis Borges und Adolfo Bioy Casares gewesen sein. Im Übrigen konnte ich mich noch verschwommen daran erinnern, dass in demselben Buch eine Erzählung von Apollinaire stand, deren Hauptfigur ein Seemann mit einem Papagei auf der Schulter war. Ich habe niemanden gefunden, der mich da auf eine Spur hätte setzen können.
Das Merkwürdige ist, dass ich damals schon verschiedene Bücher von Georges Simenon gelesen, sie aber nie in Verbindung mit der gesuchten Geschichte gebracht hatte. Er war als Autor schon eine Legende, wenn auch weniger wegen seiner Bücher als wegen der Art, wie er sie schrieb, und wegen seiner rational kaum nachvollziehbaren Produktivität. Es hieß, er habe jeden Samstag eins fertig und mehrere im Schaufenster seines Verlages geschrieben, damit die Passanten sich von seiner meisterhaften Schreibgeschwindigkeit überzeugen konnten, und dass er in einer Jacht um die Welt reiste, um seine Produktion auf ein Buch pro Tag zu steigern.
Nicht im Paris des Algerienkrieges, sondern im blühenden Mexiko von 1965 las ich zufällig eine Geschichte und fand einen Namen, der mich aus dem Sessel fahren ließ: Maigret. Plötzlich fiel mir wie durch übernatürliche Erleuchtung mit zwölf Jahren Verspätung wieder ein, dass so der Kommissar hieß, der den Verdächtigen meiner unvergesslichen Geschichte verfolgte. Der Autor war zweifellos Georges Simenon.
Das war aber kaum ein erster Schritt, denn eine einzelne Geschichte von Simenon finden zu wollen, ohne ihren Titel zu kennen, kam einer Suche auf dem Grunde des Ozeans gleich. Ich befragte Kenner seines Werkes, unter ihnen Álvaro Mutis, der mir einmal vorgeschlagen hatte, zusammen mit zweitausend anderen Schriftstellern aus aller Welt einen Brief zu unterschreiben, in dem eine Gehaltserhöhung für Kommissar Maigret gefordert wurde. Niemand erkannte die Geschichte wieder, die ich wie eine gesprungene Schallplatte ständig wiederholte. Álvaro Cepeda Samudio, der es leid war, sie so oft zu hören, empfahl mir schließlich:
»Schreiben Sie sie einfach selbst, denn diese verdammte Geschichte muss es doch geben.«
Manchmal blätterte ich in Bibliotheken und Buchhandlungen Kataloge von Simenon durch, immer in der Hoffnung, die Erzählung auf umgekehrtem Wege zu finden: die Geschichte über den Titel. Vergebens. Drei Freunde, die mich unabhängig voneinander die Geschichte hatten erzählen hören, waren sicher, sie gefunden zu haben, und schickten mir drei verschiedene Erzählungen von Simenon, denn sie fanden, sie entsprächen genau der, die ich erzählt hatte. In Wirklichkeit aber war keine so. Da stellte ich mir zum ersten Mal die Frage: »War sie vielleicht gar nicht von Simenon?«
Als ich einmal in den siebziger Jahren im Frühling in einem Genfer Café auf eine Verabredung wartete, sah ich, wie sich ein etwa siebzigjähriger Mann mit hellem Regenmantel, Filzhut und einem Regenschirm über dem Arm an einen der Nachbartische setzte. Der Kellner, der mich bediente, flüsterte mir mit unwiderstehlicher Vertraulichkeit zu: »Das ist der Schriftsteller Simenon.«
Ich schaute über den Rand meiner Zeitung und sah ihn die seine lesen, wobei er an einer erloschenen Pfeife zog. Nach den Fotos hätte ich ihn nicht wiedererkannt, denn er hatte ein Gesicht wie das jenes unbekannten Belgiers, das er Maigret gegeben hatte. Kurze Zeit zuvor hatte Simenon angekündigt, sich vom Schreiben zurückzuziehen, aber er schien nicht erschöpft, weder von seinem Alter noch von seinem unerschütterlichen Erfolg, den er Tropfen für Tropfen fast dreißig Jahre lang gehabt hatte. Einige Zeit dachte ich, ich wäre der Lösung meines Rätsels nie so nah gewesen, aber ich schaffte es nicht, zu ihm zu gehen, obwohl ich wusste, dass wir mehrere gemeinsame Freunde hatten. Später habe ich mich dann gefragt, ob er genug Zeit und Gedächtnisstärke gehabt hätte, sich seiner verstreuten Geschichten zu erinnern.
Im April des Jahres 1983 kam ich während des Musikfestivals in Valledupar in das Haus eines Freundes und fand alle Gäste im Kreis um einen alten Mann versammelt, der wie ein Artist mit einer Schönheitskönigin tanzte. Er war ganz in weißes Leinen gekleidet, trug einen Hut aus feinem Stroh, eine randlose Brille und reinrassig karibische Schuhe: weiß mit schwarzen Spitzen und Fersenkappen. Es war Victor Cohen, der mit seinen dreiundneunzig Jahren besser tanzte, als ich es in meinem ganzen Leben gesehen hatte. Als die Musik zu Ende war, kam er zu mir und händigte mir in seiner patriarchalischen Art und mit dem ihm eigenen Humor ein Zettelchen von der Größe einer Visitenkarte aus.
»Hier habe ich ein Geschenk für dich«, sagte er zu mir.
Es war der Schuldschein über neunhundert kolumbianische Pesos, die ich ihm nie bezahlt hatte. Das war das herausragende Ereignis der Feier, von dem man den Besuchern von Valledupar bis zum heutigen Tage erzählt. Ich dagegen habe Victor Cohen noch vor dem Dank für seine Großzügigkeit gefragt, ob er nach vierunddreißig Jahren zufällig noch eines der Bücher, die ich damals bei ihm zurückgelassen hatte, besitze. In seiner kleinen, aber gut sortierten Bibliothek standen drei davon. Keins war das, das ich suchte.
Julio Cortázar hat mich schließlich mitten in einem biblischen Unwetter eines Nachts in Managua an den Rand des Abgrundes gebracht. Wir hatten mehrere Stunden über Geschichten von Verfolgten gesprochen, eine seiner zahlreichen Spezialitäten, als mir plötzlich Simenon einfiel. Es war unglaublich: Bevor ich noch die Geschichte ganz erzählt hatte, sagte mir Cortázar mit seiner schönen Baritonstimme und seinen lang gezogenen R:
»Diese Geschichte heißt ›L’homme dans la rue‹ und ist Teil einer Sammlung mit dem Titel Maigret et les petits cochons sans queue.«
Es schien mir so leicht, sie zu finden, dass ich nicht weiter nach Einzelheiten fragte. Ein großer Irrtum, denn kurze Zeit später kaufte ich auf irgendeinem Trödelmarkt eine Billigausgabe auf Spanisch, und die Geschichte, die ich suchte, war nicht darin enthalten. Statt mich um eine französische Ausgabe zu bemühen, nahm ich an, Cortázar, der kurze Zeit später starb, habe sich geirrt, und legte die Sache zu den Akten. Jetzt, mit der Originalausgabe in den Händen, wird mir klar, dass es acht Geschichten sind, während der Raubdruck auf Spanisch nur sechs enthielt.