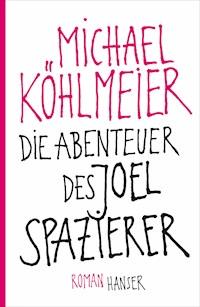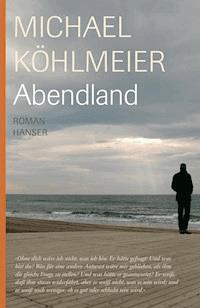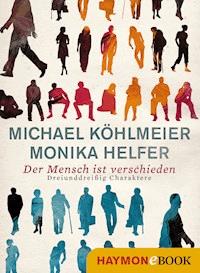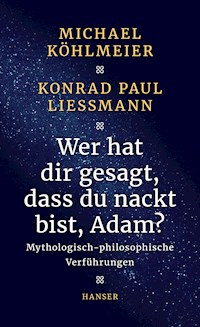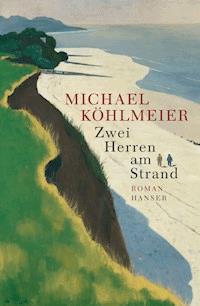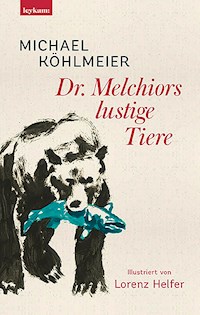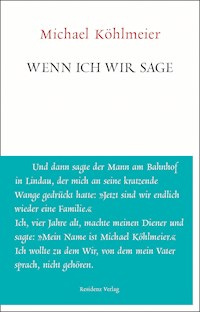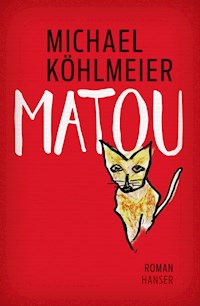
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Der charismatischste Erzähler der Welt ist ein Kater – „ Michael Köhlmeier ist ein stofflich wie stilistisch monumentales Werk gelungen.“ Jérôme Jaminet, SWR2
Die großen Fragen der Menschheit – betrachtet von einem einzigartigen Kater: Matou. Sein Leben ist ein Sieben-Leben-Leben, es reicht von der Französischen Revolution bis in die Gegenwart. Seine Leidenschaft ist es, den Menschen verstehen zu lernen. E.T.A. Hoffmann und Andy Warhol kannte er persönlich, auf der Katzeninsel Hydra führte er einst einen autokratischen Staat und kämpfte im Kongo gegen die Kolonialherren. Matous Leben sind voller großer Abenteuer, er ist ein wilder Geschichtenerzähler und ein noch größerer Philosoph. Er ist der Homer der Katzen. Der neue große Roman von Michael Köhlmeier ist eine Liebeserklärung an Mensch und Tier: voller Sprachwitz und Ironie. Ein Geniestreich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1524
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein Kater sitzt auf einem Dachboden im 9. Bezirk in Wien und schreibt seine Memoiren. E. T. A. Hoffmann und Andy Warhol kannte er persönlich, auf der Katzeninsel Hydra führte er einst einen autokratischen Staat und kämpfte im Kongo gegen die Kolonialherren. Seine Leben sind voller großer Abenteuer. Matou ist nicht irgendein Kater, er ist ein wilder Geschichtenerzähler und ein noch größerer Philosoph. Er ist der Homer der Katzen. Michael Köhlmeier hat eine literarische Figur geschaffen, die man niemals vergisst.
Michael Köhlmeier
MATOU
Roman
Carl Hanser Verlag
für unsere Bagage
MEIN ERSTES LEBEN
ERSTES KAPITEL
1
Ich habe meinen Herrn sterben sehen. Sein Tod geschah schneller, als du das Wort sterben aussprechen kannst. Ich hockte unter der Guillotine und leckte das Blut.
Der Herr meines ersten Lebens nämlich war niemand anderer als: Camille Desmoulins, der Bestürmer der Bastille, der schneidigste Reden- und Artikelschreiber der Revolution, der berühmte, berüchtigte und beliebte … – Halt! Höre ich dich rufen. Du fragst: Woher weiß er das? Er ist ein Kater. Er war ein Kater. Er wird immer ein Kater sein. Was wissen Katzen über uns Menschen und über unsere Geschichte? Was maßt er sich an! – So fragst du, habe ich recht? – Und woher bitte sollte er wissen, was eine Guillotine ist? Und was ein Revolutionär ist? Und woher obendrein wusste er damals, dass sein Herr der berühmte, berüchtigte und beliebte Camille Desmoulins ist?
Auch wenn du den Fluss meiner Erzählung schon an seiner Quelle hemmst, was mir lästig ist, gebe ich doch zu, deine Fragen sind berechtigt. Also noch einmal von vorne – diesmal werde ich zunächst von mir selbst sprechen; denn darüber kann niemand mich belehren.
2
Ich beginne ein Unternehmen, welches beispiellos dasteht und bei dem ich keinen Nachahmer finden werde. Ich will dir einen Kater in seiner ganzen Naturwahrheit zeigen, und dieser Kater werde ich selber sein. Ich allein, Matou – das ist mein Name. Ich verstehe, in meinem Herzen zu lesen, und kenne die Tiere und ein wenig auch die Menschen. Meine Natur ist von der aller Katzen, denen ich je begegnet bin, verschieden; ich wage sogar zu glauben, nicht wie ein einziges von allen Wesen geschaffen zu sein. Bin ich auch nicht besser, so bin ich sicherlich anders – im Übrigen leicht zu erkennen am kupferroten Fell und der weißen Schwanzspitze und den weißen Tupfen an meinen Pfoten.
Wie bekannt, verfügen Meinesgleichen über sieben Leben – oder über neun. Britische und amerikanische Katzen bringen es auf neun, kontinentale auf sieben. Ich befinde mich gegenwärtig in meinem siebten Leben – das mein letztes sein wird und das ich nützen will, um meine sechs vorangegangenen aufzuzeichnen. Beginnen will ich beim ersten.
Im Anfang ist keine Rede vom Sterben! Ich war voll Lebensfreude, und sie war in mir beim Augenaufschlag am Morgen. Neugierig war ich. Gierig war ich nach allem, was sich bewegte. Freude hatte ich an allem, was sich herumschubsen ließ, sei es ein Wollknäuel oder eine Murmel oder ein stinkender Fischkopf oder eine halbtote Maus. Ich liebte es, meinen Schwanz in die Höhe zu recken und die Spitze hin- und herzuwenden, vor und zurück, und bildete mir ein, ich streichle damit am Tag die Sonne und in der Nacht den Mond, denn ich wusste ja auch nicht, dass Sonne und Mond so weit oben sind, dass wir sie nicht erreichen können, auch nicht auf den Giebeln der Dächer von Paris. Und woher die Blitze und der Donner kamen, wusste ich ebenfalls nicht, aber sie waren schön. Ich suchte Abenteuer und liebte Abenteuer und suchte, was ich sonst noch lieben könnte, und hasste die sichere Ruhe. Zu betrachten hatte ich nicht gelernt, ansehen aber wollte ich mir alles, und alles war gleich schön. Mir war, als würde die Welt erschaffen, indem ich sie ansah und weil ich sie ansah, aber ohne zu wissen, wer dieses anschauende Ich war, und wenn ich die Augen zudrückte, würde die Welt um mich herum wieder nicht mehr sein – so denken auch eure Kinder, habe ich sagen hören. Ich musste zwei Leben leben, ehe ich begriff, dass der Verstand die Wahrheit nicht erschafft, sondern sie vorfindet, und abermals zwei Leben, um daran wieder zu zweifeln.
Ich hatte einen festen Wohnsitz, was damals nur wenige Katzen von sich behaupten konnten. Die meisten waren wild wie die Tiger Indiens – und wenn der Dichter Victor Hugo euch weismachen möchte, Gott, wer immer das sein mag, habe uns Katzen nur deshalb erschaffen, damit ihr Menschen einen Tiger streicheln könnt, solltet ihr wissen, dass zu jener Zeit auf den Straßen von Paris solche Liebkosungen durchaus mit Prankenhieben pariert wurden, die oft nicht ungefährliche Wunden zur Folge hatten.
Ja, ich war privilegiert, ich hatte ein Zuhause und ein behagliches obendrein. Und ich war zivilisiert. Ich konnte Milch aus einer Schale schlecken, ohne dass ein Tropfen auf den Boden fiel, und wenn ich eine Amsel erwischte, schleppte ich sie nicht in die Wohnung meines Herrn und meiner Dame und zerriss sie im Salon und verstreute ihre ungenießbaren Teile über den Teppich, im Irrglauben, ich werde dafür gelobt, weil man die Federn und die Därme für ein Geschenk hielte. Zu meinem Haushalt gehörte eine Klappe in der Tür, die nach außen und innen schwang, so dass ich ein- und ausgehen konnte, wann immer es mir behagte – auch, um die Überreste meiner Beute zu entsorgen.
Ich liebte die Straße, die ungesittete, dennoch! Die Gerüche! Ihr meint, nur die Hunde hätten eine feine Nase. Bei uns Katzen werden die Augen gepriesen. Ohne Zweifel ist uns der Hund olfaktorisch überlegen; aber besser als ihr können wir allemal riechen. Das Parfüm der Dienstmädchen hinter den Ohrläppchen, der zwiebelig pferdige Achselschweiß der Männer, wenn sie schwere Dinge stemmen; die Rippenstücke vom Schwein im Einkaufsnetz der Hausfrau; die weiche Butter im Sommer; die vollen Windeln der Kinder; ein faulender Backenzahn im Maul eines Kaplans; Madeleines, frisch, wie sie im Buch stehen; die Krankheit der Hure, die Geilheit des Freiers, die Habgier des Pimps; der Aprikosenatem der kleinen Mädchen, wenn sie mich an ihre Wangen drückten – der Wagen eines Hundefängers fährt vorbei oder solche Dinge. Ich ging den Damen hinterher und den Herren, und oft musste ich laufen, denn sie nahmen eilige Schritte. Sie liefen irgendwohin, oder sie liefen vor irgendetwas davon. Ich hörte, ich sah, ich roch.
Ich beteiligte mich an den Spekulationen und Diskussionen, die unter Meinesgleichen geführt wurden. Einige von uns trafen sich regelmäßig nachts an gewissen Hausecken und palaverten stundenlang und ließen sich auch nicht verjagen, wenn ein Mensch sein Nachtgeschirr aus dem Fenster schüttete und dazu fluchte, weil ihm die Katzenphilosophen mit ihren dissonanten Grübeleien den Schlaf raubten. Bei diesen Disputationen habe ich viel erfahren – zum Beispiel, dass wir nicht auf einer Kugel leben, sondern in einer Kugel, die sich nicht lüften lasse, weil sie abgeschlossen sei, weswegen die Stadt so stinke; und dass der Mond vorne ein Gesicht und hinten einen Arsch habe und die Wolken des Mondes Fürze seien – ein weiteres Problem. Die Erde sei entstanden aus einer speziellen Verdichtung der Luft; außerdem hätten sich in alter Zeit Löwen nur mit Leopardinnen sinnvoll paaren können und Leoparden mit Löwinnen, denn Löwe und Löwin hätten Schlangen hervorgebracht, Leopard und Leopardin Igel. Und dass neben jedem Lebewesen, ob Wolf, ob Otter, ob Ratte, ob Schmetterling, ob Taube, ob Katze oder Mensch, der jeweils eigene Tod einhergehe wie ein Schatten und dass er auch irgendwie dem ähnlich sehe, der den Schatten wirft, wie der Narr dem, den er verspottet.
Die Menschen waren ausgehöhlt vor Erschöpfung und dennoch glücklich. Jeder war nur fünf Schritte weit vom Exzess. Aber nicht nur eure, auch die Gesellschaft der Katzen war in Aufruhr, auch in unseren Kreisen trat bisweilen ein Voltaire auf oder ein Rousseau oder ein Mirabeau. Da waren erfahrene Kater, die nach menschlicher Lebensrechnung fünfzehn Jahre alt waren, nach unserer waren es Methusaleme; die erzählten von früher, und sie erzählten, früher sei alles anders gewesen, und sie meinten damit, ihr Menschen seiet anders gewesen, gelassener, friedlicher, vereinzelter, ihr hättet mehr Abstand gehalten und mehr Anstand gehabt. Dafür seien die Plätze früher frei von Blut gewesen. Blut, diese Delikatesse, hätten Herrchen oder Frauchen selten in einen Katzennapf gegossen, und wenn, nur wenig davon. »Ihr müsstet schon einen wohlhabenden Herrn gehabt haben, um an Blut zu kommen«, behaupteten die Alten. »Oder eure Dame wäre frischweg eine Schlachtersfrau gewesen. Aber wer hatte schon so ein Glück!« Wir jungen Kater und Katzen lachten – ohne zu lachen – und riefen aus: »Was! Blut soll selten gewesen sein! Was erzählt ihr für Sachen!« Denn wir Jungen kannten ja die Plätze, wo die Blutpfützen so hoch standen, dass wir nicht durchwaten konnten, ohne unsere Bäuche nass zu machen. Aber die Alten erzählten, so sei es nicht immer gewesen.
Ich liebte das Leben und liebe es immer noch! Ach, glaub mir, lieber würde ich singen als schreiben! Und manchmal schreibe ich singend oder singe schreibend, such’s dir aus. Dann kommt mir ein Lied unter, ein Couplet, eine Arie, eine Ballade, ein Song, ein Schlager. Immer dann sollst du wissen: Jetzt liebt Matou – oder was er darunter versteht …
So wird mir das Böse zum Guten,
das Schlechte macht mich satt.
Wie schön ist das liebe Leben
in dieser schönen Stadt!
Der Schlachter wirft einen Knochen
nach mir, weil er mich nicht mag.
Am Knochen hängt noch Fleisch dran,
das reicht mir für einen Tag.
Hier wachsen die Giebel zum Himmel,
vom Himmel peitscht der Blitz,
die große Stadt Paris ist
mein Reich und mein Besitz.
Das Waschweib schüttet den Kübel
mit Lauge mir über den Pelz.
Die Flöhe mögen das gar nicht,
dem Pelzchen aber gefällt’s.
Hier wird mir das Böse zum Guten,
und Schlechtes macht mich satt.
Nichts liebe ich mehr als das Leben
in dieser schönen Stadt!
3
Aber du hast recht, ich wusste gar nichts, nichts. Am Anfang wusste ich nicht einmal, dass ich mich in Paris befand; auch nicht, dass Revolution war, und hätte ich es gewusst, hätte ich nicht gewusst, was dieses Wort bedeutet. Von eurer alten Zeitrechnung hatte ich keine Ahnung; ebenso wenig wusste ich über die neue Bescheid, die sich nicht mehr nach einem Mann namens Jesus Christ richtete, von dem ich natürlich auch nichts wusste und auch nichts von seiner Geburt vor 1794 Jahren, sondern nach dem calendrier révolutionnaire français, in dem die Monate nicht Oktober, November, April, August und so weiter hießen, die neue war benannt nach der Weinlese, dem Nebel, der Blume, der erhöhten Temperatur im Sommer, Burmaire, Frimaire, Floréal, Thermidor und so weiter. Ja, du hast weiter recht, ich wusste nicht, dass mein Herr Camille Desmoulins ein berühmter Revolutionär war. Und ich wusste nicht, dass die meisten Männer, die ich im Haus meines Herrn kennenlernte, in die Geschichte eingehen würden, weil ich auch keinen Begriff hatte von dem, was ihr Geschichte nennt. – Aber ich verfügte und verfügte durch alle meine sieben Leben hindurch und verfüge noch heute über die Gabe der hurtigen Auffassung! Intelligenz ist nicht gerecht, ja; aber, und das möchte ich in aller Bescheidenheit denken dürfen, sie stellt eine natürliche und darum ehrwürdige Ungerechtigkeit dar.
Dass Camille Desmoulins eine glänzende und begehrte Persönlichkeit war, das wurde mir bald klar; denn wer uns besuchte, behandelte ihn wie eine glänzende und begehrte Persönlichkeit. Eine Persönlichkeit zu sein, das ist das höchste Glück von euch Erdenkindern, das erfuhr ich später immer wieder. Die meisten, die kamen, wünschten sich, Citoyen Desmoulins möge etwas schreiben, oftmals etwas, unter das sie ihren Namen setzen wollten; dafür bezahlten sie ihn, und er ließ sich dafür bezahlen; nicht, weil er das Geld nötig gehabt hätte, er hatte ja eine reiche Frau geheiratet; er forderte zu jeder Zeit und an jedem Ort, dass Mann und Frau für ihre Arbeit gerecht entlohnt werden, und er wollte bei sich selbst keine Ausnahme zulassen. Keiner reichte an ihn heran, wenn es um elegante Formulierungen ging oder spitze Satiren oder entlarvende Parodien; er platzierte die trefflichsten Vergleiche mit der Römerzeit in seine Reden, was damals sehr geschätzt wurde, er spielte mit Zitaten, hatte sich Hefte voll aus Büchern zusammengeschrieben, Sprichwörter in lateinischer Sprache, wenige griechisch, aber auch Shakespeare zitierte er und Cervantes, obwohl er weder Englisch noch Spanisch verstand. Wenn sich einer wünschte, einen Gegner mit Worten zu erledigen, dann klopfte er bei uns an, und teilte Camille dieselbe Meinung, dann war der Gegner erledigt; wenn dieser aber ein Freund meines Herrn war, dann wurde der Auftrag auch bei hohem Honorar abgelehnt, und der Auftraggeber durfte damit rechnen, demnächst von eben der Pranke getroffen zu werden, die er einem anderen zugedacht hatte.
Camille Desmoulins war verheiratet mit Lucile, geborene Laridon-Duplessis, der Tochter von Claude-Etienne Laridon-Duplessis und Anne-Françoise-Marie Boisdeveix, die viel mehr noch als sehr vermögend waren und ihren Schwiegersohn liebten und dem Paar zur Hochzeit die mehr als prächtige Wohnung in der Rue de l’Ancienne Comédie schenkten. Als mich Camille aus der Gosse aufgelesen und mich seiner Frau als Geschenk mitgebracht hatte, war Lucile gerade zwanzig Jahre alt. Ich sag’s gleich: Sie hat mich immer gut behandelt, hat mich nie getreten, hat mich nie auf meinen Napf warten lassen, hat mir mit der Pinzette die Zecken gezogen, hat mir Knoblauchwasser eingeflößt gegen die Würmer im Darm und hat mir das Fell eingerieben mit einer scharfen Tinktur gegen Milben, Läuse und Flöhe. Schon zu Beginn meines ersten Lebens durfte ich durch meinen Herrn und meine Dame erfahren, was ihr Liebe nennt. Vielleicht liegt hier der Grund dafür, warum ich für euch Menschen mehr Interesse aufbrachte – und aufbringe –, als die Natur uns Katzen zuteilt. Gern wäre ich bei Camilles und Luciles Hochzeitsfeier dabei gewesen, es muss sehr lustig gewesen sein, nämlich weil diese Feier, im Unterschied zu anderen Hochzeitsfeiern, sehr ernst war. Ernst war sie, habe ich später den Erinnerungen der Eheleute abgelauscht, weil Maximilien Robespierre ihr Trauzeuge war, der wahrscheinlich ernsteste Mann der Weltgeschichte, der seine Würde auch auf dem Klosett nicht ablegte und seine Gedärme ermahnte, den Ruf des Unbestechlichen zu wahren. Er hatte sich extra für dieses Fest eine neue Etikette ausgedacht, die, wie er gravitätisch verkündet habe, in republikanischer Zukunft an die Stelle des kirchlichen Rituals treten solle. Lucile und Camille hatten viel Kraft aufbieten müssen, um nicht in brachiales Gelächter auszubrechen; sie starrten geradeaus, suchten in ihrem Gedächtnis nach traurigen Romanen, schielten, damit die Welt um sie herum unscharf und unwirklich würde, und unter allen Umständen hätten sie es vermeiden müssen, den Zeremonienmeister anzusehen; ein Blick nur, und aus der hehren Huldigung einer aufgeklärten Vermählung wäre quietschvergnügtester Karneval geworden, und wer weiß, die Freundschaft mit dem besten und ältesten Freund, dem »ewigen«, wäre zerbrochen. Ich hörte, wie Lucile einer Freundin erzählte: »Sicher wäre daraus ein Streit geworden – ein conflit violent –, der das Potenzial gehabt hätte, dass aus Freunden Feinde werden.«
Ich lernte schon in meinem ersten Leben: Euer Dasein spannt sich wie eine Sehne zwischen Liebe und Tod – das ist nicht mein Senf, das sagen in mehr oder weniger ähnlichen Worten alle eure Weisen. Auf der Sehne aber hänge wie auf einer Wäscheleine alles andere, was euch Kopfzerbrechen und tägliche Freude oder tägliches Leid bereitet und was ihr für wert erachtet, dass es aufgeschrieben wird. Deshalb erlaube mir erst eine zweieinhalb Blätter kleine Abschweifung hin zur Liebe, bevor ich mich, und das sehr ausführlich, mit dem Tod beschäftigen werde.
Lucile war trotz ihrer Jugend eine Expertin auf dem Gebiet der Liebe. An ein Gespräch erinnere ich mich sehr genau – es war ja auch das erste Mal in meinem siebenfachen Erdendasein, dass ich über Liebe reden hörte. Lucile führte es mit dem jüngeren Bruder von Maximilien Robespierre, mit Augustin. Er besuchte sie oft, aber immer nur, wenn Camille nicht zu Hause war; nicht, weil er dessen Eifersucht fürchtete, sondern weil er sich vor ihm geniert hätte, über dieses Thema zu sprechen. Augustin war ein Stück älter als Lucile, sein Leben lang stand er im Schatten seines Bruders, was ihm aber recht war, er war zwar als Abgeordneter der Stadt Paris in den Nationalkongress gewählt worden, aber Politik langweilte ihn, wie ihn fast alles langweilte, außer die Frauen, aber die schien er seinerseits zu langweilen, was ihm der größte Kummer war. Er gestand Lucile, dass er mit seinen bald dreißig Jahren noch nie mit einer Frau geschlafen hatte, dass er erst einmal eine Frau auf den Mund geküsst habe, und das sei zu seiner Beschämung nicht ganz ohne ein wenig Gewalt geschehen. Er sah durchschnittlich aus, war durchschnittlich intelligent, durchschnittlich gebildet, hatte einen durchschnittlichen Geschmack und die durchschnittlichen Ansichten jener Zeit. Er besuchte Lucile, weil er von ihr belehrt werden wollte, wie er es anstelle, das Herz einer Frau zu erobern. Und Lucile belehrte ihn, und sie tat das gern:
»Was macht dir Sorgen?«, fragte sie. »Dass du vor ihr etwas Falsches sagen könntest? Dass du in ihrer Gegenwart so schüchtern bist, dass du kein Wort herausbringst? Dass du ihr nicht in die Augen schauen kannst? Dass du rot wirst? Dass du ihr nicht gefällst? Weil deine Schultern zu schmal sind? Deine Hände zu klein? Deine Stimme zu leise? Dass du zudringlich bist und das auf linkische Art?«
»Ja«, sagte Augustin, und seine Stimme war leise, und er konnte Lucile nicht in die Augen sehen, und er wurde rot im Gesicht. »All das und mehr.«
»Weg mit diesen Sorgen!«, rief Lucile. »Schau dir Camille an! Er ist kein so schöner Mann wie Saint-Just. Er ist kein Redner wie Danton. Er stottert sogar ein wenig. Er kann brillant schreiben, das ist wahr, aber das ist nichts, womit du eine Frau auf Anhieb erobern kannst, sie müsste ja erst abwarten, bis du deinen Artikel zu Papier gebracht hast, und dann müsste sie ihn auch erst lesen, das ist ein zu großer Umweg für die Liebe.«
»Und warum hast du dich in Camille verliebt?«, fragte Augustin.
»Er hat Charisma! Man möchte in seiner Gegenwart etwas sagen, und dann sagt man etwas anderes, und was man sagt, ist besser, als was man denkt. Er erhebt einen. Erst verdreht er einem die Zunge, dann den Kopf. Aber beide sitzen zuletzt richtig.«
»Ich glaube, ich habe kein Charisma«, sagte Augustin, und seine Stimme schrumpfte weiter, und er drehte sich weg von Lucile, weil sein Gesicht brannte, bis über die Ohren und bis hinunter zum Hals.
»Charisma«, belehrte ihn Lucile, »hat man nicht, Charisma erschafft man sich.«
»Und wie?«
Ich hockte zwischen den Füßen von Lucile und den Füßen von Augustin Robespierre, die einander gegenübersaßen, und merkte mir jedes Wort und jeden Gesichtsausdruck, so genau, wie nur wilde Tiere sich die Zeichen merken können, die um sie herum aufscheinen, weil wilde Tiere weder wissenschaftliche Theorien noch einen Gott zur Verfügung haben, um sich gegen die Unberechenbarkeiten der Welt zu wappnen.
»Indem du Charisma spielst«, antwortete Lucile. »Charisma spielt man, wusstest du das nicht? Spiel den Charismatiker, Augustin! Es ist ganz leicht.«
»Bei wem kann ich es lernen?«, fragte Augustin. »Bei wem hat es Camille gelernt?«
»Oh, das wirst du mir nicht glauben!«, lachte Lucile ihr silbernes Lachen. »Ich weiß gar nicht, ob ich dir das sagen darf.«
»Bitte, sag’s mir! Bitte, Lucile, bitte!«
»Camille war als Kind sehr fromm. Wusstest du das? Erzähl’s aber nicht weiter. Er hat die Bibel gelesen. Das Neue Testament lieber als das Alte. Das Evangelium des Johannes konnte er auswendig. Oder ich verwechsle es. Ich hatte keine religiöse Erziehung. War es das Evangelium des Matthäus? Oder das des Lukas? Dort jedenfalls hat er Jesus kennengelernt, und er wollte werden wie er. Und Jesus, mein lieber Augustin, ist der erlauchteste Charismatiker, der je gelebt hat. Wusstest du das nicht? Von ihm hat Camille gelernt, wie man aus sich einen Charismatiker macht. Und es ist ganz leicht.«
»Erkläre es du mir«, bat Augustin.
Und sie erklärte es ihm …
Ich werde darauf bei anderer Gelegenheit zurückkommen, ich verspreche es, ich ahne durch die beschriebenen Blätter hindurch, das interessiert auch dich. An dieser Stelle würden Luciles Ausführungen den Fluss der Erzählung abermals aufhalten und lediglich der Charakterisierung Augustin Robespierres, einer für meine Geschichte unbedeutenden Nebenfigur, dienen. Nur so viel: Ich lernte, dass auch die Liebe, wie alles andere, wofür ihr Worte erfunden habt, nachgeahmt werden kann. Ihr Menschen könnt so tun, als ob ihr liebt. Werte es nicht als eine pädagogische Anmaßung, dass ich diesen Satz kursiv setze.
Lucile war eine glückliche junge Frau, die einen glücklichen jungen Mann zum Gatten hatte und bald einen klugen Kater als Haustier. Die Desmoulins waren eine glückliche Familie, denn schon bald kam ihr Sohn Horace zur Welt, und niemand anderer als wieder der schauerlich ernste Maximilien Robespierre war der Taufpate, und wieder erfand er eine Zeremonie, die in republikanischer Zukunft das Ritual der christlichen Taufe ersetzen sollte.
4
Als Camille Desmoulins von den Polizeibeamten der Comité de salut public abgeholt wurde, lachte Lucile laut, und nur eine kleine Heiserkeit beim Luftholen verriet, dass doch Sorge in ihr war; Sorge von der Art, die sich augenblicklich in Angst und Verzweiflung wenden kann, falls eine weitere ähnliche Nachricht einträfe. Sie hielt es für ausgeschlossen, für undenkbar, dass jemand ihrem Mann etwas antun könnte. Camille werde von der Natur persönlich beschützt; Camille, so erklärte sie ihrer Mutter, die in diesen Wochen bei uns wohnte, um ihrer Tochter im Haushalt zu helfen, Camille sei ein Liebling der Natur – favori de la nature –, wer seine Hand gegen ihn erhebe, dem treibe die Natur in eben diese die Gicht. Sie lachte die Männer aus, die an die Tür gepocht hatten.
Auch Camille lachte.
»Kommt herein, Bürger!«, lachte er und schlug dem Ersten freundschaftlich auf die Schulter – »Hat euch Fouché geschickt, der alte Arschkriecher?« –, knuffte dem Zweiten in den Arm – »Joseph Fouché hat bei mir Rhetorikstunden genommen, wisst ihr das nicht?« –, hielt dem Dritten die Hand hin – »Hat aber nichts genützt. Was soll’s! Ein Polizeiminister muss nicht reden können, es genügt, wenn er einsperren kann, und dazu braucht’s heutzutage nur einen Fingerzeig« – und zwinkerte dem Vierten zu, als wäre es bloß ein Spaß, der hier abgezogen werden sollte, aus welchem Grund auch immer.
»Sie sind verhaftet!«, sagte der Erste.
»Kommen Sie mit!«, der Zweite.
»Folgen Sie uns!«, der Dritte.
»Folgen Sie uns, Sie sind verhaftet, kommen Sie mit!«, der Vierte.
»Ihr müsst euch schon einig werden«, lachte mein Herr und zog seinen Rock an, denn sich zu widersetzen, wagte er doch nicht. »Oder habt ihr eurerseits bei dem feinen, feigen Fouché Rhetorikunterricht genommen, diesem Herrn, der in den Herzen unserer Revolutionäre herumkriecht wie der Bücherwurm in der Bibliothek?«
»Ihr werdet euch rechtfertigen müssen!«, sagte Lucile leise und lachte nun nicht mehr. »Und ihr wisst auch, vor wem ihr euch rechtfertigen müsst!« Sie meinte vor dem treuen Freund, dem Trauzeugen, dem Paten ihres Sohnes, vor Maximilien Robespierre; sie wusste ja nicht und hätte es auch nicht geglaubt, dass es eben dieser treue Freund gewesen war, der den Haftbefehl ausgestellt hatte – und nicht Fouché.
Luciles Mutter umarmte ihren Schwiegersohn stumm. Ich roch ihre Angst und strich um ihre Beine und ließ mich von ihr vom Boden aufheben.
»Ich werde heute Nacht in unserem Bett schlafen und nirgendwo anders!«, rief Camille durch das Stiegenhaus nach oben. »In deinen Armen werde ich schlafen, Lucile!«
So war seine Art. Er hatte mich manchmal in die Oper mitgenommen, das war eine Saison lang Mode gewesen, Katzen und kleine Hunde ins Theater mitzunehmen, auf der Bühne waren solche Worte gesungen worden, und dazu hatten die Sänger ähnliche Gesten vollführt wie Camille Desmoulins, als er zum letzten Mal in seinem Leben seiner Frau zuwinkte. Er hielt noch einmal inne, richtete seinen Blick aber nicht auf sie, sondern hinauf zur Decke des Stiegenhauses, und seine Stimme war nun dunkel und ohne die gespielte Zuversicht, er zitierte den römischen Dichter Horaz, wie er es so oft in seinen Reden getan hatte: »Denke, dass jeder Tag der letzte sein kann, der dir leuchtet«, und zitierte weiter, nun Michel de Montaigne, auf dessen Werk ihn Lucile aufmerksam gemacht und das er allen seinen Freunden empfohlen und vielen von ihnen, so auch Robespierre, geschenkt hatte, als sie noch gut miteinander waren: »Wo der Tod auf uns wartet, ist unbestimmt. Wir wollen überall auf ihn gefasst sein. Wer zu sterben gelernt hat, den drückt kein Dienst mehr. Sterbenkönnen – meine liebste Lucile – befreit uns von aller Knechtschaft, von allem Zwang.« Und damit lief er über die Stiege hinunter zu den Polizisten, die ihn zwischen sich nahmen.
Er schlief in dieser Nacht nicht in seinem Bett, lag nicht in den Armen seiner Frau. Man brachte ihn zusammen mit seinem Freund Georges Danton und zwölf anderen Freunden in die Conciergerie. Er wurde der konterrevolutionären Konspiration, der Korruption und der Aufwiegelung angeklagt. Antoine Saint-Just, der Mann mit der makellosen zarten weißen Haut, las die Anklageschrift vor. In derselben Stunde fällte das tribunal révolutionnaire das Urteil über meinen Herrn und seine Freunde: Tod durch die Guillotine.
Lucile und ihre Mutter warteten über die ganze Nacht, und ich wartete mit ihnen. Ich saß abwechselnd auf dem Schoß von Lucile und auf dem Schoß von Maman Anne, wie Camille seine Schwiegermutter nannte. Was für ein liebevolles Quintett waren wir doch gewesen – Camille, Lucile, der kleine Horace, Maman Anne und ich! Nun waren wir nur noch zu viert. Einmal hielt Lucile ihren Sohn im Arm, einmal wiegte ihn Maman Anne auf ihrem Schoß, erst schmuste ich mit der einen, dann mit der anderen Frau, dann kuschelte ich mich an das Kind. Es war die längste Nacht in Luciles und Maman Annes Leben. Es war die längste Nacht, die ich zu Hause verbracht hatte. Gewöhnlich streifte ich um diese Zeit durch die Gassen und Hinterhöfe, traf mich mit anderen Katzen und palaverte mit ihnen oder balgte mich mit Ratten oder lief vor einer Rotte davon und kletterte auf den nächsten Baum und fegte die Krähen von ihren Schlafplätzen. In dieser Nacht wollte ich meine Familie nicht allein lassen.
Als Lucile kurz eingenickt war, das Söhnlein schlief in der Wiege, trug mich Maman Anne hinaus auf den Balkon und setzte mich auf das Tischchen mit der kalten Steinplatte. Nun führte sie mit Armen und Händen ihre merkwürdigen Zeichen vor und schnalzte dazu mit der Zunge. Ich kannte das schon. Sie wollte mir etwas sagen. Nach langem Forschen, Nachdenken und Experimentieren war sie sich gewiss, eine Sprache gefunden zu haben, die wir beide, Tier und Mensch, verstanden. Ich verstand sie nicht. Aber weil sie gleichzeitig zum Fuchteln und Schnalzen auch mit Worten aussprach, was sie meinte, verstand ich sie doch, denn damals konnte ich Menschensprache bereits verstehen, gesprochen habe ich sie noch nicht. Ich möge doch eilig zu meinem Herrn laufen, sagte sie, und sie beschrieb mir genau, welchen Weg ich nehmen sollte, sie fürchtete, ich könnte von der Straße weggefangen werden. Ich solle mich ins Gefängnis schleichen, ich sei eine kluge Katze, die klügste, die ihr je begegnet sei, ich würde bestimmt ein Schlupfloch finden. Ich solle meinen Herrn trösten. Maman Anne glaubte, mehr als Trost sei nicht mehr möglich. Ihr Gesicht wurde hart, weil sie sich in die Wange biss. Sie glaubte, dass Camille Desmoulins, der erste Apostel der Revolution, den kommenden Tag nicht überleben werde. Sie und ich, wir wussten und hatten immer gewusst, dass der »ewige Freund« nie ein Freund, dass er immer ein Feind gewesen war.
Dreimal in der Woche war Maman Anne bei uns. Schon von Weitem hörte man ihre Kleider rascheln. Sie werkelte in der Waschküche im Innenhof, plättete die Hemden, badete ihren Enkel. Kochte Suppe. Das wäre nicht nötig gewesen, schließlich war Geld genug im Haus und auf der Bank, um eine breite Dienerschaft einzustellen. Aber Camille wollte keine Herrschaft sein. Er wollte nicht befehlen. Auch Lucile wollte nicht befehlen, und Maman Anne wollte es auch nicht. Lucile liebte ihre Mutter und wurde von ihr geliebt, und nie habe ich die beiden streiten hören, immer waren sie einer Überzeugung gewesen. In jener Nacht aber haben sie sich gestritten.
Maman Anne sprach mit mir, über den Hausdächern dämmerte es, und bald sprach sie, ohne dabei zu schnalzen und zu fuchteln. Sie schüttete ihr Herz aus. Sie liebte ihren Schwiegersohn, und sie teilte seine Ansichten, sie verehrte ihn, und wann immer es günstig war, nannte sie ihn »den ersten Apostel der Revolution«. Besonders gern nannte sie ihn so, wenn Freunde uns besuchten. Sie wünschte sich, dies werde der Adelstitel für Camille Desmoulins werden. Sie sprach zu mir über den »ewigen Freund« und auch über den jungen Mann mit der zarten weißen makellosen Haut.
»Ungeheuer sind sie«, flüsterte sie und streichelte dabei meinen Kopf. »Teufel sind sie. Sie kennen keine Freundschaft. Sie kennen keine Liebe. Sie kennen keine Dankbarkeit. Es schreckt sie nicht ein schlechtes Gewissen. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi a ceux qui nous ont offensés. Auch wenn es keinen Gott gibt. Sie werden unseren lieben Camille töten, sie werden ihn töten, sie werden ihn töten …«
So flüsterte sie auf mich ein, aber immerhin laut genug, dass es Lucile hören musste, die in die Balkontür getreten war. Ich habe sie gesehen und habe versucht, Maman Anne ein Zeichen zu geben, aber im Gesicht von Meinesgleichen gibt es für euch nichts zu sehen und nichts zu erkennen, und Maman Anne sprach weiter und weinte, und Lucile konnte alles hören.
Die beiden Frauen haben sich gestritten. Lucile ist laut geworden, und Maman Anne hat sie zurück in die Wohnung gedrängt, damit die Nachbarn nicht hören könnten, was sie sagte.
Sie sagte nämlich, sie werde sich sofort aufmachen und die Freunde von Camille aus den Betten trommeln, damit sie sich zusammentun und die Conciergerie stürmen, wie Camille die Bastille gestürmt habe, und die Gefangenen befreien und jene ins Gefängnis sperren, die es verdienten, sie werde durch die Straßen laufen zum Haus von Maximilien Robespierre und ihm von der Ungeheuerlichkeit berichten, die sich hinter seinem Rücken zusammenbraue … Maman Anne kniete nieder und betete, auch wenn es keinen Gott gab. Délivre-nous du mal.
Lucile war schon aus dem Haus, und wir drei blieben zurück, Maman Anne, der kleine Horace und ich. Und vor Erschöpfung schliefen wir ein und schliefen bis weit in den Tag hinein.
Zu spät lief ich los, zu spät, um zu trösten; ich wusste, wohin ich zu laufen hatte, nicht zur Conciergerie, sondern zur Place de la Révolution, wo die Blutseen waren, die jede Katze in der Stadt kannte …
Denk also nicht: Was kann mir schon ein Kater erzählen! Du wirst dich wundern, Freund, was dieser Kater dir alles erzählen kann! Die Werke über die große Revolution, die ich im Laufe meiner sieben Leben gelesen habe, würden eine hohe und lange Wand verdecken, wenn sie dicht an dicht auf Regalbretter gereiht würden. Aber nicht nur über diese Zeit, über alle Zeiten, in denen ich lebte, habe ich gelesen, und auch über die Zeiten, in denen ich nicht gelebt habe. Und nicht nur historische und politische Bücher habe ich gelesen; auch Pneumatologie, Kriminalistik, Schamanismus, ernährungsbedingt ein wenig Ornithologie und leider auch wissenschaftlichen Atheismus habe ich durchaus studiert; und nur eurem Dünkel könnt ihr es verdanken, dass ich nicht mit Stiefeln und Federhut in euren Universitäten aufmarschierte, um zuhauf Magister- und Doktortitel summa cum laude einzusammeln und abzuholen. Nein, ich weiß nicht alles über alles. Aber was soll’s! Mir will darüber das Herz nicht verbrennen. Wie gewissen anderen. Strebern! Ich halte es mit einem eurer Philosophen, der sagte, die Irrtümlichkeit der Welt, in der wir zu leben glauben, sei das Sicherste und Festeste, dessen unser Auge habhaft werden kann. Und wenn ich nur begreife, wie ein Faden durch ein Nadelöhr gezogen wird, ist es für mich, den Kater, ein Gewinn. Aber ich lebe ja nur; ihr führt ein Leben.
5
Mein erster Herr also war: Benoît Camille Desmoulins, der Bestürmer der Bastille, der schneidigste Reden- und Artikelschreiber der Revolution, der selbsternannte Generalprokurator der Laterne – worunter er einen Spezialisten im Fach Aufknüpfen verstand –, der gefürchtete Herausgeber verschiedener Zeitungen – um zu nennen Les Révolutions de France et de Brabant oder La Tribune des Patriotes oder Le Vieux Cordelier –, der treue Sekretär von Danton, als dieser Justizminister war, weiters Mitglied des Nationalkonvents, Mitglied des Club des Cordeliers und Mitglied der Freimaurerloge Neuf Sœurs – die besonderen Wert darauf legte, dass bei ihren Treffen ausschließlich über Philosophie und römische Geschichte, niemals aber über gegenwärtige Politik debattiert wurde, weshalb auch der Vorschlag zur Abstimmung vorgelegt worden war, intern nur Latein zu sprechen, ein Vorschlag, den Camille Desmoulins selbstverständlich unterstützte … Außerdem war er ein hübscher Mann – aus den Augen einer Katze betrachtet: Diese dichten Brauen, die sich über der Nasenwurzel berührten, waren eigentlich kleine Felle, das Haupthaar eigentlich ein schwarzer Pelz! Erst war er Bruder und ewiger Freund, dann Freivogel und Feind von Bürger Maximilien Robespierre – der wiederum erst meines Herrn Trauzeuge und Gevatter seines Sohnes war, dann sein Vernichter und der Vernichter seiner Frau. – Ja, Robespierre, niemand anderer, war es gewesen, der den Haftbefehl und schließlich das Todesurteil unterschrieben hatte! Wem der Sinn danach steht, eine Biografie über diesen ehrenwerten Herrn zu verfassen, der möge sich bei mir melden; er wird Dinge erfahren, die er in keinem Archiv findet, aber er soll sich beeilen, denn ein Katzenleben ist kürzer als ein Menschenleben, und ich befinde mich am Ende meines letzten. Ich habe auch Saint-Just gekannt, den jungen Mann mit der zarten weißen makellosen Haut, unter der eine quälende Missgunst gegen jeden brodelte, der auch nur eines geraden Blickes mächtig war; und natürlich Danton, den freundlich Polternden, den habe ich auch gekannt, zweifellos ein Stern der Zeitgeschichte. Auch Georges Couthon war bei uns zu Gast gewesen, pure Galle; ein missmutiger und mürrischer Geist, der, wie Michel de Montaigne diese Art von Charakter beschrieb, über die Freuden des Lebens hinwegschleicht und lieber auf dessen Widerwärtigkeiten verweilt, um sich daran zu weiden. Ich habe mir von Mirabeau das Fell kratzen lassen und von Jacques-René Hébert, die Finger des einen rochen nach seinem eigenen Geschlechtsteil, die Finger des anderen nach Kernseife. Pierre Philippeaux bin ich zwischen die Beine gelaufen, so dass er stolperte, und genauso Hérault de Séchelles, dem ich etwas nicht Unwesentliches verdanke und den ich aus diesem Grund, aber nicht nur deshalb, besonders gern mochte und in der Erinnerung mehr hätschle, als er es wahrscheinlich verdient. Dem grausamen François-Joseph Westermann mit dem Gesicht wie ein Wasserspeier von Notre-Dame habe ich mich angeschmeichelt, ich geb’s zu; und dem schmierigen Stanislas Fréron bin ich auf den Schoß gesprungen und ebenso der lustigen Madame Roland, sie war mir lieber als die beiden.
Robespierre aber konnte ich nicht leiden. Schon nicht, als er noch der Freund meines Herrn und meiner Dame gewesen war – oder so getan hatte, als wäre er es. Hätte ich damals bereits mit eigenen Worten sprechen können, ich hätte die beiden vor ihm gewarnt. Dieser Mensch lächelte selten, und wenn, dann auf eine Weise, als verachte er jeden, den irgendetwas zum Lächeln bringen kann. Der ist einer, dachte ich bei mir, der würde lieber gar nicht leben als unter einem Wesen, wie er selber eines ist. Er erzählte nichts von sich, es war, als hätte er keine Vergangenheit, er schrieb keine Gedichte, hatte nie welche geschrieben, im Unterschied zu so vielen seiner Genossen, er führte kein Tagebuch, er überließ es einem seiner Sekretäre, ein Diarium zusammenzustellen, in dem es aber ausschließlich um politische Dinge gehen sollte. – Robespierre roch nach Tod.
Stell dir scharfen Chili vor, der in einer Pfanne erhitzt wird. Hast du? Gut. Kennst du den Geruch von verbranntem Eisen? Denk an Schweißarbeiten! Hast du? Gut. Nun vermische diese Gerüche und verdünne sie in einem Verhältnis von eins zu zehn mit dem faden Duft von faulendem Gras. – So riecht der Tod. – Wenn einem Menschen dieser Geruch anhaftet, ist er für uns Katzen gekennzeichnet. Er kann sich schrubben, er kann ins Schwitzbad gehen, er kann sich parfümieren, es nützt ihm nichts – wir riechen den Tod. Wie kann das sein, fragst du. Und woher er das weiß, fragst du wieder, er, ein Kater. Es ist ein Erkennen der eigenen Existenz. Wir Katzen riechen auch nach Tod. Gewiss nicht so intensiv wie euer Robespierre. Aber doch.
Ich kannte eine alte Katze, die war, wie ich heute, in ihrem siebten Leben, ihrem letzten, und ähnlich wie ich verfügte sie über ein ausgezeichnetes Gedächtnis, das weit in ihre früheren Leben zurückreichte. Lesen und schreiben konnte sie nicht – ohne prahlen zu wollen, möchte ich feststellen: Ich bin die einzige Katze, die das kann und je konnte. Aber Mohrle, so hieß sie, hatte in ihren verschiedenen Leben bei Menschengesprächen immer gern und genau zugehört. Sie war irgendwann, ich glaube, in ihrem dritten Leben, die Katze eines Wissenschaftlers gewesen, eines Theologen an der Universität von Coimbra in Portugal. Sie erzählte mir von einem Gespräch zwischen ihrem Herrn und einem seiner Kollegen. Der Kollege habe die Meinung vertreten, der biblische Kain, der seinen Bruder Abel erschlug, euer erster Mörder, der sei es gewesen, der uns Katzen domestiziert habe; alle anderen Tiere seien von Abel domestiziert worden, nur wir Katzen von Kain, und Kain habe an uns weitergegeben, was er war. Und so sei der Geruch des Todes auf uns gekommen. Ihr Herr habe, so erzählte Mohrle, laut aufgelacht und ausgerufen: Stammen wir nicht alle von Kain ab? Ja, habe der Kollege heiter geantwortet: Das ist wohl wahr, aber ein guter Teil ist auch Abel in uns, und Abel ist die Liebe. Das Gemisch, das Gemisch entscheidet.
Einmal hörte ich Robespierre – nicht über einen Adeligen, nicht über einen Konterrevolutionär! – über einen seiner Anhänger sagen: »Ich hege keinen Groll gegen ihn, aber ich hasse schon seinen bloßen Anblick.« Mein Herr empörte sich. Seine Frau, die liebe Lucile, aber blieb ruhig. Sie sah Robespierre direkt an – was der nicht aushielt, er senkte den Blick –, und sie sagte: »Das geht doch nicht, Maximilien. Wie kann man jemandes Anblick hassen, gegen den man keinen Groll hegt?« Robespierre antwortete ihr nicht. Nicht, weil er keine Antwort gewusst hätte, er wusste immer eine Antwort, sondern weil er in Lucile verliebt war und, ähnlich wie sein Bruder Augustin, sich in sich verwirrte, wie er mit einem solchen Gefühl umgehen sollte, aber auch nicht über die schauspielerischen Fähigkeiten verfügte, Liebe nachzuahmen. Im Unterscheid zu den meisten Historikern, Psychologen und Philosophen bin ich dennoch der Meinung, dass dieser Mann sehr wohl in der Lage war zu lieben, nur unterschied sich seine Art von der anderer: Hass und Liebe waren bei ihm eins. Und das war wohl auch der Grund, warum die Brüder Maximilien und Augustin Erregungen dieser Art hilflos gegenüberstanden: Sie konnten sich nicht entscheiden, weil sie nicht unterscheiden konnten. Der Colega von Mohrles Herr würde über Robespierre gesagt haben: In ihm war kein Tropfen Blutes von Kains Bruder Abel. Aber immerhin Sehnsucht danach.
Maximilien hat mir nie etwas mitgebracht. Eine Zeit lang besuchte er uns jeden Abend; er hat mir nie das Wollknäuel geworfen, und wenn er mich streichelte, handelten seine Finger seinem Willen zuwider. Dagegen mein Herr: Schon als seine Zeit und sein Leben eng geworden waren, versäumte er es nicht, wann immer wir aufeinandertrafen, mir seine Faust hinzuhalten, damit ich mit meinem Kopf dagegen boxe. Als Mitglied des Konvents hatte er mit einem kleinen Fingerhochheben über Sein oder Nichtsein eines Mitmenschen entschieden, und das Leben und die Gesundheit dieses Mitmenschen waren ihm kein reuiges Schlucken wert; er radierte einfach das Vorhängsel »Mit« aus, und schon war da nur ein Mensch, mit dem er nichts gemein hatte, außer dass er gleich war wie er. Aber wehe, jemand hätte seiner Katze etwas zuleide getan oder zuleide tun wollen oder nur gesagt, er wolle, oder nur gedacht, er könnte eventuell wollen, er hätte ihn in seiner Zeitung angeprangert und ihm eine Schuld untergeschoben, die nur mit der Guillotine würde beglichen werden können.
Viele fürchteten meinen Herrn; und sie fürchteten sich allein vor seinen Worten, denn was seine Knochen, Sehnen und Muskeln hergaben, ging wenig Bedrohliches von ihm aus. Er war ein schwächlicher Mann, der zwar beim Reden mächtig ausholte, aber die Fäuste waren ihm zu weich, um auch nur eine Vase von der Kommode zu hauen. Seine Reden waren mächtig, weil er sie nicht nur mit Argumenten führte, wie es Robespierre tat. Der Unbestechliche vertraute auf die Unbestechlichkeit der Argumente; Argumente, meinte er, versuchen nicht, die Vernunft zu bezirzen, sie überzeugen. Camille dagegen wusste, der Mensch besteht nicht nur aus Vernunft, die Vernunft ist Tünche, darunter schwelt das Gemüt, und dem Gemüt schmecken Argumente nicht besonders, es will mit Geschichten gemästet werden. Deshalb spann er seine Argumente immer um eine Geschichte herum oder in eine Geschichte ein, und die Geschichten nahm er von überallher, mit Vorliebe aus der Mythologie. Er erzählte von den Göttern und den Titanen, von Odysseus, Ödipus, Minos und Achill, vom Krieg um Troja und vom Krieg um die Stadt Theben, er erzählte vom Bruderzwist zwischen Atreus und Thyestes, von Jason und Medea, die in ihrer besessenen Liebe sowohl ihre eigenen Kinder als auch ihren Bruder tötete, und er erzählte von dem Mann Moses und seinem Volk, den Israeliten, die aus Ägypten ausgezogen waren, weil sie dort in Fron und Unterdrückung gelebt hatten, und er fand am Ende immer einen Haken, an dem er aufhängen konnte, was für seine Zuhörer aus der Geschichte zu lernen sei. Am liebsten nahm er in seinen Reden Bezug auf Begebenheiten aus der römischen Historie, berichtete von Exemplarischem aus dem Leben des Scipio Africanus und des Julius Cäsar, aus der Regierungszeit von Kaiser Augustus und Kaiser Claudius, streute Anekdoten ein über Cato den Älteren, Marc Aurel und Seneca, den er besonders verehrte. Seine Zuhörer waren wie hypnotisiert, denn der große Camille Desmoulins, eben der schneidigste Redenschreiber der Revolution, hatte die Gabe, so lebhaft zu erzählen, dass jeder sich einbilden durfte, er sei auf weniger als zwei Meter Abstand dabei. Wenn er die bloße Hand schwang, duckten sie sich, als holte er zu einem Streich mit dem Schwert aus; wenn er von dem Marsch des Spartacus auf Rom berichtete, unter der glühenden Sonne, dann lief ihnen der Schweiß über das Gesicht; und wenn er auf jemanden mit dem Finger deutete und dabei so tat, als wäre er selbst Brutus, der andere aber Antonius, dann fühlte sich der andere als Antonius und zog ein Gesicht wie dieser. Was der Redner seinen Zuhörern dabei an Gesinnung eintrichtern wollte, das schluckten sie bereitwillig, ohne es ihrem Verstand als Vorkoster vorzulegen. Sie liebten Camille, weil er sie aus ihrem Krimskrams heraus in die Welt der Helden führte, und wenn es nach ihnen gegangen wäre, hätte nur er reden sollen, sie wollten keinen Saint-Just, keinen Robespierre hören, schon gar keinen Couthon. Das Volk von Paris, soweit es im großen Saal der ehemaligen königlichen Reitschule, der Salle du Manège, Platz hatte, wollte Danton hören und Desmoulins, und Danton am liebsten, wenn er nach Stichworten redete, die ihm sein Freund aufgesetzt hatte. In den Nächten trug Camille sich selbst seine Reden laut vor, um ihren Klang zu prüfen. Ich hörte zu und merkte mir jedes Wort.
Wir Tiere haben ein feines Gespür für Autorität; wir wissen nicht, was Freiheit, was Gleichheit, was Brüderlichkeit bedeuten, und sind deshalb nicht frei, nicht gleich, und Brüder sind wir auch nicht; aber wen wir fürchten müssen, das wissen wir. Ich habe von meinem Herrn gelernt, diese drei großen Begriffe zu begreifen und zu unterscheiden, und ich begriff, dass es Worte sind, Worte, Worte, Worte. Als ob nicht alle Worte Beutel wären, in welche bald dies, bald jenes, bald mehreres auf einmal gesteckt wird! Ich wollte sprechen lernen, und ich habe es gelernt. Ich habe mir Zutritt verschafft zu dem himmlischen, luftigen, gefährlichen Bezirk der Worte. Robespierre hat Camille Desmoulins aufs Schafott geschickt, weil er seine Worte fürchtete.
6
Ich sah zu, wie Camille das Podest bestieg, über dem sich die Guillotine erhob – jene Bretter, die Elend, Angst und Blut bedeuteten, ein Gatter darum herum und Eckpfosten mit gedrechselten Holzkugeln obendrauf, als wären es Modelle für die abgeschlagenen Köpfe. Die Chemise hatte man ihm von den Schultern gerissen, wie eine Schürze hing sie ihm über die Hose, noch weiß, noch. Er hielt kurz inne, bat den Henker, ihm die Fesseln zu lösen, was der auch tat. Und nun streckte er den Arm aus, kreiste langsam den Horizont ab, den Zeigefinger auf die Tausenden gerichtet, die ihn mehr liebten als Danton und deren Tränen, würde man sie ihnen in diesem Augenblick aus den Augen gezapft haben, den Goldfischteich im Schlossgarten von Versailles gefüllt hätten. Und nun spuckte er auf die elende Canaille, die von Collot d’Herbois und dem lahmen Couthon – diese beiden habe ich näher kennengelernt, als mir lieb war, ein sadistischer Scharlatan der eine, ein bitterer Krüppel der andere – für ihr Schmähgezeter bezahlt wurde und sich nach vorne gedrängt hatte in der hämischen Hoffnung, meinen Herrn und seine Freunde flennen und beten zu sehen. Aber – kein Flackern im Blick meines Herrn, kein Zittern seiner Lippen! Was Desmoulins berührt, sagte man einst, schmückt er mit leichter Hand; wen er anschaut, der sieht die Barmherzigkeit. Aus der Gosse hat er mich gehoben. Und nun stand er auf dem Schafott. Und nicht weiter als einen Katzensprung von ihm entfernt war ich.
Als einer der Henkersknechte, Söhne des Scharfrichterbetriebs Sanson, des Monsieur de Paris, ihn am Arm packen wollte, brüllte er, dass es über die Place de la Révolution hallte, und die Canaille unter ihm gab Ruh.
»Mon crime, mon seul crime est d’avoir versé des larmes!«
Ein Schmerzgebrüll, nein, war es nicht. Ein Angstgebrüll, nein, war es nicht. Später sind meinem Herrn weitere Worte in den Mund fantasiert worden, größere Worte; letzte Worte, die er dem Volk und der Zukunft zugerufen habe, der Zukunft Frankreichs, der Zukunft der Welt. Das ist Spinnerei. Ich war dabei. Ich hab’s gehört. Nur die Klage darüber, dass sein einziges Verbrechen gewesen sei, Tränen vergossen zu haben – nicht seinetwegen, sondern Tränen um seine Frau und seinen Sohn und die Frauen und Söhne, die weiter unter dem Terror zu leiden hätten. Zugegeben, ein bisschen larmoyant für einen, der nicht lange zuvor die Guillotine liebevoll »das Rasiermesser der Nation« genannt hatte. Aber wenn du einem Delinquenten, gleich, wer er ist, angesichts dieser blinkenden Axt nicht einmal ein bisschen Larmoyanz zugestehen willst, dann … – ja, dann hast du kein Herz in der Brust, dann bist du einer wie Saint-Just – der uns nur einmal besucht hat und nie wieder –, dann darfst du davon faseln, es gebe kein Glück ohne Mut und keine Tugend ohne Kampf; dann bist du ein Prinzip, das nicht blutet, wenn man es sticht.
Bürger Sanson, der Scharfrichter, bat meinen Herrn, den Kopf in das Halsbett der Guillotine zu legen – mit einer Geste, als weise er ihm Platz zu auf einer bequemen Chaiselongue. So richtete mein Herr den Blick nun nach unten, notgedrungen. Und unten war ich. Er hat mich angesehen. Sein Auge war in meinem und meines in seinem, bis das Eisen fallen würde.
»Camille«, rief ich mit Menschenstimme, »erkennst du mich?«
Ich sah, wie sich sein Blick weitete. Ich erhob mich auf meine Hinterbeine, stand hoch, stemmte die Vorderpfoten in die Hüfte, um das Gleichgewicht zu wahren. »Erkennst du mich denn nicht, Camille? Ich bin es, Matou. Ich habe dir gehört. Ich gehöre dir immer. Maman Anne hat mich geschickt, um dich zu trösten, leider weiß ich nicht genau, wie das geht.«
Er stieß einen tiefen Seufzer aus. Oder war es ein Stöhnen? »Bürger Sanson!«, rief er, und seine Stimme überschlug sich. »Bürger Sanson, hörst du das? Halt inne!«
Der Bürger Sanson hatte in seinem Scharfrichterleben schon so viel gehört, so viele Schreie und Bitten, innezuhalten, und letzte Fragen, erstaunte Ausrufe, Flüche, Verwünschungen – hätte er sich jedes Mal die Zeit genommen, sich niederzubeugen, um dem Delinquenten sein Ohr zu leihen, er hätte längst einen krummen Rücken und ginge am Stock und würde der Wohlfahrt auf der Tasche liegen.
»Camille«, sagte ich, »aber ich bin auch aus freien Stücken gekommen, weil ich mich von dir verabschieden möchte und um dir für alles zu danken, was du für mich getan hast. Dass du mich aus dem Dreck geholt hast und mich mit deinen Händen gewaschen hast und mir Milch zu trinken und gehackte Leber zu fressen gegeben hast.«
»Bürger Sanson!«, rief er wieder, und in seinen Augen konnte ich nun tatsächlich Angst sehen, aber es war nicht die Angst vor dem Messer hoch über ihm, und auch heilige Entzückung konnte ich sehen, aber es war nicht ein Entzücken vor dem höchsten Wesen, vor das er – eventuell – gleich treten würde. »Bürger Sanson«, rief er wieder, »Bürger Sanson, hörst du das denn nicht? Halt ein! Etwas Ungeheures geschieht hier gerade!«
Ich sprach weiter und stand weiter aufgerichtet auf meinen Hinterbeinen, die Pfoten in die Hüfte gestemmt: »Camille, heute Morgen war ich bei den Hallen und schlich an den Metzgereien vorbei und sah die Hasen, denen das Fell abgezogen war, in Reih und Glied lagen sie auf den Tischen, nebeneinander und übereinander, blankes rosenfarbenes bläuliches Fleisch. Die Köpfe aber waren noch dran, und die Köpfe waren, was sie im Leben gewesen waren: Hasenköpfe mit Augen, Ohren, Zähnen und Fell. Damit die Hausfrau weiß, es ist ein Hase und keine Katze. Camille, im Namen von Meinesgleichen möchte ich dir danken, weil du in der Zeit, als du im Justizministerium an der Seite deines Freundes Danton tätig warst, ein Gesetz erlassen hast, das verbietet, dass Katzen gegessen werden.«
Schon griff der Bürger Sanson nach dem Strick …
»Wo bin ich ohne dich, Camille?«, flehte ich. »Was heißt denn das – die Welt? Was bedeutet dieses Wort? Du hast mich in die Welt hineingetragen und lässt mich nun stehen? Wer bin ich, Camille?«
… mit dem der Mechanismus gelöst wird, der das scharfe Dreieckseisen auf den Nacken sausen lässt.
»Bürger von Paris«, rief mein Herr und versuchte, den Kopf zu heben, was ihm nicht gelang, weil sein Nacken in der hölzernen Krause steckte, »Bürger der Welt, seht ihr denn nicht, hört ihr denn nicht? Ein Wunder ist geschehen! Das Unwahrscheinliche hat sich in diesem heiligen Moment mit dem Wahren vereint! Was für eine Zeit, in der wir leben! O ingentem simul! Hört doch! Seht doch! Die Tiere spre –«
Da fiel das Beil – das Rasiermesser der Nation. Der Kopf von Camille Desmoulins, ehemals Revolutionär, kippte in den Korb und kam zu liegen Mund an Mund mit dem Kopf von Georges Danton, ebenfalls ehemals Revolutionär.
»Camille«, sagte ich, und es war nicht mehr als ein zartes Miauen, aber ein zärtliches zugleich, und ich beendete meinen hohen Stand und hockte mich nieder, »Camille, wem gehöre ich jetzt?«
Er war der Erste, zu dem ich in Menschensprache und mit eigenen Worten gesprochen habe; von ihm habe ich sie gelernt – ohne, dass er es wusste freilich. Meine Worte waren das Letzte, was er auf dieser Welt gehört, ich war das Letzte, was er von der Welt gesehen hatte. Sein Blut tropfte auf das Pflaster, und ich und Meinesgleichen leckten davon.
7
Was für ein Tag!
Ich wäre gern schon bei der Enthauptung von Danton vorne dabei gewesen. Ich war leider zu spät gekommen. Er war der freimütigste Freund meines Herrn; ich meine damit, er hatte freien Mut, ihn in Liebe zu loben und in Liebe zu tadeln, ohne Angst, mein Herr könnte sich von ihm abwenden oder sich an ihm rächen wollen; und er war auch mein Freund, mich aber lobte er nur. Wenn er bei Camille und Lucile zu Besuch war, brachte er mir manchmal eine besondere Delikatesse mit, Rinderaugen, und die Gesellschaft lachte, wenn ich sie vor mir her durch die Wohnung rollte und dabei knurrte und fauchte. Er steckte mich, als ich klein war und leicht wie ein Stück Kuchen, in seine Rocktasche und tat, als wäre dies mein angestammter Platz, und ich ringelte mich zusammen und schlief ein, und einmal hatte er mich vergessen, und erst als er schon auf der Straße war, merkte er, dass seine rechte Seite schwerer hing als seine linke, und brachte mich zurück, und wieder lachten alle, und ich war es gewesen, der sie zum Lachen gebracht hatte. »So einer müsste man sein!«, hatte mein Herr ausgerufen. »Er zählt jeden Tag als ein Leben für sich!« Und er war stolz auf mich. So muss das Götterlachen geklungen haben in jener goldenen Zeit, von der uns Homer berichtet. Wenn Camille, Lucile, Maman Anne, Danton und Marie-Jean Hérault de Séchelles schallende Götter und Göttinnen waren, dann hätte ich gern ihren Hephaistos gespielt.
Vielleicht wäre es auch für Danton eine innere Aufrichtung gewesen, mich unten vor dem Schafott zu sehen. Ich bin sicher, er hätte mich erkannt – kupferbraunes Katzenfell, weiße Pfoten und weiße Schwanzspitze sind selten. Aber es war ein weiter Weg vom einen Ende des Platzes bis zur Guillotine und dazu ein gefährlicher Weg, unter den Gaffenden hindurch, den Besoffenen und den brünstigen Weibern, die allesamt nichts lieber taten, als mit dem einen Fuß einer Katze auf den Schwanz zu steigen und mit dem anderen ihr den Kopf zu zertreten, und so bekam ich vom Fallen des Hauptes des Demosthenes der Revolution nichts mit, merkte nur am Gejohle über mir, dass es geschehen war. – Weg mit ihm! Rasch! Nur die Toten kommen nicht wieder!
Als ich die Pflöcke des Podestes erreichte, auf dem die Guillotine stand, strichen schon zwei Dutzend von Meinesgleichen darum herum, sie schleckten das Blut des Revolutionärs, das durch die Spalten zwischen den Brettern tropfte, wussten nicht, wer er gewesen war, hatten keinen Anteil an der Geschichte, in die er eingehen würde, und stritten sich trotzdem um die Plätze an den Pfützen.
»Hast du mit dem zu tun gehabt?«, fragte mich eine Graue, ihre Schnauze glänzte von frischem, ihr Bauch und ihre Beine waren braun und schwarz von altem vertrocknetem Blut.
»Nein«, log ich, »ich habe ihn nicht gekannt.«
»Also stell dich hinten an«, sagte sie.
Ein Kater drängte sich dazwischen. »Ich habe dich hier noch nie gesehen«, sagte er. »Ist einer von den abgeschlagenen Köpfen dein Herr? Oder einer von denen, denen er erst abgeschlagen wird?«
»Nein«, log ich zum zweiten Mal, »ich kenne keinen von denen.«
»Warum trippelst du dann so traurig?«, fragte eine Schmale mit hohen Beinen – vor den Schmalen mit den hohen Beinen habe ich mich immer in Acht genommen. »Wem trippelst du nach? Einem Lebenden oder einem Toten?«
»Ich tripple niemandem nach«, sagte ich, und es war wieder nicht die Wahrheit.
»Kennt einer von euch diesen Kater?«, rief die Hochbeinige den anderen zu.
»Nein«, wurde zurückgerufen. »Den kennen wir nicht. Den haben wir noch nie gesehen. Der geht uns nichts an.«
Nur mit wenigen von Meinesgleichen pflegte ich Umgang. Ich war ein »Alleiniger«. – Ihr sagt »Einzelgänger«. Aber was heißt das? Ich kapiere es nicht. Was ist, wenn er stehen bleibt? Ist er dann ein Einzelsteher? Oder wenn er sich hinlegt? Ist er dann ein Einzellieger? Oder wenn er läuft, rennt, auf einen Baum klettert, oder wenn er, was bei euch vorkommt, in einem See schwimmt? Mit einem unserer Philosophen, er konnte eure Sprache zwar nicht sprechen, verstand sie aber, habe ich mich einmal darüber unterhalten, wie unpräzise ihr in eurer Wortwahl seid. Er meinte, das sei Absicht. Durch die Vieldeutigkeit eurer Worte und Wendungen wollt ihr verschleiern, was ihr in Wahrheit denkt. – Ist es so? Ich frage dich.
Wir lebten in historischen Zeiten! Jawohl, auch wir Katzen! Der Zeitgeist, von dem einer eurer Philosophen spricht, sickerte bis in unsere kleinen Köpfe, und der Geist sagte: Alles, was bisher geschah, führt hin zu euch, ihr seid der Endpunkt, ihr seid die Krone der Geschichte, die Gegenwart hat immer recht, nach euch ist Wiederholung! Nachts in den Nischen palaverten unsere Philosophen. Das Wort führte ein angelsächsischer Tomcat, der war schon in seinem neunten Leben angelangt, er erzählte ohne Ufer, und wir hörten andächtig zu. Später habe ich nachgerechnet: Ihr habt in seinem ersten Leben gerade euer 15. Jahrhundert geschrieben. Er erzählte von der Eroberung Konstantinopels durch Mehmet II. und dass er eine von zweihundert Katzen gewesen sei, die der Sultan auf seinen Reisen mitgenommen habe, und dass der Pelz jeder Katze einen anderen Weichheitsgrad aufwies, so habe der Herr immer seinen Launen entsprechend streicheln können. Er erzählte vom Propheten, der angeordnet habe, wer eine Katze töte, müsse dafür siebzehn Moscheen bauen lassen. Er erzählte von Schweinen, die lateinisch geredet hätten, nachdem ihnen die Juden gestohlene Hostien zu fressen gegeben haben. Aber selbst dieser Kater bekam Konkurrenz auf dem Gebiet der Historie. Eines Tages trat eine Siamkätzin auf, niemand wusste, woher sie kam, größer als wir war sie, prächtiger, mit einem mächtigen Frauenbass sprach sie, begleitet wurde sie von einer Garde schwarzer Killer, einer links von ihr, einer rechts, einer hinter ihr, einer vor ihr, die erzählte uns Geschichten, die Mäulchen blieben uns offen stehen, auch das Mäulchen des angelsächsischen Methusalems. Im Halbrund um sie herum hockten wir, die Hälse hinauf zu den Giebeln gereckt, über die der Nachthimmel mit seinen Sternen wuchs. Und während sie erzählte, schaute sie einen nach dem anderen an, am längsten aber verweilte ihr Blick auf mir. Ihr erstes Leben habe sie ebenso im Schatten einer Tötungsmaschine zugebracht wie nun hier ihr letztes, erzählte sie, nur hätten damals die Menschen ihren Mitmenschen nicht mit der Guillotine den Kopf abgeschlagen, sondern hätten sich gegenseitig ans Kreuz genagelt durch Hände und Füße hindurch. Von dem bereits zweimal von mir erwähnten Herrn Jesus Christ erzählte sie, der unter den ans Kreuz Genagelten der berühmteste gewesen sei. Es habe, predigte sie, nie einen Berühmteren gegeben als ihn, und auf seinem Schoß sei sie gesessen, seine Fingernägel hätten die Läuse in ihrem Pelz zerquetscht, nie einen Klügeren habe es gegeben, ein Zauberer sei er gewesen, aus einem Fisch habe er Tausende werden lassen, aus einem Krug Wein tausend Krüge, nie habe es einen Helden gegeben, der heller strahlte, dagegen seien Robespierre und Konsorten Glühwürmchen am Ende der Nacht. Sie bestätigte, was Lucile Augustin Robespierre erklärt hatte, nämlich dass dieser Mann das Charisma erfunden habe, dieses seltsame unsichtbare Ding, hinter dem die Revolutionäre her seien wie wir Katzen hinter den fetten sichtbaren weißen Klostermäusen. Und sie erzählte weiter, dass der Herr Jesus Christ eine gewisse Verwandtschaft mit uns Katzen habe, denn auch er sei nach dem Tod wiederauferstanden, habe sozusagen ein zweites Leben angetreten, so dass durchaus vermutet werden dürfe, diesem sei ein drittes und viertes, wer weiß, ein fünftes, sechstes, siebtes gefolgt. Unsere Philosophen lachten sich einen Buckel und fragten sie, wer ihr denn diesen Unsinn eingeplappert habe, das wisse nun wirklich jeder bis hinunter zu den angeführten Glühwürmchen, dass nur wir Katzen nach dem Tod wiederkehren … Die schwarzen Kater zu ihrer Linken und ihrer Rechten fauchten und auch der vor ihr und der hinter ihr, und sie zeigten ihre Zähne, die Siamkätzin aber zitierte den großen Mann: »Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt, und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben.«
Auf Georges Danton folgten zwei seiner Freunde, und erst nach ihnen kam der Bürger Desmoulins, mein lieber Camille, dran. Der Henker köpfte nach dem Alphabet. Ich drängte mich an den Katzen vorbei, stellte mich vor das Gerüst, erhob mich auf meine Hinterbeine, stemmte meine Vorderpfoten in die Seite und redete mit Menschenzunge. »Camille«, rief ich, »Camille, erkennst du mich? Ich bin es, Matou, dein Katerchen!«
Was für ein Tag! – Aber er war noch nicht zu Ende …
8
Scurra in umbra mortis sits. – Der Narr hockt im Schatten des Todes. Zwölf Köpfe hat der unermüdliche Charles-Henri Sanson an diesem Nachmittag mithilfe seines Apparates abgehackt. Es schien, als wäre er tatsächlich nicht müde zu kriegen, Tod häufte er auf Tod. Nachdem mein Herr drangekommen war, mochte ich nicht weiter zuschauen, schnell wollte ich nach Hause laufen zu meiner Dame und sie trösten. Lucile würde weinen und weinen und weinen und mich an sich drücken, das wollte ich gern haben und haben und haben. Durch den Blutsee zu waten, wäre pietätlos gewesen, und dann mit blutverkrusteten Pfoten auf Luciles Schoß springen, nein! Also suchte ich mir einen trockenen Weg unter der Bühne des Todes hindurch. – Und da hockte sie, die Närrin.