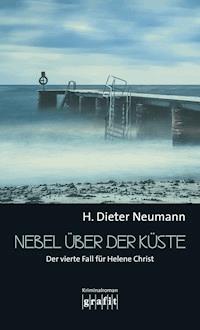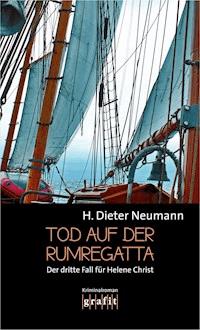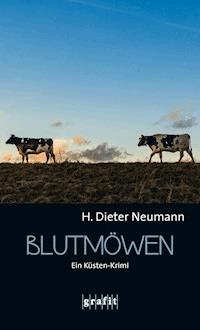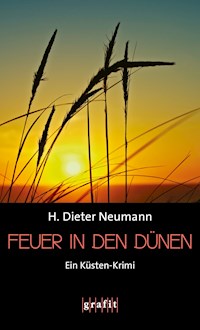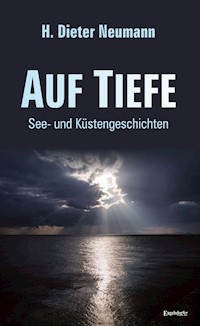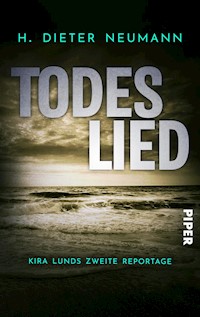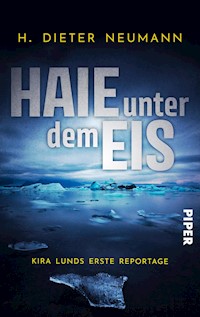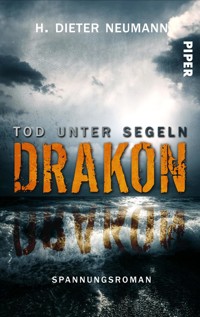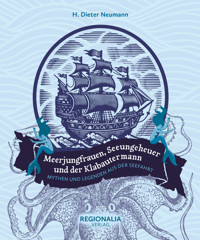
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Regionalia Verlag | Kraterleuchten
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Meerjungfrauen, Seeungeheuer und der Klabautermann – Mythen und Legenden aus der Seefahrt
Dieses Buch von H. Dieter Neumann entführt in die faszinierende Welt der Seefahrertraditionen und maritimen Mythen. Es ist ein umfassender Einblick in die Geschichten und Legenden, die die Seefahrt über Jahrhunderte geprägt haben.
Ob es um Geisterschiffe, wie den berühmten „Fliegenden Holländer“, um schaurige Seeungeheuer oder die betörenden Meerjungfrauen geht – das Werk bietet eine fundierte und unterhaltsame Reise durch die maritime Sagenwelt. Der Autor zeigt, wie Mythen wie der Klabautermann, riesige Kraken und mystische Wasserwesen entstanden sind, und verbindet diese mit den realen Ängsten und Herausforderungen der Seefahrer auf den Ozeanen.
Was dieses Buch besonders macht:
Vielfalt der Themen: Das Buch deckt ein breites Spektrum an Mythen ab – von abergläubischen Ritualen über Monsterwellen bis hin zu sagenhaften Wesen aus der Tiefe.
Historische Relevanz: Erfahren Sie, welche Rolle Seefahrtslegenden in verschiedenen Kulturen gespielt haben, von den Nordmännern bis zu den Seefahrern der Karibik.
Fundierte Recherche: Der Autor verknüpft die Mythen mit historischen und wissenschaftlichen Fakten, ohne den Zauber der Geschichten zu verlieren.
Abenteuerliche Bräuche und Rituale: Warum galt Pfeifen an Bord als Unglück? Wieso waren Katzen Glücksbringer, Hasen aber ein Tabu? Einblicke in die kuriosen Aberglauben der Seefahrt.
Dieses Buch richtet sich an alle, die sich für Seefahrt, Geschichte und Mythologie interessieren. Es ist ein Muss für Menschen, die mehr über die Ursprünge von Legenden wie dem Leviathan, der Meerjungfrau oder dem Klabautermann erfahren möchten. Auch für Liebhaberinnen und Liebhaber von Abenteuergeschichten, maritimer Folklore und kultureller Geschichte ist es eine wertvolle Ergänzung.
H. Dieter Neumann gelingt es, Mythen und Legenden in einen spannenden Kontext zu setzen und sie mit historischen Ereignissen zu verknüpfen. Sein Werk ist eine faszinierende Kombination aus Geschichtswissen, Abenteuer und Einblicken in die mystische Welt der Seefahrt. Perfekt für alle, die sich von Geschichten des Meeres inspirieren lassen möchten und gleichzeitig die historischen Hintergründe erfahren wollen.
Ein beeindruckendes Buch, das Wissen und Unterhaltung auf höchstem Niveau vereint – ideal für Mythenfans und Geschichtsenthusiasten gleichermaßen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Meerjunfrauen, Seeungeheuer Und Der Klabautermann
Mythen und Legenden aus der Seefahrt
H. Dieter Neumann
H. Dieter Neumann
Meerjungfrauen, Seeungeheuer und der Klabautermann
Mythen und Legenden aus der Seefahrt
1. Auflage 2025
Regionalia Verlag,
ein Imprint der Kraterleuchten GmbH, Gartenstraße 3, 54550 Daun
Verlagsleitung: Sven Nieder
Alle Rechte vorbehalten
Korrektorat: Tim Becker
Umschlag: Kerstin Fiebig
Illustrationen Innenteil: Anker © GraphicGoods, © Artness und Seemannknoten © Artness
Titelmotiv: Collage aus Illustrationen von © GraphicGoods, © subqistd, © Ijajil, © ghostlypixels (alle: envato) und © Pannawish Jarusilawong (iStock)
ISBN Print: 978-3-95540-420-8
ISBN E-Book 978-3-95540-432-1
www.regionalia-verlag.de
Inhalt
Willkommen an Bord!
1.000 Mythen aus 12.000 Jahren Seefahrt
„Irgendwo stirbt gerade ein Seemann!“
Vom Aberglauben der Matrosen, von kultischen Sitten und ehernen Gesetzen
Wassermänner und Meerjungfrauen
Sagengestalten des Meeres
Seeungeheuer
Über Seeschlangen, Riesenkraken und andere grauenvolle Monster aus der Tiefe
Geisterschiffe und Schiffsfriedhöfe
Von unheimlichen Erscheinungen und der fließenden Grenze zwischen Wahrheit und Mythos
Monsterwellen, Magnetberge und Phantominseln
Rätselhafte Phänomene, scheinbare Gewissheiten und gefährliche Irrtümer
„Er bläst!“
Vom Mythos um eine faszinierende Kreatur
Fluch der Karibik
Abenteuerliche Piratenlegenden aus aller Welt
Seemanns Glücksbringer
Über Rituale, Talismane und den Klabautermann
Quellenverzeichnis
Bücher von H. Dieter Neumann
Für Alma und Kalle
Gravur auf Papier, ca. 1590 (Bildnachweis: Gemeinfrei, Wikipedia)
Willkommen an Bord!
1.000 Mythen aus 12.000 Jahren Seefahrt
Römische Schiffe, Mosaik, Rimini (Bildnachweis: Gemeinfrei, Archiv des Autors)
Gewiss ein recht eingängiger Untertitel zur Einstimmung, aber kann man all die Mythen und Legenden rund um die Seefahrt überhaupt zählen? Nein, natürlich nicht. Und um es gleich vorweg zu nehmen: Wie viele davon es in den verschiedenen Kulturkreisen auf der ganzen Welt gibt, weiß natürlich niemand. Eines aber ist sicher: Ihre Anzahl ist immens, und allesamt entspringen sie dem ungeheuer erfindungsreichen Aberglauben der Seeleute, manchmal auch dem der Küstenbewohner. Dennoch liegt in einigen Sagen, mögen sie noch so unglaubwürdig daherkommen, ein Körnchen Wahrheit, und selbst der verrückteste Aberglaube der alten Salzbuckel1 hat oft einen realen Hintergrund.
Wir werden uns einige erstaunliche Mythen und Legenden ansehen, aber eben auch die aus ihnen erwachsenen, oft höchst eigentümlichen Sitten und Rituale. Längst nicht alle davon werden wir näher behandeln können, denn neben den mehr oder weniger bekannten existieren einige sehr private Rituale, die man erst kennenlernt, wenn man an Bord eines fremden Schiffes kommt. Auch sie entspringen meist altem Aberglauben, zuweilen jedoch auch dessen moderner Form, der Esoterik. Diese für Außenstehende oft unerklärlichen Sitten und Gebräuche haben (vor allem auf Sportbooten) vornehmlich den Zweck, Stimmung und Motivation der Crew zu heben, werden jedoch überwiegend nur noch zum Gaudium gepflegt.
Der Autor am Ruder des Traditionsseglers ENGELINA (Bildnachweis: Autor)
So habe ich einst auf der Ausbildungsyacht, auf der ich meinen Prüfungstörn für den Sport-Seeschifferscheingemacht habe, erlebt, dass ein Crewmitglied vom Skipper, einem alten Fahrensmann, lautstark angepfiffen wurde. Was hatte der arme Kerl verbrochen? In Ermangelung eines Löffels hatte er den gezuckerten Kaffee in seinem Becher mit einem Messer umgerührt. Mit Messern dürfe man nicht durch Wasser schneiden (Hier mag ein Rückschluss auf die Qualität des Kaffees erlaubt sein …), wurde ihm erklärt, das beschwöre Unheil über das Schiff herauf. Auf seine Bitte, den tieferen Sinn dieser Behauptung darzulegen, erhielt der Gescholtene bloß die knappe Antwort: „Das ist nun mal so.“ Na dann …
Noch ein Beispiel gefällig? Bitte: Auf der Segelyacht eines Freundes muss jeder, der laut rülpst, mit einer einschneidenden erzieherischen Maßnahme rechnen. Nicht etwa, weil das zweifellos nicht den Benimmregeln für kultivierte Menschen entspricht, sondern weil man damit angeblich Poseidon, Neptun oder in unseren nordischen Breiten eher Rasmus – jedenfalls den lokal zuständigen Meeresgott – beleidige. Zur Strafe muss der Übeltäter einen Schluck Hochprozentigen trinken und einen weiteren über die Reling ins Wasser gießen, um den Herrn über Wind und Wellen zu besänftigen.
Der Nährboden für all diesen „Spökenkram“, wie man derlei vermeintlich Übersinnliches (und die damit einhergehenden Handlungen) im Plattdeutschen nennt, hat sich über einen langen Zeitraum nach und nach aufgehäuft, denn nichts, was Menschen je getan haben, war mit so tiefem Aberglauben und, daraus resultierend, derart absonderlichen Ritualen verbunden wie die Seefahrt. Sie hat so viele Mythen und Legenden hervorgebracht wie kein anderer Lebensbereich. Und das hat einen einfachen Grund: Menschen suchen seit jeher nach Erklärungen für Phänomene, die sie nicht verstehen. Und gerade auf dem Meer gab und gibt es davon viele besonders beängstigende, oft genug lebensgefährliche.
Begreiflich also, dass sich Seeleute in der unermesslichen Weite der Ozeane einsam und verloren vorkamen. Den Horizont sahen sie fast täglich, doch markierte der auch eine klare Grenze – selbst für den Kapitän. Bis dorthin konnte er blicken, aber die Sichtweite begrenzte eben auch seine Handlungsmöglichkeiten. Ohne Funk konnte er über den Horizont hinaus nicht kommunizieren und von satellitengestützter Navigation noch nicht einmal träumen.
Nachdem sich auch unter ungebildeten Menschen weitgehend herumgesprochen hatte, dass die Erde keine Scheibe war, von der man herunterfallen könne,2 sondern dass es hinter dem Horizont immer weiterging, erschien die Welt erst recht unfassbar in ihrer scheinbaren Unendlichkeit. Daher flüchteten sich gerade die frühen Seefahrer zum Trost in Übersinnliches, glaubten an Zeichen und Wunder und erfanden Rituale, die Unheil abwehren sollten. So sind viele der maritimen Sagen entstanden, die wir noch heute kennen.
So lange man allerdings – trotz stetig wachsenden Wissensstands – immer noch zu wenig von den tatsächlichen (zum Beispiel meteorologischen oder anderen physikalischen) Ursachen gewisser Phänomene wusste, bildeten sich über die Zeit scheinbar sinnvolle ‚Erklärungen‘ heraus, mögen sie aus heutiger Sicht noch so abwegig sein – Aberglaube eben. Mit dem der Seefahrer wollen wir uns in diesem Buch ausgiebig beschäftigen, vorher aber kurz noch zu meiner Behauptung von 12.000 Jahren Seefahrt. Wie komme ich darauf?
Forschungsergebnisse legen nahe, dass frühe Menschen schon in der mittleren Altsteinzeit einfache Wasserfahrzeuge genutzt haben könnten. Wissenschaftlich nachgewiesen ist Schifffahrt jedoch bisher erst ab ca. 30.000 v. Chr., insbesondere in Ozeanien und Japan. Und archäologische Funde in Oberägypten zeigen, dass bereits um 12.000 v. Chr. rege Flussschifffahrt auf dem Nil stattfand. Aber erst etwa um 7.500 v. Chr. wurde damit begonnen, größere seegängige Wasserfahrzeuge zu bauen. Archäologische Funde dazu gibt es zum Beispiel auf Kreta oder in Irland.
Doch zurück zu unserem eigentlichen Thema, den geheimnisvollen Mythen und den oft skurrilen Ritualen der Seefahrer. Für diese gibt es – neben der schon erwähnten Unwissenheit über die Ursachen vieler Naturphänomene – noch eine weitere Erklärung.
Entstanden aus dem Versuch, das Unerklärliche fassbar zu machen, waren Seemannsgarn3 und seemännische Riten immer auch ein beliebtes Mittel zum Zeitvertreib. Denn keineswegs waren die Matrosen auf den alten Segelschiffen durchgehend gefordert. Es gab oft ganze Tage, gar Wochen, in denen der nötige Wind ausblieb, die schwerfälligen Rahsegler in brütender Hitze auf der glatten See dümpelten und sich kaum noch halbwegs sinnvolle Arbeiten für die Mannschaft an Bord fanden. Dann vertrieb man sich eben die Zeit mit Karten- und Würfelspielen und erzählte sich abenteuerliche Geschichten von blutrünstigen Seeungeheuern oder unheimlichen Geisterschiffen, von liebreizenden Meerjungfrauen und vom Klabautermann.
Press Gang der Navy bei der Arbeit in einem Pub, 1879 (Bildnachweis: Gemeinfrei, Archiv des Autors)
Kam der Matrose endlich wieder nach Hause (war dies für manchen auch nur irgendeine Kaschemme im Hafen), wollte er natürlich den Leuten von seinen sensationellen Erlebnissen erzählen. Für den Lohn eines ungläubigen Staunens der Landratten oder für ein paar Schnäpse sind viele Seefahrergeschichten entstanden, die dann die Runde machten, dabei immer weiter ausgeschmückt und so schließlich zur Legende wurden.
Wir dürfen heute natürlich über den oft lächerlich anmutenden Aberglauben der Seefahrer schmunzeln, doch sollten wir dabei nie vergessen, unter welch grauenvollen Bedingungen die Matrosen früherer Zeiten unterwegs waren: In irgendeinem Hafen für ein paar Münzen, mit viel Alkohol und nicht selten gewaltsam an Bord gepresst, führten sie für kärgliche Heuer unter elenden hygienischen Bedingungen ein hartes, oft sogar menschenunwürdiges Leben auf den Schiffen. Pökelfleisch mit durchnässtem, madigem Schiffszwieback und fauliges Wasser, schlimme Krankheiten, deren Ursache man nicht kannte, mangelhafte ärztliche Versorgung und eine Schiffsführung, die ihre Befehle oft mit roher Gewalt durchsetze, waren jahrhundertelang traurige Realität. Je länger die Reise dauerte, desto überreizter wurde die Stimmung an Bord. Manchmal versuchte die geknechtete Mannschaft aufzubegehren, meistens jedoch resignierten die Männer und ergaben sich ihrem Schicksal.
Hinzu kamen die vielen Gefahren des Meeres, denen sie ausgesetzt waren. Ob jemand im Sturm von hoch oben aus der Takelage fiel und auf Deck zerschmettert wurde oder über Bord ging und ertrank – der Tod war den Matrosen früherer Jahre ein ständiger Begleiter. Allein dadurch schon war die Saat gelegt für allerlei düstere Geschichten.
Aller Ursprung für Mythen, Legenden und Rituale an Bord jedoch war die stets mitsegelnde tief sitzende Angst vor dem Unerklärlichen, Geheimnisvollen und gerade deswegen so Bedrohlichen.
1Salzbuckel: Erfahrene Seeleute (Seemannsjargon)
2Im Gegensatz zu dem verbreiteten Irrtum, erst Galileo Galilei habe um das Jahr 1600 herum entdeckt, dass die Erde rund ist, war dies bereits im Altertum seit Aristoteles unter Gelehrten bekannt. Etwa um 200 n.Chr. berechnete der Grieche Eratosthenes sogar schon den Umfang der Erdkugel mit erstaunlicher Genauigkeit. Trotzdem hatten die meisten Menschen noch Jahrhunderte später von all dem keine Ahnung.
3Seemannsgarn ist ein vom Schiemannsgarn hergeleitetes Synonym für allzu unglaubwürdige Geschichten. Siehe: H. Dieter Neumann: HART AM WIND – Redewendungen aus der maritimen Welt , Regionalia Verlag 2024
„Irgendwo stirbt gerade ein Seemann!“
Vom Aberglauben der Matrosen, von kultischen Sitten und ehernen Gesetzen
Die Shanghai Express ist ein hochmodernes 366 Meter langes Containerschiff aus der riesigen Hapag-Lloyd-Flotte. Der Kapitän dieses Giganten der See ist zweifellos nicht nur ein erstklassiger Nautiker, sondern auch ein moderner, vielseitig gebildeter Mensch. Und dennoch zuckt er jedes Mal zusammen, wenn auf seiner Brücke jemand plötzlich zu pfeifen beginnt. Ich weiß das, denn er hat es mir einmal erzählt. Überrascht war ich nicht, schließlich segle ich seit über vierzig Jahren auf allen möglichen Schiffen und Booten. Daher kenne auch ich das eherne Gesetz: An Bord pfeift man nicht, das bringt Unglück! Jeder Seemann weiß das – seit tausend Jahren schon.
Warf früher, als es noch keine Dampf- oder Motorschiffe gab, ein Schiff im Hafen die Leinen los, wurde es stets von dem Ruf „Guten Wind!“ aus vielen Kehlen begleitet. Unter solchem verstand man – und tut das bis heute – möglichst gleichmäßigen Wind aus einer für den geplanten Kurs günstigen Himmelsrichtung. Leider traf beides nur selten über einen längeren Zeitraum zusammen. Häufig konnte man den direkten Kurs nicht fahren, sondern war gezwungen, hin und her zu kreuzen, weil man das Ziel anders nicht erreichen konnte. Also mussten immer wieder Anzahl, Art und Stellung der Segel geändert werden – besonders auf den Rahseglern eine üble und zeitraubende Plackerei, für die oft die gesamte Mannschaft gebraucht wurde. Zu wenig Wind war zwar auch eine Gefahr, denn eine lang andauernde Flaute warf nicht nur alle Reiseplanungen über den Haufen, sondern konnte darüber hinaus bedrohliche Auswirkungen auf die Moral der Mannschaft haben und sogar die Versorgung an Bord gefährden.
Seenotkreuzer im Sturm (Bildnachweis: iStock © Enjoylife2)
Weitaus schlimmer jedoch war zu viel Wind. Und das Schlimmste, was auf hoher See passieren konnte – abgesehen von Feuer an Bord, der schrecklichsten aller Katastrophen, die in nicht wenigen Fällen zum Totalverlust von Schiff und Mannschaft führte –, war ein schwerer Sturm. Vor den Urgewalten eines solchen brüllenden, in hohen Tönen um die Masten pfeifenden Unwetters, dem das Schiff in tosender See oft genug hilflos ausgeliefert war, hatte jeder Angst. Daher galt es, alles zu unterlassen, was den Wind „herausfordern“ könnte, vor allem vorwitziges Pfeifen an Bord. Dass man damit den Wind aus der Reserve lockt, ihn förmlich reizt, sich aufzublasen und mit Macht über das Schiff herzufallen, daran zweifelte seinerzeit kaum ein Fahrensmann. So wurde dieser Mythos geboren. Und das schon vor sehr langer Zeit.
Heute weiß natürlich jedes größere Kind, dass Wind nichts anderes ist als bewegte Luft, die beim Ausgleich von Luftdruck entsteht. Oder, anders ausgedrückt: Wind entsteht, weil Luft aus einem Bereich mit hohem Luftdruck heraus in einen Bereich mit niedrigem Luftdruck hinein fließt. Dabei bläst er umso heftiger, je höher der Druckunterschied ist.
Fast jeder kennt diese Zusammenhänge, ganz besonders natürlich die Männer und Frauen, die eine nautische Ausbildung durchlaufen haben. Sie verfügen sogar über sehr fundierte meteorologische Kenntnisse. Und doch zucken sie immer noch zusammen, wenn jemand an Bord plötzlich zu pfeifen beginnt. Auch auf den Segelbooten, mit denen ich in meiner Freizeit zur See fahre, erntet derjenige, der gedankenlos ein Liedchen zu pfeifen beginnt, vernichtende Blicke oder auch einen bösen Kommentar.
Faszinierend, diese Kraft uralter Mythen, oder?
Und von ihnen gab es noch weitaus mehr. Ein paar Beispiele gefällig? Bitte sehr: Ebenso anachronistisch wie der ehemals auf Dampfschiffen herrschende Aberglaube, es bringe Sturm, glühende Kohle ins Meer zu werfen, muten heute auch die mit dem Händeklatschen an Bord oder mit dem Werfen von Steinen ins Wasser verbundenen Ängste an. Klatschen (das lautmalerisch für Donner steht) rief angeblich Gewitter – also unberechenbares Unwetter – herbei, und fürs Steinewerfen rächte sich das Meer mit gefährlich hohem Seegang. Diese Mythen sind allerdings fast vergessen. Sie waren wohl allzu verschroben, abgesehen davon, dass glühende Kohle ebenso wie Steine (die früher viele Segelschiffe zur Stabilisierung als Ballast geladen hatten) auf modernen Schiffen nicht mehr an Bord sind.
* * *
Das Leben mit all den abergläubischen Regeln und Verboten war übrigens für den alten Fahrensmann gar nicht unkompliziert. Schon bevor er mit seinem Seesack an Bord ging, hatte er eine Menge Dinge zu beachten. Und damit ist nicht gemeint, dass er die richtige Kleidung eingepackt und seine Papiere, besonders sein Seefahrtsbuch, mitgenommen hatte.
Damit die Reise nicht von Anfang an unter einem schlechten Stern stand, hatte er erst einmal eine Menge ungeschriebener Gesetze zu befolgen und musste zudem auf der Hut vor schlimmen Vorzeichen und bösen Omen sein.
Das galt schon für den Tag der Abreise: Darüber, dass eine Seereise möglichst nie an einem Sonntag beginnen sollte, weil das Sturm auf der Fahrt bringen würde, herrschte noch vor hundertfünfzig Jahren breites Einvernehmen. Und auch darüber, dass die Frau eines Seemannes, solange dieser auf See war, niemals einen Besen mit der Bürste nach oben hinter die Haustür stellen durfte, weil das Unglück über das Schiff ihres Gatten bringen würde. (Besen spielen im Seemanns-Aberglauben sowieso eine erstaunliche Rolle – wir kommen später noch darauf zurück.)
Ebenso war es eine Selbstverständlichkeit, dass ein Schiff niemals an einem Freitag dem 13. die Leinen loswerfen durfte. Die Angst vor diesem Datum – oder auch bloß vor der Zahl 13 – hat sich in manchen Bereichen unseres Lebens bis auf den heutigen Tag erhalten. Es gibt für sie sogar einen komplizierten wissenschaftlichen Begriff: Triskaidekaphobie. Wie sehr wir diesem Aberglauben auch in der modernen Welt noch anhängen, sieht man daran, dass es in vielen großen Hotels ein dreizehntes Stockwerk einfach nicht gibt: Über dem zwölften liegt gleich das vierzehnte. Und bei den Olympischen Sommerspielen in Paris 2024 fehlte beim Triathlon wie immer der Startplatz 13. Selbst die jungen Triathleten von heute sind offenbar abergläubisch ...
Nicht selten auch kamen in alten Zeiten Seeleute mit langen Haaren und zottigen Bärten von der Fahrt zurück, und ihre Fingernägel waren ebenso dreckig wie lang. Mochten sie noch so eklig aussehen – sie hatten bloß ein Verbot befolgt, das sich heutigentags besonders abgedreht anhört: Sie durften sich an Bord die Haare und die Finger- und Fußnägel nicht schneiden! Man glaubte zu wissen, dass man damit den eigenen Tod hinauszögern konnte, weil von irgendwelchen finsteren Mächten aus Haaren und Horn von Matrosen ein Schiff namens „Naglafara“ gebaut würde, welches am Tag des Jüngsten Gerichts auf dem Meer erschiene. „Naglfar“, was hinter dem Schiffsnamen steckt, ist altnordisch, bedeutet „Nagelschiff“ und ist das Totenschiff in der Nordischen Mythologie, der zufolge die Menschheit auf ihm einst in den Weltuntergang segelt.
Totenschiff Naglfar, alter Stich (Bildnachweis: Gemeinfrei, Archiv des Autors)
Ursprung, Hintergrund und Sinn vieler anderer abergläubischer Ge- und Verbote liegen jedoch mittlerweile im Dunkeln. Das gilt auch für das kuriose Verbot, am Abreisetag Rotkohl zu essen, und dafür, dass man auf keinen Fall vor dem Auslaufen einer Person mit roten Haaren begegnen durfte. Falls Letzteres doch passierte, konnte der Seemann den darauf liegenden Fluch nur brechen, indem er den Rothaarigen ansprach.
War der wackere Matrose dann endlich am Schiff angekommen, musste er dies natürlich stets dem rechten Fuß zuerst betreten, um kein furchtbares Unglück über die anstehende Reise heraufzubeschwören.
* * *
Solcherart düstere Mythen waren für die Matrosen in alter Zeit absolut unwiderstehlich. Zu ihnen gehört auch diese Mär: „Wenn man Tabak an einer Kerze entzündet, stirbt irgendwo ein Seemann.“ Das hört man häufig sogar noch auf modernen Yachten, wenn sich jemand beim Sundowner abends im Cockpit zum stimmungsvollen Windlicht hinabbeugt, um seinen Glimmstängel an der Kerzenflamme entzünden.
Der reale Hintergrund dieses seemännischen Aberglaubens ist schnell gefunden, und er ist nicht einmal mythologischer Art: In alten Zeiten waren Seeleute, die keine Heuer hatten, darauf angewiesen, sich in den Häfen mit Gelegenheitsjobs mehr schlecht als recht über Wasser zu halten, während sie auf das nächste Schiff warteten, auf dem sie anmustern konnten. Verbreitet war dabei – neben allerlei anderen (legalen und weniger legalen) Mitteln, um nicht zu verhungern – das Schnitzen und der Verkauf von Streichhölzern. Leute aber, die ihre Pfeifen, Zigarren oder Zigaretten an Kerzen entzündeten, brauchten keine Streichhölzer. Somit brachten sie die armen Seeleute um ihre kargen Einkünfte, gaben sie also herzlos dem Hungertod preis.
* * *
Plausible Erklärungen, verschiedene sogar, gibt es auch für die aberwitzige Furcht vor Bananen auf dem Schiff. Angeblich ziehen diese schmackhaften Früchte Unglück an, was mir, wie ich gestehen muss, jahrzehntelang gar nicht bekannt war. Leichtfertig führte ich auf meinen Törns stets ein paar Bananen an Bord mit, ohne auch nur zu ahnen, wie dreist ich damit das Schicksal herausforderte. Diese Früchte waren für mich einfach nur wohlschmeckende und sättigende Snacks für zwischendurch. Erst Klaas, ein alter Fahrensmann, der einmal im Borkumer Hafen auf ein Bier zu uns an Bord gekommen war, machte mich angesichts der gelben Südfrüchte im Hängenetz unter dem Kajütdach mit ernster Miene darauf aufmerksam, dass mich bisher wohl nur ein gnädiges Schicksal vor dem sicheren Verderben auf See bewahrt habe.
Der Mythos von den Unglück bringenden Bananen ist im achtzehnten Jahrhundert entstanden, als der Warenhandel zwischen Europa und der Neuen Welt und damit der Schiffsverkehr immer umfangreicher wurde – die große Zeit der schnellen Frachtsegler. Von denen gingen die, welche Bananen geladen hatten, erstaunlich häufig auf See verloren.
Dafür gibt es mittlerweile unterschiedliche Erklärungen. Plausibel klingt diejenige, dass die Kapitäne wegen der schnellen Verderblichkeit der Ware in den Frachträumen stets die schnellste Route zum Zielhafen wählten, auch wenn sie möglicherweise Gefahren barg. So soll es nicht selten vorgekommen sein, dass ein Bananenschiff selbst bei hoher Sturmwahrscheinlichkeit durch nautisch anspruchsvolle Gebiete „geprügelt“ wurde. Dahinter stand – das argwöhnten jedenfalls die Matrosen – die menschenverachtende Überlegung der Reederei, sich lieber den Verlust eines Schiffes von der Versicherung ersetzen zu lassen, als tonnenweise verdorbene und damit wertlose Fracht anzulanden.
Auch aus einem anderen, durchaus nachvollziehbaren Grund waren die schmackhaften gelben Südfrüchte an Bord verpönt: Manchmal versteckten sich zwischen den Stauden giftige Schlangen und Spinnen, die den Seeleuten gefährlich werden konnten. Hatte man zudem noch anderes Obst oder auch Gemüse gebunkert, stellte man fest, dass dies in der Gesellschaft von Bananen rasant verfaulte.
Konnte es also irgendeinen Zweifel daran geben, dass Bananen Unglück brachten?
Dass sie jedoch, wie viele andere Früchte auch, lediglich das Reifegas Ethylen absondern – allerdings in besonders hoher Konzentration –, fand die Wissenschaft erst sehr viel später heraus.
Trotz aller Warnungen vor drohendem Unglück habe ich mich allerdings dazu durchgerungen, auch weiterhin Bananen für den Bordproviant einzukaufen – immer mit einem angemessen mulmigen Gefühl im Bauch, versteht sich.
Bisher ist aber noch alles gut gegangen …
* * *
Auf den gigantischen Kreuzfahrtschiffen unserer Tage, die – vollgestopft mit wahren Menschenmassen – zu Hunderten die Meere befahren, gehört meistens auch ein Priester zum Stammpersonal. Als Teil des All-Inklusive-Programms hält so ein Geistlicher an Bord Andachten und Gottesdienste für die Gläubigen unter den Touristen ab und steht für individuelle Seelsorge auf der Reise zur Verfügung.
In früheren Zeiten jedoch waren Priester auf Schiffen gar nicht gern gesehen. Manch ein braver Gottesmann, der eine Passage gebucht hatte, erschrak zutiefst, wenn er hörte, dass seine Anwesenheit angeblich Tod und Verderben über die Mannschaft brachte. Man mied ihn, wann immer möglich, und die Besatzung floh geradezu vor ihm, wenn er seine Amtstracht, gar einen Talar trug. Dann war er ein Gesandter des Untergangs, denn für Matrosen in alter Zeit, ungebildet und getrieben von tausend Ängsten, waren Tod, Sarg und Begräbnis ohne einen Pfarrer nicht vorstellbar.
Ebenso war Glockengeläut selbstverständlich ein Vorbote des Todes. Völlig klar also, dass jedes Geräusch, das in der dunklen Fantasie der alten Fahrensleute an eine Todesglocke erinnerte, augenblicklich abgestellt werden musste. Sogar die Gläser im Kombüsenschapp durften nicht klirren, und wenn dann auch noch die Schiffsglocke bei schwerem Wetter von selbst zu läuten begann, durchfuhr die Mannschaft ein eisiger Schauer: Der Untergang stand unmittelbar bevor!
Schließlich: Blumen. Diese wurden an Bord ebenfalls nicht geduldet, weil der abergläubische Matrose sie als Begräbnisschmuck ansah und somit mit Beerdigungen in Verbindung brachte. Im Gegensatz zu Priestern, von denen in unseren Tagen kaum noch jemand glaubt, ihre Anwesenheit bringe Unheil über das Schiff, hat sich die Aversion der Seefahrer gegen Blumen an Bord jedoch bis heute gehalten. Es mag durchaus noch ein gut Teil des alten Aberglaubens dahinter stecken, dass Blumensträuße im Ruderhaus oder Hängepflanzen an der Reling verpönt sind, aber vor allem ist das wohl eine Frage der Seemannskultur. Mich jedenfalls schüttelt es geradezu beim Anblick einer Segelyacht mit Hängegeranien an der Reling. Und auch eine im Cockpit neben dem Niedergang angeschraubte, lustig mit bunten Blümchen bestückte Vase lässt mich schaudern. Passionierte Segler kämen niemals auf derlei abartige Ideen. Solche Geschmacklosigkeiten bleiben Bootseignern überlassen, die sowieso lieber an ihrem Liegeplatz vertäut vor sich hindümpeln und Kaffee trinken (bei uns an Bord heißen die, pardon, „Hafenfurzer“), als sich den Torturen des Ablegens und Hinausfahrens zu unterziehen.
* * *
Ein Aberglaube, der ebenfalls bis heute nachwirkt, steht in Zusammenhang mit dem Albatros, dem größten Vogel auf der Welt. Etwas ungeheuer Anrührendes liegt in diesem Mythos, der den Dichter Samuel Taylor Coleridge Ende des 18. Jahrhunderts sogar zu einem der bekanntesten Gedichte der englischen Romantik inspiriert hat: The Rime of The Ancient Mariner