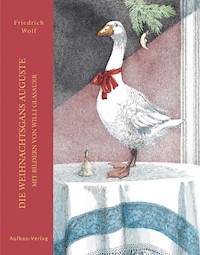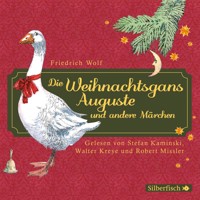10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
New York, 1950er Jahre: Die Stadt vibriert zwischen wirtschaftlicher Unsicherheit, politischer Verfolgung und der Angst vor einem neuen Krieg. Während Gerüchte über rätselhafte Flugobjekte und geheime Militärprojekte kursieren, kämpfen Hafenarbeiter um gerechte Löhne und die Friedensbewegung gegen die drohende Eskalation und den Koreakrieg. Inmitten dieser Spannungen wird der Luftwaffenoffizier Gene Stevens in ein Netz aus Lügen, Intrigen und Manipulationen verwickelt. Seine Entdeckung: Die Bedrohung von außen ist ein bewusst inszeniertes Trugbild – doch wer die Wahrheit ausspricht, gerät selbst in Gefahr. An seiner Seite steht Adda Montez, eine mutige junge Frau mit indigenen Wurzeln, die sich den perfiden Machenschaften der Mächtigen widersetzt. Doch während die Unterdrückung eskaliert und Menschen willkürlich verhaftet oder ermordet werden, wächst auch der Widerstand. Wer kann noch Vertrauen schenken? Und wie viel ist ein Leben wert, wenn es um die Sicherung von Macht geht? Friedrich Wolfs Menetekel ist ein erschreckend aktueller Roman über Fake News, politische Verfolgung, „Kriegstüchtigkeit“, Profitstreben und den Mut, sich gegen ein System zu stellen, das Angst und Chaos gezielt schürt. Eine beklemmende Vision über eine Gesellschaft am Abgrund – und den unbeugsamen Willen derer, die für Wahrheit und Gerechtigkeit kämpfen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 698
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum
Friedrich Wolf
Menetekel
oder
Die fliegenden Untertassen
Roman
ISBN 978-3-68912-439-7 (E–Book)
Der Roman erschien 1952 im Aufbau-Verlag Berlin und als Lizenzausgabe im Verlag Dein Buch, Essen.
Das Titelbild wurde mit der KI erstellt.
© 2025 EDITION digital®
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
„Und schrieb und schrieb an weißer Wand
Buchstaben von Feuer und schrieb und schwand.“
Heinrich Heine, Balsazar
ERSTES BUCH
… eine Wahrheit wird erst zur Wahrheit, wenn man sie tut.
Menetekel, II. Buch
Erstes Kapitel
1. MR. CLERK RITT IN FALSCHER RICHTUNG.
Es half nichts, dass Mr. Clerk an diesem Junitag mit einem Hebelgriff das große Fenster seines Arbeitskabinetts schloss, die Klimaanlage regulierte und zwei Becher Eissoda herunterspülte. Der heiße Luftdruck, der von dem Hurrikan nach Norden getrieben wurde, ging ähnlich dem französischen Mistral durch Glas und Zement; er dörrte die Schleimhäute aus, geigte auf den Nerven, ließ die Asthmamäuse im Brustkorb tanzen und spannte die Kopfhaut wie eine Trommel. Clerk widerstand dem Wunsch, nebenan in den Waschraum zu gehen und eine kalte Dusche zu nehmen. Er kannte den Vorgang: Heißer Winddruck das verlangte Eissoda plus Kaltdusche; das erzeugte seinen Stirnhöhlenkatarrh, der wieder nur durch Heißinhalieren plus Schwitzbad behoben werden konnte … und das bei vierzig Grad Hitze draußen.
Ein Nonsens die Natur! Eine Fehlkonstruktion der Mensch!
Aber das sind kleine Fische gegen andere widerspruchsvolle Dinge. In dem Stoß Cables, die heute an den Präsidenten der C.C.C. – der Cecil Clerk Corporation – eingegangen waren, befanden sich wieder zwei „Knochenfinger“, wie er es nannte, zwei anonyme Telegramme. Das eine lautete:
IHRE GESPENSTER UND REITER WERDEN IHRER GESUNDHEIT SCHADEN STOP GRABSTEINE SIND KEINE WUERFELTISCHE STOP MONITOR
Das andere besagte:
GREIFEN SIE NACH IHREM TELEFONHOERER UND MELDEN SIE JAMES ODD DEM CHEF IHRES LOYALITAETSPRUEFUNGSAMTES WIE VIEL ROTE SIE NOCH IN IHREM BETRIEB BESCHAEFTIGEN STOP EIN BUERGER DES LANDES
Es war für Clerk nicht schwierig, diese Drohungen zu dechiffrieren. Das erste Telegramm spielte offenbar auf die letzten Kongresswahlen an. „Gespenster“, das waren längst Verstorbene, die von bezahlten Trupps eigens zu den Wahlen zu kurzem Leben wiedererweckt wurden, damit sie ihre Namen in Form von „ghost votes“, von Gespensterstimmen, für Clerks Kandidaten in die Wählerlisten eintrugen. Diese Namen der Toten zählten also mit. Ähnlich verhielt es sich mit den „Reitern“, jenen gemieteten Wählern, die von Wahlbezirk zu Wahlbezirk zogen und auf diesem Ritt durchs Land mehrfach ihre Stimme abgaben. Wurden hier und da Zweifel an ihrer Wahlberechtigung geäußert, etwa weil ihre Namen in den Wählerlisten fehlten, so sorgte der mit ihnen reisende Gang – gute, hand- und schussfeste Burschen – dafür, dass die unnütze Fragerei schnell ein Ende fand und die chirurgische Abteilung des nächstgelegenen Hospitals ein paar neue Zugänge erhielt. Eine musterhafte Arbeit leisteten übrigens diese Boys vom Typ der Pendergastbande in einem als Wahllokal hergerichteten Grabsteingeschäft, wo sie die Wahlurnen der Einfachheit halber auf den umherliegenden Grabsteinen ausschütteten und die ungeeigneten republikanischen Stimmzettel durch demokratische ihres Patrons Mr. Cecil Clerk ersetzten. Hierauf bezog sich wohl das erste anonyme Cable, das somit eine ganz simple Wahlkorrektur tendenziös aufbauschte.
Aber erst in Verbindung mit dem zweiten anonymen Cable; das völlig sinnlos Clerk der Unterstützung der Roten beschuldigte, entstand die erpresserische Drohung, der unfaire Tiefschlag unter die Gürtellinie, wie ihn Clerk seinem früheren Kompagnon und jetzigen Gegner George McKelley trotz allem kaum zutrauen mochte. Gewiss, er hatte vor acht Jahren George aus der von Old Josh und ihm firmierten „Meteor Eastern Steel Corporation“ ausgeschifft, einfach, weil er George nicht mehr brauchte und weil eine Sache für zwei mehr abzuwerfen pflegt als für drei. Daran ist im Leben nichts Besonderes. Doch George, dieses kleine Stinktier, war ja immer so empfindlich und rachsüchtig, wahrscheinlich wegen seiner geringen Körpergröße. Viele dieser Halbzwerge sind stets voller Minderwertigkeitsgefühle, die sie in Ehrgeiz und Arbeitsfanatismus umwerten. So hatte sich dieses rasende Atom mit den gänzlich unamerikanischen, hochgebürsteten grauen Haarborsten zur Position eines Direktors der National City Bank hinaufgeschnellt mit gleichzeitigem Sitz im Aufsichtsrat einiger Schiffsbau- und Verkehrsgesellschaftten, wodurch es ihm möglich wurde, bei allen Gelegenheiten Querschüsse gegen ihn abzufeuern.
Dieser Hundesohn!
Clerk fegt die Cables beiseite, erhebt sich, ruft das Vorzimmer an, dass er nicht gestört sein will, krempelt die Hemdsärmel auf und tritt nebenan in den Baderaum, wo er sich das kalte Wasser über die nackten Arme rinnen lässt. Er könnte ja hingehen und diesen Judas McKelley mit seiner behaarten Pranke zu Puppendreck hauen, auch ohne seine zwei Zentner in den Hieb zu legen. Er knetet am flaumigen Fett seiner starken Arme herum, dem leider abgewirtschafteten Kapital seiner Großväter, der Boys aus Texas und Arizona. Immerhin, das Knochengerüst, der mächtige Brustkorb, der muskelwulstige Nacken beweisen noch diesen fast schon prähistorischen Befund. Wegen dieses Äußern nennt man ihn „Cel, the Bull“, den Stier. Auch weil er bisher kein Hindernis respektierte, jeden Gegner frontal annahm – sogar Betonwände.
Diese Taktik hatte Erfolg gehabt zur Zeit der anlaufenden Konjunktur vor und nach dem ersten Weltkrieg, wo auf offenem Gelände noch Raum war für junge Bullen und das „freie Spiel der Kräfte“, von dem damals Franklin Roosevelts preisregulierendes „New Deal“ in den Sand gestreckt wurde. Doch heute ist dieser fast harmlos anmutende Konkurrenzkampf der „freien Wirtschaft“ von einem ganz anderen gigantischen Machtkampf der großen Gruppen abgelöst worden, wo es nicht mehr bloß um die Waffe der Preisbildung geht, sondern um neu gehandhabte politische Waffen. So ist die Einstellung des ERP-Administrators, der die Kriegswirtschaft lenkt, der Ausdruck einer Machtform, die nicht bloß Millionen Arbeiter und Werkzeuge in Bewegung setzt, sondern ebenso viel Soldaten und Waffen. Was nützt da – bei der fest eingeplanten Rohstoffzuteilung und den Staatsaufträgen durch die im Senat vertretenen Banken – dem „Bullen“ die Kraft seines Stiernackens, wenn irgendeine mit dem Senat verklebte Missgeburt ihm trotz seiner Wahlarbeit von hinten den Lasso um die Beine werfen kann?
Die Asthmamäuse springen und piepsen in seiner Brust. Lohnt es sich noch? Manchmal erscheint diese Frage wie ein Gespenst.
Das Fenster auf! Der Stirnhöhlenkatarrh ? Come in !
*
Wenn er korrekt nachdenkt, so kann er die Schuld an seinem Zustand eigentlich nicht bloß den Fallstricken der „kleinen stinkigen Missgeburt“ zuschreiben oder einem boshaften Schicksal. Er hat vielmehr selbst einen entscheidenden Fehler zugelassen, der weniger in seiner nachlassenden geistigen Spannkraft begründet war, sondern gerade in seiner stiermäßigen Starrköpfigkeit, in der einmal eingeschlagenen Richtung weiterzurennen. So hat er seine alten Unternehmungen nicht umgestellt, sondern noch verbreitert. Er hat sich an den zivilen Eastern Airlines beteiligt, weil er seinem Sohn Donald, dem Fliegermajor, eine besondere Chance schaffen wollte; er hat zum Entsetzen seiner bigotten Schwester Fanny in Reno – jenem Ehescheidungsparadies im Staate Nevada – eine „Terraingesellschaft“ neu aufgezogen, ungeachtet der dort stürmisch emporschießenden Häuser mit gewissen Appartements für gewisse Mädchen, die im Vierundzwanzigstundenbetrieb „round the clock“ die Freuden dieser Welt vermehren helfen. Zweifellos entsprach dies dem Stil, wie man früher sein Kapital anlegte: Gab es auf dem einen Gebiet eine Krise, so arbeitete das Geld anderswo weiter. Heute aber ist „Konzentration der Kräfte“ das Losungswort auch für den größten Boss. Clerk hat hiervon keine Notiz genommen. Weshalb soll er alle zehn Jahre umlernen?
Die C.C.C. sitzt also mit ihrer Terraingesellschaft, mit ihren Grundstücken, mit ihren Wohn- und Landhauskolonien fest; das Kapital ihrer Bodenbank blockiert sich selbst, und das gerade heute, da die Banken ihre Reserven flüssig halten, um sie schnell hierhin und dorthin in die Rüstungskonjunktur zu werfen, in die Stahl- und Flugzeugwerke im Lande und nach Übersee. Zudem ist die „Meteor Eastern Steel Co.“ mit ihrem kühn auf den Himmel weisenden Namen größtenteils noch auf den Bau von feuerfesten Garagen, Metallbunkern und Stahltüren eingestellt, während jetzt spezialgehärtete Panzerplatten und Duralleichtmetall für Flugzeuge die Losungsworte der Industrie sind. Es ist klar, Clerk hat mit der Zeit nicht Schritt gehalten, und in Old Josh, dem Schachlöwen und Kokovoren, besaß er auch keinen zeitgemäßen Partner. So ist er also mit seinem Dutzend sehr verschiedenartiger, nicht koordinierter Unternehmungen in die Krise der mittleren Fabrikanten und Geldmacher hineingeschlittert, jener Betriebe, die heute oder morgen unweigerlich eine Beute der großen Gruppen werden. Hätte sonst George, dieses kleine Stinktier, dessen Bank mit den Schiffsbau-, Bahn- und Versicherungsgesellschaften liiert ist – hätte sonst dieser hässliche Zwerg jene dreisten Cables gewagt?
„Himmlische Trompeten!“, faucht Clerk in hilfloser Wut. „Diese Landhäuser und stählernen Hundehütten, diese ldiotie von Reno, diese Stahltüren für die Keller, um das klägliche Menschengewürm zu schützen …“ Er ist jetzt bereit, zu verstehen, dass er die letzten Jahre in falscher Richtung geritten ist. Vielleicht wird er umsatteln müssen? Vielleicht auch absatteln? The hell with it!
2. BETT ODER SARG. HUND ODER ECKSTEIN.
Wenn er die Bude hier zumacht, so hat er in Connecticut immer noch sein Landgut mit großen Weideflächen, mit über hundert Stück Rassekühen und seiner Pferdezucht; auch in Texas und in Mexiko besitzt er je eine große Hacienda seines Vaters und seiner Frau. Dorothy drängt so schon ständig, dass er länger ausspanne und mit ihr nach dem Süden ziehe. Sie selbst ist dort geboren, sie hängt mit Leib und Seele an jener Landschaft, an den Ranchs mit den großen Herden, an der Steppe und den Bergketten mit ihrem wilden Pflanzenwuchs von der tropischen Region bis zur Schneegrenze, an den Menschen – den indianischen Carreteros mit ihren Ochsenkarren; sie hat von der väterlichen Hacienda die Familie des Manuel Montez nach hier mitgebracht: Manuel selbst als Gärtner und seine beiden Töchter, Adda, die Zeichnerin im Konstruktionsbüro, und Beß, die Stenotypistin. Dorothy behauptet, es genüge, diese Menschen ihrer Heimat nur ein- bis zweimal in der Woche um sich zu haben, um selbst wieder elastisch zu werden. Dabei reitet Mrs. Clerk mit ihren fünfundvierzig Jahren im Herrensattel wie ein Cowboy, jedenfalls besser als ihre Tochter Francis, die Studentin des Richmond College.
*
Clerk sitzt an seinem Schreibtisch. Er hat den Tischventilator abgestellt und die Cables vom Boden aufgerafft; er baut aus ihnen jetzt Häuschen. Seltsam, vieles kommt ihm in letzter Zeit zwecklos vor. Er ist, wie seine Tochter Francis meint, ein „Bewegungstyp“, im Gegensatz zu Old Josh, der tagelang auf seinem Zimmer sitzen und über einem Schachproblem grübeln kann, wobei er sich von Kokosnüssen, Bananen, Orangensaft und Grahambrot nährt. Er selbst, Cecil Clerk, muss ständig auf vollen Touren laufen; doch jetzt bockt der Motor, die Zündung setzt aus. Was ist los?
Konnte man das bisschen Leben nicht billiger haben? Hatte er es nötig, für den Präsidenten mit „Gespenstern “ und „Reitern“ sich in die Nesseln zu setzen, damit jetzt der Hundesohn George sein Beinchen hebt und ihn als Eckstein benutzt? Hilft etwa der Präsident ihm aus seiner Lage? Noch zwei Jährlein, und er liegt als schöne Leiche auf dem Weg, den er jenem bereitet hat. Vielleicht wird er selbst dann bei der nächsten Wahl zu einer der „Gespensterstimmen“?
Apropos „Leiche“. Wie war das noch, was letzte Woche in dem „Readers Digest“ stand? Plötzlich muss Clerk laut auflachen. Er haut mit der Faust auf den Tisch, dass der kleine Ventilator sich ein paarmal zu drehen beginnt. Da war also irgendwo im Staate Ohio eine Frau, die mit Erfolg ihre Ehescheidung beantragte, weil ihr Mann, ein begeisterter Kriminalromanleser, fast jede Nacht von ihr verlangte, dass sie als „Leiche“ sich auf den Fußboden lege, damit er vom Bett aus die Details des eben verschlungenen Mordfalles möglichst genau rekonstruieren konnte. Anderseits habe in Brocktown im Staate Massachusetts eine Frau krank in ihrem Bett gelegen, als Feuer ausbrach. Diese Frau weigerte sich eisern, aufzustehn. „Ich darf das Bett nicht verlassen“, sagte sie, „der Doktor hat’s mir verboten.“ Sie wurde im Tumult vergessen und verbrannte.
Zwei Fälle um das Bett also, und doch: Bett ist nicht gleich Bett! Für die eine Frau ward es zum Ehescheidungsgrund, für die andere zum Sarg. Die Welt ist voller Widersprüche, die einander auf die Hacken treten.
Wenn ich die Bude hier wirklich schließe, überlegt Clerk, und mit Dorothy auf die Hacienda ziehe (dies alles natürlich bloß im Wennfall gedacht), so hätte der Hundesohn George mit seinen niederträchtigen Telegrammen sogar etwas Gutes angerichtet. Wer also ist hier der Sieger? Ist der Eckstein des Hundes wegen da oder der Hund wegen des Ecksteins?
3. DIE EMBRYONAL-ANALYSE. MONDE FLIEGEN UM DEN HIMMEL.
Clerk erkennt, dass er hier in den vier Wänden keine Antwort auf seine – im Grunde überflüssigen – Fragen findet. Vielleicht ist es der atmosphärische Tiefdruck, diese heiße träge Luftsäule, die ihm das Sitzen zur Qual macht und die Asthmamäuse in seinem Brustkorb springen lässt?
Er nimmt die Cables, stopft sie in den Tischsafe, schließt ab, wirft sich das Jackett über und verlässt sein Büro. Die Direktionsräume liegen im obersten Stock des zehnetagigen Gebäudes. Durch die flachen breiten Fenster schaut man über die Parkanlagen der Außenstadt in den weiß glühenden Himmel, der im Süden durch eine schaumige Welle braungelber Sandwolken getrübt wird. In allen Büroräumen haucht die Klimaanlage, arbeiten die Menschen möglichst stehend an ihren Plätzen, um sich dem Luftzug voll auszusetzen und so das Verkleben der Kleider am Körper und vielleicht auch der Hirnwindungen im Schädel zu vermeiden. Clerk stapft schneller als sonst durch die Räume; er hält sich nicht bei den Abteilungschefs auf. Im Lift fällt ihm ein, doch noch in der vierten Etage zu halten und im Konstruktionsbüro die neuen Modelle für feuerfeste Stahlbunker zu besichtigen. An sich wäre das ein Massenartikel, falls er tatsächlich in jedem Haus obligatorisch würde, unter Senkung des Herstellungspreises und bei staatlicher Materialzuteilung. „Unsinn“, resigniert er, „kleine Fische, alles kleine Fische!“
Der Chefingenieur Morris ist zum Werk gefahren, um einzelne Varianten in Naturgröße anfertigen zu lassen.
„Es ist noch das günstigste Krümmungspotenzial für die Belastung bei größeren Metallmänteln festzustellen“, meint Adda, die ihm auf dem Reißbrett die Zeichnung im Schnitt vorlegt. Sie erklärt ihm die Druckverhältnisse des Modells, ohne dass er mit ihren Worten mitkommt. Doch es gibt ihm eine gewisse Ruhe, diese Stimme zu hören. Er begreift, weshalb Dorothy dieses große indianische Mädchen, das sie aus dem Süden mitbrachte, gern um sich hat. Während Adda ihm die Zeichnung darlegt, betrachtet er ihren energischen Kopf mit der steilen Stirn, dem kräftigen Nasenansatz und den breiten Backenknochen; auch das feste blauschwarze Haar, das sie halblang zurückgekämmt, nur von einer Spange im Nacken gehalten, trägt, und die Bronzefarbe ihrer Haut bezeugen stolz ihre Herkunft. Sie muss Clerks Blick gefühlt haben; sie beendet schnell ihre Darlegung und beginnt mit Reißschiene und Zirkel auf dem Brett weiterzuarbeiten.
Clerk tippt mit seinem Finger auf die Wölbung des Bunkers.
„Wie meinen Sie, Adda“, fragt er schwerfällig, „ob wir dies Zeug wirklich einmal brauchen werden?“
„Hoffentlich nicht, Mr. Clerk.“
„Aber wozu stellen wir es denn her?“
Adda schaut ihn an: „Verzeihung, aber stellen wir nicht noch viel unnützere Dinge her?“
„Richtig“, quittiert Clerk mit einem jovialen Lachen, „ja, Adda, drunten in der Prärie brauchte man keine Stahlbunker.“
„Noch viel unnützere Dinge“ – was so ein Mädel alles plappert! Wenn man’s recht bedenkt … jetzt legst du dich auch noch aufs Philosophieren, alter Büffel … einfach, weil du annimmst, dein Laden gehe nicht mehr. Noch viel unnützere Dinge? Etwa die Appartements und Bordelle in Reno? Das fragt sich noch! Und die braven Burschen, die mit „Gespensterstimmen“ handeln und den Dummköpfen das Maul schließen? Bitte sehr! Oder wenn Dorothy ein halbes Dutzend junger Ratten mit vier jungen Kätzchen aufzog und diese Tierchen ihre „Erbfeindschaft“ vergaßen und jetzt friedlich aus einem Napf fressen? Das wäre wohl nichts? Im Zeitalter der Atombombe!
Schade, dass er nicht mehr ein junger Kerl ist. Er würde der Adda schon ein paar „unnütze“ Dinge beibringen. Er lehnt die intellektuellen Weiber entschieden ab. Eigentlich ist auch der Beruf einer technischen Zeichnerin eine Beleidigung der Natur. Dieses kräftige Mädel mit den eckigen männlichen Schultern und den harten hohen Brüsten zeigt bei all ihrer äußeren Ruhe die alarmierendsten Widersprüche. Einfach nichts stimmt mehr heute! Wie gesagt, wäre er dreißig Jahre jünger, so würde er mit Vergnügen sich der Aufgabe unterziehen, bei Adda die Alarmstufe 3 zu überschreiten, um die Widersprüche in diesem Mädel zu lösen.
Doch er hat seine eigenen Probleme. Er muss sich jetzt entscheiden, ob die C.C.C. in der alten Richtung weiterzotteln soll, oder ob sie mitten in der neuen Hochkonjunktur noch umsatteln kann. Er will sich mit Old Josh beraten. So sehr dieser alte Sonderling in Fragen der laufenden Produktion versagt, in organisatorischen Dingen besitzt er oft einen unbeschwerten Weitblick, wahrscheinlich, weil er in seiner göttlichen Faulheit von keinem der Details belastet ist.
*
Die Clerks bewohnen am Ostufer des Flusses zwei landhausartige Villen, die in einem ausgedehnten Park gelegen sind. Wie Clerk zwischen den alten Zedern, die sein Vater schon zu seiner Kindheit als mächtige Bäume vom Gebirge hierher überpflanzt hatte, zum linken Portal des Onkels hinauffährt, dirigiert er plötzlich den Wagen zum eigenen Hause um. Es scheint ihm fair, doch auch Dorothy zurate zu ziehen. Obschon diese Tochter eines Besitzers von großen Ländereien, Gutshöfen mit Viehherden und einem Transportsystem mit den mexikanischen Ochsenkarren stets behauptet, auf Tiere verstehe sie sich, aber von Geschäften habe sie keine Ahnung, so bemerkte er im Laufe seiner über fünfundzwanzigjährigen Ehe mit dieser Frau, wie sicher ihr Urteil über Menschen war, mit welchem Instinkt sie ihm in kritischen Situationen erstklassige Ratschläge gab. Sie tat das alles eigentlich mit einer lächelnden Gleichgültigkeit, so wie man mit geschlossenen Augen auf eine Scheibe schießt und dabei die Zwölf trifft. Sie schoss wirklich gut auf Tontauben, Fasanen und Füchse – die frühere Miss Dorothy Nielsen, deren Vorfahren vor über hundert Jahren übern großen Teich in die Neue Welt gekommen waren und sich wie in ihrer Heimat sofort mit Viehzucht beschäftigten, allerdings unter andern Bedingungen. Zudem streiften damals riesige Büffelherden zwischen Arizona, Texas und Mexiko noch frei umher. Sie wurden in Massen abgeschossen. Ihre Häute brachten reichen Gewinn, ihr Fleisch gab üppige Nahrung. Die zahmen Rinderherden vermehrten sich umso schneller. Bald wurden aus einigen der eingewanderten Cowboys die wohlbestallten Besitzer großer Ranchs, die wieder neuzugewanderte Youngboys in Dienst nahmen, die sich mit den Mädchen der Angloamerikaner und, in selteneren Fällen, mit den mexikanischen Spaniern mischten. Die neuen Herren machten einen Teil der eingeborenen Indianer als Peons zu Leibeigenen, während eine andere Gruppe als Carreteros, als „freie Arbeiter“, stolz, aber im Grunde ebenso besitzlos, ihre Ochsenkarren für die weißen Senores warenbeladen durch die felsigen, fast unwegsamen Berge fuhren.
Dorothy liebt diese stolzen, habelosen Carreteros. Sie hatte Manuel, Addas Vater, diesen indianischen Ochsenkarrenführer, der aus irgendeinem Grunde aus Mexiko geflohen war, zu sich genommen. Der anspruchslose Stolz und das tiefe Feuer einer uralten Kultur zogen sie, die Tochter eines Emporkömmlings, an. Gegensätze, die sich stoßen und berühren. Nach dem gleichen Gesetz hatte wohl auch der hitzige Draufgänger und junge Boss Cecil Clerk vor Jahren sich Miss Nielsen genähert, jener „schönen Marmorstatue“; so zogen seine Freunde ihn damals mit der „Dänin“ auf. Nun, Cecil wusste es besser. Noch heute ist er in seine stattliche Frau verliebt, ohne dass die Geschäfte und sein Zustand es ihm gestatten, ihr dies zu beweisen. Wie viele Eheleute ihres Standes leben sie nebeneinander, indem sie die Burgtore nach stillem Übereinkommen zur freien Verfügung geöffnet halten.
Wie Clerk Dorothy aufsucht, erfährt er von der Zimmerfrau, dass Mrs. Clerk ausgefahren sei, wahrscheinlich zum Flugplatz.
„Zu Mr.Donald?“
„Ich denke, Mr. Clerk.“
Töricht, dies zu fragen! Gewiss, Donald, sein Sohn, ist Versuchsflieger auf dem Flugplatz F. 8; aber nicht weit davon liegt der große Zivilflughafen, als dessen Kommandant der Colonel Dean Kennedy fungiert. Kennedy, der im Dezember 1944 an der Ardennenfront abgeschossen wurde und den rechten Arm verlor, der damals von belgischen Bauern notdürftig versorgt und gerettet wurde, der hagere, einarmige, schweigsame Offizier ist für alle Collegegirls der Prototyp des Kriegshelden aus einer geheimnisvollen, gespenstischen Welt. Und nicht bloß für diese Girls. Clerk weiß, wie Dorothy sich des fast zehn Jahre jüngeren Colonels annimmt, um ihn aus seiner „gefährlichen seelischen Selbstverkapselung“ herauszureißen. Ein Kenner wie Clerk sieht allerdings, dass bei Kennedy der Alkohol eine nicht geringe Rolle spielt. Nun, Dorothy kann tun, was sie für richtig hält; sie kann diesen „boyish man“ bemuttern, solange es nach außen diese Form nicht überschreitet. Schließlich ist Dorothy mit ihren fünfundvierzig Jahren noch jung und unverbraucht.
*
Clerk geht durch die Parkwege zur Villa nebenan. Hier hat er Glück. Old Josh, der Onkel, ist zu Hause. Er befindet sich im Seitenflügel des zweistöckigen Flachbaus bei Miss Fanny, Clerks unverheirateter Schwester.
Natürlich hat Miss Fanny eine Seance. Nachdem sie jahrelang auf die Sabbatisten und die Bibelauslegungen der Adventisten vom nahen Weltuntergang eingeschworen war, die Menschheit aber trotz der längst überschrittenen Daten programmwidrig weiterlebte, fand sie ein neues Betätigungsfeld, das eigens wie für sie geschaffen schien. Clerk trifft sie in ihrem kleinen, halb abgedunkelten Salon vor Old Josh stehend, diesem beschwörende leise Befehle erteilend. Der Onkel selbst ist mit geschlossenen Augen in einem Sessel zusammengesackt und stößt aus der Tiefe furchterregende dumpfe Laute hervor, aus denen sich noch schrecklichere Flüche entwickeln. Hinter dem brummenden, grunzenden, fluchenden Koloss aber reckt sich auf den Zehenspitzen ein hageldürres Männlein, mit einem rötlichen Haarpinsel auf dem sonst kahlen Schädel, der Clerk mit stummer Geste Schweigen gebietet. Jetzt vernimmt der Eindringling die eifernde Stimme seiner Schwester, die den in Trance sich krümmenden Old Josh förmlich durchbohrt. „Kehre zurück in das Leben vor deiner Geburt!”, mahnt sie. „Erleide noch einmal die Qualen, die du im Mutterleib hattest! Was spürst du dort vom Leiden deiner Mutter?“
Und wieder beginnt der Ohm wie ein Riesenbaby sich um eine imaginäre Nabelschnur zu drehen; er stößt kindliche Bähschreie aus und wilde, knurrende Seufzer: „Man zerquetscht meine Leber … man schlägt mein Herz … ich ersticke!“ Er bäumt sich auf, das Männlein hinter ihm sucht ihn zu halten; aber der Koloss reißt alles mit zu Boden: Männlein, Sessel und die ganze Stimmung des Wachschlafes.
Clerk ist manches von seiner Schwester gewohnt. Doch jetzt glaubt er sich in einem Irrenhaus oder in einer Folterkammer.
„Was willst du?“, fragt ihn die Schwester streng.
„Ich habe mit dem Onkel zu sprechen.“
„Du hast seine Evolution gestört, seine innere Reinigung unterbrochen!“
Clerks Geduld ist zu Ende. „Schluss mit dem Nonsens!“
„Nonsens …“ Schwester Fanny versagen die Worte.
Der kleine Herr mit dem rötlichen Haarpinsel tritt jetzt vor: „Beg pardon, Sir, mein Name ist Punch, Dozent der Metapsychologie am Richmond College, Buster Punch. Mr. Josua Clerk unterzieht sich soeben einer Behandlung seiner Leberstauung und Herzkongestionen durch die Methode der Dianetik.“
„Dianetik? Schon wieder eine neue Diät?“, fragt Clerk.
Schwester Fanny schaut verzweifelt ob der brüderlichen Unbildung zur Decke, als könne ihr Blick den Gips dort sprengen und den Himmel zu Hilfe rufen.
„Würde auch dir nichts schaden, mein Junge“, meint der Onkel und stemmt sich im Sessel wieder hoch. „Das stülpt dich um wie ’nen alten Handschuh.“
Mr. Punch greift jetzt ein und gibt dem ins Vulgäre abgleitenden Gespräch eine seriöse Wendung: „Dianetik ist die Methode“, wendet er sich zu Clerk, „die Krankheitsschlacken an ihrem frühesten Ursprungsort aufzustöbern, das heißt bereits im Mutterleib, im geschädigten Embryo; denn die Schädigung beginnt bereits im Embryo vor der Geburt …“
„Und woher weiß das Embryo das?“ unterbricht ihn Clerk.
„Oh, Sie begreifen bereits, Sie kommen mir entgegen!“ Begeistert fasst ihn der Metapsychologe am Arm. „Richtig, wir selbst müssen wieder zum Embryo im Mutterleib werden, um diese Frage stellen, um sie beantworten zu können! Sehen Sie“, das Männlein wächst wie ein Geist empor, breitet die Arme aus, als wolle es einer Mutter gleich den Zwei-Zentner-Boss in sich aufnehmen, „jedes Ihrer heutigen Leiden – ob Asthma, Schnupfen, Migräne, Leberschwellung – ist die Folge eines vorgeburtlichen Traumas; Sie kennen doch Hubbard, den Marineoffizier Lafayette Hubbard, den genialen Entdecker unsrer Dianetikmethode und der Hubbardbeichte … Sie müssen sein Buch lesen, den Bestseller des Jahres, Sie müssen alle Leiden und Beschimpfungen Ihrer Mutter noch einmal durchmachen, und Sie werden wie neugeboren sein, ein junger Gott; bitte zweifeln Sie nicht! Mr. Hubbard sagt von seiner Lehre: das ist ein Meilenstein in der Geschichte der Menschheit, der Erfindung des Feuers gleich …“
„Setz dich hierher, Cecil!“, befiehlt Schwester Fanny, während der also Betroffene gerade überlegt, wie er diesen unheimlichen Raum am schnellsten verlassen könne. „Du bist derart mit Fremdstoffen belastet“, fährt die Schwester fort, indem sie den Überrumpelten zu einem Sessel drängt, „dass gerade du eine Reinigung deines vorgeburtlichen Lebens bedarfst; setze dich bequem!“
„Erlaube einmal …“, sucht Clerk zu protestieren.
„Es ist wirklich wunderbar, mein Junge!“, ermuntert ihn Old Josh schadenfroh.
„Und nun neige den Kopf zurück“, Schwester Fanny hat ihm eine Schlummerrolle in den Nacken gelegt, „entspanne dich, atme tief, lockere auch die Nackenmuskeln … so … dein Leben wird jetzt wieder klein und zusammengerollt wie eine Kugel, winzig klein …“, flüstert Fannys Stimme, „und jetzt suche zurückzukehren in dein Leben vor deiner Geburt … spürst du, wie du dich krümmtest wie ein Wurm, wie du wimmern und schreien möchtest …“
Ja, ich möchte – gottverdammt – schreien, brüllen! denkt Clerk. Steht heut denn alles kopf? Sind sie alle wahnsinnig? DerTeufel hole den ganzen Zirkus hier! Gut, ich werde wimmern, schreien, brüllen … er hat noch eine Sekunde Hemmungen; dann springt er auf. „Ihr Narren“, tobt er los, „mögt ihr alle an eurer Nabelschnur wie in einem Lift auf- und abwärts fahren! Möge euer Nabellift unterwegs steckenbleiben und so lange mit euch Nichtstuern zwischen Himmel und Erde baumeln, bis ihr eure, meine und meiner Mutter Sünden abgebüßt habt, dass ihr nicht länger die Nerven vernünftiger Menschen ruinieren könnt …“
Schwester Fanny hat ihn am Rockkragen gepackt und fragt leise: „Du schämst dich nicht?“
Clerk wendet sich, als sei Schwester Fanny Luft, zu Old Josh und sagt: „Ich habe sofort mit dir zu sprechen!“
„Wie Ihre Stimme überspannt ist!“, schaltet sich der kleine Buster Punch wieder ein. „Mein Herr, fassen Sie in diesem hypertonischen Zustand keine Beschlüsse! Gerade Sie benötigen dringend die Befreiung, die embryonale Entladung …“
„Noch ein Wort, Sie Clown!“, brüllt jetzt Clerk. „Noch einen Mucks, und ich mache hier auf dieser Tischplatte Anchovispaste aus Ihnen, Sie fauliges Fischchen!“
„Fauliges Fischchen …“, haucht der Metapsychologe.
In diesem Augenblick schnarrt das Telefon.
Clerk will zum Apparat. Aber Schwester Fanny verlegt ihm den Weg. „In diesem Zustand nicht, Cecil! Ich sehe um deine Stirn eine violette Strahlung, die Aura des Höllenfürsten!“
Clerk hat schon die Muschel am Ohr: „Du bist es, Donald? Ja, ich höre … wie, habt ihr denn alle Rattengift im Bauch … Monde fliegen über den Himmel? Lass sie fliegen! Wie? Was soll ich denn draußen … wohl den Marsbewohnern meine Stahlbunker anbieten … danke bestens … mir genügt hier schon die Diametrie … was das ist …“
„Di-a-netik!“, ruft ihm Buster Punch vom Fenster her zu.
„Ich denke nicht daran! Grüße mir deine Kollegen vom Mars und trinke auf ihr Wohl zwei Flips! Also zum Dinner! So long!“
Die andern stehen da und erwarten von Clerk eine Erklärung dieses sonderbaren Telefongespräches.
„Ein wirklich prächtiger Tag heute!“, meint Clerk mehr zu sich, nimmt seinen Hut und verlässt den im grünen Blätterschatten des Parks liegenden Raum.
Zweites Kapitel
4. DER FUNKER UND DIE INDIANERIN. LOHNT ES SICH NOCH?
Es ist später Nachmittag. Vater Manuel hat schon morgens alle vier Efeuwände des kleinen Gärtnerhauses mit dem starken Wasserstrahl bespritzt. Trotz der Verdunstungskühle des Wassers und der Baumschatten lässt sich die Luft im Zimmer kaum atmen.
Kein guter Tag heute.
Dazu noch die Sache mit Beß. Sie bebt an allen Gliedern und wimmert leise vor sich hin. Vergebens hat der Alte ihr mit Nelkenöl die Stirn eingerieben und mit seiner braunen faltigen Hand über das helle Haar gestrichen: „Come estas, chica mia?“ Das Stöhnen der Kleinen ist die einzige Antwort.
Adda, die etwas später aus der Direktion gekommen ist, hat sie auf die Couch gebettet, ihr einen Eisbeutel auf den Kopf gelegt und den Flakon Agua Florida auf sie gesprengt – ohne sonderliche Wirkung. Vater Manuel meint, es wäre gut, Beß für einige Zeit aus dem Büro zu nehmen; diese acht Stunden vor der Schreibmaschine müssten die Nerven austrocknen wie die Wurzeln eines Baumes, die an der Sonne lägen statt in der Erde. „Sie ist so durchsichtig und weißhäutig wie ihre Mutter“, meint der alte Carretero. „Auch Mutter konnte den Wind nicht vertragen; was hat sie nicht alles fantasiert vor ihrem Tode!“
Beß reißt den Eisbeutel vom Kopf und kniet auf der Couch; sie zeigt auf ihre rechte Hand, die von einem durchbluteten Verband umwickelt ist, und auf ihre Stirn, über der ein Mastixstreifen klebt. „Fantasiert? Das ist wohl fantasiert?“, fährt sie los. „Und erst die andern hättet ihr sehen sollen, mit zerbrochenen Armen! Ein Kind lag zertrampelt am Boden, tot, ob ihr’s glaubt oder nicht!“ Sie rollt sich weinend zusammen.
„Wir glauben dir doch“, sucht Adda sie zu beruhigen; sie nimmt die Schwester in ihre Arme und drückt den Kopf der Schluchzenden an ihre Brust. „Aber das Ganze ist so sonderbar …“
„Und ich versichere euch, überall sprach man von den am Himmel fliegenden feurigen Monden und riesigen Untertassen, da fuhr durch den Waggon ein furchtbarer Blitz, dann war's finster, alles nur voller Rauch. ,Sie kommen!‘, schrie es, ,sie haben ’ne Bombe geworfen! Atombombe …‘“
„Wahnsinn, Beß!“
„Was weiß ich? Die Scheiben schlug man ein, einer trat den andern, stieß ihn nieder, alles stürzte übereinander …“
Nein, sie übertrieb nicht, die kleine Beß, trotz ihrer siebzehn Jahre und ihrer überreizten Nerven. Tatsächlich hatte es in der Untergrundbahn Kurzschluss gegeben, ein Funkenregen schoss durch den dunklen Tunnel; ein Kabel war in Brand geraten, unter Krachen und Zischen hatten sich die Waggons des überfüllten Zuges mit Rauch gefüllt. Um die folgende Panik zu verstehen, muss man wissen, dass gerade an diesem Tage vom Flugplatz die Nachricht über jene durch den Himmel sausenden feurigen Monde kam – manche sprachen von riesigen Raketenflugzeugen, andere wieder von ferngelenkten „Untertassenbomben“, welche die Russen in die Stratosphäre abgeschossen hätten und die jederzeit auf die großen Städte der USA niedergehen könnten – gerade also sprach man in dem Waggon, in dem die Stenotypistin Beß Montez von ihrem Büro heimfuhr, von dieser schrecklichen Möglichkeit, da setzte nach einem mächtigen funkensprühenden Blitz das Licht aus und ertönte der erste Schrei: „Die Bombe! Die Bombe! Die Russen!“
Es kam zu unmenschlichen Szenen. Das zur Ruhe mahnende Zugpersonal wurde beinahe gelyncht. Es gab Tote und viele Verletzte. Nein, die Stenotypistin Beß Montez hat nicht übertrieben. Aber mit dieser Feststellung ist niemand gedient.
Adda müsste zu ihrem Kurs in der Abendschule; sie will in einem Jahr die Prüfung als technische Assistentin ablegen; sie verwendet jede freie Stunde für dieses Studium. Aber kann sie Beß in diesem Zustand allein lassen? Ihr selbst und dem Vater würden so ein paar Rippenstöße nichts ausmachen; sie habe kein Herz unter den Rippen, behauptet ihr Freund Gene, sondern dort einen kleinen Felsbrocken der Sierra madre. Nun, Gene ist ein wenig ungeduldig wie alle heimgekehrten Helden des Weltkrieges und wie die Fliegermannschaften im Besonderen. Aber „der Felsbrocken der Sierra madre“ scheint ihn nicht abzuhalten, immer wieder Kurs auf sie zu nehmen; sie ist neugierig, wie lange er sich’s nicht verdrießen lässt. Zudem ist er genauso vernarrt in technische Neuheiten wie sie selbst; oft sitzen sie stundenlang hier an dem mit Wachstuch bezogenen Tisch, zeichnen, konstruieren und „bauen“ irgendein Modell. Gut, dass er ihre Art respektiert.
„Willst du nicht etwas essen?“, fragt Adda die Schwester.
„Trinken!“, bittet Beß. „Kaltes!“
Adda gießt Orangensaft ins Glas, wirft ein paar Stücke Eis hinein und spritzt aus dem Siphon Sodawasser hinzu. Sie setzt sich zu Beß, nimmt ihren Kopf und gibt ihr zu trinken wie eine Mutter ihrem kranken Kind; dabei streicht sie ihr das rötlichblonde Haar zurück. Beß ähnelt ganz der verstorbenen Mutter, einer Amerikanerin britischen Typs. Als der Vater wegen einer ernsten Sache, bei der das Buschmesser eine Rolle spielte, aus Mexiko verschwinden musste und auf der Hacienda von Mrs. Clerk Aufnahme fand, hat er sehr bald Mary Lee, die Bedienerin, geheiratet – der Indio das hellhäutige, blauäugige Girl. Doch es ging gut. Der Indio ist seit uralter Zeit der beste Familienvater. So lebt die dreiköpfige Familie in dem einstöckigen Gärtnerhäuschen des Clerkschen Parkes wie auf einer fernen Insel. Die Ereignisse der stürmischen Welt dringen im Grunde nur durch zwei Menschen zu ihnen: durch den Funker Gene Stevens und durch Ohm Ernest, den Bruder der Mutter und Monteur in einer Autoreparaturwerkstatt. Grade Ohm Ernest, der in seiner Jugend auf See fuhr, bringt stets „eine Mütze voll Wind“ mit. Er hilft kassieren bei der Automobilarbeitergewerkschaft und kann es sich nicht verkneifen, ab und zu Gene auf den Zahn zu fühlen. Der Besuch der beiden wirkt jedes Mal wie das geräuschvolle Anlegen zweier Dampfbarkassen. Nach Ohm Ernests Weggang herrscht dann wieder „tropisches Schweigen auf der Insel“, wie es Gene nennt. Beß zieht sich nach dem Essen um und rennt zu ihren Freundinnen. Adda hockt mit hochgezogenen Knien auf der Couch, liest und zeichnet. Vater Manuel, falls es nichts im Park zu tun gibt, wirtschaftet still in der Küche oder in seiner kleinen Werkstatt. Dies ist die Ordnung nach dem Tode der Mutter, eine Ordnung, die allen gerecht wird.
Heute nun, da Beß auf der Couch liegt, hat Adda mit ihrem Zeichenheft sich an den Tisch gesetzt. Und gerade heute, da sie zur Berechnung der Kegelschnitte die stärkste Konzentration braucht, scheint es ihr, als schaue Beß von der Seite dauernd auf ihre Arbeit, mit der sie nicht zurande kommt. Sie blickt auf.
„Wie fühlst du dich, Beß?“
„Gut. Du könntest ruhig gehen.“
„Deshalb frag ich nicht, du Dummes.“
Jetzt wird sie natürlich grade bleiben. Die Luft im Zimmer ist unerträglich. Sie steht auf, stellt den Ventilator an und nimmt den großen Bastfächer vom Spiegel, Beß und sich Kühlung zu fächeln. Das alles sind ja bloß Zufälle, denkt sie; man muss auf eines sich sammeln und das tun!
In diesem Augenblick hört sie draußen das Rattern eines Motorrades, das sofort aussetzt. Sie hält den Atem an.
„Gene?“, fragt Beß.
Adda beugt sich zur Schwester und bewegt den Fächer. Natürlich ist es Gene. Wer von den Erwachsenen fährt denn in diesem Lande sonst Motorrad? Aber Gene, der Fliegerfunker, hat die Leidenschaft für dies knallende, ratternde zweirädrige Ungeheuer noch vom Felde her mitgebracht, wo er mit einer schweren englischen und dann mit einer erbeuteten deutschen Maschine zwischen dem Flugplatz und anderen weniger kriegerischen Punkten zu pendeln liebte. Es ist sein Spleen, das Motorrad.
Jetzt tritt er ein. „Hallo, Kids! Beide in der Kabine? Fein!“, rumort der lange, schlaksige Bursche im Dress eines Funkers der Zivilflieger. „Aber was sieht mein Adlerauge bei der weißen Taube? Bist du durch den Liftschacht gesegelt oder hast du an einer Fliegenden Untertasse genippt?“
„Du kannst spaßen!“, meint Beß zwischen Lachen und Weinen.
Und Adda: „Sie glaubten, in der Untergrund sei Gott weiß woher eine Bombe eingeschlagen; sie machen sich selbst verrückt.“
„Natürlich, du wärst ruhig geblieben, du Heldin“, legt Beß jetzt los, „auch wo es plötzlich stockdunkel wurde und alles voller Funken und Feuer war und die Leute grad vorher von glühenden, fliegenden Monden erzählten …“
„Glühende Monde, na ja …“
„Moment!“, sagt Gene. „Jetzt tritt der Fachmann in Erscheinung; was Baby behauptet, ist gar nicht so dumm; denn heute sah unsre Beobachtung in 9000 Meter Höhe drei jener Fliegenden Untertassen von Osten nach Westen über den Himmel fegen, und das mit einer Geschwindigkeit von 800 bis 900 km die Stunde.“
„Bitte!“, triumphiert Beß.
„Hast du es selbst gesehen?“, fragt Adda den Freund.
„Nur den letzten Moment, als diese unheimlichen Vögel im weißen Dunst der Sonne verschwanden; aber die Funker von der Versuchsstation F. 8 gaben durch, dass Major Clerk mit seiner Maschine zur Verfolgung gestartet sei.“
„Donald?“, fragt Adda.
„Er kam zu spät; bis er 9000 Meter erreicht hatte, war das spaßige Ding längst weg.“
„Und was ist mit Donald?“
„Er trudelte wieder zu seiner Station. – Übrigens, nennst du den Major auch sonst mit Vornamen?“
„Wir sind Schulkameraden.“
„Ich vergaß.“
„Hatten die Dinger denn keine Abzeichen?“
„Unsinn! – Verzeih!“
„Aber irgendwoher müssen sie doch kommen?“
„Setz dich, Adda … ah, Konusse?“ Er schaut auf die Zeichnung der Kegelschnitte im Heft und dann auf ihren ernsten dunklen Kopf. „Alles bloß Vermutungen“, wirft er hin, „nichts Solides, wenn niemand so’n Vogel funkisch anpeilen oder zum Landen zwingen kann … ja, dann beginnt man Geister zu sehen, Marspiloten, sogar Russen.“
Beß kniet wieder auf der Couch und starrt mit weiten Pupillen auf den Funker; sie zittert wie im Schüttelfrost.
„Genug jetzt, Gene!“, sagt Adda; sie nimmt die kleine Schwester mit einem energischen Ruck hoch, beugt den Kopf flüsternd über sie und trägt sie wie ein Kind hinauf in die Schlafkammer.
Gene sitzt unschlüssig da. Er liebt keine komplizierten Probleme, wenigstens nicht in seinem persönlichen Leben. Entweder eine Bekanntschaft lohnt sich, oder sie lohnt nicht. Er hat nie mit den Mädels gespielt. Er nahm, was ein junger Mann von einer Frau erwarten kann, und er selbst war nicht knauserig im Geben. Doch in seiner Beziehung zu Adda wollte diese einfache Gleichung nicht aufgehen. Er hat Adda bei den Abendkursen kennengelernt. Bei dem Unterricht zeigte es sich, dass Gene in der Mathematik und Maschinenkunde alle anderen Teilnehmer weit übertraf, während Adda im technischen Zeichnen vorne lag. Natürlich verliebte sich Gene prompt in das gesunde, kräftige Mädchen, wobei er die neue Erfahrung machte, dass er bei Adda als Mann vorerst nicht zum Zuge kam; vielmehr war zwischen ihnen beiden eine gute Arbeitskameradschaft, höchstens dass sie ihn öfters mit seinem technischen Wissen herausforderte und ihn dabei bis an die äußerste Grenze seiner Leistung drängte; dann blieb ihr zuletzt noch die Überlegenheit des logischen Fragens, vor der er meist kapitulieren musste. Einmal brachte sie ihm zum Abendkurs die Lösung einer Aufgabe der sphärischen Trigonometrie, um die sie beide das letzte Mal sich vergebens bemüht hatten; sie gab freimütig zu, dass Major Clerk hier der Helfer war.
Natürlich, Clerk hatte schon als junger Fliegeroffizier das Technikum beendet, während Gene damals mit seiner Einheit an der Afrikafront lag, den Ärmelkanal forcierte und dann in den Ardennen abgeschossen wurde. In diesen letzten Monaten kam auch der Leutnant Clerk mit seiner Bomberstaffel zur Front, gerade rechtzeitig, um einige Städte noch in Trümmer zu werfen und zum Oberleutnant zu avancieren mit dem Vorpatent zum Friedenscaptain. Dagegen konnte Gene trotz seiner drei Kriegsauszeichnungen natürlich nicht antreten; auch sein Lungenschuss und der Pneumothorax mit Rippenresektion zählten längst nicht mehr.
Nichts für ungut! Die Chancen der Menschen sind verschieden. Man muss dort, wo man steht, das Mögliche nehmen. So hat Gene den Posten eines Funkers 1. Grades der Eastern Airlines inne. Er hofft, durch sein Abendstudium seinen Pflock an die äußerste Grenze seines gesellschaftlichen Spielraums stecken zu können. Das ist es, was ein ehemaliger Sergeant der Luftwaffe kann. Eine junge Frau hat natürlich andere Chancen.
„Während der Carretero denkt, sieht er nicht den Weg“, sagt Vater Manuel, der zwei Flaschen Porter aus dem Keller geholt hat; er gießt Gene und sich ein Glas ein. Schweigend trinken die Männer das starke dunkelbraune Bier.
Gene wollte sich eigentlich gar nicht lange hier aufhalten. Ihn drängte es, nach diesem heißen Tag den Abend mit Adda auf dem Fluss zu verbringen in einem Boot oder in einer der Ufercafeterias. Doch jetzt scheint ihm der Abend verloren.
Er steht auf. Da spürt er Vater Manuels Hand auf seiner Schulter. Der sonst auf seine Gartenarbeit bedachte Alte fragt mit einem aufmerksamen Blick in seinen dunklen Augen: „Sage, Gene, gibt es Krieg?“ Ganz einfach klingt die Frage des früheren Carretero, etwa so: Wie weit ist der Weg übers Gebirge?
Gene, der sonst die Antworten nicht lange im Munde herumdreht, schaut den Alten unwillig an; dann meint er: „Schiet darauf! Ich habe von dem einen genug. Wenn aber jemand mich weiterplagen will mit diesen am Himmel fliegenden Pfannkuchen, dem reiße ich gottverdammt ein Bein aus und schlage ihn damit zu Krümeln! Lohnt sich’s denn überhaupt noch, wenn man immer …“
Er kann nicht weitersprechen. Adda, die leise die Treppe herabkam, hat ihn mit der einen Hand an der Schulter zu sich gedreht und mit der andern ihm den Mund verschlossen. „Beß schläft“, sagt sie, „wir können gehen.“ Sie nimmt ihren hellen Staubmantel und ihr Barett.
*
Wie Gene draußen das Motorrad antreten will, zieht sie ihn fort: „Lass das!“
„Nicht zur Schule?“
„Nein.“
Sie fahren mit der Untergrund bis zur Endstation ans große Wasser. Adda bleibt vor einem Magazin mit Strandbedarf stehn; sie hat ihr Badetrikot vergessen und will ein billiges kaufen; doch im Laden bemerkt sie, wie Gene zögert; es ist ihm peinlich, seinen von Geschoss- und Operationswunden entstellten Körper zu zeigen.
„Der Strand ist so voll“, sagt sie, „der Wald ist heute besser. Ja?“
„Ja.“
Sie gehen vom Ufer weg durch einen anfangs mageren Nadelwald, der im Unterholz von goldgelb blühendem Ginster, von Zwergkiefern und stacheligem Gesträuch durchwachsen ist. Gene bleibt öfters hinter Adda zurück; es macht ihm Freude, ihren weiten Schritt zu sehen, ihren geschmeidigen, muskulösen Körper, der kaum irgendwo einen Zweig berührt. Es gehört nicht allzu viel Fantasie dazu, sich hundert Jahre zurückzudenken, da diese Indianerin mit dem blauschwarzen Haarschopf lautlos durch das Dickicht streifte. Es müsste wunderbar sein, mit solch einem Menschen in voller Kraft und ohne Lüge zu leben – denkt er für eine Sekunde und lacht sofort über sich selbst.
„Was hast du?“, wendet sich Adda.
„Ich stellte mir eben vor, wie du vor hundert Jahren mir am Marterpfahl mit dem Dolch den Skalp heruntergesäbelt hättest.“
Sie schaut ihn an und fährt mit ihrer kräftigen, bronzefarbenen Hand durch sein helles Haar. „Ein guter Skalp“, meint sie, „wahrscheinlich hätte ich ihn immer an meinem Gürtel getragen.“
Sie klettern noch einen Hügel hinauf und sitzen dann in einer kleinen Sandmulde zwischen den Ginsterbüschen. Gleich hinter ihnen, wo der Kiefernwald jäh abbricht, ist ein Lupinenfeld, das nach Honig duftet. Vor ihnen liegt die große See unter einem leichten dunstigen Schleier, der dem Wasserspiegel einen perlmutternen Schein gibt.
Dies ist ein Tag wie jeder. Es ist auch nichts Ungewöhnliches, dass Gene mit seiner Freundin abends aus der staubigen Schwüle der Stadt hinausfährt. Ungewöhnlich ist höchstens, dass Adda – eine der gewissenhaftesten Studentinnen – heute den Abendkurs versäumt. Doch die Sache mit Beß beschäftigt sie mehr, als sie erst dachte. Ist es die Bestätigung von Gene, dass wirklich solche fragwürdigen Scheiben über den Himmel fliegen? Oder dass Gene einschnappte, weil sie den Major Clerk mit Vornamen nannte? Überall scheinen die Nerven zu vibrieren. Sie schaut von der Seite auf Gene, der mit einem abgerissenen Ästchen Figuren in den Sand zeichnet. „Hast du Beß beobachtet?“, fragt sie den Freund.
„Ich kann mir vorstellen, was sich da tat. Es braucht heute bloß ein Ziegel vom Dach zu fallen oder ein Fenster zu klirren, gleich heißt’s: Atombombe!“
„Aber die fliegenden Monde hast du selbst gesehen?“
„Was sieht man nicht alles, Adda, wenn die andern einem Tag für Tag die Ohren vollschwatzen. Weshalb? meinst du. Manche wollen sich wichtig machen, manche geben gern an, manche haben auch andere Gründe.“
„Und welche?“
Gene zögert. Hat er zu viel gesagt? Aber dieser Donald ist da Hals über Kopf gestartet, damit es schon heute Abend in der Presse steht: Major Clerk ist mit seiner Spezialmaschine sofort zur Verfolgung des gespenstischen Scheibenflugzeuges aufgestiegen; er erreichte in zwölf Minuten eine Höhe von 9000 Metern.
„Mir scheint“, sagt Adda, da sie keine Antwort erhält, „das alles sind wildgewordne Seifenblasen in den Gehirnen unsrer unbefriedigten Flieger.“
„Ausgezeichnet.“
„Ich finde es gar nicht so ausgezeichnet, Gene, wenn man die Menschen wegen irgendeines Gerüchts in Panik versetzt und es in der Subway Tote gibt.“
„Haben wir denn die Nachricht verbreitet?“
„Ihr oder die Presse!“
„Sag mal, Adda, sind wir eigentlich hier hinausgefahren, uns wegen dieser fliegenden Pfannkuchen zu streiten?“ Er nimmt ihren Kopf zwischen seine Hände und lächelt gutmütig; er hat sie bisher eigentlich nie zornig gesehen, auch nie so sprechfiebrig. Eine dunkle Röte schlägt durch den Bronzeton ihrer Stirn und Wangen. In einer Welle der Zuneigung möchte er sie an sich ziehen; doch er sagt nur: „Ich weiß nicht, Adda, ob sich das alles noch lohnt? Für mich wäre eine ruhige Stunde mit dir wichtiger als der ganze Rummel um die Raketenflugzeuge, die Flüge zum Mars und die künstlichen Monde und fliegenden Untertassen; denn wenn es morgen wieder losgeht …“
„Mein Gott, sei still!“
Er ist schon still. Er hat sich lang gestreckt, die Arme unter dem Kopf verschränkt und schaut durch die Kiefernäste in den abendlichen grüngelben Himmel. Diese Farbe erinnert ihn an eine ähnliche Situation – oder war sie entgegengesetzt –, wie er nach dem Abschuss ausgeblutet in einem Wald der Ardennen lag, im Schnee. Es war auch so ruhig, so menschenfern, so schien es ihm damals. Damals hatte er auch nur den einen Wunsch, dass dieser Augenblick nie aufhöre, am besten, dass er mit ihm hinübergehen könne. Doch dann hörte er im Wald einen Hilferuf, den Ruf des verwundeten Majors Kennedy, seines Geschwaderchefs; er kroch zu ihm hin, und sie beide – der Major mit dem zerschmetterten Arm und er mit dem Lungenschuss –, sie schleppten sich zwei Tage und Nächte durch den Wald bis zu belgischen Bauern, sinnlos vor Durst, Augen und Mund von Dreck und Schaum verklebt, todmatt. Und wenn das morgen wieder losgehen sollte, alles noch einmal, als sei das gestern gar nicht gewesen, aber heute noch hundertmal schlimmer – lohnt das noch?
„An was denkst du, Gene?“ Adda beugt sich über ihn. Ihre Augen sind im Schatten, die Iris ist dunkel. „Sag mir nur eins, Gene, dass es ein Irrtum ist, was die Zeitungen fantasieren.“
„Na ja, die Zeitungen …“
„Sag es mir, Gene!“
Er richtet sich auf, er hockt auf den Fersen, so wie es die Matrosen und Eingeborenen machen. „Die Zeitungen, was wissen denn die? Aber es gibt andere Berichte, über die man nicht so hinweg kann.“ Es scheint, als ob Gene nun auf dem Punkt ist, Adda ernsthaft zu antworten. „Es sind ja nicht diese läppischen Zeitungsenten, sondern – na, du weißt, als Funker hört man Dinge, die andre nicht hören. Und wenn von den verschiedensten Punkten unsres Landes über Tausende Meilen hinweg von verschiedenen Menschen ähnliche Beobachtungen kommen …“
„Genauere als eure heute?“
„Genauere und ungenauere, wie du es nimmst. Denn die Angaben übersteigen meist unsre Vorstellung. Was sagst du zum Beispiel dazu, wenn die ganze diensttuende Mannschaft von Godman Base, dem Flugplatz von Fort Knox in Kentucky, voran der Befehlshaber Colonel Hix, zwanzig Flieger, Offiziere, Funker und Bodenpersonal, um 15 Uhr, also am hellen Tage sahen, wie solch ein Ungetüm von mindestens 170 Meter Durchmesser am Osthimmel auftauchte; es handelte sich um den Untertassentyp, der explosionsartig rote Flammen ausstieß und schließlich in 8000 Meter Höhe hinter einer Wolkenwand verschwand.“
„Und was meinten der Colonel und die Flieger dazu?“
Gene stockt. „Adda, ich bin entschieden wahnsinnig“, sagt er, „nicht weil die Sache nicht stimmt, sondern weil ich gequatscht habe; diese Dinge sind geheim und liefen als Chiffre.“
„Nun, Gene, du weißt ja, wie gern ich plaudere, besonders um dich hineinzulegen. – Aber wenn das Ganze doch eine Täuschung war?“
„Eine Täuschung? Angenommen. Schön. Und wie steht es damit: Am 1. Februar wurde im Staate Arizona von der Bevölkerung von Tucson ein scheibenförmiger Flugkörper mit riesigem Feuerschweif beobachtet, der über die Stadt dahinfegte. In diesem Augenblick startete grade eine B. 29 Maschine. Der Funker des Kontrollturms bat den Piloten, die Verfolgung aufzunehmen. Aber die fliegende Scheibe verschwand mit mindestens 800 Stundenkilometern.“ Gene hat sich ganz heiß geredet. „Es gibt viele, die über das Scheibengemunkel sich lustig machen. Zu ihnen gehörte auch Captain Robert Adikes von unsrer Linie. Adikes sagte einmal zu mir: ,Gene, wenn mir solch ein Vogel begegnen sollte, werde ich ihm vor den Bug fliegen, ihn mit dem Lasso fangen und im Schlepptau hierherbringen!‘ – Aber Ende April kam er sehr verschlossen von einem Flug zurück.“
„Er hatte auch …“
„Als er am 28. April wie gewöhnlich seine Verkehrsmaschine flog, fand er unterwegs einen unheimlichen Begleiter, den sowohl sein Mitpilot und Funker wie auch die neunzehn Fahrgäste sahen. Über fünf Minuten raste solch riesige feuerspeiende Scheibe neben ihm her, meist in Rauch gehüllt, in etwa 1000 Meter Abstand. Adikes versuchte, näher an das Ding heranzukommen; aber da verdreifachte es seine Geschwindigkeit auf etwa 1500 km die Stunde und ließ mit einem wahren Teufelssprung das Flugzeug mit seinen Insassen zurück.“
„Aber dann müsste das Ding ja bemannt gewesen sein“, bedrängt ihn Adda, „gab es denn kein Zeichen? Wohin flog es? Und zu welchem Zweck? Das kann man doch nicht einfach so hinnehmen!“
„Ach, du kluges Kind! Was glaubst du, wie wir uns schon den Kopf darüber zerbrochen haben? Bloß haben diese Vögelchen auf unsre Funkzeichen bisher nicht zu antworten geruht. Auch scheint es höchst zweifelhaft, ob so ein Ding bei der gewaltigen Geschwindigkeit und dem enormen Druck, der auf dem Körper lasten würde, überhaupt bemannt sein kann?“
„Doch es ist euch ausgewichen? Geflohen?“
„Weiß der Teufel, ob es ferngelenkt war.“
„Von wem? Wozu? Das Ganze muss doch einen Sinn haben?“
„Müsste, Adda. Bloß wenn du heute anfängst, nach dem Sinn von all dem zu fragen, oder wenn du dich mit diesen sogenannten Geheimwaffen beschäftigst, dann kann’s dir blühen, dass du eines Tages überschnappst und mit dem Ruf: ,Die Russen kommen!‘ wie unser ehemaliger wackerer Kriegsminister Forrestal aus dem Fenster der zehnten Etage springst, und der hätte es doch wissen müssen.“
Die Historie liebt oft solche Treppenwitze voll grausiger Logik wie diesen des an seiner eigenen Panikmacherei wahnsinnig gewordenen Kriegsministers der USA. Aber auch im winzigen Maßstab gibt es solche Fehlzündungen, bei denen eine überlastete Situation sich zwangsmäßig falsch entlädt.
So springt Adda plötzlich hoch. Sie ist sonst durchaus nicht schreckhaft. Aber da rollt ein schwarzes rundes Etwas vom oberen Rand der Sandkuhle herunter und bleibt vor ihr liegen. Mit starren Blicken schaut sie auf die schwarze Kugel.
„Hinlegen!“, ruft Gene.
Blitzschnell wirft sich Adda zu Boden. In der furchtbaren Stille hört man bloß das kaum unterdrückte Kichern von Gene, das schließlich in einer Lachsalve explodiert; dann ist’s wieder totenstill.
Adda hebt etwas den Kopf. Sie bemerkt, wie Gene auf die schwarze Kugel schaut und den Finger auf den Mund legt. Jetzt reckt sich aus der stachligen Kugel etwas vor wie ein langer Daumen, und daran sitzt das Köpfchen des neugierigen Igels, der oben aus dem Lupinenfeld zum abendlichen Jagdgang sich aufmachte, Stimmen hörte und neugierig zum Rand der Sandkuhle kam, von wo er herunterkugelte. Er hebt sein kluges Köpfchen und dreht es wissbegierig nach allen Seiten.
„Siehst du, so ist es“, meint Gene, während der Igel sich schnell wieder zusammenrollt.
„Natürlich, du bist ein Held!“, sagt Adda lächelnd, um über ihren etwas blamablen Schreck hinwegzukommen.
Gene fährt mit dem abgebrochenen Zweig unter den Sand und sucht den Igel am Bauch zu kitzeln. „Ich schenke dir den Helden, Adda“, knurrt er. „Was habe ich denn von der Geschichte im Ardenner Wald? Meinen verstümmelten Brustkorb und – was entschieden das Unangenehmste ist – mit der Erinnerung an die Vergangenheit das Gefühl, dass wir schlechten Schüler das gleiche Pensum noch einmal durchmachen müssen. Und doch müsste man endlich einmal zur Ruhe kommen. Gewiss, ich hab meinen Lungenschuss, meinen Jagdschein, ich brauche nicht mehr mit; aber die andern sind ja auch wer, und wenn dann jene weiß der Henker mit welchem kosmischen Mist geladenen Untertassen über uns fliegen und sie streuen ihren Atomdreck über uns wie übern Feld mit Kartoffelkäfern, dann ist von der radioaktiv gewordenen Luft ja alles vergiftet, deine Haut, dein Atem, dein Blut, deine Lunge …“
Er kommt nicht weiter. Adda hat ihn zu sich gezogen, sie presst seinen Kopf an ihre Brust; er spürt ihren schnellen, warmen Atem, er spürt die Wärme ihres Körpers und den leisen Druck ihrer Hände gegen seine Stirn; langsam beruhigt er sich.
Ein Luftzug weht von der See herauf. Die Dämmerung ist angebrochen. Gut, er wird sich nicht rühren. Es ist lächerlich, wie still er plötzlich geworden, wie ein Kind an der Brust der Mutter … lächerlich, und doch ist es so. Keine Erregung wie bei einer Geliebten; nein, keine Erregung … es lohnt nicht mehr.
Weshalb klingt ihm dieser unheimliche Satz heute sooft im Ohr? So beruhigend, so verführerisch, allen Lärm zudeckend, wie der Ton einer dunklen weiblichen Stimme, dieses: es lohnt nicht mehr …
„Wie du so redest!“, flüstert Adda.
Hat er geredet? Er hat nur gedacht, halb im Traum gedacht.
Adda drückt sein feuchtes Gesicht an ihre Brust. „Man hat auch uns vernichtet“, sagt sie leise. „Ihr habt uns ausgerottet, so gut ihr konntet, damals … nein, du warst es nicht, du würdest es auch niemals tun, Gene, weder heute noch damals; du hast eine zu empfindliche Haut, dein Herz schlägt durch die Haut und wird zu stark getroffen … hör mich, Gene, ja, man hat den Indianer vernichtet, mit Kugeln, mit Feuerwasser, mit Verträgen, mit List und Betrug … meine Väter wurden von ihren Wäldern getrennt, von ihren Herden, von der Steppe, auf ein sehr schmales Territorium, wo sie von euch gerade genug empfingen, um als Ochsentreiber zu leben oder auszusterben …“
Gene greift ihre kräftigen Hände: „Bist du nicht stärker als all die dünnblütigen bleichen Fratzen?“
„Stimmt! Wir haben dennoch euer Gesetz nicht angenommen“, fährt Adda fort, „wir haben uns nicht darum gekümmert, ob es dem weißen Mann gelingen wird, uns zugrunde zu richten; wir haben nach unserm Gesetz gelebt, wir haben die Tiere gepflegt, und – wie mein Vater mir erzählt – wir haben auch gelernt, die Mais- und Bohnenfelder zu bebauen; aber immer haben wir das Gesetz der Familie geehrt.“
„Ihr habt einen Panzer um euch gelegt, Adda, einen edlen und starken Panzer; doch mit diesem Panzer haben die Herren ohne Panzer mit viel Betrug aus euch gemacht, was sie wollten.“ Er richtet sich auf und schaut in ihr ernstes, dunkles Gesicht, das in der Dämmerung ihm noch fremder erscheint, so wie der Kopf einer indianischen Frau aus den Wäldern. „Darf ich dir etwas ganz offen sagen, Adda, nicht als meiner Liebsten, sondern als einer Freundin; das ist ein kleiner Unterschied, nicht wahr?“
„Sag!“
„Es ist sogar ein ziemlich großer Unterschied, Adda; ich meine es so: mit der Freundin will man zum Beispiel gute Gespräche führen und Schulter an Schulter fühlen; aber von seiner Liebsten, so wie ich’s verstehe, möchte man Kinder haben. Das ist vielleicht grob gesagt, und du brauchst nicht zu fürchten, dass ich gleich Ernst mache …“
„Da müsste ja auch ich dabei sein.“
„Richtig. – Mich erstaunt nur, dass ich dich sehr lieb habe, Adda, bitte, lass mich es dir sagen, dass ich nichts Schöneres kenne, als so in deinen Armen zu liegen, deinen stolzen dunklen Kopf zu betrachten, deinen Gang zu sehen, deinen unverdorbenen Körper; all das macht mich glücklich, und doch habe ich nicht den Wunsch weiterzugehen, dass ein Kind von uns werden könnte, so wie ich früher zu den Mädels stand.“
„Ist das so furchtbar?“
„Furchtbar oder nicht; es ist nicht in Ordnung! Es ist erst seit kurzem so!“ Er ist erregt wie ein Junge, der unerwartet vor seinem ersten Pubertätsproblem steht; es ist ja das tiefste und dunkelste Rätsel auf unserem Weg. „Ich möchte nie einem Kind zum Leben verhelfen“, stößt er hervor, „selbst nicht mit der schönsten und klügsten Frau! Jahrelang würde über dem Kind das Schwert hängen, das ihm einen Arm oder ein Bein abschlägt, seine Brust verstümmelt oder es ganz in Stücke reißt. Still, Adda, ich weiß das besser. Hinter jeder Bodenwelle liegt heute bei uns ein Flugfeld. Jede Woche braust ein neues Bombengeschwader nach Europa oder Afrika zu neuen Stützpunkten. Und glaubst du, der andere wartet bloß? Diese ferngelenkten gespenstischen Flugkörper, die jetzt immer häufiger über uns dahinbrausen …“
Adda dreht seinen Kopf jetzt sich zu, dass sie seine Augen sehen kann; ruhig sagt sie zu ihm: „Ich glaube, diese fliegenden Dinger haben wirklich vieles durcheinandergebracht. Aber das mit dem Kind glaube ich nicht. Dann würden wir ja vor dem Wahnsinn davonlaufen. Doch wohin willst du denn laufen? Selbst unter der Erde wird das Leben immerzu neu geboren. Höre, Gene, auch ich habe über die drohende Zeit nachgedacht. Vielleicht gibt es unter dem Bombenregen nur eine einzige Chance unter tausend; für diese eine Chance aber werde ich leben, diese Chance werde ich zu ergreifen suchen, und um dieser Chance willen werde ich nicht den Mut haben, zu sagen: Es lohnt sich nicht.“
Wie viel Zuversicht kann eine Stimme geben und ein gutes Gesicht. Wie leicht verzweifelt der Mensch; wie schnell wird er getröstet. Vielleicht ist diese Erde doch noch nicht verloren? denkt Gene, und bemerkt: „Nicht schlecht, Adda, wenn wenigstens einer auf diese Chance setzt.“
Es ist kühl geworden.
Sie stehen auf, schütteln den Sand aus den Schuhen und klopfen einander ab. Da liegt die See spiegelklar. Der halbe Mond schaut vom Himmel und zugleich von unten aus dem Wasser empor. Wie sie schon gehen wollen, sieht Adda seitwärts den Igel; er hat sich vergebens bemüht, die Sandkuhle hochzuklettern.
„Du armer kleiner Kerl!“, sagt Adda; sie nimmt ihre Baskenmütze, ihn damit fortzutragen. Aber die Stacheln piken hindurch. Gene wickelt ihn in seine Jacke. Sie bringen den stachligen Burschen hinauf zu seinem Lupinenfeld und warten, bis er sein neugieriges Köpfchen vorschiebt, den Mond anblinzelt und dann ruhig in das Feld tapst.
Adda schaudert vor der feucht heraufziehenden Luft. Gene hilft ihr in den Mantel; eine Sekunde will er sie an sich reißen und küssen. Doch er nimmt nur ihre Hand und schlittert mit ihr den Sandhügel hinab.
Unten auf der breiten Straße, die um die See zur Station führt, rollt ein Auto hinter dem andern. Tausende pilgern zu Fuß. Die Luft ist dick von Staub und Menschenstimmen. Vom Seerestaurant klingt laut der neue Broadwayschlager: „Forget the trubbles – be happy!“ Plötzlich singt die ganze tausendköpfige Karawane den Schlager mit; es klingt wie ein Marschlied gegen das, was alle bedroht, und für das, was sein könnte … für das Glück: be happy!
*
In dem Gärtnerhäuschen brennt noch Licht. Bevor Gene das Motorrad anwirft, legt Adda ihre Hand auf seine Schulter, lächelt und meint: „Ob es sich nicht doch ein bisschen lohnt?“
Er streicht ihr übers Haar. Wie er jetzt das Motorrad antritt, kommt der Vater Manuel. „Kinder, Kinder“, sagt er, „es ist ja schon Nacht. Der junge Herr war da und hat sich nach Beß erkundigt.“
„Donald?“
„Ja, und Senora lässt Adda bitten, über Sonntag mit ihnen nach der Hacienda zu fahren, zu einer Party.“
Gene hat den Motor angetrieben. Er gibt Adda schnell die Hand. „Ein gutes Weekend!“, sagt er und braust davon.
Drittes Kapitel
5. UM DIE FLIEGENDEN UNTERTASSEN. DIE RATTENDEMONSTRATION.
Clerks Landsitz „Dealwood“ liegt 150 Kilometer nördlich der Stadt; er ist über den breiten Highway in anderthalb Stunden zu erreichen. Das Anwesen umfasst etwa 500 Hektar besten Wald-, Acker- und Weidegeländes; es besitzt Stallungen für einige Dutzend Schweizer Rassekühe, eine mittelgroße Pferdezucht mit Spezialisierung auf irische Jagd- und Sprunghengste, ferner das zu einer Musterwirtschaft gehörige Kleinvieh. Selbstverständlich ist die Farm, was Wasser und Elektrizität betrifft, durch Frischwasser aus dem felsigen Vorgebirge und durch einen Stauteich mit eigenem kleinem Kraftwerk von der Außenwelt unabhängig. „Mehr zum Scherz“ hat Clerk in den Felswänden des Nordhanges einige Höhlen als Bunker mit Schlafräumen für alle Fälle herrichten lassen, natürlich mit dem erforderlichen Komfort, mit Sauerstoffgerät und mit gasfesten Clerkschen Stahltüren.
Übrigens war Clerk – schon lange vor dem erregenden vorgestrigen Tag – in dieser Hinsicht keineswegs leichtfertig. Auf seine Anweisung wurde die früher erwähnte Hacienda im Süden des Landes ebenfalls in eine Art Verteidigungszustand gebracht. Da jene Farm in der flachen Prärie liegt, so kamen dort seine Stahlbunker zu Ehren. Es ist beruhigend, je einen Ausweichpunkt im Norden und Süden des großen Landes zu wissen.
Für die Weekendpartys, die Mrs. Dorothy einmal im Monat abzuhalten pflegt, ist allerdings „Dealwood“ wegen der Nähe der Stadt, des besseren Klimas und des vorhandenen Komforts geeigneter. Mrs. Dorothy liebt es in ihrer burschikosen Unbekümmertheit, Menschen der verschiedensten Interessen, Berufe und Bildungsstufen zu diesem Zusammensein einzuladen, in der Überzeugung, dass sich alles „schon arrangieren“ werde.
Während nun Old Josh und der einarmige Colonel Kennedy sich ins Rauchzimmer zu einer Schachpartie zurückgezogen haben und Mr. Clerk im „Look“ und „This Week Magazine“ herumblättert, aber auch beim Schach kiebitzt, hat sich das Gros der Gäste draußen auf der Südterrasse vor dem Speiseraum in bunten Gruppen verteilt. Da hocken in einem Winkel auf Liegepritschen und der breiten Holzbalustrade die jungen Leute: die zweiundzwanzigjährige Tochter des Hauses, Francis Clerk, die Literaturstudentin des Richmond College, und ihre Freundin Susan Patric, die vor einem Jahr das Studium abgebrochen hat und jetzt als Schauspielerin in einem avantgardistischen „Rooftheatre“ – einem Studio im Dachboden eines Hochhauses – in den jüngsten surrealistischen französischen und amerikanischen Stücken mitwirkt, jenen Werken, die sich ebenso durch eine geringe Personage wie durch um so zahlreichere Inzeste und Morde auszeichnen. Dabei ist Susan selbst das Urbild des Lebens, rotbäckig, breithüftig und stramm wie eine Melkerin aus Tirol, „mit viel Holz vorm Haus“; nur dass sie aus einer sehr langen, dünnen Glasspitze zu rauchen pflegt, vielleicht als Kontrapunkt zu ihrer fülligen Form. Sie hängt jetzt hingebungsvoll am Munde ihres Gesprächspartners, eines mittelgroßen mausgrauen Herrn, des Kunstredakteurs des „Daily Citizen“, Lewis Sherman, der gerade in scharf pointierten Sätzen über eines der letzten Stücke spricht, so, als trüge er in seiner Toga Krieg oder Frieden. Etwas übermüdet lässt der Vierte dieser Gruppe, der fünfzigjährige Arzt John Boyle, die geistreiche Analyse des Kritikers an sich vorüberschäumen. Er schaut auf die von alten Platanen überschattete Grünfläche des Rasens und empfindet es offenbar durchaus nicht als eine Störung, dass der angespannt hinhörende Kopf der Studentin Francis Clerk genau in seinem Blickfeld liegt. Er kennt als Hausarzt der Familie die Geschichte der Clerks genau. Dieser keltische Rundschädel der jungen Francis mit dem braunrötlichen Haar und den fast schwarzen Augen ist, wenn man die blonden Langschädel der Eltern in Betracht zieht, zweifellos ein genetischer Rückfall auf die Vorfahren einer früheren Ahnenreihe; denn Mr. Clerks Mutter war eine geborene O’Brien. Auch der Charakter von Francis ist von dem ihrer Eltern völlig verschieden. Mit einer inneren Glut kann sie sich in eine Frage verbohren, bis sie zu einer Lösung gelangt; sie ist nicht schnell in der Auffassung, eher schwerfällig. Sie hat einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Den Knaben eines Zeitungsausträgers, den ihr Bruder Donald mit dem Wagen angefahren hatte und dem man bloß die Behandlungskosten zahlte, versorgte sie im Spital regelmäßig mit Schokolade, Bananen und Fruchtsäften, sie ließ sich vom Arzt die Röntgenplatte zeigen und unterrichtete den Jungen vier Wochen lang am Krankenbett, damit er sein Schulpensum nachhole. Dr. Boyle würde sich gern mit ihr allein unterhalten wie letzthin über sein Lieblingsthema des Heilfiebers, der Reiztherapie und des empirischen Effektes der Negation der Negation. Doch hier in diesem „Papageienkäfig“ ist es unmöglich.
Denn von dem Tisch in der Mitte klingt die hemmungslose und nicht gerade leise Stimme von Mrs. Dorothy Clerk, die mit Seymour Low, dem Physikprofessor des Richmond College, und Mr. Flagg, einem jungen Reporter des „Democratic Globe“, über die Frage diskutiert, ob die „Weltangst“ eine persönliche oder eine objektive Ursache habe? Das heißt, diese letzte Fragestellung rührt eigentlich von dem Professor her. Frau Dorothy bedient sich eines viel einfacheren Tabletts, auf dem sie ihr Weltbild jederzeit sauber serviert – etwa so: Tue recht und fürchte niemand! Das heißt: Ich bin kein großer Kirchengänger, sondern ein „persönlicher Christ“, und wenn mein Gewissen mich ruhig schlafen lässt, so bin ich mit mir selbst und mit Jesus Christus im Einklang! Eine Art moralischer Hygiene, ähnlich der morgendlichen Mundpflege.
Im Besonderen dreht sich das Gespräch der drei um das vorgestrige, durch jene Panik hervorgerufene Unglück in der Untergrundbahn. Mrs. Dorothy meint, dass diesen Menschen jeder persönliche innere Halt fehle, wenn sie in einer Sekunde aus dem Zustand des normalen Lebens in den des Wahnsinns geworfen werden könnten. Wenn jeder dieser Menschen seinen Christus wie einen Anker in sich trüge, so könnte auch bei dem heftigsten Sturm das Ankerseil nie reißen und die Seele über Bord gehen.
„Denken Sie, unter den gestern von Panik Ergriffenen waren keine Christen?“, fragt Mr. Flagg, der junge Globe-Redakteur.
„Massenchristen!“, erwidert Mrs. Dorothy. „Nicht solche der wirklich inneren Bindung an Christus, des Einzelerlebnisses.“
Professor Low hat schon ein halbes Dutzend Streichhölzchen zerstückelt, er hat sie buchstäblich hingerichtet, ohne seine kurze Pfeife zu entzünden. Er, der sich mit den feinsten elektrodynamischen Messungen beschäftigt, mit der gesetzmäßigen Beziehung zwischen den Ungenauigkeiten der einzelnen Messwerte – also der sogenannten Ungenauigkeitsrelation –, Professor Low weiß mit solchen unpräzisen Laiengesprächen nichts Rechtes anzufangen. Dennoch beendet er jetzt die Hinrichtung der Streichhölzchen und meint: „Ich denke, die primäre Ursache der Panik war nicht ein mehr oder weniger fester psychischer Zustand, sondern die bekannte unumstößliche Tatsache, dass es heute ferngelenkte Flugkörper und Atombomben gibt, und zweitens, dass man diese bekannten Größen mit dem Faktor des Unbekannten und Ungenauen umgibt …“
„Und dies wieder als Antrieb der Massenpsychose“, wirft der Globe-Redakteur dazwischen.
„Worauf es nun ankommt“, fährt der Professor unbeirrt fort, „ist dieses: Die Menschen müssen wieder zu einer objektiven Wahrheitserkenntnis gelangen; das ist der Anker, der sie hält, der archimedische Punkt, der ihrer Psyche Standhaftigkeit gewährt; das subjektive Erlebnis jedoch …“
„Sie glauben, es gibt eine Wahrheit für alle?“, unterbricht ihn Mrs. Dorothy.
„Gewiss gibt es eine Wahrheit für alle, eine objektive Wahrheit, deren Ausdruck die Naturgesetze sind, ohne die wir weder das Wissen vom innern Bau des Atoms besäßen noch auch die Atomsäule oder Atombombe selbst.“
„Aber hat diese Kenntnis verhindern können, dass die durch subjektive Täuschungsmanöver irregeleiteten Menschen diese Wahrheit wieder zunichte machen?“, ereifert sich Mr. Flagg. „Dass die Atomwissenschaft zu einem politischen Machtfaktor wurde?“