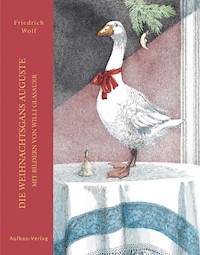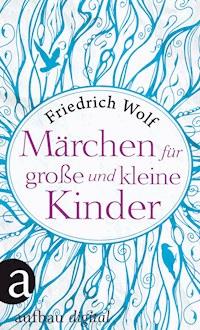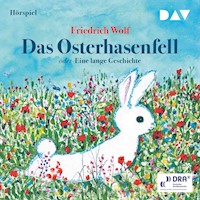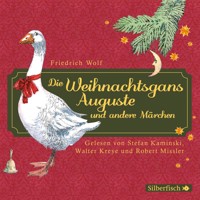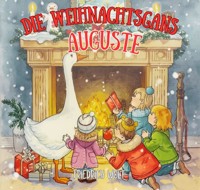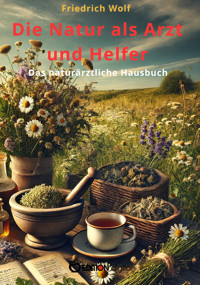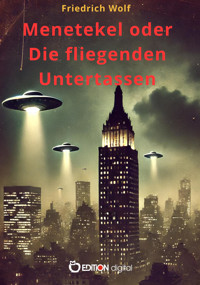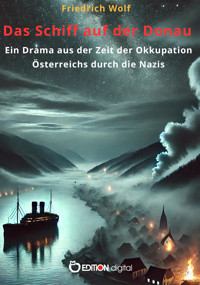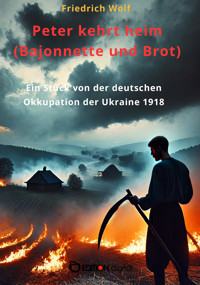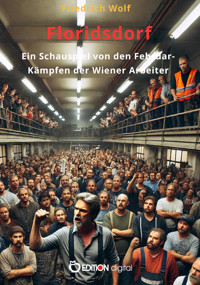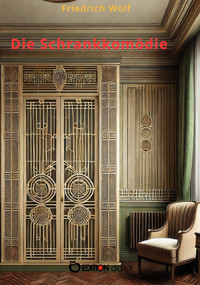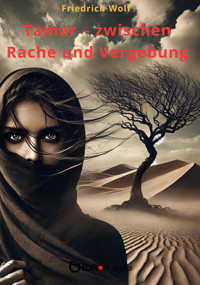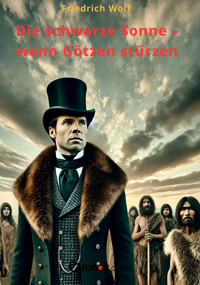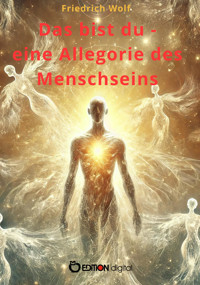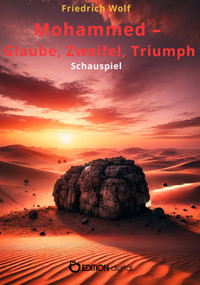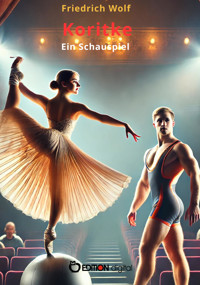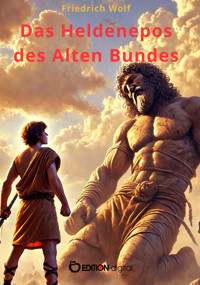
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein verborgenes Epos der Antike – neu entdeckt! Friedrich Wolf wagt sich in Das Heldenepos des Alten Bundes tief in die Ursprünge der Bibel. Er entwirrt die verschütteten Fragmente eines gewaltigen Heldenliedes, das von mythischen Recken, Riesen und Königen erzählt. Inmitten von Priesterkodizes, Gesetzestexten und Prophetenworten schlummern archaische Erzählungen über Simson, Gideon und David, über epische Schlachten, himmlische Boten und titanische Kämpfe. Wolf entfaltet die vergessene Saga der alten Stämme Israels mit literarischem Feingefühl und historischer Akribie. Dieses Werk ist mehr als eine Deutung – es ist eine Wiederbelebung des Ursprungsmythos. Ein Buch für alle, die den alten Texten auf den Grund gehen wollen und die Bibel nicht nur als religiöses, sondern auch als literarisches Monument begreifen. Tauchen Sie ein in die archaische Welt des Alten Testaments, wo Helden noch gegen Götter kämpften und das Schicksal eines Volkes auf dem Spiel stand.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 122
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum
Das Heldenepos des Alten Bundes
aufgespürt und in deutschen Worten
von
Friedrich Wolf
ISBN 978-3-68912-449-6 (E–Book)
Erstausgabe: Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart, Berlin und Leipzig 1925.
Das Titelbild wurde mit der KI erstellt.
© 2025 EDITION digital®
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E–Mail: verlag@edition–digital.de
Internet: http://www.edition-digital.de
Die Spur
Nachweis und Deutung
Ich sehe Götter aus der Erde steigen
1. Sam. 28,13
Ein mächtiger Urwald ist die Bibel. Undurchdringlich trotz vieler Wege, die Forschung und Glaubenslehre in ihn gerodet; seine Wurzeln fasern durch den Felsgrund grauer Vorzeit, seine Stämme ragen durch die Heldengeschichte und Königskämpfe eines harfen- und schwertfrohen Volkes, seine Wipfel – ein Gewölk aus Prophetie, Warnruf, Gefangenenklage und Gottesschau – rauschen mitten hinein in den Geistersturm unserer Tage. Unabweisbar: unsere ganze Epoche, ob wir Luther oder Jakob Böhme, ob wir Händels „Saul“ und „Belsazar“, Haydns „Schöpfung“ oder Klopstocks „Messias“, Dürers Passionen oder Rembrandts Simson und Tobias nennen, unser ganzes abendländisches Leben wird von den Stämmen dieser alten Kultur getragen, aus ihren Wurzeln gespeist.
Und doch – seien wir aufrichtig – wer von uns kennt die Bibel noch? Wer vermag sich durch das Fünfbuch Mose, das Buch Josua, die Richter hindurchzulesen? Wer noch entsinnt sich der wundersamen Geburtslegende eines Simson, der tollkühnen Tat Ehuds, des Linksers, Jotams Fabel, ja selbst des Deboraliedes und des uralten „Bogenliedes“, das David zur Totenklage umstimmte? Wer wird nicht die Bibel loben, aber wer wird sie lesen? Offen muss es und rückhaltlos einmal gesagt sein, das Alte Testament ist in großen Teilen für uns unlesbar! Die Lagerordnung des Wüstenvolkes, der Ritenkult, der Priesterkodex, die Rechtsprechung, die Geschlechtsregister und Stammeszwiste, das alles berührt uns nicht mehr, ist Sand über Gräbern, Verschüttung. Wir hören die Quellen kaum mehr rauschen, so tief liegen sie. Wir verstehen unter der Bibel zumeist die aus den Sandgräbern herausragenden Monumente: die Evangelien, die Psalmen, das Hohelied, das Zehngebot, die Josephsfabel, die Erzväter – und Schöpfungslegende. Aber dass die Bibel ein großes, zertrümmertes und verschüttetes Heldenepos birgt, wie vielen ist das gewärtig? Und doch finden sich in den ersten Büchern des Alten Testamentes auf Schritt und Tritt zerstreute Fragmente dieses grandiosen Heldengesangs.
Zwar ist es den Textkritikern seit der Entdeckung des französischen Arztes Jean Astruc geläufig, dass die heutige Fassung der Bibel nicht das einheitliche Werk eines Autors, dass sie aus mindestens 4 – 6 verschiedenen Hauptschichten besteht, die sich überlagern, dass ganz alte Lieder wie das Debora- und Bogenlied, frühe Signalsprüche wie die Aufbruchparole oder Josuas Ruf, Fabeln wie die Jotamfabel neben sehr jungen, nachexilischen Verordnungen und Moralpredigten der Priesterkaste stehen, dass selbst die Tatbestände der Erzählungen bunt durcheinandergewürfelt sind, einander widersprechen wie die Kainslegende, die Beschneidungsszene kurz vor dem Sturm auf Jericho, die doppelte Fassung der Ermordung Siseras, das alles ist bekannt. Auch stießen die Forscher auf deutliche Reste eines originalen Mythos (1. Mos. 6), sprechen hier von den letzten „jener gigantischen Stürmer“, heißen dort die Geschichte des Ehud „ein Stück benjamiteischer Heldensage“ und bekennen wie Kittel: „manches in der Simsongeschichte liest sich wie ein Epos oder ein alter Heldengesang“; ja selbst vom Standpunkt des Sprachforschers wird Simson als Sonnenheros („Sonnenmann“) bezeichnet. Dennoch unternimmt niemand – soweit man in der Textkritik auch vorgeschritten – das Wagnis entscheidender Textregie, einer Textsynthese, welche die Fragmente wieder bindet, das große Heldenepos, die Edda des Alten Testaments.
Dass bei diesem Wagnis ein kühner Griff Gebot ist, ein entschlossener Vorstoß in den Urwald ohne Weg, Kompass und Sterne, dass hier das Rüstzeug des bloßen Forschers unanwendbar, das bekundet selbst Löhr, der Königsberger Textkritiker; er sagt in seiner „Einführung in das Alte Testament“: der Entstehungsprozess der sogenannten „Bücher“, zumal des Fünfbuches Mose, gleiche einem „Labyrinth … von vornherein ist zu bemerken, dass es ohne das Hilfsmittel der Hypothese gar nicht möglich ist, die Entwicklung dieses Schrifttums zu verstehen. Es ist seinem Werden nach zu buntscheckig; auch umspannt die Dauer seines Werdens mehr als ein Halbjahrtausend.“ Gerade das Buch der Richter aber, das Gehäus des eigentlichen Recken- und Heldenepos, ist erst in nachexilischer Zeit gefertigt worden, während die Lieder, Signalsprüche, Schlachtrufe und Fabeln schon über ein Halbjahrtausend zurücklagen und von Mund zu Mund durchs Volk gingen. Unsere Aufgabe ist es drum – da selbst die Wissenschaft auf „das Hilfsmittel der Hypothese“ angewiesen –, diese weitverstreuten Klänge mit dichterischem Ohr zu der alten einheitlichen Melodie zusammenzuhören. Nicht ist es unsere Aufgabe, die hundert Bibelübersetzungen, Übertragungen, Auslesen, die sich starr an die Reihenfolge des masoretischen Textes und der Septuaginta halten, um eine neue zu vermehren. Unsere Aufgabe erfordert, den Schritt in den Wald zu tun abseits der ausgetretenen Straße, wir sind durch das Dickicht gedrungen, hinter uns schließen sich die Büsche, wir stehen allein in der Waldesstille. Ist's Wunder, dass auf einmal leise die Quellen wieder zu rauschen beginnen, dass aus dem Raunen der Äste und Beben der Blattkronen eine dunkle alte Melodie sich löst, durch das Zittern der Stämme aus Wurzelwerk und Erdreich emporgetragen … der Urton dieses Waldes, sein erstes Lied, das Heldenepos des Alten Bundes!
Und so sei es gesagt: Ein Sohn unsrer Tage hat das Heldenepos des alten Wandervolkes neu gehört, neu aufgespürt und reicht es in deutschen Worten Euch dar. Er hat die Heerstraße der Glaubenslehre und Geschichtsdeutung, die Pionierpfade der Literar- und Textkritik verlassen, ist quer durch das Dickicht des Priesterkodex hindurchgeschritten, er hat versucht, durch die schwere Schutt- und Lavadecke der Dogmen, Kultvorschriften, Staatsgesetze und Opferregeln mit der Wünschelrute dichterischer Fühlung die fortlaufende Goldader der Dichtung des Alten Testamentes aufzuspüren, ihr nachzugehen, dieses Stück Urbibel wieder aufzudecken, das Heldenepos, die Saga, die Edda des Alten Bundes. Und diese Goldader ist vorhanden, sie wird zutage liegen. Es war – frei sei's gesagt – ein Fund; wert gehoben zu werden mit Ehrfurcht und Sorgfalt, doch ohne Zagen.
*
„Was siehest du?“, fragt Saul in der nächtlichen Beschwörung vor seinem letzten Kampf die Hexe von Endor; sie entgegnet: „Ich sehe Götter aus der Erde steigen!“ Die Bibel ist ein magisches Buch, mit Schlüsseln und mit Schrauben allein kommt man ihr nicht bei. Da liegt gleich zu Anfang der Genesis im 6. Kapitel solch ein riesiger Findling vor der Sintflutlegende, jene merkwürdige Stelle: „Als die Menschen anfingen, sich auf Erden zu breiten, und ihnen Töchter wurden, da sahen die Söhne des Himmels, dass die Töchter der Menschen weidlich waren, und nahmen zu Weibern, nach welchen die Lust ihnen stand … Zu jener Zeit waren die Riesen auf Erden und auch nach dieser Zeit, da sich die Söhne des Himmels zu den Töchtern der Menschen gesellten und diese ihnen gebaren – das sind Recken in grauer Vorzeit, die Hochgefeierten.“ Ohne Zweifel, eine sehr alte, mythologische Stelle, da die Söhne des Himmels, „die Gewaltigen“, die Halbgötter und Giganten sich mit den Menschentöchtern paaren und das Riesengeschlecht erzeugen, gegen das der Herr in der Sintflut ankämpft. Ein Bruchstück aus der Eiszeit, ein Eddaton, „ein Nachhall einer sonst verklungenen, mythisch-epischen Geschichte.“
Dieser Ton verliert sich dann für lange; aber plötzlich, ganz unerwartet, klingt er wieder an, rauscht die Quelle wieder auf. In jenen Zeiten, da im 4. Mos. 13,33 die Kundschafter aus Kanaan zurückkehren und nicht allein von dem Land, wo Milch und Honig fließt, berichten, sondern auch von „schlimmen Dingen“. „Wir sahen dort die Riesen, die Enakiter, die zu den Riesen gehören; da kamen wir uns vor wie Heuschrecken.“ Und aus der Geschichte vom Riesen Goliath und seinen Enaksbrüdern hallt ein letzter Ton dieser Saga von den Giganten und der großen Gigantomachie.
Ein zweites, stärkeres Leitmotiv aber führt von jenem Fragment der Engelsehe mit den Töchtern der Menschen auf eine andere und tiefer verlaufende Spur; sie leitet in großem Wurf zu dem Simsonepos hinüber, zu der Engelsverheißung und Engelserzeugung dieses übermenschlichen Recken. Die Gewaltigen und Söhne des Himmels, die sich in der Genesis mit den schönsten der Menschentöchter mischen und die Riesen mit ihnen erzeugen, diese „Söhne des Himmels“ sind später „die Engel“, die auf einsamem Feld den Müttern der Recken begegnen und in Feuerlohe wieder emporfahren.
So ist über die Geburt des Simson ein vieldeutiges Halbdunkel gebreitet, gewiss nicht zufällig. Simsons Gestalt, er der „Sonnenheros“ ragt in die Zone des Mythos. Seine Mutter, Manoahs Weib, „war unfruchtbar und gebar nicht.“ Da tritt zu ihr der Engel des Herrn und spricht: „Du bist unfruchtbar, aber du sollst schwanger werden und einen Sohn gebären.“ Sie erzählt dies Begebnis ihrem Manne Manoah, auf seine Bitte erscheint der Engel Gottes, „sehr furchtbar“ anzuschauen, zum zweiten Mal dem Weib, „ihr Mann Manoah war auch diesmal nicht bei ihr“. Als dann Manoah hinzukommt und nach des Engels Namen fragt, fährt dieser erzürnt in der Opferflamme gen Himmel. „Das Weib aber gebar einen Sohn und nannte ihn Simson.“ Wer hier zu hören weiß, der vernimmt durch alle spätpriesterliche Textretusche und Dämpfung hindurch den Urton des alten Mythos, das Leitmotiv der Gigantensage, da die Söhne des Himmels, die Halbgötter, die Engel noch herabstiegen und sich den Töchtern der Menschen gesellten, um die Riesen zu zeugen, die Enakssöhne, „die Recken in grauer Vorzeit, die Hochgefeierten“. Ist es Häresie, mit einem weiteren Sprung über ein Jahrtausend, hier an die Engelserscheinung der jungfräulichen Magd zu denken, die auch einen Gottessohn gebar; hallt hier nicht ein letzter, leiser Ton des großen Mythos nach?
Ja, diese Gestalt des Simson erscheint unabhängig voneinander in vielen Zeiten und Zonen. Der hebräische Recke, der griechische Herakles, der nordische Siegfried, es ist die gleiche Erscheinung. Die Parallelen laufen bis ins einzelne: Simsons Mutter von einem Engel heimgesucht, Herakles des Zeus und der Alkmene Sohn, das Wälsunggeschlecht vom Allvater selbst stammend: Simson, Herakles, Siegfried, übermenschliche Körperkraft ward ihnen, sie töten und würgen Löwen, Drachen, Ungeheuer, sie besitzen zauberhaften Körperfetisch, der ihnen zum Verhängnis wird, Simson seine Haare, Herakles das Nessusgewand, Siegfried die hürnene Haut, alle drei – durch äußere Gewalten unbesiegbar – fallen durch das Weib: Delila, Deianeira, Brunhild. Simson aber in all seinen losen Streichen, weintollen Rätseln, lachenden Krafttaten, er ist der übermütige, sorglose, strahlenhaarige Sonnenheros des Alten Bundes. Die Literar- und Textkritiker mögen mich steinigen: die dichterische Goldader des hebräischen Heldenepos läuft vom 6. Kapitel der Genesis über den Kundschafterbericht schnurstracks hinein in das 13. Kapitel der Richter, in die Simsonsage.
Weiter führt die Spur. Wir folgen dem Quellauf der Erzählung, da noch die Engel auf Erden wandelten und zu den Frauen und Helden kamen. Unsere Rute schlägt aus über Josua und Gideon, den Recken und Gottesstreitern, schon ferner dem Mythos und sichtbarer den Grenzen der Geschichte. Da wird erzählt, wie vor Jericho plötzlich ein Mann vor Josua stand „mit einem nackten Schwert in der Faust. Und Josua ging auf ihn zu und sprach: Bist du für uns oder für unsre Feinde? Er antwortete: Nein, ich bin der Heerführer der Heere Jahwes. Eben bin ich gekommen. Da warf sich Josua auf sein Antlitz zu Boden …“ Ein altes Fragment, ein offenbarer Fremdkörper in dem vorausgegangenen trocknen historischen Bericht. Aber ein Auftakt zugleich! Noch sendet Jahwe seine Engel mit Schwertern auf die Erde! Da vermag Josuas Posaunenruf und Gebet noch elementare Wunder zu wirken, die Mauern Jerichos stürzten vor dem Schall der silbernen Posaunen, die fünf Amoriterkönige wurden in der großen Entscheidungsschlacht bei Gibeon geschlagen, Jahwe selbst griff in den Kampf und „ließ große Steine vom Himmel fallen, sodass sie umkamen“; und Josua schrie zu Jahwe:
„Sonne steh still zu Gibeon.
Und Mond im Tale Ajalon!
Da hielt die Sonne und der Mond stand …“
So steht es geschrieben im Buche Jaschar, im „Buch der Helden“.
Dieser urzeitliche Ton, da Sonne, Mond und Hagelschauer mit Josua und seiner Schar stritten, führt stracks hinüber zum Deboralied, dem Siegesgesang von der Schlacht am Bache Kison:
„Da bebte die Erde, es troffen die Himmel …
Vom Himmel her kämpften die Sterne,
Aus ihren Bahnen kämpften sie mit Sisera.”
Beide Lieder, das Deboralied und der Notschrei Gideons aus dem sonst verschollenen „Buch der Helden“ sind älteste Dokumente hebräischer Dichtkunst. Das „Bogenlied“, das David bei Sauls und Jonathans Tod anstimmte, gehört in diese Reihe. Der große Siegestag von Gibeon aber vollendete die Eroberung Südkanaans; er war ein entscheidender Tag; er hallt noch ein Halbjahrtausend in den Versen des Jesaja und Habakuk nach.
So sicher diese Schlachten bei Jericho und Gibeon historische Ereignisse sind, so neigen doch Forscher wie Holzinger dazu, die Person Josuas als eine Sagengestalt, als „einen Kristallisationspunkt judäischer Sagenüberlieferung“ anzusehen. Für uns aber ist Josua der Recke und Held, auf den Mose noch seine Hände legte, der als erster den Jordan überschritt, der vor Jericho der Veste zum ersten Sturm blies, der fünf mächtige Könige in einer Schlacht zwang, an dessen Seite Jahwe selbst mit in den Kampf griff, dessen Ruf selbst Sonne und Mond gehorchten; er ist Recke und Rufer, er verteilt das Land, er weist den Stämmen ihre Grenzen, er trägt die Posaune und das Schwert.
Von Josua aus teilt sich die Goldader in zwei Äste, führen zwei Fäden getrennt in die Heldensage der Richterzeit. Der eine, der mythisch-anekdotische, läuft über das Deboralied, da Jahwe, der Kriegsgott, wie bei Gibeon wieder mit Gestirnen und Wolkenbruch selbst eingreift in den Kampf gegen die Feinde seines Volkes, und da Jael, die Barbarin, das Haupt des Feldherrn Sisera mit einem Nagel an den Boden heftet. Dieser Kampf am Kison, der über das Schicksal Nordkanaans entschied, ist in zwiefacher Fassung erhalten, in einer Erzählung und in dem berühmten Liede. Es ist ein Wechselgesang der beiden Helden, des Recken Barack und der Debora, der großen Prophetin und Skaldin, der „Mutter Israels“. Das Einigungslied, das Siegeslied, der Befreiungsgesang der Nordstämme! Immer wieder wurde diese machtvolle Rhapsodie in den Volksversammlungen und in der Nähe des Heiligtums von Schilo gesungen. Sie erhebt sich auf den Quadern gleichgemessener Strophen, dem gedoppelten hebräischen Gleichmaß der Versteile, dem Parallelismus der Zeilen:
„ …Könige kamen, kämpften,
Damals kämpften die Könige Kanaans. …
vom Himmel her kämpften die Sterne,
Aus ihren Bahnen kämpften sie mit Sisera.“
Oder jene Stelle:
„Zu ihren Füßen krümmte er sich, stürzt nieder,
Zerkrümmt stürzt er zu ihren Füßen,
Wie er sich krümmte, lag er zerscherbt.“
Aber von diesen granitnen Versterrassen donnern auch leidenschaftlich bewegte Strophen, Strophen-Kaskaden hernieder:
„Der Bach Kison wälzte sie fort,
Ein Blutbach der Bach Kison,
Auf, meine Seele, zertritt den Tyrannen!
Da rasselten der Pferde Füße
Vom Getrab, von der Recken Getrab.“
Kittel sagt vom Deboralied: „Das Lied ist eine Perle nicht allein der hebräischen Poesie, sondern der Dichtkunst aller Zeiten, von hoher Schönheit und wilder Leidenschaft.“ Der Eindruck des Sieges am Bache Kison und der gotterfüllten heldischen Prophetin muss ein gewaltiger gewesen sein. Das Hochgefühl der Befreiung und der Wiedervereinung der Nordstämme zu einem Volk entfachte diesen stürmischen Siegeshymnus. Doch eines ist zu beachten, das ganze Gewicht dieses Vorganges, des Befreiungskampfes eines Volkes, der Tod des Tyrannen Sisera hängt etwas anekdotisch an der außen gelegenen Tat der fremden Barbarin Jael.
Knapper gedrängt, doch im Ton und Gehalt der Jaelstat nahe, ist das tollkühne Heldenstück Ehuds, des linkshändigen Richters und Recken. Er konnte es nicht wagen, seinen schwachen Stamm zum offenen Kampf gegen den Unterdrücker, die Moabiter, zu führen; erst musste eine verwegene, persönliche Tat ihren König Eglon beseitigen. Ehud ließ sich als Überbringer des regelmäßigen Tributs zu Eglon senden. „Er hatte sich aber ein Schwert machen lassen, das hatte zwei Schneiden, das gürtete sich Ehud unter sein Gewand an die rechte Seite.“