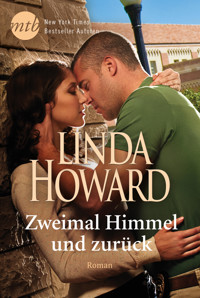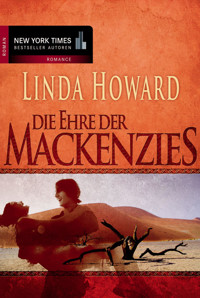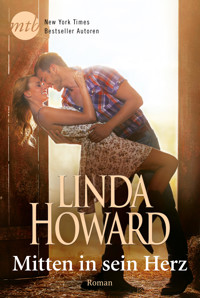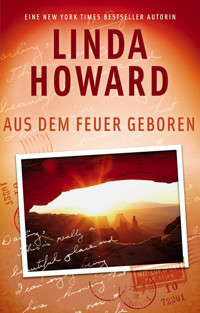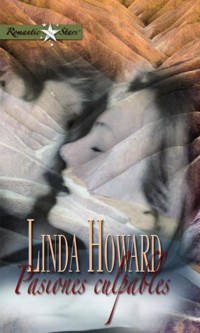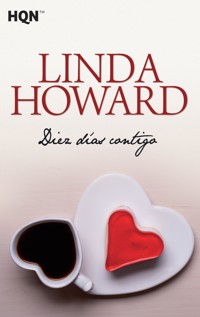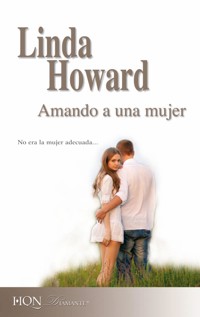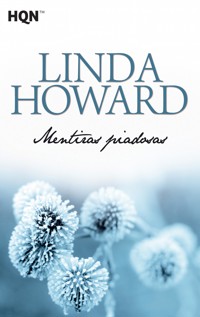5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Romance trifft Spannung - Die besten Romane von Linda Howard bei beHEARTBEAT
- Sprache: Deutsch
Ein brutaler Mord und ein ungleiches Ermittlerpaar, zwischen dem die Funken fliegen.
Knox Davis ist 35, sieht gut aus und ist Chief Investigator bei der Polizei von Pekesville. Als ein grausamer Mord die verschlafene Kleinstadt erschüttert, ist er wild entschlossen, den Täter zu schnappen.
Bei seinen Ermittlungen stößt Knox jedoch auf viele Ungereimtheiten - für ihn ist dieser Fall ein schier unlösbares Rätsel. Und plötzlich mischt sich wie aus dem Nichts die schöne Nikita Stover in seine Nachforschungen ein. Sie gibt sich als FBI-Agentin aus, doch irgendetwas verheimlicht sie vor ihm. Hin und hergerissen zwischen einem spürbaren Knistern und der Frage, ob sie einander vertrauen können, versuchen die beiden von nun an gemeinsam, den Fall zu lösen. Denn Nikita weiß nur zu gut: Der Killer hat sein grausames Werk gerade erst begonnen.
Jetzt erstmals als eBook. Weitere Titel von Linda Howard bei beHEARTBEAT u. a. "Die Doppelgängerin", "Mordgeflüster", "Heiße Spur".
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Epilog
Weitere Titel der Autorin
Die Doppelgängerin
Mordgeflüster
Heiße Spur
Über dieses Buch
Knox Davis ist 35, sieht gut aus und ist Chief Investigator bei der Polizei von Pekesville. Als ein grausamer Mord die verschlafene Kleinstadt erschüttert, ist er wild entschlossen, den Täter zu schnappen.
Bei seinen Ermittlungen stößt Knox jedoch auf viele Ungereimtheiten – für ihn ist dieser Fall ein schier unlösbares Rätsel. Und plötzlich mischt sich wie aus dem Nichts die schöne Nikita Stover in seine Nachforschungen ein. Sie gibt sich als FBI-Agentin aus, doch irgendetwas verheimlicht sie vor ihm. Hin und hergerissen zwischen einem spürbaren Knistern und der Frage, ob sie einander vertrauen können, versuchen die beiden von nun an gemeinsam, den Fall zu lösen. Denn Nikita weiß nur zu gut: Der Killer hat sein grausames Werk gerade erst begonnen.
Über die Autorin
Linda Howard gehört zu den erfolgreichsten Liebesromanautorinnen weltweit. Sie hat über 25 Romane geschrieben, die sich inzwischen millionenfach verkauft haben. Ihre Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und mit vielen Preisen ausgezeichnet. Sie wohnt mit ihrem Mann und fünf Kindern in Alabama.
Linda Howard
Mitternachtsmorde
Aus dem Amerikanischen von Christoph Göhler
beHEARTBEAT
Digitale Erstausgabe
»be« - Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2005 by Linda Howington
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Killing Time«
Originalverlag: Ballentine Books, New York
This translation published by arrangement with Ballantine Books, an Imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC
Für die deutschsprachige Erstausgabe:
Copyright © der deutschen Übersetzung 2006 by Verlagsgruppe Random House GmbH
Verlag: Blanvalet, München
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Johanna Voetlause
Covergestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de unter Verwendung von Motiven © gettyimages: passigatti | Deagreez | Nastco
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar
ISBN 978-3-7325-6971-7
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Prolog
Peke County Courthouse, Kentucky1. Januar 1985
Es hatte sich nur eine kleine Gruppe von etwa fünfzig Menschen versammelt, um zuzuschauen, wie die Zeitkapsel neben dem Flaggenmast vor dem Gerichtsgebäude des Countys in den Boden eingelassen wurde. Der erste Tag des neuen Jahres war kalt und windig, und der bleierne Himmel spuckte unentwegt winzige Schneeflocken auf sie nieder. Die Gruppe bestand mindestens zur Hälfte aus Menschen, die von Amts wegen, aus Karrieregründen oder nur auf massiven Druck hin hier waren: dem Bürgermeister und den Stadträten, dem Friedensrichter, vier Anwälten, dem County Commissioner, ein paar Geschäftsleuten, dem Sheriff, dem Polizeichef, dem Rektor der Highschool und dem Coach des Footballteams.
Es waren auch einige Frauen anwesend: die Schulinspektorin Mrs Edie Proctor sowie die Gattinnen von Politikern und Anwälten. Ein Reporter des Lokalblattes war ebenfalls erschienen und machte sowohl Notizen als auch Fotos, da die Zeitung zu klein war, als dass sie sich einen professionellen Fotografen leisten konnte.
Kelvin Davis, der Besitzer der Haushaltswarenhandlung, stand neben seinem fünfzehnjährigen Sohn. Eigentlich waren sie nur hier, weil das Gerichtsgebäude genau gegenüber dem Laden lag, über dem er und sein Sohn wohnten, weil die Übertragung des Neujahrs-Footballspieles noch nicht begonnen hatte und weil sie sonst nichts zu tun hatten. Knox, der große, schlaksige Knabe, hatte die Schultern gegen den Wind zusammengezogen und studierte die Gesichter aller Anwesenden. Er war ein ungewöhnlich aufmerksamer Junge und brachte die Erwachsenen dadurch bisweilen in Verlegenheit, aber er machte keinen Ärger, half Kelvin oft nach der Schule im Laden, schrieb gute Noten und war bei seinen Schulkameraden allgemein beliebt. Alles in allem fand Kelvin, dass er mit seinem Sohn Glück hatte.
Vor neun Jahren waren sie von Lexington nach Pekesville gezogen. Kelvin war Witwer und gedachte, es zu bleiben. Er hatte seine Frau geliebt, wohl wahr, aber eine Ehe war kein Spaziergang, und er war nicht scharf darauf, das noch einmal durchzumachen. Ab und zu ging er mit verschiedenen Frauen aus, aber nicht so regelmäßig, dass eine davon auf falsche Gedanken kam. So wie er es sah, würde er seine Einstellung zur Ehe vielleicht überdenken, wenn Knox die Highschool und das College hinter sich hatte, aber vorerst wollte er sich ganz darauf konzentrieren, seinen Sohn großzuziehen.
»Dreizehn«, sagte Knox unvermittelt mit gesenkter Stimme. Seine dunklen Brauen zogen sich in einer tiefen Falte zusammen.
»Dreizehn was?«
»Sie haben dreizehn Sachen in die Kapsel gelegt, obwohl in der Zeitung stand, dass es nur zwölf sein sollten. Würde mich interessieren, was sie noch dazugepackt haben.«
»Bist du sicher, dass es dreizehn waren?«
»Ich habe mitgezählt.«
Natürlich hatte Knox mitgezählt. Kelvin seufzte still; er hatte nicht wirklich daran gezweifelt, dass es dreizehn Gegenstände waren. Knox schien absolut alles wahrzunehmen und zu überprüfen. Wenn in der Zeitung stand, dass zwölf Gegenstände in die Zeitkapsel gegeben würden, dann würde Knox mitzählen, um sicherzugehen, dass die Zeitung richtig berichtet hatte – oder, wie in diesem Fall, falsch.
»Würde mich echt interessieren, was sie noch dazugepackt haben«, sagte Knox noch einmal und starrte dabei stirnrunzelnd auf die Zeitkapsel. Der Bürgermeister war gerade dabei, die Kapsel – genauer gesagt war es eine sorgsam in wasserdichtes Plastik eingeschweißte Metallkassette – in dem tags zuvor ausgehobenen Loch zu versenken.
Der Bürgermeister sprach ein paar Worte, die Zuschauer lachten, und der Coach des Footballteams begann Erde auf die Kassette zu schaufeln. In einer knappen Minute war das Loch aufgefüllt, und der Coach stampfte den Dreck auf gleiche Höhe mit dem umgebenden Rasen. Natürlich war etwas Erde übrig geblieben, die der Coach jedoch nicht aufhäufte. Daraufhin hoben der Bürgermeister und einer der Stadträte eine kleine Granitplatte an, auf der das aktuelle Datum eingraviert war sowie das, an dem die Zeitkapsel wieder geöffnet werden sollte – es war das Datum des heutigen Tages in genau hundert Jahren –, und ließen sie mit einem dumpfen Schlag auf die frische Erde fallen. Wahrscheinlich hatten sie vorgehabt, die Platte andächtig niederzulegen und dabei die für den Reporter mit seiner Blitzkamera gebotene Würde auszustrahlen, aber offenbar war der Stein schwerer, als sie gedacht hatten, weshalb sie ihn einfach fallenließen. Die Platte landete ein wenig schief. Der Coach kniete sich auf den eisigen Boden und schob die Platte mit beiden Händen in die richtige Position.
Der Zeitungsreporter machte Fotos, um dieses Ereignis für die Nachwelt zu bewahren.
Frierend schaukelte Knox auf den Fußballen vor und zurück. »Ich werde mal fragen«, sagte er unvermittelt und ließ Kelvin stehen, um dem Reporter nachzusetzen, ehe der in der sich verlaufenden Menge verschwunden war.
Seufzend folgte Kelvin ihm nach. Manchmal kam ihm sein Junge wie eine Bulldogge vor, die einfach nicht wieder loslassen konnte, nachdem sie sich erst einmal in etwas verbissen hatte.
Kelvin hörte den Reporter Max Browning: »Wie meinst du das?« fragen, wobei er Knox zerstreut und abgelenkt ansah.
»Die Zeitkapsel«, erklärte Knox. »In der Zeitung stand, dass zwölf Gegenstände drin sein sollen, aber sie haben dreizehn hineingetan. Ich habe mitgezählt. Ich würde gern wissen, was sie als Dreizehntes reingetan haben.«
»Es waren nur zwölf. Genau wie es in der Zeitung stand.«
»Ich habe mitgezählt«, wiederholte Knox. Er wurde nicht ärgerlich, aber er gab auch nicht klein bei.
Max sah Kelvin an. »Hey«, begrüßte er ihn und wandte sich dann schulterzuckend an Knox. »Tut mir leid, da kann ich dir nicht helfen. Mir ist nichts aufgefallen.«
Knox wandte den Kopf und richtete seinen Blick wie eine Lenkrakete auf den Rücken des davonspazierenden Bürgermeisters. Wenn Max ihm nicht weiterhelfen konnte, würde er sich an die Quelle wenden.
Doch als der Junge die Verfolgung aufnehmen wollte, hielt ihn Kelvin am Jackenzipfel zurück. »Lass den Bürgermeister in Frieden«, meinte er milde. »So wichtig ist es nicht.«
»Ich möchte es trotzdem wissen.«
»Dann frag den Coach, wenn nächsten Montag die Schule wieder beginnt.«
»Bis dahin sind es noch sechs Tage!« Knox wirkte aufrichtig schockiert, dass er so lange abwarten sollte, um etwas herauszufinden, das er noch heute klären konnte.
»Die Zeitkapsel wird schon nicht verschwinden.« Kelvin sah auf die Uhr. »Das Spiel fängt gleich an; lass uns reingehen.« Ohio State spielte gegen Southern Cal, und Kelvin war für die Buckeyes aus Ohio, weil der Mann seiner jüngsten Schwester vor ungefähr zehn Jahren für Southern Cal gespielt hatte und Kelvin den blöden Arsch nicht ausstehen konnte, weshalb er grundsätzlich für die Gegner der Trojans Partei ergriff.
Knox’ Blick verdüsterte sich, weil er feststellen musste, dass der Bürgermeister schon außer Sichtweite war und der Coach eben abfuhr. Mrs Proctor, die Schulinspektorin, unterhielt sich gerade mit einem großen Mann, den Knox nicht kannte, außerdem wollte er sowieso nicht mit Mrs Proctor reden, die griesgrämig und scheinheilig aussah, zu viel Make-up in ihre strengen Stirnfalten massiert hatte und, vermutete Knox, genauso säuerlich roch, wie sie aussah.
Mürrisch folgte er seinem Vater zurück zum Haushaltswarenladen.
Er sollte nicht mehr dazu kommen, den Coach des Footballteams zu fragen, was zusätzlich in die Zeitkapsel gelegt worden war, weil Howard Easley, der Coach, am nächsten Morgen in seinem Garten an einem Baum hängend aufgefunden wurde. Es gab zwar keinen Abschiedsbrief, trotzdem vermutete die Polizei einen Selbstmord, weil der Coach ein Jahr zuvor geschieden worden war und seine Exfrau seither erfolglos zu überzeugen versucht hatte, dass sie ihm eine zweite Chance geben sollte. Er hatte immerhin so lange im Baum gehangen, dass der Leichnam völlig ausgekühlt war und sich Schnee auf seinem Kopf und seinen Schultern abgelagert hatte.
Nach dem Suizid des Coaches war für Knox die Zeitkapsel vergessen. Als er von dem Schnee auf dem Kopf des Toten hörte, ging er in die Bücherei, um sich über das Einsetzen der Totenstarre kundig zu machen und herauszufinden, wie lange es dauerte, bis ein Leichnam so weit auskühlte. Es waren viele Variablen zu berücksichtigen, so zum Beispiel die Frage, ob in der Nacht ein Wind geweht hatte, wodurch der Leichnam schneller ausgekühlt wäre, aber wenn Knox alles richtig berechnete, hatte der Coach mindestens seit Mitternacht am Baum hängen müssen.
Fasziniert wühlte Knox weiter und kam dabei vom Hundertsten ins Tausendste, je mehr er sich in die verschiedenen Ermittlungstechniken vertiefte. Richtig cooler Shit, dachte er. Das gefiel ihm. Rätsel zu lösen, indem man winzige Fitzelchen an Beweismaterial sammelte – genau das tat er sowieso am liebsten. Scheiß doch auf den Haushaltswarenladen – er wollte Polizist werden.
1
27. Juni 2005
»Hey, Knox, wer hat das Loch neben dem Flaggenmasten gebuddelt?«
Knox, Chief Investigator des Countys, sah von dem Bericht auf, den er gerade schrieb. Als Chefermittler der Bezirkspolizei stand ihm ein eigenes Büro zu, auch wenn es nur winzig und gerammelt voll war. Deputy Jason MacFarland lehnte im offenen Türrahmen, und sein sommersprossiges Gesicht wirkte nur mäßig neugierig.
»Was für ein Loch neben dem Flaggenmasten?«
»Ich sag’s dir, da ist ein Loch neben dem Flaggenmasten. Ich könnte beschwören, dass da noch keines war, als gestern Nachmittag meine Schicht aus war, aber jetzt ist da eines.«
»Hm.« Knox rieb sich das Kinn. Ihm war kein Loch aufgefallen, aber er hatte direkt hinter dem Gerichtsgebäude geparkt, als er heute Morgen um vier Uhr dreißig hergekommen war, um durch einen arschtiefen Sumpf an Papierkram zu waten. Er war die ganze Nacht auf gewesen, und er war so müde, dass ihm das angebliche Loch vielleicht nicht mal aufgefallen wäre, wenn er drin gelegen hätte.
Nachdem er mittlerweile seit geschlagenen drei Stunden an seinem Schreibtisch saß, war es seiner Meinung nach sowieso an der Zeit, sich ein wenig die Beine zu vertreten. Er griff nach seiner Kaffeetasse, füllte sie wieder auf, als er am Kaffeeautomaten vorbeikam, und dann verließen er und Deputy MacFarland das Haus durch die Seitentür, von wo aus sie an der Backsteinwand entlang zur Front des Gerichtsgebäudes gingen, ohne dass die Gummisohlen ihrer Schuhe ein Geräusch auf dem Pflaster gemacht hätten. Der neue Tag protzte mit einem strahlend blauen Himmel, und das üppig grüne Gras war taufeucht. In den liebevoll gepflegten Rabatten blühte eine Phalanx von farbenfrohen Frühlingsblumen, aber Knox hätte Schwierigkeiten gehabt, auch nur eine davon zu bestimmen. Er kannte Rosen und Margeriten. Alles andere war unter dem Allgemeinbegriff »Blumen« zusammengefasst.
Das Gerichtsgebäude öffnete um acht Uhr, und der Parkplatz hinter dem Haus füllte sich bereits mit den Autos der Angestellten. Das Sheriff’s Department war im rechten Flügel des fünfstöckigen Gebäudes untergebracht, während das County-Gefängnis die obersten zwei Stockwerke einnahm. Früher hatten die Gefangenen den weiblichen Angestellten und Besuchern im Gerichtsgebäude nachgepfiffen oder zugejohlt, bis die Verwaltung Sichtblenden vor die Fenster montieren ließ, die frische Luft hereinließen, aber den Gefangenen effektiv die Sicht auf den Parkplatz verwehrten.
Der Flaggenmast stand an der linken vorderen Ecke des Platzes vor dem Gerichtsgebäude; links und rechts von der Ecke waren Parkbänke mit Blick auf die Straße aufgestellt, und auch hier gab es gepflegte Blumenbeete. Heute war es windstill; die Flaggen hingen schlaff am Mast. Und am Fuß des Flaggenmastes klaffte ein recht ordentliches Loch, etwa einen Meter auf einen Meter groß und sechzig Zentimeter tief.
Knox und der Deputy blieben auf dem Bürgersteig stehen; von hier aus konnten sie alles gut erkennen. Eine Granitplatte war umgeworfen worden und lag mit der Oberseite nach unten im Gras. Die Erde war weiter verstreut, als es beim Graben eines Loches unausweichlich gewesen wäre. »Das war die Zeitkapsel.« Knox seufzte. Die Sache sah schwer nach einem Teenager-Streich aus, aber sie raubte ihm die Zeit genauso wie jedes andere Verbrechen.
»Was für eine Zeitkapsel?«, fragte MacFarland.
»Hier war eine Zeitkapsel vergraben ... Scheiße, schon seit zwanzig Jahren. 1985. Ich habe zugeschaut, wie sie an Neujahr in die Erde eingelassen wurde.«
»Was war drin?«
»Das weiß ich nicht mehr, aber es war nichts wirklich Wertvolles dabei, soweit kann ich mich erinnern. Sachen wie eine Ausgabe der Zeitung, ein Jahrbuch der Highschool, Musik und so weiter.« Aber dann fiel ihm wieder ein, dass in dem Zeitungsbericht damals nicht alle Gegenstände aufgelistet worden waren, die in die Kapsel gesteckt wurden, und das ärgerte ihn immer noch.
»Höchstwahrscheinlich ein paar dumme Jungs«, sagte MacFarland, »die es für witzig hielten, eine Zeitkapsel zu klauen.«
»Hm.« Routinemäßig suchte Knox den Boden um den Tatort herum ab. Es gab keine Fußabdrücke im Tau, was bedeutete, dass die Vandalen schon vor Stunden zugeschlagen hatten. Er stieg auf eine Parkbank, um einen besseren Überblick zu bekommen, und sagte: »Puh.«
»Was ist?«
»Nichts. Keine Fußabdrücke.« So wie die aufgewühlte Erde verstreut worden war, hätte man irgendwo wenigstens einen teilweisen Fußabdruck finden müssen. Aber die Erde sah aus, als wäre sie aus eigenem Antrieb aus dem Boden geplatzt und nicht ausgehoben und mit einer Schaufel verteilt worden. Der Flaggenmast war keine drei Meter von seiner Bank entfernt, sodass er alles sehr gut erkennen konnte; auf keinen Fall hatte er irgendwelche Abdrücke übersehen. Es gab schlichtweg keine.
MacFarland kletterte neben ihm auf die Bank. »Das schlägt doch alles«, sagte er, nachdem er mindestens dreißig Sekunden lang auf den Rasen gestarrt hatte. »Wie haben sie das geschafft? Das würde mich brennend interessieren.«
»Das weiß Gott allein.« Aber er würde es herausfinden. Weil im Gerichtsgebäude auch das Gefängnis untergebracht war, gab es an jeder Ecke eine Überwachungskamera, die hoch unter dem Dachgesims montiert und im gleichen Farbton wie das Gebäude lackiert war. Wer nicht wusste, dass dort Kameras waren, konnte sie nur mit Mühe ausmachen.
Eigentlich musste er immer noch einen Bericht fertig schreiben, aber die fehlenden Fußabdrücke rund um das Loch weckten seine Neugier. Er würde keine Ruhe finden, bis er wusste, wie es die kleinen Stinker geschafft hatten, im Schein der Straßenlaterne an der Hausecke die Zeitkapsel auszubuddeln, ohne dass sie jemand gesehen hatte und ohne dass sie Abdrücke in der frischen Erde hinterlassen hatten. Zugegeben, auf der First Avenue, der Straße vor dem Gericht, herrschte während der Nachtstunden nicht allzu viel Verkehr, aber trotzdem fuhren ständig Streifenwagen vorbei. Irgendjemand hätte etwas beobachten und melden müssen.
Er sah über die Straße auf das Haushaltswarengeschäft, über dem er mit seinem Vater gewohnt hatte; nachdem er aufs College gegangen war, war sein Vater endlich wieder eine feste Beziehung eingegangen und hatte vor zehn Jahren zum zweiten Mal geheiratet. Knox mochte Lynnette, und er war froh, dass Kelvin nicht mehr allein war. Lynnette hatte nicht über einem Laden wohnen wollen, und so hatten sich die beiden ein Haus auf dem Land gekauft. Hätte Kelvin noch dort gewohnt, dachte Knox, dann hätte kein Teenager etwas anstellen können, ohne dass Kelvin es mitbekam, denn dessen Schlafzimmer hatte direkt auf den Platz gezeigt.
»Sperr die Stelle ab, damit niemand hier rumtrampelt«, wies er MacFarland an.
MacFarland hätte einwenden können, dass es hier nichts als ein Loch gab und dass eine gestohlene Zeitkapsel keinen allzu großen Wert darstellte – eindeutig nicht genug, als dass es eine nähere Untersuchung gerechtfertigt hätte –, aber er nickte nur. Es war die Aufgabe des Sheriffs, nicht seine, Knox zu erklären, wann er die Finger von einem Fall lassen sollte; außerdem hatte Knox’ Hartnäckigkeit durchaus Unterhaltungswert für die Deputys, die oft Wetten darauf abschlossen, wie weit er gehen würde, um ein Rätsel zu lösen.
Er und MacFarland gingen zum Sheriff’s Department zurück, wo sich ihre Wege trennten: MacFarland ging, um Knox’ Anweisungen auszuführen, und Knox eilte ins Gefängnis, wo die Mannschaft für die Monitore der Überwachungskameras ihre Zentrale hatte.
»Mannschaft« war in diesem Fall ein irreführender Begriff, da es sich korrekt gesagt um eine »Frauschaft« handelte, und zwar in Gestalt einer einen Meter achtzig großen, streng blickenden Dame namens Tarana Wilson, die eifersüchtig über ihr Reich wachte. Ihre Züge waren energisch und kräftig, die Haut glänzte wie dunkle Bronze, und sie hatte einen braunen Gürtel in asiatischen Kampftechniken. Knox hatte den starken Verdacht, dass sie ihn jederzeit aufs Kreuz legen konnte.
Weil sich ein kluger Mann einer Königin nie ohne ein Geschenk nähern sollte, klaute Knox einen cremegefüllten Donut aus dem Pausenraum und holte zwei Becher mit frischem Kaffee. Bewaffnet mit diesen Gaben, erklomm er die Treppe.
Er musste stehen bleiben und sich namentlich melden; dann ertönte der Summer, und er wurde in die Gemächer der Wachmannschaft eingelassen.
Die eigentlichen Zellen befanden sich in den Stockwerken darüber, und der Zugang zu diesen Stockwerken wurde streng überwacht. Seit mindestens fünfzehn Jahren war hier niemand mehr ausgebrochen. Nicht dass im Knast von Peke County wirklich schwere Jungs eingesessen hätten; die schweren Fälle kamen ins Staatsgefängnis.
Die Tür zu Taranas Büro stand offen, und sie patrouillierte vor einer Front von zehn Schwarzweiß-Monitoren auf und ab. Eigentlich saß sie so gut wie nie; sie schien ständig in Bewegung zu sein, so als würde in ihrem schlanken, muskulösen Körper zu viel Energie verbrannt, als dass sie stillsitzen konnte.
»Hey, T.«, sagte Knox und trat mit vorgestrecktem Kaffeebecher ein.
Sie beäugte misstrauisch den Kaffeebecher und drehte sich dann wieder zu den Monitoren um. »Was ist das?«
»Kaffee.«
»Wieso bringst du mir Kaffee?«
»Damit du mir gewogen bleibst. Ich fürchte mich vor dir.«
Sofort nagelte ihn ihr dunkler, schmaläugiger Blick fest. »Lügner.«
»Na schön, ich bin einfach scharf auf dich, und damit will ich dich rumkriegen.«
Der Hauch eines Lächelns zuckte um ihre Mundwinkel. Sie nahm ihm den Kaffee ab und nippte kurz daran, während sie schon wieder die Monitore kontrollierte. »Vielleicht hättest du tatsächlich Chancen, wenn ich und meine Schwestern nicht diesen Eid abgelegt hätten, dass wir uns nie mit weißen Jungs einlassen.«
Er schnaubte und streckte ihr dann den Donut hin. »Der da ist auch für dich.«
»Jetzt machst du mir echt Angst, dass du das mit dem Rumkriegen ernst gemeint haben könntest, aber lass dir eins gesagt sein: Um das zu schaffen, braucht es mehr als einen Donut.«
»Er ist mit Creme.«
»Oh Mann, das ändert natürlich alles.« Sie schnappte ihm den Donut aus der Hand und biss so fest hinein, dass die weiße Creme links und rechts aus dem Teig quoll. Sie leckte die Füllung ab, ehe sie auf den Boden tropfen konnte, aber sie ließ die Monitore dabei keine Sekunde aus den Augen.
»Na dann, was kann ich für dich tun?«
»Siehst du den Flaggenmast?« Er zeigte auf den betreffenden Monitor.
»Ja, was ist damit?«
»Davor ist ein Loch, in dem bis gestern die Zeitkapsel lag.«
»Bis gestern?«
»Jemand hat sie gestern Nacht ausgegraben.«
»Verfluchte Scheiße. Jemand hat unsere Zeitkapsel geklaut? Ich wusste zwar nicht, dass wir eine haben, aber scheiß drauf.«
»Ich würde mir gern das Band von gestern Abend ansehen.«
»Kommt sofort. Das ist echt mies, einer Stadt die Zeitkapsel zu klauen.«
Wenig später saß Knox vor einem weiteren Monitor, spulte das Überwachungsband zurück und beobachtete dabei, wie alles rückwärts lief. Er sah sich selbst und MacFarland, dann wurde die Zeit wieder aufgewickelt, und die Morgendämmerung wurde zur Nacht. Es hatte kaum Verkehr geherrscht, genau wie er es erwartet hatte. Was er keinesfalls erwartet hatte, war, dass absolut niemand an den Flaggenmast herangeschlichen kam und ein paar Minuten lang in der Erde wühlte. Als Knox bis zum Sonnenuntergang zurückgespult hatte, hielt er stirnrunzelnd das Band an.
»Hast du den skrupellosen Arschsack erwischt?«, fragte Tarana in ihrem Südstaatensingsang, ohne ihn dabei anzusehen, weil sie immer noch vor ihren Monitoren patrouillierte.
»Nein.« Er beugte sich dicht über das Standbild, auf dem deutlich zu erkennen war, dass um 20:30 Uhr die Granitplatte an Ort und Stelle lag und der Boden noch unberührt war. Das dunkelgrüne Gras stand säuberlich gestutzt rund um den Gedenkstein.
»Was soll das heißen, nein.«
»Das heißt, dass ich niemanden gesehen habe.«
»Erzähl mir nicht, dass irgendjemand schon vor einer Woche dieses Zeitkapseldings ausgegraben hat, und ihr habt es erst jetzt gemerkt.«
»Wenn dein Band nicht lügt, war die Zeitkapsel gestern Abend bei Sonnenuntergang noch da.«
Sie fuhr herum und starrte auf das Bild. »Wenn sie gestern noch da war, muss der Kerl, der sie geklaut hat, auf diesem Band sein.«
»Ich habe niemanden gesehen«, wiederholte er geduldig und spulte das Band wieder vor, um es ihr vor Augen zu führen. Als er das Band stoppte, konnten sie unten am Flaggenmast das Loch sehen, neben dem der umgekippte Granitstein lag. Eine grimmige Falte grub sich zwischen Taranas Brauen.
»Lass es noch mal laufen«, schnauzte sie und baute sich hinter ihm auf.
Er tat es und ließ das Band noch einmal zurücklaufen, wobei er es diesmal in periodischen Abständen stoppte, um festzustellen, wann der zerstörerische Akt erstmals zu sehen war. Um zwei Uhr dreißig war das Loch zu erkennen. Als er das Band um ein Uhr fünfundfünfzig wieder anhielt, lag der Rasen unberührt da.
»Jetzt lass es normal ablaufen«, sagte sie und zog sich einen Stuhl heran. Sie warf einen kurzen Blick auf ihre Monitore und konzentrierte sich dann auf das Band.
Knox drückte auf PLAY, und die Zeitanzeige begann die Sekunden abzuzählen. Sieben Minuten später sagte er: »Scheiße, was war das?« Ein kurzer, weißer Blitz hatte den Bildschirm aufstrahlen lassen. Dann war er verschwunden, und mit ihm die Zeitkapsel.
Er hielt das Band an, drückte REWIND und dann sofort wieder PLAY. Das Band war drei Minuten zurückgelaufen. Es war dasselbe Spiel. Der Boden war unberührt, dann kam der weiße Blitz, und als er erloschen war, war die Zeitkapsel weg.
»Da hat jemand an meiner Kamera rumgepfuscht«, erklärte Tarana mit unheilschwangerer Stimme.
»Das glaube ich nicht.« Stirnrunzelnd spulte Knox das Band ein weiteres Mal die entscheidenden Minuten zurück. »Schau auf die Zeitanzeige.«
Gemeinsam beobachteten sie, wie die Sekunden wegtickten. Um genau 2:00 füllte der weiße Blitz den Bildschirm. Um 2:01 erlosch der Blitz wieder, und die Zeitkapsel war verschwunden.
»Das ist doch nicht möglich«, fauchte Tarana, sprang auf und stieß ihren Stuhl zurück. Sie drehte sich um und richtete ihren nachtschwarzen Blick auf die übrigen Monitore. »Wenn jemand an dieser Kamera rumgepfuscht hat, dann kann er an allen Kameras rumpfuschen, und das lasse ich nicht zu.«
Schweigend betrachtete Knox die Sequenz ein weiteres Mal. Beim Vor- oder Zurückspulen war ihm der Blitz nicht aufgefallen. Aber er war ganz eindeutig auf dem Band, und vor dem Blitz lag der Granitblock an Ort und Stelle, während er danach zur Seite geworfen war und am Fuß des Flaggenmastes ein dunkles Loch gähnte.
Er spulte das Band zum Anfang zurück. Die Aufnahme begann exakt vierundzwanzig Stunden, bevor er hier hereingekommen war und Tarana das Band angehalten hatte. Er wusste nicht, ob man das Band manipulieren konnte, ohne dass es sich auf die eingeblendete Uhrzeit auswirkte, oder ob das überhaupt möglich war, ohne dass man dazu diesen Raum betrat. In diesem Fall steckte definitiv keine Bande von Halbstarken hinter dem Diebstahl.
Er kratzte sich am Kinn. Natürlich konnte er sich mit der Stoppuhr in der Hand vor das Band setzen und die Zeiteinblendung überprüfen, aber das würde vierundzwanzig Stunden in Anspruch nehmen und wäre außerdem todlangweilig. Es gab einen viel leichteren Weg, um der Sache auf den Grund zu gehen.
Tarana marschierte fluchend und mit Drachenatem hinter ihm auf und ab. Wer auch immer als Nächster durch diese Tür trat, tat Knox jetzt schon leid, denn es war gut möglich, dass Tarana mangels eines echten Zieles ihren Zorn am nächstbesten Objekt auslassen würde.
»Ich gehe rüber in den Haushaltswarenladen.« Er rollte den Stuhl zurück und nahm seine Kaffeetasse mit.
»In den Haushaltswarenladen? Was willst du denn im Haushaltswarenladen? Du kannst nicht einfach hier reintanzen, mir vorführen, dass jemand an meinen Kameras rumgepfuscht hat, und dann wieder raustanzen, um dir einen Staubsauger zu kaufen. Du setzt dich sofort wieder hin!«
»Dad hat auch Überwachungskameras«, sagte Knox. »Und eine davon ist auf die Ladentür gerichtet.«
»Ach ja?«, fuhr sie ihn an, doch dann begriff sie. »Ach so, schon kapiert. Glastür, große Schaufensterfront, genau gegenüber dem Flaggenmast.«
Er zwinkerte ihr zu und ging hinaus.
Als er den Platz diesmal überquerte, war deutlich mehr los als vorhin; Besucher kamen ins Gerichtsgebäude, um Behördengänge wie Autoanmeldungen, Führerscheinverlängerungen, Bootsanmeldungen zu regeln. Einige Läden hatten bereits geöffnet, darunter auch der Haushaltswarenladen; die Übrigen machten um neun Uhr auf. MacFarland hatte eine schmucke Tatortabsperrung installiert, die sich zwanzig Meter um den Flaggenmast herum erstreckte und dabei auch den Bürgersteig überspannte, sodass die Passanten auf die Fahrbahn ausweichen mussten.
Die Klingel über der Ladentür schlug an, als Knox eintrat, und Kelvin, der gerade einen Kunden abkassierte, sah auf. »Bin gleich da, Sohn«, rief er.
»Lass dir Zeit.« Knox sah zu der Überwachungskamera hoch und drehte sich um, um den Aufnahmewinkel zu überprüfen. Genau wie er in Erinnerung gehabt hatte, befand sich der Flaggenmast mehr oder weniger gegenüber der Ladentür. Wer immer den Schaden da drüben angerichtet hatte, hatte vielleicht die Überwachungskamera des Gerichtsgebäudes blockiert, auch wenn Knox nicht wusste, wie er das angestellt hatte, aber diese Kamera befand sich innerhalb des Ladens, weshalb definitiv nicht an ihr herumgespielt worden war.
Der Kunde ging, und Knox trat an die Ladentheke. »Ich muss mir das Band aus deiner Überwachungskamera ansehen«, sagte er zu Kelvin. Er nickte zum Schaufenster hin. »Jemand hat gestern Nacht die Zeitkapsel ausgegraben und dabei irgendwie die Kamera am Gerichtsgebäude ausgetrickst. Ich vermute, dass deine Kamera alles aufgezeichnet hat.«
Kelvin sah zu seiner Kamera auf und schätzte, genau wie zuvor Knox, ihren Aufnahmewinkel ab. »Vermutlich. Ich hab mich schon gefragt, was das viele gelbe Band soll. Das ist die Zeitkapsel, die sie damals da drüben versenkt haben, als wir zugeschaut haben, richtig?«
»Ganz genau. Es sei denn, jemand hätte sie ausgegraben und eine andere versenkt, von der ich nichts weiß.«
»1985. Southern Cal gewann damals die Rose Bowl, und ich durfte mir ein ganzes Jahr lang das Gequatsche von diesem Arschloch Aaron anhören.«
Kelvin bezeichnete seinen Schwager Aaron grundsätzlich als »Arschloch Aaron«, weil er den Stabreim mochte; seinen Schwager selbst mochte er weniger. Er griff unter die Theke, ließ ein Band auswerfen und reichte es Knox. »Da hast du es.«
»Ich weiß nicht, wann du es zurückbekommst.«
»Mach dir deswegen keine Gedanken, ich habe Ersatzbänder.«
Mit dem Band in der Hand kehrte Knox in sein Büro zurück. Er hatte einen kleinen Fernseher mit Recorder, den er einschaltete, um das Band einzulegen. Die Fernbedienung in der Hand, spulte er die Kassette zurück, bis er ungefähr die richtige Uhrzeit erreicht hatte, und von da an abschnittsweise wieder vor, bis auf der eingeblendeten Uhr 1:59 zu lesen war. Die Aufnahme war nicht besonders gut und die Glasscheibe verzerrte den Blick, aber er konnte den viereckigen Gedenkstein genau an der vorgesehenen Stelle erkennen. Er drückte auf PLAY und schaute zu. Weil er nicht sagen konnte, wie exakt die eingeblendete Uhr gestellt war, wusste er auch nicht, wie lange er zuschauen musste.
Um 2:03:17 gab es einen weißen Blitz. Knox saß senkrecht in seinem Stuhl. Erst um 2:03:56 war wieder etwas zu erkennen – nämlich dass der helle, viereckige Granitstein auf der Seite lag und der Boden aufgewühlt war.
»Leck mich am Arsch«, sagte er leise. »Was wird hier gespielt?«
2
Eine genauere Untersuchung des Tatortes förderte rein gar nichts zutage. Der Granitstein war auf der Seite mit den eingravierten Daten poliert, aber trotz einer minutiösen Untersuchung konnten keine Fingerabdrücke sichergestellt werden. Fußabdrücke gab es definitiv keine. Die Geschichte war ein einziges Rätsel.
Inzwischen war Knox nicht mehr der Einzige, der neugierig geworden war. Tarana kochte vor Wut, weil sie immer noch überzeugt war, dass jemand an ihren Kameras herumgespielt hatte, obwohl Knox ihr klarzumachen versucht hatte, dass die Überwachungskamera aus dem Laden seines Vaters denselben Blitz und danach nichts weiter aufgenommen hatte. Er nahm sich vor, noch einmal mit Tarana zu sprechen, wenn ihre Wut halbwegs verraucht war.
Peke County war ein kleiner Bezirk und nicht gerade eine Brutstätte des Verbrechens. In Pekesville lebte eine überschaubare Anzahl von Einwohnern, dreiundzwanzigtausend Menschen, gerade so viele, dass es einige Annehmlichkeiten gab, auf die man in kleineren Orten verzichten musste, aber auch nicht so viele, dass es Straßengangs oder Satanistenzirkel oder andere exotische Gruppierungen gegeben hätte. Das Sheriff’s Department schlug sich hauptsächlich mit Wald- und Wiesenstraftaten herum: häuslichen Gewalttaten, Diebstählen, Fahrten unter Alkoholeinfluss, Drogendelikten. In letzter Zeit waren geheime Drogenküchen in Mode gekommen, und da diese Labore vorzugsweise an entlegenen Flecken eingerichtet wurden, waren die meisten davon eher auf dem Land als innerhalb der Stadtgrenzen zu finden, weshalb die Deputys schnell zu Experten geworden waren, wie man die im wahrsten Sinn des Wortes explosive Situation klären konnte.
Aber ein Loch im Boden? Was sollten sie damit anfangen?
Als der Sheriff Calvin Cutler in sein Büro geschlendert kam und von dem rätselhaften Verschwinden der Zeitkapsel hörte, zog er los, um das Loch mit eigenen Augen zu sehen. Gefolgt von mehreren Deputys und zwei Kriminalpolizisten, marschierte er vor das Gerichtsgebäude. »Das schlägt doch alles«, sagte er, den Blick unverwandt auf die lose Erde innerhalb des abgesperrten Tatortes gerichtet. »Wozu sollte jemand eine Zeitkapsel stehlen wollen, herrjemine?«
Calvin Cutler fluchte nicht, was für einen öffentlichen Ordnungshüter so ungewöhnlich war, dass ihn seine Männer manchmal, hinter seinem Rücken zwar, aber nicht ohne Wohlwollen, als »Hochwürden« bezeichneten. Knapp zwei Meter groß, wog er an die hundertfünfzig Kilo und hatte Hände, in denen ein Basketball verschwinden konnte. Er hatte als Deputy angefangen, sich durch die Ränge bis zum Chief Deputy hochgearbeitet und dann, als der Sheriff in Ruhestand gegangen war, für dessen Amt kandidiert, das er inzwischen in seiner vierten Amtszeit innehatte. Sheriff Cutler hatte seinen Job von der Pike auf gelernt, und Knox konnte sich keinen besseren Chef vorstellen.
»Das müssen ein paar dumme Jungs gewesen sein«, fuhr er fort. »Sonst würde doch niemand so einen Quatsch anstellen.«
»Aber wie haben sie ihn angestellt?«, fragte Knox.
Der Sheriff drehte sich um und sah nachdenklich zu der Kamera unter dem Dachgesims des Gerichtsgebäudes auf. »Bloß ein Blitz auf dem Film, wie?«
»Genau wie auf dem Überwachungsband aus dem Haushaltswarenladen.«
Sheriff Cutler stopfte die Hände in die Hosentaschen und grinste Knox an. »Das macht Sie ganz irre, schätze ich.«
»Es macht mich jedenfalls neugierig.«
»Schätze, das heißt, dass Sie das Geld des Departments rausschmeißen werden, um diesem mysteriösen Loch auf den Grund zu gehen, wenn Sie den Scherz gestatten.«
Knox zuckte mit den Schultern. Auf seiner Liste an vordringlichen Aufgaben kam das an letzter Stelle. Es gab kein Opfer, und es war nichts von Wert gestohlen worden. Natürlich handelte es sich dabei um Sachbeschädigung, aber die entscheidende Frage war, ob wirklich jemand geschädigt worden war. Außerdem entschied letztendlich sowieso der Sheriff und nicht er, in welchen Fällen ermittelt wurde. »Nur in meiner freien Zeit, wenn Sie gestatten. Die Sache ist befremdlich, aber nicht von Belang.«
»Falls Sie freie Zeit haben«, schloss der Sheriff leutselig, und alle zogen wieder ab ins Gerichtsgebäude.
»Schon«, stimmte Knox ihm zu. Auch wenn das County klein war, gab es im Department immer genug zu tun, da es chronisch unterbesetzt war. Knox war zwar Chief Investigator, aber da das Büro insgesamt nur über drei Ermittler verfügte, hielt sich die Ehre in Grenzen. Dass sie nur zu dritt waren, bedeutete, dass sie zwar schon von Achtstundenschichten gehört hatten, aber nicht sicher waren, ob es so etwas wirklich gab; mehr oder weniger waren sie rund um die Uhr im Einsatz. Knox arbeitete gewöhnlich zwischen siebzig und achtzig Stunden pro Woche, aber das war auch darauf zurückzuführen, dass die beiden anderen Ermittler Familie hatten und er ihnen möglichst viel Zeit zu Hause gönnen wollte. So wie er es sah, bedeutete das nicht, dass er ein besonders guter Chef war; es bedeutete, dass er einsam war und möglichst viel arbeitete, damit er nur zum Schlafen nach Hause musste.
Sie hatten genug Zeit damit verschwendet, über den Diebstahl einer Zeitkapsel nachzugrübeln, und auf seinem Schreibtisch wartete ein Berg Papier darauf, abgetragen zu werden, ganz zu schweigen von jenen Fällen, in denen er tatsächlich ermitteln musste. Nachdem er sich mit einer weiteren Tasse Kaffee gestärkt hatte, machte er sich wieder an die Arbeit.
Knox liebte seine Arbeit. Nicht nur wegen des Kameradschaftsgeistes, sondern weil der Job wie für ihn geschaffen war. In welchem anderen Beruf würde er dafür bezahlt, Fragen zu stellen, neugierig zu sein, Rätsel zu lösen? Okay, vielleicht gab es noch mehr Jobs, in denen er ähnlich gearbeitet hätte, aber als Ermittler durfte er noch dazu eine Waffe tragen. Damit konnte ein Reporter nicht aufwarten.
Nachdem er eine Stunde an seinem Schreibtisch abgeleistet und dabei etwa ein Viertel der anstehenden Akten bearbeitet hatte, stand er wieder auf und streifte sich ein leichtes Sakko über. Er trug ein Schulterholster über einem weißen Polohemd, das korrekt in den Jeans steckte, und darunter leicht angestoßene Turnschuhe. In Anbetracht der Hitze des Frühsommertages hätte er liebend gern auf das Sakko verzichtet, aber damit hätte er gegen den Dresscode des Sheriff’s Department verstoßen. Calvin war es egal, ob seine Ermittler in Pyjamahosen Dienst schoben, solange sie ein Sakko anhatten. Trotzdem schätzte sich Knox glücklich, denn immerhin bestand der Sheriff nicht auf einer Krawatte.
»Wohin willst du?«, fragte Helen, die Assistentin von Sheriff Cutler, die sich eben in Knox’ Büro beugte, um einen zehn Zentimeter hohen Aktenstapel auf seinem Schreibtisch abzuladen.
»Zu Jesse Bingham. Jemand ist gestern Abend in seine Scheune eingebrochen, hat alle Traktorreifen aufgeschlitzt und ein paar Hühner abgeschlachtet.«
»Ich kenne niemanden, der es mehr verdient hätte, dass man ihm die Reifen aufschlitzt, aber seine Hühner tun mir leid«, sagte Helen und spazierte zurück in ihr Büro. Jesse Bingham war berüchtigt für seine pathologische Feindseligkeit und reichte praktisch jedes Mal, wenn ihm jemand über den Weg lief, Anzeige ein.
Auch Knox taten die Hühner leid. Es mochten dumme Vögel sein, aber Jesse Bingham zu gehören, war eindeutig Strafe genug.
Er bog aus dem Parkplatz links ab auf die Fourth Avenue, die direkt auf den Highway führte. Als er an der Ampel wartete, um rechts abzubiegen, sah er genau gegenüber dem Highway eine einsame Gestalt auf dem Brookhaven Cemetery stehen. Spontan schaltete er den Blinker wieder aus und fuhr, als die Ampel auf Grün wechselte, quer über die Kreuzung zur Friedhofseinfahrt.
Er parkte unter dem breiten Schatten einer hundertjährigen Eiche, stieg aus und spazierte über das dichte Gras zu der einsamen Frau, die dort stand, eine Hand leicht auf einen Grabstein aus weißem Marmor gelegt. Er wusste, auch ohne hinzusehen, was auf dem Grabstein stand: Rebecca Lacey, geliebte Tochter von Edward und Ruth Lacey, gefolgt von ihrem Geburts- und Todesdatum. Wäre sie drei Monate später gestorben, hätte auf dem Grabstein gestanden: Rebecca Davis, geliebte Ehefrau von Knox Davis. Er legte den Arm um die Frau, die daraufhin wortlos den Kopf an seine Schulter lehnte. Gemeinsam blickten sie auf das Grab der jungen Frau, die sie beide geliebt hatten: ihre Tochter, seine Verlobte.
»Sieben Jahre sind es jetzt«, sagte sie leise. »Manchmal denke ich tagelang nicht an sie, aber wenn mir das dann auffällt, ist es fast noch schlimmer als an den Tagen, an denen ich sie so intensiv vermisse, als wäre es gestern gewesen.«
»Ich weiß«, sagte er, weil er es wirklich wusste. Als er zum ersten Mal gemerkt hatte, dass er am Vortag kein einziges Mal an Rebecca gedacht hatte, war das Gefühl, sie betrogen zu haben, kaum auszuhalten gewesen. Aber die Zeit blieb nicht stehen, und die Lebenden mussten entweder weiterleben oder ebenfalls sterben; so oder so drehte sich die Welt unaufhaltsam weiter, bis der leere Platz irgendwann ausgefüllt war. Inzwischen konnte er an Rebeccas Grab stehen, ohne das Gefühl zu haben, dass ihm ein Dolch ins Herz gebohrt wurde. Seitdem die Erinnerung an ihre Liebe ein wenig verblasst war, konnte er endlich voller Zuneigung an sie denken. Die gemeinsame Zeit würde er wahrscheinlich immer lieben, dieses Versprechen auf ein trautes Glück, aber inzwischen war sie seit sieben Jahren von ihm gegangen und er nicht mehr in sie verliebt.
Er küsste die Frau, die um ein Haar seine Schwiegermutter geworden wäre, auf die Stirn. Für sie war das anders; Rebecca würde immer ihr Kind bleiben, und an dieser Art von Liebe würde sich nie etwas ändern. Es war eine Liebe, die unabhängig von allen Hormonen oder chemischen Prozessen weiterleben würde, die keine Nähe brauchte. Andererseits kannte auch Ruth jene Tage, an denen die Erinnerungen ausblieben, was vielleicht der Weg der Natur war, den Schmerz in erträglichen Grenzen zu halten.
Ruth Lacey war eine schlanke, jung aussehende Frau von dreiundfünfzig Jahren. Ihr Haar, in dem es kaum graue Strähnen gab, hatte sie zu einer koboldhaften Frisur geschnitten, die ihrem zarten Gesicht schmeichelte. Als Rebecca geboren wurde, war sie zwanzig gewesen, was ihr inzwischen lächerlich jung erschien. Ed, ihr Mann, hatte sie praktisch vom Hochzeitstag an regelmäßig betrogen, aber sie war aus Gründen, die sich niemandem außer ihr selbst erschlossen, bei ihm geblieben. Vielleicht hatte er ihr den Geschmack an der Ehe so gründlich vergällt, dass sie nicht einmal den Versuch unternahm, sich von ihm zu befreien, um mit einem anderen Mann zusammen sein zu können, vielleicht war sie auch aus rein praktischen Gründen bei ihm geblieben. Vielleicht liebte sie den Hurensohn wirklich. Knox wusste aus Erfahrung, dass man nie sagen konnte, was sich in fremden Beziehungen abspielte, welches Band manche Menschen zusammenhielt.
Sie war eine Frau, die offen und freimütig wirkte, in Wahrheit aber sehr verschlossen war. Als Rebecca starb, hatte Ruth ihren Schmerz und Kummer für sich behalten – und nur Knox davon erzählt. Damals hatten sie sich aneinander aufgerichtet, und sie hatte ihm offenbart, wie tief sie der Tod ihrer Tochter getroffen hatte. Nachdem sie einander durch die dunkelsten Tage geholfen hatten, waren, auch wenn sie sich im Lauf der Zeit weniger oft gesehen hatten, die Verbundenheit und gegenseitige Zuneigung erhalten geblieben wie bei zwei Soldaten, die Seite an Seite gekämpft und diese Kameradschaft nie vergessen hatten.
Auf Rebeccas Grab lagen immer frische Blumen. Knox hatte seinen Teil dazu beigesteuert, aber in den letzten Jahren hatte vorwiegend Ruth dafür gesorgt. Letztes Jahr war er überhaupt nicht auf den Friedhof gekommen, wenn er sich recht erinnerte. Die drei Jahre davor war er nur an Rebeccas Todestag hier gewesen.
Komisch, aber als Ruth und er am Tag nach Rebeccas Tod praktisch an derselben Stelle wie jetzt gestanden hatten, hatte Ruth ihm prophezeit, wie es sein würde: »Eine Weile«, hatte sie gesagt, »wirst du dauernd herkommen; dann wirst du allmählich loslassen können. Du wirst vielleicht an ihrem Todestag kommen oder an ihrem Geburtstag. Vielleicht an Weihnachten. Vielleicht wirst du selbst das vergessen und gar nicht kommen. So soll es auch sein. Du brauchst deswegen kein schlechtes Gewissen zu haben. Du musst dein Leben leben, und das kannst du nicht, wenn du dich an etwas festklammerst, das nie eintreffen wird.«
Er bückte sich, um ein Unkraut auszuzupfen, das dem Adlerauge des Grabpflegers entgangen war, und musste an Rebeccas Beerdigung denken, als das Grab mit Blumen überhäuft gewesen war. Sie war im März gestorben, kurz bevor der Frühling mit voller Kraft eingesetzt hatte. Er hatte bei ihr übernachtet – sie waren zwar verlobt gewesen, aber noch nicht zusammengezogen und als sie am Morgen aufgestanden war, hatte sie gesagt: »Ich habe höllische Kopfschmerzen. Ich nehme lieber ein Aspirin.« Sie war in die Küche gegangen, und er war unter die Dusche gehüpft. Als er geduscht und sich rasiert hatte, war er ihr in die Küche gefolgt und hatte sie auf dem Boden liegend gefunden; da war sie bereits tot. Er hatte den Notarzt gerufen und sie wiederzubeleben versucht, obwohl er wusste, dass es dafür zu spät war, aber er hatte es nicht fertiggebracht, es nicht zu versuchen. Als die Sanitäter eintrafen, war er völlig außer Atem und schweißnass, aber er hatte immer noch nicht aufhören können, weil sein Herz einfach nicht akzeptieren konnte, was sein Kopf längst wusste.
Bei der Obduktion stellte sich heraus, dass in ihrem Gehirn eine enorm erweiterte Arterie geplatzt war. Selbst wenn sie an diesem Morgen in der Notaufnahme gestanden hätte, hätte niemand so schnell reagieren können, dass sie gerettet worden wäre. Und so war sie mit sechsundzwanzig Jahren gestorben, zwei Wochen vor ihrem Jungfernabschied und neun Wochen vor ihrer Hochzeit.
Damals hatte er angefangen, sich mit Arbeit zu betäuben, und bis jetzt, sieben Jahre später, hatte sich nichts daran geändert. Vielleicht war es an der Zeit, allmählich auf sechzig Stunden runterzugehen. Er war kaum mit anderen Frauen ausgegangen – wer rund um die Uhr arbeitete, hatte keine Zeit für ein Date – und hatte sich infolgedessen seit Rebecca mit keiner Frau mehr eingelassen. Er war jetzt fünfunddreißig Jahre alt und er wurde mit tödlicher Sicherheit nicht jünger.
»Und wenn wir die Zeit zurückdrehen könnten?«, fragte Ruth leise und riss ihn damit aus seinen Gedanken. »Und wenn ich an den Tag vor ihrem Tod zurückkehren könnte und darauf bestehen würde, dass sie ins Krankenhaus fährt, weil ich wüsste, was ihr droht?«
»Ich glaube nicht an ›und wenn‹«, sagte er, aber er sagte es freundlich. »Wir müssen nehmen, was kommt, und uns damit abfinden.«
»Hast du dir nie gewünscht, es wäre anders gekommen?«
»Tausendmal und auf tausend verschiedene Weisen. Aber es ist nie anders gekommen. Dies ist die Wirklichkeit, und manchmal geht sie dir echt an die Nieren.«
»Das hier tut es jedenfalls.« Sie strich über den Grabstein ihrer Tochter.
»Kommst du noch oft her?«
»Nicht so oft wie früher. Ich war ein paar Monate nicht hier und wollte wieder einmal frische Blumen bringen. Ich komme längst nicht mehr so oft wie anfangs, und es macht mich ganz krank, dass sie mir so entgleitet.«
»Wie gesagt, das Leben geht weiter.« Er legte wieder den Arm um ihre Taille und drehte sie mit sanfter Gewalt vom Grab weg.
»Ich will sie nicht vergessen.«
»Ich erinnere mich weniger an ihren Tod als daran, wie sie früher war.«
»Kannst du dich noch an ihre Stimme erinnern? Meistens kann ich es nicht; aber manchmal meine ich Rebecca aus weiter Ferne zu hören, dann ist mir ihre Stimme wieder ganz deutlich im Gedächtnis; und wenig später ist alles wieder weg. Ihr Gesicht steht mir immer klar vor Augen, aber an ihre Stimme kann ich mich kaum noch erinnern.« Sie starrte auf die Bäume, um die Tränen niederzukämpfen, was ihr, wenigstens vorübergehend, auch gelang. »So viele Jahre, so viele Erinnerungen. Baby, Kleinkind, Mädchen, Teenager, Frau. Ich kann sie in jedem Alter sehen, wie auf einem Schnappschuss, und ich wünschte, ich hätte ihr mehr Beachtung geschenkt, hätte mir alles einzuprägen versucht. Aber kein Mensch kann sich vorstellen, dass das eigene Kind stirbt; man glaubt immer, dass man selbst zuerst geht.«
»Manche Menschen vertreten die Auffassung, dass wir zurückkommen, um weiterzulernen und um Dinge zu erfahren, die uns in unserem vergangenen Leben entgangen sind.« Er glaubte nicht daran, aber er konnte sich vorstellen, dass der Gedanke Trost spendete.
»Dann muss ich einige phantastische Leben hinter mir haben«, sagte sie. Sie schnaubte damenhaft. »Und phantastische Ehemänner.«
Knox war auf diesen Kommentar nicht vorbereitet und prustete unwillkürlich los. Er senkte den Blick und sah, dass sie an ihrer Unterlippe kaute, um sich ein Lächeln zu verkneifen. »Du bist zäh«, stellte er fest. »Du wirst es schaffen.«
»Und wohin bist du unterwegs?«, fragte Ruth, als sie bei ihrem Auto angekommen waren. Sie hatte nicht geweint, und sie würde das womöglich als Erfolg betrachten, obwohl der Kummer immer noch wie ein Schleier über ihren fein geschnittenen Zügen lag. Sie fragte ihn das, um die Vergangenheit vorübergehend abzuschütteln, nicht weil sie die Antwort wirklich interessiert hätte.
»Ich bin auf dem Weg zu Jesse Bingham. Jemand hat die Reifen von seinem Traktor aufgeschlitzt und ein paar von seinen Hühnern abgeschlachtet.«
»Warum, in Gottes Namen, sollte jemand den armen Vögeln etwas zuleide tun?« Sie zog die Stirn in Falten. »Das ist ja grässlich.«
»Ja, die Hühner wurden schon von vielen bedauert.«
»Aber niemand bedauert Jesse oder seine Traktorreifen, wie?« Die Stirn glättete sich wieder, und sie ließ sich lachend von ihm umarmen.
Er hielt ihr die Wagentür auf und wartete aus Gewohnheit ab, bis sie den Sicherheitsgurt angelegt hatte. »Pass auf dich auf«, sagte er, schloss die Tür, und sie winkte ihm zum Abschied zu, während sie den Motor anließ und wegfuhr.
Knox kehrte zu seinem Auto zurück; er wünschte, sie wäre ihm nicht begegnet. Sie machte ihm ein schlechtes Gewissen, weil er nicht so tief trauerte wie sie. Das konnte er nicht. Und das wollte er nicht. Er wollte eine andere Frau finden, mit der er lachen und Sex haben konnte, die er lieben und die er eines Tages heiraten konnte, um mit ihr Kinder zu bekommen, auch wenn die Chancen dafür verdammt schlecht standen, solange er sich in seiner Arbeit vergrub.
Er konzentrierte sich wieder auf seinen Job und fuhr raus zur Bingham-Farm, um festzustellen, was es mit der gemeinen Attacke auf sich hatte. Manchmal wussten die Betroffenen ziemlich genau, wer dahinter steckte, oder die Nachbarn hatten etwas beobachtet, aber Jesse war bei aller Welt unbeliebt und hatte keine nahen Nachbarn. Er gehörte zu den Menschen, die alles, was ihnen widerfuhr, auf andere schoben; wenn der Motor in seinem Lieferwagen streikte, ging er sofort davon aus, dass ihm jemand Zucker in den Tank geschüttet hatte. Wenn er etwas verlor, erstattete er umgehend eine Diebstahlsanzeige. Trotzdem konnten ihn die Kollegen nicht einfach rausschmeißen; sie mussten jeder Anzeige nachgehen, denn wenn er nur ein einziges Mal recht behalten sollte, würde er ihnen die Hölle heiß machen, weil sie ihren Job nicht erledigten.
Aufgeschlitzte Traktorenreifen und tote Hühner entsprangen allerdings ganz bestimmt nicht Jesses Verfolgungswahn. Entweder waren die Reifen aufgeschlitzt worden oder eben nicht, und die Hühner waren entweder tot, oder sie rannten herum und pickten Würmer auf. Wenigstens würde sich Knox diesmal mit eigenen Augen überzeugen können.
Jesse Binghams Farm lag auf einem hübschen Flecken mit bewaldeten Hügeln und gepflegten Feldern. Eines musste man Jesse zugutehalten: Er kümmerte sich um sein Anwesen. Die Zäune waren immer in gutem Zustand, das Gras gemäht, das Haus gestrichen und die Schuppen repariert. Und dabei hatte Jesse nicht einmal Hilfe; obwohl er schon Ende sechzig war, erledigte er alles ganz allein. Er war einst verheiratet gewesen, aber Mrs Bingham war klug genug gewesen, ihn vor über dreißig Jahren zu verlassen, um zu ihrer Schwester nach Ohio zu ziehen. Wie man hörte, waren die beiden nie geschieden worden, was für Knox ein guter Trick zum Geldsparen war. Jesse würde hundertprozentig keine Frau mehr finden, die ihn heiratete, und Mrs Bingham war nach den Jahren an seiner Seite so kuriert von der Ehe, dass auch sie nicht daran interessiert war, sich noch einmal einen Ring anstecken zu lassen.
Knox parkte seinen Wagen neben Jesses Pick-up und stieg aus. Die Haustür ging auf, sobald er die Stufen zur Veranda betrat. »Sie haben sich ganz schön Zeit gelassen«, begrüßte ihn Jesse übellaunig durch die Fliegentür hindurch. »Ich hab Sachen zu erledigen und keine Zeit, auf dem Hintern zu sitzen, bis Sie es für richtig halten, hier aufzutauchen.«
»Ihnen auch einen guten Morgen«, erwiderte Knox spröde. Er war jedes Mal überrascht, wenn er Jesse begegnete. Falls es je einen Menschen gegeben hatte, dessen Äußeres nicht zu seinem Wesen passte, dann Jesse Bingham. Er war klein, leicht untersetzt, hatte ein rundes Engelsgesicht und strahlend blaue Augen; aber wenn er den Mund öffnete, war nichts von wegen frohe Botschaft. Er wirkte wie ein tollwütiger Weihnachtsmann.
»Sind Sie hergekommen, um Ihre Arbeit zu tun oder um dumme Bemerkungen zu machen?«, fuhr Jesse ihn an.
Knox unterdrückte seine rapide aufflammende Ungeduld. »Warum zeigen Sie mir nicht den Traktor und die Hühner?«
Jesse stapfte zur Scheune, und Knox folgte ihm. Der Traktor parkte im Schutz eines Vordaches neben der Scheune, und schon von Weitem konnte Knox erkennen, dass die Felgen flach auf dem Boden ruhten. »Da«, sagte Jesse und zeigte darauf, »die kleinen Stinker haben alle sechs Reifen kaputt gemacht.«
»Sie glauben, dass es Jugendliche waren?« Allmählich begann sich Knox zu fragen, ob gestern eine Jugendgang die Stadt unsicher gemacht hatte.
»Woher soll ich das, verflucht noch mal, wissen? Das müssen Sie schon selbst rausfinden. Wer weiß, vielleicht war es auch Matt Reston von der Traktorwerkstatt, damit er mir einen Satz neue Reifen verkaufen kann.«
»Sie sprachen von ›kleinen Stinkern.«
»Das ist nur eine Redewendung. Kennen Sie so was nicht?«
»Doch, doch«, erwiderte Knox locker. »Genau wie ›Arschloch‹. Nur eine Redewendung.«
Jesse sah ihn misstrauisch an. Er hatte die Erfahrung gemacht, dass die Menschen entweder vor seiner schroffen Art zurückscheuten oder sich mit ihm anlegten. Knox Davis behielt stets die Ruhe, aber irgendwie ließ er immer durchblicken, dass er sich nicht alles bieten lassen würde.
Knox untersuchte sorgfältig den Boden; leider schienen alle Fußabdrücke von Jesse zu stammen, was er daran erkannte, dass sie für einen Mann eher klein waren. »Sie sind hier rumgelaufen?«
»Wie soll ich mir sonst alle sechs Reifen ansehen?«
»Falls es irgendwelche Fußabdrücke gab, haben Sie die ruiniert.«
»Als könnten Sie an einem Fußabdruck ablesen, von wem er stammt. Ich glaube nicht an diesen Quatsch. Millionen von Menschen tragen gleich große Schuhe.«
Knox wusste genau, wo er gern den Abdruck eines Turnschuhs Größe 45 hinterlassen hätte. Er prüfte die Reifen und suchte auf den Metallfelgen nach Fingerabdrücken, aber soweit er feststellen konnte, war jeder Reifen genau einmal aufgeschlitzt worden: einmal eingestochen, dann die Klinge nach unten gezogen. Ob der Traktor abgesehen davon überhaupt berührt worden war, ließ sich nicht mehr eruieren. Trotzdem konnte er vielleicht auf dem Traktor einen Fingerabdruck finden, der nicht von Jesse stammte – falls Jesse den Traktor nicht am Morgen abgewischt hatte, womit er alle anderen Spuren vernichtet hätte. Knox traute dem alten Stinker einfach alles zu, allerdings nicht, dass er seine Reifen selbst aufschlitzte, denn das bedeutete, dass er sie für teures Geld ersetzen musste. Es sei denn ... »Sind Sie gegen so was versichert, Jesse?«
»Klar doch. Nur ein verdammter Narr hat heutzutage keine Versicherung, wo überall Leute rumlaufen, die so tun, als wären sie auf deinem Grundstück hingefallen, nur damit sie dich verklagen können.«
»Wie hoch ist Ihr Selbstbehalt?«
»Was geht Sie das an?«
»Ich frage nur.«
Jesses Gesicht begann rot anzulaufen. »Glauben Sie etwa, dass ich das war? Glauben Sie etwa, ich würde meine eigenen Reifen aufschlitzen?«
»Wenn Sie von der Versicherung einen Satz neue Reifen erstattet bekämen und Sie einen niedrigen Selbstbehalt haben, könnten Sie auf diese Weise Geld sparen. Neue Reifen bekämen Sie für wie viel, sagen wir hundert Dollar?«
»Ich rufe den Sheriff!«, brüllte Jesse. »Schieben Sie Ihren Arsch von meinem Grund! Ich will jemand anderen, ich ...«
»Sie kriegen mich oder niemanden«, fiel ihm Knox ins Wort. »Und ich kann beim besten Willen nicht sagen, wer Ihre Reifen aufgeschlitzt hat. Es ist mein Job, alle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Und das ist eine davon.« Er ging weiter hinter die Scheune, wobei er darauf achtete, nicht in den weichen Boden an der Wand zu treten, den Jesse grasfrei hielt. Da. Die Erde war aufgewühlt. Er beugte sich darüber und konnte etwas erkennen, das aussah wie ein doppelter Fußabdruck, so als wäre jemand denselben Weg zurückgegangen, den er gekommen war. Außerdem war der Abdruck eindeutig größer als Jesses Schuh.
»Und was ist mit meinen Hennen? Glauben Sie, ich hätte meine Hennen auch selbst abgeschlachtet? Schauen Sie sich die Tiere doch an!« Jesse war ihm geifernd gefolgt und hüpfte vor Wut wie ein Rumpelstilzchen auf der Stelle.
Knox hob die Hand. »Bitte machen Sie diese Fußabdrücke nicht auch noch kaputt. Halten Sie Abstand, okay?«
»Ach, jetzt haben Sie sich’s anders überlegt, wie? Kommen hier auf meine Farm und beschuldigen mich ...«
»Jesse.« Knox’ Stimme blieb ruhig, aber der Blick, mit dem er Jesse festnagelte, verriet, dass er mit seiner Geduld am Ende war.
Jesse verstummte mitten in seiner Tirade und begnügte sich damit, mürrisch dreinzublicken.
»Zeigen Sie mir die Hennen.«
»Hier lang«, brummte Jesse und führte ihn zurück, am Traktor vorbei zu einem kleinen Hühnerstall, der sich an eine gestutzte Hecke hinter dem Haus schmiegte. »Sehen Sie sich das an«, sagte er und streckte den Finger aus. »Sechs Stück.«
Sechs Hennen lagen im Gehege verstreut. Weil kein Blut zu sehen war, vermutete Knox, dass man ihnen die Hälse umgedreht hatte. Es überraschte und erschreckte ihn immer wieder, zu welchen Gemeinheiten die Menschen fähig waren.
»Haben Sie gestern Abend irgendwas gehört?«
»Nichts, aber ich war müde und hatte Schwierigkeiten mit dem Einschlafen, vielleicht habe ich also zu tief geschlafen. Eine komische Nacht. Dieses Geblitze hat mich wach gehalten, aber gedonnert hat es kein einziges Mal. Um Mitternacht hat das endlich aufgehört, und dann bin ich eingeschlafen. Danach muss es wohl passiert sein.«
»Blitze?« Knox sah ihn misstrauisch an. Er konnte sich an keine Blitze erinnern, und er war zu der Zeit unterwegs gewesen.
»Irgendwie viel zu dicht über dem Boden. Wie gesagt: merkwürdig. Nicht wie normale Blitze. Bloß weiße Strahlen, so als würden riesige Blitzlichter losgehen.«
Weiße Blitze, dachte Knox. Was für ein Zufall. Was, zur Hölle, wurde hier gespielt?
3
»Die Blitze könnten etwas zu bedeuten haben«, sagte Knox. »Gestern gab es einen weiteren Fall von Sachbeschädigung, bei dem es einen hellen Blitz gab. Aus welcher Richtung kamen die Blitze?«
»Ich versteh nicht, was ein paar vermaledeite Blitze mit meinen toten Hühnern zu tun haben sollen«, meckerte Jesse, aber er drehte sich um und deutete auf den Wald jenseits der Straße. »Von da drüben. Mein Schlafzimmerfenster zeigt dahin.«
»Sie sagten, sie seien dicht über dem Boden gewesen.« Knox drehte sich um und ließ den Blick über das Gelände schweifen: hügelig und dicht bewaldet, so wie fast überall im Osten Kentuckys. »Wie niedrig? In Baumhöhe oder höher?«
»Dicht über den Baumwipfeln, würde ich sagen.«
»Könnten Sie die Entfernung abschätzen?«
Jesse war Farmer, und Farmer kannten sich mit Entfernungen aus. Wahrscheinlich konnte er allein durch Abschreiten ziemlich genau einen Hektar abmessen. Da es Nacht gewesen war, würde seine Schätzung zwar gröber ausfallen, aber dafür kannte er jeden Erdhaufen und jede Mulde in der Umgebung. Mit zusammengekniffenen Augen spähte er zum Hügel hinüber, zu neugierig, um noch länger zu meckern. »Ich würde sagen, knapp hundert Meter. Viel weiter können sie nicht weg gewesen sein, weil man sonst über die Hügelkuppe kommt.«
Das hörte sich vernünftig an, fand Knox. »Ich werde mir das Gelände mal ansehen«, sagte er. »Wollen Sie mitkommen?«
»Ich ziehe nur noch Stiefel an.«
Während Jesse seine Stiefel holen ging, öffnete Knox den Kofferraum seines Dienstwagens und holte seine eigenen Stiefel heraus, die ihm fast bis zu den Knien reichten. Das schwere Leder schützte vor Schlangenbissen. Zum Glück war er nicht allergisch gegen Giftsumach oder Gifteiche, aber gegen Schlangengift war seines Wissens niemand immun. Er setzte sich auf die Verandatreppe, um die Stiefel überzustreifen.
Jesse kam in einem Paar grüner Gummistiefel heraus, und gemeinsam marschierten sie über die Straße und in den Wald hinein. Knox war überzeugt, dass sie einen neuen Rekord für die Zeitspanne aufstellten, während der Jesse nichts zu beklagen oder zu meckern fand; es waren bis jetzt – wie viele – volle fünf Minuten gewesen? Er sah auf die Uhr, damit er kontrollieren konnte, wie lang der Frieden halten würde.
Unter dem dichten Blätterdach der Bäume war es deutlich kühler. Knox war kein Naturbursche, aber er konnte Rot- und Weißeichen, Ahornbäume und Hemlocktanne unterscheiden. Wilde Azaleen tüpfelten den Boden mit zarten Farbflecken. Der volle, erdige Geruch stieg ihm in die Nase und verführte dazu, tief und inbrünstig durchzuatmen.
»Riecht gut, wie?«, bemerkte Jesse, und ausnahmsweise klang er ruhig statt streitbar. Knox machte sich im Geist eine Notiz, dass der Wald Jesses Temperament positiv zu beeinflussen schien; vielleicht sollten sie hier draußen einen Verschlag errichten und ihn darin einsperren.
Der Untergrund begann anzusteigen, der Abhang wurde steiler. Sie schlugen sich durch das Gebüsch, rissen ihre Kleider von den Ranken los, die sie zu packen versuchten, kletterten über einige kleinere Felsen und umrundeten die größeren. Jesse sah sich immer wieder um und maß im Geist die Entfernung ab, da das Blätterdach zu dicht war, als dass er sein Haus von hier aus hätte sehen können. Als sie knapp unter dem Hügelkamm waren, blieb er stehen. »Etwa hier, würde ich sagen.«
Knox ließ sich Zeit und studierte ihre Umgebung in allen Details. Gleich rechts von ihnen wurde das Unterholz ein wenig durchlässiger, war aber immer noch zu dicht, als dass man die Stelle als Lichtung bezeichnen konnte. Hier wuchsen dicke und hohe Bäume, in deren Schutz blühende Hartriegelbüsche standen. Soweit er feststellen konnte, waren keine Blätter versengt oder sonstwie beschädigt worden, folglich konnte der Blitz, welcher Art er auch gewesen sein mochte, entweder nicht nah genug gewesen sein, um Schaden anzurichten, oder er war nicht mit Hitze verbunden.
Der Boden allerdings ... etwas hatte Knox auf eine nicht genau feststellbare Art gestört. Er fand zwar keine Fußabdrücke, aber an manchen Stellen war die Vegetation aufgewühlt, und dunklere, feuchte Flecken waren zu sehen. »Hier war jemand«, sagte er zu Jesse und deutete dabei auf den Waldboden.
»Ich seh’s.«
»Aber er hat seine Spuren verwischt. Ich frage mich, was er hier oben gewollt hat.« Knox drehte sich einmal im Kreis und hielt Ausschau nach einer Schneise im Laub, durch die man auf ... was auch immer sehen konnte. »Von hier aus kann man nichts erkennen. Ich halte es für möglich, dass hier jemand eine Art Blitzlicht gezündet hat, aber wozu?« Er schnüffelte wieder, roch aber nur das gleiche volle, lehmige Aroma wie vorhin. Verbrannt war hier in letzter Zeit nichts, sonst hätte der Qualm noch zwischen den Bäumen gehangen.
»Könnte auch ein Tier gewesen sein.« Jesse deutete auf die umgetretenen Pflanzen. »Vielleicht haben hier zwei Hirsche gekämpft, oder es war ein Fuchs auf Karnickeljagd. Blut sehe ich allerdings keines. Und ich sehe auch keinen Sinn in der ganzen Sucherei, außer dass wir unsere Zeit vergeuden.«
Knox sah auf seine Uhr: dreizehn Minuten, ein neuer Rekord für Jesse Bingham. »Sie haben recht.« Er machte kehrt und ging auf demselben Weg bergab. »Ich war nur neugierig wegen dieser Blitze.«
»Ich hab doch gesagt, das war ein Trockengewitter.«
»Nicht wenn Sie keinen Donner gehört haben, nein. Das Gewitter hätte direkt über Ihnen sein müssen.« Und jeder Blitz erzeugte Donner. Außerdem war der Blitz, der in der Stadt die Überwachungskameras geblendet hatte, bestimmt keine Naturerscheinung gewesen.
»Vielleicht hat es ja gedonnert, und ich hab’s vergessen.«
»Vorhin haben Sie was anderes gesagt. Da haben Sie gesagt, Sie hätten keinen Donner gehört.«
»Ich werde alt. Ich höre nicht mehr so gut.«