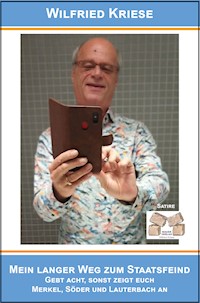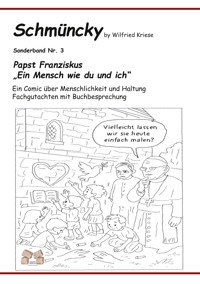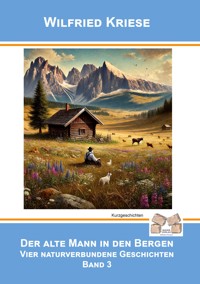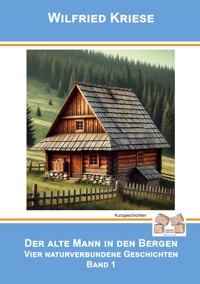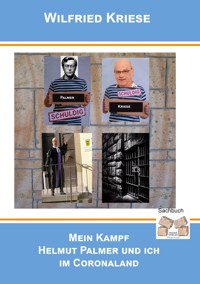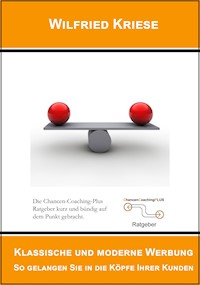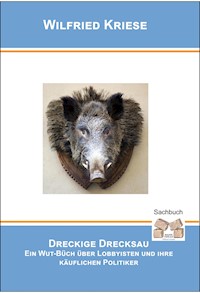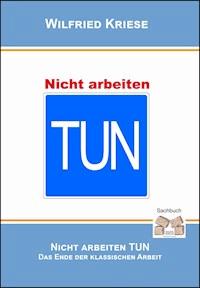
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Arbeit steht im Mittelpunkt unseres Lebens. Trotzdem sind 75% aller Erwerbstätigen mit ihrer Arbeit unzufrieden und nur noch 12% fühlen sich mit ihren Arbeitgebern und Vorgesetzten emotional verbunden. Die Auswirkungen dieser Zustände wirken bis in unser Privatleben hinein und haben verheerende gesellschaftliche Folgen. Deshalb vertritt der Autor, Wilfried Kriese, die Meinung, dass es für jeden einzelnen Zeit wird mit Arbeiten aufzuhören. Er zeigt in diesem Buch auf, wie das System Arbeit uns beherrscht und wie Sie sich aus dessen Zwängen befreien können, damit Sie zu Ihrem eigenem TUN gelangen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 66
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nicht Arbeiten TUN
Wilfried KrieseVorwort1. Teil: Das System ArbeitDie Arbeit im klassischen SinneNun geht es ab zum Thema ArbeitArbeit unter wirtschaftlichen AspektenArbeit unter sozialen AspektenEin System namens ArbeitDie Generation InstitutionenDie Rolle der PolitikEin System namens BildungVon der Old zur New Economy zum TUNDas Märchen von der Arbeit, die ausgehtDas RentenlabyrinthDas Märchen von der Elite oder was bin ich?Gehöre ich zur Elite?Es kann nicht jeder ein Einstein sein2. Teil: Weg von der Arbeit hin zum TUNEinführung: TUN für MitarbeiterLassen Sie Veränderungen zuFolgen Sie Ihrer BerufungBewerben Sie sich mit WürdeFinden Sie die Firma, die zu Ihnen passtDer Lohn des TUNSTUN für Selbstständige / Was heißt hier Arbeit?Bringen Sie Ihr Leben in SchwungRente und ArbeitTUN Sie und arbeiten Sie nichtTUN ist nicht nur ein WortWerden Sie erfolgreich in Ihrer NischeMachen Sie sich bemerkbar3. Teil: Mit Lebenszielen und Motivation zum TUN gelangenDie eigenen Schwächen zu Stärken machenStecken Sie Ihre Ziele abZiele, Zeit und MotivationIhre Motivation bestimmt Ihre LebenszieleGeben Sie niemals aufIhre Erfolge und MisserfolgeMitarbeiter-MotivationVereinen Sie Arbeit und FreizeitVergessen Sie nicht Ihren KörperChecken Sie Ihre ZieleImpressumWilfried Kriese
Nicht Arbeiten TUN
Das Ende der klassischen Arbeit
Mauer Verlag
Wilfried Kriese
72108 Rottenburg a/N
Buchgestaltung: Wilfried Kriese
Titelbild: Wilfried Kriese
Edition Wilfried Kriese 2018
Erstveröffentlichung 2008
Alle Rechte vorbehalten
Die Auszüge aus dem Brockhaus stammen
mit freundlicher Genehmigung aus:
Brockhaus. Die Enzyklopädie - Studienausgabe,
Bd. 2, 20. Auflage, F.A. Brockhaus GmbH,
Leipzig/Mannheim 2001
www.mauerverlag.de
www.wilfried-kriese.de
Vorwort
Seit mehr als 20 Jahren faszinieren mich gesellschaftliche Themen und deren Zusammenhänge.
Besonders zum Thema Arbeit entwickelte ich einen sensiblen Bezug. Das liegt daran, dass mir während der ersten 15 Jahre meines Erwerbslebens, aufgrund meiner Schulbildung, sehr viele Türen, gerade in der Berufswelt, nicht nur verschlossen blieben, sondern zusätzlich noch verbarrikadiert wurden.
Im Laufe von mehr als einem Jahrzehnt gelang es mir mich von den Zwängen, die mir vom System der Arbeitsgesellschaft aufgezwungen wurde, weitgehend zu befreien.
Dabei stellte ich auch fest, dass diese Zwänge unabhängig von gesellschaftlicher Herkunft und Bildungsstand die Menschen einengen und abhängig machen.
Die Frage, die mir heutzutage am meisten gestellt wird, lautet: Wie haben Sie all das in Ihrem Berufsleben erreicht und wie viele Stunden am Tag arbeiten Sie? Bleibt da noch überhaupt Zeit für Freizeit?
Meine Antwort ist seit Jahren die gleiche: ich arbeite nicht, sondern ich TUE.
Woraufhin sich dann meistens sehr interessante Gespräche über die Arbeit und ganz besonders über das TUN ergeben.
Als ich einigen Leuten erzählte, dass ich ein Buch über das TUN und das System Arbeit schreibe, stieß ich auf unerwartet großes Interesse und erhielt unzählige Denkanstösse zum Thema, wovon sehr viele in dieses Buch mit eingeflossen sind.
So wünsche ich mir, dass auch Sie bald aufhören können zu arbeiten und mit Ihrem TUN anfangen.
Da mich Ihre Gedanken und Erfahrungen zum Thema interessieren, würde ich mich freuen, wenn Sie mir diese mitteilen würden. Meine E-Mail-Adresse lautet [email protected].
Ihr Wilfried Kriese
1. Teil: Das System Arbeit
1. Teil: Das System Arbeit
Die Arbeit im klassischen Sinne
TUN ist das eine und arbeiten etwas vollkommen anderes. Bevor ich auf das Hauptthema des Buches, TUN und nicht arbeiten, eingehe, sollten wir uns zuerst mit dem Begriff und dem heutigen Verständnis der Arbeit beschäftigen.
Zuerst überlegte ich mir, wie ich den Begriff Arbeit erklären und vor allem, welche literarischen Hilfsmittel ich verwenden sollte. An Literatur zum Thema mangelte es mir in keiner Weise. Allerdings war ich mit all den Büchern und Beiträgen nicht wirklich zufrieden. Deshalb ging ich ins Internet. Oh je, was ich das so fand war fast nur zusammengestoppeltes Wissen. Bei Wikipedia fand ich zumindest etwas halbwegs Brauchbares, das aber auch mehr zusammengeschrieben ist, als dass man es ernsthaft zitieren könnte.
Somit fiel die Internetrecherche mangels Qualität durch. Schließlich wollte ich ja keinen zweitklassigen Schulaufsatz schreiben, um meinen Notendurchschnitt zu halten.
In solchen Fällen ist doch der gute alte Brockhaus die beste Quelle des Wissens. Darin wird der Begriff Arbeit aus historischer wie gesellschaftlicher Sicht genauestens erklärt. Allerdings so kompliziert und unverständlich, dass man schon fast ein abgeschlossenes Studium braucht um den Lexikonartikel zu verstehen.
Deshalb beschloss ich einfach Auszüge aus dem Brockhaus zu verwenden und mit eigenen Kommentaren zu ergänzen. Ich finde, mein TUN hat sich hier gelohnt, aber lesen Sie selbst.
Nun geht es ab zum Thema Arbeit
Im Brockhaus heißt es ganz am Anfang über die Arbeit:
[urspr. „schwere körperliche Anstrengung“, „Mühsal“, „Plage“], der bewusste und zweckgerichtete Einsatz der körperlichen, geistigen und seelischen Kräfte des Menschen zur Befriedigung seiner materiellen und ideellen Bedürfnisse.
Diese Erklärung ist weit weg vom TUN, denn beim TUN werden Mühsal und Plage weitgehend vermieden.
Weiter heißt es:
Begriffsgeschichte
Arbeit gehört zu den Grundbegriffen, in denen die neuzeitliche Gesellschaft ihr Selbstverständnis ausgelegt und diskutiert hat. Die Geschichte des Wortes, die in der griechischen Antike und im alten Israel beginnt, hatte ihre für das moderne Verständnis von Arbeit entscheidenden Epochen in der Reformation und im 19. Jahrhundert (...).
Im Übergang zu den Stadtgesellschaften der klassischen Zeit (Athen, Sparta) änderten sich diese Einstellungen; körperliche Arbeit und Lohnarbeit büßten ihr soziales Ansehen ein. (…) Der freie Bürger sollte allein mit musischen, philosophischen und politischen Tätigkeiten beschäftigt sein, während die niedere Arbeit von Unfreien zu verrichten war.
Als frei galten lediglich die oberen zehntausend, was man heute als Elite bezeichnet. Alle anderen hatten zu arbeiten und sozusagen nicht zu denken und zudem artig ihre Steuern zu bezahlen. Womit oft gerade soviel übrig blieb, dass es zum Überleben reichte.
Die römische Antike war nicht von eindeutigen Urteilen über die Arbeit bestimmt. Im alten Rom war die Arbeit Pflicht für jeden, ob frei oder unfrei. Später erneuerte Cicero die Grundsätze der griechischen Philosophie und wies die körperliche Arbeit den Sklaven zu. Die stoische Philosophie würdigte dagegen die Leistung, die aus der Arbeit hervorgeht.
Damals wurden die Säulen der abhängigen Arbeit errichtet. Niemand sollte mehr so frei sein, dass er ohne Arbeit auskommen konnte. Diese Freiheit war nur noch einem sehr kleinen Teil der Bevölkerung vorbehalten.
In Israel galt die Arbeit nach den Aussagen des Alten Testaments als das normale Los des Menschen. Sie steht jedoch wie dieses unter der grundlegenden Rahmenbedingung der nachparadiesischen Existenz. Seit dem Sündenfall ist mühselige Arbeit im Schweiße des Angesichts (1. Mos. 3,19) allgemeines menschliches Schicksal; Arbeit ist notwendig, um das Leben zu fristen. Diese Notwendigkeit wird nicht positiv oder wertfrei gesehen, denn auch das gelungene Leben wird nach der Klage des 90. Psalms nicht nur durch seine Kürze entwertet, sondern auch durch seine Qualifizierung, es sei bestenfalls Mühe und Arbeit (...). In der Benediktinerregel, die im starken Maße das abendländische Mönchtum geprägt hat, wird nicht nur der tägliche Gottesdienst, sondern auch die Arbeit für die Mönche verpflichtend gemacht („ora et labora“, zu deutsch: bete und arbeite).
Alle höhergestellten Geistlichen waren von der Arbeit befreit. „Die da unten“ waren da um zu beten und zu arbeiten, aber nicht um zu denken. Damit das so blieb, wurden strenge Gesetze eingeführt, die zum Gehorsam erzogen und zwangen.
Das deutsche Wort Arbeit hatte im Alt- und Mittelhochhdeutschen primär den Sinn von Lebensmühe, Not und Plage, die allen Menschen auferlegt sind (...).
Eine Wende im Verständnis der Arbeit brachte die Reformation. Für Martin Luther ist Arbeit Gottesdienst; die Magd, die den Besen schwingt, tut nichts anderes als das, was Bischöfe und Könige tun: ihre Arbeit, denn alle Arbeit gilt gleich und gleich viel. Arbeit ist Gottes Ordnung in dieser Welt, darin liegt ihre Bedeutung und ihre Würde. Jeder Mensch ist von Gott zur Arbeit berufen, und zwar in den Stand und an den sozialen Ort, an dem er sich vorfindet. Luther hat dem Wort Beruf damit seinen neuzeitlichen Sinn geben (...).
Luther, der als Gelehrter zur Elite gehörte, hat den Mut, gehabt alle Menschen auf die gleiche Stufe zu stellen. Und hat damit deutlich gemacht, dass jeder jeden braucht. Dass er und seine Sympathisanten sich mit dieser Sichtweise viele Feinde gemacht haben, die ihren Status auch mit Blutvergießen verteidigten, ist bekannt.
Für das 19. Jh. wurde Arbeit zu einem zentral Begriff. (…)