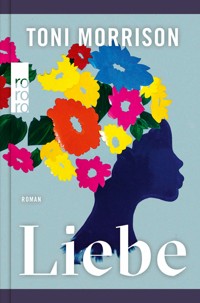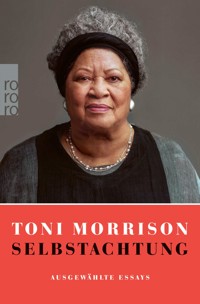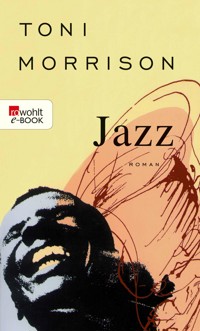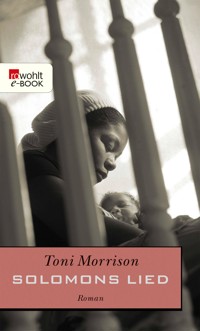18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Oklahoma, Mitte der Siebzigerjahre: In einem verlassenen Kloster suchen Frauen, Schwarze und weiße, Zuflucht. Sie sind Ausgestoßene aus der amerikanischen Gesellschaft, die sich im Umbruch befindet, voller Gegensätze wie Rassismus und Bürgerrechtsbewegung, Misogynie und Feminismus, Individualismus und der Sehnsucht nach Zugehörigkeit. Das friedliche Leben im Kloster findet bald ein brutales Ende: Die Einwohner der benachbarten Stadt Ruby, Nachfahren ehemals versklavter Menschen, selbstgerecht und zutiefst patriarchal organisiert, nehmen Anstoß an der Freiheit und vermeintlichen Freizügigkeit der Frauen. Nach Beloved und Jazz bildet Paradies den krönenden Abschluss von Toni Morrisons grandioser Trilogie über die Nachwirkungen der Versklavung in den USA. Ein so poetisches wie engagiertes literarisches Meisterwerk.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 642
Ähnliche
Toni Morrison
Paradies
Roman
Überarbeitet und sprachlich aktualisiert von Mirjam Nuenning
Über dieses Buch
«Paradies ist eine Erkundung der Konflikte zwischen den Geschlechtern, den Generationen, ein Kampf um die Geschichte selbst – wer sie erzählt und damit das Narrativ der Vergangenheit kontrolliert, wer die Zukunft formt. Es geht darum, was Männlichkeit und Weiblichkeit bedeuten und was es letztendlich heißt, Mensch zu sein.» Toni Morrison
Toni Morrisons großes Epos über Solidarität unter Frauen, Rassismus und die Folgen der Versklavung – ein so poetisches wie engagiertes literarisches Meisterwerk.
Oklahoma, Mitte der Siebzigerjahre: In einem verlassenen Kloster suchen Frauen, Schwarze und weiße, Zuflucht. Sie sind Ausgestoßene aus der Gesellschaft. Das friedliche Leben findet bald ein brutales Ende: Die Einwohner des Nachbardorfs, Nachfahren ehemals versklavter Menschen, nehmen Anstoß an der Freiheit und vermeintlichen Freizügigkeit der Frauen.
Mit einem bislang nie ins Deutsche übersetzten Vorwort der Autorin. Überarbeitet und sprachlich aktualisiert von Mirjam Nuenning.
Vita
Toni Morrison wurde 1931 in Lorain, Ohio, geboren. Sie ist eine der wichtigsten amerikanischen Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts. Zu ihren bedeutendsten Werken zählen Sehr blaue Augen, Solomons Lied und Beloved sowie ihr essayistisches Schaffen. Sie war Mitglied des National Council on the Arts und der American Academy of Arts and Letters. 1993 erhielt sie den Nobelpreis für Literatur. 2012 zeichnete Barack Obama sie mit der Presidential Medal of Freedom aus. Toni Morrison starb am 5. August 2019.
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1997 unter dem Titel «Paradise» bei Alfred A. Knopf, New York.
Der Verlag dankt Professor Dr. Anne V. Adams für ihren kenntnisreichen Rat und ihre engagierte Hilfe.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Januar 2025
Copyright © 1999 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Paradise» Copyright © 1997 by Toni Morrison
Übersetzung des Vorworts: Mirjam Nuenning
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Tracy Murrell
ISBN 978-3-644-02125-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Lois
Vielfältig und verführerisch sind die Gestalten
so vieler Sünden
und Ausschweifungen
und schändlicher Leidenschaften
und flüchtiger Vergnügungen,
denen die Menschen sich ergeben,
bis sie ernüchtert sind
und emporsteigen zu ihrem Ruheplatz.
Und dort werden sie mich finden,
und sie werden leben,
und der Tod hat keine Macht mehr über sie.
Vorwort
Es heißt, mein Großvater habe bloß einen einzigen Tag eine Schule besucht, nur um dem Lehrer zu sagen, dass er nicht wiederkommen würde, weil er arbeiten müsse. Seine ältere Schwester würde ihm das Lesen beibringen, sagte er. Diese Geschichte tauchte immer wieder in Familienerzählungen auf, doch irgendwann begann ich mich zu fragen, wo diese «Schule» gewesen sein mochte? Er wurde 1864 geboren – ein Jahr nach der Emanzipationsproklamation. Wo wäre Mitte des neunzehnten Jahrhunderts im ländlichen Alabama eine Schule gewesen? Im Keller einer Kirche? Draußen im Wald, unter Bäumen? Wer war dieser mutige, revolutionäre Lehrer gewesen? Der Ort hätte geheim sein müssen, da Schwarzen Menschen der Zugang zu Bildung, insbesondere das Lesenlernen, unter Einsatz von Gewalt verwehrt wurde und es in weiten Teilen der Südstaaten gesetzlich verboten war, Afroamerikaner*innen das Lesen beizubringen. Ein Gesetz aus Virginia aus dem Jahr 1831 ist aufschlussreich und repräsentativ: «Weiße Personen, die freie Negroes versammeln, um ihnen Lesen oder Schreiben beizubringen, müssen mit einer Geldstrafe von maximal 50 Dollar und einer Haftstrafe von maximal zwei Monaten rechnen.» «Des Weiteren werden weiße Personen, die gegen Bezahlung Sklaven versammeln, um ihnen Lesen oder Schreiben beizubringen, für jedes Vergehen mit einer Geldstrafe nach Ermessen des Richters belegt …» – zwischen zehn und hundert Dollar. Kurz gesagt, war es also nicht möglich, freie Negroes oder Sklav*innen zu unterrichten, weder bezahlt noch unbezahlt, ohne eine Strafe zu riskieren. Jede Lehrkraft musste sich des Risikos bewusst sein, das er oder sie einging.
Entgegen aller Widerstände war die Schwester meines Großvaters erfolgreich: Er erlernte das Lesen. Als Nächstes stellte sich für mich die Frage, wie er von dieser Fähigkeit Gebrauch machen konnte? Was bot sich ihm zum Lesen an? Hätte es auf dieser kleinen, armen Farm in Greenville, Alabama, Bücher gegeben? Unwahrscheinlich. Eine Bibliothek? Definitiv nicht. Doch ein Buch gab es, zu dem er Zugang hatte: die Bibel. Ich nehme an, dass dies der Grund dafür ist, dass ihm die legendäre Errungenschaft nachgesagt wird, die King-James-Bibel fünfmal von der ersten bis zur letzten Seite durchgelesen zu haben.
Lesen und das Verfassen von Texten wurden in meiner Familie hoch angesehen, nicht nur als Informationsquelle und aus Freude an der Sache, sondern auch als widerständiger politischer Akt, da so viel Mühe darauf verwendet wurde, uns vom Lernen abzuhalten. Meine Mutter schloss sich in den 1940er-Jahren dem Buchversandclub Literary Guild an. Wir abonnierten Zeitungen, die sich ausschließlich mit afroamerikanischen Nachrichten und Themen beschäftigten. Ausgaben des Pittsburgh Courier, des Cleveland Call und der Post waren völlig zerfleddert, nachdem sie durch die Hände so vieler Leser*innen gereicht wurden. Wie andere Zeitungen ethnischer Minderheiten entfachten auch unsere leidenschaftliche Bemerkungen, Fragen und Diskussionen. Wir verschlangen das Werk von J.A. Rogers, Die Seele der Schwarzen von Du Bois und alles, was wir sonst noch finden konnten, was uns über das Schwarzsein in Amerika informierte und uns darin bestärkte.
Als ich an The Black Book arbeitete, einem komplexen Zeitzeugnis afroamerikanischen Lebens auf der Grundlage von Material, das ich von Sammler*innen bekam, faszinierten mich gerade die ältesten Zeitungen, insbesondere die «colored» Zeitungen. So viel von der afroamerikanischen Geschichte – ob traurig, ironisch, widerständig, tragisch, stolz oder triumphal – wurde darin in Wort und Bild präsentiert. Besonders interessant waren die Zeitungen aus dem neunzehnten Jahrhundert, zu der Zeit, als mein Großvater jene wenige Minuten in der Schule verbracht hatte. Ich fand heraus, dass nach der Emanzipation und der gewaltvollen Vertreibung von Native Americans aus dem Oklahoma-Territorium etwa fünfzig Schwarze Zeitungen im Südwesten der USA verlegt wurden. Die Gründung Schwarzer Städte wurde ebenso fieberhaft mitverfolgt wie die rapide Besetzung der Gebiete durch Weiße. Schwarze Zeitungen spornten die Menschen an und versprachen Neuankömmlingen eine Art Paradies: Land, Selbstverwaltung und Sicherheit – es gab sogar kontinuierliche Bestrebungen, einen eigenen Bundesstaat zu gründen.
Ein Leitgedanke faszinierte mich in diesen Zeitungen ganz besonders. Es gab eine klare Warnung, die in allen Schlagzeilen und Artikeln auftauchte: Kommt gewappnet oder gar nicht.
Diese Warnungen enthielten zwei Anweisungen: 1) Wenn du nichts hast, halte dich fern. 2) Die neuen Gebiete sind das Traumland für einige wenige. Übersetzung: Arme ehemalige Sklav*innen sind in dem Paradies, das hier erbaut wird, nicht erwünscht. Was bedeutete das für ehemalige Sklav*innen, die verfolgt, erschöpft, mittellos und auf der Flucht waren? Wie fühlten sie sich, nachdem sie all diese Kilometer zurückgelegt hatten, von einem Leben in Ketten in die Freiheit, nur um gesagt zu bekommen: «Dies ist zwar das Paradies, aber ihr dürft hier nicht rein.» Mir fiel auch auf, dass die Verantwortungsträger der Gemeinden auf den Bildern ausschließlich hellhäutige Schwarze Männer waren. Waren Hautfarbenprivilegien ebenfalls Spaltungsaspekte? Replizierten sie den weißen Rassismus, den sie verabscheuten?
Ich wollte diesen Fragen auf den Grund gehen, indem ich das umgekehrte Phänomen erforschte; eine Exklusivität, die von sehr dunkelhäutigen Schwarzen Menschen praktiziert wird; die Schaffung ihrer eigenen «Gated Community», die Menschen mit gemischter ethnischer Herkunft den Zutritt verwehrt. Bedenken wir die Notwendigkeit von Nachkommen zur Gewährleistung des Fortbestands, stellt sich die Frage, inwiefern das Patriarchat dem Projekt in die Hände spielte und inwiefern das Matriarchat eine Bedrohung darstellte. Um diese Fragen zu erforschen und zu beschreiben, musste ich 1. die Definition von ‹Paradies› beleuchten, 2. mich eingehend mit der Wirkungskraft von Colorism befassen, 3. den Konflikt zwischen dem Patriarchat und dem Matriarchat dramatisieren und 4. den Diskurs rund um das Thema Race aufbrechen, indem ich ihn zuerst hervorhob, um ihn dann verschwinden zu lassen.
Die Idee eines Paradieses erscheint heutzutage kaum vorstellbar, oder besser gesagt, sie wurde bis zur Unerträglichkeit ausgereizt, was auf dasselbe hinausläuft – und ist somit alltäglich, kommerzialisiert, ja sogar banal geworden. Traditionell waren die Bilder des Paradieses in Poesie und Prosa grandios und dennoch zugänglich, jenseits der Routine und dennoch fantasievoll greifbar, verführerisch wie eine Erinnerung. Milton spricht von «den besten Bäumen, reich an schönen Früchten, goldfarbig glänzte Blüthe d’ran wie Frucht … im bunten Farbenschmelz …; (vom) heimischen Balsamduft.» Vom «Saphirquell die Bäche kräuselnd auf Goldsand und auf Perlen weiter rollend …», von «Nektar die Pflanzen tränkt und Blumen, würdig Edens … mit mannigfacher Aussicht voller Wälder, aus deren Bäumen duft’ge Harze troffen, wo Früchte glänzten mit der goldnen Schaale, so lieblich … köstlich an Geschmack. Dazwischen lagen Au’n und holde Matten, die für Herden zarte Kräuter boten.» «Und Blüthen jeder Farbe sich erwiesen und ohne Dorn die Rose selbst erblüht.» «Grotten, deren Schatten die kühlsten Sitze hegte, drüberhin der Weinstock seine Purpurtrauben rankt, und üppig wachsend, sanft empor sich schlingt …»
Diese üppige, glückselige Weite finden wir im zwanzigsten Jahrhundert in den umzäunten Grundstücken der Reichen, um die sie die Besitzlosen beneiden, oder in den prächtigen Parkanlagen, die von Touristinnen und Touristen besucht werden. Miltons Paradies ist heutzutage sehr wohl zu haben, wenn nicht in der Realität, dann zumindest als eine ganz gewöhnliche, durchschnittliche Sehnsucht. Das moderne Paradies besitzt vier von Miltons Merkmalen: Schönheit, Fülle, Ruhe und Exklusivität. Der Aspekt der Unendlichkeit scheint aufgegeben worden zu sein.
Schönheit ist eine gnädig gestimmte, kontrollierbare Natur kombiniert mit Edelmetall, Villen, feinen Dingen und Schmuck.
Fülle ist ein fast schon obszönes Merkmal des modernen Paradieses, in einer Welt des Überflusses und der Gier, die den Reichen Ressourcen zuspielt, während andere zum Neid gezwungen werden. In einer Welt, in der Reichtum auf die schamloseste Weise beschlagnahmt, angehäuft und vor den Enteigneten zur Schau gestellt wird, sollte diese Vorstellung von ‹Fülle› als Utopie uns erschaudern lassen. Fülle sollte nicht als paradiesischer Zustand, sondern als gewöhnliches, alltägliches, menschenwürdiges Leben verstanden werden.
Ruhe als kurze Pause von der Arbeit oder vom Kampf um Belohnungen und Luxus steht heutzutage nicht mehr hoch im Kurs. Sie kommt einer Wunsch-los-igkeit gleich, einem Tod ohne das Sterben. Ruhe kann Isolation bedeuten, ein Urlaub ohne wohltuende oder erholsame Aktivitäten. Mit anderen Worten: Bestrafung und/oder intendierte Faulheit.
Exklusivität hingegen ist weiterhin ein attraktives und unwiderstehliches Merkmal des Paradieses, da so viele Menschen – die Unwürdigen – sich nicht dort befinden. Die Grenzen zur Außenwelt sind gesichert, Wachhunde, Sicherheitsanlagen und Tore dienen der Legitimation der Bewohner*innen. Derartige, von dicht besiedelten innerstädtischen Gebieten abgetrennte Enklaven breiten sich immer weiter aus. Sich eine Stadt vorzustellen – geschweige denn sie zu bauen –, in der arme Menschen einen Platz haben, scheint weder möglich noch wünschenswert zu sein. Exklusivität ist nicht nur ein Traum, den sich die Reichen erfüllt haben; Exklusivität ist eine weitverbreitete Sehnsucht der Mittelschicht. Auf den «Straßen» leben die Unwürdigen, die Gefährlichen. Flanierenden jungen Menschen wird unterstellt, sich herumzutreiben und nichts Gutes im Schilde zu führen. Öffentliche Räume werden umkämpft, als seien sie Privatbesitz. Wem steht es zu, sich im Park zu vergnügen, oder am Strand, oder an einer Straßenecke? Allein schon das Wort ‹öffentlich› ist ein Streitthema.
Unendlichkeit erspart uns den Schmerz eines erneuten Todes, wird jedoch in säkularen, wissenschaftlichen Diskursen für nichtig erklärt. Dennoch hat sie die größte Anziehungskraft. Medizin und Wissenschaft fokussieren sich darauf, Menschen ein längeres und gesünderes Leben zu ermöglichen, und zeigen uns, dass wir uns nach irdischer Unendlichkeit sehnen, nicht nach dem ewigen Leben nach dem Tod. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass es nur das irdische Leben gibt.
Das Paradies als irdisches Projekt im Gegensatz zu einem himmlischen hat ernsthafte intellektuelle und visuelle Grenzen. Abgesehen von «Nur ich oder wir für immer» findet das himmlische Paradies kaum Erwähnung.
Doch vielleicht ist das nicht fair. Es ist kaum zu übersehen, wie viel mehr Aufmerksamkeit der Hölle gewidmet wird als dem Himmel. Dantes Inferno wird Paradiso immer in den Schatten stellen. Miltons brillant dargestellte und als Chaos bekannte vor-paradiesische Welt ist weitaus ausgefeilter als sein Paradies. Die visionäre Sprache der Verdammten erreicht Höhepunkte linguistischer Inbrunst, denen die Sprache der Gesegneten und Geretteten nicht das Wasser reichen kann. Es gab gute Gründe dafür, dass die Grauen der Hölle im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert in so entsetzlich abstoßenden Bildern inszeniert wurden. Dass es die Hölle um jeden Preis zu meiden galt, musste den Menschen in Mark und Bein übergehen. Es musste deutlich werden, wie viel schlimmer diese Art der Unendlichkeit war, im Vergleich zur Hölle des täglichen Lebens. Damals war das Paradies einfach die Abwesenheit des Bösen – eine unbegrenzte, bereits erkennbare Landschaft: große Bäume, die Schatten spenden und Früchte tragen, Grünflächen, Paläste, Edelmetalle, Nutztierhaltung und Schmuck. Bis auf die Überlistung des Bösen und den Kampf gegen die Unwürdigen scheint es für die Bewohnerinnen und Bewohner des Paradieses nichts zu tun zu geben. Ein offenes, grenzenloses Paradies, in dem alle willkommen sind und in dem es weder Angst noch Widersacher gibt, ist gar kein Paradies.
Auffällig an Miltons Paradies ist die Abwesenheit von Frauen. Nur Eva wird eine bedeutende Rolle zugeschrieben. Nachkommen sind scheinbar nicht notwendig, da es immer wieder neue Gesegnete gibt, die ins Paradies eintreten. Und was können Frauen abgesehen von Sorgearbeit schon tun?
Da das Paradies, das in den Schwarzen Zeitungen imaginiert wurde, auf eine nicht gerade subtile Weise hellhäutigere Schwarze Bewerber*innen ansprach, reizte es mich beim Schreiben von Paradies ganz besonders, unseren Annahmen bezüglich Race etwas entgegenzusetzen. Ich wollte eine bildreiche, metaphorische Sprache manipulieren, verwandeln und kontrollieren, um etwas zu kreieren, was sich als race-spezifische/race-freie Prosa bezeichnen lässt. Eine Sprache, welche die Macht rassifizierender Strategien ausschaltet – sie transformiert und aus der Zwangsjacke befreit, in die eine rassifizierende Gesellschaft uns sperren kann und dies auch tut – eine Weigerung, die Figuren aufgrund ihrer Hautfarbe zu ‹kennen›. Eins der übelsten Merkmale rassistischen Denkens ist die Tatsache, dass es kein neues Wissen produziert. Stattdessen scheint es die Fähigkeit zu besitzen, sich in mannigfaltigen, statischen Behauptungen immer wieder neu zu formulieren und zu konfigurieren. Es gibt keinen Bezugspunkt für rassistisches Denken in der materiellen Welt, und ebenso wie die Idee von Schwarzem, weißem und blauem Blut kreiert es künstliche Grenzen, die es entgegen jeglicher Vernunft und gegenteiliger Beweise aufrechterhält. Und während rassistisches Denken und rassistische Sprache eine fast ungebrochene Macht im politischen und sozialen Leben haben, ist das intellektuelle Gewicht, das race-basierten Unterschieden beigemessen wird, alles andere als gerechtfertigt. Sie sind ein Wissenschaftsfeld, das in Wahrheit gar kein Feld ist, sondern eine alles verzehrende Leere, die gewohnt und fremd zugleich ist.
Historische Dokumente zu den im neunzehnten Jahrhundert von Afroamerikaner*innen gegründeten Schwarzen Siedlungen lieferten eine umfassende Forschungsgrundlage für die Betrachtung race-spezifischer/race-freier Sprache. Ich bin mir bewusst, wie das Weißsein reift und den Thron der Allgemeingültigkeit besteigt, indem es sich die Macht erhält, die Welt zu beschreiben und diese Beschreibungen durchzusetzen. Diesen Anspruch auf Allgemeingültigkeit infrage zu stellen, den Schwarz-weiß-Konflikt zu exorzieren, zu verändern und ihm den Zahn zu ziehen, um mich stattdessen auf die Relikte dieser Feindschaft zu konzentrieren, erschien mir als ein Projekt, das zugleich einschüchternd und künstlerisch befreiend war.
«Das weiße Mädchen erschießen sie zuerst. Mit den anderen können sie sich Zeit lassen.»
Mit diesen einführenden Sätzen wollte ich 1. auf die Existenz von Race als hierarchisches System hinweisen und 2. auf dessen Zusammenbruch als verlässliche Information. In dem Roman wird eine rein Schwarze, von ihren Einwohner*innen selbst gewählte Gemeinde einer ebenfalls von ihren Bewohnerinnen gewählten race-losen Gemeinschaft gegenübergestellt. Anstatt den Fokus auf die Gründe für die uralten Feindseligkeiten zwischen Schwarzen und weißen Menschen zu legen, werden die Natur von Ausgrenzung, die Ursprünge des Chauvinismus und die Quellen von Unterdrückung, Übergriffen und Massakern beleuchtet. In der Schwarzen Gemeinde Ruby dreht sich alles um die eigene Race – ihre Bewahrung, die Entwicklung von Herkunftsmythen und die Erhaltung ihrer Reinheit. Im Kloster ist Race unbestimmt – alle rassifizierende Codes werden entfernt und absichtlich zurückgehalten. Bei einigen Leser*innen sorgte das für Aufruhr, und einige gaben zu, dass sie die Frage, welche der Figuren das «weiße Mädchen» war, nicht losließ; andere stellten sich zwar eingangs dieselbe Frage, verwarfen sie jedoch später wieder; und wiederum andere ignorierten die Verwirrung einfach, indem sie alle Figuren als Schwarz lasen. Die Feinsinnigen lasen sie als vollständig verwirklichte Individuen – unabhängig von ihrer Race. Ohne das ermüdende Vokabular der rassistischen Vorherrschaft versucht die Erzählung, sich frei zu machen von den Begrenzungen, die eine rassifizierende Sprache der Fantasie auferlegt. Sie ist eine Erkundung der Konflikte zwischen den Geschlechtern, den Generationen, ein Kampf um die Geschichte selbst – wer sie erzählt und damit das Narrativ der Vergangenheit kontrolliert, wer die Zukunft formt. Es geht darum, was Männlichkeit und Weiblichkeit bedeuten und was es letztendlich heißt, Mensch zu sein.
Diese Fragen schienen am eindringlichsten zu sein, wenn sie durch die Sehnsucht nach Freiheit und Sicherheit, nach Fülle, Ruhe und Schönheit, durch die Suche nach einem eigenen Ort, nach Respekt, Liebe und Glückseligkeit ergänzt wurden – kurz gesagt, eine neu gegriffene Vorstellung vom Paradies. Nicht die Aufforderung «Komm vorbereitet oder gar nicht», die dich veranlasst, eine Eintrittskarte zu kaufen, bevor du einen Vergnügungspark betrittst; sondern eine Befragung der eingeschränkten Vorstellungskraft, die das Paradies erdacht und verraten hat.
Wir nannten ihn Big Papa. Er stand im Gemüsegarten und schälte eine Süßkartoffel mit seinem Taschenmesser. Dann aß er langsam und bedächtig die rohen Scheiben. Wenn er deinen Stuhl haben wollte, stellte er sich still daneben und schaute dich an, bis du begriffst und aufstandst. Er war zu religiös für die Kirche. Er malte Bilder von meiner Schwester und mir und schenkte uns Kaugummis. Wo immer er sich aufhielt – auf der Veranda, am Küchentisch, im Garten oder im Wohnzimmer beim Lesen –, dort waren Macht und Respekt. Er übte keine Macht aus; er nahm sie an. Und weil ich ihn kannte, hatte ich das Gefühl, die Männer in Ruby verstehen und erschaffen zu können – und die Leichtigkeit, mit der sie ihre unangefochtene Autorität annahmen.
Big Papa. Ein Überlebenskünstler. Exzentrisch, Respekt einflößend, verspielt, stur, gebildet.
Er hat mir seine Violine hinterlassen.
Toni Morrison
Aus dem Englischen von Mirjam Nuenning
Ruby
Das weiße Mädchen erschießen sie zuerst. Mit den anderen können sie sich Zeit lassen. Kein Grund zur Eile hier draußen. Siebzehn Meilen sind es bis zu einem Ort, den neunzig Meilen vom nächsten trennen. Die Verstecke sind zahllos in diesem Klosterbau, aber sie haben Zeit; der Tag hat gerade erst begonnen.
Sie sind zu neunt, mehr als das Doppelte an Zahl wie die Frauen, die sie vertreiben oder töten sollen, und für beides sind sie bestens ausgerüstet: mit Stricken und einem Kreuz aus Palmwedeln, mit Handschellen, mit Reizgas samt schützenden Sonnenbrillen und mit blitzenden, eleganten Schusswaffen.
Sie sind noch nie so weit ins Kloster vorgedrungen. Einige von ihnen haben ihre Chevrolets vor der Veranda geparkt, um sich einen Bund Pfefferschoten zu holen, oder sie waren in die Küche gegangen, wo sie eine Gallone Barbequesoße erhielten. Aber nur wenige haben die Korridore, die Kapelle, den Lehrsaal, die Schlafräume zu Gesicht bekommen. Jetzt werden alle alles sehen. Und zum Schluss auch den Keller, dessen Schmutz sie an das Licht bringen werden, das bald den Himmel über Oklahoma blank putzen wird. Vorerst aber sind sie verwirrt von ihren eigenen Kleidern – haben plötzlich das Gefühl, falsch angezogen zu sein. Doch wie hätten sie in der Morgendämmerung eines Julitages ahnen können, dass es hier im Inneren dieses Baus so kalt sein würde? Ihre T-Shirts, ihre Arbeitshemden, ihre Dashikis ziehen Kälte an wie Fieber. Diejenigen, die in ihren Arbeitsschuhen gekommen sind, sind vom Donner ihrer Schritte auf den Marmorböden genervt, die Turnschuhträger von der Stille. Und dann ist da die Pracht von allem. Nur die beiden, die Krawatten angelegt haben, scheinen hierher zu passen, und einem nach dem anderen wird bewusst, dass dieses Haus, ehe es zum Frauenkloster wurde, das Fantasieschloss eines Betrügers war: ein Herrenhaus, in dem rosige und cremefarbene Marmorböden übergehen in Teak; in dem Marienglas das Licht vergangener Tage sammelt und Muster auf Wände wirft, die vor fünfzig Jahren abgewaschen und gekalkt wurden. Die reich verzierten Armaturen in den Badezimmern, die den Nonnen ein Gräuel waren, sind durch bewährte, schlichte Wasserhähne ersetzt worden, aber die pompösen Wannen und Waschbecken, die auszubauen zu teuer gekommen wäre, verharren in kaltem Protz. Alles, was dem Betrüger lieb und teuer gewesen war und entfernt werden konnte, ist entfernt worden, vor allem im Speisesaal, der von den Nonnen in ein Schulzimmer verwandelt wurde, in dem einst verstummte Arapahomädchen saßen und sich im Vergessen übten.
Jetzt durchsuchen bewaffnete Männer die Räume, in denen Makrameekörbe neben flämischen Kandelabern schweben; in denen Christus und seine Mutter, von Weinstöcken umrankt, aus Nischen hervorleuchten. Die Schwestern vom Heiligen Kreuz haben all die Nymphen herausgebrochen, aber noch immer schlingen sich Marmorlocken aus Nymphenhaar um die Weinblätter und kitzeln die Reben. Die Kälte wird spürbarer, je tiefer die Männer in das Gebäude eindringen. Sie nehmen sich Zeit, sie spähen und lauschen, sie sind auf der Hut vor der weiblichen Tücke, die sich hier verbirgt, und sie registrieren den Hefe-und-Butter-Geruch quellenden Teigs.
Einer von ihnen, der Jüngste, dreht sich um und zwingt sich, in die Zukunft des Traums zu schauen, in dem er sich befindet. Die erschossene Frau, ausgestreckt auf hartem Marmor, winkt ihm mit den Fingern zu – so sieht es jedenfalls aus. Also ist alles in Ordnung mit seinem Traum, abgesehen von der Farbe. Niemals zuvor hat er in solchen Farben geträumt: prunkendes Schwarz, aus dem ein wilder Spritzer Rot hervorbricht, daneben fiebriges, fettes Gelb. Wie die Kleider einer Frau, die leicht zu haben ist. Der Mann an der Spitze hält inne, hebt seine linke Hand, um die Schatten, die ihm folgen, zum Stehen zu bringen. Sie stocken, zügeln ihren Atem, packen brav ihre Gewehre und Pistolen fester. Der Mann an der Spitze wendet sich nach ihnen um und teilt sie mit Handzeichen ein: ihr beide dort hinüber in die Küche; zwei andere nach oben; zwei weitere in die Kapelle. Für sich selbst, seinen Bruder und den, der zu träumen glaubt, hat er den Keller reserviert.
Gewandt und gelassen, ohne ein Wort zu verlieren, trennen sich die Gruppen. Vorhin, als sie das Tor des Klosters aufschossen, waren sie ganz aufgekratzt gewesen angesichts ihres Auftrags. Doch ihre Opfer sind nichts anderes als Trümmerschutt: Menschenabfall, der manchmal in den Raum zurückdrängt, nachdem er zur Tür hinausgefegt wurde. Und deshalb ist das Gift jetzt kontrollierbar. Das Erschießen der ersten Frau, der weißen, hat es geklärt wie Butter: oben das reine Öl des Hasses, das unten in seiner ganzen Härte stockt.
Draußen steht der Nebel hüfthoch. Bald wird er silbrig werden und Regenbogen im Gras bilden, niedrig genug für spielende Kinder, und dann wird ihn die Sonne wegbrennen und Weiten voller Bartgräser enthüllen und vielleicht die Spuren von Hexen.
Die Küche allein ist größer als das Geburtshaus eines jeden dieser Männer: die Decke hoch wie ein Scheunendach, an der Wand mehr Regale als in Ace’ Lebensmittelladen. Der Tisch ist mindestens vierzehn Fuß lang, und es ist leicht erkennbar, dass die Frauen, hinter denen sie her sind, überrascht wurden. An einem Ende stehen ein Milchkrug und vier Schüsseln mit Frühstücksflocken. Am anderen Ende ist jemand beim Gemüseschneiden unterbrochen worden: Schalotten, aufgehäuft wie eine Handvoll grüner Konfetti, liegen neben leuchtenden Karottenscheiben, und die Kartoffeln, geschält und unzerteilt, sind weiß wie Knochen, feucht und frisch. Fleischbrühe siedet auf einem Herd, der mit seinen acht Kochstellen groß genug wäre für ein Restaurant. Auf einem Bord unter der großen stählernen Abzugshaube schwellen ein Dutzend Brotlaibe. Ein Stuhl ist umgestürzt. Es gibt keine Fenster.
Der eine Mann bedeutet dem anderen, die Speisekammer zu öffnen, während er selbst zur Hintertür geht. Sie ist geschlossen, aber nicht abgesperrt. Als er hinausblickt, sieht er eine alte Henne und stellt sich vor, wie ihr geschwollenes, blutiges Hinterteil geschätzt worden ist für die monströsen Eier, die es ausstieß – unförmige, missgestaltete Schalen mit zwei oder drei Dottern darin. Aus dem Hühnerstall weiter hinten dringt leises Gestammel; junge Hähne, die sich tapfer in die Nebel des Hinterhofs hinauswagen, werden verschluckt und tauchen wieder auf und verschwinden wieder und spähen mit ihren Scheibenaugen nach nichts anderem als einem Frühstück. Keinerlei Fußabdrücke zeichnen den Schlamm zwischen den Steinstufen. Der Mann schließt die Hintertür wieder und gesellt sich zu seinem Partner in der Speisekammer. Gemeinsam mustern sie staubige Einweckgläser und die Reste dessen, was im vorigen Jahr eingemacht worden ist: Tomaten, grüne Bohnen, Pfirsiche. Schlapp, denken die Männer. Der August steht vor der Tür, und diese Frauen hier haben ihre Gläser noch nicht einmal sortiert, geschweige denn ausgewaschen.
Er zieht den Suppentopf vom Feuer. Seine Mutter hat ihn in einem Topf gebadet, der nicht größer war als dieser hier. Ein Luxus in der Grashütte, in der sie geboren wurde. Das Haus, in dem er jetzt lebt, ist groß und bequem, und das Dorf hat allen Glanz der Welt, verglichen mit seinem Geburtsort, der in fünfzig Jahren von den Füßen auf den Bauch heruntergekommen war. Von Haven, einer Traumstadt im Territorium Oklahoma, zur Geisterstadt Haven im Bundesstaat Oklahoma. Befreite Sklaven, die 1889 aufrechten Hauptes gingen, lagen 1934 auf den Knien, und 1948 krochen sie auf dem Bauch durch den Dreck. Und deshalb sind sie jetzt hier in diesem Kloster. Um sicherzustellen, dass sich so etwas niemals wiederholt. Dass nichts, sei es von innen oder außen, diesen einzigen ausschließlich Schwarzen Ort zersetzt, der all die Mühe wert ist. Alle anderen, die er kennt oder von denen er gehört hat, haben sich weißen Siedlungen unterworfen oder sind geschluckt worden – oder sie sind, wie Haven, geschrumpft zu Spuren: zu Grundrissen, erahnbar noch in verändertem Graswuchs; ins Negativ gebleichten Tapeten hinter glaslosen Fenstern; aufgestemmten Schulzimmerböden, durch die sich schon stattliche Bäume zum Glockentürmchen hocharbeiten. Aus den tausend Einwohnern von 1905 waren 1934 fünfhundert geworden. Dann zweihundert und schließlich achtzig, als der Baumwollanbau zusammenbrach oder die Eisenbahngesellschaften ihre Schienen anderswo verlegten. Aus der Selbstversorgung durch die eigene Landwirtschaft, die einst auch für große Familien ausgereicht hatte, wurde ein Zubrot, das immer kleineren Parzellen abgewonnen werden musste, geteilt bei jeder Hochzeit eines Sohnes und dann wiederum für dessen Kinder, bis die Eigentümer der verbleibenden Bruchstücke, soweit sie nicht längst das Weite gesucht hatten, jedes Angebot eines weißen Spekulanten akzeptierten – so begierig waren sie darauf, wegzukommen und anderswo neu anzufangen. In einer großen Stadt vielleicht oder auch in einer kleineren, wie es schon genügend gab.
Doch er und die anderen, Kriegsveteranen sie alle, hatten eine andere Vision. Sie liebten Haven, wie es gewesen war, liebten die Idee dahinter und ihre Ausstrahlung, und sie nahmen dieses Gefühl mit sich, hegten und hätschelten es zwischen Bataan und Guam, zwischen Iwo Jima und Stuttgart und fassten endlich den Entschluss, es noch einmal zu versuchen. Er streicht über die Abzugshaube, bewundert ihre Konstruktion und Mächtigkeit. Sie ist genauso lang wie der gemauerte Ofen, der einst in der Mitte seines Heimatstädtchens stand. Als sie aus dem Krieg heimgekehrt waren, zerlegten sie ihn und schleppten die Ziegel, die Schamottsteine und die Eisenplatte zweihundertvierzig Meilen weit nach Westen – weit weg vom Land der Creek, das eine mit allen Wassern gewaschene Regierung einst als «herrenloses Land» bezeichnet hatte. Er erinnert sich an die Feier, die sie abgehalten hatten, als das eiserne Maul des Ofens wieder einzementiert wurde und die abgewetzten Buchstaben darunter wieder blank poliert zu lesen waren. Er selbst hatte mitgeholfen, zweiundsechzig Jahre Kohlenstaub und Tierfett abzubürsten, bis die Worte so hell leuchteten wie 1890, als sie neu waren. Und wenn es auch wehgetan hatte, niederzureißen, was ihre Großväter aufgebaut hatten, so war das gar nichts im Vergleich dazu, was sie selbst durchgemacht hatten und was ihnen noch bevorstehen mochte, wenn sie nicht den Neubeginn wagten. Als neue Gründerväter, die gegen eine ganze Welt gekämpft hatten, konnten und wollten sie nicht ärmlicher dastehen als die Alten Väter, die eine ganze Welt überlistet hatten. Die sich nicht von Gefahren und nicht von der Ungunst der Natur davon hatten abhalten lassen, Haven aus dem Boden zu stampfen, und die genau wussten, womit sie ihren Triumph krönen sollten: einem Ofen. Rund wie ein Schädel und unergründlich wie die Sehnsucht. Sie lebten in oder neben ihren Planwagen, sie kochten Schrot am offenen Feuer, sie schnitten Stroh und Büffelgras, um sich warm zu halten, aber das war es, was die Alten Väter als Erstes taten: Sie opferten den Großteil ihrer Kraft, um den mächtigen, makellos konstruierten Ofen zu errichten, der ihnen Nahrung gab und zugleich ein Denkmal war für das, was sie getan hatten. Als er vollendet war – jeder bleiche Ziegel perfekt ausgerichtet, der Rauchfang breit und ragend, Rost und Haken sauber eingefügt, der Luftzug mit der Klappe gut geregelt, die Feuertür dicht –, da trat der Eisenhändler in Aktion. Aus Fassreifen und stumpfen Äxten, aus Wasserkesseln und verbogenen Nägeln schmiedete er eine Tafel, fünf auf zwei Fuß groß, und mauerte sie direkt unterhalb des großen Ofenmauls ein. Bis heute ist nicht klar, woher er die Worte auf der Tafel hatte. Irgendwo aufgeschnappt vielleicht, oder auch erfunden, oder sie waren ihm eingeflüstert worden, während er, zusammengerollt über seinen Werkzeugen, in einem der Planwagen schlief. Er hieß Morgan, und keiner konnte wissen, ob er sich die Wörter, die er in das Eisen trieb, ein halbes Dutzend waren es vielleicht, selbst ausgedacht oder ob er sie geklaut hatte: Worte, die ihnen zuerst wie ein Segen erschienen; dann wie ein Fluch; und endlich wie die Verkündigung, dass sie verloren hatten.
Der Mann starrt auf das Spülbecken in der Küche. Er geht zu dem langen Tisch und greift nach dem Milchkrug. Erst schnuppert er daran, dann führt er ihn mit seiner Linken, denn in der rechten Hand hält er die Pistole, an die Lippen und trinkt mit so langen, abgemessenen Zügen, dass der Krug zur Hälfte geleert ist, ehe er den Geruch des Wintergrünöls bemerkt.
Ein Stockwerk höher gehen zwei Männer den Flur hinunter und inspizieren die vier Schlafräume, an deren Türen Namensschilder mit Klebstreifen befestigt sind. Der erste Name, mit Lippenstift gemalt, heißt Seneca. Der nächste, Divine, ist mit Tinte in Großbuchstaben geschrieben. Sie wechseln wissende Blicke, als sie feststellen, dass beide Frauen nicht, wie normale Leute, in einem Bett, sondern in Hängematten geschlafen haben. Außer diesen und einem schmalen Schreibtisch oder einem Beistelltischchen gibt es keine weitere Möblierung. Auch keine Schränke mit Sachen zum Anziehen, denn schließlich trugen die Frauen immer nur schmuddelige Sackkleider und dazu nichts, was man guten Gewissens als Schuhe hätte bezeichnen können. Aber andere seltsame Dinge sind mit Klebstreifen und Nägeln an die Wand gepinnt oder lehnen in der Zimmerecke: ein Kalender von 1968, auf dem verschiedene Daten (4. April, 19. Juli) mit einem großen X markiert sind; ein Brief, mit Blut geschrieben, aber so verschmiert, dass man seine satanische Botschaft nicht entziffern kann; ein astrologisches Diagramm; ein Filzhut, der schräg auf dem Plastikhals eines weiblichen Torsos sitzt; und nirgends in all diesen Räumen, die einst Christinnen – na ja: zumindest Katholikinnen – beherbergten, auch nur die Spur von einem Kruzifix. Was die beiden Männer jedoch am meisten beunruhigt, ist das Bündel von Babyschuhen, das, von einer Schnur zusammengehalten, an einem Kinderbett im letzten Schlafraum hängt, den sie betreten. Ein Beißring, rissig und verhärtet, baumelt zwischen den winzigen Schuhen. Mit einem Blick bedeutet der eine Mann seinem Partner, sich die vier weiteren Schlafräume auf der anderen Seite des Flurs vorzunehmen. Er selbst nähert sich dem Bouquet aus Babyschuhen. Was hofft er zu finden? Weitere Beweise? Er weiß es selbst nicht. Blut? Eine winzige Zehe vielleicht, die in einem weißen Kalbslederschühchen hängen geblieben ist? Er entsichert seine Waffe, dann schließt er sich der Durchsuchung auf der anderen Seite des Flurs an.
Hier sehen die Zimmer normal aus. Verwahrlost zwar – in dem einen ist der Boden mit verkrusteten Tellern, schmutzigen Tassen bedeckt und das Bett unter einem Berg von Kleidungsstücken begraben, ein anderes verblüfft mit zwei Schaukelstühlen voller Puppen und ein drittes mit einem Verhau und einem Geruch, wie ihn nur eine starke Trinkerin hinterlassen haben kann –, aber wenigstens normal.
Er hat einen bitteren Geschmack im Mund, und obwohl er weiß, dass dieser Ort verseucht ist, spürt er in seiner Brust einen überraschenden Peitschenhieb von Mitleid. Was, so fragt er sich, muss in diese Frauen gefahren sein? Wie konnten ihre schlichten Gemüter solche Dinge aushecken: abartigen Sex, Gaunereien und die heimliche Folter von Kindern? Hier draußen in der grenzenlosen Weite, versteckt in einem alten Herrenhaus, wo niemand sie behelligen, niemand ihnen zu nahe kommen konnte, brachten sie es fertig, die Werte so gut wie jeder Frau infrage zu stellen, die er kannte. Das Geld für den Wintermantel, das sein Vater über zwei Ernten hinweg heimlich angespart hatte. Das Leuchten in den Augen seiner Mutter, als sie über den Seehundkragen des Mantels strich. Die Überraschungsparty, die er und seine Brüder zum sechzehnten Geburtstag einer ihrer Schwestern schmissen. Hier aber, keine zwanzig Meilen entfernt von einer friedliebenden, geordneten Gemeinde, gab es Frauen, die anders waren als alle Frauen, die er gekannt oder von denen er gehört hatte. Hier, ausgerechnet hier. Isoliert und einzigartig, konnte das Dorf, in dem er lebte, zu Recht stolz auf sich sein. Es hatte kein Gefängnis, und es brauchte auch keins. Kein Verbrecher war jemals aus ihm hervorgegangen. Mit den ein oder zwei Leuten, die sich danebenbenommen, ihren Familien Schande gemacht oder das Bild der Bewohnerinnen und Bewohner von ihrem Ort gefährdet hatten, war man schon klargekommen. Ganz gewiss gab es keine Schlampe, kein leichtlebiges Mädchen hier, und er wusste auch genau, warum. Von Anfang an hatten sich die Menschen in seinem Dorf frei und beschützt gefühlt. Eine Frau, die keinen Schlaf fand, konnte jederzeit aufstehen, sich einen Schal um die Schultern legen und sich im Mondschein auf die Stufen vor der Haustür setzen. Und wenn ihr danach war, konnte sie auch in den Garten oder auf die Straße hinausgehen. Ohne Lampe und ohne Angst. Ein Zischen oder Rascheln am Straßenrand ließ ihr Herz nicht schneller schlagen, denn was immer es auch sein mochte, das dieses Geräusch verursachte, es war nicht hinter ihr her. Nichts im Umkreis von neunzig Meilen sah in ihr ein mögliches Opfer. Sie konnte so langsam dahinschlendern, wie sie wollte, und dabei an Kochrezepte denken oder an den Krieg oder an Familiendinge, oder sie wandte den Blick zu den Sternen und dachte an gar nichts. Ohne Lampe und ohne Angst konnte sie ihrer Wege gehen. Und wenn aus einem Haus abseits der Straße ein Licht leuchtete und das Geschrei eines von Koliken geplagten Babys ihre Aufmerksamkeit erregte, so konnte sie zu dem Haus hingehen und leise nach der Frau rufen, die drinnen das Kind zu beruhigen suchte. Zu zweit mochten sie dann des Babys Bauch massieren, es abwechselnd schaukeln oder versuchen, ihm ein wenig Sprudel einzuflößen. Sobald das Kind ruhiger geworden war, saßen sie vielleicht noch einen Augenblick beisammen und tauschten den neuesten Klatsch aus, wobei sie ihr Kichern unterdrückten, um niemanden aufzuwecken.
Danach konnte sich die Frau entscheiden, ob sie, erholt und zum Schlafen bereit, in ihr Haus zurückkehren wollte oder ob sie lieber immer weiter die Straße hinunterging, an weiteren Häusern vorbei, an den drei Kirchen vorbei, an dem Pferch vorbei, in dem das Schlachtvieh gemästet wurde. Immer weiter, über die Grenzen des Dorfes hinaus, denn nichts da draußen sah sie als mögliches Opfer an.
An den Enden des Flurs befinden sich zwei Badezimmer. Jeder der beiden Männer betritt eines davon, und keiner von ihnen beißt dabei die Zähne zusammen, denn sie glauben, auf alles gefasst zu sein. In einem Badezimmer, dem größeren, sind die Wasserhähne viel zu klein und schäbig für das mächtige Waschbecken. Die Badewanne ruht auf den Rücken von vier Meerjungfrauen; ihre Schwanzflossen sind weit gespreizt, um der Wanne Halt zu geben, und ihre Brüste bilden Bogen, die die Last verteilen. Die Bodenfliesen darunter sind flaschengrün. Eine Schachtel mit Binden steht auf dem Spülkasten der Toilette, daneben ein Eimer mit besudelten Abfällen. Klopapier ist keins zu sehen. Nur einer der Spiegel ist nicht mit kalkgrauer Farbe übermalt worden, und von diesem hält der Mann sich abgewandt. Er will sich nicht selbst dabei sehen, wie er Frauen und ihren Ausscheidungen nachspürt. Erleichtert verlässt er rückwärts den Raum und schließt die Tür. Erleichtert lässt er seine Pistole sinken.
Im Erdgeschoss vergessen zwei Männer, ein Vater und sein Sohn, zu lächeln, obwohl ihnen, als sie die Kapelle betreten, erst nach einem Lächeln zumute ist. Denn es ist wahr: Götzenbilder wurden hier verehrt. Winzige Männer und Frauen in weißen Kleidern mit Umhängen in Gold und Blau stehen auf kleinen Brettern, die in Wandnischen eingelassen sind. Sie halten kleine Kinder oder gestikulieren, und ihre ausdruckslosen Gesichter spiegeln Unschuld vor. Zu ihren Füßen haben unverkennbar Kerzen gebrannt, und genau wie Reverend Pulliam gesagt hat, wurden ihnen anscheinend auch Lebensmittel geopfert, denn zu beiden Seiten der Tür stehen kleine Schalen bereit. Wenn das alles vorbei war, würden sie Reverend Pulliam sagen, dass er ganz richtig gelegen hatte, und Reverend Misner würden sie ins Gesicht lachen.
Es gab unversöhnliche Gegensätze zwischen den Kirchengemeinden des Dorfes, aber in allen dreien fand sich eine solide Mehrheit, die diese Aktion für nötig hielt. Tut, was ihr müsst. Weder mit diesem Kloster noch mit den Frauen darin konnte es so weitergehen.
Ein Jammer. Früher einmal war das Kloster ein guter, wenn auch ferner Nachbar gewesen, umgeben von Maisfeldern, Büffelgras und Klee, erreichbar nur über einen unbefestigten Feldweg, der von der Straße aus kaum zu erkennen war. Das in ein Frauenkloster verwandelte Herrenhaus war schon lange vor der Siedlung da gewesen, und die letzten Arapahomädchen hatten die Internatsschule schon verlassen, als die fünfzehn Familien eintrafen. Das war vor fünfundzwanzig Jahren gewesen, als noch alle ihre Träume größer waren als die Menschen, die sie träumten. Eine Straße, gerade wie ein Prägestock, wurde durch die Dorfmitte gezogen und an einer Seite mit einem gepflasterten Gehweg versehen. Sieben Familien hatten mehr als zweihundertfünfzig Hektar Grund, drei besaßen fast fünfhundert. Bald bekam die Straße einen richtigen Namen, und ein Mann namens Ossie organisierte zur Feier des Tages ein Pferderennen. Aus ihren Armeezelten, aus halbfertigen Häusern, von frisch gerodeten Feldern kamen die Menschen und brachten mit, was sie gerade hatten. Was lange verstaut gewesen war, wurde hervorgekramt und dazugepackt, was frisch zur Hand kam: Gitarren und späte Melonen, Haselnüsse, Rhabarberkuchen und eine Mundharmonika, ein Waschbrett und Lammbraten und Reis mit Peperoni, Lil Green, «In the Dark», Louis Jordan und seine Tympany Five, selbst gebrautes Bier und Murmeltierfleisch, gegart im eigenen Saft. Die Frauen schlangen sich bunte Tücher um den Kopf; die Kinder bastelten sich Hüte aus Mohnblumen und Schlinggewächsen. Ossie schickte zwei Pferde ins Rennen, einen Zwei- und einen Vierjährigen, beide schnell und so hübsch wie junge Bräute. Die übrigen Pferde waren nur Statisten: der Schecke von Ace, das alte Fliegengewicht von Miss Esther, alle vier Ackergäule und die Stute von Nathan und dazu ein halbwildes Pony, das am Flussufer graste und keinen Besitzer zu haben schien.
Die Reiter debattierten so lange, ob mit oder ohne Sattel geritten werden sollte, dass Mütter von Säuglingen sie schließlich aufforderten, entweder auf der Stelle aufzusitzen oder mit ihnen zu tauschen. Männer redeten sich über Vorgaben die Köpfe heiß und platzierten freigebig ihre Vierteldollarwetten. Als die Pistole losging, rannten nur drei Pferde in die vorgesehene Richtung. Der Rest schlug sich seitwärts in die Büsche oder machte sich über die Bauholzstapel vor den unfertigen Häusern davon. Die Frauen standen auf der Wiese und kreischten, als das Rennen endlich in Gang kam, und ihre Kinder tanzten quiekend im hohen Gras, das ihnen bis an die Schultern reichte. Das Pony ging zuerst durchs Ziel, aber weil es nach einer Viertelmeile seinen Reiter abgeworfen hatte, wurde Nathans Fuchsstute zur Siegerin erklärt. Das kleine Mädchen mit den meisten Mohnblumen im Haar durfte das Siegesband überreichen, an dem Ossies Verwundetenabzeichen baumelte. Der siegreiche Reiter war sieben Jahre alt damals, und er strahlte, als hätte er das Kentucky Derby gewonnen. Und heute steckte er irgendwo im Keller eines Klosters und hielt Ausschau nach schlimmen Frauen, die offensichtlich schon damals, als sie, eine nach der anderen, hier ankamen, keine echten Nonnen gewesen waren und dies auch gar nicht vorgetäuscht hatten. Irgendeinem anderen Kult gehörten sie an, so glaubten alle, ohne etwas Näheres zu wissen. Aber es war auch nicht wichtig, etwas zu wissen, denn jede dieser Frauen hatte immer noch, wie einst die alte Mutter Oberin und deren Bedienstete, Lebensmittel verkauft, eine Soße fürs Barbecue, gutes Brot und die schärfsten Pfefferschoten der Welt. Für gutes Geld bekam man eine purpurdunkle Traube schwarzer Pfefferschoten oder auch ein daraus zubereitetes Relish, und was die schiere Schärfe anbelangte, stand das eine dem anderen nicht nach. Das Relish hielt jahrelang, wenn man gut darauf aufpasste, und obwohl viele Käuferinnen und Käufer versuchten, die Samen selbst anzupflanzen, gediehen diese Pfefferschoten nirgendwo sonst als im Klostergarten.
Komische Nachbarn, sagten die meisten, aber doch harmlos. Mehr als harmlos, manchmal waren sie sogar hilfreich. Sie nahmen Verirrte bei sich auf oder Leute, die einfach nur Ruhe suchten. In frühen Berichten war von Freundlichkeit die Rede und von sehr gutem Essen. Aber jetzt wusste jeder, dass das alles eine Lüge gewesen war, eine Fassade, eine sorgsam inszenierte Ablenkung von dem, was tatsächlich vorging. Als der Ernstfall offensichtlich war, trafen sich Abgesandte der drei Kirchengemeinden beim Ofen, weil sie sich nicht einig werden konnten, in welcher Kirche, wenn überhaupt in einer, man sich versammeln sollte, um darüber zu beraten, was nun zu tun war, da die Frauen alle Warnungen in den Wind geschlagen hatten.
Es war ein geheimes Treffen, aber die Gerüchte liefen schon seit mehr als einem Jahr um. Gräuel, von denen immer häufiger gemunkelt worden war, nahmen die Gestalt von Tatsachen an. Eine Mutter wurde von ihrer kalt blickenden Tochter die Treppe hinabgestoßen. Vier missgebildete Kinder kamen in einer einzigen Familie zur Welt. Töchter weigerten sich, das Bett zu verlassen. Bräute verschwanden in den Flitterwochen. Zwei Brüder schossen sich am Neujahrstag gegenseitig nieder. Fahrten zum Arzt für Geschlechtskrankheiten in Demby waren gang und gäbe. Und was sich in diesen Tagen beim Ofen abspielte, war nicht zu glauben. So mussten die neun Männer, die sich dort versammeln wollten, erst all die anderen mit ihren Schrotflinten verscheuchen, ehe sie sich in den Lichtkegeln ihrer Taschenlampen hinsetzen und die Sache in die Hand nehmen konnten. Die Beweise, die sie seit der schrecklichen Entdeckung im Frühjahr zusammengetragen hatten, ließen sich nicht länger leugnen: Die eine Gemeinsamkeit, die alle diese Katastrophen miteinander verband, war im Kloster zu finden. Und im Kloster waren diese Frauen.
Der Vater geht durch den Mittelgang und späht in die Bankreihen rechts und links. Er streut einen Lichtfächer aus seiner Black-&-Decker-Lampe unter alle Sitze. Die Knieschemel sind hochgeklappt. Beim Altar hält er inne. Der fahle gelbe Schimmer eines Fensters schwebt über ihm im Halbdunkel. Alles hier sieht verschmutzt aus. Er geht zu einem Tablett mit kleinen Gläsern, das an der Wand befestigt ist, um nachzusehen, ob Überbleibsel von Speiseopfern zu finden sind. Abgesehen von Ruß und Spinnweben sind die Gläser leer. Vielleicht sind sie nicht für Nahrungsmittel, sondern für Münzen. Oder für Abfall? Im dreckigsten liegt ein Kaugummipapier. Doublemint.
Er schüttelt den Kopf und geht zurück zu seinem Sohn am Altar. Der Sohn deutet auf etwas. Der Vater leuchtet an die Wand unter dem gelben Fenster, in dem sich, gerade zu erahnen, die Sonne ankündigt. Der Umriss eines mächtigen Kreuzes wird sichtbar. Blank wie frische Farbe ist die Stelle, an der einmal ein Jesus hing.
Die Brüder, die sich den Keller vornehmen, waren einmal identisch. Obwohl sie Zwillinge sind, sehen sie einander heute weniger ähnlich als ihre Ehefrauen. Der eine ist glatt und beweglich und raucht Te-Amo-Zigarren. Der andere ist zäher, gröber, aber er verbirgt sein Gesicht, wenn er betet. Beide jedoch haben große, unschuldige Augen, und beide sind jetzt so entschlossen, da sie vor der abgesperrten Tür stehen, wie sie es 1942 waren, als sie sich zur Armee meldeten. Damals suchten sie einen Ausweg – raus aus einem Leben, in dem alles geschuldet und nichts ihr Eigentum war. Heute wollen sie rein. Damals, in den Vierzigern, hatten sie nichts zu verlieren. Heute erfordert alles ihren Schutz. Von Anfang an wussten sie, als sie ihr Dorf gründeten, dass Isolation noch nicht Sicherheit garantierte. Starke und entschiedene Männer wurden gebraucht, wenn verirrte oder ziellose Fremde nicht einfach nur durchfuhren, ohne mehr als einen Seitenblick für das verschlafene Nest übrig zu haben, in dem es im Abstand einer Meile drei Kirchen gab, aber nichts, was einem Reisenden nützlich sein konnte: keinen Diner, keine Polizei, keine Tankstelle, keine Telefonzelle, kein Kino, kein Krankenhaus. Manchmal, wenn die Fremden jung und besoffen oder alt und nüchtern waren, mochten sie drei oder vier Schwarze Mädchen erspähen, die am Straßenrand dahintrödelten. Die ein paar Meter gingen, dann wieder stehen blieben, wenn ihre Unterhaltung es erforderte; und weiterhüpften und wieder Pause machten, um zu lachen oder um einander spielerisch in den Arm zu boxen. Die Fremden mochten beginnen, sich für die Mädchen zu interessieren. Drei Autos, sagen wir ein 53er Bel Air, grün mit cremefarbenem Interieur, Kennzeichen 085 B, Sechszylindermotor, doppelte Chromleiste an der Heckflosse, Powerglide-Automatikgetriebe mit zwei Fahrstufen; und, sagen wir, ein 49er Dodge Wayfarer, schwarz, mit einem Sprung in der Heckscheibe, Radverkleidungen, Servolenkung und Schachbrettgrill; und ein 53er Oldsmobile mit Kennzeichen aus Arkansas. Die Fahrer nehmen Gas weg, recken die Köpfe aus den Seitenfenstern und johlen. Ihre Augen werden schmal vor böser Absicht, während sie um die Mädchen herumfahren, ihre Wagen wenden, zurücksetzen, vor den Häusern Grassamen aus dem Boden mahlen und vor Ace’ Lebensmittelladen Katzen aufscheuchen. Sie kreisen die Mädchen ein. Deren Blicke starr werden, als sie zurückweichen und dabei ineinanderlaufen. Dann kommen, einer nach dem anderen, die Leute aus ihren Häusern, aus Hinterhöfen, vom Baugerüst der Bank, aus der Viehfutterhandlung. Einer der Beifahrer hat seine Hose aufgeknöpft und stellt sich im Autofenster zur Schau, um den Mädchen Angst einzujagen. Die kleinen Herzen der Mädchen bleiben stehen vor Schreck, und weil sie ihre Augen nicht schnell genug schließen können, wenden sie blitzschnell die Köpfe ab. Aber die Männer, die zu Hilfe kommen, sehen genau hin, sie sehen die Sehnsucht in dieser militantesten aller Gesten, und sie lächeln. Lächeln gequält und widerwillig, denn sie wissen, dass dieser Mann spätestens von diesem Augenblick an, und bis zur Stunde seines Todes, allen Schwarzen Menschen so viel Schaden zufügen wird, wie er nur kann.
Immer mehr Männer kommen aus den Häusern. Ihre Schusswaffen zielen auf nichts Bestimmtes, sie lassen sie locker gegen ihre Oberschenkel baumeln. Zwanzig Männer sind es, jetzt fünfundzwanzig. Sie kreisen die Autos ein, die die Mädchen umkreisen. Neunzig Meilen entfernt vom nächsten Telefon mit Notruf und neunzig Meilen von der nächsten Polizeimarke. Wäre es ein trockener Tag gewesen, so hätten die Staubfahnen hinter den Reifen sie alle schmutzig gemacht. So aber wurden nur ein paar Kiesel aus den Spuren gewirbelt, die sie hinterließen.
Die Zwillinge haben beide ein fabelhaftes Gedächtnis. Gemeinsam erinnern sie sich an jede Einzelheit von allem, was jemals passiert ist – egal, ob sie selbst dabei waren oder nicht. An die genaue Temperatur an jenem Tag, als die Autos die Mädchen einkreisten, und an die Ernteerträge jeder einzelnen Farm im County. Und nie haben sie die Botschaft, das Wesentliche einer Story vergessen, vor allem nicht bei jener Story, die alles beherrscht und die ihnen von ihrem Großvater erzählt wurde – dem Mann, der die Worte in das schwarze Maul des Ofens gelegt hat. Sie erklärt, warum weder die Gründer von Haven noch deren Nachfahren andere neben sich dulden konnten. Auf ihrer Reise, die sie aus dem Staat Mississippi und aus zwei Pfarrgemeinden in Louisiana nach Oklahoma führte, waren die 158 ehemaligen Versklavten auf keinem Fußbreit Boden zwischen Yazoo und Fort Smith willkommen. Wohlhabende Choctaw und verarmte Weiße wiesen sie ab, Hofhunde verjagten sie, Huren und Hurenbälger in Camps riefen ihnen Schmähungen nach, aber nichts von all dem konnte sie auf die aggressive Ablehnung vorbereiten, mit der sie sich in den Schwarzen Siedlungen konfrontiert sahen, die bereits im Aufbau waren. Die Schlagzeile eines Artikels im Herald, «Kommt gewappnet oder gar nicht», konnte doch wohl nicht ihnen gelten? Gewitzt, stark und willens, ihr eigenes Land zu bestellen, fühlten sie sich mehr als nur gewappnet – sie hatten eine Bestimmung. Es zog ihnen den Boden unter den Füßen weg, als sie erfuhren, dass sie nicht genug Geld mitbrachten, um den Bedingungen der «autarken» Schwarzen Gemeinden zu genügen. Sie waren, kurz gesagt, zu arm, sie sahen zu abgerissen aus, um diese Städte, die um Schwarze Zuwanderer warben, auch nur betreten, geschweige denn dort leben zu dürfen. Diese demütigende Abfuhr, die sie von den Glücklichen erfuhren, veränderte die Temperatur ihres Blutes zweimal. Erst kochten sie vor Wut, als sie sich als Menschen beschrieben fanden, «denen Kneipen und Glücksspiele mehr bedeuten als ihr Heim, die Kirche und die Schule». Dann erinnerten sie sich an ihre außergewöhnliche Vergangenheit und wurden eiskalt. Was hitzige Entschlossenheit gewesen war, wurde zu einer kaltblütigen Obsession. «Sie kennen uns nicht, sie wissen nichts von uns», sagte einer von ihnen. «Wir sind frei wie sie, wir waren Sklaven wie sie. Wozu diesen Unterschied machen?»
Abgewiesen und vertrieben, änderten sie ihre Route und zogen westlich der ausgewiesenen Siedlungsgebiete und südlich von Logan County über den Canadian River in das Gebiet der Arapahos – sturer und stolzer nach jeder Niederlage, deren Einzelheiten sich dem fabelhaften Gedächtnis der Zwillinge einprägten: schmucklose Geschichten, wieder und wieder nacherzählt in düsteren Scheunen, im Licht des Sonnenuntergangs am Ofen, im Licht des Sonntagnachmittags bei den Gebetsversammlungen. Von den Sätteln der vier Banditen mit schwarzer Haut, die ihnen getrocknetes Büffelfleisch zu essen gaben, ehe sie ihnen die Gewehre raubten. Von der Lautlosigkeit der Windhose, die sich durch und um ihr Lager schlängelte. Den schlafenden Kindern, die, als sie erwachten, durch die Luft wirbelten. Dem schimmernden Fell der Pferde, auf denen die wachsamen Choctaws saßen. Zur Abendessenszeit, wenn es zu dunkel war für Arbeiten, die mehr als das Licht des Lagerfeuers brauchten, rezitierten die Alten Väter die Saga jener Reise: von Zeichen, durch die Gott ihnen den Weg gewiesen hatte – zu Wasserplätzen; zu den Creek, bei denen sie ihre Arbeitskraft für Planwagen, Pferde und Weiderecht eintauschen konnten; und weit weg von elenden Prärienestern, die sich über fünfzig Meilen erstreckten, bevölkert von Präriehunden und satanischen Versuchungen wie lasterhaften Weibern ohne Habe und Gerüchten von Goldfunden im Fluss.
Für die Zwillinge war es diese Entdeckung – wie schmal der Pfad der Tugend sein konnte –, die ihrem Großvater die Worte für die Frontplatte des Ofens eingab. Nägel waren so kostbar, dass sie ihre Möbel mit Holzdübeln zusammenbauten, aber er opferte seinen ganzen Schatz an geraden und verbogenen Nägeln, um etwas zu sagen, das wichtig war und bleiben sollte.
Sobald die Buchstaben an Ort und Stelle waren, aber noch ehe irgendjemand Zeit gefunden hatte, über die Worte nachzudenken, die sie bildeten, wurde gleich neben dem Ofen, der auf seine Inbetriebnahme wartete, ein freistehendes Dach errichtet. Auf Kisten und improvisierten Bänken versammelte sich die Bevölkerung von Haven, um zu reden, um nicht allein zu sein und um es sich bei frisch gebratenem Wild gutgehen zu lassen. Später, als die Büffelgraswiesen einem ansehnlichen Dorf Platz gemacht hatten, in dem es eine Hauptstraße und Holzhäuser, eine Kirche, eine Schule und einen Laden gab, trafen sich die Bewohner noch immer am Ofen. Sie spießten Perlhühner und ganze Rehe auf den Grill, sie wendeten die Rippenstücke und rieben eine Extraportion Salz in die Seiten des auskühlenden Kalbsbratens. Es war die Zeit des langsamen Garens, als die Flammen so klein gehalten wurden, dass ein zwanzigpfündiger Truthahn eine ganze Nacht brauchte und ein halber Ochse zwei Tage, bis er durchgebraten war. Wann immer in den Häusern geschlachtet wurde oder wenn die Lust auf frisches Wildbret aufkam, brachten die Menschen ihre Strecke zum Ofen und blieben manchmal dort hängen, um sich mit der Morgan-Familie über die richtigen Gewürze zu streiten und auch darüber, wie sich am besten feststellen ließ, wann das Fleisch «durch» war. Sie blieben hängen, um den neuesten Klatsch auszutauschen, um zu jammern, um lauthals zu lachen oder um im Schatten des Daches einen Kaffee zu schlürfen. Und jedes Kind in Rufweite musste damit rechnen, herzitiert zu werden, um Fliegen wegzuwedeln, Holz zu hacken, den Arbeitstisch zu säubern oder mit dem Stampfblock die Erde festzuklopfen.
1910 gab es schon zwei Kirchen in Haven, dazu die All-Citizens-Bank, vier Klassenzimmer im Schulhaus, fünf Geschäfte für Textilien, Lebensmittel und Tierfutter – aber auf den Wegen zum und vom Ofen war weitaus mehr los als an all den anderen Orten. Keine Familie brauchte mehr als die einfachste Kochstelle, solange das Feuer im Ofen brannte, und es brannte ständig. Selbst noch 1934, als es mit der Siedlung bergab ging, als es so klar war wie die Sonne, dass alles Gerede von elektrischem Strom bloßes Gerede bleiben würde, dass Gasleitungen und Abwasserkanäle weiterhin nur in Tulsa zu bestaunen wären, brannte das Feuer im Ofen weiter. Bis zur großen Dürre vermisste niemand eine Wasserleitung, weil der Brunnen tief genug war. Als kleine Jungen hatten die Zwillinge sich von den Ästen der Pappel baumeln lassen, die sich über ihn neigten, um das Spiegelbild ihrer Füße im klaren Wasser zu bewundern. Oft und oft hatten sie von den blauen Kleidern und den Hüten erzählen gehört, die die Männer den Frauen vom Erlös der ersten Ernte oder der ersten Schafschur gekauft hatten. Und diese Aufregung, als das Klavier aus Saint Louis geliefert wurde, kaum dass der Boden der Zionskirche gelegt war. Sie stellten sich ihre Mutter als Zehnjährige vor, wie sie sich zusammen mit anderen jungen Mädchen schweigend um das Klavier drängte, verstohlen über die Tasten strich, einen Ton anschlug, ehe die Diakonin ihre Finger mit einem Klaps verscheuchte. Ihre klaren Sopranstimmen bei der Probe, wie sie «Er wird dich behüten» sangen – was Er offenkundig auch tat, bis Er es sich eines Tages anders überlegte.
Die Zwillinge waren 1924 geboren und hörten zwanzig Jahre lang, wie die vorangegangenen vierzig Jahre gewesen waren. Sie hörten genau zu, sie malten sich jede Einzelheit aus, und sie vergaßen nichts, denn jede Einzelheit war ein freudiger Schock für sie, erotisch wie ein Traum, erregend und von größerer Bedeutung, als es selbst der Krieg gewesen war, in dem sie gekämpft hatten.
1949, als junge, frisch verheiratete Männer, wussten sie, was die Stunde geschlagen hatte. Schon lange vor dem Krieg hatten die Menschen aus Haven begonnen, ihre Siedlung zu verlassen, und wer jetzt noch nicht dabei war, seine Sachen zu packen, hatte es zumindest vor. Die Zwillinge sahen eine schwindende Nachkriegszukunft vor sich und fanden es nicht schwer, ihre Kumpels davon zu überzeugen, dass es zu wiederholen galt, was die Alten Väter ihnen 1890 vorgemacht hatten. Zehn Generationen hatten gewusst, was dort draußen auf sie wartete: Raum, der einst frei gewesen war und einladend, wurde rechtsfrei und bedrohlich, wurde zu einer Leere, in der das Böse, zufällig oder planvoll, zuschlug, wo und wann es wollte – dort hinter dem freistehenden Baum vielleicht oder hinter der Tür jedes beliebigen Hauses, wie bescheiden oder prachtvoll es auch war. Dort draußen, wo deine Kinder Zielscheibe des Spotts und deine Frauen Freiwild waren und du selbst ausgelöscht werden konntest; wo Kirchengemeinden bewaffnet zum Gottesdienst kamen und jede Satteltasche einen Strick enthielt. Dort draußen, wo jedes Grüppchen weißer Männer eine Bürgerwehr sein konnte, war einer, der allein war, so gut wie tot. Aber die letzten drei Generationen hatten sie gelehrt und immer wieder neu gelehrt, wie man eine Siedlung schützte. Und so trugen die ehemaligen Soldaten, die so gut wie die ehemaligen Sklaven wussten, was zuerst kam, den Ofen ab und verluden seine Teile auf zwei Pritschenwagen, ehe sie noch damit begannen, ihre Betten abzubauen. Noch vor dem ersten Licht an einem Tag Mitte August kehrten fünfzehn Familien Haven den Rücken – und sie brachen nicht nach Muskogee oder nach Kalifornien auf, wie andere vor ihnen, oder nach Saint Louis oder Houston oder Langston oder Chicago, sondern zogen tiefer nach Oklahoma hinein, so weit weg, wie sie nur konnten, von dem Staub, der den von ihren Großvätern begründeten Ort bedeckte.
«Wie weit?», fragten die Kinder auf den Rücksitzen der Autos. «Wie lange noch?»
«Nicht mehr lange», beschwichtigten die Eltern. Die Stunden vergingen, und ihre Rede blieb immer gleich: «Ist nicht mehr weit. Bald sind wir da.» Als sie den Beaver Creek durch die Mündung eines Staates fließen sahen, der wie eine Pistole geformt war, als sein Wasser all die Hektar Grasland durchströmte, die sie von den zusammengelegten Abschiedsgeldern der Armee gekauft hatten (und billig dazu, nach den Wirbelstürmen von 1949), da war es endlich gut und recht und keinen Augenblick zu früh.
Hinter sich zurückgelassen hatten sie einen Ort, dessen einst so stolze Straßen von Unkraut überwuchert waren, bewacht von nur noch achtzehn Unbeirrbaren, die sich fragten, wie sie wohl zum Postamt kämen, wo vielleicht ein Brief von längst fortgezogenen Enkelkindern auf sie wartete. Wo der Ofen gestanden hatte, dösten kleine grüne Schlangen in der Sonne. Wer hätte sich vorstellen können, dass fünfundzwanzig Jahre später, in einem brandneuen Dorf, ein Kloster die Schlangen, die Depression, den Steuereintreiber und die Eisenbahn in den Schatten stellen würde, was schiere Zerstörungswut betraf?
Jetzt zerschmettert der eine der Brüder, der immer den Anführer macht, mit dem Kolben seines Gewehrs die Kellertür. Der andere und ihr Neffe warten ein paar Schritte hinter ihm. Dann steigen alle drei die Stufen hinunter, wachsam und wissbegierig. Sie werden nicht enttäuscht. Was sie sehen, ist des Teufels Schlafzimmer, sein Badezimmer und sein dreckiger Laufstall.
Der Neffe wusste immer, dass seine Mutter ihre ganze Kraft aufgeboten hatte, um mitzuhalten. Sie hatte es geschafft, dass er das siegreiche Pferd reiten konnte, aber weiter reichten ihre Energien nicht. Nicht einmal so weit, dass sie an den Debatten Anteil genommen hätte, die über die Frage geführt wurden, welchen Namen dieser Ort bekommen sollte, wo sie mit ihren Brüdern und ihrem kleinen Sohn gelandet war. Drei Jahre lang war New Haven der aussichtsreichste Vorschlag gewesen, auch wenn sich einige für andere Namen starkmachten – für Namen, so sagten sie, die nicht mit dem Makel jüngsten oder wiederholten Scheiterns behaftet seien. Veteranen, die im Pazifik gekämpft hatten, schlugen Guam vor, andere Inchon. Wer den europäischen Kriegsschauplatz kennengelernt hatte, brachte Namen ins Gespräch, die auszusprechen nur den Kindern Freude machte. Die Frauen hatten keine klare Meinung, bis die Mutter des Neffen starb. Ihre Beerdigung – die erste im Dorf – machte dem Hin und Her ein Ende, machte es überflüssig. Sie benannten den Ort nach einer der ihren, und keiner von den Männern erhob seine Stimme dagegen. Na gut. So sei es. Ruby. Ruby zum Zweiten.
Das gefiel seinen Onkeln, die so ihre Schwester betrauern und den Freund und Schwager ehren konnten, der nicht aus dem Krieg heimgekehrt war. Doch der Neffe, der Ossies Verwundetenabzeichen gewonnen und von seinem Vater die Erkennungsmarke geerbt hatte, musste bis ans Ende seiner Tage den Namen der Mutter auf Ortstafeln und Briefumschlägen lesen, und all diese traurigen Denkmale wurden größer als er selbst. Das Abzeichen, die Marke, die Zustelladresse warfen ihren Schatten über ihn. Die Frauen, die seine Mutter gekannt und gepflegt hatten, verhätschelten ihn als Rubys Sohn. Die Männer, die gemeinsam mit seinem Vater bei der Armee gewesen waren, bevorzugten ihn als den Sohn von Rubys Mann. Seine Onkel betrachteten ihn als einen der ihren. Als beim Ofen der Entschluss gefasst wurde, war er dabei. Aber vor zwei Stunden, als sie das letzte Stück rotes Fleisch verschlungen hatten, klopfte ihm ein Onkel einfach auf die Schulter und sagte: «Kaffee haben wir im Wagen. Hol deine Flinte.» Was er auch tat, aber das kleine Palmwedelkreuz nahm er ebenfalls mit.
Es war vier Uhr früh, als sie aufbrachen. Es war gegen fünf, als sie ihr Ziel erreichten, denn um sich in der Dunkelheit nicht durch Scheinwerfer oder Motorengeräusch zu verraten, gingen sie die letzten Meilen zu Fuß. Sie stellten die Autos in einem Zwergeichendickicht ab, denn ungeschützt war der schwächste Lichtschein in dieser Landschaft meilenweit zu sehen. Wo die Spitzen von Fördertürmen über fünfzig Meilen unsichtbar blieben, wurde die Kerze auf dem